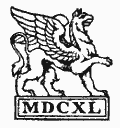
The Project Gutenberg EBook of Die große Stille, by Heinrich Lilienfein This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Die große Stille Author: Heinrich Lilienfein Release Date: October 15, 2016 [EBook #53283] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE GROßE STILLE *** Produced by Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Die große Stille
Roman
von
Heinrich Lilienfein.
9.-11. Auflage
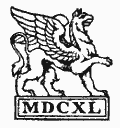
Stuttgart und Berlin 1919
J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
Alle Rechte,
insbesondere das Übersetzungsrecht vorbehalten
Für die Vereinigten Staaten von Amerika:
Copyright, 1912, by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
Stuttgart und Berlin
Dem Andenken meiner Hanna
Da klingelte es schon wieder.
Käthe hatte ihren Posten auf der obersten Treppenstufe gleich gar nicht verlassen. Elli stürmte mit lachender Neugier aus der Stube und bog sich so weit über das Geländer, daß die ältere, bedächtigere Schwester sie leise schalt und zupfte, einmal, weil es leichtsinnig war und man gesehen werden konnte, dann aber, weil sie selbst, obwohl die größere von beiden, so nicht auf ihre Kosten kam. Und der neue Ankömmling für Papas Sprechstunde mußte doch ganz genau gemustert werden. Das war so Brauch, so oft ein neues Semester begann und die Hörer einer nach dem andern anrückten, um sich den Namen des Geheimrats ins Kollegbuch schreiben zu lassen.
Marga war allein in dem gemütlichen Zimmer zurückgeblieben, das ihr und Ellis Mädchenreich war. Aber auch in ihren Fingern ruhte für einen Augenblick die feine Knüpfarbeit. Mit vorgebeugtem Kopf lauschte sie hinaus nach dem Treppenhaus. In der erwartungsvollen Stille war jedes Geräusch zu hören.
Im Erdgeschoß wurden Schritte laut. Es war Therese, die mit Brummen an die Glastür schlürfte und öffnete. Elli polterte in der Spannung einige Stufen hinunter. Ein zürnendes „Bst!” von Käthe wies sie zurecht.
Über Margas Gesicht huschte ein Lächeln. Ihre Blicke suchten die Tür. Sie ließ sich von der Spannung anstecken, als könnten die lichtlosen blauen Augen das unerbittliche Dunkel durchdringen, das sie inmitten der sonnigen Stube einhüllte.
Jetzt mußte der Ankömmling sichtbar sein.
Mit einem unverhohlenen „Oh!” der Enttäuschung fuhr Elli zurück und glitt von der Treppe ins Zimmer. „Nu mach' ich nicht mehr mit!” ließ sie sich halb traurig, halb zornig vernehmen, während sie sich in dem roten Plüschsofa, Margas Korbsessel gegenüber, schmollend zurückwarf.
„Wer war's denn?” forschte die Blinde.
„Ach was! Nicht der Mühe wert! Einfach lächerlich!” lautete die unklare Antwort, die ein tiefer Seufzer begleitete.
„Trabner, der alte Oberlehrer,” erklärte Käthe, die jetzt, gleichfalls enttäuscht, zurückkam.
„Ach der!” nickte Marga und nahm die auf den Knien liegende Handarbeit wieder auf.
„Der Flanellstorch!” ergänzte Elli, die ihren Unwillen an irgendwem auslassen mußte. „Mit der Glatze und der Stahlbrille, den Gummimanschetten und dem famosen Trikot-Stehumlegekragen. Ich glaube, er hört Papa seit fünfzig Jahren, der — der —”
„Ein sehr netter, vernünftiger Mensch,” meinte Käthe strafend. „Papa schätzt ihn sehr.” Als Älteste hielt sie es stets für ihre Pflicht, gerecht zu sein und Ellis vorlauten Urteilen die Spitze abzubrechen.
Aber Elli war heute gar nicht in der Laune, sich schulmeistern zu lassen. „Sieh mal an!” Sie bog ihren lichtblonden[S. 9] Lockenkopf zur Seite. „Du schwärmst wohl gar für den guten Flanellstorch?”
„Das ist ehrlich dumm, Kleinchen! Ich kann nur nicht leiden, daß man jemand in Bausch und Bogen ablehnt. Das weißt du.” Käthe setzte sich an den kleinen Schreibtisch am Fenster. Sie wollte fortfahren, in ihr Tagebuch zu schreiben.
„Vergiß das ja nicht gleich mit aufzuschreiben,” neckte Elli weiter. „Unter ‚Gedankensplitter‛.”
Käthe drehte sich empört nach der Spötterin um. „Das verbitt' ich mir, hörst du?” Ihre dunklen Augen zürnten, und sie strich sich die Haare aus der Stirn, zurück nach den schwarzen, wohlgeordneten Flechten. „Ich kann nicht dafür, daß dein Herr Wilkens ausbleibt,” setzte sie mit spitzem Vorwurf hinzu.
„Oho!” brauste Elli auf. „Ich kümmere mich wohl um Wilkens? Nicht so viel! Nicht so viel!” Die Röte, die ihr in die Wangen schoß, ärgerte sie noch mehr. „Nicht so viel!” erklärte sie zum drittenmal mit vor Erregung zitternder Stimme.
„Aber Kinder! Ihr seid ja garstig miteinander,” mahnte jetzt Margas weiche, ruhige Stimme. Ihre Hand tastete über den Tisch weg nach Elli, als wollte sie ihren Liebling beruhigen. „Er kann ja noch kommen,” flüsterte sie der jüngeren Schwester zu.
Elli entzog sich ihrer Liebkosung. Trotz und Schmerz kämpften in ihren hübschen Zügen und preßten ihr Tränen in die Augen. Sie war in dem seligen siebzehnjährigen Alter, wo Freude und Leid durcheinanderjagen wie Regen und Sonne an einem Apriltag. Sie kam sich unsagbar verkannt vor, nicht weil sie sich um den besagten Wilkens[S. 10] „nicht so viel” kümmerte, sondern gerade weil sie auf ihn gewartet hatte. Ihr kleines Geheimnis, über das sie mit den Schwestern sonst ganz gern einmal tuschelte, war nach ihrem Empfinden von Käthe furchtbar verletzt und entweiht.
Marga erriet diese Stimmung. Sie stand auf, legte die Arbeit auf den Tisch und setzte sich neben Elli aufs Sofa. Sie nahm sie in den Arm. Während Käthe mit großen steilen Schriftzügen ein neues Blatt des Tagebuchs füllte, redete sie in ihrer verständigen, zarten Weise halblaut dem Kleinchen zu, das nach einigem Widerstreben nicht nur den Trost in sein wundes Herz aufnahm, sondern auch dieses Herz auszuschütten begann.
Das Schnarren von Käthes Feder, das Flüstern der beiden auf dem Sofa waren die einzigen Geräusche, die das Zimmer, ja das ganze in nachmittägliche Stille versunkene Haus belebten. Kein Ton drang vom unteren Stockwerk, wo Geheimrat Richthoff arbeitete, herauf in die Mansardenstube. Der Flanellstorch mußte längst wieder seines Wegs gezogen sein, ohne daß sein Gehen auch nur ein winziges Teilchen des Interesses gefunden hätte, das seine Ankunft wachgerufen. Die kräftige, leuchtende Maisonne kam, zu mattem Gold gedämpft, durch die zugezogenen gelben Vorhänge an den Fenstern und tauchte die altmodischen Möbel, die erinnerungsreichen, behaglichen Kleinigkeiten in den Ecken und an den Wänden in ein wohliges Halbdunkel. Nichts schien mehr den dämmerigen Frieden dieser Ruhestunde stören zu wollen, die die Schwestern wie gewöhnlich zwischen Mittag und der Kaffeestunde da oben unter dem Dach verträumten und verplauderten.
[S. 11] Der Zeiger rückte auf drei Uhr los. Noch zwei Minuten, und der heisere Kuckuck mußte den Kopf dreimal zur Tür herausstrecken und sie wieder energisch hinter sich zuklappen. Damit war dann Papas Sprechstunde und alle Spannung für heute zu Ende.
Ein neues schrilles Klingeln an der Haustür kam dem Kuckuck zuvor. Marga und Elli hielten in ihrem Flüstern ein. Käthe blickte halb von ihrem Tagebuch auf.
„Sicher nichts Überwältigendes,” erklärte Elli mit einer Gleichgültigkeit, der die Neugier aus allen Fugen sah. „Ich stehe schon gar nicht mehr auf.”
„I wo, Kleinchen! Flugs auf deinen Posten!” ermunterte sie Marga.
Eine ziemlich tiefe, etwas hastige Stimme klang von unten aus dem Hausflur.
Elli rückte auf ihrem Sitz hin und her. Sie wollte nicht mehr, und doch wollte sie brennend gern. Käthe hatte die Feder weggelegt. Auch sie überlegte. Schon stand Elli auf und huschte nach der Tür. Käthe folgte langsam. Mit vereinten Kräften beugten sie sich draußen über das Geländer und spähten den heraufsteigenden Schritten entgegen. Marga lauschte wie zuvor. Es war wieder das alte lustige Spiel, das sie nicht lassen konnten, heute zum zehntenmal nicht. Die kleine Zänkerei war längst vergessen. Die Treppen, das Nußbaumgeländer knackten unter der Last der beiden vornübergebeugten Mädchenkörper verräterischer denn je.
Die Musterung des ahnungslosen Besuchers dauerte lange. Für Marga in ihrem Alleinsein schienen die Schwestern eine Ewigkeit auszubleiben. Endlich klappte im ersten Stock die Tür zum Zimmer des Geheimrats ins Schloß.[S. 12] Käthe und Elli stürmten gleichzeitig zurück ins Zimmer. „Etwas schrecklich Interessantes!” rief Elli aufgeregt schon von weitem.
„Ein Neuer! Hat noch nie bei Papa gehört!” berichtete auch Käthe mit ungewohnter Lebhaftigkeit, während sie vorsichtig die Tür nach dem Flur zuzog.
„Alt? Jung? Groß? Klein? So erzählt doch nur!” forschte Marga mit jener Neugier, die sie mitunter leidenschaftlich überkam, wenn ihr junger Sinn sich aufbäumte, als fürchtete sie, die Schwestern möchten ihr ein Stück Leben vorenthalten, nach dem sie sich in ihrer Dunkelheit nicht minder sehnte als die anderen mit ihren hellen Augen.
Alle drei rückten an dem runden Tisch ganz nahe zusammen. Fast stießen sie mit den eifrig aufgestützten Ellbogen aneinander. Käthe und Elli überstürzten und ergänzten sich in ihren Mitteilungen. Die ganze ausgelassene Lust der „Bande”, wie Papa Richthoff seine Mädels nannte, machte sich in dieser halb spaßhaften, halb ernsten Kritik Luft.
„Sehr straffe männliche Erscheinung,” beschrieb Käthe.
„Groß, schlank!” unterbrach Elli. „Schick gekleidet! Jackettanzug — Pfeffer und Salz! Braune Stiefel!”
„Weißt du, Marga, ähnlich wie der eine Assistent von Professor Lepart,” erklärte Käthe.
„Doktor Zerweck? Das Gigerl? Ich danke!” ereiferte sich Elli. „Nicht die Spur, Marga. Viel natürlicher, gar nicht geckenhaft!”
„Nicht wie ein Philologe, weißt du,” nahm Käthe den Bericht wieder auf. „Mehr weltmännisch.”
„O, das will ich nicht sagen,” widersprach Elli. „Es gibt sehr feine Philologen.” Sie verstummte plötzlich und[S. 13] wurde wieder rot. Wilkens war nämlich Philologe, derselbe Wilkens, der vorhin an der kleinen Tränenszene schuldig geworden war.
Jetzt mußten sie alle drei über Ellis Naivität lachen, sie selber nicht zum wenigsten.
„Aber wie sieht er denn nun eigentlich aus?” fragte Marga ganz unglücklich. „So erzählt doch mal ordentlich!”
Käthe und Elli fingen wieder von vorn an. Schwatzend und lachend lieferten sie eine Charakteristik, so wirr und widerspruchsvoll, daß Marga sich nach noch so vielen Beschreibungen so klug vorkam wie zuvor. Was sie mit einiger Bestimmtheit erfuhr, war nur, daß er einen braunen Vollbart trage und sehr ausdrucksvolle dunkle Augen habe. Über diese Augen, die keine der beiden Schwestern länger als eine Sekunde in beträchtlicher Ferne gesehen, drohte es zu neuem Streit zu kommen. Elli fand sie feurig, Käthe schmelzend.
Marga legte sich ins Mittel. „Wir müssen mal Papa fragen, wer es war,” sagte sie einfach und entschieden.
Käthe und Elli waren einen Moment sprachlos über diesen verblüffend klaren und offenen Rat. Dann fielen sie vereint mit ihren Bedenken über Marga her. Als ob das so einfach wäre, Papa zu fragen! Man würde ja verraten, daß man Posten gestanden! Papa würde Gott weiß was denken! Und wenn er erst merkte, daß man gern etwas von ihm wissen wollte, konnte man sicher sein, daß er schwieg wie ein Löwe. Das mußte fein eingefädelt werden. Da mußte ein richtiger Feldzugsplan gemacht werden. Wieder steckten sich die drei Mädchenköpfe wie die Häupter einer Verschwörung über dem Tisch zusammen.[S. 14] Sie fuhren erst erschrocken auseinander, als ziemlich laut an die Tür gepocht wurde.
Therese streckte den Kopf herein. „Der Kaffee steht unten,” meldete ihre mürrische Stimme. „Er wird kalt. Und der Herr Geheimrat hat nach dem seinen schon gerufen.”
Wie im Nu ging es aus der Stube und die Treppe hinunter. Elli voran, denn an ihr war die Reihe, Papa den Nachmittagskaffee zu bringen. Das war eine wöchentlich abwechselnde Ehre.
Käthe und Marga folgten Arm in Arm. Sie hatten am Nachmittag eine Besorgung zu machen und verabredeten den Stadtbummel. Bis zum Abendbrot galt es schon zu warten, ehe man gemütlich mit Papa plaudern konnte. Dann mußte man — man mußte erfahren, wer der „Neue” war.
Der Geheimrat hatte allerdings nicht die leiseste Ahnung von dem, was seine Mädels zu seinen Häupten trieben und planten. Wenn er nach dem Essen seinen Verdauungsgang im Garten gemacht hatte, wobei er mit der gewissenhaften Liebe von Jahrzehnten die Fortschritte seiner Bäume und Spaliere feststellte, die Schnecken von den Weinstöcken ablas, das allzu vordringliche Unkraut mit der Stockspitze aus den Wegen bohrte und nachbarwärts schleuderte — dann bildete die Sprechstunde den Übergang von der beschaulichen Ruhe zur eifrigen Arbeit. Wie ihm seine Besucher gefielen oder seine Laune es ihm eingab, fertigte er seine Hörer bald kurz und ohne viele Worte ab, bald verwickelte er sie in ein Gespräch und stellte — das war[S. 15] der Schrecken der jungen Semester, die zum erstenmal sich bei ihm anmeldeten — ein kleines historisches Examen an, sein Opfer unvermittelt an einem Rockknopf fassend und sich an seiner Verwirrung innerlich belustigend. War dann der letzte glücklich expediert und die Tür endgültig für weitere Besucher geschlossen, so schlüpfte er in den befreienden grauen Schlafrock, der schon bedenklich viele Jahre erlebt hatte, aber für unersetzlich galt, und steckte sich eine Zigarre an. Er verschwand hinter dem gewaltigen Zylinderbureau aus Nußbaumholz, das vom einen Fenster aus quer in die Stube stand und mit den mächtigen bändereichen Regalen im Rücken ein kleines Zimmer im Zimmer bildete. Eine Flut von Zetteln und Zettelchen, alle beschrieben mit seiner winzigen, mikroskopisch feinen Handschrift, breitete sich vor ihm und um ihn aus. Es war ein besonderes Kunststück, das nicht immer gleich gut gelang, den Nachmittagskaffee geräuschlos hereinzubringen und auf dem blätterbesäten Schreibtisch ein Eckchen zu erspähen, wo er hingesetzt werden konnte, ohne daß der alte Herr einen grollenden Sturm losbrechen ließ, weil man ihm alles durcheinanderwerfe und die peinliche Ordnung seiner Manuskripte, die für jeden andern einer peinlichen Unordnung zum Verwechseln ähnlich sah, gewissen- und verständnislos zerstöre. Nur Marga genoß das Vorrecht, daß ihren suchenden Fingern Nachsicht, sogar etwas Hilfe gewährt wurde. Das war aber eine Zartheit, die als geheimes und stillschweigendes Abkommen zwischen Vater und Tochter verborgen blieb.
Heute, wo Elli an der Reihe war, hatte es grimmiges Murren gegeben, so daß sie den Schwestern verstört berichtete, Papa sei grauenhaft aufgelegt und müsse wie[S. 16] ein schalloses Ei behandelt werden. Dabei war der alte Herr bei sich selber ganz zufrieden. Mit Bedacht und Vorliebe spielte er den Pascha, der unberechenbar seine Gnaden und Ungnaden verteilt. Nach seiner wohlgemeinten Ansicht gab es kein besseres Mittel, um die „Bande” einigermaßen in Zaum und Zucht zu halten. Nachdem ihm seine um fünfzehn Jahre jüngere Frau gestorben, ehe Elli und Marga auch nur aus den Kinderschuhen waren, hatte er eine Erzieherin ins Haus genommen. Eine Zeitlang war es auch mit einer Hausdame versucht worden. Aber aus alledem waren so viel Unbequemlichkeiten und Mißhelligkeiten entstanden, die seine ihm notwendige Gelehrtenruhe störten, daß er, als die beiden jüngsten leidlich herangewachsen waren, das Hauswesen mit seinen drei Töchtern allein zu führen unternahm. Etliche Kollegen, unterschiedliche Tanten und Basen hatten erklecklich dazu den Kopf geschüttelt. Eine Musterwirtschaft war's ja auch nicht gerade geworden. Aber er war zufrieden, wie es war; er und die drei Mädchen fühlten sich glücklich in dem alten wohnlichen Haus am Wenzelsberg.
An den Tagen, an denen nicht eine Kolleg- oder Seminarstunde ihn abrief, saß Geheimrat Richthoff vom Nachmittag bis zum Abend in seiner Schreibtischecke. Im qualmenden Nebel der Zigarren, die er eine an der andern ansteckte, verschwand für ihn die Außenwelt. An ihre Stelle traten die geistigen Gestalten seiner römischen Kaiser, mit denen er leibhaftig und wie mit seinesgleichen umging. Aus der Unzahl kleiner Züge, die er mit unermüdlichem Fleiß Tausenden von Inschriften, spärlichen, unverläßlichen Geschichtschreibern, all den zwar unermeßlichen, aber noch so unverarbeiteten Quellen abzwang,[S. 17] formte er mit feiner, geistreicher Kunst seine Kaisergeschichte. Die Studien eines ganzen Lebens trug er, an der Schwelle des Alters, in einem darstellenden Werke großen Stils zusammen. Mit eiserner Energie hatte er von Jahr zu Jahr den Wunsch, das Erforschte und Gesammelte zum Kunstwerk umzuschaffen, niedergehalten. Jetzt endlich, seit Jahresfrist, hatte er sich der Haft der Kleinarbeit entlassen. Mit dem Ungestüm eines Jungen begann er zu gestalten. In der Seligkeit, das kritisch Erklügelte endlich künstlerisch erleben zu dürfen, erfüllte sich ihm der Traum seines Daseins. Alle Freuden und Leiden des Schaffenden erlebte er in der drangvoll-fürchterlichen Enge seines Schreibtisches. Verzweiflung und Resignation wechselten mit feurigem Entzücken. Er haderte mit seinen Kaisern; er knirschte, brummte, schalt vernehmlich und drohte, wenn sie sich spröde zeigten und ihre glatten, scharfen Cäsarenköpfe in den Schleier der Undurchdringlichkeit hüllten. Das waren die Tage, wo die Arbeit um zwei, drei Zeilen vorrückte, von denen die eine wieder gestrichen werden mußte. Dann wurde er unzugänglich, griesgrämig, unwirsch und konnte mit seinem Unmut das ganze Haus durcheinanderwerfen. Ein andermal war alles eine Herrlichkeit: die Kaiser hielten ihm stand; sie traten hervor wie aus Marmor gemeißelt, klar, formgebietend, lebenheischend; dann verklärte ein heimliches Lächeln sein Gesicht, heimlich, denn es saß tief drinnen zwischen dem weißen dichten Vollbart und schoß höchstens einmal wie ein neckender Blitz unter den scharfen Brillengläsern hervor. Flüssig und leicht und selbstverständlich sprangen die Worte, die Sätze aus der Feder, und Blatt um Blatt bedeckte sich mit der minutiösen, schwer leserlichen Schrift.[S. 18] An solchen Tagen war Vater Richthoff umgänglich, zu einem Scherz bereit, innerlich von einer kindlichen Heiterkeit. Da hielt der barsche Pascha nicht vor. Er drückte ein Auge zu, ließ sich Wünsche und Bitten vortragen, gab Lob und Zustimmung, kurz: Papa hatte seinen guten Tag und die Bande mit ihm.
Einen guten Tag hatte der alte Herr auch heute hinter sich, als er sich endlich entschloß, die Feder wegzulegen und den Rest der soundsovielten Zigarre dem Aschenbecher zu opfern. Er rieb sich befriedigt die Hände und schob die kleine schwarze Samtkappe, die — ein würdiges Seitenstück des betagten Schlafrocks — den dünnbehaarten, massigen Schädel schützte, über die Stirn zurück. Dann stand er auf und öffnete ein Fenster. Vom Vorgarten, der Haus und Straße gleich einer erhöhten Terrasse trennte, atmeten die in voller Blüte stehenden zwei Kastanienbäume ihren milden, süßen Duft. Die untergehende Sonne warf rote Lichtbündel auf den Kiesplatz und sprenkelte die Gartenmöbel, die um den steinernen Tisch standen. Dort saß Marga, die Hände im Schoß, den Kopf mit dem schlichten, aschblonden Knoten weit gegen den Baumstamm zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Vom Kamin eines Hauses gegenüber schmetterte eine Amsel ihre Triller in die auffallend weiche, stille Luft des Maiabends. Marga schien angespannt zu lauschen. Ein Ausdruck, von Wonne und Weh seltsam gemischt, lag auf dem zarten Gesicht, das im Dämmerschatten des Baumes blasser aussah, als es war.
Der Geheimrat sah ihr einen Augenblick ruhig zu, ehe er sich entschloß, ihre Träumerei zu unterbrechen. Bei ihr, die sein Sorgenkind war, bekämpfte er mit einer[S. 19] Strenge, die ihm nicht leicht wurde, den für ihre zwanzig Jahre und ihre Blindheit begreiflichen Hang, sich in einer schwärmenden Gemütsstimmung einseitig zu verlieren. Gerade sie, der das Schicksal ein kärgeres Los zugemessen als den andern, wollte er davor behüten, ihre Kraft in einem überschwenglichen Gefühlsleben zu verzehren. Er vergaß darüber, daß die Unendlichkeit ihrer Träume sie auch wieder mit der verdunkelten Endlichkeit und Beschränkung ihres Daseins versöhnte.
„Na, Marga, du scheinst nicht so hungrig zu sein wie ich,” klang es jetzt mit neckendem Vorwurf zu ihr hinunter.
Ein leises Zittern lief über Margas Körper. Sie schrak zusammen, als kehrte sie plötzlich aus weiter, luftiger Ferne zurück, und die Augen irrten in die Höhe.
„Wir haben mit dem Abendbrot nur auf dich gewartet. Es ist alles fertig,” gab sie in leichter Verwirrung zurück; sie stand auf und eilte mit geübter Sicherheit der Glastür zu, die vom Erdgeschoß in den Vorgarten führte.
„Langsam, langsam!” mahnte der Geheimrat, während er sich vom Fenster zurückzog. Fast tat es ihm leid, sie aus ihrem verlorenen Sinnen geweckt zu haben. Er warf noch einen halb schmeichelnden, halb wehmütigen Abschiedsblick auf das Wirrsal seiner Manuskriptblätter, ehe er sein Zimmer verließ und die Treppe hinunterstieg.
Im Eßzimmer war alles seines Erscheinens gewärtig. Die Mädels kamen ihm entgegen und führten ihn wie im Ehrengeleit zu seinem bequemen Sessel. Käthe goß ihm den Tee ein. Marga strich seine gerösteten Butterschnitten. Elli schob ihm noch ein Kissen in den Rücken. Er ließ sich gern ein bißchen verwöhnen. Doch die Behendigkeit, mit der er heute bedient wurde, erschien ihm fast verdächtig.
Therese erschien mit den Schüsseln. Unauffällig stellte Käthe eine Platte mit jungen Spargeln als Sondergericht vor den väterlichen Teller.
Der Geheimrat stutzte. „Kinder, ich habe wohl heute Geburtstag, was? Frische Spargel! Anfang Mai! Wie komm' ich zu solchen Leckereien?” Er sah sich fragend im Kreise um. Sein eines Auge zwinkerte unmerklich.
„Marga und ich kamen auf der Hauptstraße bei Testers vorbei,” erklärte Käthe harmlos. „Wir sahen zufällig, daß er im Schaufenster die ersten Schwetzinger Spargel ausgestellt hatte, und weil du sie so gern magst —”
„So wollten sie dir eben eine Freude machen,” schloß Elli mit wohlgemeinter, aber verlegener Hast.
„Hm! Etwas unverantwortlich, aber nett von euch.” Es war jetzt für den alten Herrn ausgemacht, daß die Bande etwas von ihm wollte. Entweder mußten sie neue Frühjahrskleider haben oder sie wollten eine Einladung annehmen oder weiß Gott was. Es galt also, auf der Hut zu sein.
Käthe und Elli sahen sich mit verzweifelten Blicken an. Sie gaben das Treffen schon so gut wie verloren. Der etwas spöttische Ton verriet ihnen, daß Vater Richthoff die Absicht, ihn durch einen Leckerbissen in seiner guten Laune zu unterstützen, durchschaut habe.
Es entstand ein längeres Schweigen. Marga, der von Natur alle Diplomatie fremd war, empfand die kritische Situation am unbehaglichsten. Nur aus schwesterlicher Solidarität hatte sie sich mit dem Plan befreundet, das Geheimnis des „Neuen”, das zu ergründen man sich nun einmal in unschuldiger Kinderei verschworen hatte, auf[S. 21] raffinierten Umwegen herauszulocken. Ihr schien es geraten, jetzt geradezu aufs Ziel loszugehen.
„Hast du schon viele neue Hörer fürs Sommersemester, Papa?” fragte sie unbefangen. Und ohne sich durch einen Ellbogenstoß Ellis irremachen zu lassen, fuhr sie fort: „Bitte, erzähl' uns mal, wer heute alles bei dir war.”
Käthe und Elli blieb der Bissen im Halse stecken. Diese Kühnheit war unerhört. Noch ein ungeschicktes Wort, und Papa erriet, daß sie seine Sprechstunde belauert hatten. Im vorigen Jahr, als Wilkens sich einschreiben ließ, hatte er Elli einmal auf der Treppe erwischt: es hatte eine erschreckliche Strafpredigt über Anstand und Manieren abgesetzt. Und jetzt ...! Käthe trat Marga unter dem Tisch auf den Fuß. Es war einfach haarsträubend gefährlich, was sie da mit ihrer unverbesserlichen Offenheit anrichtete.
Der alte Herr liebte allerdings nichts weniger, als wenn man sich in seine „Amtsangelegenheiten” mischte. Wenn er etwas davon mitzuteilen für gut fand, war das eine seltene Huld und geschah aus freien Stücken. Wäre er weniger befriedigt von seinen römischen Kaisern gekommen, eine barsch ablehnende Antwort hätte nicht ausbleiben können. Aber guter Dinge, wie er war, begnügte er sich mit der mildesten Form, die er hatte, wenn es galt, unerwünschte Fragen abzuweisen: er überhörte sie und blieb eifrig in seine Mahlzeit vertieft.
Die drei Mädels kannten ihn zu genau, um nicht diesen stummen Bescheid zu verstehen.
Elli und Käthe verständigten sich durch einen Blick: Lasciate ogni speranza!
Marga hatte aufgehört zu essen. Sie hatte den Kopf[S. 22] gesenkt. Die Finger der rechten Hand strichen langsam das Tischtuch. Trauer und Beschämung prägten sich in ihrem Gesicht aus. Bei ihrer gesteigerten Empfindungsfähigkeit ging dieser stumme Tadel tiefer als eine entschiedene Zurückweisung. Sie fühlte sich überdies vor den Schwestern gedemütigt.
Dem alten Herrn entging ihre Stimmung nicht. Er wollte heute fröhliche Gesichter um sich sehen. „Sag mal, Marga,” begann er, nachdem er die zweite Tasse Tee in einem Zug geleert hatte, mit gravitätischem Ernst, „ich höre, du hast heimliche Herrenbekanntschaften!”
Käthe und Elli starrten erst Papa, dann die Schwester mit aufgerissenen Augen an.
„Ich — heimliche Herrenbekanntschaften?!” stammelte Marga.
„Na ja!” fuhr der Geheimrat im selben Ton fort, während er sich wie ein Großinquisitor im Sessel zurücklehnte. „Kennst du vielleicht einen gewissen Doktor Perthes? Ich glaube — ja doch — Max Perthes?”
„Perthes?” wiederholte Marga ungläubig und schüttelte den Kopf.
„Der Herr behauptet aber, dich zu kennen.”
„Davon weiß ich nichts,” beteuerte sie ernsthaft. Eine leichte Röte belebte ihre matten Farben. Sie erinnerte sich des Namens nicht. Sie kannte nur die Herren, die als Hörer des Geheimrats ein- oder zweimal im Jahr zur Abfütterung kamen, und auch diese nur flüchtig, denn solche offiziellen Gesellschaften pflegten für sie fast immer eine Qual zu sein, die sie nur auf Papas ausdrücklichen Wunsch ertrug.
„Was ist er denn?” platzte Elli hervor, die ihre Neugier[S. 23] nicht mehr bemeistern konnte. „Philolog oder Jurist oder —”
„Immer fein geduldig, Kleinchen! Bring mir meine Zigarren!”
Elli beeilte sich, die Kiste vor ihn hinzustellen. Erwartungsvoll blieb sie neben ihm stehen.
„Wo will er denn Marga kennen gelernt haben?” konnte nun auch die besonnene Käthe sich nicht enthalten zu fragen. Daß Marga einen Herrn kennen sollte, den sie und Elli nicht kannten, das war etwas zu Außergewöhnliches.
„Du hältst mich zum besten, Papa,” erklärte Marga bestimmt.
„Oho! Objektive, geschichtliche Tatsache! Quelle unanfechtbar!” Der alte Herr hatte sich die lange Holländerin angesteckt und blies den Rauch von sich. Er weidete sich an der Neugier seiner Mädels und gefiel sich darin, sie noch höher zu spannen. „Übrigens ein schrecklicher Modejüngling,” setzte er nach einer Pause seine Mitteilungen fort.
„Ein Modejüngling — und Marga!” rief Elli lachend. Käthe lachte mit, und auch Marga schüttelte mit leisem Lächeln von neuem den Kopf.
„Er ist, glaube ich, Mediziner.”
„Mediziner?” klang es dreifach noch ungläubiger zurück.
„Trägt er vielleicht ein Pfeffer-und-Salz-Jackett?” entfuhr es Elli. „Und —” Sie verstummte jäh, über sich selber erschrocken. In ihrer übersprudelnden Lebhaftigkeit hatte sie alle Vorsicht vergessen.
Käthe war außer sich über diese Dummheit. Sie stand auf, Marga folgte ihr. Alle drei umstanden sie den kurulischen Sessel des Geheimrats, der Gott sei Dank keine[S. 24] Ahnung von so modischen Fachausdrücken wie „Pfeffer-und-Salz-Jackett” hatte und von seinen Besuchern alles andere eher denn Einzelheiten ihrer Kleidung im Gedächtnis behielt.
„Pfeffer-und-Salz-Jackett?” wiederholte er kopfschüttelnd. „Woher kennst denn du ihn, Kleinchen?”
„Nein, nein! Ich meinte nur so; ich kenne ihn so wenig wie irgendwer,” versicherte Elli krampfhaft.
„Also, kurz und gut,” resümierte der alte Herr, „er behauptet, Volontärarzt in Hemsbach gewesen zu sein.”
„Volontärarzt? In Hemsbach?” Marga besann sich. Sie war dort einen Sommer über — es war vier, fünf Jahre her — in einer Blindenanstalt gewesen, um sich in ihren Fertigkeiten zu vervollkommnen. Aus ihrer Erinnerung an diese schwere Zeit löste sich jetzt eine entfernte Gestalt. Damals war neben dem Direktor ein jüngerer Arzt dort, der sich gern mit ihr unterhielt und mit ihr lernte. Jetzt kam ihr auch der Name zurück. „Ach, der!” setzte sie plötzlich gedankenvoll hinzu.
„Jawohl — der!” schmunzelte der Geheimrat. „Habe ich nun recht, wenn ich sage, Marga hat heimliche Herrenbekanntschaften?”
„Natürlich hast du recht!” rief Elli lustig. „Das sind ja nette Sachen, die man von dir hört, Margakind!” Sie schlang den Arm um Margas Hals und zupfte sie neckend am Ohr.
„Und gar nie ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen!” sagte Käthe ganz vorwurfsvoll.
„Aber das war ja nur eine ganz flüchtige Bekanntschaft,” verteidigte sich Marga. Sie war ordentlich bestürzt. Ihre Augen gingen ratlos auf die Suche. Sie[S. 25] war rührend in ihrer leichten Erregung und verschämten Hilflosigkeit. Dazu regte sich etwas wie Stolz in ihr. Daß der Besuch des „Neuen”, der die Gemüter so beschäftigt hatte und nun unerwartet, kampflos aus seinem Inkognito hervorgetreten war, gerade mit ihr zusammenhing, war ein für ihre abgeschlossene Welt ungewöhnliches Ereignis. „Doktor Perthes war übrigens gar kein solcher Laffe,” erklärte sie nach einigem Besinnen mit ernsthaftem Nachdruck und unter allgemeiner Heiterkeit.
Der alte Herr erhob sich jetzt gleichfalls von seinem Sessel und klopfte ihr auf die Schulter. „Jedenfalls hast du ihn mir auf den Hals gehetzt, Kind. Er behauptet steif und fest, du hättest ihn eingeladen, uns zu besuchen, wenn er je einmal hierherkäme. Zugegeben?”
„Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, daß er damals freundlich zu mir war und —”
„Närrchen! Natürlich kam er nicht nur deshalb und deinetwegen. Er hatte an mich eine Empfehlung von meinem Freunde Schlutius in Bonn, der irgendwie mit ihm verwandt ist. Das genügt! Käthe, setz ihn auf die Liste. Er wird gelegentlich mal eingeladen. Und damit hat der Schnack ein Ende.” Er gab Marga einen leichten Backenstreich. Das war ein Zeichen seiner höchsten Gunst. Dann nahm er seine Abendzeitung vor und ging durch Wohnzimmer und Salon nach der verglasten Veranda auf der Vorderseite des Hauses. Dort brannte schon die Lampe, unter deren Schein er lesend eine halbe Stunde auf und ab ging, ehe er wieder zu seinen Kaisern hinaufstieg.
Für die drei Mädels aber hatte der Schnack noch kein Ende. Kaum war Vater Richthoff außer Hörweite, so wurde Marga von Elli und Käthe mit Fragen über und[S. 26] über bestürmt. Sie wußte nicht halb soviel, als sie hätte wissen müssen. Elli, die ihren siebzehnjährigen Übermut austoben mußte, wo immer eine Gelegenheit sich bot, faßte Marga als Herr um die Taille. Marga mußte jetzt unbedingt tanzen lernen. „Was soll dein Doktor sonst von dir denken? Dein Doktor kann das von dir verlangen. Dein Doktor wird entsetzt sein, wenn du solche Schritte machst.” So ging der lose Mund atemlos immerzu, während sie Marga unerbittlich im Kreise drehte, ob diese wollte oder nicht. Käthe schrieb indessen feierlich „Doktor Max Perthes” auf die Liste der Einzuladenden, die zu führen Papa ihr anvertraut hatte, und hielt, unbekümmert, ob sie gehört wurde oder nicht, sehr weise Reden darüber, daß sie den „Neuen” gleich für einen Mediziner gehalten hätte; daß Mediziner immer so und so aussehen und immer solche und solche Menschen seien.
Zum Glück für Marga fiel es den Schwestern plötzlich ein, daß ja heute der „Akademische Gesangverein” Probe hatte. Wollte man nicht zu spät kommen und von Professor Külz ein Nasenrümpfen beziehen, so war es höchste Zeit zum Aufbruch. Im Nu stürmte Elli davon, um sich fertigzumachen. Ihr feines Stimmchen trällerte die zu probende Bachkantate durchs Haus. Käthe folgte ihr, nachdem sie Therese zum Abräumen des Tisches gerufen.
Marga blieb im Eßzimmer zurück. Sie war wie betäubt von der letzten Viertelstunde. Von Papas neckender Enthüllung und dem Umtrieb, den Elli mit ihr angestellt hatte. Sie ordnete das zerzauste Haar, dessen Strähnen von dem unfreiwilligen Tanz sich an den Schläfen und im Nacken gelöst hatten. Während Therese abzuräumen begann, ging sie auf den kleinen Hof hinaus, der in gleicher[S. 27] Höhe mit dem ersten Stock hinter dem Hause lag, und von dem ein steiler Weg bergwärts in den Garten oder, wie er allgemein hieß, den „Weinberg” führte.
Es war schon kühl geworden. Eine reine, würzige Luft strich vom Weinberg herunter. Die Dämmerung, deren dunkles Wachsen Marga um sich fühlte, tat ihr wohl. Sie kreuzte die Arme hinter dem Rücken und verschränkte die Hände. Das war ihre liebste Haltung, wenn ein Ungewohntes in ihrem Innern wirkte. So schritt sie langsam im Hof auf und nieder. So überdachte und verarbeitete sie das Kleinste und das Größte, bis es in die große und einfache Stille ihrer Seele aufgegangen war, die nichts Unfertiges und Unklares in sich duldete. Eine um die andere ging sie ihre Empfindungen durch. Erst war sie erschrocken, als Papa sie so gravitätisch vornahm und zur Rede stellte. Dann hatte sie den Scherz herausgemerkt. Freude und Stolz hatte sie gefühlt, daß ein Mann sich ihrer erinnerte, nach ihr sich erkundigte und ihretwegen Besuch machte. Jedes andere junge Mädchen hätte an ihrer Stelle ähnliches empfunden. Für sie war es nur neuer, verwirrender, weil das Leben da draußen, das Leben der Weltmenschen, wie sie es nannte, sich immer nur um die beiden Schwestern zu kümmern pflegte, nicht um sie. Sie wollte ihre heimliche Freude in der Lustigkeit der Schwestern aufgehen lassen. Willig ließ sie sich ausfragen, sich necken, mit sich tollen. Aber unvermutet stieg ein anderes Gefühl in ihr auf, ein bitteres, schmerzliches: hinter der Fröhlichkeit der anderen steckte etwas, das sie verletzte, ohne daß sie es wußten oder wollten. Daß es gerade sie war, Marga, die Blinde, die Ausgeschlossene; sie, bei der die Bekanntschaft mit einem Mann so gar[S. 28] nichts zu bedeuten hatte — das machte die Sache so besonders spaßhaft. Es war so komisch, weil es so ganz ungefährlich war. Und im selben Sinne hatte es auch Papa aufgenommen: „Damit hat der Schnack ein Ende!” — hinter diesem Wort fand ihr Grübeln die gleiche Grenze, jenseits deren es für sie keine Wünsche, keine Hoffnungen, darum auch keinen Ernst geben konnte.
Und an jene Grenze stieß auch jetzt sie selbst, während sie so sicher und still in dem ihr vertrauten Hofraum auf und ab schritt. Sie hatten ja recht. Es war in Wirklichkeit so. Dies Jenseits war ihr genommen, seit in ihrem vierzehnten Jahr, zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, eine Netzhautablösung ihre ohnehin schon schwachen Augen für immer gelöscht hatte. Damals hatte sie nur halb begriffen, was sie verloren. Erst mit den Jahren wuchs auch das Verständnis ihres Verlustes. Die Schwestern und alle, mit denen sie umging, sprachen nie davon. Aus ihrem Mitleid erriet sie es. Immer besser, immer bestimmter wußte sie, daß das höchste Glück, das einem Menschenkind nach irdischem Denken und Fühlen aufbehalten war, nicht das ihre sein konnte. Sie fühlte Kraft genug in sich, um zu entsagen. Sie kämpfte, sie rang, sie ruhte nicht, bis ihre Stille ihr gab, was sie brauchte; bis sie mit sich allein zufrieden sein und nur in sich selber ihr Glück suchen wollte. Ihr Stolz kam ihr zu Hilfe; ihr Stolz hielt sie aufrecht, wenn sie zu verzagen und schwach zu werden drohte.
Und dennoch — dennoch! Es war noch eine andere Kraft in ihr, die sich mitunter gegen ihre stille Ergebenheit aufbäumte. Ihre Jugend ließ und ließ sich nicht auf einmal und für immer niederzwingen. Die fühlte sie auch[S. 29] jetzt sich auflehnen. Die stürmte in ihr auf, daß sie die Hände an die heißen, pochenden Schläfen legen mußte. War nicht dieser Doktor Perthes doch vielleicht um ihretwillen gekommen? Er konnte ja die Empfehlung, von der Papa sprach, sich haben nur darum geben lassen, weil er sie wiedersehen wollte. Es brauchte nicht nur der Wunsch zu sein, Verkehr zu haben oder höflich zu sein oder ihr seine mitleidsvolle Achtung auszudrücken — — Aber das war ja Unsinn! Sie schwärmte ja! Sie täuschte sich vor, ihn näher zu kennen, als sie ihn je gekannt. Das Bild, das ihr die Erinnerung gab, bestand kaum aus ein paar spärlichen Zügen: er hatte manchmal mit ihr geplaudert, sie belehrt, war auf die Gedanken und Gefühle eines halberwachsenen Mädchens nachsichtig eingegangen. Sie machte jetzt ihre Erinnerung mit Gewalt ärmer, als sie war. Sie wollte nicht schwächlich, weich gegen sich sein, sondern tapfer. Und klar, wie sie es immer von sich verlangte. Rücksichtslos klar.
Jetzt war sie schon so weit, daß sie lächeln konnte. Lächeln über den winzigen, eingebildeten Sturm, der ihr Gleichgewicht hatte stören wollen.
Langsam stieg sie vom Hof in den Weinberg hinauf.
Der Nachtwind rüttelte leise und friedlich in den Büschen und Baumkronen. Von dem Fliederstrauch bei der ersten Laube nahm er eine Wolke blühenden Duftes und hauchte sie über Marga aus. Hoch und höher stieg sie; kaum daß sie an einen Stein anstieß, so vertraut war ihr die Steige. Bis zu ihrer Pappel, die hinter der zweiten Laube stand, klomm sie empor.
Dort lehnte sie sich gegen den rissigen Stamm.
Die Nacht war ihre Freundin. Sie wuchs von unten[S. 30] herauf, aus der Ebene, wo die Stadt einschlummerte; wo draußen ferne Tannensäume starrten und der Fluß zwischen jungen Feldern sich verlor, in Margas Träumen so schön wie in keiner Wirklichkeit. Sie senkte sich auf sie herab, aus der unendlichen Höhe und Tiefe des Himmels, wo die Sterne blitzen mußten, nein blitzten — ein einziges, ewiges, königliches Gewirk von leuchtendem Gold und seliger Bläue. Weit, weit breitete sie die Arme aus, als könnte sie die Nacht, die friedliche, an sich raffen. Aus der Ferne und Nähe, von unten, von oben. Und dann schlang sie die Hände beglückt über ihrem Kopf ineinander; so frei fühlte sie sich, so klar, so in sich selber und in der Nacht geborgen.
Am Sonnabend war es üblich, das Institut früher als sonst zu verlassen. Professor Hammann, der Chef, war den ganzen Tag nicht erschienen. Er war über Sonnabend und Sonntag wieder einmal weggefahren. Nach dem Rhein. Er pflegte dann Freitagabends seinen beiden Assistenten en passant seine „Dienstreise” anzukündigen.
Junggeselle, reich, durch glänzende akademische Beziehungen in seiner Laufbahn gesichert, ohne Ehrgeiz und ohne tiefere Neigung zu seiner Wissenschaft, trieb er seine Bakteriologie bestenfalls wie einen Sport unter den andern. Denn der Sport war seine Lebensaufgabe, er war die Grundlage seiner Lebensanschauung. Man konnte sicher sein, daß die „Dienstreise” einem Rennen, einer Regatta, einem Tennis- oder Hockeymatch galt, bei dem er nicht fehlen durfte. Du lieber Gott! Die Bazillen nahmen ihm das nicht weiter übel. Mit den zweien, die[S. 31] er selber früher entdeckt, war das bißchen Gelehrtenruf hergestellt: die „Jahrbuchunsterblichkeit”, wie er mit unverhohlener Selbstironie im vertrauten Kreise zu sagen pflegte. Das Weitere besorgten die Assistenten unter seinem Namen.
Doktor Markwaldt, der erste Assistent, hatte schon gleich nach fünf Schluß gemacht. Er saß rittlings auf seinem Stuhl und las seine Berliner Zeitung. Bisweilen schielte er über das Blatt weg nach seinem Kollegen, der noch immer mikroskopierte, und stellte psychologische Zwischenbetrachtungen an.
Dieser Perthes war doch ein merkwürdiger Bursche! Markwaldt bildete sich ein, Menschenkenner von Beruf zu sein — er beurteilte seine Fähigkeit nach der Fixigkeit seines Urteils —, aber dieser Junge, dieser Perthes, trotzte nun bald seit fünf Monaten, seit er überhaupt zweiter Assistent war, den Markwaldtschen Erfahrungsgrundsätzen. Drei Wochen lang arbeitete er wie ein Büffel; er verbiß sich in irgendeine Sache und schien darüber Himmel und Erde zu vergessen. Der Junge war ein Streber, ein ganz gewöhnlicher Streber. Das stand fest. So lange, bis die drei nächsten Wochen anfingen. Wie mit einem Schlage war derselbe Perthes wie ausgewechselt. Er erschien fast nur gastweise im Institut; er sprach von seiner Wissenschaft in den geringschätzigsten Ausdrücken, spielte sich als Naturmensch und Krafthuber auf, der in Wald und Feld herumtobte, wie ein Besessener ruderte und zeitweise überhaupt vom Erdboden verschluckt zu sein schien. Keine Frage: der Junge war ein ausgepichter Faulenzer, der es nie zu etwas bringen konnte. Alles Laune, Tollheit, Verschrobenheit. Bis das Wetter von neuem umschlug und der[S. 32] Arbeitsteufel wieder über ihn kam. Aus diesem Chamäleon mochte ein anderer klug werden!
Inzwischen hatte Perthes mit einem kurzen Entschluß den weißen Arbeitsmantel in den Kasten gehängt und mit dem schon bekannten Pfeffer-und-Salz-Jackett vertauscht. „Gehen wir?” fragte er mit knappem Ton, schon halb in der Tür.
„Höchste Zeit!” Markwaldt sprang auf und steckte die Zeitung in die Tasche.
Nach einer kurzen Weisung an den Institutsdiener, der aus seiner Stube im Erdgeschoß getrommelt wurde, verließen die beiden Assistenten das Haus und schlenderten, die langweilige Enzisheimer Straße vermeidend, durch die Allee am Fluß aus dem klinischen Viertel stadtwärts.
Es war ein ungleiches Paar. Perthes, hochgewachsen, schlank, brünett, überragte den rundlichen, weißblonden Markwaldt um fast zwei Haupteslängen. Auch wenn er, wie jetzt, langsam ging, war er mindestens um einen Schritt dem anderen voraus. Er hatte den blaubebänderten Panamahut abgenommen oder vielmehr noch gar nicht aufgesetzt. Lässig schlenkerte er ihn in der Linken. Den Kopf mit dem dichten, dunklen, verworrenen Haar, den buschigen Brauen, dem kräftigen braunen Vollbart neigte er leicht nach rechts zu seinem Gefährten herunter, als hörte er dessen Reden zu. Doch waren die leicht zugekniffenen Augen geradeaus ins Weite gerichtet und verrieten das Gegenteil.
Markwaldt erzählte von einem Gartenfest, das Hupfeld, das „große Tier” der Fakultät, die weitberühmte chirurgische Exzellenz, im vorigen Sommer gegeben hatte. „Sie müssen dort Besuch machen, Kollege! Unbedingt.[S. 33] Das einzige Haus großen Stils in unserem gottbegnadeten Jammerdorf. Tipptopp! Nicht diese ollen, langweiligen Geheimratsfressereien, wo man sich mit zehn, zwanzig höheren Töchtern tothupsen muß. Und dann — Alli! Pardon, Alice!” Er schnalzte statt aller Charakteristik mit der Zunge. „Na, die kennen Sie ja schon — Fräulein Exzellenz, was?”
Perthes schüttelte gleichgültig den Kopf. „Keine Ahnung,” antwortete er zerstreut.
„Nicht die Möglichkeit! Sie sollten unter die Sterngucker gehen, Perthes. Wahrhaftig!” Markwaldt blieb stehen und klopfte empört mit dem Stock auf den Boden, daß seine kuglige Figur, die so prall in dem blauen Anzug mit der buntgestickten Weste steckte, in Erschütterung geriet. Dann stützte er beide Hände auf den achatenen Stockknopf und stellte eins seiner kurzen Beine graziös hinter das andere. Er zwang so Perthes, stehenzubleiben und sich zu ihm umzuwenden. „So was übersieht man doch nicht — die einzige schicke Erscheinung im ganzen Nest! Wetten, daß das Teufelsmädel Sie schon kennt?”
Perthes zuckte ungeduldig die Achseln. Markwaldt langweilte ihn. Er wollte weiter, aber sein Partner blieb unerbittlich stehen, wo er stand, und redete drauflos.
„So werden Sie's zu nichts bringen, Verehrtester! Zu gar nichts. Und Sie wollen akademisch werden?! Die Mädels sind ja doch die Hauptsache, sag' ich Ihnen. Den ganzen Professorenklumpatsch können Sie, wie Gott-Vater, in die eine Wagschale legen, Ihre Bakteriologie und was Sie sonst wissen dazu. In die andere Schale muß das richtige Mädel, und wuppdich — sie senkt sich, daß[S. 34] die Professorenperücken und Ihre Wissenschaft an die Decke fliegen. So liegt die Chose!”
Jetzt mußte Perthes — unter der Wucht solcher Anschaulichkeit — wohl oder übel lachen. Seine starken weißen Zähne leuchteten aus dem dunklen Barthaar. „Das ist doch wohl die alte Schule, Kollege Markwaldt,” meinte er leichthin.
„Alte Schule?” ereiferte sich Markwaldt. „Alte Schule? Sie, o Sie — verzeihen Sie! — Sie unglaublicher Embryo! Die ewige Schule ist das!” Er mußte sich jetzt entschließen, dem weiterschreitenden Perthes zu folgen. „Werden ja sehen. Übrigens, Besuch machen müssen Sie bei Hupfeld doch. Das ist einfach so Brauch von alters her. Fragen Sie den Chef!”
„Ich besuche, wen ich will,” gab Perthes mit beinahe unfreundlicher Bestimmtheit zurück. Ein Angriff auf seine Freiheit bewirkte bei ihm alles andere eher als Nachgiebigkeit.
„Verdrehtes Huhn!” knirschte Markwaldt in sich hinein, doch immerhin so vorsichtig, daß sein Gefährte die Schmeichelei nur ahnen konnte. Ihm konnte es ja schließlich egal sein, wie Perthes die Sache angriff. So harmlos er sonst war, so sagte ihm doch jetzt der Ärger: Je verkehrter, desto besser. Seine Verstimmung dauerte indes nicht lange. Schon strich er wieder mit der Selbstgefälligkeit des guten Jungen, der er war, den kurzgeschnittenen dürftigen Schnurrbart und pfiff durch die roten Lippen. An der Brücke, die hinüber nach der Neustadt führte, verabschiedete er sich.
„Kommen doch zum Klinikerabend heute, was?” fragte Markwaldt.
[S. 35] „Vielleicht,” lautete die ausweichende Antwort.
„Na, denn — auf Wiedersehen!” Markwaldt schritt seinem Stammcafé zu, wo er die Zeit bis zum Abendessen mit Billardspielen totschlagen wollte.
Perthes ging auf der Altstadtseite am Fluß weiter. Die Allee wurde dort belebter. Alte Leute saßen auf den Bänken in der Sonne, die in ihrem sachten Niedergang seitwärts in die Allee hereinblinkte. Kinder häufelten Sand und liefen den Fußgängern zwischen die Beine. Auf dem Fluß schoß ein langes, schmales Ruderboot pfeilschnell dahin. Die Ruderer mit ihren roten Mützen und weißen Trikotanzügen hoben sich grell ab von dem dunkelgrünen Wasser. Ihre nackten Arme warfen sie nach dem lauten, mechanischen Kommando des Steuermanns im Gleichtakt vor und zurück. Auf dem Graspfad unten an der Uferböschung lief der Leiter des Klubs, ein jugendfroher Gymnasialprofessor, mit einer mächtigen Schalltube. Er begleitete das Boot und rief seine Kritik durch den Trichter dröhnend über das Wasser hin. Zuzeiten selbst ein leidenschaftlicher Ruderer, sah Perthes dem Boot mit Interesse nach. Dann ging er über die Straße nach seiner nahen Wohnung und stieg lässig die Treppe hinauf.
Ein geräumiges Giebelzimmer mit dem freien Blick auf den Fluß und die gegenüberliegenden Waldberge war sein Quartier. Ein kleiner Alkoven stieß daran. Eine Veranda, luftig und keck wie ein Vogelnest, war unter den Dachsparren vorgebaut. Einfach, aber freundlich und sauber war alles eingerichtet. Es war gut hausen da oben.
Als Perthes eintrat, sah er sich um. Auf dem Tisch lag eine Drucksache. Er riß sie auf und warf sie beiseite. Ein medizinischer Katalog, weiter nichts.
[S. 36] Eine Weile stand er unter der offenen Verandatür und starrte hinüber nach dem anderen Ufer. Unter den Landhäusern in der Neustadt drüben schien er ein bestimmtes zu fixieren. Dann drehte er sich schroff zurück ins Zimmer. Er trat vor seine Bibliothek, die auf einem Regal neben dem Schreibtisch an der Wand stand. Eine seltsame literarische Auslese, die sich da beisammen fand. Kochs „Reiseberichte über Rinder- und Bubonenpest in Indien” neben Richard Wagners Werken; einige Bände der „Medizinischen Wochenschrift” neben Schopenhauer, Haeckel, Zola; ein Band Kant, Sophokles, Pasteur, Goethe, Czernys Krebsforschungen nachbarlich beieinander. Nichts aus der bunten Reihe lockte ihn. Mit leeren Händen setzte er sich in den rohrgeflochtenen Schaukelstuhl.
Ganz so unbegreiflich und kompliziert, wie Doktor Markwaldt sich seinen Kollegen Max Perthes dachte, war er wahrhaftig nicht. Er gehörte nur zu den Naturen, die länger und mühevoller als andere nach einem Ausgleich ihrer inneren Widersprüche suchen, weil diese Widersprüche tiefer sind und ein unbändiges Temperament sie eher verschärft als mildert. Väterlicherseits aus einem endlosen Geschlecht wackerer, nüchterner Landärzte in der Pfalz stammend, mütterlicherseits der Abkömmling einer einst hochangesehenen Gelehrtenfamilie am Niederrhein, hatte er sich, früh verwaist, nach seinem Abiturium mit einem beinahe fanatischen Wirklichkeitsdurst auf die Naturwissenschaften gestürzt. Auf Chemie und Physik, auf Botanik, Zoologie und Physiologie hatte er sich wahllos neben- und nacheinander geworfen. Spielend bemächtigte sich sein beweglicher Geist des Stoffes und wußte ihn zu durchdringen. Dann trat jäh und heftig die Übersättigung[S. 37] ein. Es war, als trete sein Herz beiseite und lehne sich auf gegen die trockene und einseitige Arbeit des Kopfes, die es noch eben freudig zu teilen schien. Mit einem herzhaften Entschluß ging er zur Medizin über. Die Verbindung von Wissen und Praxis mußte seinen ursprünglichen und seinen ererbten Anlagen mehr entsprechen, als die bloß beschreibende Erforschung der Natur. Mit fünfundzwanzig Jahren machte er sein Examen und baute bald darauf seinen Doktor in Chirurgie. Mit der Befriedigung war es auch schon zu Ende. Dieselbe Jagd, in der ein unstetes Herz den Kopf von einem Gegenstand zum anderen riß, begann von neuem. Von der Chirurgie ging er zur inneren Medizin, von dort zur Augenheilkunde über. Die praktische Tätigkeit war so eng, so gleichförmig, so unfruchtbar. Ein kleines Vermögen, über das er unabhängig verfügen konnte, zehrte sich in diesem Hin und Wider der Neigungen langsam auf. Er fühlte den moralischen und wirtschaftlichen Zwang, sich Halt zu gebieten. In der unwiderruflichen Absicht, sich in einem Fachgebiet festzufahren, hatte er die Assistentenstelle am Bakteriologischen Institut übernommen. Hier wollte er aushalten und sich durchsetzen, eine Lebensstellung gründen um jeden Preis. Wenn er seinem Vorsatz treu blieb und seine Arbeiten nur einigermaßen von Erfolg begleitet waren, reichten seine Mittel aus, um sich zu einer Professur durchzuschlagen.
Wenn, ja wenn ... Perthes legte die langen, nervigen Hände mit den Fingern ineinander und spannte sie vor der Stirn, daß sie in den Gelenken knackten. So viel Kraft in sich zu fühlen und so wenig Herr über seinen Willen werden zu können! Seit Wochen fühlte er das[S. 38] Bohren und Quälen in sich, das einer neuen Krisis vorauszugehen pflegte. Mit Händen und Füßen wehrte er sich gegen diese Erkenntnis. Wo hinaus wollte er? Wo gab es noch eine geistige Aufgabe, die er an sich reißen konnte, um sie wieder von sich zu stoßen? In ihm wuchsen und wiederholten sich immer häufiger die Stimmungen, die ihn in allen Wissenschaften nichts mehr sehen ließen, als eine einzige unselige Verbildung. Er hatte schon früh in der Pflege und Ausbildung seiner körperlichen Kräfte ein Gegengewicht gegen die innere Unausgeglichenheit gesucht. Neuerdings übertrieb er, wie er alles übertrieb, diese physische Abmüdung in jenen oft wochenlangen Anfällen, in denen er für Markwaldt statt eines Strebers ein ausbündiger Faulenzer war. Auf die Dauer verfingen solche Radikalkuren immer weniger. Seine Entwicklung drängte ziemlich spät, aber unfehlbar auf eine Entscheidung, die nicht in der Wissenschaft, sondern nur im wirklichen Leben ausgefochten werden konnte. Nicht mehr darauf kam es für ihn an, ob er für seinen Kopf eine erträglich befriedigende Lösung für tausend und ein Welträtsel fand; ein unterdrücktes, vernachlässigtes und verleugnetes Gemütsleben verlangte sein Recht gegen die nüchterne, materialistische Kultur des Verstandes. Er stand, ohne sich darüber mehr als ahnungsweise klar zu sein, vor dem Kampfe, der über den vollen Menschen, seinen Charakter und sein Schicksal entschied. Es bedurfte nur eines geringen Anlasses von außen, und er mußte zum Ausbruch kommen.
Perthes' Gedanken nahmen jetzt ihre Richtung wieder nach dem Landhaus aus rotem Sandstein, jenseits des Flusses, das er zuvor fixiert hatte. Eigentlich hatte er die Sache vergessen wollen. Vor zehn oder vierzehn Tagen[S. 39] — oder war es so lange noch nicht? — war er am Abend, als er nicht wußte, was er tun sollte, in den Stadtgarten gegangen, um etwas Musik zu hören und Menschen zu sehen. Es war Sonntag und sommerlich warm. Zwei-, dreimal schritt er den Rundweg ab, den boshafte Menschen das „Heiratskarussell” getauft hatten. Endlos wälzte sich da im Schein der hellen Bogenlampen ein Strom von geputzten jungen Mädchen aus der Bürgerschaft und von buntbemützten Studenten im Kreise mit- und gegeneinander. Die Pärchen suchten und fanden sich in einem Kreuzfeuer von Blicken. Erst wurde die Angebetete mit feierlich-ernstem Kappenschwenken begrüßt, dann angesprochen und flirtend begleitet.
Anfangs hatte ihm das Treiben Spaß gemacht. Bald langweilte es ihn, und er setzte sich vor den Musikpavillon, wo die Stadtkapelle, ein leidlich braves Orchester, in Ouvertüren, Sinfoniesätzen und Tänzen sich und anderen gütlich tat. Während er den Tönen nachträumte und dabei gedankenverloren in das drehende Gewühl der Menschen starrte, traf sich sein Blick zufällig mit dem eines jungen Mädchens, das im Gespräch mit einem Burschenschafter, einem kecken, welterobernden Frankonenfuchs, vorüberging. Die großen vergißmeinnichtblauen Augen ruhten halb ernst, halb schelmisch eine Sekunde in den seinen. Ohne daß er sich etwas dabei dachte, wiederholte sich dies flüchtige Blickspiel ein zweites und drittes Mal. In ihrem duftigen Rosakleidchen mit dem offenen, auf die Schultern herabfallenden Blondhaar war die Kleine, halb erwachsen, halb Kind, eine Erscheinung von zartem, poetischem Reiz. Er hätte sie vergessen, wenn sie ihm nicht am Vormittag darauf, mit dem Marktkorb unter dem[S. 40] Arm, begegnet wäre, als er zum Institut ging. Sie trug die Haare aufgesteckt und schritt sehr gesetzt und geradeausblickend an ihm vorüber. Am Nachmittag des folgenden Tages sah er sie mit der Musikmappe in der Hauptstraße. Einer scherzhaften Anwandlung nachgebend, folgte er ihr über die Neue Brücke und entdeckte ihre Wohnung. An einem der nächsten Abende ging er — es war dies einer seiner regelmäßigen Spaziergänge — am jenseitigen Ufer spazieren. Sie saß handarbeitend auf dem Balkon. Perthes liebte es, die Sonne über dem Fluß untergehen zu sehen. Er hatte keinen Grund, von einer angenehmen Gewohnheit abzuweichen, und tat es jetzt nur insoweit, als er regelmäßig im Vorbeigehen hinaufsah, während sie heruntersah. Gestern war sie ihm wieder mit dem Marktkorb begegnet. Sehr würdig und ernst. Kaum daß ihn die großen, glanzvollen Augen streiften. Aber sie verlor zufällig ihren Handschuh. Perthes hob ihn auf. Er sprach sie an. Es ergab sich von selbst, daß er sie ein paar Schritte begleitete. Mit reizendem Widerstreben ließ sie es geschehen. Einige belanglose Redensarten wurden ausgetauscht. Sie sprach mit einer allerliebsten Mischung von Altklugheit und Kindlichkeit. Während der Arbeit im Institut dachte er bisweilen an sie. Wie man an eine liebenswürdige Landschaft denkt. Man ruht sich in ihrer Erinnerung aus und mochte sie wiedersehen. Heute, am frühen Morgen, als er zwischen Veranda und Zimmer unter der Tür seinen Kaffee hinunterjagte, ertappte er sich zum erstenmal dabei, wie er das bewußte Sandsteinhaus zwischen den alten und neuen Giebeln jenseits des Flusses suchte und fand. Jetzt kam er sich albern vor. Um es nicht noch mehr zu werden, beschloß er, von[S. 41] nun an die Sonne vom diesseitigen Ufer untergehen zu sehen.
Während er sich noch immer im Schaukelstuhl wiegte, schien ihm der heldenhafte Entschluß, auf eine freundliche Gewohnheit zu verzichten, noch lächerlicher als die ganze Geschichte. Das Weibliche hatte in seinem Leben stets nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Was er von Frauen kannte, verdiente kaum diesen Namen. Der beliebte medizinische Zynismus diente ihm als Schild wie gegen alle Empfindsamkeit so gegen eine seelische Überschätzung des Weibes. So wollte er es wenigstens. Warum sollte er es nicht auch, wie andere, mit einer harmlosen Spielerei versuchen, der er in jedem Augenblick ein Ende machen konnte — morgen, übermorgen so gut wie heute? War er nicht schon schwerlebig genug? Das fehlte noch, daß er spröde mit sich tat wie eine alte Jungfer!
Mit einem entschiedenen Ruck sprang er von seinem Rohrsessel auf, setzte den Hut auf und war wieder auf der Straße.
Es war später als sonst, als er auf die Brücke kam.
Die Dampfstraßenbahn, die nach den Dörfern in der Ebene fuhr, rollte lärmend an ihm vorbei. Heimkehrende Spaziergänger, verspätete Arbeiter, Kinderwagen, eine auswärtige Knabenschulklasse, die zum Bahnhof eilte, drängten an ihm vorbei.
Perthes war froh, als er die Treppe hinuntersteigen konnte, die nach der stilleren Uferstraße führte.
Die Platanenallee, die er hinaufschritt, führte zwischen Rasenanlagen hindurch, am Bootshaus des Ruderklubs vorbei. Es war schon geschlossen. Die Wiese zwischen der Allee und dem Fluß war sonst gegen Abend der[S. 42] Tummelplatz eines Fußballklubs. Auch sie war heute schon verödet. Keine Menschenseele begegnete ihm. Die Villen zur Rechten schienen wie ausgestorben.
Jetzt war er dicht bei dem bewußten Hause. Zwischen den Bäumen durch konnte er auf Erker und Balkon des Landhauses sehen. Sein „Ufermädchen”, wie er sie hieß, saß nicht da, nicht dort.
Enttäuscht schlenderte er weiter, ans Ende der Allee, wo die Anlagen und die Villenstraße aufhörten und die Obstgärten anfingen. Er bog nach der Wiese hin ab und näherte sich dem Wasser.
Über blühende Schlehenbüsche weg blickte er hinaus auf den Fluß, der seine Wellen in die Ebene wälzte. Die Sonne stand, eine feurige Kugel, darüber, umglüht von violettem, purpurnem und silberweißem Gewölk.
Das Schauspiel, das er liebte, machte ihn heute melancholisch. Er fühlte eine Leere in sich und kam sich einsamer vor als sonst. Kein Zweifel: es war, weil er Hilde König, das kleine Mädel mit den losen Haaren und den lockenden blauen Augen nicht in seiner Nähe wußte. Wie läppisch das war! Und doch konnte er nicht dagegen an.
Verdrießlich trat er den Rückweg an.
In einem Vorgarten wurde mit Wasser gesprengt. Die Luft war voll von dem frischen Geruch des genetzten Grases. Die Stadt, die jetzt rechts vor ihm lag, schmiegte sich im matten, rötlichen Licht der versagenden Sonnenstrahlen mit ihren zackigen Dächern und steilen Türmen friedlich gegen die verschwimmenden Berge. Von einer der Kirchen klang die Abendglocke herüber.
Der Balkon, nach dem Perthes von neuem spähte, blieb leer.
[S. 43] In der Ferne sah er jetzt zwei jugendliche Gestalten die Allee herunterkommen. Sie gingen Arm in Arm. Er meinte in der einen von ihnen Hilde König zu erkennen. Es war eine Täuschung. Unweit von ihm, bei einer Bank, trennten sie sich. Das größere der beiden Mädchen eilte mit lebhaftem Schritt nach dem nächstgelegenen Landhaus; das zurückbleibende setzte sich, offenbar um zu warten, auf die Bank. Sie trug unter dem leichten, offenen Mantel eine beigefarbene Bluse zum dunklen Rock und über dem hellen Haar einen einfachen englischen Strohhut mit schwarzem Band.
Gleichgültig ging Perthes vorüber. Kaum mit einem flüchtigen Blick streifte er das Gesicht der Wartenden.
Ein paar Schritte weiter blieb er stehen. Es durchzuckte ihn plötzlich, als wäre er diesen zarten und doch festen, ausdrucksvollen Zügen schon irgendwo und irgendwann begegnet. Wie zufällig wandte er sich um. Das junge Mädchen hatte jetzt einen Arm mit dem Ellbogen aufs Knie und den vorgeneigten Kopf mit dem Kinn auf den Handrücken gestützt. Die Augen, erst zur Erde gesenkt, sahen auf, als hätte sie gehört, daß sein Schritt innehielt, und suchten die Stelle, wo er stand. Das unsichere Irren des Blickes verriet ihm ihre Blindheit. Er erkannte jetzt das mattfarbene Gesicht mit den etwas knochigen Wangen, die runde, ebenmäßige Stirn, über die das Haar, unter dem Hut vorquellend, mit einer aschblonden Welle niederfiel. Er konnte sich nicht täuschen, es mußte Marga Richthoff sein.
Sie schien zu fühlen, daß sie beobachtet wurde. Unruhig wandte sie den Kopf weg und zurück, in der Richtung des Hauses, in dem ihre Begleiterin verschwunden war.
[S. 44] Perthes folgte einer impulsiven Regung und ging gerade auf sie zu.
Sie fuhr unwillkürlich etwas zurück.
„Erschrecken Sie nicht, Fräulein Richthoff —”
„Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind,” kam es zurückhaltend, aber furchtlos von ihren Lippen.
„Doktor Perthes,” sagte er einfach. „Ich habe Ihrem Herrn Vater dieser Tage meine Aufwartung gemacht. Als alter Bekannter von Hemsbach her kann ich nicht so grußlos an Ihnen vorübergehen.”
Marga, obwohl zuerst verdutzt, fand sich schnell zurecht. „Das ist nett von Ihnen,” erklärte sie offen. Eine sichtliche Freude belebte ihr Gesicht. Wie einem alten Kameraden bot sie ihm die Hand. „Papa hat von Ihrem Besuch erzählt. Ich war ganz erstaunt, daß Sie Ihr Versprechen nicht vergessen hatten.”
„Sie scheinen ja meinem Gedächtnis wenig Gutes zuzutrauen.” Perthes fühlte sich fast beschämt. Daß er sich an die Empfehlung, die ihm sein Onkel Schlutius, der Germanist in Bonn, für Richthoff mitgegeben, erinnert hatte, war ein Zufall und die Ausführung des Besuchs eine Laune gewesen.
„Es wäre noch nichts Böses gewesen, wenn Sie den dummen, eigensinnigen Backfisch von damals aus dem Gedächtnis verloren hätten,” meinte Marga.
„Na, na — so schlimm war die Sache mit Ihnen nicht.”
„O ja!” versetzte sie ernsthaft. „Ich dachte gerade in diesen Tagen daran, wie trotzig und unleidlich ich damals war. Wissen Sie noch — der Direktor hatte mich schon halb und halb aufgegeben, nur Sie ließen sich nicht abschrecken und ruhten nicht, bis ich die Buchstaben doch[S. 45] noch tasten lernte. — Ich war damals zu unglücklich, um vernünftiger und gelehriger zu sein,” setzte sie nachdrücklich hinzu.
„Und jetzt? Wie steht's mit dem Lesen und Punktieren?” forschte Perthes.
„Ganz ordentlich. Wenn Sie einmal zu uns kommen —” Marga stockte einen Moment. Es fiel ihr ein, sie möchte zu vertraulich sein. Ihrer Natur nach gab sie sich harmlos oder gar nicht. Aber sie wurde oft von den Schwestern und sogar von Papa deshalb getadelt.
„Natürlich komme ich einmal. Wenn man mich haben will,” meinte er munter. „Und dann halte ich eine Prüfung ab. Vollschrift, Kurzschrift! Lesen und Schreiben!”
„O weh! Da muß ich mich ja vorher richtig vorbereiten. Sonst blamiere ich mich unbarmherzig,” erwiderte Marga mit leisem Lachen.
„Wir werden ja sehen.” Er hörte Schritte jenseits der Allee. „Ihre Freundin kommt zurück.”
„Meine Schwester.”
„Also — auf Wiedersehen!” Er ergriff Margas Hand und schüttelte sie herzhaft.
Ehe sie seinen Gruß erwidern konnte, setzte Perthes, freundlich den Hut schwenkend, seinen Weg fort. Die unerwartete, so ungezwungen freundschaftliche Begegnung hatte ihm wohlgetan. Seine Verstimmung war gewichen. Mit großen Schritten ging er nach der Brücke und heimwärts. Er dachte sogar daran, nach dem Abendessen an den Klinikertisch zu gehen. —
Ganz aufgeregt kam Käthe auf Marga zu. „Wer war denn das?” fragte sie neugierig und vorwurfsvoll zugleich, während sie dem Davonschreitenden erstaunt nachblickte.
[S. 46] „Doktor Perthes hat mich begrüßt,” erklärte Marga freimütig. Mit anschmiegender Zärtlichkeit, in der ihre innere Erregung nachklang, hängte sie sich an den Arm der Schwester. „Er war reizend. Ganz der alte.”
„Hat er dich so mir nichts, dir nichts einfach angesprochen?”
„Natürlich! Warum auch nicht?”
Sie gingen langsam die Allee hinunter.
„Aber das tut man doch nicht,” fuhr Käthe kopfschüttelnd fort. „Eine Dame — auf offener Straße —”
„Ich hätte es viel unnatürlicher gefunden, wenn er stocksteif vorbeigegangen wäre,” versicherte Marga überzeugt. Sie war beglückt von ihrem bescheidenen Erlebnis und wollte sich nicht auf solche gesellschaftliche Haarspaltereien einlassen, die ihr ein unverständlicher Greuel waren.
Käthe schwieg. Das war ein Zeichen, daß ihr gesittetes Gewissen Margas leichtere Auffassung nicht guthieß.
Als sie auf der Brücke anlangten, begann es leise zu dämmern. Die roten Wolken über dem Fluß verblaßten, und der Ostwind blies aus den Bergen nach der Ebene. Wenn sie nicht zu spät zum Abendbrot kommen wollten, mußten sie ihre Schritte beschleunigen.
Marga war es zufrieden und fröhlich ums Herz. Mit ihren leichten, glücklichen Schritten konnte Käthe fast nicht mitkommen. Sie fühlte sich unwillkürlich und unbewußt gereizt. Ob sie wollte oder nicht: sie mußte ein wenig Wasser in Margas fröhlichen Wein gießen. „Weißt du,” begann sie bedächtig, „Lizzie hat mir erzählt,” — Lizzie war die Freundin, bei der sie in der Uferstraße für eine Minute eingeschaut hatte, um Noten zurückzubringen —[S. 47] „daß dein Doktor Perthes Abend für Abend dort herumspaziert.”
„Es wird ihm dort gefallen. Er wird sich an den Sonnenuntergängen über dem Wasser freuen,” meinte Marga lebhaft.
„Er soll nicht bloß deshalb kommen, sondern —”
„Sondern?” fragte Marga harmlos neugierig.
„Er macht Hilde König den Hof,” entfuhr es Käthe. „Er soll sie öfters mal ans Haus begleitet haben. Das spricht nicht gerade für seinen Geschmack. Denn das unschuldige Kind läßt sich ja von jedem jüngsten Studenten die Cour schneiden.” Es war, ohne daß sie es wollte, ein Ton von selbstgerechter Schärfe in ihre Worte gekommen.
Marga verlangsamte ihre Schritte. Wenn Käthe sie in diesem Moment angesehen hätte, hätte sie bemerkt, daß ihre Wangen und ihre Lippen sich leise verfärbten. Der kleine, mehr weibliche als schwesterliche Pfeil traf mitten in Margas unschuldige Heiterkeit. Sie schüttelte betroffen den Kopf. Sie konnte das nicht glauben. Gerade dieses oberflächliche kleine Mädel, das alle Welt für sein weites Herz kannte, das sollte ...
„Das ist seine Sache,” sagte sie nach einer Weile ruhig und mit möglichster Gelassenheit. Sie hatte ihren Arm in dem der Schwester gelockert, als könnte das Pochen ihres Herzens Käthe verraten, daß ihr diese Nachricht wehe tat. Aber warum auch? Sie schämte sich schon der törichten Anwandlung und hakte wieder fester unter. Fast im Laufschritt ging es jetzt über den Bahndamm weg, die Straße am Wenzelsberg hinauf und dem väterlichen Hause zu.
Anfangs hatte sich der Geheimrat mächtig gesträubt. In diesem Sommer wollte er von einer größeren Einladung bestimmt nichts hören. Einmal drängte es nicht, dann war es überhaupt ganz überflüssig.
Käthe, die es wagte, Anfang Juni direkt in die Höhle des Löwen zu gehen und ihm ein Gartenfest vorzuschlagen, wurde beinahe hinausgeworfen. Elli, die mitunter Andeutungen in die Unterhaltung warf — über das unerwartet schöne Wetter, über die wundervollen warmen Abende, über die Vorzüge, die es hätte, gerade jetzt, wo noch nicht alle Welt einem zuvorgekommen, gewisse Verpflichtungen zu erfüllen —, fand taube Ohren und bekam schließlich eine grimmige Bemerkung über die Vergnügungssucht junger Mädchen von heute an den Kopf. Marga dachte wohl manchmal daran, daß sie gern mit Doktor Perthes plaudern möchte. Aber sie schwieg. Es wäre zu ungewöhnlich gewesen, wenn sie, die stets widerstrebend an den häuslichen Gesellschaften teilgenommen, die Schwestern plötzlich unterstützt hätte.
Mitte Juni erklärte Vater Richthoff eines Morgens beim Frühstück, es sei doch merkwürdig, daß er an alles denken müsse. Warum man denn heuer die üblichen Einladungen nicht ergehen lasse? Da man ja doch in den sauren Apfel beißen müßte, wäre es das Netteste, die Jugend mal in den Garten einzuladen. Seine Mädels wären Schlafmützen.
Die Gescholtenen horchten hoch auf. Natürlich wagte niemand auch nur mit einer Silbe daran zu erinnern, daß man je selber an so was gedacht habe.
[S. 49] Elli, der das Herz im Leibe lachte, wandte ein Übermaß von Selbstbeherrschung auf, um nicht vom Stuhl aufzufahren. Es war nicht verwunderlich, daß sie Margas halbvolle Tasse umstieß. Käthe, praktisch wie sie war, wußte, daß eine solche Gelegenheit väterlicher Herablassung nicht wiederkehrte, und holte ihre Liste. Sie hub an, die Namen zu verlesen, und über die Morgenzeitung weg brummte der alte Herr zu den Vorgeschlagenen seine Zustimmung. Jetzt nannte sie Erich Wilkens.
„Hört in diesem Semester nicht bei mir,” erklärte ablehnend der Geheimrat.
„Aber er hat Besuch gemacht, Papa! Vorigen Sonntag!” fuhr es Elli heraus.
„Hat er?” gab der alte Herr gutmütig-spöttisch zurück und traf Elli mit einem scharfen Blick über die Brillengläser weg.
Elli ward rot bis über die Ohren. Sie mußte ihr Schuhband festknüpfen, um Verlegenheit und Enttäuschung zu verbergen. Marga strich leise beruhigend ihren Arm.
„Also nicht?” fragte Käthe mitleidig zögernd.
„Meinetwegen,” lautete der erlösende Bescheid.
Elli mußte vor Freude Margas Hand so überkräftig drücken, daß diese um ein Haar aufgeschrien hätte.
Doktor Perthes kam als letzter. Der Geheimrat hatte keine Ahnung mehr. Marga zuckte nicht mit den Wimpern, als Käthe ihm den Hemsbacher Arzt ins Gedächtnis brachte. „Ach der!” meinte er gedehnt. „Na ja — wenn Marga es nicht anders tut.”
„Du hast ja selbst gesagt, er soll auf die Liste kommen,” erklärte Elli kühn, um der Schwester zu Hilfe zu kommen.
[S. 50] Marga rührte sich nicht. Sie schien die Fransen an der Kaffeedecke zu zählen.
„Aber dann Schluß! Die Mädels dazu wählt gefälligst selber aus. Und mich laßt mit allem Drum und Dran aus dem Spiel. Kosten darf die Sache nichts, und stören darf sie mich auch nicht.”
Der Geheimrat erhob sich. Er war jetzt wieder ganz der gestrenge und unwirsche Herr und Gebieter, der sich nicht länger um solche Läppereien kümmerte. Fast schien ihm die Sache wieder leid zu tun.
„Nur noch den Tag, Papa!” bat Käthe. „Wir müssen doch wissen, wann dir's am besten paßt.”
Der Geheimrat war schon aus der Tür und stieg in sein Zimmer hinauf. Er hatte gestern in seiner Kaisergeschichte den segensvollen Titus porträtiert. Jetzt kam er zu dem unsympathischen und grausamen Domitian. Mit der Gnade und Milde war es zu Ende.
Doch zum Glück für das Haus ergaben Richthoffs erneute Forschungen, daß der böse Flavier unter seiner Großmannssucht und rohen Härte die besseren Anlagen seines Hauses wenigstens in seinen Anfängen nicht ganz verleugnete. So wurde es möglich, daß man dem Geheimrat doch auch noch den Termin für das geplante Gartenfest ablocken konnte.
Was gab es dann aber auch alles am Wenzelsberg zu tun! Die Einladungen mußten geschrieben werden. Es galt, den Lohndiener und die Kochfrau zu bestellen. Dann kam das Menü. Das las der alte Herr zwei Tage lang nicht, obwohl Käthe es ihm mit aller Liebe und Sorgfalt bei jeder Mahlzeit neben die Serviette legte. Am dritten Tage steckte er es in die Tasche und schickte[S. 51] es am fünften als völlig unbrauchbar zurück. Nur mit List konnte er schließlich gezwungen werden, Gegenvorschläge zu machen. Mit der Bemerkung, daß die Weibsleute nicht einmal von der Küche etwas verständen, ergriff er selbst das Kochbuch und verlangte die unmöglichsten Gerichte. Das Ungeheuerlichste war, daß er allen Einwendungen zum Trotz auf einer Suppe bestand, einer für eine Abend- und Gartengesellschaft allem Herkommen hohnsprechenden Ouvertüre. Er wollte in Italien eine Wildsuppe gegessen haben, die unbedingt ausprobiert werden mußte, ein unheimliches, höchst apartes Gemächte, von dem er sich für sich und seine Gäste Wunder versprach. Käthe konnte nicht mehr erreichen als ein Kompromiß: dafür, daß er die übrigen Gänge genehmigte, mußte ihm die abenteuerliche Suppe zugestanden werden.
Langsam kamen die Zu- und Absagen.
Je größer die Spannung war, mit der seine Mädels die Post erwarteten, um so weniger eilig hatte es der Geheimrat mit dem Öffnen der Briefschaften. Für Elli gab es Folteraugenblicke am Frühstückstisch. Sie hatte schon die Hoffnung aufgegeben, daß Wilkens käme. Endlich schrieb er zu. Doktor Perthes machte zwar eine korrekte sonntägliche Aufwartung, bei der er seine Karte abgab, aber zusagende Antwort schickte er erst am Abend vorher. Er entschuldigte seine Vergeßlichkeit, wollte aber gern kommen. Käthe konnte es nicht unterlassen, zu bemerken, daß Mediziner das „immer” so machten.
Marga blieb ihr eine Antwort schuldig. Es waren widersprechende Gefühle, mit denen sie an Perthes dachte. Sie verschloß das Hin und Her ihrer Empfindungen nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. Es[S. 52] lag in ihrer Art, daß sie das Unklare und Unfertige von sich schob, weil es sie lähmte und schwächte. Ihre Seele brauchte in ihrer Einsamkeit ungeteilte Kraft, um gesund zu bleiben. Sie hatte ihn seit jener flüchtigen Begegnung am Fluß nicht mehr gesehen. Fast regelmäßig machte sie mit einer der Schwestern, meist mit Elli, gegen Abend einen Bummel. Früher waren sie oft die Uferstraße entlang gegangen. Marga ließ sich dann die Sonnenuntergänge bis ins einzelne schildern und genoß Farbe und Stimmung in ihrer lebendigen Phantasie. Jetzt mied sie diesen Gang. Die Zurückhaltung kostete sie mehr, als ihrem stillen Wesen anzumerken war. Es gab Augenblicke, in denen sie sich dabei überraschte, ein sicheres Bild von ihm zu gewinnen. Die Frage peinigte sie, ob er nur aus gewöhnlichem Mitleid, aus Zufall oder Laune sich ihrer erinnert hätte. Oder ob er ein gewisses Verständnis für ihr Wesen hätte, eine teilnehmende Freundschaft für sie empfände. Und derselbe Mensch sollte an einem leichtmütigen Geschöpf wie Hilde König Gefallen finden? Spielte er nur mit seinen Gefühlen? War er von Natur ernst und gehaltvoll? Oder war er oberflächlich und leer? Ihre Erfahrung gab ihr keine Auskunft. Und sie wollte keine. Sobald sie sich über unnötigen Grübeleien ertappte, dachte sie gewaltsam an anderes.
Je näher der große Abend des Gartenfestes kam, um so weniger fehlte es an Umtrieb und lustiger Geschwätzigkeit. Die Toiletten mußten zwanzigmal besprochen werden. Es wurde auf Leben und Tod genäht. Die Tischordnung gab eine Fülle von Stoff zu immer neuen Diskussionen. Bis endlich auch dieses Ereignis zur Wirklichkeit wurde.
[S. 53] Man hatte an kleinen Tischen im Hof gedeckt.
Das Haus mit seiner Rückwand von Reblaub und Glyzinen auf der einen, der blumenreiche, sommergrüne Weinberg auf der anderen Seite stimmten festlich zu den weißen Tafeltüchern. Den Tafelschmuck hatte Marga ausgedacht. Das war eine besondere Stärke von ihr. Sie gab ganz bestimmte Weisungen, wie sie jeden Tisch innerlich vor sich sah, und Elli führte sie unter lautem Beifall aus. Bald war es ein Gerank von Rosen, das den silbernen Aufsatz umschloß und in duftigen Ketten zwischen die Teller fiel, bald waren es zierliche Kränze von Stiefmütterchen, die die Gedecke besäumten, Sträuße von Margueriten oder blauem Akelei, die in den Servietten steckten. Leuchter mit winzigen bunten Lichtschirmen standen munter dazwischen, und Papierlaternen in gekreuzten Zügen überspannten den Hof von einer Ecke zur anderen. Der Geheimrat, der zufällig einmal während der Anordnung herunterschneite und den Kopf in den Hof streckte, brummte etwas von einer „Blumentrödelbude”, klopfte aber dabei Marga so kräftig auf den Arm, daß sie mit seiner Anerkennung zufrieden sein konnte.
Es war sechs Uhr geworden.
Die Zeit reichte gerade knapp hin, um sich anzuziehen, und die Mädels flogen nach ihrem Dachstock.
Fünf Minuten vor sieben standen sie fix und fertig im Salon. Marga und Elli trugen weiße Tüllkleider. Käthe als älteste prangte in leichter erdbeerfarbener Seide. Das beste war der frische, unschuldige Reiz der Jugend, der wie ein leichtes, helles Lachen von ihnen ausging, wie sie so am Flügel beieinanderstanden. Aus Ellis Augen blitzte der Schalk; in dem ungebärdigen Gewirr ihrer[S. 54] lichten Haare, mit ihrem schlanken, zierlichen Figürchen sah sie wie der Frühling selber aus. Käthe, ein Gewinde von Silberfiligran, ein Erbstück der Mutter, über den dunklen Flechten, gab sich etwas gemessener und selbstbewußter: sie fühlte sich halb und halb als Dame des Hauses. Zwischen beiden stand Marga: von der bezaubernden Leichtigkeit Ellis und der etwas herben Sicherheit Käthes war sie gleichweit entfernt: die weiche Lässigkeit ihrer Bewegungen und der versonnene Ernst ihrer Züge waren nicht dazu angetan, zu bestechen oder zu erobern. Sie wirkte wie ein Bild, das man übersehen zu haben glaubt, um nachher zu finden, daß es kraft eines unbestimmbaren inneren Reizes lebendiger als alle anderen im Gedächtnis haftet.
Noch immer kam Vater Richthoff nicht. Er hatte sich, natürlich zu spät, an seine Festtoilette gemacht. Dann war ihm mitten im Anziehen ein Gedanke gekommen, den er dringend für seine Kaisergeschichte notieren mußte. In einem mehr antiken als modernen Kostüm eilte er in das an sein Schlafzimmer anstoßende Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch.
Die Klingel meldete den ersten Gast. Die Mädels im Salon waren in heller Bestürzung. Elli wagte es: sie schoß die Treppe hinauf und pochte an die Tür des alten Herrn.
„Bitte, bitte, Papa! Eil dich! Die Gäste kommen!” rief sie eindringlich und flehend.
Ein dumpfes Murren antwortete aus dem Arbeitszimmer.
„Es hat schon der erste geklingelt!” setzte Elli beschwörend hinzu.
[S. 55] „Wollt ihr wohl das verwünschte Gehetze lassen. Ich komme ja!” dröhnte es zürnend zurück.
Elli glitt wieder die Treppe hinunter.
Zum Glück war nur etwas für die Küche abgegeben worden.
Die Gäste ließen auf sich warten.
Als der Geheimrat einige Minuten später in den Salon trat — im flatternden Gehrock, die lange goldene Uhrkette auf der von Käthe zu Weihnachten und Ostern gestickten Weste, die dünnen weißen Haare über dem Scheitel und an den Schläfen festgestrichen —, erklärte er ganz empört: „Wo sind denn nun eure Gäste? Natürlich komme ich eine halbe Ewigkeit zu früh!”
Die halbe Ewigkeit dauerte kurz.
Schon öffnete sich die Tür, um sich nicht so bald wieder zu schließen. Im Handumdrehen füllte sich der geräumige Salon. Begrüßungen, Vorstellungen, Freundschaftsbezeugungen schwirrten durcheinander.
Da kam Papa Wilmanns, ein kleiner, lauter, lustiger, hinkender Altphilologe, und seine Gattin, ein stilles, ewig lächelndes, über ihren Mann verwundertes Frauchen. Hinter ihnen drei Töchter, alle flachsgelb von Haar, fast gleich in der Größe, gleich in den Augen und gleich in den lila- und weißgemusterten Kleidchen. Es ging die Sage, daß sogar ihre Eltern sie bisweilen verwechselten.
Der nächste war Trabner, der Flanellstorch, wie Elli der neben ihr stehenden Marga kichernd ins Ohr meldete. Er trug heute übrigens einwandfreie weiße Wäsche und einen Rock, der ihn nach oben und unten in die Unendlichkeit verlängerte. Sein pockennarbiges Vogelgesicht mit den paar Kinnstoppeln zuckte unaufhörlich, man wußte[S. 56] nicht, ob aus Ehrerbietung oder Nervosität. Der zwerghafte Papa Wilmanns sah staunend und beneidend an ihm hinauf. Als Trabner vor dem Geheimrat seinen jähen und tiefen Bückling machte, trat der gute Wilmanns unwillkürlich mit offenem Mund einen Schritt näher und streckte die Arme vor, als gelte es, einen Einsturz aufzuhalten.
Zwei Studenten, blauweiße Bänder um die Brust, blaue Mützen in der Hand, drängten sich nebeneinander zur Tür herein. Sie gehörten der Verbindung Corvinia an, die böse Zungen das „Betkränzchen” nannten und in Verruf brachten, Zuckerwasser statt Bier zu trinken. Elli verbarg sich hinter Margas Rücken und steckte das Taschentuch in den Mund, um nicht loszuplatzen. Inzwischen schritten die beiden in feierlich-plumpem Gleichtritt auf Vater Richthoff zu. Ihre forciert-couleurmäßige Haltung stand in so köstlichem Gegensatz zu ihrem ungehobelten Bauerntum, daß auch Käthe sich auf die Lippen biß.
Ein dicker, jovialer Burschenschafter, der mit seinem Leibfuchs, einem geckenhaften und schmächtigen Bengelchen, zufällig hinter den Corvinen ankam, zog über sein ganzes Gesicht, so rot und zerhauen, wie es war, eine Grimasse, als die Betkränzler beiseite traten. Mit freier, dröhnender Bierstimme begrüßte er Richthoff, der selber „alter Herr” bei einer Marburger Burschenschaft war.
Es trat eine kurze Pause ein. Noch waren nicht alle Geladenen zur Stelle. Aber der Zufluß zum Salon stockte einen Augenblick.
Es bildeten sich Gruppen. Der Flanellstorch verwickelte pflichtmäßig Käthe in ein Gespräch.
Elli und Marga plauderten mit den drei Wilmannstöchtern.[S. 57] Die zwei Burschenschafter traten kühn dazu und erzählten von ihrer nächsten Damenkneipe. Die zuckerwassersüchtigen Corvinen umstreberten Professor Wilmanns und den Geheimrat, während Frau Wilmanns sich selbstgenügsam in ein Familienalbum vertiefte, das auf dem Tisch lag.
Schon tat sich die Tür wieder auf.
Ein derber, struppiger Kopf ward sichtbar, und ein paar runde, graue Augen rollten zwischen unbändigen Büscheln gelblichweißen Haares heraus über das menschenvolle Zimmer.
„Sieh da — Borngräber!” begrüßte Richthoff mit vergnügtem Ruf den Ankömmling.
In komischer Verzweiflung stürmte Professor Borngräber, ein alter Hausfreund, Junggeselle und Indolog, auf den Geheimrat los.
„Aber um Gottes willen! Ihr habt ja richtige Gesellschaft! Ich denke, wir sind drei, vier Personen!” rief er mit hoher, klagender Fistelstimme, während er dem alten Herrn die Hand schüttelte. „Ich bin ja gar nicht feierlich angetan!” Er wies auf seinen moosgrünen, verknitterten Bratenrock, der ihn nicht gerade Lügen strafte.
„Macht ja nichts, alter Freund! So feierlich wird die Sache gar nicht,” versicherte Richthoff beruhigend.
„Ich drücke mich! Hörst du? Ich zieh' mich um!”
„Dageblieben!” Richthoff hielt lachend seine Hand fest.
„Sie haben ja gar keine andere Toga,” schmunzelte Papa Wilmanns boshaft.
Borngräber überhörte ihn entrüstet. Er schlug die Hand vor den Kopf, beteuerte seine Unschuld und widerstrebte nicht mehr. Er kam immer so wie heute. War immer[S. 58] außer sich und wollte fort. Und blieb immer, wenn man ihm gut zuredete.
Jetzt reckte Elli den Kopf. Sie stellte sich auf die Zehen.
Drüben unter der Tür reckte sich ein anderer Kopf ihr entgegen. Blond und kraus wie der ihre. Ein lachendes, verschmitztes Gesicht. Zwei strahlende, siegesgewisse Augen, die in die ihren tauchten. Das war Wilkens.
Kaum war diese stillschweigende Begrüßung erfolgt, so tuschelte Elli mit Marga.
„Doktor Perthes! Dein Doktor von Hemsbach!” verkündete sie, noch aufgeregt von dem Glück, Wilkens gesehen zu haben.
In der Tat zeigte sich Perthes' hochgewachsene Gestalt gleich hinter Wilkens in der Tür. Sein brauner, bärtiger Kopf ragte über die anderen hinaus. Nur der Flanellstorch konnte sich mit ihm messen. Mit dem suchenden Lächeln des Fremdlings überschaute er das Gedränge. Er hatte sich schnell orientiert. Nach Wilkens trat er auf den Geheimrat zu und begrüßte ihn mit unbefangener Höflichkeit.
Der alte Herr sah ihn einen Moment fragend an. Dann besann er sich und schüttelte Perthes die Hand. „Marga erinnert sich Ihrer. Nett, daß Sie kommen. — Kleinchen!” Er erwischte die eben vorbeihuschende Elli an einem Zipfel ihres Ärmels, ehe sie zu dem ersehnten Wilkens durchschlüpfen konnte. „Herr Doktor Perthes — meine Jüngste,” stellte er vor, während er ihr den Arm um die Schulter legte. „Führ' ihn mal zu Marga!” Er deutete aufgeräumt nach der Seite, wo sie stand. Dann mußte er neue Gäste begrüßen: Frau Geheimrat Achenbach, die Witwe eines Kollegen, eine stattliche alte Dame[S. 59] mit gütigen Augen unter schneeweißen Scheiteln, auf einen Krückstock sich stützend; weiterhin einen ehemaligen Schüler und jetzigen Privatdozenten, Bertelsdorf mit Namen, der es kaum erwarten konnte, bis er mit blinzelnder, katzbuckelnder Höflichkeit an die Reihe kam, seinen Gruß anzubringen.
Inzwischen drängelte sich Elli, gewandt wie ein Wiesel, durch die einzelnen Gruppen, Perthes mit übermütigen Gebärden hinter sich her winkend.
Marga stand an der Tür zum Wohnzimmer. Sie hatte sich dorthin zurückgezogen, weil sie sich in dem Geschwirre der Menschen überflüssig vorkam. Es fiel niemand auf, daß sie beiseite trat. Die drei Wilmannsmädchen lachten auch ohne sie über die Aufschneidereien der beiden Burschenschafter. Einsam, mit einem halben, verlorenen Lächeln lehnte sie im Rahmen der Tür.
„Da bring' ich dir Herrn Doktor Perthes, Margakind!” rief ihr Elli schon von weitem entgegen.
Marga richtete sich auf.
„Guten Abend, Fräulein Marga!” begrüßte sie Perthes kameradschaftlich. „Wir haben uns ja furchtbar lange nicht gesehen. Ich dachte immer, ich würde Ihnen mal wieder begegnen. In der Stadt, am Ufer oder sonstwo —”
„Wir sind früher oft dort gegangen,” sprudelte Elli naseweis hervor. „Aber neuerdings — ich glaube, seit Marga Sie dort getroffen hat, will sie partout nicht mehr hin.”
„Aber Elli!” wehrte sich Marga. Doch die Missetäterin war schon lachend davongewischt, um endlich zu ihrem Wilkens zu kommen.
„So, so, Fräulein Marga — Sie weichen mir also[S. 60] aus!” neckte Perthes. „Und warum denn, wenn ich fragen darf?”
„Aber das Kleinchen hat Sie ja angeschwindelt,” erklärte sie ernsthaft.
„Und ich komme Ihretwegen in eine richtige Gesellschaft. Obwohl ich mir vorgenommen hatte, hier gar nichts mitzumachen.”
„Das ist immer noch etwas anderes, als wenn ich Ihretwegen an den Fluß käme,” erwiderte Marga. Ihr Ton war abweisender, als sie wollte. Sie fand sich nicht in eine tändelnde Unterhaltung. Aller Scherz nahm nur schwer den Weg zu ihrer Seele; er machte sie eher scheu und verschlossen als zutraulich. Sie hatte sich wieder an den Türpfosten gelehnt und blickte zu Boden. Ihre ruhige Stirn kräuselte sich einen Moment: ihr offenes Gesicht war nicht darin geübt, ihre Gedanken zu verbergen.
„Was dachten Sie jetzt eben?” forschte Perthes. „Sicherlich nichts Gutes über mich.”
„Sie sind aber eingebildet, Herr Doktor!”
„Ich — wieso?”
„Als ob es nichts anderes zu denken gäbe als —” Marga vollendete den Satz nicht; sie erschrak über ihre eigenen Worte. Sie kamen ungerufen aus ihr hervor. Warum war sie so unfreundlich zu ihm? War sie denn kleinlich? Er hatte von diesem Ufergang gesprochen, von dem sie wußte, daß er einer anderen galt. Es waren nur liebenswürdige Redensarten, wenn er sie damit in Verbindung brachte. Weshalb seine Spielerei? Und doch — als er nun schwieg — tat ihr ihre Äußerung leid. Ohne ihn zu sehen, fühlte sie, daß er sich von ihr weggewandt hatte.
[S. 61] Er schaute in der Tat abgekehrt, mit gekreuzten Armen, auf die vielen schwatzenden Menschen im Salon.
„Sie sind mir doch nicht böse, Doktor Perthes?” fragte Marga mit veränderter, bittender Stimme.
„Warum denn? Ich wundere mich nur, daß Sie heute gar nicht nett zu mir sind.”
„Bin ich das wirklich nicht?”
„Wirklich nicht!” wiederholte er überzeugt.
„Wenn ich Ihnen gesagt hätte, was ich dachte, würden Sie noch unzufriedener mit mir gewesen sein.”
„Oho! Also war's doch was Schlechtes.” Lachend wandte sich Perthes wieder zu ihr.
Margas Züge drückten Unruhe und Verwirrung aus. Die erloschenen Augen mit ihrem sanften blauen Glanz schienen gewaltsam das Dunkel durchdringen zu wollen, um den Ausweg aus diesem unglücklichen Gespräch leichter zu finden. Dann nahm sie die Zuflucht zu ihrer natürlichen Offenheit. „Ich dachte, daß Sie in der Uferstraße jemand anders suchten als mich. Das war alles,” sagte sie kurz und einfach.
Perthes sah sie erstaunt an. Sie wußte also auch bereits, was Markwaldt und alle seine Bekannten wußten — daß er Hilde König nachstieg. Und er durfte ihr nicht einmal böse sein, daß sie es ihm sagte. Er hatte ihr ja ihre Gedanken abgezwungen. Wie peinlich und unbequem diese Mitwisserschaft war! Gerade hier. Er griff sich mit der gebräunten, sehnigen Hand heftig in den Bart. Die Falten auf der Stirn zuckten nervös zwischen den dichten Brauen.
Zum Glück gab jetzt der Geheimrat das Zeichen zu Tisch, indem er Frau Wilmanns den Arm bot.
[S. 62] „Darf ich Sie zu Tisch führen?” fragte Perthes Marga mit einer kurzen Verbeugung.
Sie nickte. Schweigend legte sie ihren Arm in den seinen. Sie wußte nicht, sollte sie sich freuen, daß er sie führte, oder nicht. Sie bereute, daß sie sich hatte verleiten lassen, die Wahrheit zu sagen. Warum hatte er sie gezwungen, und sie sich zwingen lassen?
Plaudernd bewegte sich der Zug der Paare durch das Wohnzimmer und die Eßstube.
An Richthoff und Frau Wilmanns schlossen sich Professor Borngräber und Frau Achenbach, ein sehr ungleiches Paar: sie majestätisch und gemessen, er voll Unbeholfenheit immer einen Schritt voraus oder zurück. Als langjährige Bekannte waren sie trotzdem beide sehr zufrieden miteinander.
Papa Wilmanns bat sich ein für allemal, wohin er kam, ein junges Mädchen zu Tisch aus. Heute, wo man, um der Gemütlichkeit keine Vorschriften zu machen, von einer festgesetzten Tischordnung abgesehen hatte, waren die Jungen schneller gewesen als er und hatten sich schon alle zusammengefunden. Er sah sich verurteilt, Fräulein Grasvogel, eine dürre, etwas spinöse Cousine des Richthoffschen Hauses, die man aus Gutmütigkeit bei keiner Einladung überging, für sich zu erobern. Der kleine lustige Mann, der außerhalb seines Lehramts stets voller Schnurrpfeifereien steckte, schritt mit weltschmerzlicher Biedermannsmiene am Arm der Cousine. In dem beweglichen Gesicht, das sonst so behaglich mit der Hakennase, den Augen einer listigen Spitzmaus und den rosigen Wangen zwischen dem fröhlichen Backenbart saß, lag eine so vorwurfsvolle Anklage, daß Elli, die mit Wilkens hinter ihm kam, nur[S. 63] mühsam ihren Ernst behaupten konnte. Sie nahm sich nur zusammen, weil Käthe mit dem überhöflichen Privatdozenten Doktor Bertelsdorf zur Rechten und dem Flanellstorch zur Linken ihr auf dem Fuße folgte. Käthe war schon durch die in letzter Minute erfolgte Absage Lizzies, ihrer Musikfreundin, betrübt. Elli wollte sie nicht noch durch eine Neckerei erzürnen, die sie auf das seltsame Doppelgestirn ihrer Tischherren beziehen konnte. Der Privatdozent hatte nämlich Käthe dem Flanellstorch vor der Nase weg engagiert; darüber war dieser so fassungslos, daß er sich, kurz entschlossen, rechts von ihr postierte und mit seinem Partner über Käthes Kopf hinweg einen Disput vom Zaun brach — über eine neue Textausgabe von Dio Cassius!
Marga mit Doktor Perthes, die Schwestern Wilmanns mit den Burschenschaftern und Corvinen, einige damen- und couleurlose Philologen im ersten und zweiten Semester beschlossen die Reihe.
Es war noch taghell im Hof, und man hatte deshalb die Kerzen noch nicht angebrannt.
Die Heiterkeit der blumengedeckten Tische steckte an. Man stürmte die Plätze.
Die älteren Herrschaften, die in ihrer engen Auslese als nächste Hausfreunde der Jugend nur zur Folie dienen sollten, hatten ihren Tisch für sich gewählt. Eine Ausnahme machte nur Papa Wilmanns, der die Cousine Grasvogel mitten unter die Jungen hineinschleppte.
Elli mit Wilkens winkte Marga und Doktor Perthes zu sich heran, denen sie an ihrem Tisch heldenhaft zwei Stühle verteidigte. Perthes hatte Marga auf der einen, Elli auf der anderen Seite. Außer Wilkens saßen noch[S. 64] der dicke Burschenschafter mit Heddy, der jüngsten der drei Wilmannstöchter, und Wilmanns selbst mit Fräulein Grasvogel am gleichen Tisch.
Käthe und ihr Privatdozent machten einen entschlossenen Versuch, den Flanellstorch loszuwerden. Sie gerieten dafür mit den Corvinen an eine Tafel.
Es dauerte eine gute Weile, bis die ganze Gesellschaft ihre Plätze innehatte.
Endlich war es so weit, daß der Lohndiener unter Beistand einer Aufwartefrau mit dem Servieren der Speisen beginnen konnte.
Die Wildsuppe, auf der Vater Richthoff so ehern bestanden hatte, dämpfte mit ihrer grausamen Würze für einen Augenblick die allgemeine Fröhlichkeit. Jedermann würgte sie zwar tapfer hinunter, aber man sah doch unterschiedliche Spuren einer gewaltsamen Selbstüberwindung. Nur der Flanellstorch, der aller Vorsehung zum Trotz einen Stuhl neben Käthe gezwängt hatte, erklärte mit der Stimme eines Domküsters, flüsternd und doch allhörbar, er habe nie so etwas Köstliches gegessen.
„Finden Sie das auch?” fragte Elli blinzelnd ihren Nachbar Wilkens. „Papa hat sie befohlen!”
Wilkens drehte statt der Antwort die Augen gen Himmel und legte die Hand auf den Magen.
Papa Wilmanns dagegen konnte die lose Zunge nicht im Zaum halten. So vernehmlich wie der Flanellstorch und mit einer Überzeugungskraft, die fürs erste alle täuschte, durchschnitt er die schweigende Beklommenheit. „Kollege Richthoff, ich denke, Sie werden meiner Frau das Rezept für diese klassische Suppe nicht vorenthalten.[S. 65] Sie kann nur von der Blutsuppe der Spartaner übertroffen werden!”
Die Verdutztheit auf allen Gesichtern löste sich in einem, von unterdrücktem Kichern zu lautem und lauterem Gelächter anschwellenden Heiterkeitsausbruch, dem sich niemand, selbst nicht das entsetzte Fräulein Grasvogel, entziehen konnte.
„Aber Rudolf!” erklang tadelnd die Stimme von Frau Wilmanns über den Hof zu ihrem Gatten, der sich, als wüßte er von nichts, in seine Vatermörder zurückgeduckt hatte.
Geheimrat Richthoff beruhigte seine Tischnachbarin mit einer gravitätischen Gebärde, erhob sich, strich den weißen Bart, tippte hell ans Glas und verschaffte sich Gehör.
„Verehrte Gäste und Freunde!” hub er mit grollendem Ton an. „Der gehässige Vorstoß, den mein Kollege Wilmanns soeben gegen meine Suppe unternommen hat, zwingt mich zu einer wissenschaftlichen Entgegnung. Mein Freund Wilmanns” — er fixierte den Professor durchbohrend — „ist, wie Sie alle wissen, der Mann der lateinischen und griechischen Syntax, also der grauesten, leblosesten Grammatik. Daraus entschuldigt sich seine völlige Unberührtheit in Dingen der Geschichte und des feineren Lebensgenusses. Nur ihm konnte es passieren, meine feurige südländische Wildsuppe mit der Blutsuppe der Spartaner in einem Atem zu nennen. Seine Spartanersuppe ist, wie jetzt männiglich außer ihm weiß, erstens eine Legende und zweitens eine geschmacklose Wurzel- und Kräutersuppe. Also genau das Gegenteil von meiner Suppe. Doch diese historische und kulinarische Zurechtweisung nur nebenher. Überzeugender als der Angriff[S. 66] des Kollegen Wilmanns ist das Urteil, das ich Ihnen allen, meine Herrschaften, von den Zügen ablese: es bedeutet rückhaltlose Anerkennung meiner Suppe! Es schlägt auch den frevelhaften Widerspruch meiner Töchter zu Boden, die, ihres Vaters kochkünstlerische Autorität verkennend, die Wahl jeder und erst recht dieser Suppe verhindern wollten. Um so dankbarer bin ich meinen Gästen für ihre gerechte und sachliche Würdigung. Stoßen Sie mit mir an auf das Wohl meiner Gäste!”
Lachender Beifallsruf und lautes Gläserklingen antwortete dem alten Herrn von allen Tischen. Sein grollender Humor, seine behagliche Selbstironie hatten die gute Stimmung nicht nur wiederhergestellt, sondern erhöht. Die Unterhaltung an allen Tischen kam in lauten, fröhlichen Gang.
Ellis frische Laune war unerschöpflich. Sie und Papa Wilmanns, der sich über Richthoffs Suppenrede königlich gefreut hatte, waren an ihrem Tisch abwechselnd die Wortführer. Wilmanns gab ergötzliche Abenteuer von seiner letzten griechischen Reise zum besten. Er und Borngräber waren zusammen gereist. Sie lagen sich alle Tage morgens über eine Fachfrage in den Haaren und abends bei begeisterndem Hellenenwein in den Armen. Als Wilmanns gerade erzählte, wie sein Gefährte beinahe von einem griechischen Schergen festgenommen worden wäre, weil er durchaus auf der Akropolis eine Nacht zubringen wollte, flüsterte Elli Doktor Perthes zu: „Ich glaube, die ganze griechische Reise hat er nur auf der Landkarte gemacht.”
„Das wollen wir nicht hoffen!” meinte Perthes lächelnd.
„O, Sie kennen die Philologen nicht! Die flunkern[S. 67] alle!” erklärte sie überzeugt. „Wenn ich denke, was nur Wilkens” — sie warf einen vielsagenden Seitenblick auf ihren Tischherrn —, „was der mich schon angeführt hat! Schon zehnmal hat er behauptet: ‚Diesmal steig' ich ins Examen! Diesmal bau' ich bombensicher meinen Doktor!‛ Und zehnmal war's Schwindel!” Ein ganz leiser Seufzer begleitete unwillkürlich den zehnfachen Schwindel.
„Und das geht Ihnen so zu Herzen?” fragte Perthes.
„Mir? Zu Herzen? Wie kommen Sie darauf? Mir geht überhaupt nichts zu Herzen!” verteidigte sich Elli empört. „Von mir aus kann Herr Wilkens zehnmal durch sein Examen fallen. Nicht wahr, Herr Wilkens?”
Der Angeredete schmunzelte nur und drehte sich herausfordernd zu Heddy Wilmanns.
„O, und die anderen Fakultäten,” fuhr Elli zu Perthes fort, „die haben andere Fehler! Die Mediziner zum Beispiel — die sind boshaft, wie Sie! Und schrecklich roh und materialistisch!”
„Hören Sie, wie ich beschimpft werde, Fräulein Marga?” wandte sich Perthes nach rechts, wo Marga geduldig, im Verein mit Cousine Grasvogel, noch immer Wilmanns' griechische Reise miterlebte.
„Wehren Sie sich nur tüchtig!” gab sie zurück.
„Also Sie verteidigen mich nicht einmal? Sie geben am Ende gar Ihrer Fräulein Schwester recht?”
„Um Sie zu verteidigen, müßte ich Sie erst besser kennen!” erwiderte Marga freundlich, aber bestimmt.
„Wie mißtrauisch Sie sind!”
„Mißtrauisch? Marga?” ereiferte sich Elli. „Na, Herr Doktor Perthes, da gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Menschenkenntnis! Die ist die Offenste von uns allen! Aber[S. 68] sie flunkert auch! Die schlechte Nachbarschaft —” Sie zwinkerte nach Wilkens und zu Professor Wilmanns hinüber.
„Ich glaube, du bist beschwipst, Elli!” warf Marga vorwurfsvoll ein.
„Noch nicht! Aber wenn du sagst, Margakind, du kennst Herrn Perthes nicht, flunkerst du. Sie kennt nämlich die Menschen in- und auswendig, wenn sie noch nicht zwei Worte mit ihnen gewechselt hat!”
„Fräulein Marga! Wenn das stimmt, sind Sie mir Genugtuung schuldig. Ich möchte schon immer gern wissen, wer ich bin.” Perthes legte etwas Spöttisches in seine Rede, das ebensogut Marga als ihm selbst gelten konnte.
Marga schüttelte leise den Kopf. „Nein, nein — Sie müssen sich selber am besten kennen.”
„Muß ich das?” erwiderte er im selben Ton wie zuvor.
„Dafür sind Sie doch ein Mann,” war Margas halblaute, entschiedene Antwort. Sie zerkrümelte ihr Brot. Ihr Mund war fest geschlossen. Nur das Zittern ihrer Nasenflügel verriet etwas von innerer Erregung. Warum quälte er sie mit so merkwürdigen Fragen? Was konnte ihm daran liegen, wie sie ihn beurteilte? Warum drängte er sich hartnäckig und eigensinnig in ihr Sinnen und Empfinden, um sich und sie zu ergründen? Gewiß, er dachte sich dabei nichts. Er mochte sich in dieser spielerischen Unterhaltung gefallen. Aber sie, Marga, war sich dafür zu gut! In der Furcht, sich und ihr Innenleben unnötig auszugeben, verkroch sie sich in sich selbst, wie eine Schnecke in ihr Gehäus.
Perthes schwieg. Er beobachtete Marga länger und[S. 69] ernsthafter als sonst. „Dafür sind Sie doch ein Mann” — was hieß das? War das ein Zweifel an seiner Reife? Oder war es eine Anerkennung? Dieses so stille und so klare Wesen der Blinden, für die er eine flüchtige, aus Interesse des Arztes und aus mitleidsvoller Teilnahme gemischte Sympathie empfand, begann ihn zu fesseln, weil es ihn reizte. Der Widerspruch zwischen seiner eigenen Zerrissenheit und ihrer ruhigen Geschlossenheit brachte bei ihm eine zwiespältige Wirkung hervor. Das Peinliche überwog das Anziehende. Bah — er würde sich wohl von einem jungen Mädchen imponieren lassen! Was war rätselhaft an ihr? Höchstens, was er aus seiner eigenen Phantasie hinzutat. Sie war wie andere Frauen: nur durch ihren Zustand ein wenig empfindsamer. Es erklärte sich physiologisch wie alles Weibliche.
Elli hatte es inzwischen für zeitgemäß gehalten, ihren Wilkens, der um die Wette mit den Burschenschaftern Heddy Wilmanns den Hof machte, entrüstet zur Rede zu stellen. Wilkens erklärte mit seiner heiteren Unverwüstlichkeit, da er nach ihrer wohlwollenden Ansicht schon einmal ein Flunkerer sei, sei es doch völlig gleichgültig, ob er nach rechts flunkere oder nach links. Elli schmollte eine ganze Minute lang. Dann fand sie sich mit Wilkens in einem versöhnend-heftigen Händedruck unter dem Tisch. Nach dem Friedensschluß wandte sie sich wieder zu Perthes. „Was treiben Sie denn eigentlich hier?” fragte sie in ihrer übergangslosen, zufahrenden Art, als sie bemerkte, daß das Gespräch zwischen ihm und Marga bedenklich im Stocken war.
„Wo? Wie? Hier — wie meinen Sie das?” Perthes richtete sich zerstreut aus seinen Gedanken auf.
[S. 70] „Na, in Ihrem Laboratorium oder Institut oder wie das Ding heißt!” erläuterte Elli ihre unbestimmte Frage.
„Wenn Sie das interessiert, müssen Sie mich mal besuchen. Ich habe einen ganzen Stall Kaninchen und Meerschweinchen. Mitunter auch Mäuse und Ratten.”
„Wozu denn das?” forschte Elli mit gruseliger, ungläubiger Neugier.
„Ich experimentiere mit ihnen.”
„Hörst du, Marga? Er experimentiert mit Tieren! Was hab' ich gesagt! Mediziner sind entsetzlich roh und gefühllos! — Was machen Sie denn mit den armen Tierchen?”
Für Perthes konnte in seiner gegenwärtigen Stimmung keine Frage gelegener kommen. Es war ihm eine Genugtuung, sich nüchterner und gefühlloser zu zeigen, als er war. Auf die Gefahr hin, den Geschmack zu verletzen, gab er sich als den kühlen, überlegenen Wissenschaftler und beschrieb rücksichtslos seine Versuche an lebenden Tieren: wie er ihnen die verschiedenen Gifte einimpfte, Gegengifte erprobte, die Wirkungen von Stunde zu Stunde beobachtete.
Elli war außer sich vor Mitleid und Empörung. „Sie sind ja ein gräßlicher Tierquäler! Und so was machen Sie mit ruhigem Blut? Was müssen Sie für ein Mensch sein!” Ganz erschrocken blickten ihn ihre strahlenden jungen Augen an.
„Das gehört bei uns zum Handwerk!” versicherte Perthes mit Achselzucken. „Wir können ja leider nicht mit Menschen unsere Experimente machen.”
„Leider!” Elli fuhr von ihrem Sitz in die Höhe. „Leider, sagen Sie? Aber das ist ja abscheulich! Dafür[S. 71] könnte ich Sie —” Sie machte eine drastische Bewegung und hielt inne. Sie mußte selbst über ihre Entrüstung lachen. „Und wir sollen Sie besuchen? Ihre Schändlichkeiten mit ansehen? Was sagst du zu dieser Einladung, Margakind?!”
Marga sagte nichts. Sie fühlte, daß Perthes sich mit Absicht schlecht machte. Er übertrieb. Er wollte sein objektives Medizinertum hervorkehren. Er tat sich und anderen mit Bewußtsein wehe. Die Erkenntnis dieser Zwiespältigkeit, dieser unfertigen Halbheit schmerzte sie mehr als seine harten Ausdrücke, seine rohen Schilderungen. Mit unwiderstehlicher Macht überkam sie das Gefühl ihrer Einsamkeit inmitten all der fremden, geräuschvollen Menschen, die in einer Welt lebten, die nicht die ihre war. Sie fror. Wie in einen schützenden Mantel hüllte sie sich in ihre schwere und doch so viel reichere Einsamkeit. Teilnahmlos lehnte sie sich in ihren Stuhl zurück und richtete die Augen in die Ferne.
Elli, die einzige, die mit schwesterlicher Liebe Margas Wesen wenn auch nicht ganz erfaßte, so doch kannte und achtete, drang nicht weiter in sie.
Auch Perthes verstummte.
„Ihr Wohl, Herr Kollege!” prostete der Burschenschafter mit tadellosem Komment und unverkennbarer Hochachtung zu ihm herüber. Er hatte mit halbem Ohr die Unterhaltung gehört und wollte als jüngeres medizinisches Semester dem älteren seine bewundernde Zustimmung zu dem Ideal fachmännischer Gesinnungstüchtigkeit ausdrücken.
Perthes dankte. Er stürzte sein Glas Wein in einem Zug hinunter. Seine Stirn hatte sich verfinstert. Er[S. 72] war verärgert. Er haderte mit sich, weil er sich hatte fortreißen lassen.
Es war eine Erlösung, daß jetzt gleichzeitig zwei Messer an zwei verschiedenen Tischen an die Gläser klangen.
Die beiden Redner, die sich zu Wort meldeten, erhoben sich miteinander und maßen sich mit erstaunten Blicken: es waren Professor Borngräber und Professor Wilmanns, die in einem und demselben Augenblick um die oratorische Palme rangen.
Papa Wilmanns war sonst nicht auf den Mund gefallen. Aber gerade seinen vielverleumdeten griechischen Reisefreund konnte er nicht ohne Verblüffung als Rivalen auftauchen sehen. Und seine Frau warf ihm überdies aus der Ferne einen so flehenden Blick zu.
„Dann werd' ich die Herrschaften eben nach Freund Jakobus langweilen!” murmelte er mit trockener Gutmütigkeit und setzte sich wieder.
Borngräber begann mit seiner hohen, beharrlichen Stimme. Er zitierte einen indischen Spruch über die Freuden der Häuslichkeit. Man durfte hoffen, er würde von dort aus in Kürze und ohne Fährlichkeiten auf das Haus Richthoff kommen. Aber es war anders verhängt. Jakobus Borngräber war nicht der Mann der geraden Fahrstraßen. Bei einem neuen östlichen Sprichwort, das mit dem Ziel seines Toastes schon wesentlich loser zusammenhing, fiel ihm ein, daß er über die Übersetzung gerade dieses Textes mit einem französischen Kollegen in Kontroverse geraten war. Das Unheil war da: er vergaß völlig seine ursprüngliche Absicht, entwickelte mit einer zähen Leidenschaftlichkeit, die im umgekehrten Verhältnis zu seinen Stimmitteln stand, das Für und Wider beider Auffassungen[S. 73] und geriet in eine Vorlesung über vergleichende Textkritik.
Die Gäste sahen sich verwundert an. Da und dort wurde nervös geräuspert. Ein unterdrücktes Lachen wurde gehört. Einzelne fingen an, sich leise, dann lauter zu unterhalten. Dies Beispiel fand jähe, fast allgemeine Nachfolge. Während der Tisch der Alten eine achtungsvolle Ruhe behauptete, hörten von der Jugend bald nur noch der Flanellstorch aus Pietät gegen alles Akademische und die beiden Corvinen aus zuckerwässeriger Wohlerzogenheit dem Redner zu. Sogar Bertelsdorf, dem Privatdozenten, der für die Ordinarien seiner Fakultät einen unbegrenzten Fonds von Ehrfurcht besaß, schien der Wein eine charaktervolle Unabhängigkeit zu geben; er plauderte ungeniert mit Käthe. Wilmanns unterhielt seinen Tisch damit, daß er unter seinen Fingern eine Menagerie aus Brot gekneteter Wundertiere hervorgehen ließ. Wilkens unterstützte den Professor mit ebenbürtigen Kunststücken: er balancierte Zahnstocher auf der Nasenspitze und ließ Brotstückchen, die er über die Fingerspitzen legte, durch einen geschickten Schlag auf seinen Unterarm in den Mund schnellen.
Die Dämmerung hatte begonnen. Die Lichter auf den Tischen und die farbigen Lampions, die in Ketten über den Hof gespannt waren, waren schon seit geraumer Weile angezündet. Die weißen Tafeltücher, auf denen jetzt Kuchen und Früchte vorherrschten, die roten Leuchterschirmchen, die helldunklen Gesichter setzten sich warm und farbenvoll ab gegen das wachsende Dunkel im Weinberg und in den benachbarten Gärten. Darüberhin taumelten ein paar verspätete Käfer. Der Himmel strahlte in einem[S. 74] zarten, milchigen Blau. An dünnen Wolkenstreifen glomm noch ein später Schimmer der gesunkenen Sonne.
Endlich hielt Jakobus Borngräber plötzlich im Strom seiner Rede inne. Die immer ohrenfälligere Unaufmerksamkeit seiner Zuhörer machte ihm nun doch seine Abirrung mit jähem Schreck klar.
Die majestätische Frau Achenbach, seine Tischdame, hatte Gleichmut und Humor genug, um ihm beizuspringen. „In diesem Sinne —” soufflierte sie ihm.
„In diesem Sinne —” stotterte Borngräber und schwang sich mit einem verzweifelten Überschlag seiner Stimme aus dem Wirrsal seiner textkritischen Betrachtungen auf die dargebotene, allumfassende Redewendung: „In diesem Sinne bitte ich Sie, sich zu erheben und zu rufen: Unser verehrter lieber Richthoff und sein gastliches Haus, sie leben hoch!”
Ein schallendes dreifaches Hoch und ein allgemeines Gläserklirren verschlangen Redner und Rede. —
Nach so langer Geduldsprobe wollte sich der frühere Tafelzwang nicht wiederherstellen lassen. Der Tisch der Alten erkannte die Situation richtig, und ehe Papa Wilmanns seine unterdrückte Rede auch noch loslassen konnte, erhoben sich die Herrschaften.
„Ich wünsche gesegnete Mahlzeit!” klang die kräftige Stimme des Geheimrats über den Hof hin.
Zwanglos verteilten sich die Gruppen.
Die Jugend stieg in ihrer Mehrzahl den Weinberg hinan, dessen Wege weit hinauf mit Papierlaternen beleuchtet waren.
Die Alten zogen sich in die Zimmer zurück, bis im Hof die Tische geräumt waren. Die zwei Corvinen und der[S. 75] Flanellstorch hielten jetzt den Zeitpunkt für gekommen, um bei Vater Richthoffs Zigarren ihre Professoren zu poussieren.
Marga war mit im Weinberg emporgestiegen. Perthes hatte sich artig angeboten, sie zu führen. Sie dankte. Darauf gesellte er sich dem ausgelassenen Schwarm zu, den Elli und Wilkens anführten. Dazu gehörten die drei Wilmannstöchter, die Burschenschafter und auch Käthe mit Bertelsdorf.
Auf der Graswiese, wo hinter dem Blumengarten das Obstgelände begann, war es noch heller als in den tieferen Partien des Weinbergs. Elli schlug ein Spiel vor. Sie fand laute Zustimmung. „Hasch, hasch!” wurde nach kurzer Überlegung gewählt, und die Paare traten lachend in die Reihe. Perthes holte sich Heddy Wilmanns. Das Tollen begann, und leuchtend stoben die hellen, fliegenden Mädchenkleider durch die Dämmerung.
Marga stand abseits. Einen Augenblick hatte sie gedacht, es würde jemand zu ihr treten, um sie zu unterhalten. Aber niemand kam. Wie es meist ging, wurde sie und ihre Blindheit jetzt in der allgemeinen Lustigkeit vergessen. Im Grunde war es ihr recht.
Die Geselligkeit solcher Abende ermüdete sie mehr und schneller als andere. Und ihre innere Einsamkeit hatte sich nach der äußeren gesehnt.
Tastend orientierte sie sich an den Johannisbeersträuchern längs des Weges. Dann stieg sie sicher bergan.
Hinter dem Obstplan kam eine Mauer, die das steile Erdreich stützte. Eine Treppe aus Steinen führte an ihr empor. Darüber standen die Weinstöcke, die Sorgenkinder des alten Herrn. Jahr für Jahr gaben sie hartnäckig nur[S. 76] wenige Pfund saurer Trauben, aber es blieb trotzdem ausgemacht, daß hier anno Domini der großartigste Wein in der ganzen Umgegend wachsen mußte. Ein zweites Mauerwerk schloß nach oben ab. Auf seiner Höhe lief eine langgestreckte Laube über die ganze Breite des Richthoffschen Besitzes. Der Laubengang hieß der Philosophenweg; er lag schon hoch über der Stadt in der freien, ziehenden Abendluft.
Dort schritt Marga, die Hände auf dem Rücken, langsam auf und ab.
Das Lärmen und Lachen der Spielenden klang nur gedämpft zu ihr herauf. In vollen Zügen trank sie die Ruhe des späten Abends. Nichts Weichmütiges durfte in ihr aufkommen. Sie ordnete ihre Gedanken und ihre Gefühle zu dem mutigen Gleichklang, in dem sie daheim war. Ihrem festen Willen zum Trotz drängte sich immer noch ein herber Ton vor. Konnte sie es nicht lassen, auf andere Menschen zu bauen, statt nur auf sich? Es war ja doch stets dasselbe: ein Suchen, das müde machte, und ein Finden, das die Enttäuschung war. Zwiespältig und halb und haltlos waren alle, bei denen sie sich die Mühe machte, in sie hineinzulauschen. So wie Perthes. Wie die Mücken tanzten sie um die Sonne, zu schwach, um in sie hineinzufliegen, zu schwach, um sie zu entbehren. Vertraute sie, Marga, denn nicht genug auf sich allein? Was horchte sie überhaupt noch nach Gefährten? Ihre Schwingen reichten aus. Auch wenn sie nur ein Weib war. Sie — sie wollte und konnte in die Sonne des inneren Erlebnisses fliegen, wo die Schönheit war, das Unbedingte und das Unendliche ...
Zwischen den zuhöchst gelegenen Pappeln, wo Margas[S. 77] Lieblingsplatz war, und dem Philosophenweg lag ein Wiesenhang unter alten Kirschbäumen.
Dort streckte sie sich aus.
Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, die Augen geschlossen, überließ sie sich ihrem Schauen. Aus dem Schoß ihrer immerwährenden Nacht quoll ihr Bild auf Bild entgegen. Nicht verschwommene, sondern scharfe und klare Gesichte, die ihre Phantasie sich schuf, und in denen ihre reiche Seele sich auslebte und ausruhte. Da war ein fernes, schimmerndes Tal, über und über von rotblühenden jungen Pfirsichbäumen voll. Ein tausendfältiger Schwarm von weißen, samtflügeligen Faltern gaukelte darüber: ein flatterndes Gewölk, das wie eitel Silber gegen den tiefblauen Himmel stand. — Ein verschlafener See blitzte auf, inmitten dunkel wuchtender Tannenberge. Das fahle, magische Licht drang aus gelben Wolkenstreifen über die Landschaft. Der Wind hob leise die Wellen, daß die Seerosen schwankten, und ein schwarzer Schwan zog sanft am Schilf entlang. — Die Berge rückten auseinander. Der See verschwand. Lachende, unabsehbar weite Blumenwiesen taten sich auf: gelbe Königskerzen und weiße Schafgarben und blauer Rittersporn wirrten sich leuchtend durcheinander, so weit der Blick reichte. Darüber, am Horizont, erhoben sich kristallene Sommerwolken, überirdische Berge, himmlische Paläste, in denen die Sonne selbst zu wohnen schien. —
Marga war so entrückt, so selig im Schauen versunken, daß sie nicht hörte, wie ein behender Schritt die Stufen nach dem Laubengang heraufkam. Erst als ihr Name gerufen wurde, zuckte sie auf und richtete sich aus dem Gras empor.
[S. 78] „Fräulein Richthoff!” ertönte es von neuem.
Sie erkannte Perthes' Stimme und gab keine Antwort. Noch war sie nur halb aus ihrer Traumwelt erwacht, und kein Fremder sollte sie stören. Sie duckte sich wieder tiefer ins Gras.
Aber seine Augen hatten ihr helles Kleid in der dunklen Wiese erspäht. „Wo in aller Welt stecken Sie denn? Sie haben sich ja richtig versteckt!”
„Bei mir selber,” gab sie einsilbig zurück.
„Drunten wird eine Bowle gebraut! Ich soll Sie holen.” Perthes war vollends zu ihr heraufgeklettert. „Darf ich mich einen Augenblick neben Sie setzen?” Ohne ihre Zustimmung abzuwarten, streckte er sich neben ihr im Gras aus.
Marga strich die Haare aus dem Gesicht und setzte sich, ihren Haarknoten zurechtsteckend, aufrecht.
Vom tieferen Garten und vom Hof herauf kam der matte Widerschein der Papierlaternen und gab im Verein mit dem sternklaren Himmel gerade Licht genug, um Perthes ihre stillen verschlossenen Züge sehen zu lassen. Nach dem ausgelassenen Spiel mit seiner lauten, übermütigen Lustigkeit, die er eben verlassen, berührte ihn ihre ruhevolle Erscheinung hier oben im Garten seltsam.
„Warum sind Sie denn so mir nichts dir nichts ausgerückt, Fräulein Marga?” fragte er nach einer Weile.
„Was hätte ich denn sonst machen sollen?” entgegnete sie ohne Vorwurf.
Er schwieg. Seine Frage war unbedacht und töricht. Wie konnte sie in dem abschüssigen Garten „Hasch, hasch!” und derlei Dummheiten spielen! Er hatte sie ja überdies mit einer gewissen Absichtlichkeit sich selbst überlassen.
[S. 79] „Sie haben nicht viel versäumt,” fuhr er fort. „Ich alter Esel habe mich wie ein alberner Junge herumhetzen lassen.” Er trocknete sein Gesicht mit dem Taschentuch; er ärgerte sich wirklich, daß er sich wie der krasseste Fuchs in solche Kindereien gestürzt hatte. „Hier oben ist's schöner!” Er schaute hinaus in die Ebene, die nächtlich verschattet sich dehnte.
Marga antwortete nicht. Sie legte ihren Rock zurecht und glättete ihre zerknitterten Ärmel.
„Ich darf ja nicht mehr fragen, was Sie denken,” begann er von neuem, „sonst würde ich's schon wieder tun, weil Sie ja doch von sich aus mir nichts erzählen.”
„Ich denke, warum Sie bei Tisch all die häßlichen Dinge sagten.”
Perthes besann sich. „Ach — Sie meinen über meine Tätigkeit? Die Geschichte mit den Tierexperimenten, und daß man leider nicht mit Menschen experimentieren könne? Aber das ist ja wahr!”
„Vor Ihrem Verstande vielleicht, ja, aber nicht nach Ihrem Gefühl.”
„Und woher wollen Sie das wissen? Du lieber Gott! In der Medizin hört man auf, ein Gemütsmensch zu sein — woher wollen Sie wissen, daß das nicht meine volle Meinung ist?”
„Das will ich Ihnen ehrlich sagen: weil Sie vor uns dummen, gefühlsduseligen Mädels renommieren wollten. Sie hatten ein Bedürfnis, sich schlechter zu machen, als Sie sind.”
Perthes horchte verwundert auf. Er hatte sich auf den Boden gelegt und den Kopf auf die Hände gestützt. Marga saß links hinter ihm. Er sah forschend zu ihr hinüber.[S. 80] „Sie beurteilen mich sehr schmeichelhaft, Fräulein Marga.” Er lachte gezwungen. „Ich glaube, Sie irren.”
„Wenn ich irre, um so schlimmer für Sie!” erklärte Marga mit jener Ruhe und Geradheit, in der sie sich selbst wiederfand. „Dann müssen Sie sich selber sehr niedrig einschätzen und Ihre Mitmenschen auch. — Und besonders uns Frauen!” setzte sie nach einer Weile gedankenvoll hinzu.
„Warum gerade die Frauen?”
„Weil Sie meinen, ihnen im Ernst mit so rohen Dingen zu imponieren.”
Wieder trat eine Pause zwischen beiden ein.
Vom Hof herauf drangen einzelne abgerissene Worte, denen lustiges Gelächter antwortete. Papa Wilmanns hielt bei der Bowle seine aufgeschobene Rede auf die Damen.
„Ich glaube, wir müssen hinunter,” bemerkte Marga kurz.
Perthes rührte sich nicht. Er trommelte mit der rechten Faust erst langsam, dann immer leidenschaftlicher auf den Grasboden.
„Was machen Sie denn?” fragte Marga aufhorchend.
„Ich ärgere mich!” gab er knurrend zurück, ohne in seinem Trommeln aufzuhören.
„Worüber?”
„Über Sie —”
„Über mich?”
„Und noch mehr über mich!”
„Und warum denn?”
„Weil — weil —” Er führte einen letzten grimmigen Hieb gegen den unschuldigen Boden. „Weil Sie verwünscht recht haben!” stieß er knirschend hervor.
[S. 81] Marga mußte unwillkürlich lächeln über das unerwartete, heftige Bekenntnis, das sich so widerwillig von ihm losrang.
Perthes bemerkte es nicht. Ihm war zumute, als wäre jählings etwas geborsten, ein Hemmnis, ein Stauwehr, das den Strom seiner Gedanken und Gefühle aufgehalten. Die offene, stillkräftige Art Margas lockte aus ihm hervor, was er nie einem anderen mitgeteilt hätte. Der Widerspruch seines Herzens, das bald in Sehnsucht nach vertiefter Empfindung, nach einer überlegenen Weltbetrachtung voll Gleichklang und Schönheit sich verzehrte, bald in Verachtung jeder seelischen Regung zur Oberfläche trieb, wo es nichts gab, als die nackte Wirklichkeit, und alles Unbegreifliche unterging in der tristen Biologie des Tiermenschen, wo nur der Genuß des Alltags Sinn und Berechtigung hatte — dieser Widerspruch tat sich in einer Flut von Selbstanklagen auf, die er rückhaltlos in die dunkle, friedvolle Nacht hinausschleuderte. Heute war er weich, mitfühlend, empfindsam und wehleidig wie ein Kind; morgen hart, schroff, roh wie ein zynischer Zweifler, der sich in Kraßheiten überbot. Sein unseliger Hang zum Extremen — war er nicht sogar jetzt lebendig, in dieser Beichte, die er ohne Grund vortrug? die so schamlos war wie die ganze Komödie, die er mit sich und aller Welt aufführte? Er war zur Halbheit, zur Maßlosigkeit, zum Unfrieden verdammt. Wertlos war der ganze Kerl. „Sie irren, Fräulein Marga — Sie irren, sage ich Ihnen! Der bessere Kern, den Sie da in mir vermuten, Gemüt oder Seele oder was es derart geben könnte, der ist bei mir nicht vorhanden! Schale, nichts als Schale — im Rechten und im Schlechten!”
[S. 82] Marga war längst ernst geworden. Sie erschrak über die so wilde, alle Schranken vergessende Entladung, die mit Unreife und Mißklang in ihre eben noch so köstliche Einsamkeit und Harmonie einbrach. Seine Bekenntniswut verletzte sie und tat ihr wohl in einem Atem. Nie hatte ein Mensch, nie zumal ein Mann ihr so sein Innerstes gezeigt. Sollte sie stolz auf dies Vertrauen sein? War sie nur der zufällige Anlaß, die zufällige Zeugin dieser selbstvernichtenden Offenheit? Durfte sie auf ihr Herz hören, das trösten und helfen wollte? Auf ihr Gefühl, das beinahe mütterlich in ihr aufwallte: Gib von deiner Klarheit seiner Unklarheit! Schenke von deiner Kraft! Schenke, schenke mit vollen Händen! — Lohnte es sich denn? Verlangte er überhaupt danach? Verschwende dich nicht! warnte es in ihr. Verschwende dich nicht!
Perthes war verstummt. Er warf sich herum und starrte, von ihr abgewandt, hinaus in die Ebene, aus der schüchtern der Fluß im Licht des gestirnten Himmels aufleuchtete.
Marga fand noch immer kein Wort.
Jenes Schweigen herrschte zwischen beiden, das zwei Menschen beschleicht, wenn der eine sich schrankenlos ausgegeben hat und der andere noch nicht weiß, was er dagegen geben soll. Ein Schweigen, das zum Anfang oder Ende des Verstehens wird.
Marga zitterte in ihrer Unschlüssigkeit.
Wenn sie ihn jetzt hätte sehen können! Einmal ihm ins Gesicht schauen, daß dies Gesicht ihr rate, was sie tun oder lassen müsse! Sie strengte alle Kräfte ihrer Seele an, um den Mangel ihrer Sinne zu ersetzen. Wie durch einen[S. 83] geheimen Rapport fühlte sie, daß er sich innerlich langsam von ihr entfernte. Er räusperte sich; er begann sich über seine Preisgabe zu schämen, zu erzürnen. Ihr Zaudern wich. Sie durfte nicht in seiner Schuld bleiben. Eben war er im Begriff aufzuspringen und sie zum Abstieg aufzufordern, als sie die Sprache fand. „Ich glaube doch an den Kern, den Sie sich absprechen, Doktor Perthes,” sagte sie mit leiser Bestimmtheit.
„Doch? Immer noch?” erwiderte er nach einer Weile ausdruckslos. „Da sind Sie eine beneidenswerte Optimistin.” Der spöttische Ton, den er annehmen wollte, verlor sich in einer bitteren Niedergeschlagenheit.
„All das Leidenschaftliche,” fuhr sie uneingeschüchtert fort, „was Sie vorhin sagten, sagten Sie ja nur deshalb, und deshalb nur so leidenschaftlich, weil Sie selber gern an einen solchen Kern glauben möchten und es nicht immer können.”
Perthes erwiderte nichts. Er hatte das bärtige Kinn auf die Faust gestützt und sah Marga an. Ihre sanfte, klare Stimme wirkte auf ihn wie eine Kinderweise, die sich beruhigend ins Ohr schmeichelt. Sein Verstand sträubte sich gegen die einfache Wahrheit ihrer Worte; das Herz sog sie dankbar in sich.
„Ich kann natürlich nicht wissenschaftlich mit Ihnen streiten,” hub Marga nach einer gedankenvollen Pause noch sicherer wieder an. „Ich habe in allen Dingen nur die Gewißheit meines Gefühls, und die sagt mir, daß es gar nicht zuerst auf die Meinungen ankommt, die man sich von der Welt und dem Leben und den Menschen so im allgemeinen macht, sondern auf das, was man aus sich selbst macht.”
„Meinen Sie? Aber wenn man bald so ist, bald so?[S. 84] Wenn man nach zwei Seiten gezerrt wird? Wenn man, um recht trivial, aber anschaulich zu reden, die bekannten ‚zwei Seelen‛ in der Brust hat?”
„Dann kommt es eben darauf an, durch welche von beiden man glücklicher, man mehr ‚man selber‛ ist!” erwiderte Marga überzeugt. „Wenn man das erst weiß, braucht man nur zu wollen.”
„Und dafür sind Sie doch ein Mann! Sagen Sie das ruhig wieder dazu! Ich kann es ganz gut noch einmal hören!” Es war keine Bitterkeit und kein Spott mehr in seiner Stimme, sondern nur eine schwermütige, dumpfe Verzagtheit. Als sein Blick aus verlorener Weite zurückkam, suchte er Marga.
Ihre Augen hatten einen warmen Glanz angenommen, der sie von innen zu erleuchten schien und ihre Blindheit vergessen ließ. Sie hatte sich höher aufgerichtet. Ihre Hände lagen gefaltet in ihrem Schoß; die Haare über ihrer runden, ebenmäßigen Stirn bewegten sich sacht im Winde, der über den Berg fuhr. Von ihrem geschlossenen, in sich einigen Wesen ging eine stille, fast heitere Gewißheit aus, die Perthes mit Achtung erfüllte, einer Achtung, die er zuvor nicht empfunden hatte.
„Und wenn ich's auf eine Probe ankommen ließe, ob Sie recht haben, Fräulein Marga?” meinte Perthes zögernd. „Wollten Sie mir ein klein wenig dazu helfen?”
Sie überlegte. Nur einen Augenblick. „Das wollte ich!” sagte sie kurz und herzlich.
Perthes stand auf, er reckte seine Arme und streckte die hohe, sehnige Gestalt. „Also auf gute Kameradschaft!” Es klang eine so ehrliche Wärme aus seinen Worten, wie er sie den ganzen Abend noch nicht gefunden hatte.
[S. 85] Margas Gesicht wandte sich arglos und voll Güte zu ihm. Sie bot ihm die Hand.
Er ergriff sie und, einer ungekünstelten Bewegung folgend, drückte er einen Kuß darauf.
„Jetzt ist es aber höchste Zeit, daß wir hinuntergehen!” Auch sie war aufgestanden. Ihre Stimme zitterte von innerer Seligkeit, von frohem Stolz über diesen Beweis der Achtung.
Sie wagte diesmal nicht, seinen Arm auszuschlagen, sondern ließ sich von ihm führen.
Schweigend stiegen sie den Weinberg hinunter ...
Von einer Bank im Blumengarten hörten sie lachendes Streiten. Es waren Elli und Wilkens. Sie waren also nicht die einzigen, die auf sich warten ließen. Weiter unten stießen sie auf Heddy Wilmanns und den dicken Burschenschafter. Mit diesen zusammen traten sie in den Hof, wo Jugend und Alter bei einer unerschöpflichen Erdbeerbowle durcheinandersaß. Papa Wilmanns hatte den Flanellstorch und die zwei Corvinen vorgenommen, denen er in der richtigen Bowlenlaune eine Philippika über die Streberei hielt. Sie hörten ihm mit stumpfsinniger Andacht zu, ohne sich getroffen zu fühlen. Der Geheimrat saß mit Frau Achenbach und Professor Borngräber in einer anderen Ecke und plauderte bei seiner sechsten oder achten Zigarre über Sommerferienpläne.
Marga und Perthes setzten sich zu Käthe und Bertelsdorf, die, unterstützt von den beiden älteren Wilmannstöchtern, die gesamte Universität Spießruten laufen ließen.
Es war lange nach Mitternacht, ehe das Gartenfest mit einem fröhlichen, von Papa Wilmanns inaugurierten und kommandierten Rundgesang sein Ende fand.
Der Alltag war wieder in seine Rechte getreten.
Der heitere Sommerabend im Haus am Wenzelsberg war für alle Beteiligten eine liebenswürdige Erinnerung geworden. Nur für Marga und Doktor Perthes spann sich ein Stück Wirklichkeit daran. Die Freundschaft, zu der sie sich zusammengefunden hatten, gewann an ungezwungener und vertrauensvoller Herzlichkeit.
Als Perthes vierzehn Tage nach dem Gartenfest am Hause vorbeigekommen war, hatte er Marga unter den Kastanien im Vorgarten sitzen sehen. Er war ohne Zaudern hinaufgegangen, um sie zu begrüßen. Sie plauderten wie zwei gute Kameraden miteinander. Ihm tat es wohl, sich auszusprechen; Einfälle, Stimmungen, Empfindungen mitzuteilen, die ihn gerade beschäftigten. Und sie verstand dankbar und still zuzuhören. Nur ab und zu warf sie ein Wort dazwischen, offen und einfach, wie sie es fühlte und dachte.
Perthes wiederholte seinen Besuch.
Bald am Vormittag, bald am Nachmittag kam er auf einen Sprung vorbei, und meist traf er Marga, die an den Ausgängen und Besuchen der Schwestern in der Stadt selten teilnahm, an ihrem Steintisch im Vorgarten, handarbeitend oder lesend.
Gleich bei einem der ersten Male fügte es der Zufall, daß der Geheimrat, von einer Fakultätssitzung heimkehrend, die beiden beisammen fand. Perthes hatte Marga ein paar Sätze diktiert, die sie punktierte, und sie waren eben bei der Korrektur der Blindenschrift; sie bemerkten den alten Herrn nicht eher, als bis er dicht hinter ihnen stand.
[S. 87] Unter dem breitrandigen Schlapphut hervor schoß er bedrohliche Blicke.
„Was wird denn da getrieben?” Richthoff stützte sich mit der einen Hand auf den Krückstock, mit der andern hatte er sich in den weißen Bart gefaßt.
„Wir repetieren unser Pensum von Hemsbach, Herr Geheimrat!” Perthes erhob sich grüßend; sein Auge begegnete ruhig dem scharfen Blick des alten Herrn.
„Wenn du nichts dagegen hast, will mir Herr Doktor Perthes ein wenig meine Kenntnisse auffrischen helfen,” setzte Marga aufrichtig hinzu.
„Hm!” brummte Papa Richthoff unentschieden. Er überlegte, daß von Rechts wegen ein junger Mann und ein junges Mädchen sich keinen Unterricht tete-a-tete zu geben hätten. Aber schon im nächsten Moment sagte er sich auch, daß er Marga, die so viel entbehren müsse, nicht um eine im Grund unschuldige, bei ihr doppelt harmlose Zerstreuung bringen dürfe. „Sie hat wohl glücklich alles wieder verschwitzt, was sie konnte?” wandte er sich, dem Tisch näher tretend, an Perthes.
„O — es geht noch ganz leidlich!” meinte der Doktor.
Der alte Herr ergriff das Blatt mit den vielen kleinen Punkten, die nach Zahl und Stellung dem Getast ihren Buchstabensinn vermitteln. Es entwickelte sich eine Unterhaltung über die Schrift, über Blindenbibliotheken und ihren Bücherschatz. Perthes, der, was er wußte, recht wußte, gab allerhand Auskünfte, die den Geheimrat interessierten.
Das Ende war, daß Vater Richthoff Marga huldvoll am Ohr zupfte. „Das bitte ich mir aber aus, daß in vierzehn Tagen der Prolog zum Faust fließend gelesen und[S. 88] geschrieben werden kann, hörst du!” Mit einem jovialen Kopfschütteln verabschiedete er sich und verschwand im Haus.
Seither konnten Perthes und Marga ihre Kameradschaft ungestört pflegen. Elli und Käthe neckten wohl manchmal die Schwester; aber da sie selber Perthes nicht ungern sahen, hatten sie gegen Margas unschuldige Eroberung nichts einzuwenden. Man gewöhnte sich daran, den Doktor als Freund des Hauses das eine oder andere Mal am Wenzelsberg zu begrüßen.
Über tausend Dinge unterhielten sich Marga und Perthes. Über Großes und Kleines mit derselben Wichtigkeit der Jugend. Er brachte ein buntes Allerlei von Eindrücken mit, wie sie sich ihm an Menschen, in der Natur, bei seinen Arbeiten boten, und Marga sog diese Wirklichkeiten aus einer ihr nur durch die Phantasie erreichbaren Welt eifrig und dankbar ein. Was sie von den Schwestern, aus Büchern, durch sich selbst wußte, bekam Fülle und Zusammenhang. Sein vielseitiges Wissen nährte das ihre. Daß sie nichts Fremdes und Schiefes in sich aufnahm, dafür sorgte ihre durch die Blindheit geschärfte Spürkraft, ihr klarer, gesunder Sinn, der nichts annahm, was er nicht gebrauchen konnte. Die Ruhe und innere Freiheit, die durch frühes Entsagen, durch Einsamkeit und Leiden in ihr gereift, war die Gegengabe ihrer Freundschaft. Sie erkannte seine Natur, die ein Ganzes und Einfaches werden wollte und doch immer wieder durch entgegengesetzte Neigungen auseinanderstrebte, sich selber komplizierte und zerriß. Perthes seinerseits fühlte die Überlegenheit, die in der Stille und Bestimmtheit ihrer Seele lag. Aber sein Verstand sträubte sich mit zahllosen Gründen dagegen, diesem Gefühl nachzugeben.[S. 89] Daß sie, zehn Jahre jünger als er, ein Weib, eine Blinde, ihm durch ihre größere Ruhe Achtung abnötigen sollte, konnte ihm oft plötzlich lächerlich erscheinen, ihn empören, seinen verbissensten Widerstand erwecken. Dann riß er irgendeine schwierige Frage herbei, eine von den großen Fragen über den Wert des Daseins, und zersetzte alle „Schwindsüchteleien”, wie er es nannte, unter vollem Aufgebot seines Wissens und seiner Klugheit. Je lauter er wurde, um so stiller wurde sie; je mehr er sich erhitzte, um so gelassener hörte sie ihm zu.
So bewies er gleich an einem der ersten Tage ihrer jungen Freundschaft, daß es nichts Vernünftiges gebe, als das tierische Werden und Vergehen; alle vermeintlich „höheren” Gedanken seien nichts als ebensoviele Illusionen, um über diese nüchterne Wahrheit zu täuschen. „Damit wir hübsch im Tretrad bleiben und nicht etwa herausspringen, weil uns die Sache zu albern wird!”
Marga hörte ihm aufmerksam zu. Als er geendigt hatte, bemerkte er ein leichtes, heiteres Lächeln in ihren Zügen.
„Sie — Sie wissen das natürlich viel besser!” rief er empört.
„O, gar nicht! Wissen werden Sie es schon besser. Aber ich fühle es anders.”
„Fühlen! Fühlen! Mit Ihrem ewigen Fühlen! Das Gefühl ist gar nichts. Jeder Hund und jede Katze sind uns darin ebenbürtig. Gefühle sind für Kinder, sind Verschwommenheiten, Torheiten, Halbheiten, die Gedanken werden möchten und nicht können! Wollen Sie das nicht endlich einsehen?”
„Nein. Ich will es eben nicht einsehen,” meinte[S. 90] Marga ruhig. „Es gibt Gefühle, die weniger sind als Gedanken, und es gibt Gefühle, die mehr sind —”
„Und mit welchem Recht?”
„Mit meinem Recht. Ich will, daß das Leben den Sinn hat, dessen Wahrheit ich fühle — ob Sie sie beweisen können oder nicht.”
Perthes schüttelte den Kopf. Sein widerspenstiger Verstand war nicht überzeugt. Trotzdem beugte sich eben das Gefühl, das er so gering bewertete, vor dem ihrigen. Es war töricht, aber es war so. Und blieb so, ein Waffenstillstand bis zum nächsten Gefecht. —
Ein Thema gab es, das sie im Gespräch nie berührten: Hilde König.
Aus Äußerungen ihrer Schwestern, aus dem Klatsch, der in einer kleinen Stadt auch nur entfernt bekannte Menschen mehr oder minder verbindet, wußte Marga, daß ihr Freund seine Verehrung für die kleine Uferschöne mit den Taubenaugen und den losen blonden Haaren ganz und gar nicht aufgegeben hatte. Man sah ihn häufiger denn je die Uferstraße entlang pilgern, sei es allein, um sie auf ihrem Balkon zu sehen, oder mit ihr zusammen, wenn er ihr mehr oder minder absichtlich begegnet war und sie heimbegleitete. Auch im Stadtgarten tauchte er auf. Man sah ihn nicht selten im „Heiratskarussell”, das ihm anfangs so lächerlich vorgekommen war, an Hilde Königs Seite.
Marga hatte sich vorgenommen, von sich aus nie wieder auf diese Angelegenheit zurückzukommen, aber je vertrauter sie und Perthes miteinander verkehrten, desto schwerer wurde ihr diese Zurückhaltung. Sie kannte ihn jetzt genügend, um zu erraten, daß der augenfällige, liebliche[S. 91] Zauber der koketten Unschuld, die so geschickt zwischen Ernst und Kindlichkeit balancierte, seinen empfänglichen Sinn anziehen mußte. Vielleicht blieb es bei einer Spielerei. Vielleicht aber — und das machte ihr sein leidenschaftliches Wesen wahrscheinlicher — verfing er sich ernsthaft in diesem Spiel. So oder so: sie, Marga, durfte sich nicht einmischen. Zartgefühl und Stolz geboten ihr dies als ein Selbstverständliches. So oft ihre Gedanken und Gefühle über die ihnen gesetzte Grenze schweifen wollten, rief sie sie schroff zurück. Freilich nicht, ohne daß sie einen leisen Schmerz dabei empfand. Er kam von der Unklarheit, die zwischen ihnen beiden über dies eine bestehen bleiben mußte; von einer Sorge um ihn; einem bangen Gefühl, das in ihr keimte, ohne daß sie es noch fassen und zur Rechenschaft ziehen konnte. —
Ein recht unbedeutendes Erlebnis sollte sie über ihn und sich aufklären.
Marga hatte es nach wie vor vermieden, sich wieder in der Abendstunde am Ufer spazieren führen zu lassen. Bis der Zufall es wollte, daß der Geheimrat eines Abends Elli mit dem Auftrag, sich ein bestimmtes Buch auszubitten, zu Professor Borngräber schickte, der in einem verwachsenen, kleinen Häuschen in der äußersten Uferstraße sein Junggesellenleben führte. Marga hatte ihre Schwester schon ein großes Stück Wegs begleitet, ehe diese mit dem Ziel ihres Ganges herausrückte. Als sie nun Einwände erhob, fiel die necklustige Elli mit all ihren Kobolden über sie her. Es blieb Marga nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Es war ein trüber, bedeckter Abend. Der Regen hatte kaum erst aufgehört. In der Allee am Fluß war es einsam.[S. 92] Die Sonne lag hinter dem grauen Gewölk, und der Fluß wälzte sich träg und schmutzig zwischen seinen Ufern hin.
Elli und Marga beeilten sich, Borngräbers Haus zu erreichen, und entledigten sich schnell ihres Auftrags. Der Himmel sah nach neuen Regengüssen aus, denen sie lieber entgehen wollten. Aber sie hatten die Allee noch nicht zur Hälfte hinter sich, als die Tropfen niederklatschten. Eng duckten sie sich unter den gemeinsamen Schirm.
Kurz vor dem Aufgang zur Brücke, am Ende der Allee, kam ihnen ein Paar entgegen, das sich gleichfalls in einen Schirm teilte.
Elli mit ihrem hellen, flinken Blick hatte die beiden schon erkannt. „Perthes mit Hilde König!” flüsterte sie hastig Marga zu.
„Wo denn?” Marga nahm sich zusammen, aber ihr Arm zuckte unwillkürlich in dem der Schwester.
„Gerade vor uns! Er scheint sie mit seinem Schirm heimzubringen!” tuschelte Elli.
Im gleichen Augenblick hörte Marga ihre Stimmen. Seine rauhe, hastige; ihre leichte, etwas gezierte und hüpfende. Dann verstummten beide. Sie hörte, wie die Schritte an Elli und ihr vorüberknirschten.
„Das ist aber stark! Er hat nicht einmal gegrüßt! Er tut, als kennte er uns nicht, und dabei schwöre ich, daß er uns erkannte!” Elli war ganz erregt. Sie ereiferte sich, ohne auf Marga zu achten. So ein Drückeberger! Einfach beiseitezusehen! Und seine Bekannten zu verleugnen wegen diesem dummen, aufgeputzten Gör! Das sollte er von ihr zu hören bekommen!
„Meinst du, daß er uns wirklich nicht sehen wollte?”[S. 93] forschte Marga nach einer Weile zögernd. Sie mußte alle Kraft aufbieten, um einer Erregung, die sie selbst bestürzt machte, Herr zu bleiben.
„Schwören will ich darauf!” beteuerte Elli, und sie schilderte sein Benehmen mit erneuter Lebendigkeit.
„Ich werde ihn fragen, warum er das tat,” erklärte Marga gepreßt.
Der Regen floß jetzt in solchen Strömen, daß sie in der nächsten besten Haustür Schutz suchen mußten. Elli, die nie zu lange beim gleichen Thema blieb, erzählte vom bevorstehenden akademischen Ausflug. Marga hörte ihr krampfhaft zu, auch auf dem weiteren Nachhauseweg. Sie wollte, was sie bewegte, überdenken, wenn sie erst wieder allein mit sich war ...
Da Vater Richthoff heute seinen Kegelabend hatte, wurde schneller als sonst Abendbrot gegessen.
Nachher übten Käthe und Elli am Flügel im Wohnzimmer ein Duett.
Marga konnte unbemerkt in ihr Zimmer im Dachstock hinaufsteigen.
Oben holte sie ihre Geige hervor. Sie hatte lange nicht gespielt. Sie war keine Künstlerin. Ihr Spiel war technisch nicht weit über das hinausgekommen, was sie, noch ein halbes Kind, vor ihrer Erblindung gelernt hatte. Aber es war Musik in ihr, und diese brachte sie gerade durch die einfachen Mittel zu ergreifendem Ausdruck.
Mit einer Hast, die ihr sonst fremd war, griff sie heute nach ihrem Instrument und stimmte es. Eine scheue Hast war es: sie wollte ihr übervolles Gemüt in Tönen erlösen und hatte doch zugleich eine Scheu vor dem Unbekannten, das die Töne ihr aus der Seele locken wollten.
[S. 94] Ihr blonder, blasser Kopf war tief über die Saiten gebeugt, und die Hand führte zagend den Bogen. Die Augen hatte sie geschlossen, den Mund zusammengepreßt. Rauhe, gebrochene Klänge holte sie aus der Tiefe herauf. Sie verbanden sich zu einer ungefügen, schluchzenden Weise, gegen die sich nur langsam aus der Höhe die Töne eines weichen, unendlichen Verlangens hervorwagten. Aus der Tiefe war es der Schmerz ihres Lebens, das so tapfer niedergehaltene Weh, jung zu sein und entsagen zu müssen; aus der Höhe war es die Sehnsucht, die laut und lauter mit ihrer hellen Stimme nach Ziel und Erfüllung rief. Und je lauter dieser Ruf ward, je ungestümer er sich vordrängte und die Entsagung überbot, um so mehr erbebte und erschrak Margas Seele. Das Unbekannte, das sie gefürchtet hatte — da war es! Da brach es hervor, nicht mehr zu unterdrücken, nicht mehr zu verkennen und zu mißdeuten: sie liebte! ... Wie ein Schauer, jubelnd und entsetzt zugleich, wogte es über die Saiten. Einen Augenblick verlor sie sich dabei. Ein zartes, fast heiteres Entzücken wollte sich regen. Dann riß sie mit einem grellen Strich über alle Saiten ihr Spiel ab. Sie ließ die Geige hart auf den Tisch fallen und warf den Bogen daneben. Sie drückte sich in die Ecke des Sofas: das Gesicht mit den Händen verdeckend, duckte sie sich und zog sich zusammen, als wollte sie sich in sich selber verbergen.
Nach einer Weile warf sie die Hände hinter sich und spannte sie um die Lehne des Sofas. Als sähe sie die Gewißheit ihrer Empfindung außer sich, richtete sie mit allem Mut, den sie in sich fand, die Augen voll und fest auf einen fernen, brennenden Punkt. Und dieser Punkt dehnte[S. 95] sich aus, gewann Form und Ausdruck und Leben: es waren Max Perthes' Züge, die sie nie gesehen, die sie nur aus flüchtiger Beschreibung kannte, und die doch ihr inneres Gesicht so bestimmt gestaltete. Sie schaute und schaute. Die Augen gingen ihr über vor dem offenen, klaren Ja, das da außer ihr stand. Aber sie ließ nicht nach und rang nach neuer Kraft: ebenso klar und unerbittlich mußte das Nein in ihr werden. Sie klammerte sich an ihren Stolz. Perthes liebte sie nicht. Er fühlte sich von einem Mädchen gefesselt, das in allen Stücken ihr Gegenbild war; für das er sie verleugnete. Und sie sollte ihre heiligsten Empfindungen wecken, ihre tiefste Seele, ihr Bestes wegwerfen, nachwerfen? Niemals! Und hätte ihr Stolz es ihr erlaubt, so hätte die Vernunft es verboten. Für sie gab es keine Liebe. Sie, die Blinde, durfte von keinem Manne, auch wenn er es wirklich ihr geboten, das Opfer seines Lebens annehmen. Die Entsagung hatte recht, nicht die Sehnsucht. Wollte sie sich lächerlich und verächtlich machen? Wollte sie gewissenlos sein?
Marga preßte ihre Hände ineinander und rang sie in ihrem Schoß.
Sie zwang mit dem Nein ihres Willens das Ja ihrer Liebe. Es war, als müßte sie es erwürgen, und weil es ein Lebendiges war, sträubte es sich gegen den Tod und klagte und schrie, und ihre Hände taten ihrem Herzen weh, über alles Sagen und Denken weh.
Unaufhaltsam, wider ihren Willen, löste sich Träne auf Träne aus ihren Augen.
Dann war es mit einem Mal vorbei.
Sie liebte ihn nicht. Es gab keine Liebe für sie, und es gab keine Liebe ohne Gegenliebe. Vielleicht gab es[S. 96] nicht einmal mehr Freundschaft zwischen ihr und ihm. Nachdem er sich so benommen wie heute am Abend.
Marga stand auf und griff wieder nach ihrer Geige.
Aber spielen, sich vollends freispielen — das konnte sie noch nicht. Sie schloß die Geige in den Kasten und stellte sie beiseite. Dann ging sie zu den Schwestern hinunter, die jetzt zu singen aufgehört hatten und bei der Handarbeit im Wohnzimmer saßen. Sie plauderte mit, so gut es ging. Und es ging besser, als sie dachte ...
Schon am nächsten Vormittag kam Perthes vorbei.
Es war noch immer regnerisch. Er fand Marga nicht im Vorgarten. Als er im Haus nach ihr fragte, wies ihn Therese in den Salon.
Er mußte eine gute Weile warten, ehe sie kam. Wie sonst wollte er ihr die Hand schütteln, doch sie reichte sie ihm nicht zum Gruß. Sie war durchaus nicht steif und unfreundlich, aber von einer Gemessenheit, die Zurückhaltung auferlegte.
Perthes hatte ihre äußere Erscheinung meist nur obenhin betrachtet. Heute fiel ihm die besondere Weiblichkeit ihres Wesens auf, die Züge und Gebärden beherrschte: eine natürliche, anmutige Würde, die durch einen Schatten von Trauer noch gehoben wurde.
Sie hatte ihn mit ein paar Worten in die Glasveranda gebeten, die dem Salon vorgebaut war.
Auf einem Rundtisch von schwarzem Ebenholz mit bunt eingelegter Platte lag ihre feine Häkelarbeit. Sie setzte sich und ließ ihn gegenüber Platz nehmen.
Ein Scherz über den feierlichen Empfang schwebte Perthes auf der Zunge. Er brachte ihn nicht hervor. Ihre schweigsame Ruhe war ihm unbehaglich.
[S. 97] „Warum erzählen Sie mir nichts?” fragte Marga, nachdem sie einige Zeit gearbeitet hatte.
„Ich dachte, Sie würden mir erzählen. Mein Kopf ist heute schon ganz dumm vom Mikroskopieren. Ich wollte eine bestimmte Geschichte herausbekommen — die Struktur eines Muskelgewebes, in dem — doch das kann Sie nicht interessieren! Ich habe mich herumgequält und nichts gefunden. Um mir wieder guten Mut zu holen, bin ich zu Ihnen gekommen. Was haben Sie in den letzten Tagen getrieben?” Er sprach hastig und zerstreut. Seine Finger spielten nervös auf der Tischkante.
„Da werden Sie nichts Interessantes zu hören bekommen! Vorgestern sind die Schwestern und ich über die Berge gegangen. Das Wetter war zu schön. Man konnte nicht denken, daß es so wie heute kommen würde. Wir waren auf dem Schweikhartshof, hin und zurück zu Fuß. Gestern” — sie stockte — „gestern war ein Tag wie alle.”
„Das tut nichts! Erzählen Sie doch! Vom Morgen bis zum Abend! Gerade, wie Sie so einen Alltag verbringen, will ich wissen!” Es klang etwas Herrisches in seinen Worten, das Marga aufblicken machte. „Das möchte ich gern wissen,” verbesserte er sich.
Sie gehorchte. Langsam berichtete sie die Tagesereignisse. „Und gegen Abend —” Hier stockte sie wieder.
„Was war gegen Abend?”
„Gegen Abend gingen Elli und ich spazieren. Das heißt, Papa schickte uns zu einem Kollegen, und wir kamen tüchtig in den Regen.”
„Wo denn?” forschte er hartnäckig.
Jetzt hob Marga ihren Kopf mit eigentümlicher[S. 98] Bestimmtheit auf. Sie antwortete nicht. Mit einem unwilligen Ruck stand Perthes auf. Beinahe hätte er den Tisch umgeworfen. Er trat an die Scheiben und blickte hinunter in den Vorgarten, wo der Regen von den Bäumen tropfte. Ungestüm strich er den krausen schwarzen Bart und blies einen pfeifenden Laut durch die Lippen. Dann brach er los. „Sie wollen wissen, warum ich Sie und Fräulein Elli nicht grüßte?” stieß er wütend hervor.
Marga fuhr emsig in ihrer Arbeit fort.
„So fragen Sie mich doch!” knirschte er gequält.
Als Marga keine Anstalt machte, ihm zu Hilfe zu kommen, ergriff er den Stuhl, auf dem er gesessen, mit beiden Händen so heftig an der Lehne, daß er in den Fugen knackte. „Ich weiß ganz genau, daß das so nicht geht. Ich war einfach dumm und feig. So ungefähr wie der Vogel Strauß, der den Kopf in den Sand steckt, damit man ihn nicht sieht. Und so feig wie ein Mensch, der seine Freunde verleugnet, weil ...” Er vollendete den Satz nicht und ließ sich auf den Stuhl fallen. „Sie sind in vollem Recht, wenn Sie mir dafür den Laufpaß geben!”
Marga hielt in ihrer Häkelei inne. Ihre Züge hatten sich aufgehellt. „Da Sie so ehrlich sind, braucht es das nicht!” sagte sie einfach.
„Ehrlich! Ehrlich! Ich hätte viel früher ehrlich sein sollen! Ist das Freundschaft, wenn einer dem anderen das Wichtigste verbirgt, was mit ihm vorgeht? Ich bin in das Mädchen, mit dem ich Ihnen gestern abend begegnete, verliebt. Wußten Sie das?”
Marga nickte kaum merklich. Sie wußte es. Und doch meinte sie, es erst seit diesem Augenblick zu wissen — so[S. 99] schnitt ihr sein Bekenntnis in die Seele. Sie sah voraus, daß er ihr jetzt sein ganzes Herz ausschütten würde, genau wie damals, als sie am Gartenfest auf dem Weinberg beisammensaßen und er seine Zerrissenheit vor ihr aufdeckte. Das Weib in ihr, dessen Liebe sie niedergezwungen, wehrte sich gegen die Qual dieses Mitwissens. Die Freundin, der sein Vertrauen galt, mußte geduldig zuhören. Der Faden verwirrte sich unter ihren zitternden Fingern. Sie beugte sich tiefer und tiefer über das Gewirr und schien ganz damit beschäftigt, es zu lösen.
Und Perthes, der von dem, was in ihr vorging, nichts ahnte, begann in abgerissenen Sätzen, nur von sich und seinen Gefühlen erfüllt, seine Beichte. Er schilderte, wie das hübsche Ufermädchen ihn gefangen genommen. Allmählich, ohne daß er es wußte und wollte. Fester und immer fester. Wie er sie zuerst sah, im Stadtgarten; wie sie ihm mit der Musikmappe begegnete; wie er ihr Haus am Ufer entdeckte und immer wieder dort vorbeiging; wie er sie angesprochen, sie begleitet — alles schilderte er mit der mitleidlosen Genauigkeit eines Menschen, dem es wohltut, das, was er bisher in sich verschlossen, herausgeben zu dürfen. Leidenschaftlich zeichnete er den Eindruck von Hilde Königs äußerer Erscheinung. Ihre leichte, frische Kindlichkeit; ihre mädchenhafte Zurückhaltung neben ihrer selbstsicheren Freiheit. Erst als er von ihrem inneren Wert zu sprechen anfing, wurde er ungewisser. Seine Unklarheit über diesen Punkt, seine Zweifel verrieten sich in allgemeinen Behauptungen. „Sie ist nicht abgründig tief, nicht problematisch! Sie hat sicher nicht mehr Verstand als tausend Frauen. Oh — Schwersinnigkeit und Schwerlebigkeit, damit kann ich selber aufwarten! Was[S. 100] ich brauche, was ich bei den Frauen liebe, ist das Leichte, Duftige, Sonnige! Was über die eigenen unzufriedenen Grübeleien fortträgt! Was das Leben, statt zu Ekel und Last, zum schönen Spiel macht! Es taugt nichts, wenn zwei schwere Naturen sich zusammentun: sie reiben sich wund. Ein Falter muß es sein, der zu einem Kriechtier, wie ich es bin, paßt. Glauben Sie das nicht auch, Fräulein Marga? Hab' ich nicht recht? Sie wissen, wie ich bin. Sie als Freundin — Sie müssen mir raten! Sie kennen ja mich und meine Unrast und Verschrobenheit.”
Eine unbeabsichtigte, nervöse Selbstironie klang durch seine mit Bildern überladene Sprache.
Marga hatte es aufgegeben, den Faden ihrer Häkelarbeit zu entwirren. Sie hatte die Arbeit auf ihren Schoß sinken lassen. Bewegungslos empfing sie das Geständnis seiner Gefühle für eine andere. Zwei bittere Falten verlängerten die Winkel ihres schmalen, zusammengepreßten Mundes. Ihre Farbe war so durchsichtig, daß man das Blut an den Schläfen auf- und niedersteigen sah.
Daß er seine Neigung für diese andere so leidenschaftlich aussprach; daß er das Mädchen mit überschwenglichen Farben malte und gerade vor ihr, Marga, die lockende, leichte Äußerlichkeit im Gegensatz zur Innerlichkeit, der sie zugehörte und als Blinde doppelt zugehörte, als sein weibliches Ideal in den Himmel hob — das war es nicht, was sie am schwersten traf. Was ihr für den Augenblick alle Fassung rauben wollte und was über ihre Kraft ging, war die Gewißheit, daß er sich täuschte. Er täuschte sich über sich selbst, denn er war der Mann nicht, der an einem Schmetterling dauerndes Genügen fand. Er brauchte nicht eine Seele, die die seine über die Schwere der eigenen[S. 101] Natur und den Ernst des Daseins fortgaukelte, sondern eine, die sich mit ihm zusammen durchkämpfte und darüber emporhob. Er täuschte sich aber auch über Hilde König. Wenn Marga das nicht schon vorher gewußt hätte: seine Schilderung konnte ihr keinen Zweifel darüber lassen. Das Mädchen war nicht das unschuldige Kind, das er in ihr sah. Das Kind war vielmehr er, den seine praktische Unkenntnis weiblichen Wesens irreführte. Die Einfachheit, die er hinter ihrer schimmernden Jugendlichkeit vermutete, war Leere, und die selbstsichere Freiheit wurzelte in einem kühlen, berechnenden Herzen. Und er mußte seine Täuschung behalten. Sie, die Freundin, durfte nicht reden. Dazu hatte sie kein Recht, weder vor ihm noch vor dem Mädchen, das er liebte. Das war es, was Marga vor Schmerz und Bitterkeit erstarren machte; sie noch immer schweigen und bewegungslos dasitzen ließ, als er längst geendigt hatte.
„Sie sagen ja gar nichts! Reden Sie doch! Ich will wissen, wie Sie darüber denken!” drang Perthes vorwurfsvoll in sie. „Kennen Sie Hilde König?”
„Nein, ich kenne sie nicht,” kam es leise von Margas Lippen. Sie sagte nicht die volle Wahrheit, aber sie konnte nicht anders.
„Ich habe sie Ihnen geschildert. Sie können sich gewiß ein Bild von ihr machen, Fräulein Marga.”
„Auch das nicht!” gab sie noch leiser zurück. Sie war fest entschlossen, sich kein Urteil von ihm abzwingen zu lassen. Der Gedanke, daß sie dem Mädchen unrecht tun und die entfernteste Eifersucht ihre Meinung trüben könnte, bestärkte sie nur in ihrem Vorsatz.
„Aber raten können Sie mir doch! Sie kennen mich![S. 102] Sie müssen beurteilen können, ob ein Geschöpf, wie ich es Ihnen schilderte, das ist, was ich brauche. Ob Sie glauben, daß ich auf der rechten Fährte bin und mein Glück finden kann. Sie predigen mir ja immer, ich soll mich mehr auf mein Gefühl verlassen als auf meinen Verstand!”
Marga hätte ihm antworten können, was sie ihm kürzlich geantwortet hatte: daß es Gefühle gäbe, die unter den Gedanken, und andere, die über ihnen stünden; aber sie wollte nicht. „Wenn Sie Ihres Gefühls so sicher sind, brauchen Sie meinen Rat ja gar nicht,” sagte sie ausweichend.
„Und das heißen Sie Freundschaft? Verzeihen Sie, Fräulein Marga, aber jetzt sind wir quitt. Sie verleugnen mich innerlich genau so, wie ich es gestern äußerlich tat!” In unwillkürlicher Erregung schlug er mit dem Absatz mechanisch auf den Fußboden. Seine großen, braunen Augen schossen zornige Blitze auf ihr Antlitz, in das die verborgene Qual dieser Stunde trotz aller Beherrschung mehr und mehr ihre Zeichen grub. Wäre er weniger nur mit sich beschäftigt gewesen, so hätte ihm ihre Veränderung nicht entgehen können. So wiederholte er nur noch ingrimmiger: „Und das heißen Sie Freundschaft?!”
Marga straffte sich in ihren Stuhl zurück. Die Härte seines Vorwurfs gab ihr einen Teil ihrer Kraft wieder. Doch ehe sie antworten konnte, fuhr er aufgeregt fort: „Ich, der Freund, habe Ihnen mit einer Offenheit, wie ich sie sonst keinem Menschen zeige, gesagt, wie es um mich steht, und Sie, die Freundin —”
„Ich, die Freundin,” unterbrach ihn Marga mit bebender[S. 103] Stimme, „bin so offen wie Sie. Deshalb sage ich Ihnen: Was Sie von mir fordern, geht über die Freundschaft. Und wenn Sie mir dafür Ihre Freundschaft aufsagen wollen, Doktor Perthes! Was Sie von mir verlangen, kann keine Frau einem Mann erfüllen. Über Ihre Liebe müssen Sie selber mit sich einig werden. So wenig ich Ihr Leben für Sie leben kann, ebensowenig kann ich mich für diese Liebe verantwortlich machen. Aus Klugheit kann ich das nicht. Aus Selbstachtung nicht. Und aus Achtung vor Ihnen nicht!”
Perthes sah sie mit aufgerissenen Augen verwundert an. Die Gegenwehr, zu der sich ihr gemartertes Herz aufgerafft, um sich von dem Unmöglichen zu befreien, mit dem er sie peinigte, gab ihren Worten einen Ton von so leidenschaftlicher, bitterer Entschlossenheit, daß er sie kaum mehr erkannte. Eine stürmische Blutwelle hatte ihr Gesicht mit jäher Röte übergossen. Ihr Mund, ihre Stirn zuckte von schmerzlichen Falten. In ihren Augen glomm es wie ein Funke des Sehens. Dann sank sie erschöpft in ihre frühere Regungslosigkeit zurück.
Ein so schlechter Beobachter Perthes bis jetzt gewesen: für einen Moment war es ihm, als risse der Blitz eine meilenferne, ungeahnte Landschaft in sein Gesichtsfeld. Ob diese Blinde mehr für dich empfindet, als du ahnst? Ob sie dich liebt? — Eine Sekunde nur, und die Vermutung, die ihm unsinnig dünkte, war ausgelöscht. Nur der Respekt vor ihrem unbeugsamen Willen erfüllte ihn und dämpfte seinen Ärger. Seine Verstimmung kehrte sich gegen ihn selbst.
„Lassen wir's gut sein! Ich überspanne die Pflicht der Freundschaft, wie ich alles überspanne. Ich werde[S. 104] ein andermal anspruchsloser sein, Fräulein Marga.” Er hatte sich erhoben und verabschiedete sich.
Der Druck seiner Hand kam Marga kühl und abwesend vor. Sie hätte ihn gern wie sonst nach der Tür begleitet. Aber ihre Kraft reichte nicht aus.
Als er längst gegangen war, saß sie noch immer reglos und ohne die Arbeit wieder aufzunehmen an dem eingelegten Ebenholztisch in der Glasveranda. Der Regen schlug dumpf gegen die Scheiben. Eine starre Gleichgültigkeit und Öde lähmte ihre Sinne und Gedanken. Mochte die Freundschaft zu Ende sein — was lag ihr noch daran! Sie hatte nicht anders gekonnt ...
Es sah allerdings danach aus, als sei es nach dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der erst vor einigen Wochen geschlossenen Freundschaft tatsächlich zu Ende. Tag um Tag verging, ohne daß Perthes sich wieder im Haus am Wenzelsberg sehen ließ. Für Marga war es eine Zeit voll Sorgen und Selbstanklagen. Das quälerische Auf und Ab und Hin und Wider ihres Herzens ermüdete sie so, daß sie bisweilen am hellen Tag von einem kurzen, erquickungslosen Schlaf befallen wurde. Hundertmal wiederholte sie sich, was sie an jenem kritischen Vormittag gesprochen und wie sie sich voneinander getrennt hatten. Jedes seiner Worte, jedes der ihren wog sie ab und wandte es nach beiden Seiten. War sie zu schroff gewesen? Hatte sie nicht doch mit ihrer strengen Scheidung von mein und dein die Pflicht der Freundschaft verletzt? Sie mußte ihm lieblos und egoistisch vorgekommen sein. Er konnte die Beharrlichkeit nicht verstanden haben, mit der sie ihm ihren Rat verweigerte. Warum sagte sie nicht ehrlich: Sie irren sich über das, was Sie brauchen![S. 105] Sie täuschen sich über sich selbst und über das Mädchen, das Sie zu lieben meinen. Ihre Tiefe braucht nicht Oberfläche, sondern wieder Tiefe. Sie brauchen ... Margas Gedanken stockten. Es überfiel sie wie Scham; als hätte sie gesprochen, was sie nicht durfte, das Geheimnis ihrer Liebe preisgegeben, ihm zugerufen: Mich, mich brauchst du! Ich verstehe dich besser, als du dich selbst verstehst! Ich kann dir aus meiner Stille und Klarheit die deine finden helfen — — Wie? Sie hätte sich angeboten? Sie, Marga, die Stolze, Verschlossene und Einsame! Schande, Schande, es nur zu denken! Nicht ein Wort durfte ihn auf den Gedanken ihrer Liebe bringen. Sie hatte schweigen müssen. Die Pflicht, die sie vor sich selbst hatte, war und blieb die höhere, und wenn sie daran verbluten sollte ...
Wenn sich Marga so immer wieder zum selben Ergebnis durchkämpfte — die Sorge um Perthes konnte sie damit nicht verbannen. Sie wuchs mit jedem weiteren Tag, den er fernblieb. Das untrügliche Ferngefühl, das ihre Seele wie einen Ersatz für die erloschenen Augen in ihr ausgebildet hatte, war seltsam wach in ihr: die Enttäuschung über Hilde König mußte unaufhaltsam über ihn kommen. Vielleicht war sie schon da, und Perthes war unter den Trümmern seiner hochgestimmten Hoffnungen niedergebrochen. Maßlos, wie er war, mußte die Ernüchterung alles in ihm umstürzen. Wohin ihn dann seine Leidenschaftlichkeit trieb — wer konnte es ausdenken? Marga sah sich von einer grausamen Furcht gepackt. Sie forschte nach allen Seiten, um unauffällig eine Nachricht über ihn zu erhaschen.
Es war wenig und widersprechend genug, was sie erfuhr.
[S. 106] Elli und Käthe lebten und webten in den Vergnügungen des Sommersemesters. Bald war es eine Damenkneipe, zu der die Erlaubnis dem alten Herrn abgelistet werden mußte, bald ein Stiftungsfest mit Ausfahrt oder ein verspäteter musikalischer Tee — eine Neuerung im gesellschaftlichen Leben, die Vater Richthoff grimmig verabscheute. Begreiflich, daß die beiden jungen Mädchen dabei von ihren Gedanken und Empfindungen, von „ihren” Herren zu erfüllt waren, als daß sie auf Doktor Perthes, den man ja doch nirgends traf, geachtet hätten. Elli wollte ihn in einem weißen Tennisanzug gesehen haben: vielleicht gehörte er neuerdings zu dem Sportklub, in dessen Mittelpunkt Fräulein Exzellenz, Alice Hupfeld, stand. Es war dies ein Kreis, der dem Richthoffschen so fern stand, daß er ihn trotz der akademischen Beziehungen kaum berührte. Ein andermal berichtete Käthe, Perthes hätte seine Spaziergänge in der Uferstraße so gut wie ganz aufgegeben. Das hatte sie von ihrer Freundin Lizzie gehört, die ja dort wohnte. Endlich war er mit Hilde König eines Abends im Stadtgarten gesichtet worden. Lauter Nachrichten, die Marga nur hin und her rissen, zu Vermutungen brachten, die sich nicht zusammenreimen ließen, sondern sie nur noch unruhiger und trauriger machten.
Die dritte Woche war angebrochen.
Perthes kam so wenig wie in den beiden vorigen.
Nun fiel sein Ausbleiben auch den Schwestern auf. Käthe bemerkte gelegentlich zu Marga, die Mediziner wären eben doch „immer” unzuverlässig. Elli, die aus ihrer Neigung für Wilkens heraus etwas von Margas Kummer witterte, erklärte, von der altklugen Weisheit Käthes angesteckt, ein Mann, der sie wegen eines anderen Mädchens[S. 107] nicht grüßte, wäre ihr so viel wert: sie blies höchst geringschätzig über ihren Handrücken. Dann schloß sie unvermittelt Marga in die Arme, küßte sie und versicherte: „Ich, Margakind, ich bin eben doch dein einziger, getreuester Liebhaber! Das merk dir und verrate mich nicht für solche Bazillengucker!” Der Spaß war harmlos und ehrlich gemeint. Daß er dabei so herzhaft weh tat, ahnte Elli nicht von ferne.
Und zu guter Letzt ließ sich bei einem Mittagessen sogar der Geheimrat vernehmen: „Was macht denn dein — dein — na, wie heißt er denn? Der Sparafantel aus Hemsbach, der dich unterrichten wollte?”
Marga zuckte die Achseln. Ehe sie antworten mußte, fiel dem alten Herrn glücklicherweise eine Briefschuld an Schlutius in Bonn aufs Herz. Darüber vergaß er völlig, seine Frage zu erneuern. —
Gegen den ihr sonst so lieben Platz im Vorgarten hatte Marga eine merkwürdige Abneigung bekommen. Als Tag um Tag verstrich, ohne daß Perthes mit seinem eiligen Schritt die Treppe heraufkam, um sich neben sie unter die Kastanien zu setzen, wurde ihr der Ort, der Zeuge freundlicher Stunden gewesen war und jetzt ihre Erwartung immer aufs neue trog, unerträglich. Sie zog es vor, die Zeit, in der sie sich selbst überlassen blieb, in der Geißblattlaube zuzubringen, am Ende des Blumengartens, dort, wo die ersten Stufen zu den Obstbäumen führten.
Es war ein besonders warmer, fast schwüler Vormittag, als sie dort, wie gewöhnlich, saß. Sie hatte eins ihrer Blindenbücher mitgenommen, von denen sie eine kleine Bibliothek besaß, die zu Weihnachten oder zum Geburtstag ihre stetige Ergänzung erfuhr. Der große, beleibte[S. 108] Band — Storms „Schimmelreiter” — nahm aufgeschlagen beinahe die Hälfte des Tisches ein. Ihre Finger tasteten von Punkt zu Punkt, und ihre Lippen lasen leise mit.
Im Schatten der dichtgewachsenen Blätter, die das Sonnenlicht zu einer goldgrünen Dämmerung dämpften, saß es sich gut. Die schwermütige Versonnenheit der Erzählung wirkte beruhigend auf Margas wunde Seele. Sie war so in ihr Lesen vertieft, daß sie überhörte, wie jemand vom Hof heraufkam. Elli kehrte von der Stadt zurück. Den rosenumrankten Strohhut, der schief und keck über dem krausen blonden Haar saß, hatte sie in den Nacken zurückgeschoben, und das erhitzte Gesicht fächelte sie mit dem Taschentuch.
„Uff! ich sag' dir, Margakind, das ist eine Hitze —”
Marga sah auf und schob ihr Buch zurück.
„Unausstehlich!” fuhr Elli fort, während sie sich neben sie auf die Bank setzte. „Du hast's gut hier im Schatten.”
„Wo warst du denn?” fragte Marga.
„Im Bad. Köstlich! Ich schwimme jetzt wie ein Fisch. Am liebsten hätt' ich gleich den ganzen Fluß ausgetrunken.”
„Und dann hast du dich so heiß gerannt? Das ist aber töricht, Kleinchen!” meinte Marga, während sie Ellis Wangen berührte. „Du glühst ja wie ein Backofen!”
„Ach was, dafür bring' ich dir auch eine Neuigkeit mit! Rate mal, was!”
Marga konnte nichts erraten.
„Es hat sich jemand verlobt,” half Elli. „Schon vor drei Tagen hat es in der Zeitung gestanden, und wir haben's übersehen. Rate, wer!”
Marga schüttelte den Kopf. „Kenn' ich den ‚Jemand‛ überhaupt?”
[S. 109] „O — ich glaube wohl!”
„Ist es eine von deinen oder von Käthes Freundinnen?”
„Nein, durchaus nicht. Auch keine von deinen.”
„Wo wohnt sie denn?”
„Am Fluß. In der Uferstraße. Jetzt mußt du doch dahinterkommen!”
Marga schrak unwillkürlich zusammen und erbleichte. „Hilde König?” fragte sie tonlos.
„Erraten!” rief Elli. „Aber mit wem? Das errätst du noch viel weniger. Das —” Elli hielt in ihrem lustigen Bericht inne.
Marga hatte alle Farbe verloren. Ihre Hände zitterten, und ihr Kopf bog sich zurück, bis er an der Wand der Laube, zwischen den Blättern einen Halt fand. Die Augen waren geschlossen, und die Lippen rangen nach Luft.
Elli war aufgesprungen. Bestürzt schob sie ihr die Arme um die Schultern.
„Aber Margakind! Was hast du denn? Was machst du denn? So sei doch verständig!”
Plötzlich schoß ihr die Erklärung durch den Sinn. Sie erriet, welchen Namen Marga zu hören fürchtete, und begriff das ganze, ängstlich behütete, schwere Geheimnis der Schwester.
„Aber nein! nein! nein!” rief Elli und umschlang sie noch fester. „Nicht mit dem! Nicht mit Doktor Perthes! Ganz gewiß nicht! Mit einem Gymnasiallehrer, den du gar nicht kennst! Du kannst mir's glauben, Margakind! Ich wollte nur einen Scherz machen! Ich hatte ja keine Ahnung, daß —” Sie bedeckte sie mit Küssen. Sie war unglücklich, den Tränen nahe, empört über sich und ihre Plumpheit und verwirrt durch das Neue, Unerwartete,[S. 110] das ihr die Erschütterung der Schwester zu verstehen gab.
Marga schlug langsam die Augen wieder auf. Sie zitterte noch immer. Aber sie versuchte zu lächeln. „Wie dumm ich bin!” flüsterte sie. „So — schwach zu sein!” Sie richtete sich auf und löste sanft Ellis Arme von ihrem Nacken. Eine rührende Mischung von Verlegenheit und Hilflosigkeit malte sich in ihrem Gesicht.
Elli zog sie aus der Laube. „Komm! Komm! Im Hof ist's jetzt wundervoll kühl. Da gehen wir auf und ab!” Sie nahm Margas Arm und legte ihn sich um die Hüfte. Ihr ganzes überströmendes Herz war erwacht. Sie drängte sich, zutraulich wie ein kleiner Vogel, an Marga und suchte ihr teilnehmendes Verstehen durch verdoppelte Zärtlichkeit auszudrücken. Obwohl ihr tausend Fragen auf den Lippen schwebten, die zu unterdrücken für ihre Quecksilbernatur kein leichtes war, wartete sie eine gute Weile und schritt, Seite an Seite mit Marga, schweigend im schattigen Hof auf und ab. Dann drückte sie ihr den Arm. „Ich versteh' dich ganz, Marga! Du brauchst mir, wenn du nicht willst, kein Wort zu sagen. Ich versteh' dich und achte dich. Und was wir da in der Laube sagten und fühlten, gehört nur uns beiden allein! Ich denke mir nichts und erinnere dich nie daran. Husch — ist es fort. Ich weiß nichts mehr davon!”
Marga schüttelte den Kopf. „Nein, nein, Elli!” meinte sie ernsthaft. „Wenn ich mich schon verraten mußte, war's bei dir am besten. Denn zu dir hab' ich das meiste Vertrauen.” Es war ihr eine Erleichterung, zu reden. Die Qual der letzten Wochen, die ihr Inneres um und um gewühlt hatte, verlangte danach, sich auszuströmen. Erst[S. 111] scheu und zaudernd, dann tapfer und rückhaltlos enthüllte sie das Geheimnis ihrer Liebe; wie sie sie entdeckt und niedergekämpft hatte; wie sie sie für immer in sich verbergen und niederhalten wollte und mußte. Ihr Stolz und ihre Besonnenheit kräftigten sich wieder, während sie erzählte.
Elli hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Sie war glücklich darüber, Margas Vertraute zu werden. Ihre Liebe zu Wilkens, die ja doch auch, freilich mit einem größeren Recht auf Wirklichkeit, in eine noch recht ferne Zukunft baute, wollte die hoffnungslose Entsagung für niemanden gelten lassen. Wenn man bisher stillschweigend immer nur angenommen hatte, Marga müsse ihren Weg durchs Leben allein gehen, so war das schließlich noch kein unumstößlicher Beweis, daß das Leben es doch nicht anders wollte. Und als Marga ihr Geständnis beendigt hatte, da ließ Elli ihrem fröhlichen Optimismus voll die Zügel schießen: nicht nur aus Mitgefühl, sondern in der ehrlichen Überzeugung und in dem heißen Wunsch, auch die Schwester, gerade sie in ihrer Dunkelheit, könne und müsse lieben dürfen und geliebt werden. Ihre jugendliche Phantasie ersann einen ganzen Roman, den sie glaubte und glauben machen wollte. Und Marga, auch wenn sie ungläubig blieb, hielt sich doch mit geheimem Entzücken an diesen Zuspruch. Ist ja doch kein Menschenherz, und zumal kein junges, so untröstlich düster, daß es nicht in seinem verborgensten Winkel mit einem Stäubchen Hoffnung spielte! Mehr und mehr erschloß sie sich dem Vertrauen, das sich ihr bot. Auch ihre Angst um Perthes, ihre Sorge, er möchte sich, wenn er nun die Verlobung Hilde Königs erfuhr, in seiner Verzweiflung verlieren, teilte sie mit Elli.
[S. 112] Und das Kleinchen riet kühn und praktisch, was Marga selbst sich nicht zu raten wagte. „Weißt du was? Du mußt ihm einfach schreiben!” platzte sie siegesgewiß heraus.
„Aber das geht ja nicht!” wandte Marga zaghaft ein.
„Das geht nicht? Warum? Ich — ich, ja weißt du, ich schreibe natürlich nie an Wilkens.” Elli wurde ein bißchen rot, weil ihr einfiel, daß sie doch schon geschrieben. „Aber das ist ja ganz was anderes! Unsereiner soll nun mal nicht an Herren schreiben. Dafür sehen und sprechen wir uns öfter. Und du — bei dir ist das überhaupt ein Ausnahmefall! Du bist ein ganz anderer Mensch als wir. Du kannst dir ruhig das Recht nehmen. Auch als Freundin! Er kann's sogar beinahe von dir erwarten. Du mußt schreiben, Margakind! Glaub mir, du mußt!”
Vom Eßzimmer klang Händeklatschen. Käthe erschien in der Tür. „Aber wo steckt ihr denn? Es ist ja Essenszeit! Schnell! Schnell!”
Und Papa Richthoffs Stimme schallte paschahaft-unwirsch hinterdrein: „Was ist das für 'ne Wirtschaft! Ich soll wohl die Damen zu Tisch bitten?”
Marga und Elli eilten, was sie konnten, ins Haus und zu Tisch.
Während des Essens hatte Marga Zeit, sich Ellis Rat zu überlegen. Sie sah auch den Ausweg, zu schreiben, als den besten an. Die Bedenken, die ihr Gewissen nicht wegräumen konnte, beschwichtigte Ellis überzeugende Rabulistik. Überdies streichelte und zupfte das Kleinchen sie heimlich mehr als einmal unter dem Tisch und tuschelte ihr zu: „Es bleibt dabei. Du mußt! Gleich nachher!”
Bis der alte Herr, der in seiner Kaisergeschichte gerade bei der Verschwörung des Parthenius und Stephanus gegen[S. 113] Domitian war, energisch brummte: „Keine Verschwörungen bei Tisch! Das lieb' ich nicht, Mamsell Plappertasche!”
Kaum war die Mahlzeit vorbei, so verwickelten sich Elli und Käthe über eine selbst zu schneidernde Bluse in die dringendste Unterredung, der eine weitläufige Anprobe folgen mußte.
Der alte Herr ging in den Weinberg, um die gewohnte Besichtigung auf Unkraut und Schnecken vorzunehmen, ehe die Sprechstunde begann. Eine Sprechstunde, die jetzt, mitten im Semester, meist in eine Ruhestunde überging, wovon jedoch niemand etwas wissen durfte.
Marga hatte also Zeit und Gelegenheit, in der Dachstube oben den großen Schritt zu wagen.
Eine Weile saß sie unschlüssig vor ihrem Briefbogen. Allerhand Formbedenken wollten in ihr aufsteigen. Es war doch immerhin furchtbar schwer und ungewöhnlich, daß sie an einen Herrn schreiben sollte. Dann überwand ihr natürlicher und gesunder Wille diese Kleinlichkeiten. Was hatte auch all das neben dem Ernst ihres Gefühls und der peinigenden Ungewißheit über des Freundes Zustand zu bedeuten! Sie setzte Punkt an Punkt und schrieb, wie es das Herz ihr eingab:
„Lieber Herr Perthes!
Sie kommen nicht mehr zu mir. Also komme ich mit einigen Zeilen zu Ihnen. Ihre Freundin ist in Sorge um Sie. Wenn Sie ihr noch böse sind, weil sie Ihnen neulich nicht raten wollte, so geben Sie ihr jetzt Gelegenheit, ihre Widerspenstigkeit gutzumachen und mit Ihnen zu reden. Mir ist, als könnte ich Ihnen ein ganz klein wenig helfen, wie es die Freundschaft soll und muß.
Marga Richthoff.”
[S. 114] Kaum war Marga fertig, so erschien Elli. Sie übernahm es, die Adresse zu schreiben.
Dann wirbelte sie wie der Wind davon und steckte mit dem Hochgefühl, bei einer Großtat mitgeholfen zu haben, den Brief an der nächsten Ecke in den Kasten.
Fräulein Rosa Eschborn, Doktor Perthes' Mietswirtin, war an allerhand Logiergäste gewöhnt.
In den fünfzehn oder zwanzig Jahren, in denen sie das schmale, dreistöckige Haus auf der Altstadtseite des Flusses besaß, hatte sie es längst aufgegeben, an ihre Mieter andere als sehr allgemeine Anforderungen zu stellen. Sie mußten leidlich pünktlich bezahlen. Sie durften ihre Möbel nicht kurz und klein schlagen. Sie mußten ihre Liebschaften vor der Tür lassen. Das waren die goldenen Grundregeln des langen, dürren Fräuleins mit dem wachsgelben Gesicht unter den plattgeklebten, grauschwarzen Haarsträhnen und dem Spitzenhäubchen, mit den leidenschaftslosen Augen und der ewigen, erdbeerfarbenen Matinee, von der man sich, so sauber sie war, niemals denken konnte, daß sie neu gewesen. Was über die Grundregeln ging, mochten die Herren mit sich selber ausmachen. Sie zuckte mit keiner Miene, wenn Herr Müller bis Mittag hinter seiner Tür schnarchte; wenn Herr von Maier, ein Korpsfuchs, bisweilen aus Versehen oder in alkoholischer Benommenheit auf der Treppe schlief; wenn Herr Schmidt die Beine zum Fenster hinausbaumeln ließ, die Zigarettenstummel auf den Boden warf, Kleider und Wäsche wie Kraut und Rüben im Zimmer durcheinanderstreute.[S. 115] All das ertrug und ordnete sie mit ergebenem Gleichmut. Ihre stille Genugtuung, ihr sittlicher Halt war das eine, daß sie nicht so, daß sie besser war. Nicht nur als ihre Mieter, sondern als die gesamte Welt. Um dessen ihren Herrgott zu versichern, war sie von einer gewissen stereotypen Frömmigkeit, die keine Predigt und keine Betstunde versäumte.
Es mußte mit einem ihrer Mieter schon seine ganz besondere Bewandtnis haben, wenn Fräulein Eschborn sich zu wundern oder gar zu beunruhigen anfing.
Dieser Sonderfall war nun aber mit dem Herrn auf Nummer eins — so hieß die luftige Stube im dritten Stock mit der wie ein Vogelnest unters Dach geduckten Veranda — eingetreten. Er war nämlich seit drei Tagen nicht zurückgekehrt.
Am ersten Tag hatte das Fräulein gedacht, er schliefe. Es gab welche, die schliefen vom Abend bis zum Abend und die folgende Nacht durch. Solche Exemplare kamen vor. Wenn sie kein Frühstück und sonst nichts begehrten, so war das ihre Sache. Am zweiten Tag gegen Mittag klopfte die Eschborn an die Tür. Dreimal hintereinander. Als kein „Herein!” ertönte, überwand sie ihre jungfräuliche Scheu, klinkte, fand die Tür offen und steckte den Kopf mit dem Spitzenhäubchen schnüffelnd in die Stube. Da sie nichts wahrnahm, was sie aufklärte, drang sie gegen den Alkoven vor. Das Bett stand unberührt. Fräulein Eschborn schüttelte den Kopf. Am dritten Tag wiederholte sie dasselbe Manöver mit demselben Erfolg. Diesmal hielt sie ein kleines Selbstgespräch, öffnete ein Fenster und sah ziemlich verdutzt auf den Fluß hinunter. Ihr Gleichmut wankte. Sie ging den Schatz ihrer Erfahrungen[S. 116] durch, aber er ließ sie im Stich. Anno 1903 war einer gewesen, der auf zwei Tage zu Verwandten gereist war, ohne sie zu benachrichtigen. 1899 hatte einer, ein russischer Chemiker, vom Laboratorium weg plötzlich in die Klinik gemußt, um sich operieren zu lassen. Der hatte nach anderthalb Tagen nach Wäsche geschickt. Soweit sie die Lebensgewohnheiten ihres Mieters von Nummer eins überhaupt kannte, war er nicht der Regelmäßigste. Trotzdem — das ging über alles Dagewesene — drei Tage spurlos verschwunden! Fräulein Eschborn stellte vertiefte Betrachtungen an. Sie ging im Geist ihre Grundregeln durch. Keine war verletzt. Aber die erste vom Bezahlen schien jetzt in gewisser Gefahr. Konnte der Doktor sich französisch verabschiedet haben? Dagegen sprach, daß er sein Hab und Gut, sogar Mantel, Stock, die nötigsten Dinge, zurückgelassen hatte. Doch — mochte es sein, wie es wollte — sie entschloß sich, an Aufklärung zu denken.
Sie ging nach dem Bakteriologischen Institut, denn sie entsann sich, daß Perthes von dort einmal den Diener gesandt hatte.
Niemand, weder der Hauswart, noch der erste Assistent, noch Professor Hammann, wußte etwas von seinem Verbleib. Markwaldt hatte nur die tröstliche Auskunft: „Das verdrehte Huhn wird wieder mal seinen Laufkoller gekriegt haben!”
Fräulein Eschborn war nicht befriedigt. Sie ging auf dem Rückweg ins Café Wagner, wo ihr Mieter zu essen pflegte. Der Doktor war dort seit vier Tagen nicht gesehen worden.
Die Angelegenheit komplizierte sich.
Gegen ihre Gewohnheit konferierte das Fräulein mit[S. 117] Perthes' Zimmernachbar, einem Referendar am Amtsgericht. Der gab ihr auf Grund seiner juristischen Kenntnisse den Rat, auf die Polizei zu gehen. Diesen äußersten Schritt verschob die Eschborn auf den kommenden Morgen. Ihr zwar erschütterter, aber noch immer achtungswerter Gleichmut sträubte sich gegen solche Exzentrizitäten. Auch hielt sie die Polizei für die natürliche Feindin aller anständigen Menschen.
Und ihr Gleichmut behielt recht.
Am folgenden Morgen, als sie in der Küche die nötigen Liter Wasser mit einem Aufguß von Kaffeebohnen und reichlicher Zichorie versetzte, wurde die Tür aufgestoßen, und Doktor Perthes erschien in einem Aufzug, der mehr als abgerissen war, auf der Schwelle. Der Lodenhut saß wie ein Fetzen über den zerzausten Haaren, und das Gesicht starrte blaß und übernächtig aus dem wirren Bart. Die weißen Sportschuhe waren über und über mit einer Kruste von Schmutz bedeckt. Der weiße, leichte Tennisanzug hatte sich grau und braun meliert.
Fräulein Eschborn prallte erschrocken zurück. Sie wollte eben versichern, daß sie im Lokalwohltätigkeitsverein sei und keinen Pfennig gebe, als der Doktor rauh und herrisch nach Kaffee verlangte.
Sie faßte sich. Ohne eine Frage zu wagen, goß sie ihm eine Tasse ein.
Perthes trank sie in einem Zuge leer. Ebenso eine zweite. Mit einem barschen „Bin für nichts und niemand zu sprechen!” machte er kehrt und stieg die Treppe hinauf.
Fräulein Eschborn dachte einen Augenblick betroffen über die Erscheinung nach. Sie schüttelte auch noch ein letztes Mal den Kopf. Dann war sie froh, daß keine[S. 118] Grundregel mehr in Gefahr war, zog sich in ihre jungfräuliche Selbstgerechtigkeit zurück und legte den Fall zu den Akten ihrer Erfahrung.
Oben in seinem Zimmer warf sich Perthes, nachdem er die Schuhe in eine Ecke geschleudert, wie er war, auf sein Bett. Völlig erschöpft fiel er in einen bleischweren Schlaf.
Erst gegen Abend weckte ihn ein tiefer, langhallender Donnerschlag. Er richtete sich auf und rieb sich die Augen. Draußen schoß der Regen in langen, glitzrigen Fäden hernieder. Fahle Wolken schoben sich träge über und an den Bergen entlang. Ein Hauch feuchter Luft quoll erquickend durchs offene Fenster herein.
Langsam kehrte in Perthes die Erinnerung an die letzten Tage zurück. Er setzte die Geschehnisse, eines ums andere, in seinem Gedächtnis zusammen. Wie ein wunderseltener, tausendstrahliger Kristall, der mit jeder Stunde an Wert und Schönheit wuchs und sein Verlangen steigerte — so war die Liebe zu Hilde König, der kindlichen, poetischen Ufernixe, in seiner Phantasie groß geworden. Alles außer ihr war vergessen und versunken. Seine sich übersteigernde Lust, diesen Kristall zu besitzen, trieb ihn nah und näher an das schimmernde Gebilde. Er streckte die Hände danach aus: da war es eine buntschillernde Seifenblase, die in eitel Dunst zerplatzte und zerfuhr.
Als Perthes an jenem Vormittag, an dem er Marga seine Liebe zu Hilde König anvertraut, keinen Rat erhalten hatte und ganz auf sich selbst verwiesen worden war, hatte er einen letzten Versuch gemacht, die Leidenschaft, die ihn verzehrte, von sich abzuschütteln. Er zerpflückte seine Empfindungen und wollte sich klarmachen, daß er[S. 119] sich in einen Wahn hineingefühlt und hineingeredet hatte. Diese Liebe existierte so wenig, noch weniger als die Freundschaft, die eben erst so jämmerlich versagt hatte.
Er ging nicht mehr am Ufer entlang, wie er sonst Abend für Abend getan. Er wich Hilde König aus, wenn er ihr begegnete.
Um die törichte Liebelei vollends ganz aus sich zu verbannen, gab er sogar dem bisher erfolglosen Drängen Markwaldts nach und ließ sich in den akademischen Tennisklub einführen. Der freie, flotte Ton, der da herrschte — so recht modern im Gegensatz zu der mehr altmodischen Innerlichkeit und Behaglichkeit des Richthoffschen Kreises — bestrickte ihn. Im Mittelpunkt stand Alice Hupfeld. Mit ihrer biegsamen Gestalt, ihrem kecken Gamingesicht, das herausfordernd aus einem leuchtenden Gewirr rotblonder Haare sprang, behexte sie die Herren und begeisterte die jungen Damen als Ideal eines schicken Mädels. Perthes war von ihrer launenhaften Art bald belustigt, bald geärgert. Er spielte mit Fräulein Exzellenz, wie sie mit ihm und mit aller Welt spielte. Nichts zu ernst nehmen, war ihre Devise, und diese Devise schien ihm wie gemacht für seine eigene erzwungene Stimmung ...
Dann kam plötzlich der Rückschlag.
Er hatte sich eingebildet, mit dem albernen Märchen am Flußufer fertig zu sein. Um sich dies vor sich selber zu beglaubigen, hatte er eines Abends wieder den gewohnten Gang gemacht. Hilde König war nicht auf ihrem Balkon. Sie plauderte mit einem der Herren des Ruderklubs unter der Haustür. Bei näherem Zusehen erkannte Perthes den Gymnasialprofessor, der die Boote von der Uferböschung aus mit der Schalltube zu kommandieren pflegte.[S. 120] Aller Vernunft zum Trotz wurde er von plötzlicher toller Eifersucht gepackt. Binnen wenigen Stunden war seine Leidenschaft heller und greller als je entfacht. Daheim, zwischen seinen vier Wänden, tobte er mit erregten Schritten auf und nieder. Er wollte ein Ende machen, eine Entscheidung herbeiführen um jeden Preis. Dies Hundeleben von Zweifeln und Kämpfen durfte nicht von vorn anfangen. Er setzte sich an den Schreibtisch und schrieb einen Brief von vielen Seiten. Seine nervösen, unverbundenen Buchstaben flogen über das Papier wie ein Schwarm aufgescheuchter Krähen. Sich selbst, seine Natur mit ihren Fehlern und Vorzügen, seine Lebensauffassung, seine Gedanken über die Frau und über die Ehe, seine Aussichten im Beruf legte er in einem gewichtigen Referat nieder, wie es ein Beamter in ernstester Sache an seinen Ressortchef schreibt. Seine Gefühle faßte er volltönend zusammen: es gab nur einen Menschen, der ihn ganz zu dem machen konnte, was er sein wollte — Hilde König. Daß er sie verehrte und liebte, mußte sie längst erraten haben; daß er ihr nicht völlig gleichgültig wäre, glaubte er jenem Blick und diesem Wort entnehmen zu dürfen. In einem kurzen Schlußsatz bat er deshalb allen Rechtens um ihre Hand. Wenn sie einverstanden war, wollte er mit ihren Eltern sprechen ...
Als Perthes diesen Brief abgeschickt hatte, war er wie erlöst.
Einen halben Tag lang kannte er sich nicht vor seliger Selbstzufriedenheit. Dann kam die Qual des Wartens von Post zu Post, des Hangens und Bangens von Morgen zu Abend und von Abend zu Morgen.
Erst nach vier Tagen brachte der Briefbote ein zierliches[S. 121] Briefchen von lila Farbe, das Monogramm H. K. auf dem Rücken.
Er riß es ungestüm auf.
Die Antwort auf seine vielen Seiten bestand in vier oder fünf mit Kinderhand geschriebenen Zeilen: das bezaubernde kleine Ufermädchen schrieb, es sei über seinen Antrag außerordentlich betroffen und erschrocken; es hätte nie an so etwas gedacht und könne, jung wie es sei, auch heute noch nicht ernstlich daran denken ...
Perthes war starr vor Überraschung.
Er drehte die lilafarbene Briefkarte hin und her, als müßte er die eigentliche Antwort auf seinen kapitalen Brief erst noch finden. Daß er die ganze Erwiderung auf sein mit der Gründlichkeit eines Psychologen, dem Ernst eines gewissenhaften Mannes, der fieberhaften Wärme eines Liebenden geschriebenes Schriftstück in Händen halten sollte, begriff er erst im Verlauf von Stunden. Als er nicht mehr zweifeln konnte, zerriß er das Billettchen mechanisch in hundert Schnitzel und ließ sie aus dem Fenster flattern.
Im Zustand öder Empfindungslosigkeit verbrachte er eine Woche oder mehr.
Dann, eines Mittags, als er bei Tisch im Café Wagner den städtischen Anzeiger durchblätterte, fiel ihm eine liebevoll umzackte, schöngesetzte Anzeige in die Augen: Hilde König und Professor Enderlein empfahlen sich als Verlobte.
Er las die Nachricht ein halbes dutzendmal. Bei der siebenten Lesung lachte er so laut und schallend, daß die Leute an den Nachbartischen ihn mißtrauisch anschielten, als hätten sie es mit einem Ausbruch plötzlicher Verrücktheit zu tun. Er hatte die Situation zu begreifen begonnen:[S. 122] der ernsthaftere und gediegenere Antrag des Gymnasialprofessors mit der Schalltube war geahnt worden, aber noch nicht eingetroffen, als der seine eintraf. Das kindliche Lilabriefchen verfolgte seine sehr klugen, dilatorischen Zwecke. Und als ...
Perthes zog es vor, das Café zu verlassen, um nicht noch einmal der Gegenstand bedauernd-ängstlicher Blicke zu werden.
Auf der Straße lachte er von neuem. Es klang dumpfer, härter, verbissener.
Er schwänzte am Nachmittag das Institut. Gegen fünf warf er sich in sein Tenniskostüm und schlenderte den Fluß entlang, nach den Spielplätzen. Noch war er nicht an der Brücke vorbei, als seine künstliche Haltung zusammenbrach. Ein Sturm von Ekel, Verachtung, Schmerz und Wut ergriff ihn. Eine Weltverzweiflung ohnegleichen, ein Haß gegen sich und gegen die Menschheit insgesamt, gegen das ganze jämmerliche Erdendasein drohte ihn zu ersticken. Statt nach den Tennisplätzen lief er bis zum nächsten Dorf in der Ebene. Dann wieder bergwärts. In irgendeinem Wirtshaus an der Straße nächtigte er. In einem lichten Moment vertauschte er sein Tennisrakett leihweise mit einem Knotenstock. Drei Tage trieb er sich besinnungslos in den Bergen umher. Durch maßlose Anstrengungen suchte er den Aufruhr in seinem Innern abzumüden. Sein überreizter Kopf spielte mehr als einmal mit Selbstmordgedanken. Aber die Lilabriefkarte fiel ihm ein, die schöngezackte Verlobungsanzeige. Das Lächerliche, Niedrig-Komische, das in dieser Lösung einer von ihm bis in den Himmel gesteigerten Liebelei lag, bewahrte ihn vor der äußersten Torheit. Der „Laufkoller”, wie Doktor[S. 123] Markwaldt jenen Trieb getauft hatte, mit dem Perthes einer seelischen Unmäßigkeit durch eine körperliche Herr zu werden strebte, tat seine Schuldigkeit. Bis auf den Tod erschöpft, apathisch, innerlich und äußerlich abgerissen, kam er in Fräulein Eschborns Mietshaus zurück ...
Jetzt hatte er seine böse Wanderschaft ausgeschlafen wie einen Rausch. Was nachkam, war auch die grenzenlose Ernüchterung des Rausches.
Perthes sprang vom Bett auf und trat ans Fenster.
Das Gewitter vergrollte in der Ferne, dort, wo der Fluß zwischen einsamen Pappeln sich in der Ebene verlor. Die Sonne rang sich mit dunkelgoldenem Glanz aus dem abziehenden Gewölk, glitzerte sanft auf den Wellen und leckte die Dächer trocken. Die abendliche Luft in ihrer wiedergewonnenen Reinheit wehte kräftig gegen ihn.
Mit Ungeduld entledigte er sich der beschmutzten Kleider. Als gelte es, mit dem körperlichen Menschen auch den seelischen reinzuscheuern, überschwemmte er sich und die halbe Stube mit Wasser. Erst als er sich von Kopf bis zu Fuß umgezogen hatte, gab er Ruhe und setzte sich in den rohrgeflochtenen Schaukelstuhl. Mit seltener, kühler Klarheit hielt er Kritik über sich und sein Dasein in den letzten Jahren. Wenn er alles Drum und Dran an aufgeputzten Gedanken und verstiegenen Gefühlen abtat, erschien er sich wie ein großer, unreifer Junge, der mit den Gliedern seines Leibes so wenig anzufangen wußte wie mit den Fähigkeiten seines Geistes und darum beide mißbrauchte. Er war kein Mann. Mochte er sich vormachen, was er wollte: dem bißchen Leben, das da auf ihn zugekommen war, um ihn zu prüfen — dieser Verliebtheit und ihrer Enttäuschung hatte er seinen Mann nicht gestellt.[S. 124] Wie ein Junge — jawohl, wie ein Junge hatte er in ohnmächtiger Wut den Boden gestampft, geschrien, geheult und war ausgerissen! Nicht mehr Zorn und Verzweiflung erfaßte ihn jetzt, sondern eine tiefe Traurigkeit, eine zerknirschte Beschämung, ein hoffnungsloses Gefühl des Verlassenseins. Er wie kein anderer gehörte zu den Männern, deren Schicksal sich an den Frauen entscheidet. Sein Charakter konnte nur in der Liebe Klärung, Halt, sich selber finden. All sein Suchen von Wissenschaft zu Wissenschaft galt doch nur der Leibhaftigkeit des Lebens und nicht dem Wissen. Er konnte nicht allein sein, weil er allein nicht mit sich fertig wurde. An einen Menschen außer sich mußte er sich klammern können, um seiner eigenen Kraft teilhaftig zu werden. Er mußte weiter suchen und würde doch nur immer irren. Sein zufassendes Temperament, das stets zuerst das Ziel begehrte, ermattete vor der trostlosen Ziellosigkeit einer ewigen Irrfahrt. Die Erschlaffung des Herzens löste die des Körpers ab. So allein wie er war niemand. So zur Einsamkeit verdammt und zur Zweisamkeit geschaffen. Diese Erkenntnis hatte er gewonnen, und im gleichen Augenblick, wo sie sich ihm gab, drückte sie ihn zu Boden.
Es hatte an die Tür seines Zimmers gepocht, ohne daß er darauf geachtet.
Das Klopfen wurde wiederholt, und Perthes rührte sich nicht. Er hatte ja gesagt, daß er nicht gestört sein wollte. Vergeblich drückte der Einlaßbegehrende die Klinke nieder. Die Tür war verschlossen. Ein unwilliges Brummen ließ sich von draußen hören. Dann erfolgte ein Rascheln auf der Schwelle, und durch die Spalte unter der Tür schob sich ein Brief.
[S. 125] Der Briefbote stapfte laut die Treppe wieder hinunter.
Bei dem raschelnden Geräusch hatte Perthes unwillkürlich den Kopf nach der Tür gewandt. Er sah den eingeklemmten Brief.
Der konnte warten.
Schließlich erhob er sich doch und nahm ihn auf.
Die Adresse war in einer kecken, schnörkellustigen Damenhandschrift hingeworfen, die er nicht kannte. Nachlässig öffnete er das Kuvert. Ein Bogen mit Blindenschrift fiel ihm entgegen.
Marga Richthoff stand mit Bleistift, schief, aber in sicheren Zügen unter den Punkten.
Halb neugierig, halb mißtrauisch las er die Zeilen.
Er legte das Blatt auf den Tisch, stützte die Arme auf und beugte sich, den Kopf zwischen die Hände fassend, darüber.
Da gab es also doch jemand, der sich um ihn kümmerte.
Seltsam!
Seine Mundwinkel zuckten bitter. Er überlegte. In den letzten Wochen hatte er blutwenig an Marga gedacht. Wenn sie einmal vor ihm auftauchte, drängte er sie in dem Mißbehagen über die unerfreuliche letzte Begegnung beiseite. Vollends in den Tagen seines unsinnigen Umhertreibens war sie für ihn wie ausgelöscht gewesen.
Und jetzt ging von ihren paar Zeilen, die so einfach und gerade waren, ein eigentümlich beruhigendes, warmes Gefühl auf ihn über. Er verglich diese Zeilen im Geist mit dem nichtssagenden Billett von Hilde König, das seine Krisis eingeleitet hatte, und Margas Gesicht tauchte vor ihm auf: das weiche, verlittene und doch von einer inneren[S. 126] Sonne verklärte Gesicht der Blinden, ihre ruhigen Bewegungen, ihre sanfte Bestimmtheit in Wort und Ton. Er meinte die blicklosen, tiefen Augen mit ihrem anspruchslosen zarten Blau dringend und bittend sich zugewandt zu sehen. Wie mit einer geheimen Fernkraft, die in dem Stückchen Papier, den paar Punkten und den paar Buchstaben des Namenszuges ihre Leitung gefunden, wirkte ihr Wesen auf ihn. Noch nie war ihm die große, reife Stille dieses Wesens so lebendig nahegetreten. Warum hatte er sie nicht früher so klar erkannt wie jetzt? Warum hatte er ihr nicht fester vertraut? Warum hatte er sich so schnell abkühlen lassen und war nicht zu ihr gegangen, statt sich närrisch und kindisch auszutoben? „Ihre Freundin ist in Sorge um Sie” — das waren die Worte, die er sich wiederholte und immer wiederholte. Sie wollte ihm helfen; sie hatte nicht wissen können, wie schwach er war, als sie ihn auf sich selber verwies. Jetzt, durch ihre Zeilen hatte sie ihm geholfen! Ein Hauch des Friedens, nach dem er sich sehnte, streifte ihn. Er war nicht ganz allein. Der Druck der Einsamkeit wich, und dafür wuchs eine leise Freude in ihm auf. Eine Dankbarkeit, die durch das Bewußtsein, Marga unrecht getan, sie verkannt, sie noch nie in ihrem vollen Wert geschätzt zu haben, zu einer Schuld wurde, die er abtragen wollte. Er mußte ihr etwas Gutes erweisen. Ihr seine Achtung, seine Verehrung, seinen Dank bezeugen. Und wie er nun einmal war, mußte er es gleich tun, gleich — es duldete keinen Aufschub! Er hatte sie lange genug vernachlässigt!
Eine Minute später stürmte Perthes die Treppe hinunter, die er am Morgen erschöpft heraufgekrochen war. Im Hausflur hätte er um ein Haar Fräulein Eschborn[S. 127] umgestoßen, die ihren Augen nicht traute, als der Doktor mit freundlichem Kopfnicken, vergnügt und tadellos gekleidet, an ihr vorbeischoß. Kein Zweifel — der Mieter von Nummer eins gehörte einer Spezies zu, die ihr doch noch nicht vorgekommen war.
Perthes lief, nur seiner Eingebung folgend, dem nächsten besten Blumengärtner in den Laden. Er wollte Rosen haben. Rote? Nein. Rote paßten nicht. Weiße? Die hatten etwas Trauriges. Rote und Weiße, so ungefähr einen Armvoll.
Mit dieser Bürde eilte er nach der Straße am Wenzelsberg.
Er sah weder rechts noch links. Er bemerkte deshalb nicht, daß unterschiedliche Spaziergänger, die ihm begegneten, über sein blindes Rennen und über seinen Arm voll Rosen die Köpfe schüttelten. Er sah auch Alice Hupfeld nicht, die, vom Sportplatz zurückkehrend, wo man der Nässe wegen doch nicht hatte spielen können, mit Markwaldt an einer Ecke plauderte und bei Perthes' Anblick eine vieldeutige Grimasse schnitt. Erst in der Nähe des Richthoffschen Hauses verlangsamte er seinen Lauf.
Er sah auf die Uhr. Es war gleich halb acht. Soviel er sich entsinnen konnte, also die Zeit, wo bei Richthoffs Abendbrot gegessen wurde. Dann blickte er auf seine Rosen. Eigentlich — genau genommen — das, was er wollte, hatte seine Bedenken. Wenn ihm der alte Herr entgegenkam? Wenn — und wenn ... Ein Wenn ums andere verzögerte seinen Schritt.
Er war dicht am Haus. Dort war der Vorgarten, über der Mauer, hinter der geflochtenen Eisenbalustrade. Er ging auf die andere Seite der Straße. Da saß richtig[S. 128] jemand unter den Kastanien. Es war Marga. Sie hatte sich eine Decke auf die Bank gelegt. Die Abendsonne hatte den Kiesboden leidlich getrocknet, und sie genoß die regenfrische Luft. Als er sie gewahrte, sank ihm erst recht der Mut. Die Scheu, nach dem, was er eben erst hinter sich hatte, unvermittelt vor sie hinzutreten, hielt ihn unschlüssig zurück. Sollte er umkehren? Bis morgen warten?
Ratlos wandte er den Blick hinter sich, die Straße hinunter.
Leicht und schnell kam ein junges Mädchen um die Ecke der nächsten Seitenstraße, in einer duftigen weißen Bluse.
Es war Elli.
Mit ein paar Schritten war Perthes bei ihr. Er grüßte: „Wollen Sie mir einen großen Gefallen tun, Fräulein Richthoff?” fragte er hastig und ohne Umschweife.
Elli sah ihn aus schalkhaften Augen verwundert, ein klein wenig spöttisch an.
„Bitte, geben Sie das Fräulein Marga!” Er reichte ihr seinen Bund von weißen und roten Rosen.
„Aber, sie sitzt ja dort!” lachte Elli. „Bringen Sie ihr's doch selbst!”
„Das geht nicht! Nein, nein —” wehrte Perthes und drängte ihr den Strauß in die Hände.
„Und was soll ich bestellen?”
„Gar nichts, oder doch —” Er überlegte. „Doch, sagen Sie — sagen Sie, dem Freund sei geholfen! Er danke der Freundin!” Und als fürchte er irgendwelche Einwände, schwenkte er seinen Hut und machte sich schnurstracks davon.
Elli besann sich nicht lange. Das Haustor erreichen,[S. 129] die Stufen hinaufspringen und auf Marga zueilen, war eins.
„Da, Margakind, da!” Sie schob den duftenden Strauß der Schwester so heftig entgegen, daß diese betroffen zurückfuhr.
„Aber was ist denn nur?” stammelte Marga.
„Von Doktor Perthes!” erklärte Elli außer Atem und triumphierend. Dann wiederholte sie getreu seine Worte: Dem Freund sei geholfen. Er danke der Freundin!
Und Marga ergriff das lockere volle Gebinde mit zitternden Händen. Sie vergrub ihr Gesicht tief, tief in die roten und weißen Rosen ...
Es war erst Anfang Juli und noch vier Wochen bis Semesterschluß. Trotzdem hatte Vater Richthoff, unerwartet und überraschend, beschlossen, zu reisen. Er brach seine Vorlesungen und Seminarübungen ab. Als ausgemachte Sache verkündigte er seinen Mädels, daß er nach Kissingen fahre. Käthe solle ihn begleiten. Es war Mittwoch. Bis spätestens Montag müsse man fahren können.
Kein Wunder, daß dieser allerhöchste Ukas das Haus am Wenzelsberg von oben bis unten umkehrte. Die Mädels hatten, zum mindesten in der Idee, so viel zu tun, daß sie gar nicht wußten, wo anfangen. Es galt nicht nur tausend Dinge zu besorgen, sondern, was noch viel zeitraubender war, zu bereden. Nach den Gründen zu forschen, die den jähen Aufbruch des alten Herrn veranlaßten, getrauten sie sich nicht.
Diese Gründe würde der alte Herr auch keinesfalls[S. 130] verraten haben. Sie waren ihm selbst erst zwei Tage vor dem Entschluß einleuchtend gemacht worden. Und zwar vom Arzt. Seine „Bande” brauchte von der fatalen Vorgeschichte nichts zu wissen.
Am Montag war, wie alle vierzehn Tage, Kegelabend gewesen. Da pflegten sich der Geheimrat, Wilmanns, Borngräber und einige Freunde von verschiedenen Fakultäten gemütlich in einer bejahrten Schenke am Haspelgraben zu treffen und ihrer wissenschaftlichen Übersättigung im Kegelschieben Luft zu machen. Außerdem wurde auch das Neueste vom Neuen aus akademischen Kreisen kolportiert und glossiert. Nur so nebenbei, aber mit vernichtendem Witz. Jede Fakultät hatte dafür ihren Spezialisten. Den Klatsch der philosophischen bearbeitete Papa Wilmanns; den juristischen gab Geheimrat Roller, ein Epikureer mit ehrwürdigem Faungesicht, sehr pikant zum besten. Der theologische troff süß und lieblich aus dem sanften Mund des Professors Hegewald, eines beliebten Damenpredigers von weicher, hoher Christusgestalt; den naturwissenschaftlich-mathematischen brachte Krausewetter, ein dicker, sehr cholerischer Herr, der alle Entdeckungen anderer schon lange vorher gemacht und nur, da sie ihm nebensächlich erschienen waren, verschwiegen hatte. Dem medizinischen endlich widmete sich mit trockenem, sachlichem Spott Geheimrat Geismar, in seiner nüchternen, bescheidenen Zurückhaltung der wandelnde Gegensatz seines Kollegen Hupfeld, der vielbesprochenen chirurgischen Exzellenz, die, erhaben über das kegelnde Banausentum, ihre eigene, nicht minder einflußreiche Sphäre hatte. Man tat niemand weh in der Kegelbahn am Haspelgraben. Dafür sorgten gutmütige Brummgeister wie[S. 131] Richthoff und naive Kindergemüter wie Jakobus Borngräber. Aber man verschonte auch niemand. Auch sich selber nicht.
Hier ereignete es sich nun, daß Vater Richthoff mitten im Spiel von einer Unpäßlichkeit befallen wurde. Professor Kreth, der liebenswürdige Direktor der Universitätsbibliothek, hatte gerade den klassischen Ausspruch eines norddeutschen Bibliothekars zitiert: Die Bibliotheken wären herrliche Institute, wenn nur das verdammte Publikum nicht wäre! Die Heiterkeit war allgemein. Richthoff trat als nächster Spieler an. Ehe er noch die Kugel abschieben konnte, wurde er von Schwindel befallen, schwankte und mußte von den besorgten Freunden geführt und niedergesetzt werden.
Geismar sprang sofort bei.
Etwas Äther, ein Glas Kognak genügte, um den alten Herrn wieder zu ermuntern. Er schlug die Augen auf. Als er sich dann von lauter verdutzten Gesichtern umgeben sah, lächelte er. „Na, mein lieber Hegewald,” scherzte er dem Theologieprofessor zu, „mit der schönen Grabrede ist es diesmal noch nichts!”
„Ein Racheakt, Kollege Richthoff!” erklärte der gleich wieder spaßende Wilmanns. „Ein ganz infamer Racheakt Ihrer römischen Kaiser, sage ich Ihnen!”
„Ohne Zweifel,” meinte Geismar ernsthafter, während er Richthoff forschend beobachtete, „Sie müssen in den letzten Wochen des Guten zuviel getan haben.”
Borngräber, der mit seinen kugelrunden Augen verwundert aus dem krausbärtigen Gesicht sah, rezitierte tiefsinnig aus dem Arabischen: „Keine Krankheit ist schlimmer als Unverstand.”
[S. 132] „Ach was! Diese verwünschten Prätorianer werden mich noch lange nicht kleinkriegen. Noch weniger als der brave Nerva!” Vater Richthoff stand auf, reckte sich, zog die buschigen Augenbrauen in die Höhe, zum Zeichen, daß er sich pudelwohl fühle, und kommandierte: „An die Gewehre!”
Mit voller Kraft schob er seine Kugel.
Der Zwischenfall war erledigt.
In bester Laune spielte man wie sonst, bis nach elf Uhr, und ging nach einem letzten Schoppen und einer vorletzten Zigarre angeregt heimwärts.
Geismar, der in der Neustadt wohnte, schloß sich auf dem Nachhauseweg Richthoff an und begleitete ihn bis vors Haus. Um sich noch auszulüften, wie er vorgab. „Haben Sie schon öfter mal solche kleinen Klapse gehabt, Kollege?” forschte er beiläufig vor dem Abschied.
„Nicht daß ich wüßte!” erwiderte der alte Herr. „Hat ja wohl auch nichts Großes zu bedeuten?” warf er nach einer Weile im Ton der Frage hin.
„Glaube kaum,” meinte Geismar. „Aber für alle Fälle, lieber Richthoff, machen Sie mir mal morgen das Vergnügen und kommen Sie zu mir.”
„Womöglich gleich in die Klinik?” scherzte Richthoff abwehrend.
„Nur in die Privatwohnung. Zwischen vier und fünf Uhr. Auf einen Sprung.”
Der alte Herr wollte nichts davon wissen.
Aber Geismar redete ihm mit so freundschaftlicher Bestimmtheit zu, daß er, der vorgerückten Stunde wegen, versprach, die Sache in wohlwollende Erwägung zu ziehen.
Der alte Herr dachte ursprünglich durchaus nicht[S. 133] daran, Geismars Einladung nachzukommen. Aber er schlief schlecht, und gegen Morgen stellten sich erneute Beklemmungen ein. Da sagte ihm seine Vernunft, bei seinen Jahren und angesichts der großen Arbeit, die noch vor ihm lag, möchte es doch ratsam sein, mit sich hauszuhalten. Er stellte sich also am Nachmittag bei Geismar ein. Was dieser schon bei dem gestrigen Anfall vermutet hatte, ergab auch die Untersuchung: eine ziemlich vorgeschrittene Arterienverkalkung. Doch sagte er davon Richthoff nichts, sondern empfahl ihm nur für die Zukunft ein bißchen Diät: weniger rauchen, wenig Alkohol und dergleichen. Vor allem aber und sofort eine mehrwöchige Ausspannung. Womöglich mit einer leichten Kur in Kissingen. Später Schweiz oder Bayern. Ohne Bergsteigen natürlich!
Vater Richthoff gehörte zu den Naturen, die sich unangenehme Aufklärungen, wenn sie ihnen nicht gerade aufgezwungen werden, gern ersparen. Deshalb interessierte es ihn nicht weiter, auf was Geismar diagnostiziert hatte. Er gab sich damit zufrieden, daß er, wie alle älteren Leute, sein Herz nicht zu sehr strapazieren dürfte. Der erste Halbband der Kaisergeschichte war druckfertig. Er fühlte sich auch geistig etwas erfrischungsbedürftig, zumal da er die ersehnte Italienreise in diesem Frühjahr sich immer noch nicht vergönnt hatte. Trotzdem wetterte er über die Ratschläge seines ärztlichen Kollegen. Doch der war Menschenkenner genug, um hinter den Ausfällen des alten Herrn eine halbe Bereitwilligkeit zu entdecken und sie durch kluges Zureden in eine ganze zu verwandeln.
Der Erfolg blieb nicht aus.
Am Mittwoch früh, nachdem der Geheimrat die Sache[S. 134] noch einmal beschlafen, erfolgte der bekannte Frühstückserlaß: „Will am Montag mit Käthe für ein paar Wochen nach Kissingen. Später vielleicht Schweiz. Das Erforderliche vorbereiten!” —
Käthe war erfüllt von der Auszeichnung, die ihr zuteil wurde. Der alte Herr pflegte sonst seine Reisen meist allein zu machen. Es waren vorzugsweise Studienreisen gewesen, aber auch wenn er auf Erholung reiste, legte er nachdrücklichen Wert darauf, die „Weiberwirtschaft” los zu sein. Wohl einer Anregung des Arztes folgend, hatte er diesmal anders entschieden, und Käthe kam denn auch ihrer Aufgabe, „das Erforderliche vorzubereiten”, mit all dem peinlichen Eifer und der geschäftigen Wichtigkeit nach, die einen wesentlichen Zug ihres Charakters ausmachten.
Für Elli und Marga, die sie rechtschaffen herumkommandierte, war es gar nicht so leicht, diese schwesterliche, etwas herbe Überlegenheit zu ertragen. Marga, glücklich in dem wiedergewonnenen Besitz ihrer Freundschaft mit Perthes, der wie in früheren Tagen ungezwungen im Hause aus und ein ging, fügte sich geduldig. Aber zwischen Elli und Käthe kam es ein paarmal zu harten Auseinandersetzungen und hochroten Köpfen.
Das Ergebnis solcher kleinen Reibungen war, daß die beiden Jüngeren, die durch Margas Geheimnis noch besonders verbunden waren, sich um so enger zusammenschlossen. Sie bauten ihre eigenen, hoffnungsfrohen Sommerpläne, denn etwas mußte ihnen Papa doch auch zugestehen! Wenn Käthe eine so „erwachsene” Reise mit ihm machen durfte, erst ins Bad und dann womöglich noch in die Schweiz, so durften sie nicht ganz leer ausgehen.[S. 135] Das sah der alte Herr auch ein. Sie sollten ihre Sommerfrische haben. Sie mußte aber möglichst nahe sein, denn Haus und Garten mußten überwacht werden können. Und sie sollte so bescheiden und billig sein, als sie sich nur finden ließ. Das verstand sich von selbst.
Nach längeren parlamentarischen Verhandlungen wurde das von Marga und Elli ausgearbeitete und höchsten Orts vorgelegte Projekt genehmigt: die beiden sollten Mitte des Monats für einige Wochen in der „Sägemühle” Quartier nehmen. So hieß ein bekanntes kleines Gasthaus, eine Stunde flußaufwärts von der Stadt — „an Wald und Wasser lieblich gelegen”, wie es in den Prospekten hieß. Daß sie, vertrauensvoll sich selber überlassen, keine Dummheiten machen durften, das wollte Vater Richthoff sich ausgebeten haben! Dafür waren sie seine Töchter und alt genug, um zu wissen, was sie tun und lassen mußten. Im übrigen wurden für alle Fälle die Eltern Wilmanns mit einer feierlichen Vizevormundschaft betraut.
Bis Sonntag hatte Käthe mit Hilfe der Schwestern alle Vorbereitungen getroffen.
Die kleinen Zänkereien waren vergessen, die drei Mädchen befanden sich in einer friedfertigen, durch den Abschied und die lockenden Sommerpläne teils wehmütig, teils heiter erregten Stimmung: sie gingen Arm in Arm durchs Haus oder auf den Weinberg. Es war ein warmer, sonnenheller Tag, und der Feierklang der Kirchenglocken flutete vom Tal die grünen Berghänge hinauf. Nachmittags — die Koffer waren gepackt, und nur im Arbeitszimmer des Geheimrats stand noch eine Riesenhandtasche, die jederzeit in ihren offenen Schlund wahllos die[S. 136] unglaublichsten Zettel und Broschüren von dringendster Unentbehrlichkeit aufnehmen konnte — nachmittags gab es noch einen lustigen Familienkaffee, den Vater Richthoff mit seiner Anwesenheit auszeichnete. Er war so aufgekratzt wie selten, voll kindlicher Freude auf die bevorstehende Reise. Sogar ein Bocciaspiel im Hof schlug er ganz von sich aus vor und beteiligte sich mit jugendlicher Munterkeit am Werfen und Treffen der bunten Holzkugeln, die er vor Jahren aus Italien mitgebracht hatte. Elli und Marga ließen sich von seiner Fröhlichkeit anstecken. Zumal wenn Marga, die ja mehr oder minder aufs Geratewohl die Kugeln schleudern mußte, einen Treffer machte, gab es ein lautes Hallo des Beifalls.
Käthe spielte mit zerstreutem Ernst. Sie wälzte in ihrem gründlichen Köpfchen, unter der dunkelbeschatteten, herrisch-aufrechten Stirn seit einigen Stunden eine Aufgabe, die sie auf den letzten Tag verschoben hatte, weil sie immer nicht recht Zeit oder Mut oder Stimmung gefunden hatte, sie auszuführen.
Sie mußte nämlich noch mit Marga reden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Es galt, der Schwester gegenüber eine Pflicht zu erfüllen, die ihr auf dem Gewissen lastete. Sie war ja sozusagen das Gewissen des Hauses. Sie fühlte sich für alles und jeden verantwortlich. Und für Marga noch im besonderen.
Eine Aussprache — Käthe war eine Meisterin in „Aussprachen” — war unvermeidlich. Sie faßte sich indessen erst nach dem Abendbrot ein Herz.
Während Elli für Vater Richthoff dies und das, was ihm jetzt erst als Neuestes und Wichtigstes einfiel, herbeiholte,[S. 137] nahm sie Margas Arm und lud sie zu einem Gang auf den Weinberg ein.
Einträchtig stiegen sie aufwärts, da und dort an den Stachelbeerbüschen und Johannisbeersträuchern im Vorbeigehen naschend.
Käthe schmiegte sich mit einer Zärtlichkeit an Marga, wie sie ihrer herberen Art sonst nicht eigen war.
Marga ahnte nichts. In ihrer Seele war, zumal jetzt, wo die Trennung ihre Empfindungen mit einer zarten Melancholie begleitete, kein Platz für Argwohn oder Mißtrauen. Noch nie war sie so sicher im Gefühl ihrer inneren Unendlichkeit und ihrer äußeren Begrenztheit gewesen wie in diesen Tagen, die ihr die Freundschaft mit Perthes vertieft und bereichert wiedergeschenkt hatten. Noch nie hatte aber auch ein Mensch, geschweige ein Mann, sie so in ihrem eigensten Wesen geachtet, wie er es jetzt tat und in jedem Wort, jeder Handlung ausdrückte. Das gab ihr eine zufriedene Heiterkeit, die sie wärmte und von innen nach außen verklärte.
Sie waren jetzt auf dem Philosophenweg angelangt. Atemholend nach der Steigung, schritten sie langsam in dem Laubengang von einem Ende zum anderen. Die Sonne lugte noch golden durchs wilde Reblaub. Von weiter unten im Garten, wo es unmerklich dämmerte, hörte man vorlaute Grillen zirpen und wieder verstummen.
Käthe fand den Moment gekommen, um ihr Anliegen vorzubringen. Die Überlegung hatte ihr feinliniges Gesicht etwas verschärft, die Erregung es leicht gerötet. Sie strich sich über die Stirn und das wohlgeordnete dunkle Haar. Dann legte sie die freie Hand in die[S. 138] Hüfte, als wollte sie sich auch äußerlich einen gewissen feierlichen Halt geben.
„Setzen wir uns ein wenig, Margakind.” Sie brauchte diesen Schmeichelnamen, der von Elli stammte, fast nie; heute drängte er sich ihr unwillkürlich auf die Lippen. „Ich möchte noch etwas mit dir reden. Etwas sehr Ernstes, Zartes, was außer uns niemand hören darf.” Sie führte Marga zu der Bank, die am nächsten Ende des Ganges stand.
Dort ließen sie sich nieder, und Käthe nahm Margas rechte Hand in die ihrige.
Marga wußte nicht, was diese Vorbereitungen bedeuten sollten. Sie gab sich geduldig darein und horchte mit einem halb neugierigen, halb verwunderten Lächeln.
„Du darfst mir aber ja nicht böse sein, hörst du?” hob Käthe lebhafter wieder an. „Ich meine es nur gut mit dir, und wenn ich mich irgendwie täusche, so nimm's nicht übel. Es geschieht nur aus Liebe!”
„Aber was gibt's denn nur, Käthe?” fragte Marga mit zunehmendem Staunen. „So sprich doch geradezu! Was willst du mir sagen?”
„Weißt du, Margakind, so einfach, wie du dir's denkst, ist das nicht. Ich hab' mir's lange überlegt. Oftmals dacht' ich, ich wollte mich gar nicht hineinmischen. Aber schließlich sagte ich mir immer wieder: Ich bin die Ältere! Elli, der du vielleicht mehr Vertrauen schenkst als mir, ist so jung, manchmal so toll und unvernünftig. Sie meint es gewiß immer sehr gut. Aber raten, besonnen und fest raten kann dir doch das Kleinchen nicht!”
Marga wurde mit jedem Wort betroffener. Ein kaltes, enges Gefühl beschlich sie. Diese Andeutungen drückten[S. 139] sie. Sie spürte, daß jemand die Tür zum Allerheiligsten ihres Herzens aufmachen wollte, und sperrte sich dagegen. Unwillkürlich hatte sie ihre Hand der Schwester entzogen und steckte sie hinter ihren Rücken. „Was willst du mir denn raten?” fragte sie mit einem eigentümlich dunklen, schweren Ton.
„Du sollst nicht meinen, Marga, daß ich mich in dein Vertrauen eindrängen will,” versicherte Käthe.
Aber du tust es ja doch! schwebte es Marga auf der Zunge. Doch hielt sie die Worte zurück.
„Ich tue nur, was ich für meine Pflicht halte. Und ich erwarte ja auch gar nicht, daß du mir dankbar dafür bist. Das kannst du jetzt noch nicht. Später wirst du mir's einmal danken, das weiß ich!” Käthe hatte ganz ihre altkluge, mütterliche Würde gefunden, wie sie sie brauchte. Die anfänglich erregte Hast ging mehr und mehr in eine gutgemeinte, aber etwas lehrhafte Nüchternheit über. „Warum so viel Umschweife machen? Du hast recht. Ich möchte einmal frei und ehrlich mit dir über deine Freundschaft mit Doktor Perthes reden, Marga. Glaub' mir, ich hab' viel darüber nachgedacht. Über die Freundschaft von Mann und Frau überhaupt. Du darfst mir schon ein Urteil zutrauen. Ich kann im Leben draußen so viel mehr sehen und erfahren als du. Ich glaube nicht, daß es diese Freundschaft gibt. Und wenn sie's gibt, ist sie immer nur ein Übergang. Und der, der zuerst hinübergeht zu etwas anderem — verstehst du mich, Margakind? — der kann sehr, sehr unglücklich werden, wenn der andere nicht nachfolgt. — Jetzt ist's heraus. Das wollte ich dir sagen!”
Käthe umschlang die Schwester, als wollte sie sie tröstend an sich ziehen.
[S. 140] Marga erwiderte die Umarmung nicht.
Schlaff ließ sie ihre Hände niederhängen und bog ihren Kopf zurück, um sich Käthes Liebkosung zu entziehen. Das Herz war ihr wie zugefroren bei diesen besonnenen Worten, und die Kälte teilte sich ihrem Körper, ihrem Antlitz mit. Und doch stieg es sommerwarm auf vom Gras und von den Blumen. Der Wind fächelte mild von der Ebene nach den Bergen herüber, und die Grillen zirpten ringsum in der wachsenden Dämmerung.
Käthe in ihrem Eifer nahm Margas Schweigen für ein Bekenntnis. Sie wurde noch beredter und eindringlicher. Vielleicht, ja gewiß wußte Marga selber nicht, was in ihr sich vorbereitete. Sie sollte sich nicht täuschen lassen durch Perthes' Liebenswürdigkeit. Die Männer, und zumal solche Männer, die sie, Käthe, durch und durch kannte, dachten sich nichts bei einem temperamentvollen Wort, einem Handkuß, einem Strauß Rosen, den sie in einer Laune ihren Freundinnen in den Schoß legten. Sie wollte ja Marga nur warnen. Gerade jetzt, wo sie und Elli allein blieben. Sie sollte sich bewachen; lieber zu schroff als zu entgegenkommend sein; sich doch ja kein Gefühl einreden, das nicht Wahrheit werden konnte. Käthe gab sich ganz nach; sie ließ sich fortreißen von jener liebevollen Lieblosigkeit, der nur Frauen, und die nur untereinander fähig sind, jenem Gemisch von Güte, Neid, Hingebung, falscher Mütterlichkeit — der ganzen Weiblichkeit, wie sie natürlichste Natur ist — schön und häßlich in einem. Ihre Redeflut, die selbstgewiß und selbstgefällig in den weichen Sommerabend hinausfloß, endigte in einem Appell an Margas Charakter: sie war stark genug, um zu entsagen. Wozu brauchte sie die Liebe eines Mannes,[S. 141] die ihr nun einmal vorenthalten sein mußte? Sie hatte ja Kraft und Liebe genug in sich und um sich. „Glaub' mir, Margakind, und wenn du's heute nicht glauben kannst, glaubst du's morgen. Goethe hat recht, wenn er sagt ...”
Marga hörte nicht, wie recht Goethe hatte. Sie hörte überhaupt längst nicht mehr, was Käthe sprach. Sie fühlte nur, daß ein Unberufener nun doch mitleidslos sich eingedrängt hatte in das zarte Geheimnis ihres Herzens. Sie hätte aufschreien mögen: Hände weg von meiner Seele! — aber dann war es schon zu spät. Diese Hände tappten und tasteten, suchten und fanden, und legten sich grausam auf die Wunde, die sie ängstlich behütet, fürsorglich verbunden und verborgen hatte. Nun brach sie auf und blutete. Es weinte in Marga vor Schmerz. Und gleichzeitig empörte es sich in ihr gegen die Entweihung. Wer war die, die es wagen durfte, so mit ihr zu reden? Woher nahm sie das Recht, ihr Vorschriften zu machen? Ihr, die längst all das in sich beraten und durchgekämpft? Die sich nichts, aber auch gar nichts von dem erlassen und geschenkt hatte, was ihr jetzt mit fast übermütiger Selbstzufriedenheit vorgehalten wurde? Was kaum je bei ihr geschah: sie verlor ihre Beherrschung. Ihre Besinnung wurde übertäubt von dem einen leidenschaftlichen Wunsche: Fort! Nichts mehr hören! Nichts antworten! Laufen — weit, weit! Bis ans Ende der Welt, um allein zu sein, allein mit sich, seinem Leid, seiner Bürde, seinem Geheimnis hoffnungsloser Liebe!
Mit einem jähen, heftigen Ruck, der Käthes Hände unsanft von ihr löste, war sie aufgestanden. „Ich danke dir, Käthe!” rang es sich fremd aus ihrem Mund. „Überlaß das nur mir. Ich bin immer allein mit mir fertig geworden.[S. 142] Ich brauche niemandes Hilfe, um zu wissen, was ich vom Leben erwarten und annehmen darf, was nicht!”
Verdutzt blickte Käthe an ihr empor. So hatte sie Marga, die Sanfte, Verträgliche, Geduldige, noch nicht sprechen hören. „Aber Marga, du —”
„Wenn ich einsam sein soll, so achte auch du meine Einsamkeit. Mehr kann ich dir nicht antworten.”
Käthe schwieg. Wie Marga jetzt vor ihr stand, im Schatten der Dämmerung gegen den verblassenden Abendhimmel sich hoch und stolz abzeichnend, die Lippen aufeinandergepreßt, die Augen streng und abweisend in die Ferne gerichtet, fühlte sie, die Ältere, die Erfahrenere und Sehende, sich einen Augenblick klein, unbedeutend mit all ihrer Altklugheit — gegen die Blinde, die so sicher und stark auf ihren Weg hinaussah.
Nur einen Augenblick.
Dann erhob sie sich aus dieser verstohlenen Demütigung doppelt gekränkt, verkannt und erbittert.
Aber ehe sie dafür den rechten Ausdruck fand, hatte sich Marga am Geländer der Laube entlang getastet. Sie eilte die Steinstufen hinab und lief den Zickzackweg hinunter — ohne Hilfe, behend wie ein Sehender, sicher geleitet von jenem fast übernatürlichen Instinkt, den die Erregung noch schärfte.
Käthe wollte ihr nach. Sie rief ihren Namen. Es war Marga verboten, allein die steile Gartensteige abwärts zu gehen.
Doch sie stieß ja jede Hilfe von sich! Mochte sie auf eigene Gefahr sich zurechtfinden!
Bei Käthe siegte die Erbitterung über die Besorgnis, die sie sonst nie für die Blinde außer acht ließ. Sie war[S. 143] zu tief verletzt. Warum hatte sie nicht geschwiegen? Hatte sie nicht vorausgewußt, daß sie keinen Dank ernten würde? Nun war sie abgewiesen worden mit all ihrem guten Willen, ihrer ehrlichen Meinung! Sie würde ihre Hilfe nicht mehr aufdrängen. Gewiß nicht! Nie mehr! Über den Schläfen strich sie ihr Haar zurück und prüfte die schweren Flechten, obwohl es Nacht geworden war und keine Strähne in dem glatten Scheitel oder am Knoten sich gelockert hatte. Ordnung war nun einmal ihr Element. Maß und Ordnung. Mochten andere das Ungeordnete, Regellose vorziehen. Sie hatte auch nur bei Marga Ordnung machen wollen. Wenn die es nicht brauchte, nicht litt ...
Mit dem zugleich gemessenen und tänzelnden Schritt, der sich nichts vergab und doch auch die Gleichgültigkeit gegen das, was vorgefallen war, zur Schau tragen mußte, machte sich Käthe auf den Weg und kam eine Viertelstunde nach Marga, leise vor sich hinsummend, ins Haus.
Elli und Marga waren schon auf ihr Zimmer gegangen.
Der Geheimrat wirtschaftete noch geräuschvoll in seinem Arbeitszimmer. Man hörte ihn oben deutlich ab und zu gehen. Die Riesenhandtasche nahm neue Unentbehrlichkeiten in sich auf.
Käthe ging noch einmal gewissenhaft ihre Zurüstungen für den Reisetag durch. Dann machte sie gemeinsam mit der schläfrig schlurfenden Therese den üblichen Rundgang im Erdgeschoß, um den Verschluß von Läden und Türen zu beaufsichtigen.
Am anderen Morgen, in ziemlicher Frühe, nach einem hastigen Kaffee, erfolgte der Abschied.
[S. 144] Der alte Herr hatte sich alle Sentimentalitäten, besonders aber die Begleitung auf den Bahnhof, streng verbeten.
In letzter Minute konnte er doch nicht anders: er küßte Marga und Elli barsch auf die Stirn.
„Seid hübsch artig, Mädels; verstanden? Adieu!” Damit eilte er fort, dem Wagen zu, der vor dem Haus wartete. Therese folgte keuchend mit der zu unheimlichen Dimensionen angeschwollenen Handtasche, die noch eine halbe Bibliothek verschlungen haben mußte. Der Hauptkoffer war schon aufgeladen.
Käthe und Elli umarmten sich. Mit Marga gab es nur einen Händedruck.
Vom Vorgarten, unter den Kastanien hervor, winkten die beiden Zurückbleibenden dem Wagen nach. Vater Richthoff salutierte. Käthe nickte noch einmal und winkte mit dem Taschentuch.
Die Fahrt ging um die Ecke nach dem Bahnhof. — —
Dort, wo der Fluß, dem Zug der Waldberge folgend, zum letztenmal eine mutwillige Schwenkung machte, um sich dann, des spielerischen Geschlängels überdrüssig, geradeaus und kräftig in die weite Ebene hinauszuwerfen, stand die „Sägemühle”. Dem Zweck, den ihr Name andeutete, diente sie längst nicht mehr. Seit vielen Jahren war sie nur noch ein einfaches, freundliches Gasthaus, rückwärts gegen den Buchenwald gelehnt, vor sich einen schattigen Wirtsgarten, den nur ein schmaler Weg von der Uferböschung und dem hurtigen Fluß trennte. Da die Sägemühle kaum eine Stunde von der Stadt entfernt lag, war sie ein beliebter Ausflugsort: an Sonntagen und schönen Sommernachmittagen wurde sie von Bürgern[S. 145] und Professoren, von Kaffeeschwestern und Studenten zu Fuß, zu Wagen und mit dem Boot viel besucht. In der besten Zeit des Jahres fanden auch die paar sauberen Fremdenzimmer ihre Liebhaber; wer anspruchslos an Buchenwald und Wasser, an guter Verpflegung, an dem belebten Wechsel ländlicher Einsamkeit und städtischer Ausflüglerfröhlichkeit sein Gefallen hatte, konnte sich bei den willigen Wirtsleuten einige Wochen zufrieden fühlen. Spaziergänge gab's in Hülle und Fülle: auf den Bergen durch die stundenweiten Laub- und Nadelforste; im Tal zwischen wogendem Getreide, oder den blumenüberwachsenen Uferpfad entlang nach kleinen Dörfern und alten Städtchen, wo verfallene Raubritterburgen emporragten und sich im Fluß spiegelten.
So war Margas und Ellis Sommerheim beschaffen, in das sie vierzehn Tage nach Vater Richthoffs und Käthes Abreise übersiedeln sollten.
Stille, fröhliche Tage im Hause am Wenzelsberg gingen vorher.
Zuerst hatte Marga noch unter der Aussprache mit Käthe gelitten. Aber Elli mit ihrer frischen, glücklichen Wirbelwindnatur hatte ihr den Kopf und das Herz lachend reingefegt. Jeden Tag wußte sie etwas Neues vorzuschlagen, um Unterhaltung zu schaffen. Man sollte zwar, nach der Mahnung des alten Herrn, keine „Dummheiten” machen. Aber — du lieber Gott! Das war ein weiter Begriff! Immer gescheit und sittsam sein, war abscheulich langweilig. Daran war nicht zu denken. Man war tüchtig spazierengelaufen, hatte sich auf den Straßen umhergetrieben und die Menschen beobachtet, voran die Fremden, die um diese Jahreszeit besonders aus Old-England und[S. 146] von jenseits des großen Teichs reichlich zuströmten. Dann mußte man baden, Besuche machen und empfangen, die Wohnung ein paarmal umräumen, mit Therese den Küchenzettel besprechen, auf dem Weinberg dem Gärtner beim Pflücken der Stachelbeeren und Johannisbeeren helfen, unerlaubte Bücher lesen, im Vorgarten handarbeiten und die vorübergehenden Leute glossieren. Und Elli duldete nicht, daß sich Marga von irgend etwas ausschloß. Die Schwester einmal so recht „mitleben” zu lassen, sie, deren Geheimnis sie innig teilte, von Herzensgrund schadlos zu halten — das war Ellis „Prinzip” für diesen Sommer. Sie stand sonst mit den „Prinzipien” nicht auf dem besten Fuß. Das waren nach ihrer Ansicht Dinge für alte Tanten, Backfische, Philosophieprofessoren und Spießer jeder Art, die sich das Leben partout verekeln wollten. Aber Prinzipien, die zugleich dem Herzen wohltaten und unterhaltend waren, mit denen konnte es gewagt werden. Daß dabei Wilkens nicht zu kurz kommen durfte, verstand sich von selbst. Er guckte öfters mal ein, wie Perthes auch. Man traf sich zufällig auf einem Spaziergang. Zweimal sogar — doch das setzte einen harten Kampf mit Marga — abends bei der Musik im Stadtgarten. Das war so stilwidrig-unakademisch, daß man der Versuchung nicht widerstehen konnte. Bei allem hielt Elli peinlich darauf, daß Marga „ihrem” Doktor genau so gerecht wurde wie sie „ihrem” Erich. Die möglichste Gleichheit beruhigte sie selbst und sollte Marga Freude machen. Wenn sich Marga auch sträubte — sie war nach der Auseinandersetzung mit Käthe mit doppelter Vorsicht darauf bedacht, ihr Verhältnis zu Perthes und damit ihr eigenes Gefühl in strengen Grenzen zu halten —, Elli wußte[S. 147] immer mit der hinreißenden Dialektik ihrer siebzehnjährigen Verliebtheit und Lebenslust jedes Bedenken fortzuplappern. Und kam sie nicht damit zum Ziel, so sang und lachte sie es weg. Gegen ihr Lachen war Marga so ohnmächtig wie gegen ihre losesitzenden Tränen. Es tat ihr im Grund der Seele zu wohl, einmal jung mit den Jungen sein zu dürfen.
Dann kam der Umzug nach der Sägemühle und dabei eine Meinungsverschiedenheit, die Stoff zu schwerwiegenden Diskussionen bot.
Elli hatte Wilkens längst und beizeiten verständigt, daß und wohin man gehen würde. Marga dagegen bewahrte gegen Perthes Stillschweigen und verbot auch der Schwester, Andeutungen zu machen. Die wachsende Vertraulichkeit, in die sie sich durch die Gunst der Umstände und durch Ellis fanatischen Gleichheitsdrang hineingezogen sah, begann sie zu ängstigen. Sie war öfter und ungestörter mit Perthes zusammen als sonst. Er pflegte die Freundschaft mit einer Achtung und Zartheit, die sie beseligte. Nichts, was mit ihm vorging, unterschlug er ihr: seine ernstesten Gedanken so gut wie seine alltäglichen Beobachtungen, seine Stimmungen, die schweren wie die leichten, lud er vertrauensvoll bei ihr ab. Sie fühlte instinktiv, wie diese schöne Vertraulichkeit, so viel sie gab, doch auch an der Kraft zehrte, mit der sie ihre wahre Gesinnung für ihn niederhielt. Wenn sie so stark bleiben wollte, wie sie mußte, war eine längere Trennung das beste Mittel. Sie wollte weggehen, ohne daß er wußte, wohin, und ohne daß er den Tag ihres Aufbruchs kannte. Natürlich würde er sie leicht finden können. Es gab außer dem Zufall, daß er nach der Sägemühle einen Ausflug[S. 148] machte, Möglichkeiten genug für ihn, ihren Aufenthaltsort schnell zu erforschen. Aber er sollte nicht aufgemuntert sein. Vielleicht zürnte er über ihr Verschwinden. Doch ihr Gefühl ließ sie nicht anders handeln. Es war freilich kein so klares, einfaches Gefühl wie die, denen sie sonst folgte. Ihre Neigung hatte trotz aller Vorsicht allerlei uneingestandene Heimlichkeiten miteingesponnen. Die Liebe macht nun einmal, mit oder ohne Willen, auch die Starken schwächer, als sie sind. Nein, Perthes sollte nicht aufgemuntert werden. Wenn er kommen wollte, mußte er es schon ganz von sich aus tun. Von sich aus ...
So ereiferte sich denn Elli diesmal vergebens. Sie stellte Marga vor, wie grausam, rücksichtslos, unfreundschaftlich, ja geradezu unanständig es sei, so zu handeln. Aber Marga blieb fest. Elli mußte sich fügen. —
An einem Montagnachmittag, nachdem die Möbel verdeckt, die Teppiche und Gardinen eingekampfert, alle Rouleaus herabgelassen waren, so daß Therese nur noch abzuschließen brauchte, setzten sich Marga und Elli mit ihrem Handgepäck in den Lokalzug und fuhren flußaufwärts, zwei Haltestellen weit. Dann holte sie die Fähre über nach der Sägemühle.
Der große Koffer, eine sehenswürdige Häßlichkeit aus Vater Richthoffs Junggesellenzeit, stand schon in dem blanken, behaglichen Zimmerchen mit den weißen Tüllvorhängen und dem braungestrichenen Boden, zu dessen offenen Fenstern der Buchenwald beinahe seine Zweige hereinstreckte.
Noch am Abend mußten das Haus, der Garten und die nähere Umgebung besichtigt werden, obwohl sie, längst bekannt, viele Überraschungen nicht bieten konnten. Elli[S. 149] beschrieb Marga all die Herrlichkeiten haarklein — bis auf die Enten und Gänse, über die man stolperte.
Das Abendbrot in einer Laube am Fluß schmeckte königlich.
Die paar Ausflügler, die noch verstreut im Wirtsgarten saßen, reckten verwundert die Hälse, so laut und ansteckend lustig klang das Lachen zu ihnen herüber.
Am anderen Morgen begann das Faulenzerleben der Sommerfrische, in seinen Einzelheiten entworfen und geleitet von Elli. Erst anderthalb Stunden Frühstück mit Massenvertilgung von Butter und Honig. Nicht zu spät, aber auch ja nicht zu früh. Dann mit der Hängematte in den Wald bis Mittag. Nach dem Essen in der Halle, einem luftigen Holzbau mit großen, zum Teil bunten Glasfenstern und einem Orchestrion, wurde geschlafen. Die anstrengende Untätigkeit des Vormittags forderte das.
Zum Kaffee setzte man sich in den Garten, an einen versteckten Platz, zwischen hohe Haselbüsche. Von dort ließen sich die Menschen, die von der Stadt kamen, trefflich mustern. Elli versah sie einzeln mit Etiketten, um sie Marga anschaulich zu machen.
Als etwa anderthalb Stunden so vergangen waren, verstummte das Gespräch eine Weile.
„Weißt du,” legte dann Elli los, „ich hatte bestimmt erwartet, daß Wilkens käme. Er hat mir's nämlich versprochen.”
„Heute schon? Gleich am zweiten Tag?” fragte Marga, etwas erstaunt.
„Sei du mal ganz ruhig, Margakind! Ich weiß jemand, dem es schon greulich leid ist, daß er einen gewissen anderen Jemand nicht doch, wie sich's gehörte, benachrichtigt hat!”
[S. 150] „Da irrst du dich, Kleinchen!” versicherte Marga ernsthaft.
„Na, wenn ich dein Doktor wäre, ich würde mich für so eine Freundschaft bedanken. Gott, wenn ich denke” — Elli fädelte eine neue Farbe für ihre Stickerei ein und sah die Schwester dabei halb kritisch, halb schelmisch von unten herauf an — „du müßtest eine schrecklich biedere und gestrenge Hausfrau abgeben, Marga!”
„Schwatz' doch keinen Unsinn, Kind!” wehrte Marga, leicht errötend.
„Oh, Gedanken sind zollfrei!” fuhr Elli unbeirrt fort. „Freilich, wenn du immer so spröde und tugendsam mit deinen Verehrern bist wie in letzter Zeit mit Perthes, hat's damit gute Weile.”
„So sprich doch nicht so laut!” mahnte Marga. „Und nenne wenigstens keine Namen! — Ich bin doch zu ihm wie immer,” setzte sie nach einer Weile zögernd, fast fragend hinzu. Hatte sie sich in jüngster Zeit weniger frei und natürlich gegeben, dann war nur der Stachel daran schuld, der von der Aussprache mit Käthe in ihr zurückgeblieben war ...
Elli erriet ihre Gedanken. „Von Käthe hätte ich mich nun schon gar nicht ins Bockshorn jagen lassen,” sagte sie überzeugt. „Abgesehen davon, daß ihr Benehmen gegen dich haarsträubend taktlos war, hat sie so altertümliche und hausbackene Ansichten, daß —” Elli stockte. Sie bog einige Zweige des Gebüsches auseinander. Dann fuhr sie geräuschvoll in ihrem Stuhl zurück. „Da haben wir die Bescherung!” rief sie mit halblautem, aufgeregtem Kichern.
Ehe sich Marga nach dem Wesen dieser Bescherung[S. 151] erkundigen konnte, klang ein kräftiges „Guten Abend, die Damen!” zu dem versteckten Tisch.
Im nächsten Augenblick schwenkten sich mit zeremoniellem Gruß zwei Hüte.
Perthes und Wilkens, in traulichem Verein, standen im Bereich der Haselbüsche.
Elli tat riesig überrascht. „Nein, so was! Denk' mal, Marga, Doktor Perthes und ein Herr Wilkens überrumpeln uns hier gleich zu zweien! — Sie kommen natürlich ganz zufällig?”
„Natürlich — ganz zufällig!” schmunzelte Wilkens, während man sich die Hände schüttelte.
„Und daß wir ‚gleich zu zweien‛ kommen, Fräulein Elli, wie Sie liebenswürdig hervorheben, ist erst recht zufällig,” erklärte Perthes. „Wir kommen auch in sehr verschiedener Sendung. Herr Doktor Wilkens —”
„Pardon! Immer noch Wilkens!” warf Elli mit einem vernichtenden Blick auf den fälschlich Promovierten dazwischen.
„Ehe ich mich weiter insultieren lasse, bitte ich Platz nehmen zu dürfen!” parierte Wilkens mit fröhlichem Gleichmut und nahm sich, ohne die Erlaubnis abzuwarten, einen Stuhl. „Ich rate Ihnen dasselbe, Herr Doktor Perthes, denn Sie wissen nicht, was die Damen noch für Liebenswürdigkeiten bereithalten. Ich habe die Erfahrung gemacht —”
„Ums Himmels willen!” unterbrach ihn Elli, sich die Ohren zuhaltend. „Was der Mensch redet! Und dabei ist man zur Erholung hier!”
„Das Schweigen ist oft viel bedenklicher als das Reden,” nahm Perthes das Wort, indem er sich Marga[S. 152] gegenübersetzte. „Ich meine nämlich das Schweigen von Fräulein Marga.”
„Sie haben mich ja noch gar nicht zu Wort kommen lassen!” verteidigte sich Marga.
„Das hat noch gute Weile. Erst redet der Ankläger, dann der Angeklagte.”
„Sie sind wohl inzwischen zur Juristerei übergegangen?” fragte Elli naseweis.
„Wollen wir uns nicht vorher ein Glas Bier kommen lassen?” meinte Wilkens gemütlich zu seinem Nachbar.
„Das können Sie! Denn Sie sind hier gewissermaßen eingeladen,” gab Perthes zurück.
„Eingeladen?” Elli schüttelte entrüstet ihren Blondkopf. „Das muß ich mir schönstens verbitten. Herr Wilkens hat von mir allerdings erfahren, wohin ich gehe. Aber eingeladen habe ich ihn nicht! Davor werd' ich mich hüten!”
„Weil er sowieso kommt,” ergänzte Wilkens, während er dem in der Ferne vorbeistreifenden Kellner seine Bierwünsche durch Zeichensprache deutlich machte.
„Das tut Herr Doktor Perthes auch!” entfuhr es Elli übermütig.
„Oho! Dagegen lege ich Verwahrung ein!” protestierte Perthes und schlug lebhaft mit der großen Hand, die schon so sommersonnengebräunt war wie das räuberbärtige Gesicht unter dem weißen Panama, auf den Tisch. „Also, Fräulein Marga! Ich bin nur hier, um Rechenschaft zu fordern. Wenn mir nicht Ihre Therese begegnet wäre, die auf dem Weg zum Bahnhof grüßend an mir vorbeischnob, wüßte ich überhaupt nicht, wo Sie sind. Herr Wilkens ist mein Zeuge, mit dem ich mich eine halbe[S. 153] Stunde später auf der Landstraße traf. Man hat mich böswillig hintergangen! Man hat mir kein Sterbenswörtchen von dieser Sommerfrischenidee gesagt. Ist das freundschaftlich?”
Marga suchte vergeblich nach dem rechten Ton, um auf den scherzhaft-temperamentvollen Angriff einzugehen.
„Sagte ich es nicht? Dieses Schweigen ist Schuldbewußtsein!” triumphierte Perthes. „Wenn Sie sich wenigstens auf einen Spaß hinausreden wollten!”
„Einen Spaß?” kam es jetzt ehrlich, aber leise von Margas Lippen. „Da müßte ich Sie geradezu anschwindeln, Herr Perthes!”
„Sie wollen mir also einfach zeigen, daß ich durchaus nicht unentbehrlich bin, Fräulein Marga,” sagte Perthes nach einer kleinen Pause, aus dem heiteren Ton der Philippika zu gedämpftem Ernst übergehend.
„Vielleicht,” stammelte Marga zaghaft. Es kostete sie eine schmerzliche Überwindung, dieses vor der Vernunft wahre, vor ihrem Herzen unwahre Wort hervorzubringen.
„Sie vergaßen dabei zu überlegen, ob Sie Ihrem Freunde ebenso unentbehrlich sind,” erwiderte Perthes knapp und mit einem Anflug von enttäuschter Bitterkeit.
Die Unterhaltung stockte.
Elli ergriff die Gelegenheit, um Wilkens einen Gang nach der „Menagerie” vorzuschlagen. Die Wirtsleute der Sägemühle hatten im Wirtschaftshof ein paar Kaninchen, einen Fuchs, allerhand Geflügel und vor allem ein junges Rehzicklein, das Ellis besondere Gunst genoß und Wilkens gezeigt werden mußte. Sie hatte nebenher den Gedanken, die beiden, Marga und Perthes, würden sich allein schneller und besser „zusammenzanken”. So[S. 154] pflegte das wenigstens immer bei ihr und Wilkens zu sein.
Diesmal irrte sie sich.
Perthes verstand Margas Verhalten, das ihm plötzlich und willkürlich verändert erscheinen mußte, nicht. In den letzten Wochen nach dem Bruch mit Hilde König und der stürmischen Freundschaftskrisis mit Marga hatte er sich stetig gesünder gefühlt. Dies ungezwungene, vertrauensvolle Beisammensein gab ihm Ruhe und Gleichgewicht. Es stärkte in ihm den Glauben an einen gewissen Wert seiner Persönlichkeit. Lebenslust und Frohsinn kehrten ihm zurück. Er gab sich im einzelnen keine Rechenschaft über die Fortschritte seiner Genesung. Nur daß er seine Dankbarkeit ohne Rückhalt zur Schau trug. Ohne es zu wollen und zu beachten, übertrug er etwas von der Leidenschaftlichkeit, die er in seine phantastische Neigung für die kleine Ufernixe gelegt hatte, auf seine Freundschaft. Ein halber Mensch, wie er selbst sich so gern schalt, mußte er doch immer seine ganze, ungeteilte Person einsetzen, wenn er, was freilich selten genug geschah, sich einem anderen über das Maß alltäglichen Bekanntseins näherte. Und er war dann im Fordern ebenso rücksichtslos, als er im Geben unbedacht war.
Wenn er gewußt hätte, wie seine letzten, verbittert hervorgestoßenen Worte auf Marga wirken mußten! Welchen Aufruhr sie in ihre Seele warfen!
Was wollte er damit sagen? Wie tief ging dieser Vorwurf ihm selbst? Ob er, unbewußt, doch angefangen hatte, mehr für sie zu empfinden, als die Freundschaft schuldig war?
Diese Gedanken wälzten sich quälend in Marga. Sie weckten eben die Gefühle, die sie so tapfer niederhalten[S. 155] wollte und mußte. Sie zehrten von neuem, stärker und gefährlicher als je, an der Kraft, die zu bewahren — freilich mit halben Mitteln — sie eine Trennung herbeizuführen gesucht hatte.
Eine dumpfe, wehvolle Angst arbeitete in ihr.
Sie durfte ihn nicht zurückstoßen. Und durfte doch auch seine zunehmende Annäherung nicht dulden! Wo war die Grenze? Woher nahm sie Kraft, immer neue Kraft, zu wollen, was sie nicht wollte; nicht zu wollen, was sie wollte? Ihr Herz hatte auch sein Gesetz, auch Kraft wider Kraft und bäumte sich auf gegen die Zügel, die sie ihm anlegte. Das trübte die klare Stille ihres Wesens. Das nahm ihr ihre Unbefangenheit. Sie erschien kälter, gleichgültiger und verschlossener als sonst. Ihr Schweigen und seine Verstimmung nährten sich gegenseitig und machten dies erste Alleinsein auf der Sägemühle für beide höchst unerquicklich.
Perthes war nahe daran, sich zu verabschieden. Da kamen Wilkens und Elli zurück und brachten den Vorschlag, im Garten gemütlich Abendbrot zu essen.
Man war da jetzt ganz unter sich. Die letzten Gäste vom Nachmittag waren im Aufbruch begriffen, und Elli wartete gar nicht erst eine lange Erklärung von Marga oder Doktor Perthes ab, sondern wählte einen Tisch weiter vorn im Garten, freier und näher dem Fluß, wo sie für vier Personen decken ließ.
Sie fand ihren Einfall riesig lustig und kommandierte Wilkens und den Doktor abwechselnd für ihre Dienste. Perthes wollte nicht zurückbleiben. Im Gegenteil, er überbot die anderen und sprang von seiner Verstimmung über zu lauter Ausgelassenheit.
[S. 156] Marga beteiligte sich an diesem Treiben nur widerstrebend, um niemand die Freude zu verderben. Sie erriet, was in Perthes vorging. Mit einer gewissen Absichtlichkeit wollte er ihr zeigen, daß er sich aus dem Vorhergegangenen nichts mache.
Dabei konnte er es nicht lassen, sie wieder und wieder zu necken.
„Obwohl Fräulein Marga mich so schlecht behandelt!” — „Trotzdem Fräulein Marga gar keinen Wert auf meine Gesellschaft legt!” Solche und ähnliche Wendungen ließ er ständig mit einfließen. Ohne Bedacht, nur seiner inneren Gereiztheit nachgebend, trieb er das Spiel jener Koketterie, deren auch Männer fähig sind. Er wollte Marga zu irgendeiner Äußerung verlocken, mit der sie sich ins Unrecht setzte und ihre Freude, daß er doch gekommen war, verriet. Sie sollte sich für das „Verbrechen an der Freundschaft”, das er ihr vorwarf, entschuldigen und damit seiner Eigenliebe schmeicheln.
Er erreichte von Marga nur ein Lächeln, das matt und traurig aussah, weil sein Benehmen ihn vor ihr verkleinerte und ihr an der Seele riß, wo sie am empfindlichsten war.
Es war um diese Stunde köstlich im Garten am Fluß. Er lag verträumt im dämmerigen Schatten der mächtigen Linden und Ahornbäume.
Draußen zog still, vom Schein des roten Abendhimmels überhaucht, Welle an Welle.
Am jenseitigen Ufer, auf den Wiesenhängen, wurde noch geheut. Der süße Duft der Mahd flog über den Fluß. Die feinen Ränder der Waldberge tauchten mit tausend und abertausend scharfen Tannenspitzen in den letzten Sonnenglanz.
[S. 157] Die wundersame Ruhe des Abends rang groß und beharrlich gegen die lärmende Lustigkeit des jugendlichen Tisches im Garten.
Ellis jubelndes Lachen, Wilkens' Jodler, die laute, hastige Stimme von Perthes hielten vergebens dagegen. Die ländliche Mahlzeit, bestehend aus zwei großen hochgebräunten Eierkuchen, frisch gepflücktem Salat, Schwarzbrot und Butter, war mit gewaltigem Beifall begrüßt worden. Noch war sie nicht vertilgt, noch hatten Perthes und Wilkens kaum um neue „Metkrüge” geklappert, geläutet und gerufen, als schon das feierliche Schweigen über das Laute seinen Sieg davontrug. Still und stiller, wie draußen über dem Fluß und Wald, wurde es auch drinnen im Garten. Und die kleinen, sanften Geräusche des Abends, die nur ebensoviele Lockrufe der sieghaften Stille sind, machten das Gespräch vollends verstummen: der späte, hell anhebende und kurz abbrechende Triller einer Lerche im Feld; das Plätschern eines Fischerkahns im Wasser, der flußabwärts glitt; ein fernes, gedämpftes Hundegebell aus dem nächsten Dorf.
Elli war schnell für das Lyrische gewonnen.
Als Wilkens wieder an sein geleertes Glas klimperte, flog ihm ein „Prosaischer Radaumacher!” an den runden, wollig-blonden Kopf. Er wurde ganz klein und verdrehte sentimental die so gar nicht melancholischen Augen.
Perthes hatte zu rauchen begonnen. Er stieß ein paar Wolken von sich, blies Ringel von zartem Dunst und warf die Zigarre hinaus auf den Fluß.
Marga saß in sich gekehrt neben ihm. Sie suchte sich aus der Stille des Abends zur eigenen zurückzufinden.
„Wir, Marga und ich, machen jetzt unseren Spaziergang[S. 158] über die Wiesen, nicht wahr, Margakind?” erklärte Elli plötzlich und stand auf. Marga nickte. Unbekümmert um Perthes und Wilkens, Arm in Arm aneinandergeschmiegt, traten sie aus dem Garten.
„Wir sind jetzt wohl beurlaubt?” fragte Perthes den mit ihm zurückbleibenden Wilkens.
Wilkens schüttelte den Kopf. „Nee, so lass' ich mich nicht in den Sand setzen!” meinte er gleichmütig. „Im übrigen — Fräulein Marga kenne ich so genau nicht, aber Elli ist felsenfest überzeugt, daß wir zwei hinterdreinschlendern. Wetten, daß —?” Er blinzelte den Doktor mit der listigen Miene des erfahreneren Liebespraktikus an.
„Da mache ich nicht mit!” versetzte Perthes bestimmt.
„Meinen Sie, ich?” warf sich Wilkens in die Brust. „Es dauert keine fünf Minuten, und die Mädels sind zurück; sowie sie merken, daß wir streiken.”
Es dauerte aber zehn Minuten und länger.
Wilkens wurde unruhig. Er stand auf und ging ein paarmal halb verlegen zum nächsten Tisch und wieder zurück. Dann sah er verstohlen über den niedrigen Lattenzaun des Gartens weg, den Weg hinunter.
„Schlendern wir 'n bißchen auf eigene Faust?” fragte er schon bedeutend kleinlauter zu Perthes zurück, der sitzen geblieben war.
Widerstrebend erhob sich dieser. Er war jetzt mit seiner Geduld zu Ende.
Die Rücksichtslosigkeit, mit der er von Marga behandelt wurde, empörte ihn. Am liebsten wäre er ohne Abschied heimgegangen. Er war zum ersten- und letztenmal auf der Sägemühle. Das war eine ausgemachte Sache. Aber er wollte es ihr offen sagen. Sie hielt ja so viel von[S. 159] der Offenheit in der Freundschaft, wenn sie auch mit ihrem heutigen Verhalten das Gegenteil bewies.
Deshalb blieb er. Deshalb schlenderte er, unlustig genug, mit Wilkens aus dem Garten in die angrenzenden Wiesen, am Fluß entlang. Er hatte den Hut vom Kopf gerissen. Sein Gesicht hatte sich verfinstert. Der Unmut, gleich wieder leidenschaftlich wie sein ganzes Temperament, lag in tiefen Falten auf seiner Stirn und blickte ihm aus den Augen. Er fuhr sich einmal ums andere durch den schwarzen Haarbusch oder strich über den krausen Vollbart.
Und dabei lag die Dämmerung so mild und verträglich ringsum.
Das hohe Gras mit seinem Labkraut, seinen Schafgarben und Kuckucksblumen überwucherte den schmalen Weg, den „Leinpfad”, auf dem früher die Pferde an strammer Leine die Lastkähne stromaufwärts geschleppt hatten. Das Wasser in seinem tiefen, stählernen Grau rauschte und gluckste heimlich, als wollte es den sachten Abendwind, den tuschelnden Geheimniskrämer, noch an bedeutsamer Wissenschaft übertreffen. Und drüben, über den Heuhocken, den silberreifen Kornäckern, dem Berg mit seinem schweren, düsteren Tannenmantel, lag es wie feiner, rieselnder Taudunst. Auf all das achtete Perthes nicht. Nicht einmal auf das gefühlvolle Summen von Wilkens, mit dem dieser seinen zärtlichen Gefühlen Ausdruck verlieh. Nur die eigene Verstimmung schien ihm der Aufmerksamkeit wert.
Und dann, als der Leinpfad, dem Flußlauf folgend, sich bog und von ein paar knorrigen Krüppelweiden eingefangen wurde, waren plötzlich Marga und Elli dicht[S. 160] vor ihnen. Sie kamen langsam und stumm den Weg zurück.
„Ist das auch eine Art, seine Damen ohne Schutz in die Nacht hinauslaufen zu lassen?” rief Elli, die so ungewohnt lange auf ihren Wilkens hatte warten müssen, den beiden zürnend entgegen.
„Bitte sehr!” entgegnete Wilkens, „die Damen sagten uns ja gar nicht —”
„Daß sie Wert auf unsere Begleitung legten!” ergänzte Perthes mit Schärfe.
Elli hing sich statt jeder weiteren Antwort an Wilkens' Arm.
„Na, also!” schmunzelte Wilkens und führte sie wieder flußaufwärts weiter.
Marga stand vor Perthes.
Unschlüssig blieben sie sich einen Augenblick gegenüber.
Um keinen Preis hätte Perthes das erste Wort gesprochen.
„Wollen Sie mir Ihren Arm geben?” fragte endlich Marga zaghaft. Ihre Stimme klang weich, bittend, wie er sie den ganzen Nachmittag nicht gehört hatte.
Perthes tat sofort, wie sie ihn gebeten. Sie gingen in der, Elli und Wilkens entgegengesetzten Richtung nach der Sägemühle zu. Er hatte sie mit heftigen Vorwürfen empfangen wollen. Aber jetzt, wie sie so an seiner Seite schritt, fühlte er sich ruhiger werden. Es war ein und dieselbe Wirkung ihres Wesens, die sich ihm immer mitteilte, ob er wollte oder nicht.
„Ich war drauf und dran, heimzugehen, ohne Sie noch einmal gesprochen zu haben,” begann er mehr traurig als zornig.
[S. 161] Marga sagte nichts. Ihr Kopf war tief vornübergebeugt, als sähe sie auf den Weg.
Elli hatte mit ihr geredet und ihr ihr Betragen vorgeworfen. Sie wollte liebenswürdiger sein. Aber es war schwer, so schwer! Irregemacht an ihrer Zurückhaltung, die ihn kränkte, und doch sich bewußt, daß jeder Schritt, den sie ihm weiter entgegenkam, sie schwächer und unglücklicher machte, suchte sie umsonst den immer schmäler werdenden Weg zwischen ihrem Stolz und ihrer Pflicht auf der einen, ihrer Liebe auf der anderen Seite.
Perthes fühlte, wie ihre Hand, die zufällig die seine streifte, kalt war und zitterte. Was war das? Er schaute sie prüfend an. Weinte sie denn? Es ging eine leise, schütternde Bewegung durch ihren Körper, die ihm nicht entgehen konnte; aber er sah keine Träne in ihren blicklosen Augen, als er sich vorbeugte. Und doch hatten ihre Züge den Ausdruck des Weinens, einen seltsamen, rührenden, ergreifenden Ausdruck verborgenen, inneren Weinens.
„Was ist Ihnen denn, Fräulein Marga? Warum verstehen wir uns denn heute nicht? Warum sind Sie so anders als sonst zu mir? Was haben Sie nur? Habe ich irgend etwas verbrochen? Mißfällt Ihnen etwas an mir? So reden Sie doch nur! Sagen Sie, was es ist!” Besorgt, dringend, beinahe verzweifelt stieß er seine Fragen hervor. Es war keine Spur von Ärger oder Bitterkeit mehr in seinen Worten.
„Ich habe nichts gegen Sie. Gar nichts!” Marga schüttelte energisch und abwehrend den Kopf. „Nur —” setzte sie flüsternd hinzu, „nur —” wiederholte sie noch einmal kaum hörbar. Unfähig, sich auszusprechen, kehrte sie ihr Gesicht von ihm ab.
[S. 162] „Nur?” Er ließ sie los und stellte sich vor ihr auf den Weg. Er zwang sie, zu ihm aufzusehen.
Ihre leeren Augensterne hasteten scheu an ihm vorbei, hinaus in die Weite. Als suchte sie die Nacht, die jetzt immer dichter heranzog, um sich in ihr zu verstecken.
Perthes nahm wieder ihren Arm. Willig ließ sie sich weiterführen.
Er war ratlos. Er verstand sie nicht. Wieder und wieder betrachtete er sie von der Seite. Nichts Trotziges, Eigensinniges war an ihr zu entdecken. Aber ihrem Antlitz fehlte auch die Festigkeit, die Ruhe und Klarheit, die sie sonst erfüllte. Eher war es Angst, Schwäche, Hingebung — eine scheue, hilflose Mädchenhaftigkeit, wie er sie so nie bei ihr wahrgenommen hatte. Das warme, mitleidsvolle Gefühl, ihr helfen, sie schützen zu wollen, regte sich in ihm. Er hätte sie an seine Brust ziehen mögen. Nicht leidenschaftlich, sondern wie ein Bruder die Schwester. Ihre Schulter streifte die seine. Noch einmal, länger. Sie schien sich an ihn zu lehnen. Er war nahe daran, seiner zärtlichen Empfindung nachzugeben, aber im selben Augenblick ließ Marga ihn los.
Sie riß sich zusammen, als ahnte sie die Bewegung, die er machen wollte. Sie blieb stehen und warf die Arme hinter sich. Der Wind ließ das Haar um ihre Schläfen flattern. Gewaltsam trat ein herber, entschlossener Zug in ihr sonst weiches Gesicht. „Ich will Ihnen sagen, was es ist,” preßte sie hervor. „Es gibt Zeiten, in denen ich einsam sein muß. Ganz einsam. Ich brauche dann all meine Kraft nur für mich allein. Und bin ungesellig und unfreundlich wie jetzt. Vielleicht — vielleicht —” Sie stockte. Dann kam es mit äußerster Anstrengung: „Vielleicht[S. 163] wäre es besser, Sie besuchten mich — in diesen Wochen hier draußen — gar nicht. Deshalb habe ich Ihnen auch nichts von der Sägemühle gesagt.”
Perthes sah sie mit bestürzten Augen an. Er wußte nichts zu erwidern auf dies seltsame, unerwartete Geständnis. Auch keinen Zorn empfand er gegen sie, daß sie ihn so gewissermaßen vor die Tür setzte. Nichts von Enttäuschung, von Zweifel an ihrer Freundschaft. Dazu hatte er sie zu sehr achten gelernt. Und er achtete sie gerade jetzt mehr als je, obwohl er ihr Reden weniger begriff als ihr Schweigen am Nachmittag. Es ging eine Traurigkeit von ihr aus, die auch ihn ergriff. Über die ganze Landschaft schien sie sich auszubreiten — über die dunklen Wiesen, den schwarzen Fluß, die finster starrenden Waldberge. Und in dieser Traurigkeit schritten sie nebeneinander weiter, ohne sich zu führen, er links, sie rechts am Weg. Er hatte vergessen, daß sie blind war und er sie führen sollte. Und sie wollte fern von ihm sein, so fern als möglich, und nicht geführt sein. So allein, wie sie es ihr ganzes Leben hätte sein sollen ...
Ehe sie den Garten der Mühle erreicht hatten, wurden sie von Elli und Wilkens eingeholt.
Auch die waren stumm. Aber es war die Stummheit des Glücks: die glänzte aus Ellis Augen und glänzte als ein sattes, seliges Lächeln auf Wilkens' vollen Lippen.
An der Böschung vor dem Garten lag noch ein Kahn. Der Schiffer, dem er gehörte, lungerte am Zaun. Er hatte gehört, daß noch Fremde aus der Stadt da seien, und bot nun hutrückend seine Dienste an. „Der Mond kommt!” setzte er verheißungsvoll hinzu und deutete hinauf nach[S. 164] den Bergen. Über einer Waldkuppe im Osten war es hell von weißem Licht.
Wilkens wandte sich fragend zu Perthes.
Der nickte zerstreut.
Es gab einen schnellen Abschied von wenigen Worten. Dann stiegen die beiden die Böschung hinunter und in den Nachen.
Marga und Elli traten hinaus auf die Landstraße. Sie folgten eine Weile dem Boot, das sich flußabwärts in die Mitte des Flusses hinüberarbeitete. Die Ruderschläge hallten dumpf und gleichmäßig zu ihnen zurück. Der Kahn und seine Insassen waren in tiefem Schatten.
Dann stieg der Mond über den Berg. Draußen, stadtwärts, flimmerte der Fluß in mattem, märchenhaftem Silber auf. Langsam breitete sich das Licht über das schlafende Tal.
Das Boot war jetzt in der Strömung. Schneller schoß es davon und strebte aus dem Schatten, den die nahen Berge warfen, ins rieselnde Silber da draußen. Elli winkte mit dem Taschentuch. Marga setzte sich auf einen der Prellsteine, die die Landstraße säumten.
Erst als sie schon weit von der Mühle waren, schaute Perthes zum erstenmal zurück.
Jetzt lag auch die Straße weiß im Schein des steigenden Mondes.
Und er meinte Marga zu erkennen, wie sie da saß, die Hände im Schoß gefaltet, das Gesicht mit den irrenden, suchenden Augen hinaus nach dem Wasser gerichtet.
Und mit einem Mal zuckte es von der hellen, fernen[S. 165] Gestalt herüber in seine Seele, geheimnisergründend und rätsellösend, klar wie das weiß flirrende Mondlicht: sie liebte ihn. Jetzt verstand er sie. Marga liebte ihn ...
„Dieser Perthes hat doch ein Schwein, nicht zu glauben! Finden Sie nicht auch, Herr Professor?”
„Na ja — wie man's nimmt. Exzellenz scheint ihm sehr gewogen zu sein.”
„Und dabei hat dieser sonderbare Heilige akkurat immer das Gegenteil von dem getan, was ihn bei Hupfeld in gute Meinung bringen konnte! Ich sagte ihm seinerzeit: ‚Wenn Sie hier was erreichen wollen, müssen Sie Exzellenz Ihre Aufwartung machen.‛ Was gibt er zur Antwort? ‚Ich besuche, wen ich will.‛ Ich führe ihn in unseren Sportklub ein. Alice Hupfeld sagt ihm: ‚Sie müssen uns mal besuchen, Doktor! Papa hat von Ihnen durch Rehbach in Bonn gehört. Er interessiert sich für Sie.‛ Perthes nickt mit dem Kopf und — bleibt weg. Denkt nicht daran, zu Hupfelds zu gehen. Was geschieht? Drei Wochen später läßt ihn der Geheime Rat höflich zu einer Besprechung in die Chirurgische bitten! Mir steht der Verstand still.”
„Warten wir ab! Perthes ist begabt. Ohne Zweifel. Hat auch Glück. Aber ein unsicherer Kantonist. Er hat keinen Ehrgeiz, so wenig wie ich. Doch — chi lo sa? Vielleicht ist er Heiratspolitiker!”
Diese freimütige Unterhaltung wurde im Bakteriologischen Institut zwischen Professor Hammann, dem[S. 166] Chef, und dem ersten Assistenten Doktor Markwaldt während der Frühstückspause geführt.
Hammann saß mit übergeschlagenen Beinen in einem für ein Laboratorium reichlich behaglichen Ruhesessel. Die paar Kaviarbrötchen, die ihm der Diener mit einem Glas Sherry jeden Vormittag um elf Uhr präsentierte, waren verzehrt. Er hatte den goldenen Kneifer abgenommen, wischte sich apathisch die kurzsichtig-blöden Augen und rieb den Kopf mit dem millimeterkurz geschorenen, grauschwarzen Haar am Sesselrücken.
Markwaldt lehnte an einem der Tische und kaute an seiner Butterstulle. Nach dem bedeutungsvollen Wort „Heiratspolitiker” hielt er es für geraten, die Unterhaltung vorsichtiger zu führen. Der Chef schien da auf Fräulein Exzellenz anzuspielen. Das war eine heikle Sache, denn man munkelte, daß zwischen ihm selbst und Alice vor einigen Jahren irgend ein zartes Verhältnis bestanden haben sollte. Genaues wußte niemand. War es nur eine flüchtige Courmacherei gewesen, wie die einen behaupteten, oder war es, wie andere mutmaßten, bis zu einer Art Verlobung gekommen — etwas hatte gespielt, so viel war gewiß. Dabei standen die beiden nach wie vor im Sportklub auf dem freundschaftlichsten Fuße. Daran erinnerte sich Markwaldt, während er seine Stulle mit bemerkenswertem Appetit zerkaute. Ob sich mal ohne Gefahr auf den Zahn fühlen ließ?
„Heiratspolitiker?” wiederholte Markwaldt nach einer Weile nachdenklich. „Das traue ich Perthes erst recht nicht zu. Erstlich ist er, wie ich ihn kenne, überhaupt kein Politiker. Und zweitens wüßte ich auch nicht, wem die Politik gelten sollte,” ergänzte er sich unschuldig.
[S. 167] „Na — Sie sagen doch selbst, daß Fräulein Exzellenz ihn zum Besuchmachen aufgefordert habe,” ließ sich Hammann gähnend vernehmen.
„Ach, deswegen! Sie glauben doch nicht —”
„Glauben? — Ich glaube gar nichts, das heißt — von den Frauen glaube ich alles und gar nichts!” Hammann beschäftigte sich jetzt damit, mit den Fingerspitzen die paar Brosamen von den tadellosen, hellgrauen Beinkleidern wegzuschnellen.
„Nein, nein! Da kann ich Sie vollkommen beruhigen, Herr Professor!”
„Mich beruhigen? Was heißt das?” fragte Hammann etwas lebhafter, während er sich im Sessel halb aufrichtete, den Kneifer auf die Nase drückte und nun seinerseits den Sprecher mit einigem Mißtrauen ansah.
Markwaldt merkte, daß er — freilich nicht ganz zufällig — eine unvorsichtige Wendung gebraucht hatte, und beeilte sich, kein Mißverständnis aufkommen zu lassen. „Wie ich höre,” erklärte er mit geheimnisvoller Wichtigkeit, „soll Perthes einer von den Richthoffstöchtern den Hof machen.”
„Richthoff? Richthoff — wer ist das?” Hammann besah sich gelangweilt seine eleganten Fingernägel. Er kannte kaum die Professoren seiner eigenen Fakultät, geschweige denn die der anderen.
„Richthoff ist, soviel ich weiß, Ordinarius für alte Geschichte oder einen ähnlichen Klumpatsch,” erläuterte Markwaldt.
„Ach sooo ...”
„Es sind, glaube ich, drei oder vier Mädels. So die richtigen philosophischen Putchen —”
[S. 168] „Na — denn man zu!” Hammann erhob sich. Die Sache interessierte ihn nicht länger. Er reckte seine schlanke, muskulöse Figur, die Figur des wohltrainierten Vierzigers, die im Gegensatz zu Markwaldts dicker, praller Stutzererscheinung weltmännisch-elegant im Sportjackett saß. Er ging nach seinem Arbeitskabinett nebenan. „Hörten Sie übrigens schon etwas von den Badener Rennen? Wann — wie — was?” fragte er unter der Tür, den Kopf zurückwendend.
„Noch nicht eine Silbe!” versicherte Markwaldt diensteifrig, während er vom Tisch mit plumper Grazie auf den Boden hüpfte.
Professor Hammann zog die farblosen Brauen über den grauen Augen in die Höhe, tippte den ebenso farblosen, kurzen Schnurrbart mit den Fingerspitzen und verschwand. Er zog die Tür hinter sich zu, um völlig ungestört sein Berliner Sportblatt zu lesen. So lange konnte die Arbeit ruhig noch warten.
Markwaldt, sich selbst überlassen, machte sich pomadig an sein Präparat.
Mit Neugier erwartete er die Rückkehr seines Kollegen Perthes. Es dauerte bis gegen zwölf, ehe der Erwartete kam und nach kurzem Gruß, als wäre nichts vorgefallen, an sein Mikroskop ging.
„Wie hat Ihnen denn das große Tier gefallen? Erzählen Sie!” konnte sich Markwaldt nicht enthalten, ihn aufzumuntern.
„Sehr liebenswürdig,” erwiderte Perthes einsilbig. Er schien nicht die mindeste Lust zu irgendwelchen Mitteilungen zu haben.
„Was hat er denn von Ihnen gewollt?”
[S. 169] „Allerhand.”
Markwaldt ließ sich durch die zugeknöpfte Art von Perthes nicht abschrecken. Und sollte er so viele Fragen tun müssen, als draußen vor dem Fenster an den langweiligen Hornsträuchern Blätter waren. „Will er Sie vielleicht zu seinem Assistenten machen?” forschte er unentwegt, mit einer boshaften Betonung, die der ausweichenden Geheimnistuerei seines Kollegen galt.
„Und wenn er das wollte?” gab Perthes gleichgültig zurück.
Markwaldt hielt mit der Arbeit ein und stemmte die kurzen, massigen Arme in die Hüften. „Anzukohlen brauchen Sie mich aber nicht gerade, Perthes!” sagte er ganz entrüstet. Er hatte die Frage nur aus Ulk gestellt, und der Gedanke, daß davon auch nur ein Wort wahr sein könnte, verursachte ihm Kongestionen.
„Fällt mir nicht ein, Sie anzukohlen, Doktor Markwaldt. Hupfeld hat mir in der Tat eine Assistentenstelle an der Chirurgischen Klinik angeboten.”
„Ja — aber — nu — nu — nu, sagen Sie mal!” Markwaldt kam aufgeregt zu ihm heran und fuchtelte mit den Händen. „Das ist ja Mumpitz! Das verbitte ich mir! Sie sind ja Bakteriologe! Sie —”
„Wenn Sie's durchaus wissen wollen, wie die Sache kam — nichts ist einfacher!” erklärte Perthes, ohne von seinem Mikroskop aufzusehen. „Vor einigen Wochen hatte ich die Bazillenschnüffelei so satt, daß ich in einem Anfall von Mißmut an Professor Rehbach in Bonn schrieb, ich hätte Lust, wieder zur Chirurgie zurückzukehren. Ob er etwas für mich wüßte. Irgendeine Assistentenstelle. Ich hatte bei ihm doktoriert, und wir verstanden uns[S. 170] immer leidlich. Inzwischen hatte ich die Geschichte wieder so gut wie vergessen. Heute sagte mir auf einmal Hupfeld, sein Schüler Rehbach, bei dem er wegen eines Assistenten angefragt, hätte mich empfohlen. Ob ich Lust hätte. — Fertig ist die Laube, würden Sie sagen! Das ist alles.”
„Menschenskind! Alles! Alles, sagen Sie! Als könnte es was Selbstverständlicheres nicht geben!” zeterte Markwaldt. „Sie sind der blasierteste Fasan oder das neugeborenste Lamm, das mir je vorgekommen ist!” Er drehte sich auf dem Absatz rund herum und klatschte sich auf den Schenkel. „Wissen Sie denn nicht, daß Hupfelds Assistenten, wenn sie nicht geradezu Hornochsen sind, gemachte Leute sind?”
„Sie sind sehr freigebig mit Ihren zoologischen Kenntnissen, Kollege!” Perthes streifte ihn über sein Instrument weg mit einem spöttischen Blick.
„Sind Sie denn der Exzellenz nicht schlankweg um den Hals gefallen? Oder haben ihr die berühmte Hand vor Rührung abgequetscht? Oder —”
„Sieht mir das ähnlich?”
„Nee, nee, ähnlich sieht Ihnen das freilich nicht. Ähnlich sieht Ihnen, daß Sie sagten: ‚Sehr nett von Ihnen, Herr Hupfeld! Ich hab' das nicht anders erwartet!‛ Vielleicht haben Sie dem alten Herrn auch auf die Schulter geklopft, was? Und dann erklärten Sie wohlwollend oder zimperlich, so wie 'ne höhere Tochter, die mit Mama'n sprechen muß: ‚Ich werde mir's mal überlegen‛! — Hab' ich recht?”
Jetzt mußte Perthes wider Willen lachen. Die bissige und doch zugleich gutmütige Aufregung Markwaldts[S. 171] belustigte ihn. „Ganz so war's ja nicht. Aber Bedenkzeit mußte ich mir allerdings ausbitten.”
„Wußt' ich 's doch! Ihnen müssen die Tauben nicht bloß gebraten, sondern auch gleich hübsch tranchiert in den Mund fliegen! Ich sage Ihnen, ich” — Markwaldt stellte sich breitbeinig in Positur und klopfte sich auf die Brust —: „Wenn Sie Glückspilz da nicht mit beiden Händen zugreifen, sind Sie — nee, die Zoologie ist dafür zu gut! — sind Sie reif für 'ne andere Klinik! Für die da drüben — am Wasser, wissen Sie — für die psychiatrische. Aber nicht als Assistent, sondern in die Isolierzelle! Dixi!” Damit schritt er heftig zurück an seinen Platz und präparierte seine Mauslungen.
Perthes dachte nicht ganz so gleichgültig von Exzellenz Hupfelds Anerbieten, wie es den Anschein hatte. Wenn er auch bei dem häufigen Wechsel, zu dem ihn seine innere Unrast innerhalb der Wissenschaft schon getrieben hatte, einer neuen Wendung skeptischer gegenüberstand als ein anderer und ihm Fragen des äußeren Erfolgs unbedeutender erschienen als die jener inneren Befriedigung, nach der er sich bisher umsonst abgehastet, so bedeutete doch der Vorschlag des berühmten Hupfeld, in seinen Assistentenstab zu treten, einen Fortschritt, so verlockend und aussichtsreich, wie er sich nur wünschen ließ. Er war weder der blasierteste Fasan noch das neugeborenste Lamm, zwischen denen ihm Markwaldt die Wahl ließ. Kam es darauf an, so konnte er sich freuen, so gut wie irgendeiner. Vielleicht toller als irgendeiner. Nur durften dann nicht so widerspruchsvolle Gedanken und Empfindungen sein Inneres beschäftigen wie gerade in den letzten Tagen.
Seit sich ihm Margas Geheimnis auf der nächtlichen,[S. 172] mondbeschienenen Heimfahrt von der Sägemühle enthüllt hatte, hatte er keine ruhige Minute mehr. Es war nicht wie vor einigen Wochen jenes leidenschaftliche Toben und Sichverlieren, das ihn in allen Höllen und Himmeln umherwarf. Im Gegenteil, er war besonnener als je und hatte sich zur mitleidslosesten Objektivität gezwungen, deren er fähig war. Am Tag nach jener letzten Begegnung räsonierte er einfach und nüchtern: Sie liebt dich. Liebst du sie? Was er bei strenger Untersuchung in sich fand, war: unbegrenzte Achtung, ein warmes, wohltemperiertes Freundschaftsgefühl, wie er es nie für einen Menschen empfunden, und tiefes Mitleid. Aber Liebe? Erdbewegende, himmelstürmende Liebe, wie er sie sich vorstellte und ersehnte, fand er nicht. Keine Beschleunigung seines Pulses, kein heißer, wirbliger Kopf, der nur einen Gegenstand denken und fassen konnte, keine Sehnsucht seiner Sinne, diesen Gegenstand im Arm zu halten, zu besitzen. Er liebte also Marga nicht. Folglich gab es für ihn als Mann von Ehre und Takt nur eine Möglichkeit: er mußte sie meiden, wie sie ihn ja selbst gebeten hatte. Strengste Zurückhaltung mußte er sich auferlegen, um sie nicht durch ein weiteres Entgegenkommen noch unglücklicher zu machen. Er hatte schon gerade genug gesündigt. Nun, da er von ihrer Liebe wußte, erklärte sich ihm so vieles: ihr Versagen, als er sie wegen seiner Liebelei mit Hilde König um Rat fragte; ihr Schweigen über den Umzug nach der Mühle; ihr ganzes Verhalten bei seinem Besuch da draußen, von dem ängstlichen, abweisenden Empfang bis zu der gewaltsamen Bitte, sie dort allein zu lassen. Wie mußte er sie gequält haben! Wenn es sein mußte, wollte er diese Freundschaft lieber opfern, als ein zweideutiges[S. 173] Spiel treiben, das mit Margas Verzweiflung endigen mußte.
Am Tag danach räsonierte Perthes nicht minder eindringlich.
Er stellte von neuem Achtung, Herzlichkeit, Mitleid bei sich fest, aber keine Liebe. Was war eigentlich Liebe? Gab es denn die Liebe, die er sich zusammenidealisierte? Er wollte sehr gründlich zu Werk gehen. War diese „Liebe” nicht ein sehr unklares Gemenge, das zwei sehr verschiedene Bestandteile zu verbinden strebte? Wenn er dies Phantasieprodukt recht unter die Lupe nahm, fiel es auseinander in Leidenschaft und in eine seelische Unbekannte, die er einstweilen mit x bezeichnete. Weiter kam er für diesmal nicht. Dagegen ertappte er sich des öftern, wie er in Gedanken Ausflüge nach der Sägemühle machte und sich ausmalte, was Marga jetzt tun und denken mochte. Ob und wie sehr sie unter seinem Ausbleiben litt. Vielleicht war es doch nicht richtig, ihr nicht wenigstens eine Zeile zu schicken, die ihr darlegte, wie er die Sache ansehe.
Der nächste Tag — es war der gestrige — ließ ihn mit dem Gefühl einer großen, schmerzlichen Leere aufwachen.
Kein Wunder, daß er als gewissenhafter Selbstschauer über diese Leere Rechenschaft verlangte. Was fehlte ihm? Was oder wen vermißte er? Ohne Zweifel den Umgang mit Marga. Oder Marga selbst. Er entbehrte eine angenehme Gewohnheit. Seine Gefühle für Marga waren dieselben wie vorher. Oder doch nicht ganz? Wo war er doch stehen geblieben? Liebe = Leidenschaft + x. Besser: x + Leidenschaft. Die Leidenschaft war sicher das Nebensächliche, das Zweite, das Untergeordnete. Aber x? War die große Unbekannte vielleicht Achtung + Herzlichkeit[S. 174] + Mitleid, eben jene Summe, in der sich die Freundschaft darstellte? Perthes mißtraute dieser Gleichsetzung. Sie befriedigte ihn nicht. Gewiß nicht. Nicht annähernd. Sie mußte falsch sein. Mit Gewalt hielt er sich jeden Gedanken an die Mühle und Marga fern.
Und heute?
Es war Freitag. War er mit dem linken Fuß aus dem Bett gestiegen? Er war unzufrieden mit seiner ganzen bisherigen, so peinlichen Analyse, mit der Methode überhaupt.
Was wollte er eigentlich? Das Unmögliche! Das lag so in seiner verhängnisvollen Natur; er wollte, was er nicht brauchen konnte, und wollte nicht, was er brauchte. Es genügte ihm offenbar nicht, daß er sich mit seiner albernen Schwärmerei für Hilde König und deren kläglichen Nachkrämpfen vor sich selber unsterblich blamiert hatte! Wo hinaus wollte er mit dem öden Spintisieren der letzten Tage? Es war doch vollkommen gleichgültig, was „Liebe an sich” war. Es handelte sich um das, was er als Liebe brauchte. Für sein Glück. Sein Wille hatte da das entscheidende Wort zu sagen. Hatte er sich je reicher, harmonischer, mehr als er selbst empfunden als in dieser Freundschaft? Er mußte an ein Gespräch denken, das er einst mit Marga gehabt. Sie hatte davon gesprochen, daß es viel weniger auf die Meinungen ankomme, die man sich von den Dingen im allgemeinen mache, als auf das, was man aus sich selber mache. Er hatte ihr entgegengehalten: „Was aber dann, wenn man bald so ist, bald so? Wenn man die bekannten ‚zwei Seelen‛ in der Brust hat?” — „Dann kommt es eben darauf an, durch welche von beiden man glücklicher, man mehr ‚man selber‛[S. 175] ist. Wenn man das erst weiß, braucht man bloß zu wollen!” Begriff er jetzt, was er damals nicht begreifen konnte? Wollte er begreifen? Er war am Wendepunkt seines Lebens. Es galt, sich zu entscheiden. Vor ihm lag eine Wirklichkeit: nicht freilich die Vollkommenheit, das Unmögliche und Überschwengliche, wohl aber Schönheit, Harmonie, die große Stille, die er ersehnte. Wenn er ein Mann war, brauchte er nur zu wollen. Die Wirklichkeit zu ergreifen und sich zuzurufen: Das ist die Liebe! Meine Liebe! Ich setze sie gleich der Unbekannten, und damit ist sie's! So will ich's! ...
So weit war Perthes' Überlegung gediehen, als er am Morgen ins Institut kam.
Dann rief ihn ein Diener von der Chirurgischen Klinik zu der unerwarteten Konferenz mit Hupfeld.
Unter dem ersten Eindruck des lockenden Antrags hatte er von dort den Weg nach der Straße am Wenzelsberg eingeschlagen. Er war so gewohnt, alles mit Marga zu besprechen, daß er für den Augenblick ihr Fernsein völlig vergessen hatte. Erst unterwegs fiel es ihm ein.
Ganz niedergeschlagen machte er kehrt und ging ins Bakteriologische Institut zurück.
Aber es wollte mit der Arbeit heute nicht vorwärts.
Er hatte in den letzten Tagen zu viel Seelenmikroskopie getrieben, um an der prosaischeren der Gewebezellen Geschmack zu finden. Es litt ihn nicht am Untersuchungstisch, und ehe Markwaldt das ihm unerträgliche Schweigen des Kollegen durch einen neuen Ausfall brechen konnte, war dieser davongelaufen.
Er bummelte nach der Stadt.
Nach all der vorsichtigen und gewissenhaften Überlegung,[S. 176] mit der er seine Gefühle zu zerfasern begonnen hatte, war er jetzt auf dem Punkt angelangt, wo sein Temperament sein Recht verlangte. Der Anstoß, den Hupfelds Anerbieten ihm gab, genügte gerade, um ihn den Sprung tun zu lassen, auf den die vermeintlich so objektiven Grübeleien der letzten Tage ihn unaufhaltsam zudrängten. Und es war ein Sprung. Vor ein paar Wochen war er für Hilde König Feuer und Flamme gewesen, für die leichte, poetische Äußerlichkeit, den „Falter”, den er, das schwerfällige „Kriechtier”, brauchte um jeden Preis! Und jetzt war es die tiefe, versonnene Innerlichkeit, die von allem Äußerlichen abgekehrte, schlichte, anspruchslos-ernste Marga, die ihm unentbehrlich war wie keine andere! In der kürzesten Spanne Zeit hatte sich seine Natur von einem Extrem ins andere geworfen. Aber so sah er, Perthes, das, was sich vorbereitete, nicht an. Er sah, im Schein seiner ehrlichen Selbstprüfung, eine gründliche, sein ganzes Wesen wandelnde Entwicklung. Und als er sich jetzt einen Ruck gab und entschlossen auf das Postgebäude zuging, wunderte er sich über die Ewigkeit, die es gedauert, ehe sein Entschluß gereift war. Er trat ein und ließ sich am Schalter einen Kartenbrief geben. Mit fliegender Schrift warf er die Zeilen darauf:
Bitte dringend um eine Unterredung. Komme gegen fünf auf die Sägemühle.
Herzlich Ihr
Max Perthes.
Als er fertig war, fiel ihm ein, daß der Brief sie nicht rechtzeitig erreichen könnte. Nicht einmal als Eilbrief. Sollte er telegraphieren? Marga konnte erschrecken.[S. 177] Er lief von der Post nach dem Bahnhof. Dort ergatterte er einen grünen Radler. Der mußte die Botschaft geradeswegs und so schnell wie möglich nach der Mühle bringen. Perthes war nicht eher beruhigt, als bis der junge Mann mit seinem grünen Käppi um die nächste Ecke geflitzt war. Es war schon viel zu viel Zeit versäumt, viel zu viel.
Sich die Stunden bis zur eigenen Fahrt nach der Mühle zu vertreiben, kostete ihn eine unglaubliche Anstrengung.
Er nahm sich vor, sein Mittagessen im Café Wagner länger auszudehnen als sonst. Die Folge war, daß er eine Viertelstunde eher fertig war, als gewöhnlich. Dann wollte er in seiner Behausung mindestens eine Stunde schlafen. Noch keine halbe Stunde war vergangen, so sprang er von seinem Schaukelstuhl auf und streckte den Kopf zum Fenster hinaus. Es war ein bedeckter, aber angenehmer Sommertag. Es lohnte sich immerhin, zu Fuß nach der Mühle zu gehen. Nein! Das dehnte sich so widerlich lang. Also mit dem Lokalzug. Aber da mußte er noch anderthalb Stunden warten. Genau so war's mit dem Vergnügungsdampfer. Und der blieb überdies mit Vorliebe in der starken Strömung hinter der Brücke, dem sogenannten „Teufelswirbel”, stecken. An einen Nachen war erst recht nicht zu denken. Das Rudern dauerte gegen den Strom eine halbe Ewigkeit. Blieb — das Rad. Das war nicht mehr recht fair, aber praktisch. Er entsann sich eines medizinischen Kollegen von der Augenklinik, der ihm ein Fahrrad pumpen konnte. Obwohl es noch nicht drei Uhr war, machte er sich zu diesem Bekannten auf den Weg. Natürlich war der noch bei Tisch. Aber das Rad war da, und nach einer Bestellung seines Namens durch die Hauswirtin[S. 178] konnte er riskieren, es zu nehmen. Jedenfalls nahm er es. Daß er so von allen ihm zu Gebote stehenden Fuhrwerken — Autodroschken ungerechnet — das geschwindeste gewählt, war der reine Zufall. Wenn er zufuhr, konnte er in zwanzig Minuten auf der Sägemühle sein. Und er fuhr zu.
Er sah nicht rechts noch links. Er wäre um halb vier Uhr an Ort und Stelle gewesen, wenn er nicht ganz unerwartet von einer Stimme hinter sich angerufen worden wäre.
„Holla, Doktor! Sie sind wohl Rennfahrer, was?” klang es ihm boshaft nach.
Verdutzt drehte er sich um. Er hatte gar nicht bemerkt, daß er an einer gleichfalls radelnden jungen Dame vorbeigesaust war.
An der Stimme hatte er Fräulein Hupfeld erkannt.
Wenn er nicht schon zurückgeschaut, und wenn es sich nicht um die Tochter seines präsumtiven Chefs gehandelt hätte — er wäre schlankweg weitergefahren. So machte er eine Volte und wartete, bis Fräulein Exzellenz in sehr gehaltenem Tempo sich näherte. Sie sah schick aus in dem leichten, lichtbraunen Kostüm mit der gleichfarbenen Mütze, die ein heller, bauschiger Autoschal mit flotter Schleife unter dem Kinn festhielt. Die kecke Stupsnase und ein paar seltsam flackernde, graubraune, intensive Augen blickten aus dem flatternden Musselin hervor. Frei und ungezwungen, nur die eine Hand am Griff der Lenkstange, saß sie auf dem Rad. Die länglichen, schmalen Füße in braunen Lackhalbschuhen regierten spielend die Pedale.
„Sie sind also auch noch so stillos, zu radeln?”
[S. 179] „Ich bin immer mein eigener Stil,” gab Perthes mit hochtrabender Kürze zurück.
„Hübsch. Das könnte beinahe ich gesagt haben!” Alice war jetzt neben ihm. „Wissen Sie, das wievielte Mal es ist, daß Sie mich nicht grüßen, Doktor Perthes?”
„Nein, gnädiges Fräulein. Jedenfalls bedaure ich —”
„Das erstemal vor einigen Wochen. Da rannten Sie mit einem Armvoll Rosen an mir vorbei, als hätten Sie mich noch nie gekannt.” Sie reichte ihm mit handkußheischender, ungezwungener Bewegung die Hand von Rad zu Rad, während sie ihn mit einem herausfordernden Blick von Kopf zu Fuß oder vielmehr, wie dies ihre Gewohnheit war, von Fuß zu Kopf musterte.
Perthes begnügte sich mit einem flüchtigen Händedruck. Nichts kam ihm ungelegener als dies Zusammentreffen, und er gab sich keine Mühe, sein Mißbehagen zu verbergen.
Alice, die seinen Widerstand sofort heraus hatte, fuhr noch langsamer und zwang ihn, mit ihr gleiches Tempo zu halten.
„Das zweitemal, wo Sie mich schnitten,” fuhr sie mit gemächlicher Harmlosigkeit fort, „gingen Sie mit einem blonden Herrn, der ungemein jovial und lustig aussah, im Geschwindschritt über die Brücke nach der Altstadt. Papa und ich fuhren im Automobil an Ihnen vorbei. Das war vor fünf, sechs Tagen.”
„Aber Sie führen ja geradezu Buch über meine Unterlassungssünden!”
„Das drittemal heute, Doktor. Ist das etwa Absicht — Herr Perthes?” Sie sah ihn nicht an, aber rundete auf eine maliziöse Art ihre spitzbübischen Lippen.
[S. 180] „Gnädiges Fräulein,” wehrte sich Perthes, „ich bitte tausendmal um Vergebung! Ich bin völlig unschuldig! Denn —”
„Na — ob Sie so sehr unschuldig sind,” bemerkte Alice mit einem vieldeutigen Seitenblick, „ist 'ne Frage für sich! Wo wollen Sie denn eigentlich hin?”
„Ich fahre spazieren,” erwiderte Perthes hastig.
„Spazieren?” wiederholte sie ungläubig-gedehnt. „Das trifft sich ja famos. Ich fahre nach dem Stift. Wir wohnen jetzt ein paar Wochen draußen. So ab und zu wohnt sich's ganz nett in dem alten Rumpelkasten. Sie kennen doch Stift Nieburg?”
„Vom Vorbeigehen — natürlich.” Das Stift lag einige hundert Schritte von der Sägemühle entfernt auf halber Bergeshöhe; ein schloßartiges Gebäude aus dem achtzehnten Jahrhundert mit einer hochgetürmten Kapelle, mitten in altem Park, das Flußtal beherrschend. Exzellenz Hupfeld hatte sich diesen prächtigen Sitz, ein früheres adliges Fräuleinstift, als Sommerresidenz gekauft. „Es muß sich dort nicht schlecht hausen lassen. Das denke ich mir,” setzte Perthes hinzu, um das Gespräch nicht unhöflich stocken zu lassen.
„Gott, Papa hat nu mal die schnurrige Vorliebe für olle Kamellen! Ich mach' mir nicht viel draus. Das Romantische ist nicht mein Fall. Aber Sie, Doktor — Sie sehen so'n bißchen nach Räuberromantik aus. Die Kapelle ist ganz niedlich. Und im Saal hängen über wurmstichigen Möbeln, die wertvoll sein sollen, greulich öde Ahnenbilder. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie 'n bißchen mit rauf! Ich bin bis Abend mutterseelenallein. Schloßbesichtigung gratis!” Sie zwinkerte halb listig,[S. 181] halb spöttisch mit ihren Augen, die ihre Farbe wechseln zu können schienen, indem sie bald grünlich, bald golden aufschimmerten oder ihr undurchdringliches Graubraun bewahrten.
„Sehr liebenswürdig! Aber zu meinem Bedauern — heute geht's nicht. Wirklich nicht! Ich muß nachher noch arbeiten!” Perthes war nicht für Ausrede und Verstellung gemacht. Man sah ihm an, daß er flunkerte. Er errötete sogar ein wenig. Ihr sagen, wohin er wollte, konnte er nicht. In ihrer Gegenwart von Marga oder auch nur von etwas zu reden, das mit ihr im Zusammenhang stand, widerstrebte ihm. Er wäre ihrer Einladung auch nicht gefolgt, wenn er gekonnt hätte. Alice Hupfelds freie und saloppe Art, die immer der Gipfel des Modernen sein sollte, entsprach seinem Geschmack heute weniger denn je. Vielleicht daß sie ihn auch verwirrte. Ihre spottsüchtige Koketterie zwang ihn zu einer ständigen Kriegsbereitschaft, die ihm heute besonders beschwerlich wurde.
Sie dachte nicht daran, ihn zu entlassen. Je deutlicher seine Ungeduld wurde, um so weniger. Dieses schwarzbärtige Mannkind, das sie in Perthes sah, reizte sie, je spröder er sich gab, nur um so stärker. Seine Gewandtheit, sein Temperament und seine Kraft, die sie vom Sportplatz kannte, imponierten ihr. Sein Aussehen, das dunkelgebräunte Gesicht mit den ungebärdig über die Stirn fallenden, buschigen Haaren, den großen, oft unvermittelt aufglühenden Augen, hatte für sie etwas Exotisches, das sie anzog, während seine innere Unberührtheit und Ungelenkigkeit, die mit der äußeren Geschicklichkeit kontrastierte, sie lächerte und zu spöttischer Überlegenheit herausforderte.
[S. 182] „Ich glaube, Sie sind ein wenig prüde, Doktor Perthes,” sagte sie nach einer Weile wie in Gedanken vor sich hin.
„Ich? Wieso? Wie meinen Sie das?” fragte Perthes zerstreut.
„Ich denke mir's eben. Vielleicht steckt hinter Ihnen ein ganz ehrsamer, biederer Philister — wie?” Ihre Augen begegneten mit voller Angriffslust den seinen, und ihr Mund verzog sich, als unterdrücke sie ein boshaftes Lachen.
„Schon möglich!” gab Perthes achselzuckend zurück. Seine Unbehaglichkeit wuchs mit jeder Umdrehung des mühsam zurückgehaltenen Rades. Welche Tücke hatte ihm gerade jetzt dieses verteufelte Mädel zuführen müssen, das sichtlich sein Vergnügen daran fand, eine Stimmung auszunutzen, die ihn wehrlos machte?
„Mit wem verkehren Sie denn hier in der Hauptsache?” forschte sie unvermittelt weiter. Es war eine Liebhaberei von ihr, Fragen scheinbar zusammenhangslos aneinanderzureihen, die sie dann plötzlich zu einer unvermuteten Schlinge zusammenzog.
„Ich habe sehr wenig Verkehr, Fräulein Hupfeld. Vorzugsweise bin ich in Gesellschaft meiner Bazillen,” scherzte er grimmig.
„Da haben Sie ja ausgesuchte Gesellschaft!” lachte Alice.
Es war ein helles, kurzes, aufreizendes Lachen, bei dem er nervös die Hände um die Lenkstange preßte, als wollte er sie zerbiegen. Wußte sie, daß er bei Richthoffs aus und ein ging? Wollte sie ihn aushorchen? Spottete sie über seinen Verkehr?
Zum Glück trennten sich jetzt die Wege. Der zum Stift Nieburg führte seitwärts bergan. Die Landstraße lief nach der Sägemühle geradeaus weiter.
[S. 183] Alice sprang leichtfüßig vom Rad.
Perthes tat dasselbe, um sich zu verabschieden.
„Werden Sie denn bei Papa als Assistent eintreten?” warf sie nüchtern hin.
„Wohl möglich!”
„Na — dann werd' ich Sie mal ein bißchen in Erziehung nehmen, Doktor Perthes!”
„Scheint Ihnen das nötig?”
„Oh — dringend! Ich werde Sie zum Beispiel lehren, daß man junge Damen seiner Bekanntschaft nicht übersieht. Dann werd' ich Ihnen beibringen, daß man einer jungen Dame, die ihr Rad bergan schieben muß,” — sie deutete auf den etwas steilen Weg, der zum Stiftstor führte — „seine Dienste anbietet!”
„Da scheint die Assistenz bei Ihrem Herrn Vater mit gewissen Nebendiensten verbunden zu sein!” entfuhr es Perthes wütend. Sein Unmut darüber, daß er aufgehalten und absichtlich mißhandelt wurde, riß ihn zu dieser groben, patzigen Unhöflichkeit fort.
Er hatte sich Alice gegenüber nur eine Blöße gegeben. Sie warf den schleierumbauschten Kopf in den Nacken zurück. Eine Strähne ihres rötlichen, ungebärdigen Haares schlüpfte unter der Mütze hervor. Ihre Lippen spitzten sich und bebten leise, während die kecken, spitzbübisch-kecken Augen ihn wie zuerst von Fuß zu Kopf musterten und sich dann ohne Scheu in die seinen hefteten.
„Ich wollte sagen —” verbesserte sich Perthes mit einer Unbeholfenheit, die nichts verbesserte.
„Nicht nötig!” schnitt sie ihm das Wort ab. „Ich werde mich für Ihre Grobheiten schon schadlos halten, Doktor!” Sie gab ihm die Hand, als wäre nichts geschehen. Und er[S. 184] wagte diesmal nicht, diese schmale, schmiegsame Hand ohne einen flüchtigen Handkuß zu lassen.
Ihre Augen zuckten triumphierend. Sie nickte ihm zu, als wollte sie sagen: Ich fange schon an, mich schadlos zu halten! Und ohne ihn weiter zu beachten, stieg sie, das Rad neben sich herschiebend, zum Stift hinauf. —
Perthes schwang sich wieder auf den Sitz. Er fuhr in schnellem Tempo der Mühle zu, deren Dach unweit zwischen den hohen Gartenbäumen durchschimmerte. Seine Uhr zeigte vier. Es war also noch immer reichlich viel früher, als er sich angemeldet hatte. Aber er hätte ohne dieses Zusammentreffen auf offener Straße eine halbe Stunde eher da sein können. Warum hatte sich dieses tolle Mädel wie ein fratzenschneidender Kobold in seine ernste, zielsichere Stimmung gedrängt? Er wütete innerlich gegen sie und ihre forschen Allüren, ihre spottlüsterne, herausfordernde Überlegenheit. Diese ganze gelenkige Mischung von Harmlosigkeit und Bosheit war ihm verhaßt. Ohne Zweifel! Und um ihr pfiffiges Schelmengesicht zu vertreiben, rief er sich Marga ins Gedächtnis. Es hielt schwerer, als er gedacht. Fräulein Exzellenz war hartnäckig, auch noch in seiner Vorstellung.
Perthes war froh, als er die Sägemühle erreichte, die heute wie verschlafen hinter ihrem sonnenlosen Garten lag. Ein Pfauenschrei vom Geflügelhof war der einzige Laut, der ihn bei der Einfahrt empfing.
Er sprang ab und schob sein Rad in den Gitterstand, der für diesen Zweck links vom Tor angebracht war. Er war trotz des Schattens heiß geworden und trocknete sich die Stirn. Ein Blick in den Garten überzeugte ihn, daß da die Gesuchten nicht zu finden waren. Er trat ins Haus[S. 185] und fragte die Wirtsfrau, die neben dem Büfett döste, nach den jungen Damen. Sie glaubte, die beiden Fräuleins hätten einen Ausflug gemacht. Ja, natürlich; jetzt, während sie sich die Augen rieb, fiel es ihr „für gewiß” ein: sie waren schon am Vormittag weg und wollten erst zum Abend zurückkommen.
Damit hatte Perthes auch nicht einen Augenblick gerechnet.
Wahrhaftig! Als er sich im öden, plakatreichen Gastzimmer umblickte, wo nur die Fuhrleute oder die Bauern aus der Umgebung ihr Glas Bier oder ihren Schnaps zu trinken pflegten, sah er seinen eiligen Kartenbrief friedvoll am Spiegel stecken. Marga hatte ihn also nicht einmal mehr erhalten. Trotz des grünen Radlers! Heute, ausgemacht heute mußten die beiden eine Tour machen! Wo das Wetter nicht einmal danach war! Ganz verzweifelt knickte er auf einer der rohgezimmerten Bänke zusammen. Wohin die Damen gegangen wären, forschte er kleinlaut. Das wußte die gute Wirtsfrau auch nicht. Vielleicht hatten sie's ihrem Mann gesagt, aber der war in der Stadt. Also ihnen entgegenfahren konnte Perthes auch nicht. Es blieb gar nichts anderes übrig: wenn er nicht unverrichteter Dinge heimkehren wollte, mußte er bis gegen Abend warten. Eine Geduldsprobe, die zweite schon an diesem Nachmittag, die wie Rauhreif auf sein Ungestüm fiel ...
Er bestellte sich Kaffee. Trostlos ging er in den Garten und setzte sich an den Tisch im Haselgebüsch, wo sein erster mißlungener Besuch auf der Mühle angefangen hatte.
Kein Spaziergänger ließ sich heute ringsum blicken.
Es gab so Tage, erklärte die Wirtin, als sie ihm selber[S. 186] den Kaffee brachte, da blieben sie wie auf Verabredung alle weg. Dabei war es doch nicht einmal übles Wetter. Im Gegenteil. Sehr angenehm zum Gehen. An Regentagen kamen sie manchmal in hellen Haufen. Es war sogar möglich, daß heute, mit dem Lokalzug um fünf Uhr, noch so viele kämen, daß man nicht Hände genug hatte, sie zu bedienen.
So philosophierte die junge, jetzt munter gewordene Frau, und Perthes hörte gottergeben zu.
Oder er hörte vielmehr nicht zu, sondern sah unglücklich zwischen den Büschen durch, in den Garten. Wie trübselig der aussah mit seinen leeren, buntgedeckten Tischen! Wie jämmerlich der dumme Springbrunnen in der Mitte, den er noch nie beachtet, in sein dürftiges Bassin plätscherte! Und draußen kroch der Fluß in grauer Greisenhaftigkeit; drüben, am anderen Ufer, schwammen Feld und Wald langweilig ineinander.
Das war ja, um selber trübselig zu werden! Und das sollte womöglich stundenlang dauern? Wie gemacht für ihn, um sich zu vergrübeln!
Stand er vielleicht im Begriff, eine Dummheit zu machen? Die Dummheit seines Lebens, die alle früheren übertraf? Oder — wie? — wenn Marga ihn nicht anhörte? Wenn, ja wenn — das war das Tollste, darauf war er noch gar nicht gekommen, und das war so unmöglich gar nicht! — wenn er sich nur eingebildet hatte, daß sie ihn liebe? Wenn sie überrascht war von dem, was er ihr sagen wollte? Und ihn abwies? Aber das war ja verrückt!
Gepeinigt stand er auf und ging mit langen Schritten in dem leeren Garten zwischen den Tischen auf und ab, um den blödsinnig plätschernden Springbrunnen herum[S. 187] und noch einmal herum. Gewiß, das war unsinnig! Und doch plagte ihn diese jüngste Ausgeburt seiner Phantasie mit allen Teufeleien, deren sie fähig war. Wie ein dummer Junge stand er jetzt da und starrte kleinmütig über den Lattenzaun des Gartens weg in den Fluß. Warum sollte sie auch die Sache nur in Erwägung ziehen? Was konnte er ihr überhaupt bieten? Wie sollte er sich verständlich machen und die Geschichte anfassen? Am Ende hatte es gar keinen Zweck ... Im Nu war Max Perthes aus dem Gleise geworfen, wenn sich etwas nicht so gerade und einfach anließ, wie er es vor sich sah. Es blieb dabei: er konnte immer noch erst springen, aber nicht gehen ...
Der Lokalzug brachte diesmal nicht den von der kundigen Wirtin als möglich prophezeiten Andrang. Der Garten blieb leer. Zwei, drei Einspänner, alte Herren mit Perücken, mit Mänteln mitten im Sommer und Stöcken mit Elfenbeinkrücken, tranken, weil sie nun einmal täglich kamen, ihre Tasse Kaffee und lasen ihre Zeitung. Das war alles.
Und doch hellte sich der Himmel gegen Abend auf. Die Sonne drängte sich, etwas blaß und schüchtern freilich, durch die weißgrauen Wolken. Und den Fluß herunter kam ein Boot mit rotbemützten Studenten gezogen, deren Gesang halb wehmütig, halb heiter übers Wasser klang. Sie sangen von der Saale im Tale und den Burgen auf den Bergen. Erinnerungen an seine eigene Studentenzeit am fröhlichen Rhein erwachten in Perthes. Sie und der verhallende Gesang und das zage Sonnenlicht erzeugten eine ruhigere Stimmung in ihm. Die zerfahrenen, unmännlichen Zweifel wichen allmählich einer tapferen, fast heiteren Zuversicht. Das Unmögliche und Unerreichbare[S. 188] einer Liebe, die es nirgends, für ihn jedenfalls nirgends, gab, lag hinter ihm mit der Unreife und Halbheit, der rastlosen Jagd von Extrem zu Extrem; das Wirkliche und Faßbare war vor ihm. Das wollte er als Mann ergreifen und festhalten. So konnte er Marga entgegentreten, mit ihr sprechen.
Drüben, am anderen Ufer, stieß jetzt das Fährboot ab.
Perthes sah zu, wie es erst gegen die Strömung arbeitete und sich dann in der Mitte des Flusses von den Wellen aufnehmen ließ. Der breite Rücken des Schiffers hatte ihm die Insassen verdeckt. Jetzt erkannte er sie und richtete sich auf. Er ging aus dem Garten und stieg die Böschung hinunter, nach dem Steg ...
„Du, ich glaube — wahrhaftig! — Doktor Perthes erwartet uns drüben!” konstatierte Elli mit halblauter Überraschung.
Marga, die die Hand ins Wasser getaucht hatte, um die frische, ziehende Kühle zu spüren, hob sie langsam heraus. Sie war selbst verwundert, wie langsam. Und war auch verwundert, wie wenig verwundert sie war. All die letzten Tage war sie so tieftraurig, so in sich zerrissen, so bitter-wortkarg gewesen. Elli hatte sich gar nicht mehr mit ihr zu helfen gewußt und schließlich, aus reiner Verzweiflung, einen Tagesausflug vorgeschlagen — trotz des mäßigen Wetters. Weit über die Berge waren sie durch die einsamen Wälder nach einer Schloßruine über dem Flußtal gewandert. Marga blieb bis über Mittag so trüb und verschlossen, als sie nur je gewesen. Erst am Nachmittag kam plötzlich, ihr selbst unerwartet und unverständlich, eine Fröhlichkeit über sie, wie lange nicht. Grundlos, gegenstandslos — eine von jenen unbegreiflichen[S. 189] Offenbarungen des Gefühls, die sinnlos erscheinen und doch mit geheimnisvoller Ahnung mitten im Unglück eine glücklichere Zukunft vorauszukünden scheinen. Und diese frohe Aufwallung, die Elli jubelnd begrüßte und miterlebte, hielt vor. Auf dem Hinweg hatte Elli vergebens versucht, der Schwester die Herrlichkeit der alten Buchen, der aus der Ferne ins Walddüster lachenden Kornfelder, des in der Tiefe zwischen Felsen aufschäumenden Flusses nahezubringen; auf dem Heimweg war es Marga, die beschrieb. Eins von den Bildern, die ihr inneres Gesicht sah: es war ihr, als schritten sie unter goldwolkigem Sommerhimmel talab über einen unabsehbaren Hang von blauen Glockenblumen, die im Winde wunderbar läuteten, mit zarten, dünnen, verheißungsvollen Stimmchen. Und wie sie an den Fluß kamen und übersetzten, hörte sie noch immer auf das seltsame, lockende, feine Klingen im Winde. Wie natürlich war es, daß er da drüben stand am Ufer, jenseit des Blumenhanges und des Wassers, das ihn silbern besäumte! Sein gemessen-ernster Gruß, der jetzt ihr Ohr traf, erschreckte sie nicht. Sie lächelte, als müßte es so sein. Die eine Hand gab sie Elli; die andere ergriff er und half ihr aussteigen, während Elli dem Fährmann seinen Groschen gab.
„Sie sind ja gar nicht ein bißchen erstaunt und ungehalten, mich hier zu treffen!” meinte Perthes.
Marga erwiderte nichts. Wie sie von ihm sich die Böschung hinaufführen ließ, klangen ihr die Glockenblumen von drüben nach; ihre zarten, dünnen Stimmen wuchsen, und ihr Geläute schwoll so mächtig, daß es sie betäubte.
Erst als sie im Garten standen, verstummte das Getön, und sie ließ seinen Arm los.
[S. 190] „Sie müssen nicht denken, ich hätte Ihr Verbot, zur Mühle zu kommen, leichtsinnig vergessen, Fräulein Marga!” begann Perthes wieder. „Der Brief, mit dem ich mich anmeldete und um eine Unterredung bat, steckt in der Wirtsstube drinnen seit Stunden am Spiegel. Es hängt auch jetzt noch ganz von Ihnen ab, ob Sie mich einen Augenblick hören wollen!” Er sah Marga forschend an. „Unter vier Augen,” setzte er hinzu und sah hinter sich.
Aber Elli war verschwunden. Wie von der Erde verschluckt. Sie versicherte später, sie habe stets einen „feinen Merks” für gewisse Situationen gehabt. Einen sehr feinen sogar ...
Marga antwortete nicht auf Perthes' Frage. Ihr war zumute, als spänne das Bild ihrer Phantasie sich selbsttätig weiter; als sei all das Traum und nicht Wirklichkeit. Sie ließ sich von ihm an den Tisch im Haselgesträuch leiten und setzte sich zu ihm, wie er es wollte.
„Vor ein paar Wochen,” hob Perthes, durch ihr Schweigen befangen, an, „hatte ich daran gedacht, von hier für immer fortzugehen. Wissen Sie: damals, als ich die törichte Geschichte mit Hilde König ausgeschwärmt hatte. Und als Sie, Fräulein Marga, mich vorigen Dienstag auf Wochen hinaus fortschickten, dachte ich wieder, es würde wohl das Beste sein. Ich hatte Lust, wie ich Ihnen schon früher einmal erzählte, die Bakteriologie wieder an den Nagel zu hängen und zur Chirurgie zurückzukehren. Erinnern Sie sich noch, Fräulein Marga?”
Sie nickte mechanisch mit dem Kopf. Sie verstand nur halb, was er sagte.
„Nun erhielt ich heute ein unerwartetes Anerbieten, hier bei Geheimrat Hupfeld als Assistent einzutreten,”[S. 191] fuhr er mutiger fort. „Ehe ich mich entscheide, möchte ich hören, was Sie darüber denken.”
„Aber davon versteh' ich ja gar nichts!” erwiderte Marga leise. Sie nahm zerstreut ihren weißen englischen Strohhut ab und legte ihn neben sich auf den Stuhl. Verträumt strich sie das Haar über ihrer Schläfe zurecht.
„Zu verstehen brauchen Sie da weiter nichts, Fräulein Marga. Sie sollen mir nur sagen, ob Sie wünschen, daß — daß ich — nun, daß ich eben hierbleibe. Das hängt nämlich von Ihnen ab. Nur von Ihnen,” wiederholte er gepreßt.
„Von — mir?” stammelte Marga. Sie hatte bisher die Augen blicklos ins Weite gerichtet. Jetzt suchten sie ihn mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Besorgnis und Verwirrung, als könnten sie ergründen, wohin er mit diesem vieldeutigen Wort zielte. Ob er scherzte; ob er sie quälen wollte, mit ihr spielen, oder ob ...
„Ich rede in vollem Ernst, Fräulein Marga!” beteuerte Perthes, der ihren Blick richtig deutete. „Ich habe mich die letzten Tage, während ich fernblieb, gründlich vorgenommen. Ich wäre nicht wieder zu Ihnen gekommen, wahrhaftig nicht, wenn ich mir nicht ein Recht dafür hätte zusprechen können. Ich nehme die Stellung nur an, wenn Sie, Fräulein Marga, mir erlauben, wie bisher zu Ihnen zu kommen. Auch auf die Sägemühle. Und ich muß sogar noch weitergehende Bedingungen machen: wenn Sie versuchen, mehr für mich zu sein als eine Freundin! Wenn Sie —” Die Erregung nahm ihm die Stimme, und er faßte nach ihren Händen, die vor ihm auf dem Tisch lagen. „Wenn Sie —”
[S. 192] Marga zog sie mit einem leisen Aufschrei zurück. Sie warf sich gegen die Lehne ihres Stuhles. Bei seiner Berührung war sie plötzlich aus ihrer traumhaften Betäubung erwacht. Eine jähe Röte schoß in ihre Wangen und wechselte augenblicklich mit tiefer Blässe.
„Nein, nein, nein!” stieß sie entsetzt hervor. Sie krampfte ihre Hände vor der Brust ineinander. Das sollte Wirklichkeit sein? Das durfte ja nicht Wirklichkeit sein. Niemals! „Nein! Nein! Nein!” wiederholte sie noch einmal mit äußerster Anstrengung und hob die Hände gegen ihn, als wollte sie so das Unmögliche und Unerlaubte von sich wegzwingen. Ihre Augen hatten einen beinahe irren Ausdruck angenommen. Sie wollte aufspringen. Sie wollte fortlaufen, ihm entfliehen — aber ihre Kraft versagte. Die Arme fielen ihr erschöpft nieder, und die Augen schlossen sich, wie von einem übermenschlichen Schmerz zugedrückt.
Perthes war gleichfalls erblaßt. Schweigend starrte er sie an. „Sie wollen also nicht,” sagte er dann tonlos und bitter.
„Ich — ich darf nicht!” stammelte Marga mit zuckenden Lippen.
„Sie dürfen nicht?” fragte er dumpf. „Und warum nicht? Weil Sie nicht können? Weil Sie mir nicht mehr geben können als Freundschaft? Darum?”
Marga schüttelte gequält den bleichen, blonden Kopf.
„Oh, Sie trauen mir nicht! Sie können nicht glauben, daß ich weiß, was ich will! Was ich tue! Ich habe Ihnen keine hohen Liebesbeteuerungen vordeklamiert! Ich will nicht, daß Sie auch nur eine unwahre Silbe von mir hören! Nur versuchen sollten Sie's mit mir! Ehrlich versuchen,[S. 193] bis Sie sich überzeugt haben, daß ich's ehrlich meine!” Seine Worte brachen jetzt ungestüm und drängend aus ihm hervor. Er verkannte sich nicht. Er wußte, wie er an Reife hinter ihr zurückstand. Aber er wußte auch, daß er sie und nur sie brauchte! Und er wiederholte ihr mit seiner leidenschaftlichen Beredsamkeit alles, was in diesen Tagen in ihm vorgegangen war, mit rückhaltloser, nichts verbergender Offenheit.
Während er noch sprach, sank Margas Kopf vornüber auf den Tisch, auf ihre Arme. Und mit einem Mal schüttelte das Schluchzen wie ein Schauer ihren Leib.
Erschrocken hielt Perthes inne.
„Ich darf ja nicht! Ich bin ja blind! Ich darf ja nicht!” ging es wie der Schrei eines auf den Tod Getroffenen durch den abendlichen, einsamen Garten.
Jetzt hatte Perthes verstanden.
Er reckte sich. Auch über ihn lief es wie ein Zittern. Es war sein Herz, das groß und übermächtig und warm in ihm aufpochte, als wollte es die kräftige Brust sprengen. Es war gut, was er wollte! Und es war Schönheit, die seine Seele weitete! Mochte das Gefühl nun Mitleid sein, unsägliches Mitleid oder brüderliche Freundschaft oder Liebe: er mußte ihre Hände ergreifen, stark und zwingend. Er mußte sie an sich ziehen —
Und Margas Kraft war zu Ende. Willenlos fiel ihr Kopf an seine Brust, und ihr tränenüberströmtes Gesicht verbarg sich dort. Um schwach zu sein, einen Augenblick schwach wie ein Weib, das liebt — und kostete ihre Schwäche sie ihre Seligkeit ...
Als Elli mit dem „feinen Merks” eine halbe Stunde später vernehmlich „Pardon!” rief, ehe sie an den Tisch[S. 194] hinter den Haselbüschen trat, fand sie die beiden Hand in Hand, und Marga lehnte an Perthes' Schulter. Elli war natürlich furchtbar überrascht. Aber genau genommen hatte sie gewußt, daß es so kommen würde. Fast hätte sie „immer” dazugesetzt, wie Schwester Käthe.
Kissingen, den .. Juli 19..
Meine liebe kleine Elli!
Nur durch eine Ansichtskarte habt Ihr uns bisher Eure Übersiedlung nach der Sägemühle gemeldet. Papa ist schon ganz ungehalten, daß er keinen Brief bekommen hat, und ich habe große Mühe, Euch gegen seine empörten Ausfälle, wie undankbare, mißratene Kinder er habe, in Schutz zu nehmen. Also schreibt ihm nur gleich nach Empfang meines Briefes, sonst wird er ernstlich böse.
Es ist hier im lieblichen Frankenlande wunderbar schön. Die Natur bietet viel. Aber noch mehr das großartige, wirklich internationale Badeleben. Wenn man den rechten Blick für Menschen hat, kann man hier seine Studien machen. Es ist doch kein bloßes Vorurteil, das Wort: Reisen bildet! Ich habe hier, in den paar Wochen, mehr beobachtet und gelernt als zu Hause in einem halben Jahr. Die „große Welt”, die uns auf Schritt und Tritt umgibt, ist zuerst verwirrend und blendend; aber allmählich gewöhnt man sich daran. Toiletten sieht man — im Bad, am Brunnen, bei den Konzerten —, Du kannst Dir keine Vorstellung machen, Kleinchen, wie tipp-topp! Man will sich ganz klein vorkommen, aber dann sagt man sich: Wahre Bildung ist doch vornehmer als dieser hohle Luxus![S. 195] Und man sucht in dem Gewühl von Menschen nach solchen, die wirklich fein — ich meine, geistig und seelisch bedeutend sind. Wie schnell kommt da die Erfahrung, daß solche Menschen recht nahe beisammen sind und gar nicht aussehen wie diese prunkenden Weltmenschen. Ich schreibe regelmäßig und viel in mein Tagebuch und wundre mich oft selbst, natürlich ohne Hochmut, wie reif und mit mir selber fertig ich in den letzten Jahren geworden bin. Wenn Du artig bist, Kleinchen, sollst Du im Herbst — versteht sich mit Auswahl — daraus vorgelesen bekommen.
Was treibt Ihr denn auf der Mühle?
Gewiß macht Ihr schöne Ausflüge über die Berge, handarbeitet im Garten, liegt in der Hängematte im Wald und lest viel. Meine Gedanken sind oft und in schwesterlicher Liebe bei Euch. Lest nur, bitte, bitte, ja keine Bücher, die noch nichts für Euch sind! Das kann so viel Unheil anrichten. Denkt Euch: Lizzie, die doch älter ist als Ihr, hat kürzlich ein Buch von Zola (!) gelesen, das sie ganz krank und verzweifelt gemacht hat. Ich habe ihr kräftig den Kopf zurecht gesetzt, sie will mir das Buch einmal schicken, und ich werde mich, ihr zuliebe, gründlich mit ihm auseinandersetzen, um ihr zu helfen, denn allein findet sie ja doch nicht heraus. Ich bin ganz traurig über sie.
Sage, bitte, Marga, ich hätte hier noch einmal unser letztes Gespräch auf dem Weinberg durchgedacht und wäre zum gleichen Resultat gekommen wie damals. Vielleicht hat sie inzwischen mich auch besser verstanden und eingesehen, wie gut ich's mit ihr meine. Ich bin ihr gar nicht böse, daß sie's nicht gleich konnte!
Papa kam eben in mein Zimmer und wetterte über die „vermaledeite Briefschreiberei”. Ich will also schließen.[S. 196] Es ist gar nicht immer so leicht mit ihm, weil er in beständigem Krieg mit dem Badearzt und allen Verordnungen lebt. Doch wenn man ihn zu nehmen weiß, läßt er sich meistens zu seinem Besten überzeugen. In acht bis vierzehn Tagen soll's nach Tirol oder nach Bayern gehen. Wie ich mich darauf freue, könnt Ihr euch denken!
Mit herzlichen Grüßen, auch für Marga, und einem Kuß für Dich, liebe Elli, bin ich
Deine getreue Schwester
Käthe Richthoff.
P. S. Denkt Euch, morgen will Doktor Bertelsdorf hierherkommen. Er muß Papas Rat für eine wissenschaftliche Publikation haben. Der Flanellstorch hat sich auch bei Papa „für einen Sprung” angemeldet, wurde aber abgewiesen.
K. R.
P. S. 2. Erwarte Brief binnen zwei Tagen. Verweigere sonst weiteres Kostgeld. Tatsachenbericht, keine Gefühlsduseleien. Gruß.
Papa.
Mit sehr gemischten Gefühlen und sehr kritischen Glossen hatte Elli am Sonntagmorgen diesen Brief von Schwester Käthe vorgelesen. Das war ja Käthe, wie sie leibte und lebte. Nach Ellis Ansicht mußte man ihr für diese „infam-gütige” Epistel mal kräftig die Meinung geigen.
„Wenn sie so fortmacht, platzt sie ja eines Tags vor lauter Menschenkenntnis und Lebenserfahrung!” legte Elli zum Schluß los. „Und das, was sie über dein Verhältnis zu Perthes schreibt, Margakind — die Andeutung, mein' ich, über ihre verdrehte Abschiedspredigt —, das ist jetzt einfach lächerlich geworden! Das gönn' ich ihr!”
„Laß gut sein, Elli!” mahnte Marga versöhnlich.
[S. 197] „Jawohl! Ich finde, wir sind ihr einen Strahl kalten Wassers auf diesen Schreibebrief einfach schuldig! Wir sind doch schließlich keine Wickelbabys mehr! Von mir will ich noch nicht mal reden, aber du — du bist doch jetzt so gut wie Braut, Marga —”
„Sag' so was nicht, Elli!” wehrte Marga ernsthaft. „So weit sind Perthes und ich noch nicht! Du weißt, wir haben uns streng versprochen, es nur erst miteinander zu versuchen.”
„I — was! ‚Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft‛, heißt's im Reklamestil!” erklärte Elli mit überzeugtem und überzeugendem Lachen. „So ähnlich war es mit mir und Wilkens auch; man verspricht sich zuerst, haarsträubend brav und zurückhaltend und vernünftig zu sein, und nachher —”
„Schwatz' doch keinen Unsinn, Kleinchen — ich bitt' dich!”
„Kleinchen! Kleinchen! Das mag ich schon gar nicht mehr hören! Und daß es geschrieben wird, verbitt' ich mir endgültig. Das werd' ich Käthe schreiben. Und —”
„Ich glaube, du schreibst besser an Papa, und nachher diktiere ich dir einen Brief für Käthe.”
Elli legte Marga ihre beiden Hände auf die Schultern, sah so wehmütig drein, als es ihre lachenden Augen tun wollten, und wiegte den lockigen Kopf mitleidig von einer Schulter zur anderen: „Marga, Marga, mit dir geht's bergab! Seit Freitagabend überfließt du von lauter Zuckerwasser! Hätt' ich das gewußt, wär' ich eher in den Garten gekommen! Da hättet ihr euch die Umarmung malen können! Und die ganze Verlob—”
„Elli!” rief Marga aufgebracht und hielt der Schwester den Mund zu.
[S. 198] „Stell' dich nur recht tugendsam!” neckte das Kleinchen weiter. „Ich kenne dich jetzt! Ich werde deinem Max erzählen —”
Marga faßte jetzt die plappernde Elli so kräftig und bedeckte ihr den Mund so nachhaltig, daß sie nicht mehr weiter schmälen konnte. Dafür lachte sie um so übermütiger, und Marga mußte mitlachen.
Dann wurde der Frühstückstisch in der Halle geräumt. Sie setzten sich in den Garten, und Elli schrieb an Vater Richthoff vier enge Seiten. Zwar keine „Gefühlsduseleien”, aber erst recht keinen Tatsachenbericht, sondern lauter tolles Zeug. Nachher diktierte ihr Marga das „Zuckerwasser” für Käthe.
Draußen im Gras funkelte die Sonne auf den Tauperlen. Das erste sonntägliche Vergnügungsschiff mit bunten Wimpeln und voller lustiger Menschen keuchte stromaufwärts. Vom nächsten Dorf trug ein launischer Frühwind den Klang der Kirchenglocken unter die Bäume im Garten ...
Es war Margas voller Ernst, wenn sie gesagt hatte, Perthes und sie wären so weit noch nicht und wollten es erst miteinander versuchen. Als Perthes am Morgen nach jenem Abend seligen Selbstvergessens wieder auf der Mühle erschienen war, hatte ihn Marga ganz anders empfangen, als er erwartete. „Geradezu frostig und lieblos,” meinte er entrüstet. Aber Margas Gewissen hatte sie schon in der Nacht, die sie schlaflos verbrachte, mit Vorwürfen und Anklagen gepeinigt, die die erste Freude dämpften. Sie sah, was geschehen war, im Licht unverantwortlicher Schwachheit. Mit hundert Gründen bewies sie Perthes, wie unbesonnen und unrecht es wäre, sein Schicksal und das ihrige zu verbinden, und was sie sagte,[S. 199] kam wahrhaftig nicht aus dem Bedürfnis unschuldiger Koketterie, die das Gegenteil hören wollte. Sie zwang sich zu dieser schmerzhaften Klarheit, weil ihre Natur es so verlangte. Wußte er denn, was es hieß, mit einer blinden Frau durchs Leben zu gehen? Hatte er eine Ahnung von den Entbehrungen und Enttäuschungen, die ihm, dem Sehenden, bevorstanden, wenn er, Seite an Seite mit ihr, ins Leben trat, in die Welt, die ihr ewig fremd und verschlossen bleiben mußte, unter Menschen, die ihn einen kurzsichtigen Schwärmer schelten und über eine Verlobung mit ihr oder gar eine Ehe die Achseln zucken würden? Was half es, wenn sie, Marga, kraft ihrer Liebe jede Demütigung gern auf sich nahm — ihn, den Sehenden, den Stolzen, den leidenschaftlichen Mann mußte eine Wirklichkeit, wie sie ihr Instinkt angstvoll vorausfühlte, wundreiben und unglücklich machen mit ihren tausend unvorhergesehenen, wehtuenden, stechenden Kleinigkeiten. Mitleidlos gegen sich und ihn ersparte sie ihm keine von den Wahrheiten, die sie in den langen Stunden der Nacht gesammelt hatte.
Freilich — die Wirkung auf Perthes war dieselbe, als wenn sie ebensoviel zu ihren Gunsten vorgebracht hätte. Je mehr Hindernisse und Beschwerlichkeiten sie ihm zeigte, um so beredter und temperamentvoller verfocht er seinen Entschluß. War er nicht Manns genug, um zu wissen, was er tat? Scheute er vielleicht das läppische Gerede und Gehabe anderer? Hatte er nicht immer für seinen eigenen Kopf seinen eigenen Weg gefunden? Und nun, wo er durch Marga erst recht und ganz er selbst wurde, sollte er gegen die kleinen Läppereien des Alltags, die sie da in der Nacht ausgeklügelt und zu Schrecknissen vergrößert hatte, nicht[S. 200] stark genug sein? Das war ja ein nettes Zeugnis von Vertrauen, das sie ihm ausstellte!
Trotz seiner heftigen Gegenwehr gab Marga sich nicht zufrieden. Er mußte Schritt für Schritt erobern, was er an einem Abend im Sturm und für immer gewonnen zu haben glaubte. Er brachte es einstweilen nur zu einem feierlichen Pakt: er sollte kommen und gehen dürfen wie bisher in der Stadt, am Wenzelsberg; aber nicht öfter und keinesfalls täglich. Auch wegen des Geredes der Leute nicht. Sie wollten sich einer dem anderen so offen und natürlich geben, als sie nur konnten, um sich immer besser kennen zu lernen. Für das Maß der gegenseitigen Vertraulichkeiten hatte Marga, obwohl sie weder prüde noch doktrinär veranlagt war, einen ganzen Kodex ausgearbeitet: das zärtliche „Du”, das im Glück des ersten Verstehens eingerissen war, wurde verpönt. Sie wollten sich „Sie” und mit dem Vornamen nennen, und auch das nur unter vier Augen. Von anderen Liebkosungen als von einem etwas herzlicheren Handkuß durfte nicht die Rede sein.
Gegen diese letzte Verordnung wehrte sich Perthes am entschiedensten.
Um sie von vornherein zu entkräften, wollte er sogar Marga sofort herzhaft in seine Arme ziehen. Aber sie geriet in eine so hilflose Erregung, bat ihn so inständig, ja flehentlich, ihr zu folgen, daß er nachgab.
„Das versteh' ich nicht!” eiferte er. „Für Kasteiungen hab' ich gar kein Talent, Marga. Ich weiß auch, trotz all der schönen Reden, nicht, zu was sie gut sein sollen.”
„Das soll dafür gut sein, daß uns, wenn unser Versuch mißlingt und wir nicht zusammenbleiben können, das Auseinandergehen nicht zu schwer wird.”
[S. 201] Perthes wollte sie auslachen, aber sie legte so viel ernste, beinahe schwermütige Überzeugung in ihre Worte, daß er es nicht fertigbrachte. Er dachte nicht daran, ihre pessimistische Auffassung gelten zu lassen. Aber die ängstliche Vorsicht, die an das Glück nicht glauben konnte, die mädchenhafte Scheu, die der eigenen Liebe zum Trotz sich so streng und haushälterisch gab, rührte ihn und nötigte ihm Achtung ab. Wenn er auch bei sich dachte, dies drakonische Hausgesetz bleibe ein Unding, weil es einen neutralen Zwischenzustand zu schaffen suche zwischen Liebe und Freundschaft, den es nie und nirgends gebe, so begriff er doch, daß so und nicht anders Margas empfindliches Gewissen sich mit dem Neuen abfinden konnte.
Unter solchen Umständen hatte er seufzend dem „Gesetz zur Verhinderung der Liebe”, wie er es nannte, seine Sanktion erteilt.
Es kam trotzdem, wie es kommen muß, wenn zwei Menschenkinder jung und aus Fleisch und Blut sind. Es wäre zwischen Marga und Perthes auch so gekommen, wenn Elli nicht von vornherein erklärt hätte, diese zimperliche Schöntuerei sei Hokuspokus, und zusammen mit ihrem Wilkens, vor dem das Geheimnis nicht gewahrt bleiben konnte, nicht jede Gelegenheit benutzt hätte, um diesem „faden Platonismus” mit Scherz und Spott auf den Leib zu rücken.
Acht ganze Tage bestand das „GzVdL.”, wie es abgekürzt getauft wurde, leidlich voll zu Recht.
Dann gewahrte Marga mit Schrecken, wie Stück um Stück von ihrem wohlgemeinten, aber doch nur in der Theorie möglichen Zwischensystem abbröckelte. Da wurden zunächst die Pausen zwischen Perthes' einzelnen Besuchen[S. 202] auf der Sägemühle immer kleiner, und bald war es ganz selbstverständlich geworden, daß er jeden Tag kam, manchmal sogar zweimal, und an einem Sonntag blieb er vom Morgen bis zum späten Abend. Das nächste Bollwerk brachten Elli und Wilkens durch ein förmliches Komplott zu Fall. Das steife „Sie” zwischen Marga und Perthes war ihnen schon lange ein Dorn im Auge. Aber alle Sticheleien verfingen nicht. Marga blieb fest und stellte sich taub für die dicksten Anspielungen; und Perthes wollte sie an der Illusion, die sie beruhigte, nicht irremachen.
Elli, ewig auf Schelmereien bedacht, nahm ihre Zuflucht zu einem abgefeimten Trick.
Eines Abends, als Wilkens und Perthes, wie dies jetzt so selten nicht mehr war, zum Abendbrot auf der Mühle blieben, ließ sie ihrer Ausgelassenheit alle Zügel schießen und riß jeden, auch Marga, in ihre übersprudelnde Laune hinein. Schließlich erhob sie ihr Glas, ließ die Augen lustig zu Perthes hinüberspringen und warf den zerzausten Kopf keck zur Seite. „Doktor Perthes, ich schlage vor, daß wir zwei Schmollis machen!”
Perthes, so aufgeräumt er selber, so sympathisch ihm Fräulein Sausewind war, wurde doch von diesem freundschaftlichen Anerbieten überrumpelt. „Mit Vergnügen!” erklärte er. „Aber ich muß da höheren Orts erst anfragen.”
Elli zwinkerte ihm zu. Er verstand und wandte sich an Marga. „Marga, Sie haben wohl nichts dagegen? Da es Ihre leibliche Schwester ist, die mit mir schmollieren will.”
Marga war fassungslos überrascht und sah ganz verdutzt drein. „Elli ist wohl 'n bißchen beschwipst?” meinte sie ausweichend.
[S. 203] „Bitte schönstens!” verteidigte sich die Verdächtigte entrüstet. „Das ist eine häßliche, grundlose Verleumdung!”
„Die ich mir auch in meinem Namen verbitten muß, Fräulein Marga!” brummte Wilkens höchst unwirsch.
„Wenn Sie mich noch lange warten lassen, Herr Doktor Perthes,” — Elli betonte die Anrede mit spitzer Breite — „sind Sie der unhöflichste Mensch, der mir je vorgekommen ist! Marga hat da überhaupt gar nicht mitzureden!”
„Aber Herrn Wilkens muß ich doch wenigstens um Erlaubnis fragen?” sagte Perthes, der nun ganz mit im Spiel war, zuvorkommend.
„Nun, Herr Wilkens?” fragte Elli. „Man überschätzt zwar Ihre Autorität, aber —”
„Ich denke durchaus fortgeschritten in solchen Dingen,” ließ sich Wilkens mit liberaler Großartigkeit vernehmen.
„Na also! Du siehst, Marga — drei gegen eine!” triumphierte Elli.
Marga wußte nicht aus noch ein. Sie war nicht ohne Humor. Aber der Mangel an äußerem Erleben hatte diese letzte und reifste Kraft nur erst spärlich in ihr entwickelt. Sie fand auch jetzt kein Scherzwort, um sich, ihre Schwere überwindend, aus der Klemme zu helfen. Sie versuchte zu lächeln. Doch der Ausdruck ihrer Augen strafte das Lächeln Lügen, und ihre Mundwinkel zuckten verdächtig.
Elli lenkte ein. „Gott, Margakind, ich will dich ja schließlich nicht benachteiligen!” erklärte sie großmütig. „Ich trete von meinem Schmollis zurück unter einer Bedingung: wenn du es Doktor Perthes anbietest statt meiner! Ich tue es blutenden Herzens und werde an Herrn Perthes nicht so bald wieder mit einem so verlockenden Vorschlag herantreten.”
[S. 204] Jetzt konnte auch Marga sich nicht des Lachens erwehren. Sie wollte nicht Spielverderberin sein und erhob bedächtig ihr Glas. Es kam ihr schwer, überschwer vor. Im Grunde waren ihr die Tränen näher als das Lachen. Aber Perthes ließ sein Glas kräftig dagegenklingen. Sie drückten sich die Hand, was Elli ausnehmend prosaisch fand.
„Es wird dir ja den Kopf nicht kosten, Marga!” meinte Perthes beruhigend.
Und das Du klang Marga so lieb und vertraut, daß sie noch einmal seine Hand fest und dankbar ergriff. Es kam ja doch alles, wie es wollte. Er sollte sie nicht für kühl und zimperlich halten. Ihr Blick leuchtete von Liebe, und zugleich seufzte sie. So mußte wohl das Glück sein, ihr Glück: ein Kranz, strahlend und schwer in einem ...
Es war gut, daß das Sommersemester in den ersten Augusttagen zu Ende ging.
Von den vielen Bekannten in der Stadt, die ja doch auch den beliebten Spaziergang nach der Sägemühle sich nicht nehmen ließen, drohten allerhand Fährlichkeiten. Lose Zungen und spitze, scharfe Augen gab es hier wie überall. Daß die Richthoffschen Mädels da draußen „immer mit Herren gingen”, konnte sich auf tausenderlei Weise herumreden, und wehe, wenn die Kunde, womöglich übertrieben und entstellt, zu Vater Richthoff und Käthe sich verirrte!
Elli nahm die Sache nicht weiter tragisch. Aber Marga mahnte immer wieder zur Vorsicht.
Und mit Recht. Da war zum Beispiel Cousine Grasvogel, die mit irgendeinem Kränzchen von älteren jungen Damen mindestens einmal die Woche auf der Sägemühle erschien und, während sie die „lieben, lieben Mädels”[S. 205] ostentativ umarmte, ihre gutmütige, aber neugierige Nase rundum wittern ließ. Richtig trat dann gerade während einer dieser zärtlichen Begrüßungen Wilkens in den Garten. Kaum hatte er jedoch die Schwierigkeit der Lage erkannt, so ging er wie der älteste Bekannte auf Fräulein Grasvogel zu, die er auf dem Gartenfest am Wenzelsberg nicht eines Blickes gewürdigt hatte, begrüßte die gute Cousine mit einer Vertraulichkeit und ehrfürchtigen Wärme, als schätze man sich seit Jahren, und sagte: es sei reizend, daß sie mit den beiden Fräulein Richthoff einen Ausflug auf die Mühle gemacht habe. Er ließ sich von ihr umständlich erklären, die „lieben, lieben Mädels” seien nicht mit ihr gekommen, sondern wohnten hier außen für einige Wochen, und war über die Neuigkeit aufs angenehmste verwundert. Elli biß sich die Lippen blutig, um ernst zu bleiben. Marga gab recht unsichere und zerstreute Auskünfte über die Verpflegung auf der Mühle und die Zimmerverhältnisse. Dann verabschiedete sich Wilkens sehr korrekt von allen dreien und tauchte erst wieder auf, als die Luft rein war.
Schlimmer war es schon, daß Frau Geheimrat Achenbach einmal mit dem Wagen die Landstraße entlang fuhr, als man, dem mäßigen Wetter vertrauend, paarweise dort lustwandelte. Das Schlimmste aber ließ ein Besuch von Käthes Freundin Lizzie befürchten, die an einem Sonntagvormittag, als man im Buchenwald hinter dem Gehöft zu vieren picknickte, aus heiterem Himmel herunterschneite. Elli erfand eine ganze Räubergeschichte. Aber ob Lizzie, die sich sehr reserviert benahm und eine undurchdringliche Miene aufsetzte, daran glaubte, war mehr als fraglich. Gott sei Dank fand Perthes in ihrer ans[S. 206] Pathologische streifenden Musikleidenschaft ein Thema, das die Unterhaltung leidlich in Gang hielt.
Unschädlich war nur Professor Borngräber, der gar nicht selten im Vorbeigehen der Sägemühle einen Besuch abstattete. Es fiel ihm bisweilen abends ein, daß er nach ärztlichem Ratschluß neben seinen geistigen auch seine körperlichen Funktionen nicht völlig vernachlässigen sollte, und dann arbeitete er mit zerstreuter Hast die Landstraße ab bis zum Mühlengarten. Meistens las er dann, unter Verachtung aller Lichtverhältnisse, ein dickes Buch zu seinen Spiegeleiern mit Schinken, ließ aus Vergeßlichkeit das Bier so abstehen, daß es in der Wärme des Sommerabends bald zu kochen anfing, und hatte von der Umwelt keine Ahnung. Oder aber, wenn er die Töchter seines Freundes Richthoff dann doch aus reinem Zufall entdeckte, war er so erfreut, sie zu sehen, daß er niemand sah als nur sie. Sein unschuldiges Junggesellenherz war ohne jedes Arg, und sein Sinn blieb, trotz aller Herzlichkeit, zur einen Hälfte doch immer an den Ufern der heiligen Ganga.
Unverantwortlich lässig hatte sich bisher der von Vater Richthoff selbst eingesetzte Vizevormund, Professor Wilmanns, benommen. Marga und Elli hatten pflichtmäßig vor ihrer Übersiedlung bei ihm vorgesprochen, und der bewegliche kleine Herr hatte laut verkündet, er werde bald mal auf der Mühle „Generalrevision” halten. Er hatte zur Bekräftigung seine eine Hand würdevoll auf die lahme Hüfte gelegt, die andere in die Brust gesteckt und die Brauen so hoch gezogen, daß man fürchten mußte, Augen und Stirn könnten nie wieder in ihre normale Lage zurückkehren. Doch die bedrohliche Ankündigung blieb ohne Folgen. Nur die drei Wilmannstöchter kamen einmal zum[S. 207] Kaffee auf die Sägemühle, nachdem sie sich vorher artig durch eine Postkarte angemeldet hatten. Sie entschuldigten ihre Eltern; Papa hatte vollauf mit seinem Wörterbuch zu tun, einer Sisyphusarbeit, an der er seit bald einem Jahrzehnt sich mühte; die bescheidene, aufopfernde Mama half dabei täglich ihre fünf bis sechs Stunden. Danach konnten Elli und Marga überzeugt sein, daß von dieser Seite nichts mehr zu befürchten sei, zumal die ganze Familie Wilmanns mit Beginn der Ferien nach Thüringen reisen wollte.
Aber die Generalrevision kam doch! Anfang August, genau einen Tag vor Semesterschluß.
Am Nachmittag hatte es Bindfaden geregnet. Es wurde Abend, ehe der Himmel sich leidlich aufhellte. Keine Seele aus der Stadt hatte sich auf der Mühle blicken lassen. Perthes war trotz des Unwetters um fünf Uhr gekommen. Sein Lodenmantel und sein Hut mußten am Herdfeuer in der Küche aufgehängt werden. Wilkens stellte sich zum Essen ein, für das man, da der Boden zu feucht war und die Bäume tropften, in einer Laube hatte decken lassen. Elli rekognoszierte für alle Fälle auf Margas Wunsch nochmals das Terrain, obgleich Wirtsleute und Kellner übereinstimmend berichteten, es sei kein menschliches Lebewesen im Garten. Sie kam mit der Meldung zurück, in einer abgelegenen Ecke sitze, aller Nässe von unten und oben zum Trotz, Professor Borngräber und kritzle unheimliche Schriftzüge in ein Notizbuch. Das klang zwar abenteuerlich, war aber anderseits auch so beruhigend, daß jedes Bedenken schwand. Es war so gut, als gehörte einem der ganze Garten allein. Guter Dinge voll, zog man von der Halle in die Laube und setzte sich zu Tisch.
[S. 208] Man hatte noch kaum mit dem Abendbrot begonnen, als Elli scharf und unruhig über den Fluß äugte, hinüber auf das Fährboot. Das füllte sich plötzlich mit einer ansehnlichen Gesellschaft, aus der weiße Mädchenkleider herüberleuchteten.
Wilkens war auch aufmerksam geworden. „Ich zähle drei Wilmannstöchter, Papa, Mama und studentischen Anhang,” konstatierte er mit seiner unerschütterlichen Gelassenheit.
„Wahrhaftig! Ich auch!” rief Elli mit lachender Bestürzung.
Perthes hatte sich erhoben. Er mußte die Nachricht bestätigen. „Mit sicherem Kurs auf die Sägemühle!” setzte er tröstlich hinzu.
Verblüffung und Schrecken waren groß. Die Ratlosigkeit noch größer. Jeder schlug einen Ausweg vor, der nichts taugte. Und dabei näherte sich das Boot mit zunehmender Eile.
„Wenn man Professor Borngräber bäte, sich an unseren Tisch zu setzen?” ließ sich Marga bedächtig vernehmen, als keiner von den anderen mehr Rat wußte.
„Sieh mal einer — das Margakind!” rief Elli begeistert. „Die Liebe — ich sag' es ja schon immer — geradezu genial macht sie die Liebe!”
„Man könnte auch sagen, durchtrieben!” kommentierte Perthes, indem er Marga strafend und anerkennend auf die Finger klopfte.
Es war keine Zeit zu verlieren.
Elli sprang schnell entschlossen durch den Garten. Man hörte sie gleich darauf, wie sie den ahnungslosen Jakobus Borngräber mit einer Sturmflut von liebenswürdigen[S. 209] Worten überfiel und betäubte. Es dauerte noch nicht zwei Minuten, so hatte sie ihn herumbekommen. Er erschien an ihrer Seite, den Hut, ein Monstrum von einem schokoladefarbigen Hut, schief übergestülpt; ein dickleibiges Buch mit einem Notizbuch darauf wie eine Bundeslade vor sich hertragend. Mantel, Schirm und Bierglas hatte Elli übernommen. Mit dem unmöglichen, aufgedunsenen Baumwollschirm wies sie ihm den Tisch, während sie immer weiter plapperte: sie würden sich so riesig freuen, wenn er sich zu ihnen setzte, und es wäre zu nett von ihm, daß er das täte, und sie würden an Papa eine Ansichtskarte schreiben, daß er sie besucht hätte. Der gute Borngräber nahm jetzt Buch und Notizbuch unter den Arm. Rund und verwundert rollten seine Augen beim Eintritt in die Laube, so verwundert, wie sie das immer taten, wenn sie sich mit der Welt der Erscheinungen auseinandersetzen sollten. Daß da außer Marga, die er Fräulein Käthe nannte, und Elli, die er mit Marga verwechselte, noch zwei Herren saßen, die sofort aufsprangen und sehr bekannt und erfreut taten, war ihm nicht befremdlicher als anderes. Seine goldgelben Zähne lachten verlegen und freundlich aus dem silberstruppigen Gesicht. Er verteilte Händedrücke, wobei sein Buch auf die Erde fiel; Perthes hob es hilfsbereit auf, während Wilkens ihn selbst nach dem Stuhl an der Spitze des Tisches drängte und ein Gespräch über neue indische Funde vom Zaun brach, von denen er irgendwo gelesen haben wollte.
Eben hatte sich die aberwitzige Brut knapp unter die schützenden Flügel des sich seiner Rolle durchaus unbewußten Professors geflüchtet, als vor dem Garten Papa Wilmanns' breite, behagliche Stimme erschallte.
[S. 210] „Wollen sehen, ob wir die Vögel im Nest treffen. Geh mal vor, Heddy — daß sie nicht zu sehr erschrecken!”
Doch diese zarte Vorsichtsmaßregel erwies sich schon im nächsten Augenblick als überflüssig. Papa Wilmanns' scharfe, spitzmäusige Augen hatten über den Zaun weg bereits die entscheidende Entdeckung gemacht.
„Kiek mal eener!” Stürmisch drang er in den Garten und stand im Handumdrehen am Eingang der Laube. „Kiek mal eener! Hat man je so was gehört oder gesehen!? Mein Freund Borngräber, dieser Tugendheuchler, sitzt hier schamlos vor aller Welt und macht jungen Mädchen den Hof!”
Frau Wilmanns und ihre Töchter mit dem Gefolge von einigen Studenten, die Wilmanns für ihre selbstlose Mithilfe am Wörterbuch ab und zu durch eine Einladung entschädigen mußte, kamen auf seinen Ruf hinterdrein. Es gab vor und in der Laube eine herzliche Begrüßung mit ausgiebigem Händeschütteln, wobei die Wilmannsmädchen Perthes und Wilkens mit etwas erstaunten Blicken maßen, und auch Mutter Wilmanns sie schüchtern fragend besah. Aber ihr Gatte hielt eine so fulminante Abrechnung mit Borngräber, daß Elli und Marga sich eine bessere Abwehr der Neugier gar nicht wünschen konnten. Wobei nicht gesagt sein soll, daß der schlaue Generalrevisor die Situation verkannt hätte. Aber er war nun einmal immer schwach gegen junge Leute ...
„Meine Herrschaften!” polterte er los. „Ich habe Ihnen schon wiederholt von unserer griechischen Reise erzählt. Oder noch nicht?”
„Doch, doch!” ließen sich beschwörende Stimmen hören.
[S. 211] „Gut! Sie können sich jetzt vorstellen, was ich mit meinem Kollegen Borngräber in puncto puncti, das ist in betreff der Griechinnen, auszustehen hatte. Dieses harmlose Gesicht, das sich auch jetzt wieder den Anschein vollendeter und rührender Kindlichkeit gibt —”
„Wollen wir uns nicht setzen, Papa?” wagte Frau Wilmanns vorsichtig einzuwerfen.
„Diese Maske verträumter Wissenschaftlichkeit wird niemand länger täuschen!” fuhr Wilmanns unter allgemeiner Fröhlichkeit fort. „Ich könnte —”
„Wilmanns, ich warne Sie!” Borngräber schüttelte seine Befangenheit ab und fuchtelte mit seinem Bierglas, das er aus unerklärlichem Grund bei der Begrüßung mit sich erhoben hatte. „Ich warne Sie! Ich werde von Kalypso erzählen, einem gewissen thrakischen Mädchen im Hotel —”
„Schweigen Sie!” rief Wilmanns empört. „Sie haben gar nichts zu erzählen! Ich stehe hier in verantwortlicher Stellung,” — schon fuhr die Hand gravitätisch in den Busen, und das hinkende Bein drehte sich dramatisch nach außen — „ich komme, um als Vizevormund im Namen des arglosen Richthoff bei meinen Pflegekindern Revision zu halten, und finde als Wolf in Schafskleidern — Sie!”
„Kalypso, Frau Professor Wilmanns,” schrillte mit verdoppeltem Feuer Borngräbers Fistelstimme, „Kalypso war ein auffallend hübsches Mädchen —”
„Genug von Ihren Ausschweifungen!” donnerte Wilmanns, dem die Kalypso gefährlich zu werden schien. „Genug, sage ich! Wir werden uns bei einer Bowle weitersprechen! Aufgeschoben ist nicht ausgehoben! Helfen Sie[S. 212] mir, meine Herren, das Symposion vorzubereiten, statt sich bucklig zu lachen, wenn zwei ehrsame Professoren ihrer Alma mater sich rein sachlich aussprechen! Ich denke, wir haben in der Laube alle Platz. Schieben wir einen Tisch an!” Er legte selbst Hand an eine Tischkante. Wilkens, Perthes, die Wörterbuchvolontäre sprangen bei und faßten wacker mit an. Im Nu war der Tisch in der geräumigen Laube zu einer Tafel erweitert. Weinflaschen, eine halbe Sekt darunter, frische Walderdbeeren ließen nicht zu lange auf sich warten, und Borngräber vereinigte sich mit seinem feindlichen Freunde zu einem Waffenstillstand, um die Bowle zu brauen, eine praktische Tätigkeit, in der er merkwürdigerweise brauchbare Erfahrungen hatte. Papa Richthoff in Kissingen mochte sich ja die Vormundschaft über seine gewissenlosen Töchter etwas anders vorgestellt haben — aber für alle Teile war die Wilmannssche Auffassung von einer Generalrevision die denkbar sympathischste, nicht zuletzt für Marga und Elli, denen man zu diesem festlichen Gelage nicht zuzureden brauchte.
Die Abkühlung des regnerischen Tages wirkte nach.
Als die Sonne untergegangen war, verlegte man mit Rücksicht auf die älteren Herrschaften den zweiten Teil der Bowle in die geschützte Halle.
Wilmanns schloß einen Akkord mit den Wirtsleuten, um das mehr rhythmisch als im strengen Sinne musikalisch beanlagte Orchestrion in den Dauerbetrieb zu versetzen. Während er nach Kissingen eine Postkarte losließ: „Ihre Töchter, lieber Kollege, treffe ich bei meiner sehr gewissenhaften vormundschaftlichen Inspektion durchaus artig und munter. Gefahr droht ihnen nur von dem Indologen Borngräber, der sie zu heimlichen Banketten[S. 213] einlädt” — während dieses der Wahrheit nicht zu nahe tretenden Berichts eröffnete Elli mit Wilkens den Tanz. Die Wilmannstöchter und ihre jugendlichen Begleiter ließen ihr Beispiel nicht lange ohne Nachahmung.
Bei der zunehmenden Ungezwungenheit und Lustigkeit fiel es nicht weiter auf, daß Marga und Perthes sich absonderten.
Sie standen bei der Tür und plauderten. Er, angeregt von der Bowle, der allgemeinen Fröhlichkeit und den lockenden Weisen der „Rosen aus dem Süden”, folgte mit blitzenden Augen dem Tanz der jungen Mädchen in ihren hellen, fliegenden Sommerkleidchen.
„Na — wagen wir es nicht auch, Margakind?” flüsterte er nach einer Weile lebhaft.
„Nein, ich kann ja nicht tanzen!” gab Marga zurück.
„Aber Elli hat mir verraten, daß du mit ihr tanzt. Und zwar recht gut! Komm — tu nicht zimperlich!”
„Es geht nicht!” wiederholte sie ängstlich. „Sicher nicht! Du würdest dich mit mir nur lächerlich machen!”
„Aber Kind, das ist ja kleinlich! Ich möchte gern tanzen!”
Sie fühlte seinen heißen Atem an ihrer Wange. Die Hand, die nach der ihren faßte, verriet die Erregtheit seines warmblütigen Temperaments.
Marga entzog sich ihm. Ehe er es verhindern konnte, war sie in den dunklen Garten hinausgeglitten. Eine plötzliche, wehe Traurigkeit hatte sie befallen: er, entzündlich und lebensdurstig, wie er war, verlangte in die Welt, die ihr verschlossen war, und sie hatte nichts von alledem, was andere ihm geben konnten — keine Leichtigkeit, keine tanzende, lachende Lustigkeit! Nichts, gar nichts[S. 214] — so schien es ihr in diesem Augenblick — als ihre schwere Seele und ihre trostlose Blindheit! Und so würde es immer sein!
Perthes folgte ihr schnell.
Er war ärgerlich über sie. Über ihre übertriebene Schwerfälligkeit. Über ihre Empfindlichkeit und die Unvorsichtigkeit, so davonzulaufen.
Sie hatte schon einen Vorsprung gewonnen. Erst am anderen Ende des Gartens holte er sie ein.
Sie lehnte mit dem Rücken an einem Baumstamm. Die Hände hatte sie hinter dem Kopf ineinandergepreßt, und die Augen starrten verängstigt in die Höhe, während ihre Brust sich schwer atmend hob und senkte.
„Aber Marga, wie kannst du nur so sein! So — verzeih! — so überspannt empfindlich!” Wort und Ton konnten seine Verstimmung nicht verbergen.
„Ich kann nicht tanzen! Gewiß nicht. Bitte, bitte, tanze doch du! Mit Elli und den anderen!” stieß sie flehend hervor.
Einen Augenblick durchfuhr es Perthes bitter, ohne daß er wußte, wie es kam. Drinnen lockte die Musik mit ihrer sinnenfrohen Lebenslust. Das war nichts für sie! Also auch nichts für ihn. Er stieß zum erstenmal — oder war es nicht das erstemal? — an die Grenze seines Glücks. Aber er wollte nicht. Wie läppisch von ihm, durchaus tanzen zu wollen! Er war alt genug, um darauf und auf anderes ohne Ärger verzichten zu können. Wie unrecht von ihnen beiden, daß sie um einer so kleinlichen, erbärmlichen Sache willen, wie es diese schlechte Musik war und das bißchen improvisierter Tanz, sich verstimmen wollten! Er redete auf Marga ein, herzlich, leidenschaftlich, und[S. 215] überredete sich selber dabei. Warum sprach sie überhaupt immer davon, daß dies oder jenes nicht für sie sei? Wollte sie die Wirklichkeit fliehen? Brauchte sie denn das? Er wollte sie ja mitten hineintragen! Erst recht und gerade sie! Und er wollte ihr von da draußen alles bringen — Licht, Lust, Wonne, Kleines wie Großes — was sie begehrte! Hell und heller als um jede andere sollte es um sie werden!
Und Marga hörte zu. Er hatte noch nie mit so viel Feuer von seiner Liebe zu ihr gesprochen. Sie kostete seine tröstenden Worte wie einen heilenden Trank. Ungläubig erst, zaghaft — dann mit vollen Zügen. Und sie war es, die den Arm um seinen Nacken legte. Die ihn küßte. Was hatte er, wenn sie spröde tat? War es nicht wenig genug auch so? Und sie schuldete so viel Dank! Und sie war jung! Sie liebte ihn wie nichts auf der Welt! Mochte vollends fallen, was ihre Angst und Vorsicht zwischen ihm und ihr hatte aufrichten wollen. Sie küßte ihn wieder und ließ sich küssen. Dann gingen sie, eins vom Arm des anderen umschlungen, noch eine Weile durch den Garten. Ihre Liebe dünkte ihnen reich und groß und heilig wie nie. Sie wollten ihre Unendlichkeit fühlen — heute, da sie zuerst an ihre Endlichkeit gestoßen waren.
Die neue Assistentenstelle in der Chirurgischen Klinik, die Perthes nunmehr endgültig angenommen hatte, sollte er vertragsmäßig zum ersten September antreten. Er hatte sich am Bakteriologischen Institut zum fünfzehnten August freimachen wollen. Vierzehn Tage dachte er für seine Ausspannung herausschlagen zu können. Um nicht[S. 216] zu weit von Marga entfernt zu sein, wollte er sich in einem einsamen Hof in den Bergen einquartieren, den er von seinen Wanderungen kannte und der etwa zwei Wegstunden von der Sägemühle ablag. Seine Ferien wollte er, außer zum Zusammensein mit ihr, zu häufigen Fußmärschen in dem abwechslungsreichen Waldgebirge benutzen.
Alles war verabredet und festgesetzt, als Professor Kronheim, Hupfelds erster Assistent, unerwartet erkrankte.
Der Geheime Rat, der seine eigenen Sommerferien nicht verkürzen wollte, wandte sich an Perthes und bat in schmeichelhafter Weise, ihm aus der Verlegenheit zu helfen. Was war zu tun? Perthes mußte, fluchend freilich, bis auf weiteres seinen eigenen Erholungsplänen entsagen und Mitte des Monats, Hals über Kopf, aus seinem Institut in die Klinik überspringen.
Die neue Tätigkeit war wesentlich anstrengender und unfreier als die frühere. Das sollte auch Marga draußen auf ihrer Mühle bald fühlbar werden. Es gab in der Klinik regelmäßigen Tag- und Nachtdienst. Um die täglichen Besuche war es mit einem Mal geschehen. Es vergingen zwei, drei Tage, ehe Perthes sich auf der Sägemühle blicken lassen konnte. Und da stellte es sich heraus, daß dieselben Pausen, die Marga erst hatte zur Bedingung machen wollen, ihr jetzt recht lang und schwer erschienen. Sie suchte freilich sich und Elli einzureden, es wäre viel besser so: die stete Sorge, durch Cousine Grasvogel und andere gute Freunde ins Gerede zu kommen, wurde geringer; die Freude des Wiedersehens wurde durch die längere Trennung nur verstärkt. Jetzt, wo die Schranken der Vorsicht und Zurückhaltung durch seine und ihre Schuld gefallen waren, wuchs die so lange unterdrückte[S. 217] und verleugnete Liebe Margas mit jedem Tag. Ihre schwere Natur, einmal entzündet, drängte zu jener Reife, die das Weib in der Liebe erst ganz zu dem macht, was es sein soll. Tapfer hatte sie ihr Leiden getragen; aber so sehr es sie gefördert, es hatte doch auch ihre Entwicklung gehemmt und so manches verkümmern lassen: nun streifte ihr Ernst sein Zuviel an Schwere und Herbheit ab und verband sich dafür mit weicher Hingebung und einer zarten Leidenschaftlichkeit, die ihn schöner und voller kleidete. Konnte früher ihre Beherrschung dem oberflächlichen Blick temperamentlos und apathisch vorkommen, so zeugte jetzt auch ihre äußere Erscheinung gegen ein solches Vorurteil: ihr Gang war freier und leichter, ihre Bewegungen wurden sicherer und ausgeglichener; der Kopf mit seinem schlichtgeknoteten, aschblonden Haar senkte sich nicht mehr so oft und so müd-ergeben; durch ein warmes, zuversichtliches Leuchten ersetzten die Augen ihre Blicklosigkeit; die Wangen bekamen mehr Farbe und die ganze Gestalt Frische und Fülle. Es war noch immer die große Stille, die ihr Wesen trug und umfloß, aber ein bräutlicher Schimmer verklärte sie. Und bräutlich fühlte sich Marga selbst in den Stunden, in denen ihr Glück ohne Angst und Bedenken sie ausfüllte, bräutlich in der sehnsüchtigen Erwartung, in der träumenden Versonnenheit, im süßen, berechtigten Stolz. Wenn dann Perthes kam, war sie es, die im ersten Augenblick des Alleinseins ihm die Arme um den Hals legte, sein Gesicht, seine Haare, seine Hände liebkosend betastete und küßte. Sie begann in ihm und durch ihn die Wirklichkeit in Besitz zu nehmen.
Perthes entging die Wandlung nicht, die sich mit Marga vollzog.
[S. 218] Es wäre unnatürlich gewesen, wenn sie ihn nicht erfreut hätte. Aber es mischte sich etwas Neues und Fremdes in diese Freude. Solange es gegolten hatte, Margas Liebe aus ihrer ängstlichen Verhüllung von Scheu und Vorsicht zu lösen, hatte dies Spiel von Gefühl und Vernunft ihn in fortwährender, froher Spannung gehalten, und sein Empfinden für sie schien mit jedem Sieg, den er ihr abgewann, an Innigkeit zu wachsen. Es kamen Augenblicke, wo er sich verliebt vorkam, so verliebt, wie er es vor Wochen, als er sich zum Entschluß drängte, noch nicht für möglich gehalten hätte. Aber nun, da Margas Liebe entfaltet war und naturgemäß in ihr mit der Zärtlichkeit der Seele auch die der Sinne erwachte, erschrak er bisweilen mitten unter ihren Liebkosungen über sich selbst. Er hatte aus der Liebe, die er sich verordnete, seinerzeit die Leidenschaft wegräsoniert. Jetzt zitterte sie ihm, nicht aufdringlich freilich und maßlos, aber doch blutwarm und lebendig aus Margas Zärtlichkeit entgegen. Was hatte er ihr dagegen zu geben? Wo blieb bei ihm die Leidenschaft, die die ihre beantwortete? Freilich erwiderte er stürmisch ihre Umarmung und gab ihr ihre Küsse verdoppelt zurück, aber zwang er sich nicht dazu? War in seinem Ungestüm nicht die Furcht, hinter ihr zurückzubleiben, und war diese Furcht nicht schon der Beweis, daß seine Liebe der ihren nachstand?
Er verwünschte solche Gedanken. Das allzu häufige, untätige Beisammensein war doch unvernünftig gewesen und hatte ihn durch Übersättigung überkritisch gemacht. Von dieser Seite sah er in seiner klinischen Tätigkeit keine unwillkommene Gelegenheit, mit seiner und Margas Liebe mehr hauszuhalten. Seine Stellung mit ihren gesteigerten[S. 219] Ansprüchen befriedigte ihn. Mit dem ganzen Feuereifer, dessen er fähig war, gab er sich ihr hin. Dem Zureden Margas und der eigenen Einsicht folgend, entzog er sich auch dem Verkehr mit seinen Kollegen nicht mehr so völlig wie bisher. Er dachte sogar daran, sich einmal wieder im Tennisklub sehen zu lassen. Aber die Aussicht, mit Alice Hupfeld zusammenzutreffen, hielt ihn ab. Nach der gemeinsamen Radfahrt auf der Landstraße hatte er danach kein Verlangen. Es war möglich, daß sie verreist war. Der Geheime Rat war auf Stift Nieburg. Das wußte er. Alice war nirgend zu sehen. Doch das wollte nichts Sicheres besagen. Es war jedenfalls geratener, ihr aus dem Wege zu gehen ...
Da überraschte ihn vor Ende August Exzellenz Hupfeld mit einer Einladung aufs Stift. Zum einfachen Mittagessen. Fast gleichzeitig erfuhr er zufällig aus dem Gespräch mit einem Kollegen, daß Fräulein Exzellenz von einer vierzehntägigen Hochgebirgstour zurückgekehrt sei.
Seine Lust an der Einladung nach Nieburg, von vornherein nicht groß, wurde durch diese Nachricht sehr herabgemindert. Er trug sich mit dem Gedanken, abzulehnen, und suchte nach einem plausiblen Grund. Seltsam: der Widerwille, mit Alice zusammen zu sein, nahm in dem Maße zu, als das Essen auf dem Stift sich näherte. Er sprach auch mit Marga darüber. Es war ihm ein Bedürfnis, so oft er Alice Hupfeld einmal erwähnen mußte, seine Antipathie gegen sie beinahe überscharf zum Ausdruck zu bringen. Marga hatte nur ein unvollkommenes, nicht sehr anziehendes Bild von Alice wie von dem ganzen Kreis, dem sie zugehörte. Sie war keine von jenen kleinen Naturen, die aus Mangel an eigenem Urteil um jeden[S. 220] Preis „gerecht” sein wollen. Gleichwohl hielt sie seine Härte für übertrieben und riet ihm, der Einladung nach Nieburg zu folgen.
Letzten Endes blieb auch Perthes, wenn er sich die Gnade seines neuen Chefs nicht von vornherein verscherzen wollte, gar nichts anderes übrig, als anzunehmen.
An dem Tag, der ihn zu Hupfelds führen sollte, blieb er so lange auf der Klinik, daß er knapp noch Zeit hatte, sich umzukleiden. Er mußte einen Wagen nehmen, um überhaupt noch zu rechter Zeit nach Stift Nieburg zu kommen.
Als der Kutscher von der heißen Landstraße abbog, sah Perthes sehnsüchtig nach der Mühle, die schattig und beschaulich wie immer mit ihren Ziegeln aus den Bäumen hervorlugte. Am liebsten hätte er noch jetzt die Fahrt dorthin kommandiert. Er schalt sich selbst über seine Torheit. Dies lächerliche Mißbehagen stand in keinem Verhältnis zur Unbedeutendheit der Sache. Er war doch wohl nachgerade alt und Manns genug, um sich in unbequemer Gesellschaft ein paar Stunden mit Anstand herumzulangweilen!
Das große eiserne Gittertor war verschlossen. Nur die ins Mauerwerk gebrochene Nebenpforte stand offen. Man erwartete also nicht so viele Besucher, wie Perthes hinter der Einladung zum einfachen Mittagessen geargwöhnt hatte. Er stieg aus, entlohnte den Kutscher und trat in den Garten: mit seinen kurzgeschorenen Rasenflächen, seinen üppigen Palmengruppen und farbensatten Blumenbeeten lag er still in der sengenden Augustsonne. Still und wie erstarrt in weißer Hitze stand auch weiter zurück das lange, schloßartige Gebäude mit dem efeubewachsenen[S. 221] Untergeschoß, den hohen, hellgrünen Fensterläden, die zum Teil geschlossen waren, und dem mächtigen Giebeldach. Die Bäume des Parks gaben einen Hintergrund, der sich mit massigem Düster gegen das grelle Licht abhob.
Auf einem der gelben Kieswege, die zwischen wohlgepflegten Taxushecken abseits vom Fahrweg sanft emporstiegen, kam Perthes ans Haus. Nach der Hitze draußen atmete ihm das alte, weiträumige Bauwerk schon bei der Eingangstür mit ihren geschnitzten Flügeln und glänzenden Messingringen wohltuende Kühle entgegen. Der Diener, der ihn in Empfang genommen, führte ihn durch lange, etwas nüchterne Gänge über ein breites, an den Wänden mit Nachbildungen antiker Reliefs geschmücktes Treppenhaus in den ersten Stock.
Das Zimmer, das er betrat, war auf den ersten Blick erstaunlich tot und drückend.
Große, in den Farben gedämpfte Gobelins verkleideten die Wände ringsum. Zwei Bänke mit ledergepolsterten Sitzen und Lehnen, ein runder Tisch mit schwerer, goldbrokatener Decke, die einst einen Altar geziert haben mochte, und einer riesigen Fayencevase in der Mitte, hochrückige, steife Lehnstühle — lauter in den Holzteilen tiefdunkle Möbelstücke — waren mehr stilvoll als einladend. Durch eine Tür, deren schmale Portiere zurückgerafft war, sah man ins anstoßende Zimmer: es war — fast schien es, in bewußtem Gegensatz zu dem Vorraum, in dem Perthes stand — in helles Licht getaucht. Man sah einen ziemlich einfachen Schreibtisch, der mit schmuckloser Platte auf zarten, ausgebauchten Beinen stand. Der altertümliche Globus auf der Ecke, das kristallene Tintenfaß, noch mehr aber der Polsterstuhl mit seinem Bezug von grünem,[S. 222] geriefeltem Samt brachte Raffinement in die Einfachheit dieses Arbeitszimmers.
So weit war Perthes in seinen Betrachtungen gekommen, als von dort ein leises Räuspern und teppichgedämpfte Schritte hörbar wurden. Gleich darauf wurde Hupfeld in der Tür sichtbar.
„Sehr liebenswürdig, daß Sie uns das Vergnügen machen,” ließ sich seine volle, getragene Stimme vernehmen. Er überschritt die Schwelle nicht, sondern lud den Doktor mit einer kurzen Bewegung ein, näherzutreten. Freundlich, fast vertraulich bot er ihm die Hand — eine Hand, so weich und lässig, daß Perthes sich versucht fühlte, sie zwischen seinen muskulösen Fingern durch einen heftigen Druck auf ihre Knochen zu prüfen. Und doch war diese Hand mit ihrem fabelhaften Geschick die Begründerin von Exzellenz' europäischem Ruf. Die hochgewachsene Gestalt überragte noch die seines Assistenten. Auf den breiten Schultern saß ein verhältnismäßig kleiner Kopf, dem bartlose, glatte, mit dem Alter etwas verfettete Züge und weißes, dichtstehendes, aufrechtes Haar die Schönheit eines bejahrten Heldenvaters gaben.
Ein zweiter von jenen Winken, deren herrische Kürze mit der auffallenden Loyalität des Geheimen Rats kontrastierte, forderte Perthes auf, es sich in einem roten Saffiansessel bequem zu machen, der gegenüber dem Schreibtisch, neben einem von Photographien und künstlerischen Reproduktionen bedeckten Tisch stand und ein bücherreiches Regal im Rücken hatte.
Exzellenz setzte sich in den grünen Polsterstuhl. „Und wie fühlen Sie sich in unserer Klinik, mein lieber Doktor?”
„Danke, Exzellenz! Soweit ich mir schon ein Urteil[S. 223] erlauben kann, sehr wohl,” erwiderte Perthes, in den Saffiansessel mit Widerstreben versinkend.
Hupfeld lächelte befriedigt. Er war ein Meister jenes diskreten Lächelns, das die angenehmste wie die ärgerlichste Stimmung gleich gut verhüllt. „Wie ich Ihnen schon sagte, haben Sie mir durch Ihren früheren Eintritt einen großen Dienst geleistet,” fuhr er, jedes, auch das unbedeutendste Wort prononcierend, fort. Während er mit gemessener Wärme des erkrankten Professors Kronheim gedachte, beharrte er regungslos in der für sein Gesicht so vorteilhaften Profilstellung. Das gelbliche, durch die dünnen Vorhänge getönte Licht vom Fenster umfloß schmeichelnd seine majestätischen Umrisse und den grünen Polsterstuhl. Bisweilen traf ein knapper Blick den Doktor. Wenn die Augen von Exzellenz ihre graue Starrheit einen Moment aufgaben, nahmen sie einen stechenden Glanz an und erinnerten Perthes durch ihren spöttischen Ausdruck an die von Alice.
Mit der Freiheit des großen Mannes liebte es Hupfeld, die Themen des Gesprächs unvermittelt zu wechseln. Er gefiel sich in einer klassischen Vielseitigkeit. Im Hinblick auf Perthes' mannigfaltigen Studiengang sprach er davon, daß er selbst eigentlich hätte Botaniker werden sollen und wollen. Dabei gab er seinem Talent zur Rede nach und setzte die Worte mit der sinnlichen Selbstgefälligkeit eines Juweliers, der die Perlen seines Geschmeides einzeln durch die Finger gleiten läßt. „Ich habe mir, wie Sie sich vielleicht schon überzeugten, die Vorliebe für die Pflanzenwelt gewahrt.” Er deutete mit einer Bewegung der molluskenhaften Hand in der Richtung des Gartens. „Wenn es Sie interessiert, werde ich Ihnen nachher im[S. 224] Gewächshaus meine bescheidene, aber ich darf wohl sagen erlesene Sammlung von Orchideen zeigen. — Wissen Sie denn übrigens, daß Sie hier in Nieburg auf klassisch geweihtem Boden weilen?”
Perthes schüttelte verneinend den Kopf.
„Es ist verbürgte Tatsache,” erklärte Hupfeld, indem er sich noch hoheitsvoller in seinem grünen Polsterstuhl zur Schau setzte und die berühmte Hand mit leichten Bewegungen seine Worte begleiten ließ, „daß in diesen Räumen Goethe im Jahre 1793, auf der Rückreise von der Belagerung von Mainz verweilte. Sein erlauchter Geist trifft sich mit meinem bescheideneren in der Liebe für die Pflanzen und für die Kunst des Mittelalters. Das macht mir den Aufenthalt hier besonders lieb und bedeutungsvoll. Auch die Gebrüder Boisserée sind hier öfters zu Gast gewesen. Wenn der gute Wille genügte, etwas von der Universalität jener Zeiten und jener Geister sich zu eigen zu machen, und wenn man Zeit hätte —” Der Geheime Rat vollendete seinen vielsagenden Satz nicht, sondern ließ ihn in einem tiefsinnigen Schweigen stecken. Vielleicht, um Perthes Gelegenheit zu geben, ein naheliegendes Kompliment einzuflechten; vielleicht auch nur, um den versteckten Vergleich mit Goethe in dem Zuhörer — oder vielmehr in dem Zuschauer — äußerlich nachwirken zu lassen.
Perthes besaß leider gar keinen Sinn weder für Schmeicheleien noch für klassische Vergleiche. Es bereitete ihm im Gegenteil ein heimliches Vergnügen, Exzellenz zu enttäuschen. Nachdem er sich ungefähr so viel Zeit gelassen hatte, als nötig war, um die Bartlocken der gewaltigen Büste des Zeus von Otricoli zu zählen, die auf[S. 225] einem Postament in der Ecke hinter dem Schreibtisch stand — also nach einer sehr respektvollen Pause —, hub er plötzlich an, von einem klinischen Fall zu sprechen. „Haben Exzellenz gehört, daß die Operation von Miß Read — es handelte sich um Ileus strang...”
„Ja — ja! Natürlich!” fuhr Hupfeld aus seinem Nachsinnen zerstreut auf. „Die Sache ist sehr interessant! Sehr interessant! Wir sprechen nachher noch davon. Für jetzt darf ich Sie nicht länger unseren Damen vorenthalten.” Er erhob sich etwas jäh. „Bitte!” Er deutete wieder in seiner befehlenden Art nach der rückwärtigen Tür. Mit der Zuvorkommenheit eines Fürsten ließ er seinen Gast voranschreiten. Sie durchschritten zuerst die eigentliche Bibliothek, einen sehr stimmungsvollen Raum mit Tausenden von Bänden auf hohen, geschnitzten Regalen.
„Ich habe meine paar belletristischen und kunsthistorischen Bücher von den fachwissenschaftlichen getrennt und hier untergebracht,” erläuterte der Geheime Rat im Vorbeigehen.
Von da traten sie in das Speisezimmer.
Wenn Perthes Muße gehabt hätte, den „Saal” genau in Augenschein zu nehmen, würde er ihm seine Anerkennung nicht versagt haben. Die kolossalen Brabanter Schränke, die gegen eine Tapete von blaßroter Seide standen, das wundervolle Barockgestühl, die gravitätischen Ahnenbilder an den Wänden im Verein mit Teppichen, Truhen und kostbaren Behängen zeugten von Geschmack. So aber mußte er sich vor allen Dingen in einer der tiefen Fensternischen der Dame des Hauses vorstellen lassen.
[S. 226] „Mein neuer Assistent, Herr Doktor Perthes,” führte ihn Hupfeld wohlwollend ein.
Die weibliche Exzellenz, eine kleine, lebhafte Dame von rosiger Gesichtsfarbe und einem kindlichen Ausdruck von Daseinsfreudigkeit auf den wulstigen Lippen und in den schwimmenden Äugelchen, reckte ihre etwas schwerfällige Figur freundlich im Stuhl in die Höhe, nickte dreimal mit dem Kopf und gab Perthes die Hand. „Es ist schwül. Glauben Sie, daß wir ein Unwetter bekommen werden? Ich frage heute jedermann, ob wir heute ein Gewitter bekommen werden. Ich bin nämlich sehr ängstlich. Sehr, sehr ängstlich!” Sie bekräftigte ihre Gewitterfurcht mit einem hohen, kindlichen Lachen. „Wie meinen Sie?” fragte sie dann dringend, die Hand an ihr schwerhöriges Ohr haltend.
Perthes, etwas betroffen von diesem Willkommgruß, der in seiner Naivität peinlich war, faßte sich so schnell wie möglich. „Ich glaube nicht, daß wir ein Gewitter haben werden,” antwortete er höflich.
„Hörst du, Moritz,” wandte sich Frau Hupfeld triumphierend an den hinter ihrem Sessel stehenden, blutjungen Leutnant, „Doktor Pätel — hieß er nicht so, Papa?”
„Doktor Perthes,” korrigierte der Geheime Rat mit einer Deutlichkeit, die zugleich zuvorkommend und entschuldigend klang.
„Na ja — Doktor Pätel glaubt auch nicht an ein Gewitter, Moritz!”
Der Leutnant, ein zierlicher, hübscher Junge mit harmlosem, frischem Kindergesicht, zuckte die Achseln. „Willst du mich, bitte, vorstellen, Papa?” bat er den Geheimen Rat.
[S. 227] „Natürlich — ich bitte um Verzeihung! Mein Sohn, Leutnant Moritz Hupfeld. Und hier —” Er winkte nach dem Fenster, wo ein junges Mädchen ohne Teilnahme für das, was vorging, hinausschaute. „Komm mal her, Hilla! — Die Tochter meines Bruders, des Obersten Hupfeld in Straßburg,” erläuterte Exzellenz.
Das junge Mädchen fand es nicht der Mühe wert, näherzutreten. Sie erwiderte, sich langsam umwendend, Perthes' Verbeugung mit einem halben Blick und ziemlich schnippischem Kopfnicken. „Weißt du, Onkel, ihr müßtet in den ollen, langweiligen Garten da mal 'ne Fontäne oder so was 'reinsetzen,” schloß sie ihre viel wichtigeren Fensterstudien.
„Nein! Um Gottes willen! Wo denkst du hin, Kind? Eine Fontäne?” jammerte Frau Hupfeld erschrocken. „Das ewige Plätschern kann einen ja schwermütig machen!”
„Sei ohne Sorge,” legte sich Hupfeld ins Mittel, „ich liebe keine Wasserkünste!” Er bewahrte inmitten dieser reichlich albernen Unterhaltung die herablassende Würde seiner Größe.
„Cousine Hilla hat nu mal eine Vorliebe für große silberne Glaskugeln, Goldfische und Terrakottazwerge, die unter Pilzen sitzen,” hänselte der Leutnant, während er mit Perthes einen Blick gegenseitigen Wohlgefallens wechselte.
„Pfui, Moritz!” wehrte sich Hilla entrüstet und geruhte dabei, sich zu nähern und ihre nichtssagend hübsche Larve mit schmachtendem Tadel ihrem Vetter zuzuwenden. „Sind Sie der Doktor, der so gut Tennis spielt?” wandte sie sich dann plötzlich mit der vorlauten Selbstverständlichkeit eines verzogenen Backfisches an Perthes.
[S. 228] „Woher wissen Sie das, gnädiges Fräulein?” fragte Perthes trocken zurück, während er auf das schmale Persönchen kühl heruntersah.
„Von Alice natürlich!”
„Alice!” nahm Hupfeld das Wort. „Wo steckt denn Alli? Wir werden uns ohne sie zu Tisch setzen. Entschuldigen Sie, mein lieber Doktor! Meine Tochter lebt in einem beständigen Krieg mit unserer Hausordnung,” ergänzte er halb stolz, halb tadelnd, während er seiner Frau artig den Arm bot.
„Dem armen Kinde wird doch nichts zugestoßen sein?” meinte Frau Hupfeld ängstlich.
„I wo, Mama!” lachte der Leutnant. „Das wäre das erstemal. So was verdirbt nicht!”
„Ich sah sie vor einer Viertelstunde von meinem Zimmer aus in den Park laufen,” bemerkte Cousine Hilla. Sie hängte sich dabei an den Arm ihres Vetters, der sie höflich dem Gast hatte überlassen wollen. Mit Zivilisten ging sie nur in Ermangelung wirklicher Menschen zu Tisch.
Perthes, dem offenbar ursprünglich Alice als Tischnachbarin zugedacht war, mußte sich seinen Platz allein suchen.
Er ergab sich in sein Los. Kam er sich doch unter diesen fremden Menschen so gelangweilt und unbehaglich vor, daß er froh war, sitzen und essen zu dürfen.
Exzellenz hielt bei der Suppe einen kleinen Vortrag über altes Porzellan, von dem er eine Sammlung anzulegen beabsichtigte. Es genügte, verständnisvoll zu lächeln, was übrigens nur Perthes tat. Frau Hupfeld teilte einstweilen ihre ganze Aufmerksamkeit zwischen einem harmlos-fröhlichen[S. 229] Appetit und der erneuten Sorge um das Wetter, das zu beobachten sie dem aufwartenden Diener in geheimnisvollem Ton sehr dringlich einschärfte. Hilla machte ihrem Vetter Leutnant ungeniert den Hof, ohne der Weisheit ihres großen Onkels die geringste Beachtung zu schenken.
Der weißbehandschuhte Diener hatte schon den zweiten Gang serviert und einen Flüsterwein eingegossen, als die Tür zum Saal aufgerissen wurde und Alice hereinstürmte.
„Denkt euch, Kinder —”
„Meine Nerven! Meine Nerven!” klagte erschrocken die Geheime Rätin.
„Der Gärtner hat in der Raubtierfalle einen richtigen Iltis gefangen! Ich hab' ihn mir angesehen! Eine Mama, die Junge erwartet!”
Alice reichte dem Doktor während ihres zoologischen Berichts sehr obenhin die Hand und setzte sich zwischen ihn und ihren Bruder.
„Wie schrecklich!” ließ sich Frau Hupfeld, ihre Nerven vergessend, neugierig vernehmen. „Was hat er gefangen? einen Tiflis?” Umfassende Bildung gehörte nicht zu Mama Hupfelds Vorzügen. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen — aus Hupfelds weniger berühmter Zeit — und ihre Impromptus waren das Entsetzen von Exzellenz.
„Einen Iltis!” kicherte Alice. „Und zwar —” wollte sie mit überlauter Deutlichkeit fortfahren.
„Mein Liebling,” unterbrach sie der Geheime Rat mit einer Entschiedenheit, die zugleich bestimmt war, Iltis und Tiflis zu bedecken, „ich schätze die Natürlichkeit. Das weißt du. Aber sie darf nicht degoutant sein.”
[S. 230] „Auch meine Meinung. Besonders bei Damen!” bekräftigte Leutnant Moritz die väterlichen Worte.
„Da hab' ich mich ja wieder mal nett in die Nesseln eurer Prüderie gesetzt!” Alice sah mit verschmitztem Lachen von einem zum anderen.
„Wohin hat sie sich gesetzt?” fragte mit unerschüttertem Wissensdrang Frau Hupfeld.
„Mich mußt du ausnehmen, Alli,” erklärte voll schwärmender Bewunderung Cousine Hilla. „Ich finde deine Natürlichkeit furchtbar schick! Ich wollte, ich wäre auch so vorurteilslos.”
„Das fehlte noch!” brummte der Leutnant.
„Steht nur Ihr Urteil aus, Herr Doktor Perthes!” wandte sich Alice mit einer Verbeugung an ihren Nachbar. „Dann kann über mich richtig abgestimmt werden!”
Perthes, obwohl nichts weniger als entzückt von dieser Aufforderung, begegnete dem spitzbübischen Zwinkern ihrer Augen mit einem ruhigen Blick. „Wenn Sie darauf Wert legen, gnädiges Fräulein —”
„Und ob!”
„Ich schätze Natürlichkeit. Bei Damen sogar besonders. Sie wird da nur leicht Manier. Und hebt sich so wieder selbst auf.”
„Sehr gut!” nickte zustimmend der Geheime Rat. „Sehr gut, lieber Perthes!” wiederholte er noch einmal, nachdem er mit vorgeschobenen Kennerlippen an seinem Weinglase genippt hatte.
„Das heiß' ich 'ne schlanke Abfuhr — wie, Allichen?” schmunzelte der Leutnant vergnügt.
„Mir ist das zu hoch!” meinte mit patziger Geringschätzung Cousine Hilla.
[S. 231] Alli selbst kniff die Augen zusammen wie beim Tennisspiel, wenn sie berechnen wollte, wie sie den Ball am besten zurückschlüge. Es lag in dem halboffenen Blick etwas Lauerndes, das die Freude an gefangenem Raubzeug, wie einem Iltis, erklärlich machte. Im nächsten Augenblick lachte sie. Es war dieses helle, kurze, aufreizende Lachen, das Perthes kannte.
Der Diener hatte eben begonnen, neue Schüsseln zu reichen. Den Schleien folgten römische Poularden. Alice hatte den Kopf mit dem rötlichen Haargewirr über die Lehne zurückgeworfen. Die gelenkige Gestalt in dem eng anliegenden, blauen Foulardkleid schüttelte sich leicht, als gelte es, ein paar Tropfen von der milchweißen Haut des Halses und der Arme absprühen zu lassen. Dann bog sie sich blitzschnell ganz nahe an Perthes heran. „Es ist doch so, daß hinter dem Räubergesicht ein ganz ehrsamer Philister sitzt, nicht?” tuschelte sie ihm mit boshafter Hast zu.
Er wollte ihr erwidern. Aber ebenso geschwind hatte sie sich von ihm weggewandt und drehte ihm halb den Rücken. Sie sprach mit Hilla und ihrem Bruder. Während des Restes der Mahlzeit behandelte sie ihn als Luft. Ein Verfahren, das ihn, wie er sich selber vorsagte, höchst kalt ließ, aber seine Behaglichkeit im Hause Hupfeld nicht erhöhte. Er wünschte sich über alle Berge. Oder doch zum mindesten einen halben Kilometer talwärts in die Sägemühle. Die ungewohnte Atmosphäre, die ihn umgab, bedrückte ihn: dieser „große Mann” mit seiner preziösen Redeweise und seiner hohlen, posierten Majestät; diese vielleicht gutmütige und natürliche, aber immer nur mit sich selbst beschäftigte, rosig-dicke Frau Exzellenz;[S. 232] Fräulein Hilla, die ihre Dummheit durch die doppelte Portion Hochmut und Dreistigkeit wettzumachen suchte, und Alice — wie ihm das alles zuwider war! Samt dem altertümlichen, schwerfälligen, überstilvollen Luxus! Samt dem tadellosen Diner auf Wedgwoodporzellan und den Flüsterweinen und dem schleichenden Lakaien mit den weißen Handschuhen! Er war kein Feind von Reichtum und Geist und Geschmack; aber er hätte gern einmal laut fluchen oder eins der hohen Fenster aufreißen und einen Strom noch so heißer Sommerluft hereinströmen lassen mögen — um sich selber wiederzuerkennen und freizumachen!
Man näherte sich dem Dessert.
Der Leutnant brachte, Gott sei Dank, etwas Zug in die Unterhaltung. Er erzählte von Ballonfahrten, die er von Freiburg aus, wo er in Garnison stand, unternommen. Besonders von einem Ausflug nach Straßburg, wo sie kurz vor dem Ziel, in Kehl, die Reißleine ziehen mußten und um ein Haar im Rhein gelandet wären.
„Wo war das, Moritz?” fragte Frau Hupfeld, die die Hand am Ohr mit allen Zeichen des Gruselns der halsbrecherischen Schilderung zu folgen versuchte.
„In Kehl, Mama,” lautete der bereitwillige Bescheid.
„In Kiel?” wiederholte die alte Dame mit Staunen. „Ich wußte gar nicht, daß Kiel so nahe bei Straßburg liegt. Ich dachte immer —”
Diesmal brach die Heiterkeit über Mama Hupfelds durch keine Sachkenntnis getrübte Geographie so elementar und laut hervor, daß der Geheime Rat sie nicht durch eine ableitende Bemerkung aufhalten konnte. Seine[S. 233] kleine, dicke Frau schloß sich der Fröhlichkeit so unbefangen an, wie wenn sie nichts anderes beabsichtigt hätte, als ein Bonmot zum besten zu geben. Zu allem Unheil pflanzte sich eben jetzt der Diener in steifer Positur hinter ihrem Stuhl auf, offenbar um ihr eine unaufschiebbare Meldung zu machen.
„Was gibt's, Karl?” fragte sie besorgt, als der Beifall, den sie unfreiwillig entfesselt hatte, sich legte.
„Exzellenz, im Süden zieht ein Gewitter herauf!” meldete der Diener mit der Feierlichkeit eines spanischen Granden.
„Allmächtiger!” entfuhr es dem Leutnant in komischer Verzweiflung.
Frau Hupfeld schnellte mit allen Zeichen der Angst von ihrem Sitz in die Höhe. „Oh — was Sie sagen, Karl!” stammelte sie. Sie sah wirklich bemitleidenswert aus.
Cousine Hilla biß auf ihre Serviette, um nicht von neuem herauszulachen. Alice schnitt eine Grimasse. Perthes fixierte standhaft den zierlichen Rand seines Tellers, denn wenn er bis jetzt als Gast des Hauses seinen Lachmuskeln eine peinliche Reserve auferlegt hatte, diese im Ton einer antiken Schicksalsverkündigung vorgetragene Gewittermeldung drohte seine Kraft zu übersteigen.
Der Geheime Rat blieb ernst. „Es wird ja so schlimm nicht sein!” redete er begütigend seiner Frau zu.
Aber für Frau Hupfeld gab es, nachdem sie sich vom ersten Entsetzen erholt, kein Halten. „Herr Doktor Pätel — Sie müssen mich entschuldigen — ich kann nun mal nichts dafür!” erklärte sie mit hastiger Verlegenheit. „Nein — und ich wollte noch von der wundervollen[S. 234] Ananas essen! Stellen Sie sie für mich zurück, Karl! Und Annette soll auf mein Zimmer kommen. Sie muß mir die Laden schließen. Johann auch!”
Schon war sie, ihre beleibte kleine Person mit erstaunlicher Elastizität vorwärtsschiebend, aus dem Saal geflohen, um in ihrem Schlafzimmer unter Beihilfe der verfügbaren Dienstboten die nötigen verdunkelnden Vorbereitungen zu treffen.
Das Gleichgewicht der Tafel war gestört.
Exzellenz — seine Verstimmung in eine gesteigerte, über die Kleinigkeiten des Tages erhabene Hoheit hüllend — hielt es für angebracht, die Mahlzeit nicht mehr über Gebühr zu verlängern.
Er stand denn auch bald auf und gab so das Zeichen der Befreiung vom Tischzwang. Die Herren begaben sich in die Bibliothek. Während der Leutnant den mit Silber eingelegten Zigarrenschrank herbeiholte und Perthes mit den unterschiedlichen Vorzügen der Importen bekannt machte, zog Hupfeld sich stillschweigend zu einer kleinen Mittagsruhe zurück.
Alice und Hilla traten unter die Tür der Bibliothek.
„Hilla will mal meine Iltismama besehen. Kommst du mit, Säbelmännchen?” Alice richtete ihre Aufforderung absichtlich nur an ihren Bruder, als existierte Perthes gar nicht.
„Das hängt von Herrn Doktor Perthes ab,” erwiderte der Leutnant, den Zug seiner Zigarre prüfend.
„Bah — es fragt sich sehr, ob wir Herrn Perthes nach der famosen ‚Abfuhr‛ an Alli überhaupt noch dazu einladen!” erklärte Fräulein Hilla mit schnippischer Promptheit.
[S. 235] „Dann müßt ihr auf meine Gesellschaft auch verzichten, Hillchen!” gab Leutnant Moritz ritterlich zurück.
Alice maß Perthes über ihre Schulter weg mit dem ihr eigenen Blick vom Fuß zum Kopf.
„Bitte sehr, sich durch mich nicht bestimmen zu lassen. Unser Tierpark im Bakteriologischen Institut war so reichhaltig, und ich bin so froh, ihn los zu sein, daß ich auf Iltismütter keinen besonderen Wert lege.” Perthes sprach mit aller ihm zu Gebot stehenden Gelassenheit, ohne Alices Blick zu vermeiden. Dabei mußte er allerdings die zartgewickelte Zigarre beinahe zwischen seinen Fingern zerdrücken, so sehr reizte ihn Alices Benehmen.
„Stolz lieb' ich den Spanier!” bemerkte sie leichthin; aber ihre Mundwinkel zuckten mehr nervös als spöttisch, und ihre Absätze klappten stärker auf den Boden, als nötig war. Seine Sprödigkeit machte sie kampflüstern. Sie wäre jetzt am liebsten dageblieben, um es gleich darauf ankommen zu lassen, wer Sieger blieb. Doch Hilla zog sie energisch aus der Tür.
„Hat dein Papa immer so verdrehte Assistenten?” fragte die Cousine laut genug, daß man es noch in der Bibliothek hören konnte.
„Schweig! Das verstehst du nicht!” herrschte Alice sie an.
Hilla sah ihr ganz betroffen in die funkelnden Augen.
„Er ist ein feiner Junge, sag' ich dir!” Alice wollte hinzusetzen: Gerade, weil er so widerhaarig tut! Aber sie behielt diesen Nachsatz für sich und pfiff dafür auf dem Weg zum Park leise vor sich hin — so bedeutungsvoll, wie nur junge Damen pfeifen können ...
[S. 236] Nach einigen Minuten gingen Perthes und Leutnant Hupfeld auf eigene Faust ins Freie.
Sie hatten beide Gefallen aneinander gefunden. Der aufgeweckte junge Offizier, der nach den besten Eigenschaften seiner Mutter geraten zu sein schien, traf sich mit Perthes im Interesse für den Luftsport. Der Leutnant hatte in Berlin und auch in Paris Flugversuche gesehen, von denen er sehr anschaulich zu plaudern wußte. Nachher erzählte er von Freiburg und von winterlichen Skitouren im Schwarzwald. —
Sei es, daß die Iltismama an Reiz eingebüßt hatte, sei es, daß Cousine Hilla Sehnsucht nach Vetter Moritz bekam — die jungen Damen kehrten auffallend schnell von ihrer Raubtierbesichtigung zurück.
Man setzte sich in den Schatten unter eine breitästige Eiche.
Der Diener kam mit einem Klapptisch, mit Mokka und einer Batterie von Likören aus dem Hause.
Alice hatte sich, wie die beiden Herren, einen Curaçao eingießen lassen. Sie näherte sich Perthes mit der Miene einer frommen Helene. „Wollen wir uns wieder vertragen, Doktor?” Sie hielt ihm den kleinen Finger hin, um mit ihm anzustoßen.
„Ich bin mir nicht bewußt, daß —”
„Nun machen Sie gefälligst nicht wieder Geschichten! Wollen Sie — oder wollen Sie nicht?”
Perthes gab sich zufrieden, tippte an ihren Finger, und sie tranken sich zu.
Während Hilla den Leutnant mit Beschlag belegte und entführte, setzte sich Alice neben Perthes auf die Bank unter der Eiche. Sie stemmte sich mit den Händen[S. 237] rechts und links gegen den Sitz und ließ die Füße mit den hübschen, bronzefarbenen Schnallenschuhen und den blauseidenen durchbrochenen Strümpfen übereinandergleiten.
„Warum sagten Sie das mit der ‚manierierten Natürlichkeit‛, Doktor Perthes?” fragte sie nach einiger Zeit in nachdenklichem Ton, in die Betrachtung ihrer Schuhspitzen scheinbar versunken.
„Weil es meine Meinung war und Sie mich darum fragten,” entgegnete er.
„Ich glaube, Sie haben greulich viel an mir auszusetzen!” fuhr sie in derselben Weise fort.
„Das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit!” Er lehnte den Kopf gegen den Stamm der Eiche und blies den Rauch seiner Zigarre in nervösen Zügen über sich. Er vermied es, sie anzusehen.
„Man muß wohl hausbackener sein, um Ihnen zu gefallen?” Sie streifte ihn mit einem halben Blick. Der gutsitzende, elegante Gesellschaftsanzug stand in anziehendem Gegensatz zu der naturhaft gebräunten Farbe seines Gesichts und seiner Hände.
„Ich dachte, wir hätten auf Versöhnung angestoßen,” meinte er. „Aber Sie —”
„Natürlich, das schließt doch nicht aus, daß ich mich mit Ihnen ein bißchen kabble. Ich kabble mich immer mit Menschen, die mir gefallen!” Sie sah ihn jetzt mit dem Schalksgesicht voll an. Ihre Augen flirrten keck unter der weißen Stirn und dem rötlichen, vorgebauschten Haar, während die Zungenspitze über die Lippen spielte.
Perthes warf seine Zigarre fort und streckte sich unbehaglich. „Davon halt' ich nicht viel. Vom Kabbeln nämlich. Ich bin nicht sonderlich geschickt dazu und gerate[S. 238] leicht vom Hänseln ins Hauen!” Seine Hand, die er mit dem Rücken vor die Stirn geschoben, schloß und öffnete sich instinktiv. Ohne daß er sich dessen bewußt war, gab diese Bewegung seine geteilte Empfindung für Alice wieder, die sich durch dies Tete-a-tete steigerte: er hätte sie gleichzeitig leidenschaftlich an sich reißen und von sich stoßen mögen.
„Oho! Das klingt ja ordentlich gefährlich!” lachte sie belustigt. „Sie überschätzen am Ende doch Ihr Temperament, Doktor!” setzte sie mit herausforderndem Spott hinzu. Sie hatte gar nicht im Sinn, ihre „kabbelnde” Taktik ihm gegenüber einzustellen. Im Gegenteil, es machte ihr Vergnügen, die spröde Zurückhaltung, die er zur Schau trug, den Philister, wie sie es nannte, mit seiner Reizbarkeit in Widerstreit zu bringen. Sie tat das ohne Berechnung. Dafür war sie viel zu sehr ein Geschöpf der Laune. Es war vielmehr die Neugierde: es lockte sie, herauszubekommen, ob die Reibung zwischen seiner Sprödigkeit und seinem Temperament kein Feuer geben könnte.
Das Gewitter aus Süden, das Frau Hupfeld von der Tafel aufgeschreckt hatte, war recht zögernd aufgezogen. Erst jetzt holten seine Wolken die Sonne ein. Ein greller, silberner Rand schied das Blau und das Grau des Himmels. Das Licht auf dem langgestreckten, eintönigen Rücken des Hauses schwand. Die Schatten unter der Eiche wurden beinahe finster. Der Donner murrte dumpf und nah.
„Das scheint ja doch noch ernst zu werden,” lenkte Perthes das Gespräch ab.
„Sie sind doch nicht auch gewitterscheu wie Mama?”
„Das müssen Sie mir ja ansehen, gnädiges Fräulein!”
„Wenn Sie wünschen, zeige ich Ihnen mal die Kapelle.[S. 239] Papa würde es Ihnen nicht verzeihen, wenn Sie nicht dort gewesen wären!” Alice war aufgestanden. Sie schlang die Hände hinter ihrem Kopf ineinander und dehnte sich. „Wollen Sie? Wenn Ihnen die Besichtigung mit mir allein zu langweilig ist, können wir noch Moritz und Hilla rufen.”
„Ihre Gesellschaft genügt mir.”
„Danke! Ich nehme das für ein mißratenes Kompliment.” Sie neigte übertrieben-höflich den Kopf und ging dann voraus.
Alice nahm sich Zeit und führte Perthes auf einem Umweg quer durch den Park. Sie lief, und er blieb trotz seiner großen Schritte immer hinter ihr.
„Sie haben Bergtouren gemacht?” begann er von sich aus die Unterhaltung wieder.
„Ach — es war recht mäßig dieses Jahr!” gab sie gleichgültig zurück. „Das Wetter war zu unbeständig.”
„Mit wem waren Sie denn zusammen?”
„Mit mir und mit dem Führer!”
„Nur mit dem Führer?”
„Warum denn nicht?” Sie drehte sich flüchtig nach ihm zurück. „Ich finde das viel aparter und origineller, als wenn Moritz oder sonstwer mich immer als Dame schont und bemuttert!”
Perthes wollte Genaueres von ihren Touren hören, aber sie schien dazu heute nicht aufgelegt. Seine Augen ruhten auf ihrer leichten, schlanken Gestalt. Durch ständiges Trainieren, Gymnastik und Sport hielt sie ihre Formen in gefälliger, sehniger Schmalheit. Die Schultern, die Arme und Hüften waren, für sich betrachtet, überschlank; aber ihre Art, sich zu bewegen, fest und geschmeidig zugleich,[S. 240] gab dem Körper eine reizvolle Harmonie, die nichts Eckiges oder Spitzes aufkommen ließ. Beim Gehen schien sie nie mit dem Absatz den Boden zu berühren. Dabei war ihr Gang weder schwebend noch geziert, sondern von jener kecken Freiheit, die zu dem spöttelnden Leichtsinn ihres ganzen Wesens paßte. Es war ein und dasselbe sinnliche Geheimnis in ihrer Erscheinung, in ihrem Lachen, in ihrem boshaften Geplauder; ein Geheimnis, gegen das seine Vernunft und Geradheit sich wehrten, und das doch, ohne daß er es sich gestand, ihn nicht losließ.
Sie zeigte ihm mit flüchtigen Bemerkungen, die sie über die Schulter warf, die Sehenswürdigkeiten des Parks. Da war ein Gedenkstein vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts, eine girlandenumwundene, mit einer Opferschale gekrönte Säule, moosig bezogen und mit einer Inschrift versehen, die kein Mensch lesen konnte. Der Geheime Rat behauptete fest und steif, es sei eine Erinnerung an Goethes Besuch auf dem Stift. Dann brüchiges, efeuüberwuchertes Gemäuer, verfallene Stufen, die in die Tiefe führten, wo eine Quelle rieselte. Weiterhin ein halber Turm aus verwittertem Sandstein, den Exzellenz, allerdings selbst mit einer gewissen Skepsis, für den Rest eines Burgfrieds aus Raubritterzeiten erklärt hatte. Ein verträumter Teich, über und über mit Wasserlinsen bedeckt; eine romantische Grotte, die zur Schatzgräberei ermutigte, ein ... Doch da klatschte es schon derb auf das hohe Blätterdach der Bäume und fuhr mit scharfen, silbernen Fäden durch die Zweige. Der Regen brach los.
„Wer zuerst an der Kapelle ist!” rief Alice mit ausgelassenem Gelächter.
[S. 241] Sie raffte leicht ihr Kleid und stürmte vorwärts, ohne den Weg einzuhalten, quer durch Gras und Gebüsch.
Perthes, weniger durch diese Aufforderung als durch den niederfahrenden Regen bestimmt, setzte ihr nach. Kurz vor der niederen Bogentür der Kapelle, die fast märchenhaft hinter den tiefhängenden Ästen auftauchte, überholte er sie. Alice schoß in vollem Lauf hinterdrein und prallte mit dem Gewicht ihres Körpers gegen ihn. Die alte morsche Tür hielt der doppelten Last nicht stand, sondern knarrte aus dem Schloß. Eins am andern Halt suchend, gelangten sie mehr im Fall als im Schritt in den dämmrigen Raum. Ihre erhitzten Gesichter sahen sich verdutzt und lachend an.
Die hohen bunten Glasfenster waren mit Sonnenvorhängen gedeckt, so daß es beinahe finster in der Kapelle war. Sie war möglichst als Gotteshaus erhalten. Ein Hochaltar aus der Kölner Schule — die süßliche Madonna in der Mitte, rechts und links auf den Flügeln die knienden Stifter —, Sanktuarium, Lesepult und Kerzen davor, traten, von einem Streiflicht getroffen, aus dem Dunkel der kleinen Apsis. Alice zog einen der Vorhänge auseinander. Man erkannte jetzt leidlich die geschnitzten Chorstühle an den Wänden, Bilder der Stationen Christi, die blanken Pfeifen einer kleinen Orgel auf der rückwärtigen Empore. Das halbe Gewitterlicht von draußen gab eine fahle, wunderliche Stimmung.
Geschmackvolle Schränke zwischen den Chorstühlen und glasüberbaute Tische, die an Stelle der Bänke das Kapellenschiff füllten, enthielten die Sammlung des Geheimen Rats: Meßgewänder und Schmuckstücke aus dem späten Mittelalter, Gemmen und Münzen aus der[S. 242] Antike, Handschriften aus dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert.
Auch wenn sie besser zu sehen gewesen wären — Perthes hätte jetzt kaum zu einer näheren Besichtigung Lust gehabt. Er lehnte schweigend an einem der Pfeiler und begnügte sich, die ruhige Gesamtheit der kleinen Kirche und ihre Kühle auf sich wirken zu lassen. Der Regen prasselte an die Scheiben, und der Sturm brauste draußen in den mächtigen Bäumen.
Alices unfromme Stimme weckte ihn schnell. „Als Säulenheiliger sehen Sie wirklich nicht gut aus, Doktor!” klang es von der Höhe der Orgelempore hallend zu ihm herunter. „Kommen Sie lieber zu mir herauf und helfen Sie mir!”
Perthes entdeckte nicht ohne Mühe die schmale Stiege, die sie emporgeklettert war, und folgte ihr. Sie krachte bedenklich unter seinen Tritten.
Alice stand hinter der verstaubten Orgel und wirtschaftete an einer hohen Leiter.
„Wobei soll ich Ihnen helfen?” fragte er mit leisem Argwohn.
Sie deutete über sich.
Man sah über die Dachsparren durch in den engen Turm, in dem zu oberst ein oder zwei Balken querliefen, die wohl früher eine Glocke getragen hatten.
„Ich möchte mir von da oben mal das Unwetter ansehen!”
„Aber das ist ja Unsinn!” entfuhr es Perthes. „Da kommen wir nicht hinauf. Oben an der Leiter fehlen Sprossen, und weiter hinauf sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, hochzukommen. Überdies wackelt das ganze[S. 243] Ding hier!” Er schüttelte mit seinen Händen die gar nicht einladende Leiter.
„Das hätte ich mir denken können, daß Sie für so was nicht zu haben sind! Aber ich will da hinauf, hören Sie! Wenn ich mir den Hals breche, sind Sie schuld, der Sie mir nicht behilflich sein wollen!” Sie stieg entschlossen auf die erste Sprosse. „Ich brauche Sie gar nicht!”
„Das erlaub' ich nicht!” Perthes faßte zornig und besorgt ihre Hand.
„Wollen Sie mich loslassen. Mit Ihrem Bärengriff! Erlauben! Was haben Sie zu erlauben!?”
„Seien sie nicht so eigensinnig, Fräulein Alice.” Zum erstenmal brauchte er in der Erregung ihren Vornamen.
„Jetzt erst recht! Ich bin nicht so ängstlich um mein bißchen Leben besorgt wie Sie um Ihren schönen Gehrock, Doktor — der —”
Mit einem Satz war Perthes neben ihr und drängte sie knirschend beiseite.
„Sie Barbar!”
Er klomm behend aufwärts und sie mit leisem, befriedigtem Lachen hinter ihm drein. Sie hatte seinen Mut und seine Entschlossenheit in Frage gezogen, und er war unbesonnen genug, sich das nicht zweimal sagen zu lassen. Wie ein großer, bravoursüchtiger Junge kletterte er hoch und höher. Wo die Sprossen fehlten, streckte er ihr ohne ein Wort befehlend Hand und Arm zu, um ihr zu helfen, und sie zog sich geschickt an ihm empor.
Es war eine waghalsige Torheit, wie er richtig vorhergesagt hatte.
Über der Leiter waren eiserne Krampen ins Fachwerk geschlagen, die zur Not als Stufen dienen konnten.
[S. 244] Er hatte es aufgegeben, noch einmal gegen Alices Wagemut vorstellig zu werden. Er wußte, daß er sie damit nur um so trotziger machen würde. Ganz nur mit dem gefährlichen Aufstieg beschäftigt, vergaß er jede Bedenklichkeit: er schlug seinen Arm hinter ihren Rücken; halb zog, halb hob er sie weiter, und ihr geschmeidiger, leichter Körper schmiegte sich ohne Scheu an den seinen.
Dort, wo der Turm, ein richtiger Dachreiter, sich gegen das Dach absetzte, war eine schmale Galerie, in der sie, gegen die Wand gelehnt, einen Augenblick Seite an Seite veratmen konnten. Wenn er sich auf die Fußspitzen erhob, streifte er mit den Händen an das Glockengerüst. Er suchte es auf seine Festigkeit zu prüfen. Es war stark genug, um zwei Menschen zu tragen, und saß fest im Gemäuer. Die Balken, einer etwas höher als der andere, aber in gleicher Richtung, bildeten eine notdürftige Bank.
Perthes schwang sich hinauf. Mit dem einen Arm hielt er sich, mit dem anderen half er Alice und setzte sie mit einer letzten, ruckhaften Anstrengung neben sich — fast leidenschaftlich-heftig, wie ein unartiges Kind, das in Teufels Namen seinen Willen haben muß.
„Wenn Sie nicht so grob zufaßten, würden Sie einen ganz guten Bergführer abgeben!” stieß sie aufatmend hervor.
„Chirurgen haben bekanntlich immer harte Hände,” spottete er ingrimmig. „Fassen Sie die Planke da gefälligst fester,” kommandierte er, „sonst segeln wir in die Tiefe.”
„Sie sind ja ein netter Tyrann!” Alice sah ihn mit einer Mischung von Schelmerei und fast zärtlicher Bewunderung an. Sie saßen eng aneinandergedrängt; die[S. 245] Arme hatten sie sich wechselseitig hinter den Rücken legen müssen, um sicher zu sitzen. Ihre in der Anstrengung des Aufstiegs erglühten Gesichter berührten sich beinahe. Er spürte die losen Strähnen ihres zerzausten Haares auf seiner Wange.
„Wollen Sie nicht lieber, statt mich zu schelten, sich die Aussicht ansehen?” meinte er erregt.
Es war in der Tat schön da oben.
Durch die spinnwebverzierten Gucklöcher des Turmes übersah man flußaufwärts das Tal. Die Wolken hingen schwer und schwarz über den Tannenkuppen. Blitz auf Blitz zuckte daraus hervor und riß die verdunkelte Landschaft in grelles, phantastisches Licht. Der Donner rollte ferner. Aber der Wind wühlte noch immer in den Baumwipfeln, auf die man heruntersah, und der Regen fuhr in langen, glitzrigen Strichen nieder.
Das tosende Bild des Unwetters war nicht dazu angetan, Perthes ruhiger zu machen. Während er mit vom Staube brennenden Augen hinausstarrte, fühlte er, wie die warme Nähe von Alices biegsamem Körper seine Sinne gefangennahm und seine Widerstandskraft lähmte. Er vermied es krampfhaft, sie anzublicken. Sein herrisches, scharfes Wesen war die letzte Schanze, die er zwischen sich und ihr aufwarf und verteidigte.
„War das etwa nicht der Mühe wert, hier heraufzuklettern?” fragte sie nach einer Weile vorwurfsvoll. „Tun Sie nicht Abbitte, Doktor Perthes?” Sie beugte ihren Kopf vor, um ihm in das beharrlich geradeaus gerichtete, finstere Antlitz zu schauen. Die rotblonden Haare schienen wie kleine, zackige Blitze ihr Gesicht zu umzucken, und die flackernden, boshaften Augen suchten die seinen.
[S. 246] „Sie werden fallen! Halten Sie sich ruhig!” knirschte er. Mit der äußersten Anspannung seines Willens wich er ihrem Blick aus. Er wußte, daß er sie an sich reißen und küssen mußte, wenn sich seine Augen mit den ihrigen trafen — küssen wie ein Rasender. Ob sie dabei beide in Gefahr kamen, in die Tiefe zu stürzen, war ja dann vollends gleichgültig ...
„Ah — ich glaube, Sie fixieren da drüben die Sägemühle!” Ärgerlich glaubte Alice das Ziel seines starren Blicks entdeckt zu haben.
Perthes hatte bisher das rote Ziegeldach an der Krümmung des Flusses, zwischen windgepeitschten Baumkronen, noch gar nicht beachtet. Jetzt erkannte er es. Der Bann war gebrochen.
Der Gedanke an Marga stürmte schmerzlich, anklagend, bitter auf ihn ein und kühlte sein Blut ab.
„Steigen wir ab, gnädiges Fräulein. Es wird lange genug dauern. Halten Sie sich eine Sekunde fest. Mit beiden Händen. Hier und hier.” Er bedeutete ihr die beiden Stellen am höheren Glockenbalken. Dann ließ er sich am anderen auf die Galerie nieder und half ihr folgen.
Er hatte seine nüchterne Überlegung wieder.
Wo der Dachreiter auf dem Dache der Kapelle aufsaß, war eine gähnende Luke. Sie konnte auf den Dachboden führen. Vielleicht bot sich dort ein minder halsbrecherischer Weg. Ohne auf Alices Einwände zu hören, leitete er sie von der Galerie bis an die Luke. Dort kletterte er voraus und inspizierte das Terrain. Nach wenigen Augenblicken kam er zurück und hob sie zu sich auf den Boden. Sie tappten Hand in Hand, vorsichtig und stumm durch den[S. 247] dunklen Raum, wo sie eine Fledermaus aufscheuchten und Spinngewebe zerrissen. Eine im Vergleich mit der Leiter, an der sie hochgeklommen, bequeme Holztreppe führte vollends in die Tiefe. Der Abstieg war ein Kinderspiel gegenüber dem unsinnigen Aufstieg. In einer engen, völlig kahlen Kammer, die wohl als Sakristei zwischen Apsis und Schiff der Kapelle eingeklemmt war, gelangten sie auf ebener Erde an. Durch eine offene Tür kam man von dort hinter den Hochaltar und zurück in die Kapelle.
„Der Weg wäre einfacher gewesen!” bemerkte Perthes, nicht ohne Vorwurf.
„Ich wußte nicht, daß man vom Boden in den Turm steigen kann,” gab Alice frostig und einsilbig zurück.
Als sie unter das Tor der Kapelle traten, sah er auf die Uhr. Es war spät geworden. Beinahe sieben. „Höchste Zeit, daß ich mich verabschiede!” murmelte er heftig.
Sie schritten wortlos durch den Garten nach dem Haus. Der Regen hatte aufgehört. Es tropfte nur noch schwer und laut von den glänzenden Zweigen.
Im Flur klingelte Alice nach dem Diener. „Vielleicht wünschen Sie sich etwas ausbürsten zu lassen, Herr Doktor!” Sie musterte sein verstaubtes Äußere vom Fuß zum Kopf mit einem halben Lächeln, das er mit einem Blick auf ihr ziemlich mitgenommenes blaues Foulardkleid erwiderte. Dann ließ sie ihn stehen und ging die Treppe hinauf.
„Bitte, sagen Sie mir noch, gnädiges Fräulein, wo ich mich von Ihren Eltern verabschieden kann,” rief ihr Perthes nach.
„Seine Exzellenz, der Herr Geheime Rat, wurden in die Stadt gerufen. Ihre Exzellenz, die gnädige Frau,[S. 248] sind zu Bett gegangen,” meldete der hinzukommende Diener.
Alice war auf dem Treppenabsatz stehen geblieben. „Na, denn adieu!” Sie nickte ihm zu und streckte die Hand lässig über das Geländer.
Perthes berührte sie leise und verbeugte sich. „Sie haben wohl die Güte, mich den Herrschaften dankend zu empfehlen. Auch Ihrem Herrn Bruder und Ihrer Fräulein Cousine.”
Fräulein Exzellenz war schon verschwunden ...
Perthes ließ sich von dem Diener, so gut es ging, den Anzug reinigen.
Zwei Minuten später trat er aus dem Haus. Er atmete auf und ging mit schnellen Schritten durch den Garten dem Tor zu. Als es zufiel und Stift Nieburg hinter ihm lag, war es ihm, als wäre eine Ewigkeit vergangen, seit er dort eingetreten war. Und doch waren nur wenige Stunden vergangen, seit er an derselben Stelle aus der Droschke gestiegen. Wie um einen gefährlichen Spuk, der kein Anrecht auf Wirklichkeit hatte, schleunig loszuwerden, lief er zur Landstraße hinunter. Flußaufwärts über den Bergen verzog sich das Gewitter mit aschgrauen und nachtschwarzen Wolken. Flußabwärts, der Ebene zu, blaute der Himmel wieder, und die Sonne zerriß das dünne, schleierhafte Gewölk. Ihre Strahlen drangen mutig vor und erreichten die Straße. Bis hinauf zur Mühle wagten sie sich, bewarfen das Ziegeldach und blitzten auf den nassen Blättern des Wirtsgartens. Die Rinnsale in den Wagenfurchen auf dem Fahrdamm, noch eben trostlos braun und schmutzig, sprühten blendend auf und wetteiferten mit dem goldgekräuselten Schein[S. 249] der Wellen im Fluß. Ein breiter Regenbogen spannte sich vom jenseitigen Ufer über das Tal und berührte mit seinem Scheitel diesseits den Bergwald.
Wo der Stiftsweg die Chaussee erreichte, hatte Perthes haltgemacht. Er sah nicht zurück; aber er sah auch nichts von dem milden Zauber des aufgeklärten Sommerabends vor sich. Ursprünglich hatte er geradeswegs nach der Sägemühle gewollt. Marga erwartete ihn dort — das wußte er. Nach dem widerwärtigen Besuch auf Nieburg wollte er — so hatte er versprochen — sich und sie entschädigen und wieder einmal über das Abendbrot bleiben, was er in letzter Zeit selten genug hatte tun können.
Nun schien es ihm plötzlich schwer, ja unmöglich, Wort zu halten.
Vor ein paar Stunden wollte er an ein und derselben Wegscheide den Wagen lieber zur Mühle als zum Stift fahren heißen. Jetzt schrak er vor dem Gang, die Landstraße abwärts, zurück, als läge ein unüberwindliches Hindernis zwischen ihm und dem roten Ziegeldach, dem vertrauten Garten. Er hatte den Hut vom Kopf gerissen und preßte die Hand gegen die Stirn. Was war eigentlich geschehen, das ihn so mutlos machte? Er hatte sich nichts vorzuwerfen, nicht das geringste. Keine Handlung und kein Wort, noch so leis und flüchtig, konnte ihn anklagen. Und doch lag es wie ein dunkles, erstickendes Gefühl von Unrecht, ja von Schuld auf ihm.
Drunten, zwischen den Bäumen des Mühlengartens, schimmerten zwei helle, sommerliche Kleider. Arm in Arm traten zwei Mädchengestalten auf die Landstraße. Er hätte Marga und Elli erkannt, auch wenn die sinkende[S. 250] Sonne sie weniger scharf beleuchtet hätte. Elli hielt die Hand vor die Augen und spähte die Straße entlang.
Unwillkürlich trat Perthes einen Schritt zurück, um hinter einer Schlehenhecke am Wegrand verdeckt zu sein. Im nächsten Augenblick, als er sich dieser Bewegung bewußt wurde, mit der er sich verleugnete, wurde ihm auch seine Gemütsverfassung erschreckend klar.
Was da oben auf Stift Nieburg in ihm wach geworden, war das andere! War das, was er für Marga nicht empfand und nie empfinden würde! Die Leidenschaft, die zu den Sinnen sprach; die das Blut aufreizte und die Vernunft auslöschte. Wenn er es auch vermied, sich umzublicken, zurück nach Nieburg und hinauf nach dem Kapellenturm — Alices spitzbübisches Gesicht mit der kecken Stupsnase, den graugrünen, boshaft flackernden Augen, dem lüsternen Mund, mit dem weißen Teint und der Wolke von rötlichem, blitzwirrem Haar blickte ihm über die Schulter; ihre biegsamen Glieder drängten sich an die seinen und hielten ihn fest. Und er begehrte sie. Seine Arme verlangten, sie an sich zu raffen. Sein Mund suchte den ihrigen. Er hatte geglaubt, er brauche die Leidenschaft nicht! Er hatte sich überredet, daß sie zu seinem Glück nicht passe. Ausgestrichen hatte er sie, niedergehalten — war über sie weggesprungen. Wenn sie sich rächen wollte!? Und sie rächte sich ja schon! Sie wollte nicht übersprungen sein. Gewiß — seine Ansicht hatte dem Willen diesen Sprung aufgezwungen. Aber der Feind, den er unterschätzte, erhob sich in seinem Rücken. Das Gewaltsame des Entschlusses, mit dem er sich Marga zu eigen gegeben, war ihm mit einem Mal deutlich. Wie ein Schwimmer hatte er sich mit einem heftigen, entscheidenden Stoß[S. 251] ans feste Land geworfen — und nun kam die Woge, die er überwältigt meinte, mit erneuter Kraft und wollte ihn wegspülen. Er sollte nicht ans Land. Er gehörte nicht der großen Stille, sondern dem Sturm —
Ohne sich über die Richtung Rechenschaft zu geben, hatte Perthes mit aufgeregten Schritten den Weg nach der Stadt und nicht nach der Mühle eingeschlagen.
Aber das durfte er ja nicht. Er wurde erwartet! Ließ er sich schon fortspülen?
Ein paar Schritte von der Chaussee stand eine Aussichtsbank in der Uferböschung. Linkshin sah man nach dem Tal, rechtshin nach der im Dunst verschwimmenden Stadt, die mit ihren Häusern und Kirchtürmen unmittelbar aus dem Fluß aufzusteigen schien.
Dort setzte er sich.
Der Kettendampfer mit einer endlosen Reihe von bewimpelten, schwerbefrachteten Lastkähnen schnaubte und rasselte den Fluß herunter, an ihm vorbei. Hinter ihm auf der Landstraße zogen grölende Arbeiter vorüber; ein Automobil fauchte und tutete — dann klirrte ein Fahrrad — er sah und hörte nichts. Er brauchte seine ganze Besinnung und seine volle Stärke, um sich festzustemmen und der Woge zu wehren, die ihn vom Land reißen wollte. Sie trug menschliche Züge. Darum war es so schwer, sie wegzuschieben, sie fortzustoßen, ihren gelenkigen, verführerischen Widerstand zu brechen. Wie schwer, das Land im Auge zu behalten, Marga zu sehen, die blinde, anspruchslose, in der Dämmerung verblassende Marga! Ein wildes, unstetes Ringen war es, und als er sich durchgekämpft zu haben glaubte, lohnte kein freies, heiteres Gefühl. Ein bitteres „Muß” stand mit krausen, harten Falten auf[S. 252] seiner Stirn, lag drückend auf seinem Rücken und schien ihm die Glieder zerbrochen zu haben.
Langsam und mechanisch schritt er den Weg zurück, den er gekommen war. Flußaufwärts nach der Sägemühle. Er wiederholte sich standhaft ein und denselben Schluß und klammerte sich an ihm fest. Wenn die Liebe nicht stark genug war, mußte die Pflicht das ihre dazutun ...
Es dunkelte schon, als Perthes nach der Mühle kam.
Marga und Elli hatten es aufgegeben, ihn zu erwarten. Sie saßen in der Halle bei einer Lampe. Elli erzählte aus der Stadt, von wo sie um sechs Uhr zurückgekommen war: sie hatte einige Besorgungen gemacht und nach dem Haus am Wenzelsberg gesehen. In wenigen Tagen sollten die Sommerferien für sie zu Ende sein, sollte nach der Stadt zurückgekehrt werden.
Ein froher Ausruf Ellis, mit dem sie sich unterbrach, verkündete doch noch die Ankunft von Perthes.
Überrascht und beglückt leuchtete es in Margas Augen. Sie stand auf, um ihm entgegenzugehen. „Wußt' ich's doch, daß du Wort halten würdest, wenn's irgend ginge!” rief sie heiter.
„Wort halten? Warum soll ich nicht Wort halten?” erwiderte Perthes mit der Reizbarkeit eines schlechten Gewissens. Er schob Margas Arme, die sich mit zärtlicher Vertrautheit um seinen Nacken schlingen wollten, beiseite.
Erschrocken weiteten sich ihre blicklosen, von Liebe strahlenden Augen. „Verzeih!” stammelte sie verwirrt und ließ die Arme sinken. „Bist du verstimmt von deinem Besuch?”
[S. 253] „War es denn so schlimm? Erzählen Sie mal ordentlich! Wir sind schrecklich neugierig,” bat Elli, unbekümmert um seine zweifelhafte Laune. „Der Grandseigneur, wie ihn Papa immer nennt, soll ja sehr exzellent sein. Er sieht auch so aus. Und Alice Hupfeld —”
„Ob ich noch etwas zu essen bekomme?” Perthes ließ sich auf einen Stuhl fallen. „Verstimmt oder nicht, ich bin hungrig!” Er wunderte sich selbst über seinen rauhen, unfreundlichen Ton, unter dem sich seine innere Unfreiheit verbarg. „Bitte, Fräulein Elli, sorgen Sie mal für mich!” setzte er artiger hinzu.
„Das lassen Sie sich gut sein, daß Sie schön darum bitten!” Elli stand auf. Sie drohte mit dem Finger. „Sonst hätten Sie lange warten können. Sie scheinen ja hübsch geladen zu sein!” Bereitwillig ging sie in die Wirtsstube.
Marga hatte sich verschüchtert neben Perthes gesetzt. Es bedurfte nicht viel, um sie scheu und ängstlich zu machen. Sie nahm ihm seine Barschheit nicht übel. Aber mit der feinen Witterung, mit der die Natur sie für ihre Blindheit entschädigt hatte, erriet sie ein Fremdes, Neues hinter seinem Wesen. Um nicht empfindlich zu scheinen, suchte sie noch einmal seine Hand zu erreichen.
„Komm, sprich dich aus! Erzähl' mir!” drängte sie sanft. „War's denn gar nicht ein bißchen nett auf dem Stift?”
„Es ging so. Ich mußte noch einmal in die Stadt, ehe ich herkam. Darum wurde es so spät.” Er hatte ihr seine Hand einen Moment überlassen. Sie streichelte sie begütigend. Gleich darauf zog er sie wieder zurück. Es sträubte sich etwas in ihm, ihre Liebkosung anzunehmen.[S. 254] Er ärgerte sich auch, daß er log. Warum das? Das war abscheulich! Sie hatte ihn gar nicht aufgefordert, sein Spätkommen zu entschuldigen. Er sprach nur, um zu sprechen.
Marga schob schweigend ihre Finger ineinander, wie um sie von jeder neuen Vertraulichkeit abzuhalten. Sie schlüpfte gleichsam in sich hinein und grübelte beklommen.
Elli kam zurück. Sie hatte bestellt, was noch zu bekommen war. Eine Studentengesellschaft, die gegen Abend eingefallen war, hatte unter den Vorräten tüchtig aufgeräumt. Die Wirtsfrau erschien bald und brachte, was sie hatte.
Perthes aß ein paar Bissen. Aber sein Hunger war nur Täuschung gewesen.
Marga und Elli saßen einsilbig dabei. Seine Mißlaune wollte keine Unterhaltung aufkommen lassen. Das Schweigen, an dem er selber schuld war, nahm ihm vollends die Lust am Essen. Nach einigen Minuten schob er den Teller beiseite.
Elli drückte sich. Sie wickelte sich in ihren Schal und lief trällernd in den Garten.
Darauf schien Perthes nur gewartet zu haben. „Ich möchte was Wichtiges mit dir bereden, Marga. Hör' mich mal geduldig an!”
Sie horchte auf. Warum sie geduldig sein sollte, erriet sie nicht, denn sie war sich keiner Ungeduld bewußt. Aber schon daß Perthes wieder sprach, und zwar ruhiger, freundlicher als zuvor, tat ihr wohl.
Langsam, umständlicher und ungeschickter, als es sonst seine Art war, entwickelte er seinen Plan. Dies halbe Verhältnis zwischen ihm und ihr schien ihm auf die Dauer[S. 255] unhaltbar. Um ihret- und um seinetwillen. Es legte ihrem Verkehr eine Heimlichkeit auf, die schon hier, auf der Mühle, oft peinlich gewesen war. In der Stadt mußte das noch viel unbequemer werden. Und erst wenn Vater Richthoff zurückkäme! Wie sollte sich da das Versteckspiel weiterführen lassen? Es kam ihm unerträglich für sie beide vor. Unerträglich und unwürdig. Darum war es das beste, sie faßten sich ein Herz und veröffentlichten ihre Verlobung. Das hob alle Zweideutigkeit auf. Das war auch jetzt, wo er eine aussichtsreiche Stellung innehatte, nur natürlich. In einigen Jahren, wenn dies und jenes, auf das er hoffen, ja sogar bestimmt rechnen konnte, sich erfüllte, war er gewiß so weit, daß sie heiraten konnten.
Ohne ihn zu unterbrechen, hörte Marga zu. Was er sagte, kam ihr überraschend. Daß die Geheimhaltung ihrer Liebe sich mehr und mehr erschweren würde, darüber hatte sie bei sich auch schon nachgedacht. An die Lösung freilich, die er heute vorschlug, hatte sie sich so schnell nicht getraut. Und doch — es war nicht der unerwartete Vorschlag, der sie beirrte. Auf was sie mehr horchte als auf seine Gründe, war die Art, in der er sein Anliegen vorbrachte. Der Ton, der unter den Worten mitschwang. Sie hätte nicht auf den Begriff bringen können, was sie befremdete. Sie fühlte nur eine Veränderung, die vorgegangen war — deutlicher und tiefer, als das verstimmte Gebaren bei seiner Ankunft ihr davon eine Ahnung gegeben. Er schien gar nicht mit ihr zu reden, sondern mit sich: mit den Mitteln kühler Überlegtheit verteidigte er sich gegen einen Gegner, den er sich offenbar voll Leidenschaft und Unbesonnenheit vorstellte. Nur durch eine Täuschung übertrug er diese Gegnerschaft auf sie und gab sich die Rolle des Vernünftigeren.
[S. 256] Als er geendet hatte, spielte er nervös mit den Fingern auf dem Tisch, als könnte er Margas Antwort nicht abwarten. Sie hatte noch nicht Zeit gehabt, sich zu sammeln, als er beinahe ungehalten aufsprang.
„Wie denkst du darüber? Sprich! Hab' ich nicht recht? Oder bist du anderer Ansicht?”
Marga schüttelte leise den Kopf. „Es kommt mir nur unerwartet. Ich muß mich erst in das Neue hineindenken.”
„Ich meine, du müßtest dich freuen, daß ich dieser Heimlichtuerei und Halbheit ein Ende machen will!” Er ging mit lauten Schritten in der Halle auf und ab. Sie konnte nicht sehen, wie unmutig sein Gesicht war. Er biß sich auf die Unterlippe und fuhr sich einmal ums andere über die krausgezogene Stirn in sein buschiges, schwarzes Haar. Sie hörte, was sie nicht sah, aus dem Klang seiner Stimme, aus der fahrigen Härte seiner Tritte.
„Ich will mich gewiß freuen, Max. Laß mir nur ein bißchen Zeit. Wir können uns doch alles in Ruhe zurechtlegen.”
„Das klingt aber gar nicht nach Freude. Eher nach dem Gegenteil!” stieß er vorwurfsvoll hervor.
Margas Augen erweiterten sich wieder ängstlich. Sie suchten nach ihm, bittend, besänftigend. „So was darfst du nicht sagen, du! Das hört sich ja an, als hätte ich dich nicht lieb genug. Wenn es aber auf meine Liebe ankäme — das weißt du — dann —”
„Auf was soll es denn ankommen? Zweifelst du etwa daran, daß ich in zwei, drei Jahren mich so weit bringe, daß wir unser Heim gründen können? Sehr großartig wird's freilich fürs erste nicht sein. Eine erste Assistentenstelle an einer kleineren, auswärtigen Klinik vielleicht.[S. 257] Später eine außerordentliche Professur und so weiter. Das trau' ich mir zu. Oder ist es dir zu lang, einige Jahre öffentlich verlobt zu sein? Es ist doch besser, denk' ich, als heimlich so lange herumzulavieren. Auch angenehmer für dich. Oder meinst du, daß dein Vater —” Er sah zu Marga hinüber und hielt inne.
Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Dieses herrische, gereizte Drängen, dieser Stolz, der nur von sich sprach, seine fast feindselige Heftigkeit verletzten sie. Sie mußte unwillkürlich seiner ersten Werbung gedenken, die so anders geklungen, so voll Zartheit und Achtung. Das brachte sie, gegen ihren Willen, aus der Fassung.
Perthes sah seinen Fehler ein. Er näherte sich ihr und legte die Hand auf ihre Schulter. „Lieber Gott, Kind, ich will dich ja zu nichts zwingen! Vielleicht bin ich auch heute nicht in der besten Stimmung, um die Worte recht zu wählen. Aber du sollst auch nicht zu schwerfällig sein! Nicht zu weich, Marga! Nicht so überernst! Es sind nun einmal Realitäten, die da zu besprechen sind, und die wollen real angefaßt sein! Das ist alles!”
Perthes wußte nicht, wie schlecht sein Trost war. Auch jetzt noch, wo er ein Unrecht wieder gutmachen wollte, sagte er Dinge, die Marga in die empfindliche und zarte Seele schneiden mußten. Zu schwerfällig, zu ernst, zu weich — vielleicht war sie das, aber er hatte noch nie solche Ausstellungen an ihr gemacht. Sie mußte all ihre Tapferkeit aufbieten, um ihre Tränen zurückzudrängen. Wenn er sie jetzt an sich gezogen, sie in seine Arme genommen hätte! Gewiß hätte sie das rechte Wort gefunden! Aber er war schon wieder beiseite getreten. Ihre Lippen waren ihr wie versiegelt. Ganz in sich hineingescheucht[S. 258] war sie jetzt, wie in ihren einsamsten, unverstandensten Mädchentagen.
Seine reizbare Laune war nur zu willig, ihr Schweigen als Trotz oder wenigstens als Eigensinn zu nehmen. „Ich bin müde. Und wir kommen heute doch nicht zueinander!” Er nahm seinen Hut. „Überleg' dir, was ich sagte, bis zum nächstenmal!”
„Du willst doch nicht schon gehen?” rang es sich von ihren Lippen.
„Doch. Ich habe morgen einen schweren Tag auf der Klinik und muß ausschlafen. Grüße Elli von mir. Adieu, Marga!” Er drückte ihr die Hand. „Wann fahrt ihr denn nach der Stadt?”
„Übermorgen, denk' ich,” gab sie tonlos zur Antwort.
Marga hörte, wie seine Schritte sich hastig nach der Wirtsstube entfernten. Er wechselte mit der Wirtin beim Bezahlen seiner Zeche ein paar Worte. Dann knarrte die Tür, die von dort in den Garten führte.
Warum sprang sie nicht auf? Warum rief sie ihn nicht? Warum lief sie nicht hinter ihm drein?
Sie saß wie gebannt.
Nicht einmal geküßt hatte er sie zum Abschied. Heute zum erstenmal nicht. Heute, wo sie davon gesprochen hatten, ihre Verlobung zu veröffentlichen; wo zum erstenmal von Hochzeit und Ehe nah und greifbar die Rede gewesen war!
Marga nahm den Kopf zwischen ihre beiden Hände.
Am Nachmittag war ihr so froh und leicht zu Mut gewesen. Sie hatte sich in ihrer Einsamkeit — während Elli in der Stadt, er auf dem Stift war — so glücklich gefühlt, so bräutlich stolz. Als dann Elli zurückgekehrt war,[S. 259] wollte sie nur von ihm mit ihr sprechen. Immer nur von ihm. Sie erwartete, sie ersehnte ihn mit klopfendem Herzen. Als er nicht kam und nicht kam, meinte sie vergehen zu müssen vor seliger Ungeduld. Wie niedergeschlagen war sie, als er ausblieb! Wie jubelte es in ihr, als er doch, doch noch kam!
Und jetzt?
Er hatte vom Schönsten und Höchsten gesprochen; von dem, was bisher nur wie ein ferner Traum, ein leuchtendes, kaum faßbares Bild im Schimmer der Zukunft gelegen! Wo blieb ihre Freude? Sie wollte sich freuen! Gewiß — sie hatte ihn gekränkt. Sie tat ihm unrecht. Sie war schlecht und kleinlich gewesen. Warum kam ihre Freude nicht jetzt? Woher die Bangigkeit, die drückende, quälende Angst, die sie statt ihrer empfand? Sie fühlte die weite Halle wie eine schmerzhafte Leere um sich, und aus der Leere kroch ihr ein Schrecknis entgegen. Ungestalt und unbegreiflich. Und doch war es da und stellte sich zwischen ihn und sie. Es war der Zweifel, den sie verabscheute; für den sie sich schalt; den sie nicht verscheuchen konnte. Konnte die Liebe so sprechen, wie er es getan? Wenn seine Liebe nicht war, für was sie und er sie hielt? Wenn es Mitleid war und wenn — doch das war ja nicht auszudenken, das war ja frevelhaft von ihr! — und wenn er auf ein öffentliches Verlöbnis nur drang, um — ja, um jede Brücke zur Umkehr hinter sich abzubrechen?!
Marga schauerte zusammen. Sie tastete nach ihrem Schal und fand ihn nicht.
Woher kamen ihr so grausame Gedanken? Woher nahm sie das Recht zu diesem häßlichen Verdacht? Es half nichts, daß sie so fragte. Angst und Zweifel ließen sie darum[S. 260] nicht los. Sie hatte ja nichts mehr als diese Liebe! Schranke um Schranke, die die Vorsicht zum Selbstschutz errichtet, war in diesen Sommerwochen mit all ihrem unverhofften Glück, ihrem reichen Erleben geschwunden und gefallen. Sie war wehrlos, wenn das Entsetzliche sich erfüllte, daß — daß ...
Elli kam zurück. Sie hatte Perthes noch gesprochen. Auf der Landstraße, auf der sie ein Stück stadtwärts gewandert war. Einen Gruß hatte er ihr noch für Marga aufgetragen. Und einen Kuß.
Sie warf sich fröhlich an Margas Hals und bestellte ihn zehnfach.
Marga weinte und lachte zugleich. Die Angst, die zehrende Herzensangst schwand vor neuer Hoffnung. Sie erzählte Elli von Perthes' Plänen. Sie schöpfte Mut aus der jubelnden Zustimmung der Schwester. Selber schalt sie sich schwerfällig, weich, überernst. Elli belegte sie noch mit viel schlimmeren Schimpfnamen.
Und sie stellten sich Käthes maßloses Erstaunen vor, malten sich Vater Richthoffs Meinung in hundert Vermutungen aus, plauderten und bauten Luftschlösser, bis das Öl in der Hängelampe zu Häupten ihres Tisches zur Neige ging, die Flamme bläulich zuckte und die Halle dunkel und dunkler wurde.
Dann führte Elli die „erklärte” Braut mit feierlichem Übermut nach oben.
Ehe der alte Herr und Käthe von der Sommerreise heimkehrten, mußte im Haus am Wenzelsberg das große Herbstreinmachen erledigt sein.
[S. 261] Kaum waren Elli und Marga von der Sägemühle, war Therese aus ihrem Heimatdorf zurückgekommen, so wurde mit Hilfe der Scheuerfrau das Unterste zu oberst gekehrt. Das Gröbste taten natürlich die dienstbaren Geister. Aber daneben gab es noch genug zu tun, woran die beiden Schwestern ihre erholten Kräfte üben konnten. Elli zumal warf sich ungestüm wie ein junges Füllen ins Joch. Sie wollte überall dabei sein. Marga hatte ihre liebe Not, sie vom Teppichklopfen und Treppenscheuern abzuhalten. Wenn sie sie dann zu einer angemesseneren Hantierung zurückholte, zur Ordnung in Schränken und Kommoden und im Silberkasten, schmollte Elli über ihre gezügelte Tatkraft, ja, sie schimpfte wie ein Rohrspatz.
„Du hast's wahrhaftig nötig, Margakind, mir gute Lehren zu geben! Lernen solltest du von mir, statt mich von aller tüchtigen Arbeit fernzuhalten! Du wirst 'ne nette Hausfrau abgeben! Die nur so wie der Geist Gottes über den Wassern schwebt, statt selber was Rechtes anzufassen! Perthes kann einem leid tun!”
Ihr höchstes Vergnügen war, wenn Marga auf solche Vorhaltungen „einschnappte”, wenn sie sich ernsthaft verteidigte und erklärte, es genüge gewiß, die Aufsicht zu führen. Da legte Elli verdoppelt los: sie würde sich nicht wundern, wenn es bei Marga mal drunter und drüber ginge. Sie dächte wohl, Perthes werde ihr so fünf bis sechs Dienstboten halten! Und sie, Marga, könne dann dasitzen, auf einem goldenen Thrönchen, die Hände im Schoß und ihre hohen Befehle lispeln! Elli ruhte nicht und entwarf die grimmigsten Zerrbilder von dieser künftigen Tatarenwirtschaft im Haus Perthes. Sie trieb es so lang und so toll, bis Marga wirklich ganz kleinlaut wurde.
[S. 262] „Du kannst ja schon recht haben,” erklärte sie schließlich traurig und verlegen. „Was andere können, kann ich natürlich nicht. Das hab' ich ihm auch schon oft genug gesagt.”
„Ja, ja,” stimmte Elli tiefsinnig zu, während sie sich vor Vergnügen auf die Lippen biß.
„Er kann und will sich nicht denken, wie schwer es mit mir sein wird. Und großartig werden wir's wahrhaftig nicht haben. Im Anfang mal sicher nicht. Wenn es schon im Haus nicht so wird, wie er's erwartet — unter den Menschen, in der Geselligkeit, bin ich erst recht zu nichts nütze.” Marga legte tatsächlich die Hände in den Schoß, aber nicht, um „hohe Befehle” zu erteilen, sondern um verzagt vor sich hinzugrübeln.
Jetzt schlug Elli um wie das Wetter im April. Sie lachte sie aus, daß beinahe die Leute auf der Straße zusammenliefen.
Wie konnte Marga so närrisch sein, das dumme Geschwätz für bare Münze zu nehmen! Im Handumdrehen machte sie aus dem Haus Perthes eine Musterwirtschaft. Großartig würde das werden! Keine so herkömmliche, peinliche Spießerei, sondern frei und schön, wie es sein sollte! Marga mit ihren geschickten Händen, ihrem guten Geschmack, ihrem klaren Kopf würde eine bessere Hausfrau werden als zehn andere mit zwanzig und mehr Augen! Und dann wäre auch sie noch da — die Schwägerin Elli! Ihr würde man doch wohl nicht das Haus verbieten. Sie wollte die Geschichte schon im Schwung halten, wenn Marga mit den zwölf Kindern nicht immer aus und ein wüßte. Eine Tante würde sie abgeben wie —
Marga verbot ihr zürnend den Mund. Aber sie mußte[S. 263] doch lachen. Und während sie ihre Arbeit des Silberputzens wieder aufnahm, ließ sie sich gern überzeugen, daß es famos gehen würde! Trotz ihrer Prüderie und Schwarzseherei! Das war ja ihres eigenen Herzens sehnsüchtiger Wunsch und Wille ...
Perthes hatte den Schwestern zur Rückkehr in die Stadt Blumen geschickt. Für Marga hatte ein kurzer Brief beigelegen, in dem er sie für seine schlechte Stimmung am letzten Abend auf der Mühle um Verzeihung bat. Die Frage, wie sie sich zur Bekanntgabe der Verlobung stellte, erneuerte er nicht. Sie war ihm dankbar, daß er nicht in sie drang. Dafür kam sie selber beim ersten Besuch, den er am Wenzelsberg machte, darauf zurück. Als hätte sie sich durch die unheimlichen Gedanken, die sie an jenem Abend peinigten, an ihrer Liebe versündigt und müßte ihren Wankelmut durch doppeltes Vertrauen wieder gutmachen, stimmte sie freudig zu und legte alles in seine Hände. Sein Vorwurf der Schwerfälligkeit hatte lang und nachhaltig in ihr gearbeitet. Sie drängte ihre Einwände und Bedenken energisch zurück und kämpfte jeden Schatten eines Zweifels, jede Regung mißtrauischer Sorge um ihr Glück tapfer nieder.
Und er? In einem Übermaß von Arbeit auf der Klinik enthielt er sich kritischer Überlegungen. In Erinnerung an den Gewitternachmittag auf Nieburg vermied er jedes Zusammentreffen mit Alice, ja, er schob auch alles beiseite, was ihn nur in Gedanken zu ihr führen konnte. Er hatte sich vorgenommen, nicht rechts noch links zu sehen: für ihn galt nur Marga; das Wort, das er ihr gegeben; der Entschluß, den er für sie beide gefaßt. Über eins war er sich klar geworden: er erfüllte damit nicht nur[S. 264] eine Pflicht gegen sie; was er tat oder ließ, entschied über ihn, seinen Wert und seine Persönlichkeit. Bei Marga war die Reife und Vollendung, nach der er innerlich strebte. Eine Vollendung mit Schmerzen, wie alle Vollendung im Leben. Wenn er aber zu ihr nicht hinaufreichte, in Marga die große Stille nicht begreifen und sich zu eigen machen konnte, gab es für ihn überhaupt kein Aufwärts, sondern nur ein Abwärts, in die Mittelmäßigkeit und Halbheit, ins Gelebtwerden statt ins Leben aus eigenem Willen. Darum biß er die Zähne aufeinander. Darum ging er geradeaus und vorwärts mit der Ehrlichkeit der Verzweiflung: er stritt um sich selber, indem er um Marga stritt ...
Es wurde Mitte September.
Das Richthoffsche Haus war längst so blitzblank und einladend, als es nur sein konnte. Auch das schwerste Stück Arbeit, Vater Richthoffs Studierzimmer instand zu setzen, ohne daß ein Buch von der Stelle gerückt, eine aufgeschlagene Zeitschrift umgeblättert, ein Zettel verschoben wurde, war mit strenger Gewissenhaftigkeit bewältigt. Man erwartete nun mit Spannung von Tag zu Tag die Nachricht aus Bayern, die die Ankunft meldete.
Käthes letzter Brief war aus Tegernsee gekommen. „In wenigen Tagen sind wir bei euch!” hatte es verheißungsvoll geklungen. „Papa depeschiert Tag und Stunde.”
Aber statt der Depesche kam eine Karte: man hatte sich unerwarteterweise mit Hofrat Geismar getroffen, der in Kreuth seine Ferien zubrachte. Der hatte es verstanden, den alten Herrn noch für eine Woche zu sich zu locken.
Marga, die der Heimkehr der Reisenden im Hinblick[S. 265] auf die schwierigen Eröffnungen, die sie zu machen hatte, und auf Perthes' Werbebesuch mit ebensoviel Bangen wie Freude entgegensah, gab sich geduldig in die Zögerung. Elli grollte ganze zwei Stunden lang. Nachher traf sie sich, zufällig natürlich, mit Wilkens in der Stadt und fand das Leben so rosig und „wonnig” — das war ihre Lieblingsbezeichnung — wie je.
Und die acht Tage vergingen auch.
Ehe sie zur Bahn zogen, umarmten sich Elli und Marga noch einmal: sie schworen sich treue Waffenbrüderschaft für ihre Liebesgeheimnisse. Sie kamen gerade recht zum Zug.
Käthe ließ grüßend das Taschentuch flattern. Kurz darauf war sie auch schon auf dem Perron, blühend, gebräunt, ordentlich rundlich in dem funkelnagelneuen, hellgrauen Kostüm, das Papa unterwegs spendiert hatte. Küsse und Umarmungen folgten in stürmischer Abwechslung.
Der alte Herr brauchte geraume Zeit, ehe er sich zeigte. Er war nämlich gerührt. Und das paßte ihm nicht. Deshalb wirtschaftete er eine beträchtliche Weile im Abteil mit dem Handgepäck und dem Dienstmann, der es herausbeförderte. Dann erst kam er zum Vorschein, mit einer Miene, die sehr würdig und zurückschreckend aussehen sollte, — den neuen Strohhut mit grünem Band verwegen wie Garibaldi über dem weißbärtigen Gesicht. Die Mädels waren trotzdem so respektlos, ihn „auf offener Straße”, wie er abwehrend schalt, zu umhalsen und zu küssen. „Ruhig im Glied!” befahl er mit sehr rauher Stimme. „Seid wohl, hoff' ich? Und habt euch reputierlich geführt? Werden ja sehen!”
[S. 266] Im Wagen — „um sich das Schlaraffenleben abzugewöhnen” — ging es lachend und plaudernd an den Wenzelsberg.
Der alte Herr war die Milde und Gemütlichkeit selbst — auch nur „zum Abgewöhnen” natürlich. Und auch die drei Schwestern waren voneinander hoch befriedigt. —
Zwei, drei Tage nachher hatte das Leben am Wenzelsberg sein gewohntes Aussehen.
Der Geheimrat hatte sein Heimweh nach den römischen Kaisern trotz Kissingen und den bayrischen Bergen mächtig in sich wachsen gefühlt. Eine so lange, faule Ausspannung war unerhört. Sein Gewissen fand nur darin Beruhigung, daß die Post jetzt einen Stoß von Korrekturen für die erste Abteilung des ersten Bandes der „Kaisergeschichte” brachte. Da gab es doch gleich alle Hände voll zu tun.
Das Arbeitszimmer im ersten Stock füllte sich mit dem alten, mächtigen Qualm.
Ein Schmerz war nur, daß er sich von Geismar zu „Nikotinlosen” hatte beschwatzen lassen. Das ausgemachte Stroh war das! Aber die römischen Gewaltherren zeigten sich wenigstens nicht weiter beleidigt von dem schlechten Zigarrenrauch. Sie standen aus Winkeln und Ecken, aus Zetteln und Zettelchen gehorsam auf, mit scharfen Profilen und tatenfrohen, hoheitsvollen Gebärden. Und sie sollten die paar Wochen vor Semesteranfang bei Gott nicht rasten dürfen, sondern tüchtig Modell stehen. Dafür wollte der alte Herr sorgen!
Er ahnte nicht, daß ihm eine überraschende Störung sehr nahe bevorstand.
An einem der ersten Vormittage nach ihrer Ankunft[S. 267] hatte Käthe ihre Freundin Lizzie in der Uferstraße besucht. Lizzie besaß neben ihrer verzehrenden Leidenschaft für Musik, die sich kein Konzert und keine Opernaufführung entgehen ließ, nur noch einen einzigen hervorstechenden Wesenszug: die fast ebenso ungemessene Vorliebe für Klatschereien jeder Art. So ließ sie es denn auch bei Käthes Besuch an Andeutungen über Herrenbesuche auf der Sägemühle und daran sich knüpfenden verfänglichen Redereien nicht fehlen. Käthe war empört. Papa Richthoff die Freude an der ganzen Reise nachträglich zu verderben, lag ihr natürlich fern. Er sollte im Gegenteil von diesen Dummheiten der Mädels so wenig wie möglich erfahren. Um so gewisser war es, daß Marga und Elli etwas zu hören bekommen sollten!
Nach Käthes Erfahrungen war es leichter, Elli den Kopf zurechtzusetzen. Deshalb sollte sie zuerst dran glauben, und zwar noch am selben Tag.
Aber die Sache fiel merkwürdig fruchtlos aus. Elli war einfach nicht kleinzukriegen. Alle Vorhaltungen der älteren Schwester beantwortete sie mit einem fröhlichen, höchst despektierlichen Lachen.
„Laß nur gut sein, Gouvernantchen!” erklärte Elli fidel. „Wir, Marga und ich, haben uns inzwischen unbedingt mündig gemacht. Bei mir hast du gar keine Aussicht auf Reue und Besserung. Mich haben die Wochen auf der Sägemühle einfach in Grund und Boden verdorben. Versuch's mal mit Marga! Uff! Da könntest du dich aber bös blamieren! Ich weiß, was ich weiß, und ich warne dich! Heißa juchhei!” Elli schlug klatschend die Hände über dem Kopf zusammen und vollführte einen in Käthes Augen außerordentlich unangebrachten Tanz. Das ganze[S. 268] sah aus, als hätte sie und nicht die Schwester in den bayrischen Alpen schuhplatteln sehen.
Käthe entzog sich einstweilen weiteren Auseinandersetzungen durch eine stolze Flucht. Am Abend schrieb sie in ihr Tagebuch: „Ernst sein können ist alles. Wie sind Menschen zu bedauern, die von diesem großen Geheimnis, das allein das Leben lebenswert macht, keine Ahnung haben oder doch nichts wissen wollen! Es ist seltsam, daß in einer und derselben Familie, unter Geschwistern die Anlagen zu Ernst und Leichtsinn so ungleich verteilt sein können!”
Damit war aber die von Käthe für nötig gehaltene Aussprache nur vertagt, nicht aufgehoben. Das durften sich „die Kleinen” nicht einbilden, daß sie ihnen ihr ärgerniserregendes Benehmen so hingehen ließ!
Sie bildeten sich's auch nicht ein, die Kleinen! Elli verständigte vielmehr Marga von dem, was drohte. Und Marga, die nicht so kampflustig wie Elli war, sah ein, daß es nun das beste wäre, nicht länger zu zaudern, sondern Vater Richthoff ein offenes, ehrliches Geständnis abzulegen, ehe ihm, von welcher Seite immer, mißverständliche Dinge zugetragen wurden.
Von Perthes hatte sie in den letzten Tagen nichts gesehen und nichts gehört. Es galt, zuerst seine Meinung noch einmal einzuholen. Elli beförderte ihre Zeilen, die ja die letzten heimlichen sein sollten. Sie fing auch die Antwort ab. Marga fand sie recht knapp und flüchtig. Aber sie sagte sich, daß sie bei seiner angespannten Tätigkeit nicht mehr von ihm erwarten durfte. Hupfeld war verreist, und es ruhte auf den Assistenten die doppelte Arbeitslast, zumal Kronheim noch immer krank war. Die[S. 269] Hauptsache blieb. Perthes war einverstanden; sie sollte ihren Vater auf seinen Besuch vorbereiten, für den Tag und Stunde unter ihnen festgesetzt war.
Es war Nachmittag. Der alte Herr hatte wie gewöhnlich seinen Gang auf den Weinberg gemacht, auf Schnecken gefahndet, die drei Trauben, die es gab, kolossal gefunden, sich über die zeitige, hohe Röte des wilden Reblaubes am Philosophenweg gewundert und war dann, seines Kaffees gewärtig, nach oben ins Arbeitszimmer und an seinen Schreibtisch gegangen.
Da trat Marga mit klopfendem Herzen bei ihm ein.
Er warf schon Notizen mit seiner kritzeligen Handschrift auf die flatternden Zettel. Erst als Tasse und Löffel auf dem in seine Nähe geschobenen Tablett lauter als sonst klirrten, sah er auf. Er wußte, daß in dieser Woche die Reihe an Elli war, ihm den Nachmittagskaffee zu bringen. Er war aber nicht weiter erstaunt, als er sie durch Marga vertreten fand, sondern kam ihr zu Hilfe und setzte selber die Tasse dorthin, wo sie seine Ordnung am wenigsten beeinträchtigen konnte.
„Wo steckt denn das Kleinchen?” fragte er ganz nebenbei, sich wieder ans Schreiben machend.
„Ich bat sie, ihr heute den Gang zu dir abnehmen zu dürfen,” erwiderte Marga mit einer gewissen Förmlichkeit, in der ihre Erregung durchzitterte.
„So —” sagte der alte Herr zerstreut. Er hatte nur halb hingehört. Schon besaßen ihn wieder die Zettel und ihre Geister.
„Dürft' ich einen Augenblick mit dir reden, Papa?” ließ sich Marga nach einer Weile schüchtern von neuem vernehmen.
[S. 270] „Ach so — du bist noch hier?” Er rückte ganz erstaunt an seiner Brille. „Mit mir reden? Aber doch jetzt nicht! Ich hab' unbändig zu tun, Mädel!”
„Ich weiß nicht, wann ich es sonst tun könnte. Ich möchte allein mit dir sein, und es ist etwas Wichtiges,” fuhr sie fester und lauter fort.
Der Geheimrat blickte sie ungläubig und ziemlich ungnädig an. „Na denn! Aber kurz!”
„So kurz ich kann!”
Dem alten Herrn fiel jetzt die Aufregung auf, die sie in ihren Zügen und Gebärden vergeblich zu bemeistern suchte. „Setz' dich mal! Hierher!” Er schob ihr den Stuhl neben seinem Schreibtisch zu. „Und nun vorwärts — wenn's so wichtig ist!”
Marga tastete sich am Stuhl hin und setzte sich, wie geheißen. Mit schlichten Worten, wie ihr sie das Gefühl eingab, erzählte sie, was zwischen ihr und Perthes vorgegangen war. Die Liebe gab ihr den Mut, herzlicher und vertraulicher zu werden, als sie es sonst ihrem Vater gegenüber wagte.
Der alte Herr hörte zuerst nur sehr im allgemeinen zu. Er spielte mit seinem Gänsekiel und sah ab und zu in seine Blättchen. Allmählich änderte sich das. Seine Augen vergrößerten sich hinter den Brillengläsern. Er schob sein Käppchen von der einen Schläfe nach der anderen, warf den Gänsekiel beiseite und strich sich mit einer barschen Regelmäßigkeit seinen weißen, kräftigen Bart.
Er traute seinen Ohren nicht. Da saß eins seiner Mädels am hellichten Nachmittag neben ihm und gab, mitten hinein in seine römische Kaisergeschichte, eine handgreifliche Liebesaffäre zum besten. Wäre es Elli gewesen, auch[S. 271] Käthe — er hätte sie einfach hinausgeworfen. Aber Marga! Marga, bei der er an so etwas nie gedacht hatte! Die ihm viel zu besonnen und abgeschlossen geschienen, als daß sie sich bei ihrem Leiden auf solche Dinge einlassen sollte!
Den alten Herrn überlief es bald heiß, bald kalt. Einmal war er nahe daran, zornig aufzubrausen: Also zu derlei kapitalem Unfug habt ihr eure Sommerferien benutzt! Dann war er drauf und dran, ihr zuzurufen: Das sind ja Märchen, Kind! Du träumst! Oder du hast dich täuschen lassen! Aber er tat nichts dergleichen. Der Ernst, mit dem Marga sich ihm mitteilte, das tiefe Glücksgefühl, das hinter ihren Worten warm und stolz aufleuchtete, entwaffnete ihn, so oft er im Begriff war, sie stürmisch zu unterbrechen. Er, der sich wahrhaftig besser auf geistige als auf sinnenfällige Beobachtungen verstand, sogar er bemerkte jetzt, wie ihre äußere Erscheinung, die ihm bisher nur als „wohl” aufgefallen war, in diesen Sommerwochen an Haltung und Ausdruck gewonnen hatte; wie die blicklosen Augen über den frischeren, farbenvolleren Wangen die Sonne von innen nach außen trugen. Sein Zorn und sein Unglaube gingen in fassungslose Bestürzung über. Hier handelte es sich also nicht um eine backfischhafte Kinderei; nicht um eine von den nebensächlichen Kleinigkeiten, mit denen die „Bande” immer zur Unzeit daherkam. Da war vielmehr eine schlimme Sorge und Verantwortung, die nicht den grimmigen Pascha, sondern den Vater in seiner ganzen Verantwortlichkeit aufrief und verlangte. Er hatte da drüben in Bayern gemurrt, weil der Arzt ihm die Berge zu besteigen verboten. Nun hatte er seinen Berg vor sich, zu Hause! Den höchsten, den er[S. 272] seit dem Tod seiner jungen Frau sich hatte auftürmen sehen. Den hätte er sich gern verbieten lassen; aber der, gerade der mußte erstiegen sein!
Marga hatte ihr Bekenntnis beendigt. In tapferem Schweigen, die Hände im Schoß verschränkt und die Augen erwartungsvoll gesenkt, harrte sie auf Antwort. Es war so still in dem verqualmten, bücherumhegten Zimmer — man konnte den Holzwurm hören, der in den goldbraunen, altfränkischen Möbeln aus Vater Richthoffs Junggesellenzeit bohrte und tickte.
„Das — das ist also — so gewissermaßen — mein Reisepräsent!” stöhnte der alte Herr nach geraumer Weile, viel eher schmerzlich als vorwurfsvoll. „Was soll denn da geschehen? Was soll denn ich nun dazu tun?” Ratlos und hilflos richtete er die Frage mehr an sich als an Marga und stöberte dabei, was seit Menschengedenken unerhört war, selber seine Zettel und Manuskriptblätter durcheinander.
„Du sollst uns nur die Erlaubnis geben, glücklich zu werden,” meinte sie leise und überzeugt.
„Erlaubnis? Glücklich werden! Als ob das mit zwei Worten abzumachen wäre! Ich — ich, der ich diesen jungen Menschen da, diesen, diesen — deinen Max oder wie du ihn immer nennst, so gut wie gar nicht kenne! Der ich — bei dir — mit solchen, solchen Alfanzereien gar nicht gerechnet habe! Meiner Lebtage nicht! Du, die du doch —” Er stand vor ihr und fuchtelte mit den Händen. Er hatte sagen wollen: Die du blind bist! Die du nicht heiraten sollst und kannst! Aber der traurige Schatten, der über Margas zuversichtliche, klare Stirn flog, ließ ihn abbrechen. Alle seine gebieterische Würde, seine pflichtmäßige Entrüstung[S. 273] vergessend, nahm er ihren Kopf zwischen seine Hände: „Kind! Kind! Was habt ihr denn da angerichtet! Mußte das denn sein? Sag doch selber, daß es ungereimtes Zeug ist! Und daß —”
„Gewiß ist es nicht ungereimt, Papa. Nicht so ungereimt, wie es dir jetzt vorkommen will! Und er — Doktor Perthes — möchte mit dir reden, um dir's noch besser zu sagen, als ich's kann!”
Der alte Herr ließ die Hände sinken. „Mit mir reden!” wiederholte er verzweifelt. Also so weit war die Geschichte schon. Die Präliminarien waren alle schon überwunden. Womöglich mit einem richtigen, auswendig gelernten, feierlichen Heiratsantrag wollte der junge Mann ihm das Haus stürmen.
„Wenn dir's recht ist, so kommt er morgen nachmittag,” ergänzte sich Marga bittend.
„Morgen nachmittag!? Mir recht!? Aber das ist ja das reinste Komplott! Das verbitt' ich mir! Das —” Der Geheimrat suchte vergeblich seinen handfesten Grimm wiederzufinden, der ihm sonst noch in allen Lagen wider die Angriffe seiner Bande geholfen hatte. „Überlegen werd' ich mir doch die Sache noch dürfen!” stieß er mit klagender Rauheit hervor.
„Ich bitte dich drum,” gab Marga herzlich und mit Vertrauen zurück. „Sicherlich wirst du —”
„Nein! Nein!” wehrte sich der alte Herr. „Nichts werd' ich sicherlich! Gar nichts: sicherlich!” Er suchte sich eine gebieterische Haltung zu geben. „Laß mich jetzt zufrieden! Ich muß arbeiten! Allein sein!”
Marga stand auf. Sie wollte nichts mehr sagen. Aber ihre Arme, ihre Hände suchten nach ihm. Durch eine[S. 274] Liebkosung wollte sie ihn um Vergebung, um Hoffnung bitten.
Vater Richthoff war heute nicht widerstandsfähig genug, um einer „Gruppenbildung”, wie er das sonst so verabscheuend nannte, auszuweichen. Er strich ihr ein-, zweimal über die fahlblonden, weichen Scheitelhaare, ungeschickt wie ein verschämter Liebhaber. Reden wollte er um keinen Preis. Sich zu nichts, zu gar nichts verpflichten.
Und für Marga war schon seine flüchtige Zärtlichkeit trostreich und hoffnungsvoll. Wenn sie erst gesehen hätte, daß seine Brillengläser sich sehr verdächtig beschlugen! Er schob sie von sich, ehe sie seine Hand erhaschen und küssen konnte.
Gehorsam ging sie nach der Tür und aus dem Zimmer.
Wenn der alte Herr geglaubt hatte, er werde bei der Arbeit sein Gleichgewicht wiederfinden und die Entscheidung, die ihm da plötzlich aufgebürdet wurde, irgendwie vertagen können — etwa wie eine inopportune Quellenfrage zweiten Ranges —, hatte er sich über seine eigentliche Gemütsverfassung getäuscht. Nach einem vergeblichen Anlauf, den er nahm, um in die ersten Regierungsjahre des Trajan zurückzukehren, sprang er gleich wieder auf. Es begann ein rastloses Auf- und Niederschreiten, das von leisen und lauten, schmerzlichen und zornigen Erwägungen begleitet war.
Daß die Mädels einmal würden heiraten wollen — „Männer daherschleppen könnten”, hieß er es bei sich —, hatte er mitunter im Bereich der Möglichkeit gesehen. Aber fern, so fern, daß es beinahe wieder ins Reich der Unmöglichkeit gehörte. Bei Marga war es für ihn immer eine stillschweigende Gewißheit gewesen, an die er nicht[S. 275] rührte: Sie wird nicht heiraten. Sie ist auch selber zu besonnen, um daran zu denken. Mitunter, wenn sie ihm träumerisch und gefühlsweich zu werden schien, hatte er sie etwas derb angefaßt: nicht aus weitblickender Überlegung, sondern aus einer mehr instinktiven Gedankenregung. So wie es einmal mit ihr hatte kommen müssen, sollte sie dem Leben lieber zu hart als zu weich gegenüberstehen. Ein Erziehungssystem hatte er nie besessen. Für keins seiner Mädels. Dafür hatte er weder Talent noch Zeit. Und sie waren ja auch so ganz leidlich geworden. Wenigstens hatte es ihm bisher so geschienen.
Nun brachten ihn die jähen Enthüllungen des heutigen Nachmittags aus dem Konzept. Wie wenn ihm einer nach einem fertigen Kapitel der Kaisergeschichte eine neue Schrift vorgelegt hätte, die er nicht kannte und die seine ganze Auffassung über den Haufen warf. Er wurde irre an sich. Er hatte doch wohl nicht genug getan? Die Tanten und Tunten hatten am Ende recht, die vor Jahren gemeint, er könne mit den drei Mädels so allein nicht zuwege kommen. Die bloße Paschastrenge tat es nicht. Er hätte sich mehr mit ihnen abgeben müssen. Mit jeder von ihnen. Aber wie denn? Er konnte nicht bei ihnen sitzen, mit ihnen ausgehen, ihr Tun und Lassen überwachen, die Kindsmagd spielen — das lag ja so weit, so himmelweit ab von seinem Beruf, der geistigen Lebensaufgabe, die das erste hatte sein müssen! Es half ja auch gar nichts, wenn er sich jetzt vordeklamierte, wie er alles hätte anders, hätte besser machen können. Damit konnte er die Tatsache nicht wegbuchstabieren, daß Marga, seine Marga, sein Sorgenkind sich von einem wildfremden Menschen liebhaben ließ.
[S. 276] Er durfte nur ja oder nein sagen.
Nein sagen mußte er natürlich.
So weltfremd er im Grunde war: seine Vernunft sträubte sich dagegen, in eine solche Ehe zu willigen. Marga war blind. Sie konnte niemals einem Mann, und wenn er ein Held an Selbstüberwindung war, das sein, was er von einer Lebensgefährtin fordern mußte. Eine solche Liebe, sie mochte noch so groß und überschwenglich sein, mußte sich wund und mürb reiben an den Forderungen der Wirklichkeit. Das konnten zwei törichte junge Leute bestreiten, aber es blieb darum nicht minder wahr und mußte jedes Glück zerstören. Also mußte er nein sagen.
Kaum aber stand dieses harte Nein da, vor ihm, so lehnte sich auch schon sein Herz mit voller Macht gegen das grausame Verdikt auf.
Seine Erinnerung kehrte zu den schweren Tagen zurück, in denen Marga, ein Kind, an den Folgen einer Netzhautablösung das helle, frohe Licht ihrer klaren Augen verlor. Es war etwa ein Jahr nach dem Tod seiner Frau. Und dieser zweite Schlag traf ihn nicht leichter als der erste. Das Hoffen und Bangen schwankender Wochen, das Verzweifeln und Aufbäumen gegen das Unabänderliche, alles, was er mit dem Kind blutenden Herzens durchlitt und durchkämpfte, bis es in frühzeitiger, innerer Reife über sein Los emporwuchs, erwachte vor ihm. War es nicht genug, daß das Schicksal sie von tausend Freuden des Tages ausschloß und in immerwährende Nacht bannte? Blind sein — hieß es für sie nicht, mit einem Teil ihres Wesens schon gestorben sein, ehe sie gelebt hatte? Wo stand geschrieben, daß Marga mit der Kraft, zu sehen, auch das Recht und die Kraft, zu lieben, verwirkt hatte? Woher[S. 277] nahm er die Macht, zu entscheiden: Das ist dein Glück, und das ist dein Unglück? Die Liebe — konnte sie sie nicht entschädigen wollen für das, was ihr an Licht und Lust genommen war? Und er hatte den Mut, es grausamer mit ihr zu meinen, als ihr Schicksal? Der Idealist in ihm bekämpfte die nüchterne Besonnenheit, die er seinem guten Herzen aufzwingen wollte. Er kannte den Mann nicht — kaum von Angesicht — der ihr die Hand bieten wollte. War es ausgemacht, daß er nicht wußte, was er wollte und tat? War es wirklich so über allen Verstand, daß ein Mann diese ruhige, offene, klare Marga liebte, so liebte, daß er ihre Blindheit über ihrem inneren Wert vergaß? Der Stolz des Vaters setzte die Gesundheit und Fülle ihrer Seele gegen das Gebrechen ihres Körpers. Fast war es, als hielten unter solchem Gewicht das Für und Wider sich die Wage ...
Richthoff achtete nicht darauf, wie unter dem Sinnen und Sorgen die Stunden vergingen.
Es wurde Abend.
Die Septembersonne mit ihrem vollen, ruhigen Schein huschte zwischen den Zweigen im Vorgarten hindurch auf seinen Schreibtisch: sie fand ihn nicht wie sonst auf seinem Platz, den weißbärtigen Kopf über Bücher und Manuskriptblätter gebeugt. Verwundert glitt sie allmählich aus der Stube und ließ der Dämmerung das Feld.
Vater Richthoff stand vor einer rundbauchigen, altmodischen Kommode, deren goldbraunes Holz metallene Ranken verzierten. Auf der Kommode stand eine Photographie, in die er sich vertieft hatte. Es war das Bild seiner verstorbenen Frau, bei dem er Rat suchte; als könnte ihr jugendlich-zartes, lebensfrohes Gesicht aus der[S. 278] Ferne vieler Jahre Trost und Klärung in seine Wirrnis bringen.
Als es an die Tür klopfte, fuhr er erschreckt zusammen.
Mit einem gepreßten „Ich komme ja schon!” winkte er Käthe, die fragend hereinschaute, aus der Tür.
Es dauerte noch eine gute Weile, ehe er kam. Und dann saß er zerstreut und wortlos beim Essen. Kaum daß er die Speisen berührte. Nach einer Viertelstunde verschwand er wieder.
Käthe, die nicht wußte, was vorgefallen war, erging sich in besorgten Mutmaßungen über seine Gesundheit. Sie ließ durchblicken, daß Hofrat Geismar ihr in Kreuth einige gar nicht unbedenkliche Andeutungen gemacht habe, wie wichtig es sei, daß sich Papa schone. Sie fand nur wenig Gehör bei den Schwestern und verstummte wie sie.
Elli drückte Marga heimlich ermunternd die Hand. Sie hatte sich alle Mühe gegeben, in Vater Richthoffs Mienen Gutes zu lesen. Doch als Marga sie später im Garten befragte, wie er ausgesehen, vermochte sogar ihr Optimismus das Barometer höchstens auf „Veränderlich” zu deuten.
Eine beklemmende, schwüle Nacht senkte sich auf das Haus am Wenzelsberg.
Die Lampe im Studierzimmer des Geheimrats überdauerte mit ihrem Schein die spätesten Wanderer. Als der alte Herr sie endlich löschte, hatten die Geister der römischen Cäsaren Gelegenheit, sich über wunderliche Dinge, die sie gehört und gesehen, die erlauchten Köpfe zu zerbrechen.
Am nächsten Vormittag hatte er eine lange Unterredung mit Marga.
[S. 279] Noch nie hatten sie sich so verstanden, waren die Herzen von Vater und Tochter sich so nahe gekommen wie in dieser Stunde. Der Geheimrat sprach weder das Ja noch das Nein, das zu erwirken seine Vernunft und sein Herz sich so heiß befehdet hatten. Aber er erklärte sich bereit, den Doktor, diesen Eindringling und Ruhestörer, zu empfangen. „Um ihm den Kopf zu waschen!” wie er meinte. Und er ließ sich zwar nicht von Marga küssen, aber er gab ihr selbst eine Art unwirschen Kuß auf die Stirn und brummte etwas von „Vertrauen haben” in den Bart. Und Margas Augen schimmerten von Dankbarkeit. —
Käthe hatte sich für den Nachmittag mit Lizzie zu einem Besorgungsgang in die Stadt verabredet. Bald nach Tisch ging sie aus dem Haus.
„Die wird Augen machen, wenn sie am Abend heimkommt!” frohlockte Elli, als sie mit Marga allein zurückblieb.
„Ich hätte ihr gern eine Andeutung gemacht,” meinte Marga nachdenklich. „Sie wird es nicht schwesterlich finden, daß ich sie so gar nicht vorbereitete.”
„Ach was,” beruhigte Elli, „die Überraschung ist ja gerade das Netteste! — Was machen wir jetzt? Es dauert noch anderthalb Stunden, ehe das große Ereignis beginnt. Ich glaube, ich bin aufgeregter als du, Margakind! Faß mal an!” Sie legte die Hand der Schwester an ihre glühheiße Wange. „Hast du kalte Hände — puh! Dir scheint's ja auch tüchtig schummerig zu sein. Wir müssen was vornehmen! Du hättest mal sehen sollen, wie Papa aussah bei Tisch! Richtig feierlich wie ein Brautvater. Und manchmal bewegte er die Lippen, wie wenn er eine kleine Ansprache[S. 280] hielte — an den künftigen Schwiegersohn natürlich!” Sie kicherte erregt und sah zum Fenster der Eßstube hinaus auf den Weinberg. „Wahrhaftig! Papa kommt schon zurück! Keine zehn Minuten war er heut' bei seinen Schnecken. Du hast die Hausordnung schön auf den Kopf gestellt, Margakind! — Komm, wir gehen nach oben! In unsere Stube. Da wird's noch am ehesten auszuhalten sein.”
Marga ließ sich willenlos von Elli hinaufführen. Nun, da die Entscheidung mit jeder Minute näher auf sie zukam, wurde es ihr doch schwer und schwerer ums Herz. Um nicht verzagt zu werden, mußte sie sich immer bei sich wiederholen: Es ist ja doch das Glück, das vor der Tür steht! Papa wird sicher alles gutmachen! Und Max —
Aber Elli ließ sie nicht erst lange grübeln. Sie drückte sie in die Sofaecke, setzte sich neben sie, ganz nahe, und schwatzte — schwatzte das Blaue vom Himmel herunter. „Natürlich wird ihn Papa nachher dabehalten. Er muß bei uns Abendbrot essen. Denk' dir, als dein offizieller Bräutigam! — Kannst du dir eigentlich Papa vorstellen — als Schwiegervater? Wenn er mit deinem Max sich so richtig was erzählt? — Eigentlich ist's doch zu schnurrig, daß du die erste von uns dreien bist. Lizzie, Cousine Grasvogel, die Wilmannsmädels — die Gesichter möcht' ich sehen! — Wer wohl die nächste nach dir ist? Wenn doch Wilkens endlich wenigstens seinen Doktor machen wollte! Er hat mir geschworen, er werde nach Neujahr ins Examen steigen. Aber seine Meineide sind gar nicht mehr zu zählen!” Traurig und seufzend ließ Elli die Stimme sinken.
„Diesmal wird er bestimmt Wort halten,” tröstete Marga.
[S. 281] „Meinst du? Vielleicht nimmt er sich ein gutes Beispiel. — Ach, du, Margakind, waren das Tage auf der Sägemühle! So schön wird's im ganzen Leben nicht wieder!”
Jetzt war der rechte Gesprächsstoff gefunden.
Sie gingen miteinander den Sommer durch, beinahe Tag um Tag. Wie Perthes und Wilkens zum erstenmal miteinander draußen auftauchten. So unerwartet und doch erwartet. Wie Marga ihm das Wiederkommen verbot. Wie sie und Elli jenen Ausflug über die Berge machten. Erst in so niedergeschlagener, trüber Stimmung und dann auf dem Heimweg so glücksfroh — über den endlosen Hang von läutenden Glockenblumen, den Marga erträumte. Als sie über den Fluß setzten, stand er drüben am Ufer. Ihre Herzen fanden sich. Und dann die lustigen Mahlzeiten zu vieren! Der tolle Besuch von Papa Wilmanns, wo Borngräber den Sündenbock machen mußte und die „Generalrevision” in Bowle und Tanz sich auflöste. Elli jubelte noch in der Erinnerung, und Marga, von ihrer Lustigkeit angesteckt, vergaß für Augenblicke, wie ihr Herz klopfte.
Die Kuckucksuhr meldete dreiviertel vier. Die Zeit war im Fluge vergangen. Sie horchten betroffen auf, als sie schlug, und wurden beide still und ernst.
„Ich möchte Max so gern einen Moment sprechen, ehe er zu Papa hineingeht,” brach Marga zuerst wieder das Schweigen. „Ihm wenigstens die Hand drücken oder doch zuwinken,” meinte sie beklommen.
„Natürlich sollst du das! Ich leg' mich auf die Lauer. Laß mich nur machen!” Schon war Elli aufgesprungen. Sie öffnete die Tür und schlüpfte nach dem Flur, um die[S. 282] Wache anzutreten, so wie sie und Käthe es zu machen pflegten, wenn das Semester anfing und die Hörer von Papa sich in der Sprechstunde anmeldeten. „Weißt du noch,” flüsterte sie, sich auf der Schwelle nach Marga umdrehend, „wie wir ihn zuerst sichteten? Damals — mit dem Pfeffer-und-Salz-Jackett?”
Ob Marga das noch wußte! Es litt sie nicht länger auf ihrem Platz.
„Bleib doch!” mahnte Elli. „Wenn es klingelt und ich sehe, daß er's ist, ruf' ich dich!” Sie beugte sich herunterspähend über das Treppengeländer, obwohl noch nichts zu hören und zu sehen war.
Der Kuckuck holte zu seinen vier Rufen aus. Gleichzeitig wurde an der Hausklingel geläutet. Lange und schrill tönte es durchs Haus.
Marga ließ es sich nicht nehmen: ehe Elli es verhindern konnte, eilte sie die Treppe hinunter.
Sie war noch nicht im Erdgeschoß angelangt, als Therese schon geöffnet hatte. Eine fremde Stimme traf ihr Ohr. Enttäuscht blieb sie stehen.
„Da wird ein Brief für Sie abgegeben, Fräulein Marga.” Therese kam ihr entgegen und schob ihr ein Kuvert in die Hand.
Marga erschrak unwillkürlich. Was war das? Doch nicht — Perthes würde doch nicht etwa abgehalten sein, zu kommen? Sie fühlte, wie ihr alles Blut aus dem Herzen strömte. Zitternd öffnete sie den Umschlag. Die Zeilen waren in Punktschrift geschrieben. Sie konnten also nur von ihm sein.
Es dauerte eine Ewigkeit, ehe ihre Finger sich zurechtfanden.
[S. 283] „Was ist denn los!” raunte Elli neugierig von oben. So weit sie sich vorbeugte, sie konnte nicht sehen, was vorging.
Marga achtete nicht auf ihre Frage. Während ihre Fingerspitzen das Papier abtasteten, bewegten ihre Lippen sich lautlos. Sie las:
„Liebe Marga!
Was gäbe ich drum, wenn ich diese Zeilen nicht schreiben müßte! Du wirst mich verachten, wenn Du sie liest, wie ich mich verachte. Ich kann nicht kommen. Ich kann mein Wort nicht einlösen — —”
Weiter kam Marga nicht. Ihre Knie zitterten. Sie zerknitterte den Briefbogen zwischen ihren Fingern und preßte die Hand gegen ihr Herz. Ein gedämpfter, kurzer, klagender Aufschrei, wie der Schrei eines Sterbenden, rang sich von ihren Lippen. Instinktiv suchte sie die Treppen zu erklimmen. Sie stolperte wie eine Trunkene. Im ersten Stock taumelte sie gegen Vater Richthoffs Tür. Das ewige Dunkel um sie her schien ihr in eine Wolke roten Bluts verwandelt. Sie konnte nicht rufen. Ihre Sinne schwanden, und sie meinte, ihr Leben schwinde mit ihnen —: Er kam nicht! Er würde nie kommen! Alles war zu Ende ...
Der alte Herr öffnete seine Tür, erstaunt über das Geräusch, das sie erschütterte. Zur rechten Zeit, um Marga in seinen Armen aufzufangen.
Exzellenz Hupfeld hatte den Rundgang durch die chirurgische Klinik beendigt. Der Geheime Rat hatte eine mehrwöchige Nordlandreise hinter sich und war heute zum[S. 284] erstenmal wieder in der Klinik erschienen. Seine Assistenten in ihren weißen Mänteln begleiteten ihn bis unter das Portal, wo der Chauffeur mit dem Automobil wartete. Er pflegte dann bis zuletzt Fragen zu beantworten und Weisungen zu erteilen.
Der zweite Assistent, Doktor Brunner, ein sehr gewissenhafter, etwas pedantischer und schwerfälliger Mensch, dessen Haltung den ehemaligen Militärarzt verriet, folgte mit Perthes, dem im Range dritten, bis an den Wagenschlag, während einige jüngere Volontärärzte unter der Einfahrt stehen blieben.
Exzellenz gefiel sich in diesem feierlichen, beinahe fürstlichen Bild seiner An- und Abfahrten. Das Gefolge seines Stabes, vervollständigt durch den in Positur stehenden, die Mütze senkenden Chauffeur und den dienstbereiten Oberwärter, stand gut zu seiner überragenden Gestalt im hellgrauen Staubmantel mit der eleganten Schirmmütze. Er hatte es deshalb nicht sonderlich eilig mit dem Einsteigen. „Sie haben also keine guten Nachrichten von Professor Kronheim?” fragte er mit seiner lauten, getragenen Stimme den rechts von ihm stehenden Brunner.
„Leider nein, Exzellenz,” lautete die Antwort. „Ich fürchte, Kollege Kronheim wird seinen Urlaub noch um weitere vier bis sechs Wochen verlängern müssen.”
„Ist denn die Lungenaffektion fortgeschritten?”
„Fortgeschritten nicht gerade,” berichtete Brunner korrekt weiter, „aber es fehlen auch die Anzeichen für eine Besserung. Er denkt an einen Aufenthalt im Süden.”
„Daran hätte der arme Kerl eher denken sollen. Fatal. Höchst fatal!” Hupfeld strich sich gedankenvoll über das runde, volle Kinn. „Sie sagen, vier bis sechs Wochen.[S. 285] Ich fürchte — ich fürchte, die Sache wird sich über den ganzen Winter hinziehen. Und wir haben in vierzehn Tagen Semesteranfang!” Er hatte den einen Fuß auf den Wagentritt gesetzt.
Chauffeur und Wärter beugten sich hilfsbereit vor, um ihn zu unterstützen.
Aber Exzellenz beharrte in tiefsinniger Stellung. „So wird die Geschichte nicht gehen. Wir müssen auf irgendeinen Ausweg denken,” überlegte er. „Ich sage das nicht,” wandte er sich lebhafter an seine beiden Assistenten, „um ihnen, meine Herren, den leisesten Vorwurf zu machen. Im Gegenteil, Sie tun das Menschenmögliche. Ich bin außerordentlich zufrieden.” Ein anerkennender Blick der blaßgrauen Augen schweifte von Brunner zu Perthes, auf dem er ruhen blieb. „Sie müssen entlastet werden, meine Herren! Sie reiben sich auf. Besonders Ihr Aussehen, mein lieber Perthes, gefällt mir ganz und gar nicht. Sie überarbeiten sich!”
„Exzellenz sind sehr gütig. Aber ich fühle mich ausgezeichnet!” versicherte Perthes. Die gelbliche Farbe seines Gesichts, die tiefen Furchen unter den verschleierten Augen schienen ihn freilich Lügen zu strafen.
„Nein, nein, mein Lieber,” erwiderte mit einem huldvollen Hochziehen der dünnen, falben Augenbrauen der Geheime Rat, „ich kenne das. Sie sind ein Gewaltmensch. Sie werden nicht ruhen, bis Sie eines Tags zusammenklappen. Daraus wird nichts. Dazu sind Sie zu gut. Ich habe andere Pläne mit Ihnen!” Er nickte dem Doktor mit bedeutungsvollem Wohlwollen zu und schwang sich in den Kraftwagen, so gewandt und sicher, daß der Chauffeur nur den Schlag schließen und der Oberwärter nur[S. 286] einen respektvollen Bückling anbringen konnte. „Lassen Sie sich bald mal wieder bei uns sehen, Doktor Perthes. Sie, Kollege Brunner, lädt man ja doch umsonst ein. Der Herbst ist so schön draußen auf dem Stift!” Hupfeld lüftete jetzt höflich die Mütze. „Los!”
Das Automobil fauchte einen Augenblick. Dann fuhr es unter hellem Signal leicht und glatt davon.
„Sie werden sehen, er macht diesen Perthes zu seinem ersten Assistenten!” tuschelte einer der Volontärärzte den Kollegen zu, während sie ins Haus zurücktraten.
Perthes, der ihnen mit Brunner folgte, konnte die halb bewundernde, halb neidische Bemerkung hören. Er zog ärgerlich die Stirn in Falten. Es war ihm unangenehm, daß womöglich auch Brunner, der der nächste nach Kronheim war, solche Mutmaßungen auffangen konnte. Im übrigen waren ihm die Gerüchte, die über ihn im Umlauf waren, nicht neu. Er galt für den erklärten Günstling von Exzellenz. Ebenso ausgemacht war es unter den Kollegen, daß er Hupfelds Schwiegersohn werden würde. Daß ihn der Geheime Rat bevorzugte, darüber konnte er sich ebensowenig täuschen wie die anderen. Was aber seine vermeintlich bevorstehende Verbindung mit Alice Hupfeld anging, so hatte er noch vor acht Tagen, am Vorabend der geplanten Verlobung mit Marga, eine dahin zielende Fopperei Markwaldts, seines früheren Institutsgenossen, auf dem Klinikerabend mit fast beleidigender Schärfe zurückgewiesen. Würde Markwaldt, diese gutmütige Klatschbase, die es sich nun einmal zur Aufgabe gemacht hatte, den wahren Charakter des mysteriösen Perthes „auszuwickeln”, seine Anzapfung heute zu wiederholen gewagt haben — er hätte bestenfalls ein Achselzucken[S. 287] oder ein spöttisches Zucken der Mundwinkel zur Antwort bekommen. Die Verachtung würde nicht einmal nur dem Frager gegolten haben; der Gefragte hätte sie auch auf sich selbst bezogen.
Ja, Max Perthes hatte begonnen, „umzuschalten” ...
Seine schroffe Abfertigung Markwaldts, so kurz vor dem beabsichtigten Besuch bei dem alten Herrn am Wenzelsberg, war ein letztes, ohnmächtiges Aufflackern gewesen. Damals war in ihm die Täuschung, er könnte wie ein Nachtwandler, nicht rechts, nicht links blickend, sich zu dem festen Ziel einer öffentlichen Verlobung mit Marga Richthoff durchzwingen, schon geschwunden. Mit jedem Schritt, den er der Entscheidung entgegentat, hatte er seine Kraft sich mindern gefühlt. Dafür trat ein, woran sein selbstherrlicher Stolz sich immer zu glauben geweigert hatte: seine Gedanken waren unermüdlich tätig, ihm die Äußerlichkeiten des Lebens herbeizuschleppen und vor ihm aufzutürmen, die aus dem Bund mit Marga sich ergeben mußten. Jene Kleinlichkeiten und Erbärmlichkeiten des Alltags, vor denen sie selbst in ihrem reiferen, weiblichen Feingefühl ihn gewarnt, und die er für jetzt und alle Zukunft gering geachtet hatte, gewannen eine unheimliche Gewalt über ihn. Was würden die Kollegen zu seiner Verlobung sagen? Was würde Alice für ein Gesicht ziehen? Wie mußte Exzellenz Hupfeld sie aufnehmen? Die Sticheleien, der Spott und Ärger, die Geringschätzung und Zurücksetzung, die kommen würden — wie winzige bösartige Insekten wimmelten sie herbei, quälten seine Einbildung, unterfraßen und untergruben seinen ohnehin schon krampfhaften Entschluß. Nichts, gar nichts war geschehen, wenn er seine Verlobung mit Marga durchgesetzt hatte! Dann[S. 288] begann ja erst der Kampf! Ein Kampf, der seinem Stolz, seiner Stellung als Mensch und Gelehrter Wunde um Wunde schlagen, ihn vielleicht für immer aus seiner Laufbahn drängen würde!
Und er, der sich der Meinung anderer gegenüber für so gleichgültig und unempfindlich hielt, bebte schon vor den Gebilden zurück, mit denen seine Phantasie auf ihn eindrang. Vergebens wiederholte er sich gegenüber dieser kläglichen Schwachheit, daß bei Marga das Höhere, Schönheit und Frieden, die Selbstreife und die Erfüllung seiner inneren Sehnsucht sein würde — ein Königreich gegenüber allem, was er an äußerlicher Wirklichkeit drangab. Das Königreich war nicht für ihn. Er hatte sich überschätzt. Er reichte da nicht hinauf! Und die Liebe, die ihn hätte emporheben müssen — sie war nur ersprungen, nicht erschritten und erlebt.
Der Schiffbruch, dessen Schrecken er am Abend nach dem unseligen Diner auf Nieburg geahnt — jetzt war er da. Die Welle, die ihn vom Strand, wo Marga ihn erwartete, zurückgerissen, trieb ihn vollends ab, rettungslos, unwiderstehlich, stromab in die Mittelmäßigkeit ...
Perthes litt unsäglich in den Stunden, die dem Absagebrief an Marga vorausgingen. Die Verachtung, der Ekel, den er gegen sich selber empfand, brachten ihn an den Rand der Verzweiflung. Wenn er es doch versuchte? Wenn er es darauf ankommen ließ, ob er, durch ein öffentliches Wort gebunden, nicht doch stärker war, als er meinte? Er ermaß, wie furchtbar er Marga treffen mußte. Ein Leid bis auf den Tod wollte er ihr antun, ihr, deren zartes, hingebendes Gemüt er kannte; ihr, die er sich gewissenlos, über ihre ängstlichen Bedenken weg, zu eigen gemacht![S. 289] Aber war es gewissenhafter, sie noch enger an sich zu ketten, um sie noch schlimmer zu enttäuschen und zu trügen? Wollte er nicht einmal so ehrenhaft sein, sie zu retten, solange noch ein Schimmer von Hoffnung war, es zu können?
Und er schrieb den Absagebrief.
Es war die zweite Niederlage, die Perthes innerhalb ein und desselben Jahres erlitt. Aber was war seine Kinderkrankheit der Liebe, die er im Frühjahr durchgemacht hatte, gegen das, was er jetzt erlebte? Damals fiel er bei der jugendlich unerfahrenen Jagd nach einer Sonnenwolke eines Tags aus seinen sieben Himmeln auf die nüchterne Erde. Die Verzweiflung, die jenem Sturz folgte, war heiß und zornig gewesen, eine echte Weltverzweiflung, wie sie mehr oder minder keinem Menschen von Temperament erspart bleibt. Die Verzweiflung aber, die jetzt sich seiner bemächtigte, diese grausame Selbstverzweiflung war kalt und verächtlich. Damals hatte er mit dem Gedanken an einen freiwilligen Tod gespielt; jetzt, männlicher geworden, trotz aller Unfertigkeit, war er der selbstzerstörenden Tat in Gedanken ferner, in Wirklichkeit näher. Doch der Rest von Lebensenergie, der in ihm war, gönnte ihm die Flucht aus dem Dasein nicht. Gerade in der Selbstverachtung fand er einen Stachel, der die Kraft weckte, weiterzuirren, um sich weiterzuentwickeln.
Warum sollte er der berechnende Streber nicht sein, wie ihn die Kollegen hinter den Erfolgen argwöhnten, die ihm bisher ohne sein Hinzutun in den Schoß gefallen waren? War es ihm versagt, das zu werden, was sein höheres Ich gewollt, so schob ihm dafür das Leben die Leiter[S. 290] der Karriere, diese goldene Himmelsleiter, so bequem wie möglich zurecht. Er brauchte nur seinen Fuß auf die Sprosse zu setzen. Die Leiter in der Kapelle auf Nieburg war vielleicht so gewissermaßen ihr Symbol gewesen. Und so anstrengend brauchte die Strebeleiter nicht zu sein, und war sie auch nicht. Er brauchte nur der Dutzendbruder, zu dem Natur und Geschick ihn bestimmten, mit Absicht und gutem Willen zu sein, so konnte es ihm nicht fehlen! Es lag ein dämonischer Reiz in der Abkehr von der Höhe zum Durchschnitt.
Was Perthes auch in seinem Aussehen so sehr herunterbrachte, waren viel mehr seine inneren Kämpfe als — wie Exzellenz Hupfeld vermutete — die klinische Überbürdung. Und er war töricht oder gleichgültig genug, die paar Freistunden, die ihm blieben, nicht zur Erholung zu benutzen. Spiel und Sport, die er im Sommer vernachlässigt hatte, wollte er systematisch forcieren. Er trat in den Ruderklub ein. Er interessierte sich mit Hilfe Markwaldts und Professor Hammanns, seines früheren Chefs, für Pferderennen und fuhr einen freien Sonntag mit ihnen nach Baden-Baden. Er zeigte sich, wann es nur irgend ging, bei Tennis und Hockey und erneuerte seinen Ruf als ausgezeichneter Spieler. Dort war es auch, wo er, anfänglich langsam und mit Überwindung, dann mit allem Nachdruck aus seiner Reserve gegen Alice Hupfeld heraustrat.
Mit Staunen sah Alice, die ihn nach dem Abenteuer im Kapellenturm kühl und schnippisch behandelte, wie seine Zurückhaltung in höfliche, später in eifrige Dienstbeflissenheit überging. Er konnte also doch Feuer fangen, dieser seltsame Mischling von Biedermann und Bandit,[S. 291] als den ihre nach pikanten Eroberungen lüsterne Phantasie ihn ansah. Sie triumphierte bei sich. Ihr Benehmen wurde in dem Grade spröder und süffisanter, als er sich um sie bemühte. Sie gefiel sich in immer neuen, launischen Einfällen, die seine Geduld auf die Probe stellen sollten. Das Radfahren hatte sie als unzeitgemäß und altmodisch endgültig aufgegeben. Seit vierzehn Tagen war sie passionierte Reiterin. Geschickt, wie sie in allen leiblichen Übungen war, lernte sie schnell und saß bald tadellos im Sattel. Sie arrangierte in der Universitätsreitbahn eine Quadrille. Professor Hammann und Cousine Hilla, die schon wieder zu Besuch da war, um bei Alice einen Bewunderungskursus durchzumachen, Perthes und sie gaben die Paare. Dann kamen Ausritte in die Ebene oder talaufwärts und in die Berge, bei denen ihre Verwegenheit die Partner zu Tollheiten jeder Art verleitete.
Perthes ließ sich weder durch ihre Launen noch durch ihre Spöttereien abschrecken. Mit höhnischer Verachtung unterdrückte er in sich jeden Ruf seiner Seele, der sich gegen dies gefährliche Spiel warnend erheben wollte. Es fehlte nicht an Anwandlungen von Schwermut. Mitten in der Nacht — er wußte nicht wie und warum — fand er sich einmal vor dem Haus am Wenzelsberg, wo er, des scharfen Oktoberwindes ungeachtet, nach einem Lichtschein in der Mansarde starrte. Waren es Marga und Elli, die da noch wachten? Wie hatte Marga den schweren Schlag, den er ihr versetzt, ertragen? Litt sie um ihn? War sie vielleicht krank? Der schneidende Wind beizte ihm die Augen feucht. Oder war es die Qual seines Herzens? Ein andermal war er, von einer jähen Regung überfallen, auf der Sägemühle abgestiegen und hatte sich in den herbstlich-öden[S. 292] Garten gesetzt. Als die Wirtsfrau kam und nach seinen Wünschen fragte, murmelte er unverständliche Worte und sprang auf und davon. Mit Geißelhieben jagte er sich und seine Sentimentalitäten heim. Und er überließ sich nach solchen Entgleisungen mit einer wahren Wildheit dem verführerischen Reiz, den Alice auf ihn ausübte. Bei ihr — ohne Zweifel bei ihr war das Rätsel, das er suchte, das sich ihm jeden Tag von neuem aufgab; das Ewig-Weibliche, wie es zu ihm paßte — ein Irrlicht, das aufglomm und erlosch und in der Ferne von neuem aufglomm, um ihn durch ein Leben des Erfolgs, der Äußerlichkeit und Mittelmäßigkeit hindurchzugaukeln ...
Es war Mitte November geworden.
Das Wintersemester hatte sogar für die medizinische Fakultät wieder begonnen, die doch allerorts eine Ehre dareinsetzt, das maliziöse Wort, die Vorlesungen seien eine unangenehme Unterbrechung der Universitätsferien, nicht Lügen zu strafen.
Exzellenz Hupfeld konnte sich noch nicht entschließen, Stift Nieburg mit seiner Stadtwohnung zu vertauschen. Der köstliche Spätherbst des Jahres war da draußen ob dem Flußtal, inmitten der laubbraunen und tannengrünen Bergzüge, zu schön. Zweimal täglich und öfter mußte das Automobil den Weg nach der Chirurgischen Klinik hin und zurück machen.
Professor Kronheim, der erste Assistent der Klinik und vertretende Chef, hatte seine Tätigkeit noch immer nicht wieder aufnehmen können. Die Nachrichten von der Riviera, wo er Genesung suchte, lauteten wenig hoffnungsvoll. Brunner und Perthes mit den Volontärärzten versahen nach wie vor die ganze Arbeit. Der Geheime[S. 293] Rat war auf die von ihm angedeutete Reorganisation nicht wieder zurückgekommen.
Eines Sonntags, als Perthes, der am Nachmittag freihatte, gegen drei Uhr in seine Wohnung hinaufsteigen wollte, trat ihm die an Sonntagen meist unsichtbare Hauswirtin, Fräulein Eschborn, mit einer Visitenkarte entgegen, die sie mit seltener Feierlichkeit zwischen ihren beiden Händen balancierte.
Gleichgültig nahm Perthes die Karte entgegen und ging, ohne einen Blick daraufzuwerfen, nach oben. Erst vor seiner Tür las er den Namen. Es stand da mit schöngeschnittenen Buchstaben groß und einfach: „Benno Hupfeld Wirklicher Geheimer Rat.”
Kein Zweifel: Exzellenz mußte ihm einen offiziellen Besuch zugedacht haben. Da die Ordinarien der Fakultät mit herkömmlicher Bequemlichkeit höchstens ihren verheirateten Assistenten die Aufwartung zu erwidern pflegten und ein Mann wie Hupfeld sich sogar unter seinen unmittelbaren Amtsgenossen so banaler Verpflichtungen mit einer liebenswürdigen Entschuldigung entheben durfte, zeugte diese Karte von einer außergewöhnlichen Artigkeit. Gleichwohl warf sie Perthes beim Eintritt in sein Zimmer aufs Geratewohl beiseite.
Nach einer kleinen Weile besann er sich eines Besseren.
Was war er doch noch immer für ein unvollkommener Schüler der Strebekunst!
Mit einer Feierlichkeit, die die von Fräulein Eschborn übertraf, nahm er die hohe Visitenkarte von dem Stuhl, auf den sie geflogen, und trug sie zwischen den beiden Mittelfingern nach seinem Schreibtisch. In der Mitte der Unterlage von rotem Löschpapier legte er sie mit einer[S. 294] Verbeugung nieder. Sie war ja doch, richtig gewürdigt, das erste nicht zu unterschätzende Dokument des Fortschritts, das seine neue Methode des bewußten Hochkletterns gezeitigt hatte. Von Rechts wegen hätte sie auf ihrem Ehrenplatz mit Lorbeer umrahmt werden müssen. Schade, daß er den nicht zur Hand hatte!
Am Montag, als Exzellenz Hupfeld sich zur üblichen pompösen Abfahrt aus der Klinik anschickte, trat Perthes mit vollendeter Höflichkeit an den Geheimen Rat heran. „Exzellenz hatten die außerordentliche Liebenswürdigkeit —”
„Ach ja. Ich wollte Sie gestern besuchen. Schade, daß ich Sie nicht antraf!”
„Das Bedauern ist ganz auf meiner Seite —”
„Ich wollte mit Ihnen eine Angelegenheit besprechen, die —” Hupfeld überlegte lächelnd. „Im übrigen, ich möchte das nicht aufschieben. Sie können sich mit mir ins Auto setzen. Es läßt sich da ungestört plaudern. Wollen Sie?” Die Frage wurde von einer jener herrischen Gebärden begleitet, die Hupfelds Liebenswürdigkeit eigentümlich machten.
Perthes erschrak unwillkürlich über den neuen Beweis von Wohlwollen. Die Volontärärzte auf der Treppe des Vestibüls machten lange Hälse. Doktor Brunner war diskret und höflich, aber mit ersichtlich langem Gesicht zurückgetreten.
„Sie brauchen nicht zu befürchten, daß ich Sie zu lange in Anspruch nehme,” fuhr Hupfeld, der dies Schwanken schmeichelhaft beurteilte, beruhigend fort. „Ich lasse Sie mit meinem Wagen zurückführen.”
Nun gab es keine Widerrede. Perthes faßte sich schnell.[S. 295] „Wenn Exzellenz einen Moment warten wollen?” Er deutete auf seinen Operationsmantel.
Der Geheime Rat nickte gütig.
Perthes lief nach dem Hause. Ein saurer Gang in der Sonne öffentlicher Gnade. Er kniff die Lippen zusammen und heftete die Augen geradeaus ins Leere, als er an den beiseitetretenden Volontären vorbeieilte. Im Nu kam er zurück, in Jackett und Hut. An den ironischen Mienen der jungen Kollegen las er ab, was sie von dieser Autounterredung hielten. Als er wieder ins Freie trat, meinte er hinter sich etwas flüstern zu hören wie: „Exzellenz Schwiegerpapa!” Die Wut trieb ihm das Blut in den Kopf. Doch schon schritt er an Brunner vorüber, der unglücklich dreinsah und an seinem militärischen Schnauzbart zu kauen schien.
Der Krankenwärter half ihm ins Automobil, in dem Exzellenz schon Platz genommen hatte. Er machte dabei einen Bückling, für den Perthes ihm ins Genick hätte hauen mögen.
Doch schon fuhren sie tutend davon.
Hupfeld zögerte nicht, seinem Fahrgast seine Absichten auseinanderzusetzen. Fürs erste freilich, solange sie noch innerhalb der Stadt fuhren, sah er sich durch häufige Grüße unterbrochen. Er pflegte alle mit ausgesuchter Höflichkeit zu erwidern, ob es sich um einen Universitätsdiener handelte oder um einen Geheimrat. Erst hinter der Brücke, am Ausgang der Neustadt, wo die Villenstraße allmählich in die Landstraße überging, kam er in medias res. Nachdem er die Aussichtslosigkeit betont, die das Befinden des armen Kronheim biete — er hatte neuerdings selbst sehr trübe Nachrichten aus Rapallo erhalten —, sprach er[S. 296] von der Notwendigkeit, die erste Assistentenstelle seiner Klinik einstweilen neu zu besetzen.
„Die Angelegenheit ist durch die Persönlichkeit des guten Brunner, der eigentlich der nächste Anwärter ist, kompliziert,” erklärte der Geheime Rat fortfahrend. „Um es von vornherein zu sagen: er ist nicht der Mann, den ich brauche.”
„Ich habe ihn als einen sehr gediegenen, pflichteifrigen Kollegen schätzen gelernt,” schob Perthes ein, wobei er sich selbst über die neugewonnene Fähigkeit wunderte, sich durch billige Komplimente für andere ins beste Licht zu setzen. Perfid war er also auch schon.
„Zugegeben, lieber Perthes!” stimmte Hupfeld in das wohlfeile Lob ein. „Zugegeben! Aber es fehlt ihm jeder Zug ins Große. Er kann nichts selber in die Hand nehmen, wenn ich einmal nicht zur Stelle bin. Der leitende Arzt, der mich vertreten soll, muß etwas vom Herrscher an sich haben. Weitblick, eigene Gesichtspunkte, Vielseitigkeit!” Exzellenz gab jedes dieser ihn selbst verherrlichenden Prädikate mit monumentaler Rhetorik von sich. „Und dann — was die Hauptsache ist —, er muß das Zeug zu einem erstklassigen Operateur haben. Das hat der gute Brunner bei aller Gewissenhaftigkeit und relativen Geschicklichkeit nicht. Das haben — senza complimenti — Sie, mein lieber junger Kollege!”
Perthes wollte mit einer Schmeichelei für die Ganzgroßen abwehren. Aber dazu reichte seine Gewandtheit noch nicht. Die Worte blieben ihm im Hals stecken. Er mußte sie durch Gebärden ersetzen.
„Doch, doch!” versicherte huldvoll der Geheimrat, der ihn auch so verstand. „Machen wir uns nichts vor.[S. 297] In so einschneidenden Fragen pflege ich mit rücksichtsloser Objektivität vorzugehen. Bleiben wir also bei sicheren Tatsachen. Die kurze Zeit, in der Sie bei mir arbeiten, hat mich von Ihrer außerordentlichen Befähigung überzeugt. Sie wären mein Mann! Sie werden es sein —”
„Aber, Exzellenz, ich bitte —”
„Hören Sie mir ruhig zu, lieber Freund!” Hupfeld legte die überweiche, berühmte Hand auf Perthes' Arm. „Ich habe alles erwogen. Sie sind sehr jung. Brunner darf nicht vor den Kopf gestoßen werden. Es heißt diplomatisch zu Werke gehen.” Ein schlaues, geistreiches Lächeln kräuselte seinen vieldeutigen, glatten Mund. Er entwickelte mit rednerischer Selbstgefälligkeit sein Projekt. Er wollte es übernehmen, Brunner von seinen guten Absichten zu überzeugen. Erstlich sollte dieser als der ältere durch seine Fürsprache im Ministerium — es genügte da ein Wink nach der Residenz — schon in den nächsten Wochen den Professorentitel erhalten. Ferner wollte ihm Hupfeld die bestimmte Aussicht machen, daß er binnen Jahresfrist einen Ruf als Außerordentlicher oder Leiter eines städtischen Krankenhauses nach auswärts erhielte. Dafür konnte Hupfeld bei seinen Verbindungen garantieren. Demgegenüber mußte Brunner einsehen, daß Exzellenz sich den jüngeren Perthes für die Stellung eines ersten Assistenten ganz speziell heranbilden wollte, und mußte ihm schon jetzt die nominelle Vertretung dieses Postens überlassen.
So weit war der Geheime Rat in seinen Ausführungen gekommen, als das Automobil sein sausendes Tempo verlangsamte und zum Stift hinauffuhr.
Die Unterredung konnte an dem Punkt, an dem sie[S. 298] angelangt war, nicht abgebrochen werden. Es blieb Perthes nichts anderes übrig, als die Einladung anzunehmen, mit Hupfeld zu frühstücken. Er griff sich an den Kopf, als er die Räume wieder betrat, die er vor einigen Wochen mit so großem Widerwillen kennen gelernt hatte. Die erste Viertelstunde, während er neben seinem Chef in dem weiträumigen Saal mit den gewaltigen Schränken, den seriösen Ahnenbildern, der neu angelegten, kostbar-bunten Porzellansammlung saß, meinte er einen schweren Traum zu wiederholen. Dann zwang er sein bedrücktes Herz mit eisiger Schroffheit zur Ruhe. Es ging vortrefflich. Bei einer Flasche Mosel und ausgesucht zarten Zwergbeefsteaks stellte Hupfeld die Bedingungen auf, unter denen er seinen künftigen ersten Assistenten verpflichten wollte. Perthes sollte sich innerhalb der nächsten vier Jahre nicht habilitieren dürfen, um ganz zu seiner, Hupfelds, Verfügung zu sein; sich auch dann noch ohne seine Zustimmung weder nach außerhalb bewerben noch einen etwaigen Ruf annehmen dürfen. Die Anstellung sollte erst nach einiger Zeit definitiv werden. Wann und mit welchem Gehalt, blieb späterer Bestimmung vorbehalten. Der Geheime Rat verschwieg, daß er bei dieser Gelegenheit einige dem Minister genehme, ihm zum Lob gereichende Ersparnisse zu machen gedachte. Dagegen ließ er Perthes nicht im Zweifel, daß er ihm die zukünftige Karriere innerhalb der hiesigen Universität gewährleisten wollte.
Perthes sah durch diese glänzenden Anerbietungen jede Erwartung weit übertroffen. Gleichwohl zwang er sich dazu, seiner Befriedigung keinen allzu begeisterten Ausdruck zu geben. Der Dämon, von dem er sich in seiner Selbstverachtung beherrschen ließ, riet ihm, sich zu sparen[S. 299] und seine streberischen Pläne womöglich als Ganzes zur Reife zu bringen. Es lockte ihn, seine Fähigkeit, emporzukommen, gleich durch ein Meisterstück zu erproben.
„Exzellenz sehen mich gegenüber solchen Beweisen des Vertrauens verwirrt —”
„Es sollte mich freuen,” versicherte Hupfeld mit großartiger Loyalität, „wenn es mir mit meinen Vorschlägen gelungen wäre, Ihre Wünsche mit den meinen in Einklang zu bringen.”
„Meine Wünsche wagten sich so hoch nicht, Exzellenz. Gleichwohl werden Sie es billigen, wenn ich mir angesichts so weitausschauender Pläne einige Tage erbitte, um sie durchzudenken.”
Hupfeld sah den Doktor ziemlich erstaunt, beinahe mißtrauisch an. Diesmal war ihm ein Zaudern unverständlich. „Nun ja —” meinte er gedehnt. „Ich gebe Ihnen natürlich Bedenkzeit. Nur —”
„Exzellenz dürfen überzeugt sein, daß ich dies Zugeständnis nicht mißbrauche. In wenigen Tagen, vielleicht schon morgen —”
„Bringen Sie mir eine zustimmende Antwort,” vollendete der Geheime Rat mit leichter Schärfe. Er hatte sich erhoben und bot Perthes verbindlich die Hand zum Abschied. Als er allein war, schüttelte er den Kopf: „Bei alledem — ein merkwürdiger junger Mann!”
Er sollte diese Merkwürdigkeit bald besser verstehen, als er ahnte. —
Nach milden, sonnigen Tagen brachte der November seine gewohnten brausenden, kühlenden Stürme, die im Wirbel das rote und braune Laub aus den Baumkronen rissen.
[S. 300] Gerade das unstete, tosende Wetter lockte die Abenteuerlust von Fräulein Exzellenz. Sie schlug für einen der nächsten Nachmittage den Teilnehmern der Reitquadrille einen Fernritt, und zwar einen tüchtigen Fernritt vor. Bei trügerischem Sonnenschein brach man auf. Perthes hatte sich mit Mühe freigemacht. Er sprengte mit Alice voran. Sie sah im langen, schwarzen Reitkleid gut aus. Es ließ ihre biegsamen Formen zu herausfordernder Geltung kommen. Der flache, ebenrandige Hut saß keck über den rotblonden Haaren. Professor Hammann und Cousine Hilla folgten in mäßigem Tempo und unter bedenklichen Protesten. Man hatte auch noch kaum die Sägemühle hinter sich, als der Wind grimmig einsetzte, den Himmel voller Wolken fegte und den Reitern brausenden Widerpart hielt. Als Perthes und seine Begleiterin bei einer Wegbiegung, am Eingang in ein leidlich windstilles Gehölz, sich umblickten, war von Hammann und Fräulein Hilla keine Spur mehr zu sehen.
„Wollen wir auch das Hasenpanier ergreifen?” fragte Alice mit einem spöttischen Blitzen der grünlich schimmernden Augen, während sie die losgerissenen Haarsträhnen aus den Wangen strich.
Statt der Antwort gab Perthes seinem Pferd die Sporen.
Mit klingendem Lachen jagte Alice ihm nach, bis sie wieder an seiner Seite war. Sie versetzte ihm zur Strafe einen leichten Hieb mit der Gerte auf die Hand, die die Zügel führte.
Hinter dem Wald ging es mit aufeinandergepreßten Lippen und zugekniffenen Augen gegen den Sturm. Kurz vor dem ersten Dorf schnob ein feiner, dichter[S. 301] Regenschauer aus den Wolken und durchnäßte Reiter und Roß.
Nun mußte man doch wohl oder übel im Wirtshaus haltmachen.
Alice fand es apart und reizend, in dem sauberen Herrschaftszimmerchen, in dem ein Ofenfeuer grüßend leuchtete, Tete-a-tete zu „mahlzeiten”. Man sah durchs Fenster hinaus auf den windgepeitschten Fluß, die regenwolkenverhangenen Berge. Fast wie auf der Sägemühle, dachte Perthes, als er zufällig hinausblickte. Um so besser, setzte er höhnisch hinzu. Er überließ sich dem willkommenen Reiz der Situation. Die nassen Kleider erfüllten unter der behaglichen Wärme die Stube mit ihrem Dunst. Es war ziemlich dunkel. Aus der Ofenecke, wo Alice sich eingerichtet hatte, sah man nur ihre Augen mit seltsamer Intensität aufglänzen.
Nachher, am Tisch, gab sie sich allerliebst. Sie war etwas aufgeregt und suchte diesen Zustand, der ihr kleinlich schien, durch die ausgelassene Freiheit ihres Benehmens zu verdecken. Sie gab sich die Rolle der Demimondaine, die sie augenwerfend und trällernd trefflich zu mimen verstand. Perthes sollte dazu den Galantuomo spielen.
Er ging bereitwillig darauf ein. Aber in einem Moment leidenschaftlich vorgetragener Liebeserklärungen, die sie mit koketter Kälte über sich ergehen ließ, vergaß er das Spiel. Er riß Alice in seine Arme und bedeckte sie mit Küssen.
Als er sie wieder freigab, war sie ernüchtert und erschrocken. „Was fällt Ihnen ein!” stammelte sie verlegen.
„Was mir schon längst hätte einfallen müssen!” gab er siegesgewiß zurück.
Schmollend und zürnend trat sie von ihm weg. Sie[S. 302] stellte sich ans Fenster und stand dort geraume Zeit, von ihm abgekehrt.
Er setzte sich mit scheinbarer Gelassenheit in die Ecke am Ofen und stocherte mit der Zange im Feuer.
Plötzlich wandte sie sich um. Mit ihrem drolligsten Spitzbubengesicht, halb spöttisch, halb ärgerlich, sah sie ihn an. „Nu — werden wir uns wohl verloben müssen. Wie abgeschmackt Sie sind!” meinte sie halblaut.
Er war mit zwei Schritten an ihrer Seite. Sie musterten sich mit einem tiefen, brennenden Blick. Dann küßten sie sich in einer neuen, wilden Umarmung. Und verlobten sich, trotz aller Abgeschmacktheit ...
Als Perthes sich am folgenden Tag in der Hupfeldschen Stadtwohnung einstellte, um Exzellenz Hupfeld seine Zusage für die erste Assistentenstelle zu bringen, empfing ihn der Geheime Rat sehr gemessen.
„Sie haben ja Ihre Bedenkzeit sehr eigenartig benutzt, Herr Doktor! Nun darf ich wohl um Bedenkzeit bitten?” lautete die strenge Einleitung.
Aber der hohe Herr konnte sich nicht lange auf so eisiger Höhe halten. Er wurde väterlich gerührt. Und lächelte bald wie ein gütiger Schöpfer über die kleinen Unarten und Torheiten seiner Geschöpfe.
Im Salon warteten Frau Hupfeld mit Alice und Cousine Hilla. Bei der Tür stand der Diener Karl. Diesmal nicht, um Gewittermeldungen vorzutragen, sondern um auf einen Wink die Sektkelche zu reichen. Schade, daß Leutnant Moritz fehlte.
Man feierte Verlobung im Familienkreise. Vorverlobung.
Es war stilvoller und großartiger, als es je im Haus am Wenzelsberg hätte werden können ...
Schon seit über vierzehn Tagen hatte Vater Richthoff seine Vorlesungen wieder aufgenommen. Zwischen drei und vier Uhr des Nachmittags schallte wieder häufig und hell die Klingel durchs Haus: nacheinander kamen und gingen die Hörer, junge Semester mit bunten Mützen, Bier- und Milchgesichter, alte Semester wie Oberlehrer Trabner mit der Glatze und der Stahlbrille, den Gummimanschetten und dem Trikot-Stehumlegekragen, „Flanellstorch” genannt.
Aber die „Bande” war nicht wie sonst auf dem Posten über der Treppe, um die Alten zu registrieren und die Neuen zu etikettieren. Höchstens daß Elli mal neugierig über das Geländer lugte. Dann war es nur, weil Wilkens, der Faulpelz, sich noch immer nicht hatte einschreiben lassen. Kurz vor Semesteranfang hatte er, um sich, wußte der Himmel von was, zu „erholen”, noch eine verheiratete Schwester in Magdeburg besuchen müssen und war noch nicht wieder zurückgekehrt. Nur Ansichtskarten meldeten der entrüsteten Elli, daß es ihm wohl ergehe.
Das grausame Leid, das Marga mitten in ihren frohen, bräutlichen Träumen heimgesucht hatte, lastete auf allem und allen. Nicht zuletzt auf dem alten Herrn. So fromm und artig und märchenhaft still war es in zwanzig Jahren um ihn her nicht zugegangen. Wenn er hinter dem Schreibtisch saß und kritzelte, konnte er sicher sein, daß kein störender Laut seine römischen Kaiser in ihrer Würde bedrohen, ihn aus der vornehmen Vertraulichkeit ihrer geisterhaften Gegenwart aufscheuchen würde. Aber trotzdem — oder gerade deshalb? — warteten diese oft vergeblich auf die[S. 304] Zwiesprache mit dem Meister, der sie rief. Kein zürnendes Murren, keine feurige Apostrophe drang aus dem verqualmten Winkel. Statt dessen hatte der alte Herr mehr als einmal den Gänsekiel nicht mehr in der Hand, sondern den grauen, krausbärtigen Kopf vergrämt aufgestützt, und lauschte hinaus in die unheimliche Ruhe seines Hauses. Wenn doch mal eine Tür unversehens ins Schloß geknallt wäre! Wenn doch ein nicht mehr zu bändigendes, junges Mädchenlachen aus der Dachstube herunter- oder vom Erdgeschoß, aus den Wohnzimmern heraufgekollert wäre, daß er empört hätte dazwischenfahren können! Wieviel besser wäre das seinen Cäsaren bekommen. Der erste Halbband der Kaisergeschichte war vor vierzehn Tagen erschienen. Schon kamen begeisterte Briefe von entfernten Hochschulkollegen und früheren Schülern. Vater Richthoff lächelte höchstens über die guten Vorzeichen. Jetzt, wo er den gerechtfertigten und verdienten Lohn einer Lebensarbeit einheimsen sollte, blieb die rechte Freude aus.
Richthoffs Freunde: Wilmanns, Borngräber, die Kegelbrüder und die Fakultätsgenossen — alle waren bestürzt und schlugen die Hände zusammen über das müde, verdrossene, teilnahmlose Wesen des alten Herrn. Er war ja nicht mehr zu kennen! Hofrat Geismar zerbrach sich vergeblich den Kopf, wie es möglich war, daß nach dem frischen, verheißungsvollen Abschied in Bad Kreuth jede Nachkur daheim ausblieb. Wilmanns, der mit seiner Familie Thüringen unsicher gemacht hatte, schimpfte vergeblich auf das teure Schwarzburg, wo ihm die lärmende Holzindustrie das Leben verbittert hatte; lobte umsonst das liebliche Ilmenau mit Engelszungen und erzählte die kühnsten Abenteuer mit lauter Beredsamkeit. Borngräber,[S. 305] der „Mädchenjäger”, wie ihn Papa Wilmanns hartnäckig benamste, rollte ohne Erfolg die verwundert-treuherzigen Augen und jammerte, daß ihm der Wind drei Hüte in die Ostsee geführt habe, statt, was doch sein Versöhnliches gehabt hätte, in ein klassisches oder orientalisches Meer. Richthoff hörte nur mit halbem Ohr zu und schob seine Kugel so flau, als wollte er ja den Kegeln nicht zu nahetreten.
Und Marga? Sie, von der der Kummer ausgegangen war, der das Haus am Wenzelsberg drückte und freudlos machte?
Es gibt einen Schmerz, der, ohne laut und heftig zu sein, sich doch wenigstens in Zeichen des inneren Kampfes verrät: nicht Tränen, aber ihre Spuren, nicht das harte Aufbäumen, aber das wehe, zitternde Zurückweichen und Wegwenden zeugen dafür, daß ein Lebendiges, wenn auch noch so schwach und versteckt, sich wehrt gegen das Tötende, auch im Unterliegen den Widerstand wahrt und in der Gegenbewegung sich erhält. Wenn Marga diesen Schmerz gezeigt hätte! Man hätte ihn, so leise er sich regte und rührte, zu lindern und zu heilen suchen können. Aber in ihrem Schmerz war kein Kampf, kein Widerstand, keine Bewegung. Von dem Augenblick an, wo sie aus ihrer tiefen Ohnmacht aufgewacht war, schien jeder Wille in ihr gebrochen zu sein. Sie konnte nicht weinen. Ihre Züge blieben leblos: mitunter hatten sie den Ausdruck einer leeren Maske, die in unbewußter Angst und Hilflosigkeit erstarrt ist. Ihre Seele schien nicht mit aufgewacht zu sein aus der Ohnmacht des Körpers. Ihr Geist war klar, beinahe nüchtern klar; sie wußte, was vorgefallen war, und sprach selbst mit matter, klangloser Stimme[S. 306] davon. Sie hörte auch zu, wenn der alte Herr, alle Barschheit und Zurückhaltung in Liebe und Mitgefühl vergessend, weich und ernst mit ihr redete; wenn Elli, Tränen in den sonst strahlenden Augen, sie ermutigen wollte und Käthe herzliche, ungezierte Worte des Verstehens fand. Aber sie blieb empfindungslos. Das Gefühl, das man ihr entgegenbrachte, klang nicht zurück. Alle die reichen und tiefen Kräfte des Gemüts waren wie ausgelöscht. So ausgelöscht, daß man zuweilen hätte glauben können, sie litte nicht einmal. Und doch — oder gerade deshalb — strömte eine Traurigkeit von ihr aus, so unsagbar, so über alles Trösten und Mitleiden, daß sie jeden ergriff und niederdrückte und das Haus mit einer stummen Klage erfüllte. Wie ein reifes Kornfeld, das unter einem Hagelschauer sich in eine tote Wüste verwandelt hat, so war Margas große Stille zur großen Leere geworden.
Die erste Sorge galt natürlich ihrer Gesundheit. Der Geheimrat wollte den Arzt rufen lassen. Auch Käthe drang darauf. Elli wurde beauftragt, Marga selbst zu fragen, um sie nicht zu erschrecken. Sie zeigte sich völlig gleichgültig und meinte nur, sie wüßte nicht, was sie einem Arzt zu sagen hätte. Die Ohnmacht schien auch keine weiteren körperlichen Folgen zu haben. Ihr Aussehen veränderte sich kaum. Sie klagte über nichts. Man war übereingekommen, daß das Leid, das sie getroffen, unter keinen Umständen auch nur andeutungsweise nach außen dringen und zu irgendwelchen Gerüchten Anlaß geben dürfe. Diese Schonung, die einzige, der auch die äußeren Umstände ihres Unglücks entgegenkamen, mußte um jeden Preis gewahrt werden. Das war der Grund, weshalb man es vorläufig doch unterließ, den Arzt zuzuziehen.
[S. 307] Wochen vergingen, ohne daß Margas Zustand sich veränderte. Nach wie vor war sie äußerlich gesund, nach wie vor dämmerte ihre Seele pflanzenhaft dahin.
Der alte Herr sah mit Besorgnis, wie diese schleichende Qual die Stimmung im Haus mehr und mehr verdüsterte. Sie zehrte an ihm und seiner Arbeitskraft, an Käthes und Ellis Frische und Frohmut. Wie schwüle Sommertage, die grau und lastend ohne die reinigende Entladung eines Gewitters sich ablösen, schlichen die Tage einer um den anderen hin, und die Menschen im Haus schlichen mit ihnen. So konnte es nicht fortgehen! Es mußte etwas geschehen. Ein Entschluß mußte gefaßt werden, der irgendwie wieder Luft und Licht in die stickige Atmosphäre brachte.
Ohne Wissen der Mädels ging der Geheimrat vor.
Er hatte in Pommern, weit droben an der Küste, einen Stiefbruder. Man schrieb sich alle Jubeljahr, sah sich noch seltener. Für Käthe, Marga und Elli spielte der Onkel Gutsbesitzer fast eine mystische Rolle. Vor Jahr und Tag war er einmal an ihrem Kinderhimmel aufgetaucht: ein jovialer, untersetzter Mann mit ein paar seelenguten Augen in seinem wetterharten, braunroten Gesicht. Keine entfernte Ähnlichkeit mit Vater Richthoff. Seine Frau oder gar die Cousinen — es konnten sechs oder mehr sein, denn Onkel Thiele schickte, wenn nichts anderes, so doch Jahre hindurch regelmäßig eine fröhliche Geburtsanzeige — waren völlig sagenhaft.
Dorthin richtete der alte Herr, einer plötzlichen Eingebung folgend, seine Hoffnungen und bald darauf ein Schreiben, so brüderlich und leserlich, als es ihm nur möglich war. Zum Schluß fragte er unumwunden an,[S. 308] ob man seine zwei Jüngsten für ein paar Wochen auf Güstow brauchen könnte. Der Geheimrat mußte keine acht Tage warten, bis die Antwort kam, geschrieben von einer guten, ehrlichen preußischen Landwirtsklaue. Es wäre zwar im Sommer schöner in Güstow. Dafür hätte man aber jetzt, nach guter Ernte, mehr Zeit und mehr Geld. Auch versprächen die Jagden allerhand Gutes. Kurz: die beiden Jüngsten wären willkommen. Seine Frau und seine Döchtings wären schon jetzt „doll vor Vergnügen” über den Besuch der Richthoffschen Vettern. Das war ein kleines Mißverständnis: Onkel Thiele hatte sich im Lauf der Zeit eingebildet, sein Stiefbruder müsse naturnotwendig ebenso viele Jungens haben, wie er Mädels hatte. Doch das ließ sich aufklären. Die Hauptsache war: Marga und Elli wurden erwartet.
Der Geheimrat atmete auf. Er erhielt Onkel Thieles Brief zum Frühstück. Als er ihn zu Ende gelesen, sah er seine Mädels der Reihe nach an. Zum erstenmal brachte er es fertig, ihren trübseligen Mienen mit einer halbwegs heiteren Verschmitztheit zu begegnen. „Wißt ihr, wer Onkel Bernhard ist?” forschte er in der Runde.
„Onkel Bernhard?” Elli schüttelte den Kopf.
„Meinst du Onkel Thiele in Pommern?” fragte Käthe nach bedächtigem Schweigen.
„Allerdings,” nickte Vater Richthoff, „Onkel Bernhard Thiele, Gutsbesitzer auf Güstow, Kreis Regenwalde in Pommern.”
„Ach, der! Dein Stiefbruder! Was ist's mit ihm?” Elli war glücklich, daß das öde Einerlei der Mahlzeiten durch einen neuen Unterhaltungsstoff sich für einen Augenblick aufhellte. Das leidlich muntere, väterliche Gesicht[S. 309] entzündete leise ihre alte, ausgelassene Laune. „Hat er wieder Familienzuwachs bekommen?”
„Das gerade nicht, Naseweis!” erwiderte der Geheimrat. „Aber er lädt euch ein.”
„Lädt uns ein? Nach Pommern? Auf sein Gut? Wen — uns? Für wann?” Es war so verlockend für Elli, einmal wieder drei, vier Fragen auf einmal losfeuern zu können.
„Onkel Thiele lädt dich und Marga ein, ihn jetzt für einige Wochen auf Güstow zu besuchen!” erklärte der alte Herr klar und bündig.
Elli blieb der Bissen im Hals stecken. Käthe riß die braunen Augen ungläubig auf. Sie wollte schon den Mund öffnen, als ein Blick Vater Richthoffs ihr die richtige Fährte gab. Sie nickte verständnisvoll. Auch Elli begriff schnell, daß hier etwas Gutes im Werk sei. Marga selbst saß teilnahmlos dabei, als hätte sie nichts gehört und verstanden.
„Lest mal selbst!” Richthoff reichte Onkel Thieles Brief Käthe über den Kaffeetisch. Elli beugte sich voll Neugier mit darüber. Zu zweien entzifferten sie die massiven Zeilen.
„Na, mein Mädchen, wie denkst du über die Einladung?” wandte sich der Geheimrat inzwischen an Marga, seine Hand zärtlich auf die ihre legend.
Margas Augen kehrten aus der leeren Weite, in der sie erstarrt waren, langsam und fragend zurück. „Über die Einladung?” wiederholte sie. „Ach so — ihr sprecht von Thieles in Pommern. Wen hat er denn eingeladen?”
„Aufmerksamkeit schlecht!” scherzte der alte Herr. Er erklärte ihr nochmals ausführlich, um was es sich[S. 310] handelte. „Ich möchte, daß ihr, du und Elli, den Thieles die Freude macht!” setzte er aufmunternd hinzu.
„Denk' mal an, Margakind! Nein, das ist zum Totschießen!” Elli lachte so laut und herzlich, wie es seit Wochen im Haus am Wenzelsberg nicht erhört war. „Die halten uns für zwei Jungens! Für zwei Vettern!”
„Ja — den Irrtum muß ich Onkel Bernhard noch nehmen. Die Enttäuschung könnte zu groß sein,” bemerkte Vater Richthoff vergnügt.
„Aber nein! Gerade nicht! Das darfst du keinesfalls, Papa!” rief Elli. „Malt euch mal aus — paß auf, Margakind! — Die stehen auf ihrem Bahnhof, so ihre zehn Köpfe hoch: Onkel, Tante, acht, neun Mädels — alle blond wie Hafer und dick und rot wie Rosenäpfel! Der Zug, so'n rechtes Bimmelbähnchen — Blumenpflücken während der Fahrt verboten! —, braust heran. Sie recken ihre Hälse. Sie suchen die Wagen ab. Wo zum Kuckuck sind die Richthoffschen Jungens?! Und der Zug fährt wieder ab. Auf dem Bahnsteig stehen nur zwei Mädels. Marga und ich! Und empfehlen sich zur geneigten Ansicht! Denkt euch, die Gesichter!” Elli schüttelte sich vor Wonne. Auch der alte Herr schmunzelte, und Käthe lächelte über Ellis blühende Phantasie. Nur Marga rührte sich nicht. Ellis Lustigkeit reichte nicht an ihre verschollene Seele.
„Und wann sollten wir denn dorthin kommen?” fragte sie schleppend, ohne daß ihre Stimme ein näheres Interesse verriet.
„Sobald ihr wollt!” erklärte Richthoff. „Die Jahreszeit ist ja nicht die rechte. Ihr müßt euch für den norddeutschen Winter einrichten. Da oben ist's kalt. Gerade gut, um sich mal tüchtig auszulüften. Das wird dir guttun, Marga![S. 311] Andere Menschen, anderes Leben. Ein bißchen Zerstreuung — verstehst du, Kind?” Er beugte sich zu ihr vor. Nur behutsam wollte er an die Absicht rühren, die er mit dieser Reise für sie verband. Das übrige setzte die Vertraulichkeit hinzu, mit der er ihr auf den Arm klopfte. „Also ausgemacht! Ihr reist je eher, je lieber!” Er erhob sich erleichtert und ging mit seiner Zeitung nach oben. Ein Wink verständigte Käthe und Elli, Marga zuzureden und etwaige Bedenken zu zerstreuen.
Zu jeder anderen Zeit hätte die unerwartete Reiseaussicht in weite Ferne, die verblüffende Großmut des sonst so gestrengen und in pecuniis genauen Papa Richthoff unter der Bande wie eine Bombe eingeschlagen. Dermalen war die Freude natürlich gedämpft, die Verwunderung zurückgedrängt. Aber es war doch, als hätte man in dem verdumpften Haus irgendwo ein Fenster aufgerissen: ein frischer Luftzug, ein schräger, dünner Sonnenstrahl schlüpfte herein.
Käthe fand etwas von ihrer altklugen Weisheit wieder. Was sie über Margas von ihr vorausgesagtes Unglück empfand, eine wenn auch schmerzliche Genugtuung, hatte sie taktvoll nur ihrem Tagebuch anvertraut. Dafür erging sie sich jetzt in trefflichen Aussprüchen über die Wunder, die eine Ortsveränderung an einem beschwerten Menschenherzen immer tue, und sorgte nebenher mütterlich für die beiden Kleinen, denen sie die Reise nach Norden ehrlich gönnte.
Elli aber regte und tummelte sich in dem lang entbehrten, schmächtigen Sonnenschein wie ein Kätzchen, das sich auf gut Wetter putzt. In einem allmählichen Crescendo, das ihrem Temperament nicht ganz leicht wurde, aber[S. 312] Margas Zustand berücksichtigte, ließ sie ihrem Optimismus die Zügel schießen. Ihre umtriebige Natur sah sich jetzt wieder einer handgreiflichen Aufgabe gegenüber: sie konnte nun mal Marga in ihre alleinige Behandlung nehmen. Eine richtige Kur hatte sie mit ihr vor. Wie man dürres, vertrocknetes Land fürs erste tüchtig unter Wasser setzt, so wollte sie Marga unter Freude setzen. Sollte es nötig sein: sie wollte nicht nur das Rittergut Güstow mit Onkel und Tante Thiele samt den unzählbaren Cousinen, sondern ganz Preußisch-Pommern auf den Kopf stellen. Mit den Vorbereitungen zu diesen Großtaten begann sie sachte schon jetzt. Sie ließ Marga keinen Augenblick allein. Unausgesetzt umflatterte sie sie, unterhaltsam und wachsam zugleich. Ihre Plappermaschine, durch die Kümmernisse der letzten Wochen dem Verrosten nahe, kam neugeölt in neuen Gang. Außer dem Gutsleben, das ihre Phantasie mit Jagdabenteuern, Segelfahrten an der nahen Küste, Überlandpartien in Kutsche und Schlitten zu märchenhaften Tanzbällen ausschmückte, war es besonders Berlin, die Reichshauptstadt, die sie vor Marga in feenhafter Glorie aufsteigen ließ. Sie mußten nämlich in Berlin Station machen. An einem Tag war Gut Güstow nicht zu gewinnen. Papa hatte an einen befreundeten Kollegen geschrieben, wo sie einquartiert werden konnten. Aus dem einen Rasttag ließ Elli drei bis vier werden. Man konnte doch so 'ne Gelegenheit, mal was Rechtes zu sehen, nicht ungenutzt vorbeilassen. Das mußte auch Papa einsehen. Nicht schon jetzt, aber im geeigneten Moment, wenn man ihm eine entzückte Karte schrieb, die alles erklärte. Und nach Güstow depeschierte man — Elli depeschierte in der Einbildung öfter[S. 313] als alle europäischen Kabinette — und bat um Frist. Dann — oh, es war unbeschreiblich, in welchen Strudel von Genüssen man sich dann stürzte! Stürzte mit der grausigen Andacht, die die Weltstadt dem jungen, unverdorbenen Mädchengemüt Ellis einflößte — schon aus der Ferne. Theatervorstellungen, philharmonische Konzerte, Zoologischer Garten, Kaiser sehen, Warenhausbummel, Unter den Linden, Friedrichstraße, Potsdam, Sanssouci, Hochbahn und Untergrundbahn, das drehte sich und prasselte wie ebenso viele Feuerräder durch die Luft.
Mit den Erfolgen ihrer Lustkur mußte sich Elli allerdings einstweilen sehr bescheiden. Im Anfang verhielt sich Marga vollständig gleichgültig. Wie eine blasse Wand, auf die man die buntesten Bilder der Wunderlaterne geworfen hat, war sie nachher so stumm und leblos wie vorher. Sie half, soweit es in ihren Kräften stand, beim Einpacken. Mechanisch erwiderte sie die Fragen, deren Antworten man ihr in den Mund legte. Sie war mit keinem Gefühl bei dieser Reise. Es war nicht einmal sicher, ob sie hörte, was Elli unermüdlich deklamierte. Trotzdem stellte diese mit der Zeit winzige Triumphe ihrer Methode fest. Wenn es nur ein Kopfschütteln oder Kopfnicken war, das sie erzielte, verzeichnete sie schon einen Fortschritt. Und als es ihr gar gelang, den Tag vor der Abreise durch eine bis dahin nicht dagewesene Brillantvorführung von Berliner Genüssen Marga ein Lächeln — nicht zu entlocken, sondern schon mehr zu entreißen, lief sie erst in die Küche, wo gerade Käthe eine süße Speise bereitete, und dann stürmte sie, alles Herkommen außer acht lassend, in Vater Richthoffs Arbeitszimmer, so blitzgewaltig, daß[S. 314] der alte Herr entsetzt von seiner Kaisergeschichte in die Höhe fuhr.
„Marga hat gelächelt! Marga hat richtig gelächelt! Beinahe gelacht!” verkündete sie schallend.
Ehe der Geheimrat sich fassen und sie ausschelten konnte, war sie wie die Windsbraut wieder draußen. Er schüttelte verwirrt den Kopf. Das Ereignis stand in keiner Beziehung und keinem Größenverhältnis zu den Germanenkämpfen, die das römische Weltreich erschütterten. Aber bemerkenswert war es schließlich doch. Sehr sogar. Und der alte Herr lächelte hinterdrein auch.
Am Nachmittag desselben letzten Tages vor der Berlin-Güstower Novemberreise trat eine kurze Ebbe ein. Es war gepackt. Die allernötigsten Besprechungen konnten noch beim Abendbrot erfolgen. Zwischendrin mußte nach Ellis Ansicht noch etwas unternommen werden. Damit einem die Zeit nicht zu lang wurde. Sie schlug Marga einen Stadtbummel vor. So zum Abschied von dem guten, alten Nest, das einem schon jetzt furchtbar klein und provinzmäßig vorkam.
Marga war meist schwer zum Spazierengehen zu bewegen. Sie fühlte sich, wenn sie sich überhaupt wohl fühlte, zu Hause noch am besten. Diesmal willigte sie überraschenderweise sofort ein, und Elli verzeichnete den zweiten kolossalen Fortschritt des Tages.
Es war ein kühler, selten klarer Spätherbsttag. Die Sonne schien rotgolden und wehmütig aus dem halb klaren, halb federwolkigen Himmel. Der Wind pfiff scharf um die Straßenecken. Fest und schützend drückte sich Elli an Marga. Auf der Brücke blies es ganz toll aus Osten. Fast flogen die Hüte mit auf. Der Fluß schäumte ungebärdig.[S. 315] Eben rasselte ein Kettendampfer unter der Brücke durch. Die Pfeife schrie mürrisch in den Wind hinein, und dann legte er sein Dampfrohr nieder, um durch den Brückenbogen zu kommen. Die bewimpelten Lastkähne, mit rotem Sandstein befrachtet, schaukelten in endloser Reihe hinter ihm drein.
Die Leute blieben trotz des Windes einen Augenblick stehen und warfen einen Blick über das Geländer. Auch Elli hielt eine Sekunde an und schaute hinunter.
„Was gibt's denn?” fragte Marga. Fern wie sie war, wußte sie sich Stillstand und Geräusch nicht gleich zu erklären.
„Bloß der Kettendampfer. Komm!” Schon ging Elli weiter.
„Wo kommt er denn her?” fragte sie mit einer ungewöhnlichen Bewegung der sonst so eintönigen Stimme.
„Wer? Ach so, der Dampfer! Vom Tal herunter.”
Sie gingen weiter. Margas Schritt war schleppend geworden.
Elli schaute ihr ins Gesicht. Mit Staunen sah sie, wie in ihren Zügen eine außerordentliche Erregung arbeitete. Der kleine, unbedeutende Vorgang — der alltäglichste fast, der sich denken ließ — schien ein Zittern in ihre erstorbene Seele zu bringen. Eine Erinnerung schaffte in ihr. Auf der Sägemühle hatten sie so manchmal vom Garten aus den Lastschiffen zugeschaut. Vielmehr Marga hatte hinausgehorcht auf das Rasseln und Plätschern, und Elli mußte ihr die Kähne zählen.
Elli erriet nur unklar, was sie beschäftigte. Instinktiv lenkte sie jedoch das Gespräch ab. Sie erzählte ihr von neuen Villen in der Vorstadt. Zu ihrer Beruhigung[S. 316] war die Erregung in Margas Antlitz bald wieder geschwunden.
Drüben über der Brücke — sie wollten gerade noch ein paar Schritte die Neustädter Hauptstraße hinaufschlendern — liefen die Schwestern durch einen Zufall Cousine Grasvogel in die Hände. Natürlich wußte sie schon von der Reise der lieben Kinder. Es gab einen unausweichlichen Schwatz, einen Regen von Fragen, die Elli beantworten mußte. Die Grasvogels waren nämlich mit den Thieles auf Güstow, und zwar doppelt, verwandt. Die Richthoffs und die Thieles, der Geheimrat und der Gutsbesitzer waren die gesellschaftlichen Leuchten, in deren Glanz sich Cousine Grasvogels armes Altjungfernherz vor der Mitwelt und sich selber sonnte. Es gab da Grüße und Gott weiß was zu bestellen.
„Wie habt ihr's gut, daß ihr noch einmal in die Nachsommerfrische dürft!” meinte sie begeistert.
Nachsommerfrische war eine Wendung, die Elli um Margas willen unliebsam drohend fand. „Ja, Papa ist sehr gut. Entschuldige übrigens! Wir haben noch schrecklich viel zu tun und zu besorgen!” Mit geschäftiger Hast suchte sie sich von Fräulein Grasvogel loszuringen.
Doch die witterte mit dem sicheren Sinn der gereiften Weiblichkeit schon länger zwischen Sommerfrische und Nachsommerfrische interessante Zwischenfälle oder Übergänge. Ellis Hand ließ sie los, aber dafür hielt sie die Margas um so fester. „Die Sägemühle ist euch aber auch gut bekommen, nicht wahr, Marga?” flötete sie weiter.
Elli gewahrte mit Sorge, daß das Wort Sägemühle, das daheim verpönt war, in Margas Mienen dieselbe Unruhe[S. 317] hervorbrachte wie zuvor auf der Brücke der harmlose Kettendampfer.
„Ausgezeichnet!” antwortete sie, lauter als nötig, an Margas Stelle. „Entschuldige nur, wir müssen —”
„Natürlich, ihr habt's eilig!” versicherte Cousine Grasvogel durchaus verständnisvoll, aber ohne locker zu lassen. „Was mir gerade einfällt — ihr werdet gewiß verwundert —”
„Gar nicht! Gar nicht!” rief Elli. Sie wußte nicht warum, aber sie ahnte, daß die gute Cousine noch mehr Unheil anrichten wollte, und strebte, Marga am Arm zerrend, entschieden davon.
„Ach — ihr wißt's am Ende schon lange! Nicht? Ich meine, daß der liebenswürdige, nette Doktor — wie heißt er doch? — Doktor Perthes — er war doch mal bei euch auf der Sägemühle, nicht? oder öfter — und auf dem reizenden Gartenfest im Juni, nicht? — daß er sich mit Alice Hupfeld verlobt hat? Vorgestern erfuhr ich's von —”
Elli hatte Marga mit Gewalt fortreißen wollen. Aber seit der Name Perthes gefallen war, stand sie steif, schwer, unbeweglich. Und als die für beide niederschmetternde Neuigkeit heraus war, stand auch Elli einen Moment, wie vom Schlag gerührt, kreidebleich.
Cousine Grasvogel, die es nicht bös meinte, stockte in ihrem Redefluß, selber bestürzt und sprachlos über die Wirkung ihrer Mitteilung.
In der nächsten Minute riß Elli Marga mit einem halb wütenden, halb schmerzlichen Aufschrei herum und lief mit ihr, so schnell sie konnte, heimwärts davon.
Marga selbst folgte willig und wortlos. Der Zufall wollte, daß sie fast an derselben Stelle, wo ihr einst Käthe[S. 318] über Perthes' Liebelei mit Hilde König eine erste Andeutung gemacht, diesen tiefen, über alles Verstehen schmerzhaften Streich empfing. Das dumpfe, erregte Arbeiten in ihren Zügen war in ein fast konvulsivisches Zucken übergegangen. Ihre erstorbene Seele erwachte aus der bleiernen Erstarrung von Wochen. Das Blut stieg und fiel in ihren Wangen mit heißen, beklemmenden Wellen.
„Ich glaube, wir sollten besser mit der Elektrischen fahren!” stieß sie, nach Atem ringend, plötzlich hervor.
„Natürlich, Margakind!” Elli hatte die nächste Haltestelle erspäht. Sie half Marga in den Wagen und schmiegte sich drinnen dicht an sie. Sprechen konnte sie nicht.
Von der Station hinter dem Bahnhof erreichten sie schnell das Haus am Wenzelsberg. Noch zu rechter Zeit.
Ein furchtbarer, herzbrechender, den Körper schüttelnder Weinkrampf kam über Marga. Wehrlos mußte sie sich dem Schmerz überlassen, und ihr lautes Schluchzen erfüllte vom Flur das Haus. Therese, Käthe, der alte Herr stürzten herbei.
Noch nicht eine halbe Stunde später lag Marga mit hohem Fieber zu Bett.
In der Nacht wurde sie bewußtlos und redete irre. Alice, Perthes, die Sägemühle, der rasselnde Schleppdampfer zermarterten in wirrer, grauser Jagd ihr Hirn.
Geismar wurde gerufen. Er konnte noch kein bündiges Urteil geben, äußerte sich aber sehr besorgt.
Am Morgen konstatierte er ein Nervenfieber.
Marga reiste statt zu Thieles auf Güstow weiter, viel weiter. Bis an die Grenze zwischen Leben und Tod ...
Als Doktor Markwaldt, der ehemalige Kollege am Bakteriologischen Institut, die Kunde von Perthes' Verlobung mit Fräulein Exzellenz erhielt, da meinte er zu dem Überbringer, einem der Volontärärzte der Chirurgischen Klinik: „Da haben wir's ja! Genau, wie ich's voraussah!” Im Grunde seines Herzens aber war er verblüfft. Noch verblüffter aber war er, als er statt einer gedruckten Anzeige folgende Zeilen erhielt:
Lieber Markwaldt!
Sie haben, wie Sie mir gelegentlich gestanden, immer geschwankt, ob ich ein Faulpelz oder ein Streber sei. Ich habe mich mit Fräulein Alice Hupfeld verlobt. Ich denke, das wird Ihrem Schwanken ein Ende machen.
Gruß Ihr Perthes.
Zum mindesten eine originelle Art, sich selber zu denunzieren, dachte Markwaldt kopfschüttelnd. Als er seinerzeit am Klinikerabend, auf dunkle Gerüchte hin, Perthes aufgezogen und sich eine so erregte Abfuhr geholt hatte, war er nur aggressiv gewesen, um dem „Unergründlichen” einmal auf den Zahn zu fühlen. Er wußte, daß Perthes zum Richthoffschen Hause in naher Beziehung stand, und glaubte nicht im Ernst an eine Verbindung mit Hupfelds. Jetzt, wo sie doch plötzlich Wahrheit geworden war, schien ihm die Sache nicht ganz behaglich, und er räsonierte, menschenfreundlich wie er war: „Wenn sich der Junge nur nicht in die Nesseln gesetzt hat! Er bleibt ein verdrehtes Huhn!” Aber er bewunderte doch den Tiefblick Professor Hammanns, seines Chefs. Der hatte zuerst über Perthes das ahnungsvolle[S. 320] Wort „Heiratspolitiker” fallen lassen. Nur so en passant und als Vermutung. In Markwaldts Augen war er durch diese Probe weltmännischer Menschenkenntnis hoch in der Achtung gestiegen, und der Assistent benutzte die nächste Gelegenheit, vor ihm seine Bewunderung auszudrücken.
Seltsamerweise nahm Professor Hammann dieses Kompliment mit mehr als oberflächlichem Dank auf. Der gutmütig-klatschsüchtige Markwaldt, der sich selber so findig vorkam und doch immer an der rechten Fährte vorbeilief, konnte nicht wissen, daß er seinem Chef mit seiner Anerkennung nur eine gemischte Freude bereitete.
Denn Ludolf Hammann, um es vorweg zu sagen, trug sich seit einiger Zeit selbst mit heiratspolitischen Absichten. Daß er, der freiheitliebende Junggeselle, dessen Herz für den Sport, dann für sich und erst in letzter Linie für die Frauen schlug, dabei mehr der Not als der Neigung gehorchte, lag nahe. Für Alice Hupfeld hatte er vor Jahren mal so etwas wie eine Neigung zu empfinden geglaubt. Bei näherer Bekanntschaft mit ihren gegenseitigen Charakteren mußten sie sich beide „für den Ernst der Ehe ungeeignet” finden. Sie lachten sich also auseinander und blieben gute Freunde. Wenn der patente, wissenschaftliche Amateur und Zufallsgelehrte, der er war, jetzt ernstlich daran dachte, seine Unabhängigkeit dranzugeben, so mußte sie von anderer Seite bedroht sein. Seine Vermögensverhältnisse hatten denn auch — was außer ihm niemand wußte — in aller Stille einen schweren Stoß erlitten. Das Kapital, das ihn unabhängig machte, steckte zum größten Teil in der Bank eines für unbedingt sicher geltenden Onkels in den Rheinlanden. Diese Bank kämpfte[S. 321] mit der Liquidation. Hammann sah sich mit einem Schlag vor sehr beträchtlichen Verlusten und damit vor der Gefahr, seine wohlige Lebensweise in unerhörtem Maß einschränken zu müssen. Kein Wunder, daß er auf einen Ausweg sann, der das geringere Übel bedeutete, und — horribile dictu — sich nach einer reichen Partie umsah.
Die akademischen Kreise der kleinen Universitätsstadt zerfielen, von Hammann aus gesehen, in der Hauptsache in ein modernes und ein rückständiges Lager.
Das rückständige Lager kam für ihn nicht in Betracht. Rückständig waren die Professoren, denen die Gelehrsamkeit wie in alten Tagen ein vornehmer Selbstzweck blieb. Es waren die Leute, die er meist nicht einmal mit ihrem richtigen Namen kannte, alte Herren wie Vater Richthoff, Wilmanns und Borngräber. Jedoch nicht nur Philosophen, sondern auch vereinzelte Juristen, Mediziner, wie Geheimrat Geismar, und Theologen, von denen gar nicht zu reden war. Daß unter allerhand Schrullen in dieser, wie es schien, aussterbenden Kategorie von Hochschullehrern der beste Kern von Gediegenheit und berechtigtem Gelehrtenstolz steckte, war für Hammann uninteressant und nebensächlich.
Wichtiger, allein wichtig war für ihn die zweite Gruppe, die neben der ersten allmählich als neue und moderne akademische Gesellschaft herangewachsen war. Zuerst und vornehmlich rekrutierte sich diese aus den Fakultäten, die wie die naturwissenschaftliche und medizinische dem praktischen Leben der Gegenwart näher standen als ihre selbstloseren Kollegen. Den Akademikern dieses Schlages war ein großzügiger Hang zum Kapitalismus eigen. Sie hielten die Legende vom Selbstzweck der Wissenschaft um des[S. 322] guten Scheines willen aufrecht, aber verstanden sie zeitgemäßer, also kaufmännischer. Der typische Repräsentant der neuen Gattung war Exzellenz Hupfeld. Leute wie Hammann, zahlreiche Kollegen aus den übrigen Fakultäten stellten den Chorus. Man wollte nicht mehr nur forschen und lehren, sondern im weitesten Sinne des Wortes auch leben. Alte Häuser, wie das am Wenzelsberg, mit steilen Weinbergen und Schnecken darin, verwunschene Butiken wie Borngräbers efeuumranktes Landhäuschen paßten nicht zu solchen Anschauungen. Gelehrsamkeit war etwas sehr Schönes, aber eine pompöse Villa im Villenviertel, ein altes Damenstift im Tal, kostspielige Liebhabereien, ein Automobil, Dienerschaft — kurzum, Luxus war mindestens ebenso schön. Mit so vorgeschrittener Auffassung war aber auch die Exklusivität des Akademikers, die ihn bisher nicht nur aus Dünkel, sondern aus geistigem Unabhängigkeits- und Selbsterhaltungstrieb von anderen Ständen sonderte, im alten Sinne nicht aufrechtzuerhalten. Die moderne Hochschulgesellschaft erschloß sich denn auch naturgemäß Elementen, die man früher hatte abseits stehen lassen. Um sich nichts zu vergeben, erweiterte man die Grenze nicht nach unten, sondern nach oben. Nach oben freilich im wirtschaftlichen und altständischen Sinne, nicht im geistigen, wo ein soziales Oben und Unten nicht zu finden war.
Auf dieser Verschiebung der gesellschaftlichen Grenze nach oben beruhte seit einiger Zeit im Kreise derer um Hupfeld der Einfluß des Grafen oder besser der Gräfin Hüningen.
Der Graf, in sehr naher, aber nicht ganz legitimer Beziehung zu einem regierenden Hause stehend, hatte sein[S. 323] Domizil seit etwa anderthalb Jahren in einem kleinen Palais der Altstadt, wo im Anfang des vorigen Jahrhunderts eine Prinzessin ihre Witwenjahre vertrauert hatte. Nach reichlich bewegtem Leben als Gardeoffizier und späterer Attaché in Konstantinopel und anderwärts waren jetzt seine Interessen in einer ausschließlichen Liebe für Wappenkunst nahezu erstarrt. Man sah ihn fast nie, und dann nur mit der gewichtigen Miene eines von der Arbeit gebeugten Forschers, dem das Monokel und der Schleppschritt als Überbleibsel vergangener Tage seltsam unharmonisch anhafteten. Die Gräfin dagegen, aus der steinreichen Familie eines ostdeutschen Großindustriellen stammend, von mütterlicher Seite Amerikanerin, war trotz ihrer fünfundvierzig oder mehr Jahre noch immer eine beinahe jugendliche Erscheinung. Stattlich, sehr gewählt in ihrem Geschmack, gewandt und geistreich in ihrem Auftreten, hatte sie sich überraschend schnell in der vorgeschrittenen akademischen Gesellschaft zu einer tonangebenden Stellung emporgeschwungen, die ihr allerdings die „Rückständigen” nicht eingeräumt hätten. Mehr und mehr bildete sie mit Exzellenz eine Doppelsonne, und Hupfeld, dessen Frau zur Repräsentation wenig geschaffen war, ließ sich die Teilung seiner Gewalt gefallen, da die Gräfin es verstand, dem großen Manne zu schmeicheln. In ihrem Geleit, man konnte auch sagen, in ihrem Schatten, trat ihre Tochter Edith in die Gesellschaft. Sie hatte von der Mutter ein sehr hübsches Gesicht, vom Vater eine Indolenz und geistige Armut geerbt, die der Beweglichkeit der Mutter als Folie diente. In sachlicher Würdigung aller Umstände widmete sich Professor Hammann als ziemlich einziger Verehrer der gutmütig-beschränkten Komtesse Edith.
[S. 324] Während Hammann mit seinen heiratspolitischen Absichten sich in einer durchaus vertrauten Sphäre bewegen konnte, mußte Perthes, der mit beiden Füßen von einem Lager ins andere gesprungen war, aus der einfachen Behaglichkeit des Richthoffschen Hauses in die üppige, große Welt der Hupfeld und Hüningen, sich an die neue Umgebung erst gewöhnen. Doch das ging fürs erste überraschend gut und leicht. Dem glücklichen Bräutigam zeigte sich das veränderte Dasein einstweilen nur von der angenehmsten Seite. Nach der Bekanntmachung der Verlobung begann ein wahrhaft verteufelter Reigen von Besuchen und Einladungen, von liebenswürdigen Familienfesten, Aussteuerkäufen und Zukunftsberatungen. Es gab Tage, an denen er und Alice kaum einen Moment erhaschten, um hinter irgendeiner Flügeltür der weiten, überladenen Zwölfzimmeretage, die Hupfelds im Winter in der Stadt bewohnten, sich die Lippen wund zu küssen. Aber gerade die seltene Möglichkeit, sich allein zu haben, die Atemlosigkeit eines immerwährenden Taumels, der sie auseinanderriß und nur eben zwischen Tür und Angel den Vorgeschmack einer tollen Verliebtheit kosten ließ, erhöhte für ihn und Alice den Reiz. Diese vergnügliche Jagd war wie geschaffen, um sie ihm immer neu, immer lockend als das verführerische Irrlicht zu zeigen, das er begehrte, und auch ihr die Freude an ihrem „Räuberhauptmann”, wie sie ihn endgültig getauft hatte, in der rechten Spannung zu erhalten. Die Bewußtheit, mit der Perthes sich in den Wahn auch dieses so ganz anders gearteten Glückes hineingepeitscht hatte, schien schneller, als er erwartet, in die Illusion völliger Befriedigung überzugehen. Er konnte tagelang vergessen, mit welcher[S. 325] dämonischen, ja zynischen Gewaltsamkeit er die Verlobung mit Alice angestrebt und herbeigeführt hatte. Wohl konnte ihm in einem Moment der Selbstbesinnung einmal die Frage auftauchen, ob es mit rechten Dingen zuging, daß er mit solcher Geschwindigkeit zum Oberflächlichen und Mittelmäßigen „genas”. Aber derartige Momente waren selten, und er tat, was er vermochte, um sie noch seltener zu machen.
Die Hochzeit war auf Mitte Januar festgesetzt.
Ein einziges Mal, in den geräuschvollen Bräutigamswochen vor Weihnachten, wurde Perthes von einem ernstlichen Rückfall bedroht. Es war an einem Sonntagmittag. Das intime Familiendiner bei Hupfelds war um ein paar Gedecke erweitert worden. Unter anderem war ein früherer Schulfreund von Leutnant Moritz, ein junger Assistenzarzt der Inneren Klinik, zu Tisch geladen. Perthes unterhielt sich gerade mit Alice über die unmittelbar bevorstehende Verlobung von Professor Hammann und Edith Hüningen. Da machte ihn eine Äußerung des gegenübersitzenden Kollegen aufhorchen. Dieser sprach mit seiner Tischnachbarin, einer Studentin der Medizin, zwei Worte über einen schweren Fall von Nervenfieber in seiner Klinik und nannte zufällig den Namen eines Fräulein Richthoff. Perthes erblaßte und ließ seine Gabel ziemlich laut auf den Teller klirren. Er hatte sich jeder Erkundigung nach Marga, so schwer es ihm bisweilen wurde, streng enthalten. Der neue Kreis, in dem er jetzt ausschließlich verkehrte, berührte sich kaum mit dem früheren, so daß ihm keine Nachrichten von drüben zukamen. Nun traf ihn diese Kunde, die er instinktiv auf Marga bezog, mit voller Wucht. Er mußte sich beherrschen, um bei Tisch bleiben zu können.
[S. 326] Alice war die einzige, die seiner Bewegung Beachtung geschenkt hatte. Neugierig sah sie in sein durch die Aufregung verändertes Gesicht. Sie hatte den Namen Richthoff so gut gehört wie er. Sie wußte, daß zwischen ihm und den Richthoffschen Mädchen irgend ein Zusammenhang bestanden hatte, war aber, wie es so geht, immer wieder von einer Frage abgedrängt worden. Jetzt hätte sie gern ihre Neugierde befriedigt. Doch die Gelegenheit war nicht günstig dafür. Sie beschloß ihn nachher auszufragen.
Gleich nach Aushebung der Tafel verschwand Perthes mit einer flüchtigen Entschuldigung.
Ohne Überlegung, nur seinem Gefühl folgend, eilte er auf dem nächsten Weg zur Inneren Klinik.
Dort ließ er durch den Pförtner den Kollegen bitten, der den Sonntagnachmittagsdienst hatte. Es war ein stiller, argloser, nur seinem Beruf ergebener Mensch. Perthes brauchte keine Umschweife zu machen. Er fragte also nach Marga Richthoff. Der Assistenzarzt wußte sofort Bescheid. Mit einer Teilnahme, die verriet, daß er der jungen, blinden Patientin etwas mehr als das übliche Berufsmitgefühl zugewandt hatte, erzählte er, daß am Tag vorher die Krisis eingetreten sei. Aller Voraussicht nach sei das Fieber gebrochen und die Gefahr überwunden. Perthes stellte noch einige fachmännische Fragen über den Verlauf der Krankheit, bedankte sich und ging davon.
An der Befreiung, die er nach günstigem Bescheid empfand, merkte er, daß er eine Wunde besaß, die nicht aufbrechen durfte. Er gestand es sich nicht, aber er wußte, daß die entgegengesetzte Nachricht ihn vernichtet hätte.
Eine halbe Stunde nachher war er wieder bei Alice.
Sie stellte ihn zur Rede, wo er gewesen, und wollte,[S. 327] als er auswich, auch auf die Frage zurückkommen, die sie bei Tisch unterdrückt hatte. Er schloß ihr den Mund mit Küssen und lenkte hartnäckig ab. Er hatte diesen Rückfall abgetan und wollte an nichts mehr erinnert sein.
In den wenigen Tagen, die noch bis Weihnachten übrig blieben, beschäftigten die hundert Fragen von Einrichtung und Wohnung das Brautpaar und die Eltern Hupfeld. Über die Wohnung gab es eine kleine Meinungsverschiedenheit. Exzellenz war der Ansicht, daß sein künftiger Schwiegersohn sich eine der niedlichen Villen kaufen müsse, die in der Neustadt täglich wie Pilze aus der Erde schossen. Alice hatte das von Anfang an nicht anders erwartet. Dagegen hatte Perthes seine Bedenken. Sein eigenes kleines Vermögen — daraus hatte er nie ein Hehl gemacht — war im Lauf seiner Studien und im häufigen Wechsel der Stellungen, die sein wiederholtes Umsatteln mit sich brachte, so gut wie aufgezehrt. Das Gehalt eines ersten Assistenten an der Chirurgischen Klinik, wenn es auch nicht schlecht bemessen war, reichte noch nicht einmal für ein einigermaßen angenehmes Leben zu zweien, wie es Fräulein Exzellenz gewöhnt war. Dazu mußte die stattliche Rente mithelfen, die sie als Mitgift bekommen sollte: um diese Abhängigkeit konnte Perthes, so sehr sich sein Selbstgefühl dagegen sträubte, nicht herumkommen. Desto fester war er entschlossen, sich dem Geheimen Rat nicht noch mehr zu verpflichten. Wovon sollte er aber aus eigener Kraft eine Villa kaufen?
Hupfeld ließ schon einen Agenten kommen. In Gegenwart der ganzen Familie wurden Pläne von entzückenden Landhäusern besichtigt. Eins, das in einer nagelneuen Bergstraße fix und fertig stand, fand allgemeinen Beifall.[S. 328] Nach weitläufigen, fröhlichen Beratungen über die Verteilung der Zimmer, Gartenanlagen, Wahl der Tapeten und so weiter zogen die Damen sich zurück. Der Agent machte den Herren seine geschäftlichen Vorschläge. Die Gesellschaft, die er vertrat, bot glänzende Bedingungen bei einer verschwindenden Anzahlung. Auf diese Weise wurden im Handumdrehen fast alle Akademiker zu Hausbesitzern gemacht. Perthes benahm sich gegenüber der Verlockung sehr kühl und widerstrebend. Exzellenz begriff erst nach und nach den Grund. Man verabschiedete den Agenten, ohne sich gebunden zu haben, und sprach sich offen aus. Hupfeld erklärte mit dem feinen Lächeln des wohlwollenden Grandseigneurs die Bedenken von Perthes für sehr ehrenwert, aber nicht stichhaltig. Diese paar tausend Mark Anzahlung waren eine Lappalie. Er wollte sie dem jungen Paar mit Vergnügen zum Geschenk machen. Als Perthes sich dagegen mit dankbarer Entschiedenheit wehrte, wurde der Geheime Rat ungeduldig, beinahe ungnädig. Von einer Mietvilla, wie Perthes sie vorschlug, wollte er nichts hören. Seine Alli hatte ja nun auch gerade an diesem Häuschen besonderen Gefallen. Er nannte Perthes, der in ein Geschenk durchaus nicht willigen wollte, einen Starrkopf und erbot sich, die Summe nur vorzuschießen. Damit mußte Perthes, wenn auch ungern, sich schließlich zufrieden geben.
Weihnachten war da. Die Festtage zu Hause zu feiern, war seit einigen Jahren nicht mehr fair. Hupfelds gingen gewöhnlich für sechs bis acht Tage nach St. Moritz. Da indessen die Hochzeit vor der Tür stand und der Leutnant seine ledige Alli auch noch mal genießen wollte, wie er aus Freiburg schrieb, wählte man diesmal den näheren[S. 329] Feldberg. Im Schwarzwald war viel Schnee gefallen Der Wintersport versprach köstliche Feiertage ...
Am Tag vor dem heiligen Abend fuhren die Eltern Hupfeld mit Alice. Am ersten Feiertag kam Perthes nach. Er fuhr im selben Zug mit der Gräfin Hüningen, mit Hammann und dessen Braut, Komtesse Edith. Aus einem Coupéfenster dritter Klasse winkte Markwaldt, der in seinem Sporthabit wie ein Salontiroler aussah.
Auf dem Feldberg waren Rodelsport und Skilauf in vollem Gange. Im Hotel drängte sich eine internationale Gesellschaft, in der auch Offiziere, Korpsstudenten, Professoren nicht fehlten. Ein Staatssekretär aus Berlin, ein siamesischer Prinz, ein amerikanischer Boxcalfmillionär bildeten die Zentralgestirne. Alice, die außer Cousine Hilla neuerdings Edith Hüningen unter ihre Fittiche genommen hatte — um Hammann bei seinen „Pygmalionsversuchen” zu helfen, wie sie boshaft erklärte —, war ganz in ihrem Element. Während Papa Hupfeld sich mit dem Staatssekretär auf der Basis gemeinsamer Exzellenz vorzüglich verstand, ließ sie sich von der schlitzäugigen Siamesenschönheit Schmeicheleien sagen und neckte den Boxcalfmann bis aufs Blut.
Perthes, der mitten aus schwerer Arbeit kam, wurde es weniger leicht, sich in diesem eigentümlichen Weihnachtstrubel wohl zu fühlen. Alice erklärte, ihr Räuberhauptmann sei und bleibe zwar der netteste und famoseste Junge in dieser internationalen Raritätensammlung, aber er müsse eifersüchtig gemacht werden. Mit ihren Manieren eines Gamin, ihren drolligen Bosheiten und Unarten machte sie sich Sklaven und Anbeter. Aber Perthes hütete sich, eifersüchtig zu sein. Zum mindesten es zu scheinen. Wenn[S. 330] er sie dann glücklich vor sich im Davoser Schlitten hatte, mit ihrer engen, weißen Jacke und der schiefen Eismütze, preßte er sie mit jener zornigen Leidenschaftlichkeit an sich, die sie so oft in ihm weckte, und sie sausten mit Hojo an den verschneiten Tannen vorbei zu Tal ...
Nach Neujahr kam im Eilschritt die Hochzeit. Ein prunkvoller Festtag rauschte vorbei: rührend in der Kirche — denn man hielt auf religiösen Anstand —, lärmend, luxuriös auf dem in blühenden Sommer verwandelten Stift Nieburg. Am Abend ein und desselben Tages, an dem Marga, in Tücher und Decken gehüllt, von Elli gestützt, von Vater Richthoff und Käthe beaufsichtigt, ihren ersten, minutenlangen Gang durch den besonnten Hof am Wenzelsberg unternahm, brachte das Automobil Doktor Perthes und Frau Alice, geborene Hupfeld, nach der Bahn.
In Südfrankreich, später in Neapel flogen dem jungen Ehepaar die Wochen der Reise in zeitloser Wonne vorbei. Trunken vom Glück einer entzügelten, unerschöpflich scheinenden Verliebtheit sahen sie einer den anderen im zauberhaften Licht immer neuer Reize. Sie dünkten sich andere Menschen geworden zu sein mit nie geahnten, unbegrenzten Möglichkeiten ihrer selbst und allen Daseins.
Im Februar kamen sie zurück.
Der Geheime Rat holte sie ab und führte sie im Triumph in das entzückende, über Erwarten bequem und elegant ausgestattete Heim, wo Mama Hupfeld mit unwandelbarer, dicker Kindlichkeit sie empfing.
Nachher jagten sie sich wie die Jungens durch ihre Zimmer.
Auf der Rückreise waren sie etwas schlaff geworden. Ein klein wenig Katerstimmung hatte sich einschleichen[S. 331] wollen — nun die Alltäglichkeit vor ihnen, das Außergewöhnliche hinter ihnen lag.
Jetzt, beim ersten Schmaus zu zweien, im eigenen Nest, verkündete Perthes, daß es für ihre Liebe überhaupt keinen Alltag gäbe, und Alli bekräftigte diese Devise mit ihrem hellen, kurzen, aufreizenden Lachen, das sich stärker erwiesen hatte als alle seine gemütvollen Torheiten aus längst vergangener Zeit.
Der frische Luftzug, der dünne, schräge Sonnenstrahl, den Vater Richthoff durch den gutgemeinten pommerschen Reiseplan hatte in sein Haus locken können — wie flüchtig und trügerisch war er gewesen! Wie schnell sollte die Hoffnung, die ihn aufatmen und Elli eine ganze Kur ersinnen ließ, um Marga „unter Freude zu setzen”, von verdoppeltem Kummer, vervielfachter Sorge verschlungen werden! Schicksal und Natur hatten es mit Marga anders vor als väterliche Güte und schwesterlicher Feuereifer ...
Trotz aller Weisheit unserer heutigen Medizinmänner ist ein seelisches Prinzip der Träger des Lebens. Wenn das Leid an seine Wurzel trifft, gilt kein Flicken und Kleistern mehr. Allenfalls gibt es ein müdes, seelenloses Vegetieren, das der Körper mechanisch fristet, aber kein Gesunden zu neuem Menschentum. Die abgestorbene Wurzel treibt nicht mehr. Vielleicht birgt das Erdreich, dem sie entsprang, eine zweite Lebensmöglichkeit. Aber dann müßte die verkümmerte Wurzel schwinden; es müßte ein frischer, jungfräulicher Boden zurückbleiben können. Die Natur, die immer nur Bedingung ist und nicht Grund,[S. 332] kann diesen Boden bereiten. Sie liebt die toten Wurzelstrünke nicht. Wenn sie beginnen, den Organismus zu schädigen, hebt der Kampf um Sein oder Nichtsein an, und die größte Gefahr birgt die größte Hoffnung. Nach schwerem Ringen entscheidet sich der Sieg des Körpers über die feindliche und doch freundliche Krankheit. Die erstorbene Wurzel ist vernichtet, die alte Seele dem Erdboden gleich gemacht, dem neuen, keimempfänglichen, lockerscholligen Ackerland. Wird ein junger Keim sprießen? Wird aus dem Schoß des Unendlichen ein neuer Trieb hervorbrechen? Das weiß nur das Schicksal allein. Denn das Schicksal bestellt die Saat, wie die Natur den Boden bereitet ...
Den schwülen Wochen folgten die Wochen des Unwetters. Aber der verdoppelte Kummer, die vervielfachte Sorge waren nicht grausamer als das traurige, schleichende Harren ohne Hoffnung. Man stand ehrlich Feind gegen Feind. Es war ein harter, wehvoller Streit, und die ihn mit Marga stritten, hatten die Befriedigung, wenigstens ihre Tapferkeit erweisen zu dürfen. Der alte Herr trug mutig seine Fahne. Die römischen Cäsaren brauchten sich ihres Meisters nicht zu schämen. Er war, wie alle guten Meister, auch ein guter Schüler in seiner eigenen Schule. Und Käthe und Elli schlossen sich an ihn in festerer Liebe denn je. Erst daheim und dann, als die Gefahr den Gipfel erstieg, draußen in der Klinik war all ihr Denken und Fühlen bei der Kranken. Wenn es sein Beruf und die häuslichen Arbeiten irgend erlaubten, ging Richthoff am Morgen und Abend selber nach dem klinischen Viertel und holte bei Geismar, bei einem Assistenten, bei den Krankenschwestern den Bericht der Stunden. Dazwischen kamen[S. 333] und gingen Käthe und Elli in friedlichem Wetteifer. Nach langem Warten oft nur ein Wort zu erhaschen, war schon eine Belohnung. Wenn der Geheimrat und Käthe nicht gewesen wären: Elli hätte das Krankenzimmer Margas aller Gefahr und jedem Widerstand der Ärzte zum Trotz einfach gestürmt. Ihre Liebe war in der Sorge so ungestüm wie in der Freude. Man kannte sie in der Klinik vom Pförtner bis hinauf zum Direktor, und wenn sie kam, wappnete sich jeder gegen ihre impulsive Liebenswürdigkeit, ihre nie entmutigte Überredungskunst. Und dann, als das Fieber sank, die Ansteckungsgefahr gewichen war, als erquickender, stärkender Schlaf Marga umfing, war Elli die erste, die sie sehen mußte: an der Tür stehend, auf den Fußspitzen, mit den strahlenden, tränenschimmernden Augen, vom Arzt und der Krankenschwester im Schach gehalten, damit sie nicht auf ihr blasses, abgemagertes, verzehrtes Margakind losstürzte und das „Häuflein Mensch”, das da so still und verfallen der Genesung entgegenschlummerte, in ihren Armen zerdrückte.
Langsam, ganz langsam ging es bergauf. Jede Station nach oben wurde mit dankbarem Jubel begrüßt. Zehn Tage nach Neujahr erlaubte Geismar die Überführung Margas nach dem Wenzelsberg.
Trotz der eisigen Winterluft stand der alte Herr, leichtsinnig wie ein Junger, nur durch den aufgestülpten Rockkragen und das übliche Samtkäppchen sich schirmend, im Vorgarten auf Posten. Als er den Wagen aus der Querstraße heraufbiegen sah, ging er vorsichtshalber ins Haus. Er wußte, daß er diesmal seine überzeugte Abneigung gegen „Gruppenbildungen” unmöglich würde aufrecht[S. 334] erhalten können. Sie mochten sich aber dann wenigstens nicht vor unberufenen Augen vollziehen.
Lieber Gott, wie lange die Mädels brauchten! Er wartete ja schon ewig auf dem ersten Treppenabsatz, wohin er sich zurückgezogen hatte, um in jedem Fall über der Situation zu bleiben. Therese stand schon längst unter der Glastür und wischte sich zum zwanzigstenmal die Hände an der Schürze ab, um Fräulein Marga zu begrüßen.
Und dann brachten sie sie. Halb getragen, halb geschoben kam sie durch die Tür. Auf dem blassen Gesicht, in den zielverlorenen Augen glänzte ein Widerschein von all der wärmenden Liebe, die sie umhüllte. Therese sagte ihr „Grüß Gott!” Marga erwiderte mit ihrer sanften, herzlichen Stimme.
Bei diesem Ton fiel dem alten Herrn plötzlich ein, wie es gewesen wäre, wenn er die Stimme dieses seines blinden Sorgenkindes nicht wieder im Haus am Wenzelsberg gehört hätte. Und da hielt er sich nicht über der Situation. Er stieg hinunter von seinem Treppenabsatz, und es gab eine richtige Gruppenbildung, an der er selber mit zwei Küssen auf Margas Wangen sehr gravierend beteiligt war.
„Nicht wieder solche Geschichten machen. Ja nicht! Herzlich willkommen. Sich setzen! Sich stärken! Ausruhen!” Einmal ums andere strich er die Haare über Margas Schläfen zurecht, die wenigen zarten, die die Krankheit ihr gelassen. Er selber führte sie ins Eßzimmer und setzte sie in den Lehnstuhl, der sein Privileg war. Elli erklärte feierlich, es sei einfach unmöglich, daß andere Menschen sich so freuen könnten wie die Richthoffs. Und Käthe vollendete in stummer Beglücktheit einen schönen,[S. 335] tiefgründigen Satz für ihr Tagebuch, der verdient hätte, gedruckt zu werden ...
Das erste Viertel des neuen Jahres brachte Schritt für Schritt den alten guten Geist in das Haus am Wenzelsberg. Nun war Vater Richthoffs „Bande” wieder beisammen. Nun trat er seine Paschawürde wieder an. Während der zweite Teil der ersten Abteilung der „Kaisergeschichte” seinem Ende entgegengedieh, erlebte er es, daß die Türen wieder unerlaubt ins Schloß knallten und Ellis Lachen aus der Dachstube oder vom unteren Flur in seine Zettelwirtschaft und sein Miniaturgekritzel hineinschmetterte. Er schmunzelte, wurde bös, stand auf, schob das Käppchen von einem Ohr aufs andere und donnerte, Ruhe gebietend, durch den Türspalt. Die Cäsarengeister spitzten ihre Ohren wie kampfmutige Rosse beim vertrauten Schlachtruf und stritten sich hinterdrein um die Ehre, vom Gänsekiel des alten Herrn gelobt oder getadelt zu werden.
Erst der Frühling, der im Weinberg schüchterne Krokus und naseweise Maiglocken an die Sonne trieb, gab Marga ein wenig Rot in die Wangen und kräftigte ihre schmächtig gewordenen Glieder. Was in ihr wurde und wuchs, hervor aus neuem, unberührtem Boden, verriet sich kaum. Das Vergangene, das herbe Leid des Herbstes, schien wie in fernem Dunst zerflossen zu sein. Die Krankheit hatte ihre Erinnerung geschwächt. Weite Strecken des Gewesenen schienen wie ausgelöscht oder dämmerten ohne ernsten Zusammenhang. Erst allmählich traten die Geschehnisse in matterem, verändertem Licht wieder in ihr Bewußtsein. Sie sprach nie davon, und Vater Richthoff und die Geschwister hüteten sich in begreiflicher Scheu,[S. 336] daran zu rühren. Die Traurigkeit der großen Leere — war von ihr gewichen. Dankbar empfanden es die, die sie umgaben. Laut und allzu lebhaft war sie auch in den Tagen ihres höchsten Glücks nicht gewesen. Man war es deshalb schon zufrieden, daß sie nun wieder sanft und leise ihren Platz unter den Schwestern innehatte. Das Klare, Tapfere, Offene ihres Wesens, der Reichtum und die Reife inneren Schauens und Erlebens — all das regte sich noch kaum in ihr. Es war schattenhaft und rissig wie ihre Erinnerung. Aber sie war dem Tode zu nahe gewesen, als daß das wiedergewonnene Leben mit dem erwachenden Frühling seine zaghafte Lust hätte zurückhalten können. Sie wollte wieder. Und wenn es nur war, daß man sie in die Sonne führte, mit ihr plauderte, ihr Blumen pflückte und vorlas. Einmal, als sie mit Elli sich zum erstenmal emporwagte bis zum Philosophenweg im Weinberg, wo hinten auf dem Wiesenhang die Pfirsichbäumchen zu blühen anfingen und im junggrünen Schlinggewächs die Finken ihre Triller probierten, breiteten sich ihre Arme wieder weit, so weit, und ihr Kopf warf sich zurück, als wollte sie die Sonne suchen, die sie umrieselte. Sie wollte wieder leben. Sie wollte vom Schicksal wieder ihr Teil empfangen: eine neue Saat für eine neue Seele ...
Noch vor Semesterschluß brachte der erste Frühling eine Überraschung.
Als sollte ein frohes Ereignis bezeugen, daß es das neue Jahr im Ernst besser meine als das verstrichene. Bei Käthe zeigten sich seit einiger Zeit Symptome einer größeren Nachdenklichkeit, Verschlossenheit und Weltklugheit als sonst. Irgend ein sehr wichtiges Problem schien sie und ihr Tagebuch zu erfüllen. Nach Weihnachten hatte[S. 337] Richthoffs Schüler, der Privatdozent Bertelsdorf, dessen Tenor im akademischen Gesangverein eine Rolle spielte, eine seltene Beharrlichkeit darin gezeigt, Käthe nach den Proben heimzubegleiten. Käthe hatte sich bei Bertelsdorfs Aufmerksamkeiten bisher nie viel gedacht. Sie kannte seine Schwäche, sich bei den Professoren durch einen recht biegsamen Rücken lieb Kind zu machen. So erklärte sie sich auch die Häufigkeit, mit der er, im Wetteifer mit dem Flanellstorch, bei geselligen Veranstaltungen sie zur Tischdame begehrte; so auch, freilich nicht mehr ganz zweifellos, sein Auftauchen in Kissingen. Im übrigen konnte man sich mit ihm sehr gescheit unterhalten. Sie war empfänglich für allerlei wissenschaftliche Belehrungen, die er zu geben wußte; er war ein geduldiger Zuhörer für Käthes Lebenserfahrung und Weltweisheit — das wog bei ihr seine Liebedienerei beinahe auf. Er hatte die Fähigkeit, sich ihr unterzuordnen, was für ihre Beurteilung von Menschen und deren Wert gar keine nebensächliche Rolle spielte. Als er jedoch eines Abends auf dem Heimweg von der Messiasprobe einen regelrechten Antrag mit a, b und c entwickelte, überraschte er sie doch. Sie sagte zuerst rund heraus nein. Als sie aber ans Richthoffsche Vorgartentor gekommen waren und Bertelsdorf, beharrlich wie er war, seine Werbung noch einmal zur Diskussion stellte, versprach sie wenigstens, sich die Sache zu überlegen.
Zunächst nur aus Artigkeit. Dann aber ging sie mit sich zu Rat — in all der Rechtschaffenheit, die ihr eigen war. Einige Wochen dauerte es. Nun hatte zwar ihr Nein sich durchaus noch in kein Ja verwandelt, aber die Wage stand annähernd im Gleichgewicht. Und da machte Bertelsdorf einen Vorstoß auf eigene Faust: er hielt in[S. 338] einem sehr detaillierten Brief, der auch philologisch bemerkenswert war, bei Geheimrat Richthoff in aller Form um seine älteste Tochter an.
Vater Richthoff hatte nach seinen jüngsten Erfahrungen einen Horror vor Brautwerbungen. Anderseits war ihm der Gedanke, daß seine Töchter dem üblichen Los anderer junger Mädchen nicht für immer ausweichen könnten, wenigstens nicht mehr vollkommen neu. Es schien nun einmal in den Sternen zu stehen, daß er in die Ära hochzeitlicher Bedrängnisse eingetreten war. Bei Käthe fielen die Bedenken fort, die den Entschluß, als es Marga galt, so erschwert hatten. Bertelsdorf war ihm als Schüler wert, wenn er auch an ihm als Menschen manches auszusetzen hatte. Mehrere möglichst geheime Konferenzen mit Käthe folgten. Das Ergebnis war, daß der Privatdozent der letzten beiwohnen durfte. In aller Stille, ohne zu große Aufregung, verlobten sich die jungen Leute, und der alte Herr gab seinen Segen.
Es war Käthes eigener taktvoller Wunsch, daß Marga so schonend wie möglich von diesem Ereignis unterrichtet werden sollte. Elli wurde zur Mittelsperson ausersehen und zuerst von Käthe eingeweiht. Ihr fröhliches Herz, zur Mitfreude so geschaffen, machte sich in vielen Umarmungen der Braut Luft. Sie versprach, ihr Bestes zu tun.
Es sind oft nicht die schlechtesten Diplomaten, die von Diplomatie keine Ahnung haben. Elli behandelte Marga zwei Tage hindurch mit sehr durchsichtigen Vermutungen und Andeutungen, bis dieser gar nichts anderes übrig blieb, als das Vorgefallene zu erraten. Sie erbleichte wohl; ihre Lippen zitterten, und ihre Augen senkten sich in einer schmerzhaften, traurigen Anwandlung. Aber das[S. 339] Vergangene hatte keine Gewalt mehr über ihren neuen, jungen Willen, zu leben. Im Gegenteil: die Nachricht fiel wie ein erstes Saatkorn auf den fruchtwilligen Boden. Es regte sich in ihr etwas von ihrer früheren Tapferkeit. Sie ließ sich von Elli geradeswegs zu Käthe führen und brachte ihr mit warmen, ungekünstelten Worten ihren Glückwunsch. Käthe war gerührt. Und der Geheimrat, der gerade dazukam, war bei sich auf sein Sorgenkind noch stolzer als auf die Braut, die er nun doch ins Haus bekommen hatte.
Die Ostertage, mild und sonnenreich, voll Verheißung des jungen Frühlings für die alte Erde, ließen das Haus am Wenzelsberg nach innen und außen so recht im gewohnten Schimmer seiner guten, warmherzigen Behaglichkeit aufleuchten. Kaum war die Verlobungsneuigkeit in die Stadt geflattert, so kamen in langen Zügen die Freunde des Hauses. Papa Wilmanns rückte mit Frau und Töchtern an und schalt laut durch alle Zimmer, sein Kollege Richthoff sei ein Heimtücker und Duckmäuser, genau wie Borngräber. Auch ein Komödiant. Nun sehe man, was er den Winter über ausgeheckt habe, als er so unleidlich gewesen. Borngräber erschien natürlich auch. Er hatte sich eine sinnige kleine Ansprache ausgedacht, aber als er glücklich so weit war, hatte er vergessen, um was es sich genauer handelte, und sprach in dunklen Worten von einem frohen Ereignis. Man hätte ebensogut meinen können, er käme, um Richthoff zur Großvaterschaft zu gratulieren. Weiter kam Frau Geheimrat Achenbach mit ihren hoheitsvollen, weißen Scheiteln und dem Krückstock; Cousine Grasvogel, ein bißchen kleinlaut nach ihren letzten unglücklichen Leistungen,[S. 340] aber voll ehrlicher Rührung; Fräulein Lizzie aus der Uferstraße; der Flanellstorch, sehr geknickt und nervös, und viele andere: eine ganze Defiliercour, die der alte Herr an der Seite des Brautpaars voll Würde abnahm. Elli und Marga standen abseits in der Glasveranda vor dem Salon, die die Gratulanten in ein blumenbuntes Gewächshaus verwandelten. Auch sie bekamen viel Freundliches zu hören. Elli wünschte man Glück, so oft man sie sah, „einfach, weil so was existierte”, wie Frau Achenbach scherzend meinte, und Marga, weil alle sich freuten, sie wieder gesund zu sehen ...
Niemand ahnte, wie bald sich die hellen, traulichen Räume am Wenzelsberg den gleichen, aber so ganz anders gestimmten Gästen öffnen sollten ...
Geheimrat Richthoff hatte gleich nach Ostern, ehe die Vorlesungen des neuen Semesters wieder begannen, eine langersehnte, für die Forschungen der Kaisergeschichte notwendige Italienfahrt geplant. Nach den mancherlei seelischen Aufregungen des Winters versprach er sich von den paar Wochen im Süden auch für seine Erfrischung das beste. Alle Vorkehrungen waren getroffen. Der alte Herr fühlte seine jugendliche, unerschöpfliche Begeisterung erwachen, wie sie ihn immer überkam, wenn er nach Jahren wieder klassischen Boden unter die Füße bekommen sollte.
Hofrat Geismar machte ihm einen dicken und harten Strich durch seine frohe Rechnung. Als er sich ihm vorsichtshalber vor der Reise noch einmal stellte, mehr besuchs- als konsultierenderweise, riet ihm der ärztliche Freund kurzerhand von der Italienfahrt ab. Wie seine Herztätigkeit dermalen beschaffen sei, wäre Gleichmäßigkeit der Lebensweise gebotener als Veränderung.
[S. 341] Richthoff beschimpfte Geismar und die ganze Sippe der Ärzte als Kurpfuscher und Freudenverderber aufs ehrenrührigste. Lange trug er sich mit der Absicht, trotzdem zu reisen. Aber dann kapitulierte er doch vor der „Quacksalberei”. Für seine Mädels, die sich über seinen jähen Planwechsel verwundern mußten, erfand er eine Geschichte in grimmigen Bruchstücken: eine unerwartete Arbeit sei in die Quere gekommen. Und er blieb. Den anderen Rat Geismars, sich auch zu Hause in den Ferien etwas Ruhe und Ausspannung zu gönnen, befolgte er nicht. Unter keinen Umständen sollten ihn diese tyrannischen Menschenschinder zum weichlichen Sybariten machen. Als echter Protestler rauchte er zwischen seinen erbärmlichen, nikotinfreien Strohstengeln eine halbe Kiste anständiger Havannazigarren, Importen, die ihm ein Verehrer in Bremen mit launigen Versen dediziert hatte.
Das Semester begann.
Die Sprechstundenbesucher kamen. Unter den ersten befand sich eine junge, hochgewachsene, brunhildenhafte Livländerin. Sie hatte dem Geheimrat, der bisher keine Damen zugelassen hatte, die Erlaubnis schon im Wintersemester halb abgetrutzt, halb abgeschmeichelt. Das heißt, der alte Herr machte bei ihr nur insofern eine Ausnahme, als er nicht, wie er das sonst gelegentlich getan, im Kolleg auf die Dame zuschritt und ihr mit grimmiger Galanterie den Arm bot, um sie hinauszugeleiten. Er duldete sie. Nicht weil er von seinem Grundsatz abgehen wollte, sondern um sich eine liebenswürdige Schwäche zu verstatten. Als Ausnahme, die die Regel bestätigt ...
Die junge Livländerin rechnete auf ihre sonnigen, ostseeblauen Augen. Auch für den Sommer. Sie verehrte[S. 342] den alten Herrn. Es mußte ihr gelingen, von der geduldeten zur offiziellen Hörerin vorzurücken. Zur Verblüffung Thereses kam sie mit einem Strauß von köstlichen, rosablühenden Rosen.
Auf der Treppe begegnete ihr Elli. Diese kannte „die” Hörerin des Vaters von einer Gesellschaft bei Wilmanns und tauschte mit ihr einen lächelnden Gruß.
Dann trat das junge Mädchen bei Vater Richthoff ein, ihren Strauß wie einen Schild vor sich hertragend.
Der Geheimrat saß am Schreibtisch und schlürfte den Kaffee, den ihm Elli eben gebracht. Höflich stand er auf. Mit der Zuvorkommenheit, die er Damen gegenüber nie vergaß, ging er ihr entgegen. Ihr Lächeln erwiderte er mit einer Verschmitztheit, die sagen wollte: Diesmal wirst du mich nicht kleinkriegen. Er war noch nicht bei ihr, um ihr die Hand zu geben und sie zum Sitzen einzuladen, als er, offenbar durch einen Fehltritt, zur Seite kippte. Mit beiden Händen suchte er am nahen Tisch Halt. Die junge Dame wollte ihm beispringen. Aber er war schon mit einer seltsamen Schwerfälligkeit in einen Sessel gesunken.
Sie legte die Rosen vor ihn hin. Mit Befremden nahm sie wahr, wie sein Mund sich bewegte, ohne das dankende Wort hervorbringen zu können. Eine krampfhafte Verzerrung arbeitete in seinem bärtigen Antlitz. Das Sammetkäppchen schob sich ihm in die Stirn. Seine Hand, die emporgriff, um es hinauszurücken, fiel schwer zwischen die Rosen auf den Tisch. Der Körper sank gegen die Lehne.
„Was ist Ihnen, Herr Geheimrat?” stammelte das junge Mädchen mit zunehmendem Schreck.
[S. 343] Seine Augen starrten sie durch die Brille irr und ratlos an.
Sie lief nach der Tür und rief die Treppe hinunter, laute, hilfeheischende Worte.
Elli kam von unten, Käthe von oben, beide mit fragenden, verwunderten Mienen.
„Ihrem Herrn Vater ist unwohl geworden!”
Die Schwestern eilten mit der Fremden bestürzt ins Arbeitszimmer. Der Anblick raubte ihnen einen Moment die Sprache. Dann schrien sie auf vor Schreck.
Der Leib des alten Herrn war vornüber gesunken. Sein kahler Kopf, von dem das Käppchen herabgeglitten war, ruhte mit den wenigen weißen Strähnen auf dem Strauß von duftenden Rosen.
„Papa — was ist dir?” Elli hatte sich neben ihm auf die Knie geworfen und griff nach den schlaffen Händen.
Käthe rief nach Therese, nach dem Arzt. Sie rannte aus dem Zimmer. Elli mit demselben Ruf besinnungslos hinter ihr drein. Von dem gleichen Gedanken beseelt, stürzten sie aus dem Haus. Käthe nach dem nächsten Fernsprecher, Elli zu Geismar.
Therese stand verständnislos und kopfschüttelnd unter der Küchentür, sah die beiden Fräulein vorbeirasen, ohne ihre Worte zu verstehen, und die fremde Dame, die sich unheimlich und überflüssig fühlte, ihnen fluchtartig folgen ...
Marga war bei dem entsetzten Aufschrei der Schwestern aus der Tür ihres Zimmers im Dachstock getreten, das Käthe vor ihr verlassen. Sie wußte von nichts. Aber das Rufen, Laufen und Türenschlagen erfüllte sie mit[S. 344] einer erschreckenden Ahnung, die ihr scharfer Instinkt schnell in die klarste Gewißheit verwandelte.
Da unten, einen Stock tiefer, war der Tod eingekehrt. Sie meinte seine eisige Kälte gegen ihre Wangen, ihre Stirn andringen zu fühlen.
Und mit der Gewißheit kam eine wunderbare, mechanische, gebietende Sicherheit über sie. Mit einer langsamen Ruhe, über die sie sich selber wunderte, stieg sie die Treppe hinunter und trat durch die offene Tür in das Arbeitszimmer ihres Vaters.
Sie flüsterte seinen Namen. Keine Antwort kam zurück. Sie wußte, daß es nicht sein konnte. Sie atmete den Duft von Rosen. Trotz ihrer Ruhe bebte sie zurück vor der kalten Stille und wagte sich nicht weiter. Sie tastete um sich und setzte sich auf den ersten Sessel am Tisch. Ihr inneres Gesicht war erwacht. Wahr, aber schöner als alle Wirklichkeit. Sie sah das büchervolle, verqualmte Zimmer; sie sah den Tod, eine anmutige Mädchengestalt mit einem Büschel Frühlingsblumen in lachenden Farben, die auf den alten Herrn mit dem grimmig-gütigen Gesicht scherzend zutrat; sie sah, wie sein Haupt mit einem verständnisvollen Lächeln sich über den Duft und die Blüten neigte und tief, immer tiefer darin versank. Und stumm, andächtig, ein Bild im Bilde, saß sie dabei und hielt Wache, während die Tränen sich leis und schwer aus den blinden Augen lösten und über ihre gefalteten Hände tropften ...
Später kamen die Schwestern. Nach ihnen der Arzt, Hofrat Geismar. Er konnte nur den durch eine Herzlähmung herbeigeführten Tod des Freundes konstatieren.
[S. 345] Und dann kam es weiter wie ein wirrer, böser Traum, Stunde um Stunde, vom Tag zur Nacht, von der Nacht zum Tag, hinter dem Tod sein trübes, düsteres Geleit.
Elli und Käthe waren wie gelähmt von Schmerz. Nur Marga behauptete inmitten des Gedränges der kleinen, harten Notwendigkeiten ihr Gleichgewicht. Mit ihr allein konnte Professor Wilmanns, der als erster am Platz erschien und als treuer Hausfreund im Verein mit Geismar und Bertelsdorf die Leitung aller Angelegenheiten übernahm, sich beraten und bereden. Das Schicksal hatte gesät. Rauh und herb. Aber gerade dieser tiefe, große Schmerz ließ die neue Kraft ihrer Seele emporwachsen: die Klarheit, ihre Tapferkeit, ihre reife Stärke zu leiden und zu lieben.
Die Schar der Freunde, noch vor wenigen Wochen so froh und festlich gestimmt, zog trauernd durch das verwaiste Haus am Wenzelsberg. Verwandtschaftliche und offizielle Beileidsbezeugungen von auswärtigen Universitäten, vom Ministerium, von der Berliner und Münchner Akademie, von seiner Burschenschaft; die würdige Feier in der Aula, bei der Borngräber die knappste und ergreifendste Rede seines Lebens hielt, das machtvolle Feiergepränge des akademischen Leichenzuges wogte daher und wogte vorüber. Noch ein Druck von unzähligen, wohlmeinenden Händen am Grab, und dann führte die letzte Kutsche die drei schwarzgekleideten Richthoffmädels zurück ins einsame väterliche Haus ...
In der Nacht, nachdem sie den alten Herrn hinausgetragen hatten, kam sich das alte Haus am Wenzelsberg schlecht und wurmstichig und älter vor denn je. Es knackte[S. 346] in seinen Dielen, es streckte sich im Gebälk und in den Wandfugen. Dann horchte es in sich hinein: es war ein eigentümliches Knistern und Raunen im öden Arbeitszimmer von Vater Richthoff. Die Geister zogen, die hohen, erzgemeißelten, ehrfurchtgebietenden Cäsaren — sie zogen aus Zetteln und Blättern, aus Winkeln und Ecken durch die mondhelle Stube hinaus in die Mainacht. Sie hatten begriffen, auch sie, daß es zu Ende war.
Beim Weihnachtswiedersehen auf dem Feldberg hatte Leutnant Hupfeld gelegentlich ausgerufen: „Ich kann mir nicht helfen, Kinder! Aber Alli mir als junge Frau zu denken, ist mir schlankweg unmöglich!”
Der frische, natürliche Junge hatte da ein Wort gesprochen, wahrer und prophetischer, als er selber wußte.
Frau Alice Perthes war nicht zu Würde und Ehrsamkeit, oder, wie sie es nannte, zur biederen, deutschen Hausfrau geschaffen. Ihre Sucht, modern, chic, vorurteilslos zu sein, war nicht gemacht und angelernt; sie ergab sich durchaus natürlich und folgerichtig aus ihrem wurzellosen Wesen, ihrem prickelnden, sensationsdurstigen Temperament, ihrer spottlustigen, spitzbübischen Wechselnatur, wie sie im beweglichen Spiel ihrer Mienen, ihrem graziös-leichtfertigen Gang, ihrem gelenkigen, biegsamen Körper sich ausdrückte. Sie war auch gar nicht gesonnen, in der Ehe eine andere Haut anzuziehen. Das flotte Mädel zu sein und zu bleiben, das sie Gott sei Dank war, blieb Alices Wahlspruch auch für die Ehe. Und Perthes, den eben[S. 347] diese herausfordernde Mädelsmanier so leidenschaftlich angezogen hatte, wiederholte ihr immer wieder: „Gerade wie du bist, Irrwisch, brauch' ich dich und will ich dich haben!”
Die neue gesellschaftliche Atmosphäre, in die sich Perthes versetzt hatte, war ihm nach wie vor nur in ihren Annehmlichkeiten fühlbar geworden. Ein elegantes, großzügiges häusliches Leben, Geselligkeit im eigenen Heim, Geselligkeit draußen, der angenehme Nervenreiz beständiger Abwechselung: das waren lauter Dinge, die ihm fürs erste imponierten. Soweit es seine beschränkte Zeit irgend erlaubte und die Rücksicht auf die sichere Hand, die sein chirurgischer Beruf verlangte, es zuließ, machte er mit. Den großen Rout im Palais Hüningen, die üppigen, offiziellen Semesterdiners bei den Schwiegereltern, kleine und große Schmausereien bei Hammanns und anderen Bekannten — ließ er sich nicht entgehen, auch wenn er sich mal ein bißchen kaput und ermüdet fühlte. Worin er sich bescheiden mußte, das war der Sport, dem seine Frau nach wie vor huldigte. Das Neueste, was die Gräfin Hüningen einzubürgern suchte, war Polo, und Alice war Feuer und Flamme für das Pferdeballspiel. Dazu fehlte ihm die Zeit. Und sein Leben konnte dann mitunter ein wenig junggesellenhaft werden. Wenn er zur Hauptmahlzeit zwischen sechs und sieben „mordshungrig” von der Klinik kam, mußte er sich öfter allein servieren lassen, weil sein Irrwisch noch „herumstrolchte”. Aber das Grundgesetz ihrer Ehe, das er stillschweigend sanktioniert hatte, war die Freiheit hüben und drüben. Sie mußte geachtet werden.
[S. 348] Mitte Mai — er war eben am Schluß eines solchen Junggesellenmahls angelangt — kam Alice aus der Stadt heim. Gewöhnlich brachte sie einen Sack voll Tagesneuigkeiten mit, die sie als Nachtisch zur gefälligen Auswahl ihrem Räuberhauptmann auf den Tisch schüttete. Im Vorbeigehen hatte sie bei den Eltern ein Butterbrot gegessen und setzte sich dann noch zur Unterhaltung neben ihn.
„Denk' mal an — ich komme durch die Hauptstraße — sehe an einem Bücherladen ein Telegramm des Tageblättchens angeschlagen und denke Wunder was passiert ist. Nachher steht weiter nichts drin, als daß irgend ein oller Professor am Herzschlag gestorben ist!”
„Wer denn? Von hier jemand?” fragte Perthes ziemlich gleichgültig, während er sein Glas mit gemischtem Rotwein an den Mund setzte.
„Ach, ein Philologe glaub' ich. Richter oder so was.”
„Doch nicht Richthoff?” Perthes setzte sein Glas ab. Er war unwillkürlich betroffen.
„Doch — Richthoff. Natürlich! So hieß er!” Alice, die die enttäuschende Neuigkeit in der Tat nur obenhin und gedankenlos gelesen und auch jetzt so vorplapperte, erinnerte sich nun des rechten Namens und gleichzeitig einer Beziehung ihres Mannes dazu, die sie noch immer nicht recht herausbekommen hatte. „Hast du nicht dort früher verkehrt, Männi?” setzte sie harmlos hinzu.
Perthes war sehr ernst geworden. So ernst, wie sie ihn lange nicht gesehen. Er hatte mit der Vergangenheit gründlich und dauernd abgeschlossen. Aber diese Todesnachricht beschwor doch, ob er wollte oder nicht, Erinnerungen herauf.
[S. 349] „Gott, Räuberhauptmann, du machst ja ein gräßlich düsteres Gesicht. Was ist denn los?”
„Schließlich handelt es sich ja auch um eine ernste Sache”, meinte er zerstreut.
„Nu ja! Hast du denn den guten Mann so nahe gekannt?”
Perthes schwieg. Er dachte an den braven alten Herrn und sann darüber, was aus seiner „Bande” werden mochte.
„Du, das mußt du mir mal erzählen,” fuhr Alice unbekümmert fort. „Ich weiß nämlich genau, wie es stand. Von Markwaldt. Du mußt einer von den Töchtern mächtig den Hof gemacht haben! Nu mal heraus mit der Sprache!” Sie rückte zutunlich näher, wie um eine amüsante Geschichte zu hören. Beglückt, nun endlich den rechten Faden gefunden zu haben, den ihre Neugier immer wieder verloren, sah sie ihm mit einem übermütig flackernden Blick in die Augen.
Perthes hatte keine Lust zu Bekenntnissen. Zu dem war ihm die Art, wie sie ihn dazu drängen wollte, peinlich.
„Weißt du was?” sagte sie lebhaft. „Wir schließen einen richtigen Handel! Du erzählst mir dein Abenteuer mit den Richthoffs. Ich erzähle dir dafür, wie ich mich um ein Haar mit Hammann verlobt hätte, willst du?” Sie legte ihm den Arm um den Hals und kraulte schmeichelnd seinen dichten, schwarzen Bart.
Er ließ es eine Weile geschehen. Dann löste er sich aus ihrer Liebkosung. Den Handelsvorschlag hatte er nur mit halbem Ohr gehört. Er war erfüllt, bedrückt von dem, was die Kunde vom Tode Richthoffs in ihm lebendig gemacht hatte. Der Gedanke, sich durch eine solche Beichte, so zuwider sie ihm an sich war, von diesem[S. 350] Druck zu befreien, war vielleicht so schlecht nicht. Wenigstens jetzt nicht, wo er seiner Stimmung entgegenkam. Und dann erwachte die Lust in ihm, diese dämonische Lust, mit der er sich zu Alices Lebensgefährten gemacht und sich von einer erträumten Höhe heruntergeholt hatte: er wollte versuchen, die alberne Bürde vergangenen Schwersinns mit einem Ruck vollends abzuwerfen.
So gab er nach. Mehr sich als ihr.
In einem von Sarkasmus und verschämtem Ernst gemischten Ton begann er seine idealistische Epoche zu schildern. Aber es gelang ihm nur im Anfang, gegenüber den Menschen und Dingen von einst die leidenschaftslose Überlegung festzuhalten. In dem Maße, als er sich dem Mittelpunkt seiner Erinnerungen näherte, fühlte er, daß er seine Kraft überschätzt hatte. Er wurde warm. Eine schwermütige Verbissenheit zerhackte seine Sätze. Das Gedächtnis Margas sträubte sich gegen jede Entweihung. Er konnte über dieses Mädchen und diese Liebe nicht mit dem Achselzucken der großen Welt hinwegkommen, das er seiner Umgebung für so manches andere abgelernt hatte. Warum hatte er sich verführen lassen, den Schleier von diesem Erlebnis zu ziehen? Und doch konnte er nicht abbrechen, dem wortreichen Eifer, in den er geriet, nicht Einhalt gebieten. Als müßte er sich für die Taktlosigkeit seiner Enthüllungen bestrafen, suchte er mit nervös hervorgeschleuderten Worten und Sätzen ein gerechtes Bild von Margas innerem Wert, von seiner eigenen Mittelmäßigkeit zu geben, die nicht zu ihr hinaufreichte. Es war eine Sisyphusarbeit, der er erliegen mußte. Er hatte sich verrannt und fand keinen Ausweg, bis ihn ein Blick auf Alice ernüchterte.
[S. 351] Sie saß zusammengekauert auf ihrem Stuhl und sah ihn mit verwunderten, belustigten Augen unentwegt an, wie er, gleich einem fremden, spaßigen Tier im Speisezimmer auf- und abschritt, da einen geschnitzten Hocker wegstoßend, dort an einem der türkischen Kelims zerrend oder eine der Kristallkaraffen auf dem Büffet vom Platz rückend.
Er stand still und schwieg.
„Aber Maxi”, kicherte sie leise. „Daß du so ein sentimentaler Junge warst, noch vor nicht einem Jahr, das hätt' ich mir denn doch nicht träumen lassen! Geahnt hab' ich ja den Spießer immer 'n bißchen —”
„Nicht wahr? Unglaublich!” stieß er hervor. Es klang gar nicht spießig, sondern eher wild und zornig.
„Und noch heute sprichst du von deiner Angebeteten wie von einem Wunder! Und blind war sie auch? Einfach romantisch, Männi! Bürgerlich und romantisch! Gibt's nicht ein Lustspiel, das so heißt? Und dabei bin ich überzeugt, sie war auch nur ein biederes, sentimentales —”
„Lassen wir's!” schnitt er ihr das Wort ab. „Dummheiten, du hast recht!” Er lachte gezwungen.
Sie war aufgestanden und hatte sich ihm genähert. Sie ließ ihr Lachen, das kurze, helle, aufreizende, in das seine klingen.
Er stand ihr gegenüber. Das Blut ging wie eine Welle durch seinen Körper und flirrte vor seinen Augen. Er erzitterte und ballte die Faust. Dann ergriff er sie und riß ihre Arme auseinander, als wollte er sie zerbrechen.
Sie stieß einen Wehruf aus.
Er bog ihren Kopf beinahe brutal zurück, nahm ihn zwischen seine starken, großen Hände und senkte seinen Blick in die schillernden, boshaft-schillernden Augen. Wer[S. 352] war denn das, der über ihn, über sein prostituierendes Geständnis, über alles, auch das Ernsthafteste, was er einst besessen und hochgehalten, lachen, so lachen durfte? Wo war das Geheimnis hinter diesen Augen? Wie war sie beschaffen, diese Seele oder was es war, dieses ewig Kichernde und Spottende? Wo war der Grund in diesem Ungrund?
Sie wand sich los. Dieser wühlende, dringende Blick war ihr ungemütlich.
„Wahrhaftig, ich glaub', du fängst an, bei mir noch Gemütsstudien zu machen? Auf deine Räuber- und Bärenmanier! Das laß mal besser sein!” schalt sie. „Da verschieb' ich mein Geständnis lieber. Wir müssen sowieso fort. Zu Hammanns. Sie erwarten uns um neun. Ich mach' mich zurecht!” Sie glitt aus dem Zimmer.
Perthes stand einen Augenblick unschlüssig, mißgelaunt. Er hatte keine Lust, heute unter fremde Menschen zu gehen. Also Vater Richthoff war gestorben. Und er hatte, ausgemacht heute, seine Erinnerung mit diesem Bekenntnisse — — Warum nicht? Das war der echte Perthes! Gewiß! Und der echte Perthes ging in sein Ankleidekabinett, um sich für Hammanns umzukleiden ...
Die Bedingungen, die Exzellenz Hupfeld seinerzeit Perthes als Gegenleistung für seine Ernennung zum ersten Assistenten auferlegt hatte, konnte er als Schwiegervater nicht in ihrer vollen Strenge durchsetzen. So erklärte er sich denn auch damit einverstanden, daß Perthes sich habilitieren sollte. Die wissenschaftlichen Arbeiten, die dem Eintritt in den Lehrkörper der Alma mater notwendig vorausgehen mußten, nahmen im Lauf des Frühjahrs mehr und mehr auch seine kurze Freiheit in[S. 353] Anspruch. Er mußte sich zunächst aus dem gesellschaftlichen Strudel etwas zurückziehen. Für seine Person wurde ihm dies dadurch erleichtert, daß er sich von dem ewigen Hin und Her nachgerade ein wenig ermüdet und übersättigt fühlte. Und dann machten ihm die unverhältnismäßig hohen Ausgaben, die dies anspruchsvolle Leben verursachte, neuerdings manchmal Sorgen, und er ergriff gern die Gelegenheit, sie durch seinen unauffälligen Rückzug möglicherweise einzuschränken.
Er hatte sich vorgenommen, Alice von solchen Sorgen nichts mitzuteilen.
Bei sich dachte er, wenn er selber den allzuhohen Anforderungen der Geselligkeit auszuweichen begänne — seine wissenschaftlichen Gründe dafür schien sie zu würdigen —, würde auch sie allmählich ganz naturgemäß nicht mehr soviel ausgehen wollen.
Doch darin hatte er sich getäuscht.
Alice fand es riesig nett, sich auf eigene Faust zu amüsieren. Sie dachte nie daran, von ihren Passionen und Unterhaltungen, von all den Ansprüchen ihres verwöhnten Mädchenlebens in der Ehe auch nur das Geringste entbehren zu sollen. Im Gegenteil. Jetzt, wo sie nach der Verheiratung ihr eigener Herr war, wollte sie ihre Ungebundenheit erst recht genießen. In ihrem Elternhaus hatte es kaum einen Wunsch gegeben, den sie sich zu versagen brauchte. Davon konnte auch jetzt keine Rede sein. Was aber den Reiz gegen früher erhöhte, war, daß jetzt neue Bedürfnisse ihrem Belieben unterstellt waren. Eine Hausfrau im gewöhnlichen Sinn zu sein, dazu fehlte ihr Lust und Talent. Aber Aufträge zu geben, ins Blaue hinein zu verfügen und zu befehlen, besonders[S. 354] aber zu kaufen, machte ihr einen Hauptspaß. Ihre Ausstattung an Gegenständen der Einrichtung, der Wirtschaft, an Toiletten und Kleidungsstücken jeder Art war mehr als reichlich. Und doch nicht reichlich genug, um vor den unerschöpflichen Einfällen ihrer Laune zu bestehen.
Unter dem Patronat der Gräfin Hüningen vollzog sich im Kreis der modernen akademischen Gesellschaft jener stoßweise Wandel von Liebhabereien und Modetorheiten, der jedem Monat seinen neuen Heiligen gab. Mitunter handelte es sich um harmlose Dinge: man bekam für einige Wochen den musikalischen Koller, der kein Konzert vorüberließ, die Tees, die Soireen, die ganze Unterhaltung musikalisch verseuchte. Dann mußte man plötzlich Vorlesungen besuchen: es war einfach Anstandssache, Kunstgeschichte, diese Erbdomäne aller Dilettanten, zu treiben oder Literatur bei einem plötzlich zum Stern erster Ordnung erklärten jungen Professor zu hören.
Doch bei solchen geistigen Anfällen, die Alice nur aus Mode und nicht aus irgendwelchem Interesse mitmachte, blieb es nicht. Man schwärmte serienweise für bestimmte kostspielige Stoffe, für echte Spitzen, für Kopenhagener Porzellan, für eigenartige Intarsien, für Seltenheiten und Reformen jeder Art in Toilette und Haus, die die Kauflust wie ein Fieber erregten.
Perthes, den eine gute Weile seine Verliebtheit blind machte, drückte auch späterhin, solang' es irgend ging, seine Augen standhaft zu. Da Alice mit ihrer Rente den Haushalt zu einem guten Teil mitbestritt, war seine Situation heikel. Wenigstens empfand er sie so, mit der Zartheit eines vornehm denkenden Menschen. Er redete sich auch ein oder glaubte wirklich, diese Kaufwut[S. 355] werde sich abschwächen und von selber eindämmen. Aber als die Rechnungen sich mehrten und es sich nicht mehr um Summen handelte, die sich nebenbei begleichen ließen, ohne daß man die Posten besah, aus denen sie sich zusammensetzten, wurde er aufmerksamer und kritischer. Mit dem Schrecken des Mannes, der sich nie viel um Geld gekümmert, aber durch seine Herkunft und Erziehung, ohne sich dessen genau bewußt zu sein, gewisse solide Maßstäbe ererbt hat, gewahrte er Zahlen, die sein Verständnis überstiegen. Es war ihm unverständlich, wie ein paar Schuhe vierzig Mark, ein Hut neunzig Mark, ein spitzenbesetztes Hemd sechzig Mark sollte kosten müssen und können. Naiv, wie seine Erfahrung war, meinte er, es müßten da Mißverständnisse, Irrtümer, Beutelschneidereien mitunterlaufen, denen seine kleine Frau unschuldig zum Opfer fiel.
Er wagte bei der nächsten Gelegenheit — es handelte sich um einen für seine Begriffe unerhört teuren Abendmantel —, Alice zu befragen.
„Aber Männi — davon verstehst du nichts! Ich finde den Mantel billig!” erklärte sie achselzuckend. Sie hatte, wie sie erzählte, sich sogar einen besseren „verkniffen” und war ordentlich stolz auf diese Einschränkung.
Perthes verstummte. Er war verblüfft. Hartnäckig bewahrte er noch einige Monate den guten Glauben, daß da etwas nicht mit rechten Dingen zugehe. Er hätte sich gern bei irgendeiner Dame Aufklärung geholt, ob das so sein müsse, aber er fürchtete, sich lächerlich zu machen. Schließlich war er gezwungen, sich über die Folgen, die eine solche Lebenshaltung haben mußte, doch ernstlich zu besinnen. Er rechnete die steigenden Ausgaben[S. 356] gegen die Einnahmen und kam zu einem vernichtenden Resultat.
Nun blieb nichts anderes übrig: er mußte mit seiner Frau sich aussprechen.
Die Sache wurde durch einen besonderen Umstand noch schwerer, als er sie schon an sich nahm. Alice sah für den Herbst einem frohen Ereignis entgegen. Als sie ihm ziemlich spät und ziemlich beiläufig davon Kenntnis gab, hatte ihn die Nachricht ergriffen. Sie selbst war so wenig feierlich gestimmt, steckte so in ihrem täglichen Trubel, daß sie für seine gefühlvolle Auffassung nicht Zeit hatte. Gleichwohl behandelte er sie von da an mit doppelter Rücksicht. Deshalb kam ihm diese Auseinandersetzung über Geldfragen so ungelegen wie möglich. Er nahm sich vor, sie aufs schonendste einzuleiten.
Noch im Lauf des Sommers, kurz vor den großen Ferien, kam ihm die Gelegenheit entgegen.
Von der Klinik zurückkehrend, betrat er ihr Zimmer, das neben dem Speisezimmer mit allem erdenklichen Geschmack und Komfort ein kleines, von Mama Hupfeld ausgestattetes Reich für sich bildete. Er wollte Alice begrüßen, die er dort vermutete. Unter der Portiere blieb er verdutzt stehen. Es war da in dem zierlichen Raum eine wahre Ausstellung eröffnet. Die verschiedensten Handarbeiten, als da waren Knüpfteppiche, Sofakissen, Tischläufer, Decken und Deckchen mit Mustern jeden Stils und auf Stoffen jeder Art, bedeckten den Diwan, die Stühle, den Tisch. Ein halboffener Riesenpacken mit verwandtem Inhalt lag auf dem Boden. Daneben saß Alice, mit dem Aufschnüren eines zweiten, kleineren Pakets beschäftigt. Das heißt, sie suchte die Schnur aufzureißen.[S. 357] Als das nicht ging, probierte sie es mit den Zähnen. Und in dem Moment, als Perthes sich bemerkbar machte, hatte sie eben wohl oder übel aufstehen wollen, um die Schere zu holen.
„Du denkst wohl, ich will hier einen Kramladen aufmachen?” lachte sie belustigt.
„Es sieht beinahe so aus,” erwiderte er mit einem verwunderten Blick auf dies Warenlager.
„Ach gib mir mal die Schere.” Sie deutete nach ihrem Schreibtisch. „Alles für den Bazar im November,” erklärte sie, während er ihr die Schere reichte.
„Für welchen Bazar?”
„Na — ich erzählte dir doch schon immerzu davon. Wir machen ein Wohltätigkeitsfest. Ich glaube für Säuglinge oder Seemänner oder so was. Eine feudale Sache jedenfalls. Ich bin mit im Komitee. Die Gräfin ist Vorsitzende. Ich habe mich entschlossen, eine Handarbeitsbude zu übernehmen. Dafür kauf' ich eben ein!”
„Aber Kind, du willst doch die Arbeiten nicht alle kaufen, wie sie hier sind?”
„So ziemlich!”
„Und dann willst du sie selber —”
„Du — das ist ja eben der Trick! — Ich mache an jedem ein paar Stiche. Wenigstens an manchen. Das Übrige gebe ich fort. Nachher mach' ich aller Welt weiß, jedes Stück und jeder Stich sei von mir. Die Leute werden's nicht glauben, aber sie werden sich drum reißen! Ach — und dann, du glaubst nicht, was wir für Überraschungen vorhaben. Das wird keine so abgeleierte, gewöhnliche Wohltätigkeitsschnurrerei! Werden uns hüten!” Und nun entwickelte sie, immer auf dem Boden sitzend, den[S. 358] Festplan in der skizzenhaften, schnoddrigen Form, in der sie stets ihre längeren Erklärungen abgab, überall dort, wo ihr nicht gleich das Wort einfiel, sich mit „so'n Dingsda!” behelfend. Perthes hätte ein Zeichendeuter sein müssen, wenn er diese Kette von „Dingsda” sich hätte auslegen können.
Doch darauf verzichtete er von vornherein. Er nahm seine Geduld zusammen und hörte scheinbar aufmerksam zu.
„Du vergißt, Alli”, begann er dann vorsichtig, „daß dein Zustand dir vielleicht, ja wahrscheinlich gar nicht erlaubt —”
„Na, höre! Ich werde doch nicht jetzt schon anfangen, mich zu kasteien.” warf sie dazwischen.
„Das will ich nicht sagen. Aber dem Umtrieb der Vorbereitungen wirst du nachher nicht gewachsen sein. Und überdies: wer weiß, ob du im November schon wieder dabei sein kannst?”
„Das fehlte gerade!” sie sah mißmutig zu ihm auf. „Weißt du, dann pfeif' ich aber auf das ganze Kindervergnügen, wenn —” Sie vollendete den Satz nicht. Perthes hatte unwillig die Stirn gerunzelt. „Das fehlte gerade!” setzte sie nochmals wegwerfend hinzu. Sie war außer sich bei dem Gedanken, durch diese dumme Störung könnte ihr Vergnügen beeinträchtigt werden.
Perthes kannte Alice zur Genüge, um ihre Gefühle an ihren Grimassen abzusehen. Ihre Frivolität verletzte ihn. Sie bestimmte ihn, den Augenblick nicht vorbeigehen zu lassen, ohne die immer wieder verschobene Aussprache herbeizuführen. Er machte sich einen Stuhl frei und zog ihn in ihre Nähe.
„Ich möchte gern mal ein ernstes Wort mit dir sprechen, Kind!”
[S. 359] „Noch ernster?” Es zuckte sehr wenig ernst um ihren Mund.
„So leid es mir tut — sei mir nicht böse und mißversteh' mich nicht — ich muß dir das aber sagen: du solltest deine Kauflust ein klein wenig einschränken!”
„Ich — meine Kauflust? Und wieso?”
„Wir müssen mehr haushalten, Liebling. Ich habe gerechnet und —”
„Um Gottes willen tu nur das nicht! Rechnen!” stieß sie mit einem komischen, aber ganz ehrlichen Schaudern hervor.
„Ich verlange es ja nicht von dir,” meinte er mit gutmütigem Lächeln. „Aber ich muß das wohl. Schulden machen ist nicht mein Fall. Und so, wie der Hase jetzt läuft, kann er nicht weiter.” Er bemühte sich nun, ihr so ruhig und klar wie nur möglich, so schonend, als er nur konnte, einen Begriff von den Mißverhältnissen ihrer Einnahmen und Ausgaben zu geben. Ohne alle überflüssigen Einzelheiten. Sehr sachlich und überzeugend.
Anfangs hörte sie zu. Nachher nahm sie neue Muster aus den Paketen und ließ sie durch ihre Finger gleiten. Als er fertig war, sagte sie außerordentlich gelassen, ohne auch nur aufzusehen: „Männi — weißt du — eigentlich brauchtest du damit doch mich nicht behelligen!”
„Aber wen denn sonst?” gab er, sich beherrschend, zurück.
„Sprich doch einfach mit Papa. Der ist für so was da. Der soll seinen großen Beutel 'n bißchen weiter aufmachen. Voilà tout!” Sie sagte das so kühl und sicher, als gäbe es keine selbstverständlichere Sache.
Perthes war von seinem Stuhl aufgesprungen. Er[S. 360] fühlte, wie ihm das Blut zu Kopf stieg. Um ruhig zu bleiben, machte er ein paar Schritte. Beim Fenster drehte er sich um.
„Davon kann keine Rede sein. Eben das will ich um jeden Preis vermeiden. Nicht einen Pfennig weiter nehme ich von deinem Vater an!” Seine Worte lauteten sehr bestimmt. Es klang eine unbeabsichtigte Schärfe durch. Um sie gut zu machen, meinte er: „Das mußt du übrigens selbst einsehen!”
Alice schwieg eine Weile. Sie legte ihre Muster langsam beiseite. Dann schob sie ihre feinen, schmalen Hände im Schoß ineinander und blickte ihn von unten nach oben, mit dem malitiösen Blick ihrer Mädchentage an.
„Das versteh' ich nicht. Verzeih — aber das wäre ja unglaublich philiströs gedacht!”
„Philiströs, beste Alli,” — er reckte sich nervös — „philiströs ist ein Wort, mit dem eine gewisse junge Dame etwas vorsichtiger sein sollte! Es ist sehr bequem, all das philiströs zu nennen, was einem nicht in den Kram paßt!”
„Oho, Männi!”
„Mein Standpunkt ist ehrenhaft, weiter nichts. Ich erwarte, daß du ihn würdigst. Und ich bitte dich —” er suchte von neuem seinen schroffen Ton, der sich ihm ungewollt gab, zu mildern und steckte die Hände, die zu lebhaften Bewegungen ausgeholt hatten, krampfhaft in die Taschen seines Jacketts. „Ich bitte dich, dich danach einzurichten. Ich verlange von dir nichts Außergewöhnliches. Nur ein bißchen Mäßigung und Beschränkung. Du wirst das mir zu lieb tun!”
Sie antwortete nichts. Sie legte den Kopf im Nacken zurück und tätschelte ihre krausen, rotblonden Haare. Dann[S. 361] verschlang sie die Hände hinter sich und dehnte sich. Sie unterdrückte ein Gähnen.
Perthes war empört über ihr Gebahren. Er fühlte, wie die Kraft, sich zu beherrschen, ihn verließ. Um nicht loszubrechen, ging er aus dem Zimmer.
Alice sah ihm verwundert nach. Sie pfiff leise vor sich hin, während sie in der Auswahl ihres Musterlagers fortfuhr. Die Geschichte an sich imponierte ihr gar nicht. Sie hatte sie auch schon wieder halb vergessen. Aber sie glaubte heute eine leidige Entdeckung erneuert zu haben: der Philister in ihm — den sie als Mädchen schon gewittert, aber nun gebannt glaubte — dieser Philister hatte hinter ihm hervorgelugt! Das war häßlich! Das degoutierte sie! Dafür würde sie sich bedanken!
Und ihre spitze, feine Zunge züngelte ganz zufällig zwischen den Lippen hervor und streckte sich einen Augenblick wegwerfend in einer nicht zu mißdeutenden Richtung ...
Die Katastrophe, die zweite, die innerhalb weniger Wochen das Haus am Wenzelsberg überfallen hatte, war so plötzlich hereingebrochen, so ohne alles Vorwissen und Vorbereitetsein, daß das Leid der Schwestern mit jedem Tag, da sie sich seiner Größe und seines Umfanges bewußter wurden, immer weiter zu wachsen schien. Wie ein Orkan war der Tod mit seinem Gefolge von Anstrengungen und Aufregungen über sie hingefahren und hatte sie betäubt; jetzt meinten sie, die Wucht der Erkenntnis müsse sie mit der doppelten Wucht des Schmerzes ganz zerbrechen.
Es verging keine Stunde, ohne daß der alte Herr, so[S. 362] gut in seinem Grimm, so männlich in seiner rauhen Selbstwehr eines feinempfindenden Herzens, so humorvoll in seiner gestrengen Paschawürde, für jeden und jedes fehlte. Wie hatte sich's unter der Hut seines geraden, freien Geistes so sicher gelebt! Wie hatte seine Bedeutung als hervorragender Gelehrter auch durch die kleinen Schrullen des Alltags unter scheinbaren Schwächen und Willkürlichkeiten durchgeschimmert. Seine Allgegenwart hatte das Haus erfüllt und gewärmt, auch wenn er abseits im zettelreichen, bücherverbauten Schreibtischwinkel saß und nur für seine römischen Kaiser zu sprechen war. Was hätte Elli darum gegeben, wenn er sie zur Antwort auf eine vorwitzige Frage, mit der sie bei ihm eindrang, aus seiner Stube hätte werfen können! Wie gern hätte Marga sich hart anfassen lassen, wenn er meinte, ihr Gemüt stählen zu müssen — er, der der Gütigste und Besorgteste war, so oft das Leben sie hart anfaßte! Und Käthe, wie willkommen wäre es ihr gewesen, ein plötzliches „Blaustrumpf!” an den Kopf zu bekommen! All das — und sein Schneckenmordgang im Weinberg, die Sprechstundenwacht auf der obersten Treppe, der gefährliche Kaffeeturnus am Nachmittag, all das und tausend anderes war vorbei. Vorbei mit jenem „nie wieder!” dahinter, das so grausam und unerbittlich nur der Tod sprechen kann.
Elli, die sonst so schnell ihre Tränen weglachen konnte, war die Verzweifeltste. Die Härte des Lebens war diesmal zu nah und unmittelbar an ihre frohe Kindlichkeit herangetreten. Auch Käthe, die besonnene Käthe, erholte sich nur mühsam. Marga und Bertelsdorf, die die Not zu einer seltsamen und nicht sehr innerlichen Trostgenossenschaft zusammenführte, mußten im Verein mit dem unermüdlichen[S. 363] Wilmanns alles aufbieten, um die beiden aufzurütteln und aufzurichten.
Die Wirklichkeit, wie sie nun einmal war, verlangte nur zu bald ein lebenstüchtiges Wollen und Entschließen.
Vater Richthoff war ein trefflicher Mensch und Forscher, aber kein großer Haushalter gewesen. Ein Vermögen hatte er nicht hinterlassen können. Das Haus war mit Hypotheken belastet. Eine kleine Lebensversicherung gab höchstens die Mittel für die nächste Zeit.
Schonend legte Wilmanns nach Ordnung des geschäftlichen Nachlasses den Geschwistern ihre Lage dar. Für Käthe war gesorgt. Bertelsdorf war wohlhabend. Obwohl er seine Verbindung mit Käthe nicht zuletzt auch nach akademischen Vorteilen berechnet hatte, war er doch zu anständig, um nicht seinen Mann zu stellen: die Hochzeit sollte, sobald es irgend anging, in aller Stille erfolgen.
Aber Marga und Elli?
Wilkens, der sich auch in diesen schweren Tagen brav wie immer benahm, stand tatsächlich vor seinem Staatsexamen. Den Doktor hatte er glücklich hinter sich. Aber auf Jahre hinaus konnte er noch nicht daran denken, ein Heim zu gründen. Für Marga stand fest, daß Elli und sie sich, womöglich Seite an Seite, eine wenn auch noch so bescheidene Existenz schaffen müßten. Sie, die Blinde, deren Zukunft den Freunden am trübsten und aussichtslosesten vor den sorgenden Augen gestanden, war von vornherein fest entschlossen, niemand im Weg zu sein, sondern mit der alten Tapferkeit und Klarheit das Leben anzugreifen und ihm ein Stückchen Unabhängigkeit abzugewinnen. An ihrem Mut rankte sich auch Elli empor.
Es war nicht leicht, ja es schien beinahe unmöglich,[S. 364] etwas zu entdecken, das den beiden eine auskömmliche Zuflucht bot.
Hundert Pläne wurden ausgedacht und wieder verworfen. Immer scheiterte die Möglichkeit der Ausführung an einem neuen Hindernis: sei es, daß die Ausbildung zu einem bestimmten Beruf unumgänglich nötig war, daß andere materielle Vorbedingungen sich nicht erfüllen ließen oder daß wohl die eine, aber nicht die andere Schwester ihre Unterkunft finden konnte.
Eines Abends vor dem Schlafengehen — es waren schon Wochen vergangen, Käthes Hochzeit und die Trennung von ihr standen dicht bevor, das Haus war zum Verkauf ausgeschrieben — erklärte Elli mit einem komischen Stoßseufzer, der die Rückkehr ihres Frohsinns ankündigte: „Nächstens werden wir für uns eine ‚Kleinkinderbewahranstalt‛ suchen müssen!”
„Warum für uns?” meinte Marga ernsthaft. „Wir könnten ja —” sie stockte und überlegte.
„Was könnten wir?” forschte Elli.
„Nun, ich dachte — aber es wird auch nicht gehen — wenn wir einen Kindergarten gründeten!” Sie mußte selber über diese Idee lachen, und Elli stimmte ein. Sie spannen das Unmögliche weiter, und es sah auf einmal gar nicht so unmöglich aus. Elli fing Feuer. Noch vor Mitternacht hatte ihr Optimismus ein fertiges Projekt. Vielleicht war ihm kein besseres Los beschieden als vielen anderen. Wahrscheinlich würde es im Frühlicht des nächsten Tages schon nichtig erscheinen. Aber für jetzt konnte man neuen Mut daraus schöpfen. Und es schlief sich so gut darüber ein ...
Es stellte sich heraus, daß das Kindergartenprojekt sich[S. 365] bei Tag immer noch sehen lassen konnte. Wenn auch von der Idee zur Wirklichkeit der Weg weit war, Marga und Elli beschlossen doch, diesen ihnen vom Zufall geschenkten Plan weiter zu verfolgen. Da ergab es sich freilich schnell, daß sie allein nicht zum Ziel kommen konnten. Obwohl einfach und häuslich erzogen oder besser durch gesunde Anlagen geworden, waren sie doch als zwei Geheimratstöchter nicht vorbereitet, sich mit unmittelbaren und harten Notwendigkeiten praktisch auseinanderzusetzen. Zum Glück war unter den Freunden des Vaters eine Dame, die nicht nur mit dem guten Ton der Gesellschaft, sondern auch mit sozialen Verhältnissen Bescheid wußte. Nicht aus Sport, wie die Gräfin Hüningen, aber aus dem Bedürfnis eines liebevollen Herzens und eines geraden Sinnes. Auch nicht aus irgendeiner wohlfeilen sozialen Theorie heraus, sondern weil für sie das Soziale sich ebenso von selbst verstand, wie es das Moralische soll. Es war dies die majestätische Frau Geheimrat Achenbach mit ihren silberweißen Scheiteln und dem Krückstock, die besondere Freundin Borngräbers. Professor Wilmanns erzählte ihr gelegentlich ziemlich skeptisch von dem Gedanken seiner Schützlinge. Sie lud Marga und Elli zu sich ein. Zuerst nahm sie den beiden alle Illusionen und machte sie rechtschaffen kleinmütig. Weil man nun einmal, wie sie überzeugt war, ein Haus nicht von oben herunter aus der Idee, sondern von unten herauf aus der Praxis bauen mußte. Dann aber, als die Schwestern dachten, sie würden also auch auf diesen Plan verzichten müssen, weil keine die nötigen Vorkenntnisse, die Ausbildung, keine die Erfahrung und Umsicht besaß, deren es bedurfte, versprach Frau Achenbach, sich der Sache anzunehmen.
[S. 366] Und sie hielt Wort.
Freilich sollte es fast ein Jahr dauern, ehe man zum Plan die feste Gestalt sah.
Da gab es zunächst für Ellis Ungestüm eine harte Probe. Durch Vermittlung von Frau Achenbach fand sich für sie in einer benachbarten kleinen Stadt ein Unterschlupf als Volontärin in einem großen Erziehungsheim, dem ein Kindergarten angegliedert war. Zu ihrem und Margas Schmerz mußten sie sich für eine bis dahin unerhörte Zeit trennen. Was sollte so lange aus Marga werden?
Das Haus, das alte Haus am Wenzelsberg, war verkauft worden. Ein kleiner Überschuß, zusammen mit der mageren Versicherungssumme, auf deren eines Drittel Käthe zugunsten der Schwestern verzichtete, konnte für zwei bis drei Jahre zum Unterhalt ausreichen. Bertelsdorf hatte das Glück, einen Ruf als Extraordinarius an eine technische Hochschule in Mitteldeutschland zu erhalten. Er zog mit seiner Frau — die stille Hochzeit wurde im Juni gefeiert — nach herzlichem Abschied noch im Lauf des Sommers davon. Elli sollte ihre Volontärstelle als Kindergärtnerin demnächst antreten. Marga mußte für sich einen Ausweg finden und fand ihn: Onkel Thiele auf Güstow in Pommern hatte zwar nicht zur Beerdigung seines Stiefbruders kommen können, aber brieflich jede Hilfe angeboten, zu der sein Herz und sein Geldbeutel, die in ihrer Weite zueinander im umgekehrten Verhältnis standen, fähig wäre. Marga nahm die Hilfe für sich an. Elli brachte sie nach Pommern.
Die Reise wurde zwar ganz anders, als sie einst vor Ellis blühender Phantasie gestanden hatte. Aber schön war sie doch. Unterwegs begrüßte man Wilkens, der[S. 367] in einem sächsischen Nest eine erste Hilfslehrerstelle gefunden und angenommen hatte. Schwermütig war er noch immer nicht geworden. Dagegen gab ihm der Stolz, sein Examen gemacht zu haben, eine gewisse breite Manneswürde. In Berlin gab es zwar keinen ungemessenen Vergnügungstaumel, wie Ellis Feuerwerk ihn einst vorgezaubert. Aber bei dem schon früher in Anspruch genommenen Kollegen Richthoffs war man einige Tage gut aufgehoben und sah von der „Weltstadt” genug, um die schaudernde Andacht nicht nur nicht enttäuscht, sondern erhöht zu sehen. Und der Empfang in Güstow war einfach urgemütlich: die sechs bis acht haferblonden, quicken Cousinen, die brave, beleibte Mama Thiele, der Onkel mit seinem verwitterten, jovialen, rostbraunen Landmannsgesicht unter dem grünen Hut mit der Spielhahnfeder, alle waren an der Bimmelbahn, freuten sich „doll” und führten Elli und Marga im besten Wagen nach Gut Güstow. Sie taten dort, was in ihren Kräften stand, um die beiden schnell bei sich heimisch zu machen. Als Elli sich nach zehn Tagen verabschiedete, war es mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ganz ernst konnte man von Thieles nicht fortfahren, sogar wenn es Marga zu verlassen galt.
Und Margas mutiger, klarer Sinn fand sich in der neuen Umgebung bald zurecht. Die schlichten Menschen in dem altväterischen Herrenhaus mit ihrer unverwüstlichen Jugend, ihrer unermüdlichen Lust an der Arbeit und am harmlosesten Vergnügen, der Gutshof mit seinem mannigfaltigen Wirtschaftsbetrieb, die weiten, kornduftenden Felder, der schattige Garten und der einsame Kiefernwald — das war eine in sich ruhende, natürliche Welt, die ihr wohltuend entgegenkam. Ihre Seele tat das ihre, um sie, wo[S. 368] und wie es nur immer ihr Zustand erlaubte, in sich aufzunehmen. Neue Eindrücke und neue Empfindungen legten sich schützend und klärend zwischen sie und ihr früheres Leben im Haus am Wenzelsberg.
Sie wollte aber nicht nur feiern und sich pflegen. Unter den Cousinen Nummer sechs bis acht waren zwei gerade im rechten Alter, daß Margas Kinderfreude an ihnen sich üben und ausbilden konnte. Aus sich heraus schuf sie sich eine praktische Methode und praktische Kenntnisse, die berufsmäßig zu lernen ihr versagt war. Die Bilder, die ihr inneres Schauen mit seltenem Reichtum und frischer Anschaulichkeit ihr gab, hatte sie früher ängstlich fast nur sich vorbehalten. Jetzt im Umgang mit Stöffy und Illi Thiele überwand sie alle Scheu. Die Kinder gaben ihr wie von selbst die Fähigkeit, sich mitzuteilen, das Geschaute in eine faßliche Form hinüberzuleiten, zu erzählen und zu fabulieren. Sie mußte ein Stück ihrer inneren Schwere opfern. Aber sie empfing dafür nicht nur eine größere Beweglichkeit des Gemüts, sondern ein echtes und gerechtes Gegengeschenk. Langsam und unmerklich fast. Der Humor, der sich früher, trotz Ellis Beispiel und trotz Vater Richthoffs grimmkräftigen Anlagen dazu, bei ihr nur spärlich hatte sein Recht verschaffen können — jetzt entwickelte er sich und streifte ab, was die früheren Mädchenjahre unter der Wirkung ihres Leidens an Überernst und zu tiefer Empfindsamkeit angesetzt hatten. Das war die Überraschung, die die neue Seele in sich trug. Und nicht nur ein Nebenbei, eine zufällige Mitgabe war das: es wurde, wenn sie es recht verstand, die beste Bedingung für ihr neues Leben. Waffe, Würze und Kraft, nicht nur[S. 369] wieder zu werden, was sie gewesen, sondern mehr. Marga verstand es recht. Sie ließ das Lachen aus Kindermund, bald das lautschallende, bald das leis verträumte, hinüberklingen in sich. Es war wieder die große Stille, die in ihr anhub, ihr Wesen durchdrang und durchleuchtete. Aber um einen Grundton reicher, reifer, lebenstüchtiger — um einen hellen, leichten, lachenden Ton.
Erst um Weihnachten, später als beide gedacht, sahen sich Marga und Elli in Käthes jungem Heim wieder.
Voll weher Erinnerungen, aber auch voll froher Zuversicht ging's ins neue Jahr hinüber.
Als die beiden in ihre Universitätsstadt zurückkehrten und bei Cousine Grasvogel Gastfreundschaft annehmen mußten, fanden sie zu ihrer Freude, daß Frau Geheimrat Achenbach nicht müßig gewesen war. Sie hatte in einer Gartenstraße — dort, wo die Altstadt in der Ebene verlief, nicht zu fern vom Mittelpunkt, aber in freier, gesunder Lage, ein nicht mehr neues, aber sauberes Häuschen ermittelt, das zur Miete ausgeschrieben war. Ein Vorgarten mit Rosensträuchern davor, ein Grasgarten mit ein paar Obstbäumen dahinter, im Erdgeschoß drei große Zimmer und die Küche, oben unterm Giebel ein luftiger Schlafraum — alles nicht großartig, aber zweckentsprechend und freundlich. Besonders wenn erst das Frühjahr Blätter und Blüten darumrankte.
Mit dankbarer Geschwindigkeit griffen Marga und Elli zu. Der Rest ihres Kapitals sicherte ihnen für die nächsten zwei Jahre die Miete; er ermöglichte auch die nötigen Anschaffungen für die „Schulstube”, die Frau Achenbach schon ins Auge gefaßt hatte. Die Wohnräume, das Empfangs- und Wohnzimmer neben der „Klasse” und das Schlafzimmer[S. 370] ließen sich mit den Möbeln, die sie aus der Einrichtung des väterlichen Hauses zurückbehalten, so vollstopfen, „daß sie vor Gemütlichkeit platzten”, wie Elli sich ausdrückte.
Dann kam der erste selige Tag hinter den eigenen Scheiben. In den Zimmern, im Vorgarten, im Grasgarten mußte man zwei dutzendmal aus- und einlaufen, bis man vor Müdigkeit fast umfiel. Hinterdrein ging das Annoncieren los und das Besuchemachen. Es gab Enttäuschungen. Und gab eine närrische Freude, als — auf einen Tag, wie es das Glück immer macht — drei kleine Leute auf einmal angemeldet wurden. Mit den von Frau Achenbach schon Angeworbenen halte man jetzt acht, drei Jungens, fünf Mädels, und konnte anfangen.
Das war ein Montag, als das Häuflein Grundstock angezettelt kam.
Erst ein strammer Bengel von fünf Jahren. Allein, mit einem roten Russenkittel, blauen Hosen, einer Botanisiertrommel und dem Finger in der Nase. Zwei flachsblonde Prinzeßchen, Hand in Hand, die mit ihrer Mama furchtbar tapfer die Straße daherzogen und, als besagte Mama sie in der Schulstube zurückließ, plötzlich mörderisch zu brüllen anfingen. Weiter ein winziger, fast zu junger Mann von vier Jahren, der sehr artig mit der Schwester ankam, aber nur blieb, wenn er bis auf weiteres sein Steckenpferd bei sich behalten konnte.
Marga und Elli wollte es angst und bange werden vor all den großen, fragenden Augen und den offenen Mäulchen, die bereit waren, zu lachen und zu weinen — in ein und demselben Atemzug.
Aber es ging viel besser, als es zuerst aussah.
[S. 371] „Tante” Elli wußte mit ihren strahlenden Augen Spiele und Späße, daß der Mann mit dem Gäulchen sein Steckenroß vertrauensvoll beiseite legte und sich vor Vergnügen schüttelte. Sie lehrte die kleinen Mädchen Papier flechten, ganz allmählich, beinahe heimtückisch, so daß sie an kein Fortgehen mehr dachten, und die Jungens, die älter waren als der Steckenpferdmann, die Sache auch probieren wollten, selbst wenn man dabei auf der Bank sitzen bleiben mußte. Und „Tante” Marga, die so merkwürdige Augen hatte, daß es einem erst ein bißchen unheimlich wurde und man nachher sie gerade deshalb streicheln mußte — die erzählte Geschichten mit ihrer warmen Stimme: die Augen mußte man aufreißen, als gelte es geradewegs in den Himmel zu schauen, und den Mund konnte man nicht mehr zusammenbringen, ehe sie zu Ende war. Man sang und sprang, man purzelte und tanzte Ringelreihen im Grasgarten, daß nach sechs Wochen ein junger Herr erklärte, es sei einfach verrückt, daß man nicht immer da sei, und zwei junge Damen, die erst nicht hatten bleiben wollen, in Tränen schwammen, weil sie zum Mittag fortgeholt wurden.
Der Reigen wurde größer. Die Freunde, auch außer Frau Achenbach, machten mächtige Propaganda. Professor Wilmanns war untröstlich, daß er sein Enkelbübchen — den Jungen Heddis, die vor einem Jahr geheiratet hatte — nicht schlankweg aus der Wochenstube zu den Richthoffs bringen konnte. Dafür bearbeitete er seine jüngeren Kollegen mit einer fanatischen Beharrlichkeit, bis sie nachgaben und ihren Nachwuchs schickten, oder, weil sie es mit der Furcht bekamen, in einem stattlichen Bogen um ihn herumgingen. Borngräber verbreitete an einem[S. 372] Kegelabend die verleumderische Nachricht, Papa Wilmanns hätte in einer Vorlesung über Homer, an Hektors Kinder anknüpfend, von dem Segen gesprochen, den eine Kleinkinderschule in Troja hätte stiften können. Der erboste Wilmanns rächte sich. Er brandmarkte seinen lügnerischen Kollegen, indem er ihm späte Heiratsabsichten andichtete, die auch keinen anderen Beweggrund hätten, als eine Frau unglücklich zu machen, und ihm, Wilmanns, bei seinen Schutzbefohlenen in der Bergfelderstraße mit Zwillingen den Rang streitig zu machen. Das war nun auch nicht wahr. Die Wahrheit war nur, daß der Indologe Jakobus Borngräber sich schämte, für die Mädels des guten Richthoff immer nur seinen guten Willen zu haben. Der Weg von seiner ostöstlichen Wissenschaft zu einem modernen Kindergarten war gar zu weit, und so ging er wenigstens mitunter den näheren von seinem verwunschenen Haus in der Uferstraße nach der Bergfelderstraße und schaute um eine Ecke in den Grasgarten. Wenn er nicht gerade das gesuchte Haus verwechselte, sondern sich zurechtfand, rollte er die verwunderten Augen, heuchelte, stehenbleibend, ehrliche Kinderliebe und schwenkte, wenn Elli ihn zufällig entdeckte und ihm zunickte, verlegen den Hut.
Natürlich blieben für Marga und Elli auch jetzt die Sorgen und Enttäuschungen nicht aus. Sie mußten es sich oft rechtschaffen sauer werden lassen, und der alte Herr hatte sich wohl auch für die Zukunft seiner „Bande”, sofern er sie je genau erwogen, etwas Besseres gewünscht. Und doch: sie selbst fühlten sich zufrieden bei ihrem Beruf. Wenn sie am Abend im Wohnzimmer, das tatsächlich „vor Gemütlichkeit platzte”, ihren Tee brauten, konnte man Marga singen und Elli lachen hören. Es kam vor, daß[S. 373] nicht nur Elli Marga, sondern Marga Elli einen Bären aufband. Sie entwickelte aus ihrer Erinnerung an Güstow in Pommern unheimliche Geschichten von halsbrecherischen Segelfahrten, schönen polnischen Schnittern und Schnitterinnen, Jagdabenteuern, die Onkel Thiele bestanden — ganze Romane, die Elli mit gläubiger Neugier aufnahm, bis sie mit Entrüstung hinter den Trug kam. Sie blieb bei nächster Gelegenheit mit rächendem Schabernack nicht dahinten. Der Strom von Jugend und Fröhlichkeit, der zwischen ihren Herzen und denen der Kinder kreiste, nahm immer wieder auch das Harte und Schwere mit sich oder löste es zur Harmonie. Elli schwor, wenn sie auf Wilkens warten müßte, bis sie alt und grau würde, wollte sie nicht verlernen, Feuerräder durch die Luft surren und leuchten zu lassen. Und Marga, die schwere Marga, lachte dazu und breitete am Feierabend die Arme aus, der Sonne zu, als wollte sie den Tag an sich raffen, das Licht aus der Ferne und Nähe, von oben und unten. Sie schlang die Hände beglückt über ihrem Kopf ineinander, so frei fühlte sie sich, so still, so in sich selber und im Licht geborgen.
Der erste „verheiratete Sommer” hatte sich für Max Perthes ziemlich einsam angelassen. Seine Schwiegereltern waren seit dem Mai fast ununterbrochen wieder auf Stift Nieburg. Auch Alice brachte dort viele Tage zu. Er selber kam nur bisweilen an einem Sonntag für ein paar Stunden hinaus.
Die Einsamkeit bekam seinen wissenschaftlichen Arbeiten sehr gut. Er fand eine eigentümliche neue Befriedigung[S. 374] in einer Tätigkeit, die seine praktische in der Klinik nach der geistigen Seite ergänzte. Die Sehnsucht nach Stille, die er so ganz verbannt und überwunden zu haben glaubte, suchte, ohne daß er es zugestanden hätte, einen schüchternen Ausweg und entdeckte ihn in dieser gelehrten Neigung, die er sich früher nicht zugetraut hatte. Für seine Person verzichtete er nach der Reise im Januar nicht ungern auf den Sommerurlaub. Er verständigte sich mit seinen Schwiegereltern dahin, daß Alice die Hochsommerwochen unter ihrer Obhut in St. Blasien verbringen sollte. Sie selber murrte anfangs über den notwendigen Verzicht auf die ihr so teure Bergfexerei. Zum Glück fand Perthes diesmal bei Exzellenz Hupfeld eine nachhaltige Unterstützung im Kampf gegen jede Unbesonnenheit. Exzellenz träumte von goetheschen Enkelfreuden und wollte seine „wilde Hummel” schon im Zaum halten.
So blieb Perthes allein und verteilte sein gleichförmiges Leben zwischen der Klinik und dem behaglichen Herrenzimmer seines Landhauses, wo er oft bis Mitternacht und länger bei der Schreibtischlampe saß. Nur selten ging er spazieren. Gegen das Flußtal aufwärts von Nieburg hatte er seit dem Sommer des vergangenen Jahres eine scheue Abneigung. Weiter hinein in die Berge oder hinaus in die Ebene reichte die Zeit nicht. In die Stadt kam er, außer auf dem Weg zur Klinik, so gut wie nie; und diesen einzigen Stadtweg legte er meist in der Straßenbahn zurück.
Wie ein Fremdling kam er sich schon vor, als er eines Abends gelegentlich einen Gang durch die Hauptstraße machte. Der Postbote hatte ihm am Morgen das Honorar für einen nebenbei geschriebenen Aufsatz in der „Medizinischen[S. 375] Wochenschrift” gebracht. Er wollte es dazu verwenden, um in aller Stille eine der großen Rechnungen des letzten Vierteljahrs zu begleichen.
In dem Modeladen, dem sein Gang galt — es war das erste Sport- und Toilettengeschäft der Stadt — erfuhr er mit Befremden, daß der Betrag schon beglichen sei. Er wollte es nicht glauben und forschte weiter. Der Besitzer, ein sehr höflicher, geschniegelter Herr, ließ ihn das Kontobuch einsehen. Es stellte sich heraus, daß die Rechnung für Exzellenz überschrieben und vor ein paar Wochen bezahlt war. Perthes zuckte die Achseln und murmelte etwas von einem unverständlichen Irrtum. Kaum konnte er vor dem Inhaber, der ihn dienstfertig bis an die Tür begleitete, Beschämung und Zorn verbergen.
Der Gedanke, daß ihm Alice hinterrücks diese Demütigung zugefügt, schien ihm unfaßbar. Sein Stolz, den er einst gezwungen, sich der bewußten Streberei zu unterwerfen, hatte sich in die letzte Festung einer peinlichen pekuniären Empfindlichkeit geworfen und machte einen entrüsteten Ausfall. Er war drauf und dran, an Hupfeld einen erbitterten Brief zu schreiben, um solche Liebenswürdigkeiten ein für allemal abzulehnen, und die Summe mitzuschicken. Nur die Rücksicht auf den Zustand seiner Frau ließ ihn dann doch davon absehen. Soviel stand ihm indessen fest: es mußte hier eine reinliche, prinzipielle Klärung erfolgen. Aber er wollte warten, bis er keine Gefahr mehr lief, ihr zu schaden. In seinem ganzen Leben hatte er nicht so viel Selbstüberwindung lernen und üben müssen, als es ihn kostete, seine Entdeckung in sich hineinzuwürgen. Die Arbeit wurde ihm für mehrere Tage verdorben, und es blieb auch nachher ein Stachel zurück, der[S. 376] immer wieder in ihm bohrte. Er sah Alice vor sich mit ihren irrlichthaften Augen, der ewig herausfordernden Miene eines Gassenjungen, den tollen Sprüngen des tollen Mädels von einst. Hatte sie denn gar keinen Sinn für den Stolz des Mannes, der sich in ihm auflehnte gegen eine unwürdige und maßlose Abhängigkeit? Verstand sie nichts von der Erniedrigung, der sie ihn vor ihren Eltern aussetzte? Die Frage tauchte wieder auf, die er seit dem Frühjahr, seit jener Todesnachricht von Richthoff und seiner freiwillig-unfreiwilligen Beichte über Marga, mehr als einmal hatte in sich zurückdrängen müssen: was wohnte hinter den grünschimmernden, flackernden Augen, hinter diesem alles zerspottenden Mund, hinter der kühlen Stirn unter den rötlich-krausen Haarwolken? Doch das war ja Unsinn! Was suchte er denn? Das Rätsel war ja eben der Reiz des Rätsels. Die Verliebtheit, noch immer mächtig über ihn, lehnte sich auf und stritt gegen das sinnlose Fragen. Gewaltsam wie früher meinte er über seine Skrupel Herr werden zu sollen. Er vergönnte sich einen dummen Streich: über den nächsten Sonntag fuhr er nach St. Blasien.
Es gab eine lustige Überraschung, als er bei Hupfelds im Kurhotel einbrach. Zwei Tage glücklicher Trunkenheit folgten: er war Alices alter Räuberhauptmann und sie sein entzückender Irrwisch.
Nachher, zu Hause, fand er, daß er trotzdem mit dem Streit in sich so fertig nicht war, wie er gehofft. Die Erinnerung an die zwei Taumeltage schwand. Die Erinnerung an seine Demütigung blieb. Er mußte ein Kompromiß schließen, um den Streit loszuwerden. Das Kind war es fortan — aber natürlich war es so — nur das Kind, das Alice ganz zu dem machen sollte und mußte,[S. 377] was sie noch nicht war. Er verlangte ja gar nicht viel. Nur ein Gran Verständigkeit, ein halbes Lot Ernst. Der mußte kommen! Die Mutter mußte in ihr erwachen und sie auf die natürlichste Weise dazu führen, seinen Stolz zu verstehen, mit ihm über diese wirtschaftlichen Dinge einer Meinung und damit häuslicher zu werden!
Perthes baute eine völlig wolkenlose Zukunft auf das Kind ihrer Liebe ...
Der Herbst war da. Alice flog ihm wieder in die Arme. So frisch und ungebärdig und fast so schlank wie immer. Perthes selbst war mit seinem Schwager, Leutnant Moritz, doch noch acht Tage in den Vogesen gewandert. Auch er fühlte sich gestärkt und von Grillen befreit, voll Zuversicht und Arbeitslust.
Mit Semesteranfang begann das alte gesellschaftliche Treiben.
Die Gräfin Hüningen hatte aus Berlin, wo sie auf der Hin- und Rückfahrt nach Borkum einen Monat haltgemacht, neue Pläne, neue Kaprizen mitgebracht. Aber wie Perthes vorausgesehen, mußte Alice sich einige Zurückhaltung auferlegen. Ihre Beweglichkeit wurde eingeschränkt, ob sie wollte oder nicht. Bei sich triumphierte er, es würde alles so werden, wie er voraussah. Wenn sie bisweilen über die Stränge schlug, wenn sie aufbrauste, weil er sie im Zügel hielt, und ihn offen einen „ekligen, ollen Philister” schalt und die dumme Plackerei ihres Zustandes verwünschte, so war er von einer unerschütterlichen Geduld und Rücksichtnahme. Er sagte sich, daß das ganz in der Ordnung war. Bei ihr wie bei allen Frauen; nur eben ihrer Eigenart entsprechend. Und er übte sich in einer Zartheit, einer Beherrschung seines[S. 378] Temperaments, die ihm niemand, am wenigsten er selbst sich zugetraut hätte.
Gleich nach Mitte Oktober kam der große Tag.
Exzellenz Hupfelds Automobil hielt fast vom Morgen bis zum Abend vor der Villa. Perthes hatte sich frei gemacht. Der Ordinarius für Gynäkologie, ein Freund des Geheimen Rats, war zugegen. Mama Hupfeld erhielt durch ihren Diener halbstündigen Wetterbericht, denn ihre furchtsame Erregbarkeit war für Wochenstuben nicht gemacht.
Um sechs Uhr abends erblickte ein schreihälsiger junger Perthes das Licht der Welt.
Hupfeld, der Großvater, und Perthes, der Vater, schüttelten sich mit gerührter Freude die Hände. Alice war schwach, aber außer jeder Gefahr. Als Perthes bei ihr eintrat, mit Blumen und lachend besorgter Miene, betrachtete sie eben verwundert das kleine Menschenbündel, das ihr die Wärterin hinhielt. Sie lächelte bei seinem Kommen.
Er setzte sich neben sie und ergriff ihre rechte Hand, um sie zu küssen.
Nach einer Weile murmelte sie ein paar Worte.
„Wie meinst du, Liebling?” Er beugte sich vor, denn er hatte nicht verstanden. „Hast du einen Wunsch?”
Sie wiederholte ihre Worte. Er meinte sich zu verhören, und ließ sie sich zum drittenmal, noch näher ihrem Mund, wiederholen.
„Nu hab' ich mir aber meinen Basar verdient! Ehrlich!” kam es klar und überzeugt hervor.
Perthes gab keine Antwort. Er legte ihre Hand zurück auf die Decke. Sein Herz klopfte zum Zerspringen. Er[S. 379] hatte mit ihr ein dankbares Wort über den tüchtigen Burschen reden wollen, den sie ihm geschenkt. Es blieb ihm in der Kehle stecken. Er lächelte ihr noch einmal zu und ging auf den Fußspitzen aus der Stube.
Während Exzellenz nach ihr sah, stand er lange im Speisezimmer am Fenster, ohne hinauszusehen in das Herbstdunkel mit den trägen Bergmassen, dem düsteren Fluß, dem gestirnten Himmel.
Das war also alles, was Alice empfand!
Sie hatte ihre Arbeit geleistet und erwartete ihre Belohnung. Kein Wort für das Kind, kein Wort für ihn.
Eine grausame Erbitterung stieg in ihm auf. Sie wurde von einer Traurigkeit abgelöst, wie er sie lange nicht gefühlt. Wie aus dem Nichts, ungerufen, aber voll und deutlich tauchte Marga vor ihm empor. Marga als Mutter — eine Welt von Innerlichkeit, von Gemüt, von Schönheit und Liebe. Er preßte die Fäuste gegen die Schläfen; seine ganze Energie spannte er an, um diese tödliche Vision abzuhalten, fortzudrängen, zu vernichten. Es gelang ihm. Aber eine unerklärliche, zornige Angst und Beklemmung blieb in ihm zurück. Es waren wieder Alices Schalksaugen vor ihm, hinter die er zu dringen suchte. Und er bebte vor dem, was er zu ergründen meinte. Er wies die Ahnung zurück. Mit dem Rest seines dämonischen Nichtwollens warf er seine erwachende Seele nieder ...
Alice genas schnell und normal. Auch der Junge machte die besten Fortschritte. Sie behandelte ihn sehr unterschiedlich: bisweilen überhäufte sie ihn mit Zärtlichkeiten; ein andermal vergaß sie ihn völlig. Beharrlich war sie dagegen in dem Wunsch, keinesfalls dem Basar[S. 380] fernbleiben zu müssen. Die „Handarbeitsbude” hatte sie wieder aufgegeben, die Musterauswahl zurückgeschickt, bald nach jener Aussprache mit ihrem Mann: nicht etwa, weil er sie überzeugt hatte, sondern weil sich ihr die Sache als zu mühselig erwies und nicht den rechten Spaß machte. Ihre neuen Pläne hielt sie geheim: sie hatte nur, schon während ihres Wochenbettes, regelmäßige Konferenzen mit Edith Hammann. Gesundheitlich war gegen ihre Teilnahme kaum etwas einzuwenden. Sie gedieh vorzüglich in ihrer koketten Krankenstube. Die Taufe wurde für Anfang Januar festgesetzt. Der Junge sollte nach seinem berühmten Großvater den Vornamen Benno erhalten.
Seltsamerweise waren auch Perthes' Gedanken mehr bei dem unnützen Basar als bei seinem Kind. Sie kristallisierten sich auf diesen Punkt mit der Hartnäckigkeit einer fixen Idee. Mit dem verzweifelten Eigensinn eines Mannes, der in seinem Glauben erschüttert ist, aber sich nichts davon eingestehen möchte, beschloß er, Alices Liebe eine Kraftprobe aufzuerlegen. Das Wohltätigkeitsfest war, unvorhergesehener Schwierigkeiten halber, auf die zweite Hälfte des Januar verschoben worden. Unter dem Weihnachtsbaum — er hatte Alice überreich und zartsinnig beschenkt — erbat sich Perthes ihren Verzicht auf diese kostspielige Veranstaltung, geradezu als Beweis der Liebe. Sie wollte nichts davon hören, aber allmählich trug seine Beredsamkeit, die so feurig sein konnte, den Sieg davon. In einem Wirbel von Liebkosungen erstickte ihr Widerstand. Sie versprach, den Basar aufzugeben.
Perthes war selig. Sein Glück schien ihm noch einmal bis in die Wolken zu reichen ...
Bennos Taufe wurde von den Schwiegereltern zu[S. 381] einem prunkenden Familienfest ausgestaltet, das die niedliche Villa Perthes von oben bis unten mit Gästen füllte. Außer den Eltern Hupfeld waren Leutnant Moritz und Cousine Hilla da, Graf und Gräfin Hüningen, Professor Hammann und Frau und viele andere. —
Perthes' Habilitationsschrift war vor Weihnachten fertig geworden und eingereicht. Er arbeitete jetzt an seiner Antrittsvorlesung, die wohl Anfang Februar folgen konnte. Er mußte sich tüchtig dranhalten, um fertig zu werden. Alice, die die „schreckliche Paukerei” sehr abgeschmackt fand, war wohlauf und verbrachte wieder, wie zuvor, die meisten Stunden des Tages außer dem Hause. Perthes war seit ihrem Weihnachtsversprechen völlig beruhigt und nachsichtiger denn je. Sie waren beide zärtlich und einträchtig miteinander, so oft eine halbe Stunde sie zusammenführte. Fragte er zufällig einmal, was sie triebe, so lautete die regelmäßige Auskunft, daß sie mit Bubi bei den Großeltern gewesen sei. Er fand das riesig nett für sie und die alten Herrschaften und bedauerte nur, daß er selber seinen Jungen höchstens einmal zwischen Tag und Dunkel in den Armen halten konnte.
An einem der letzten Januarabende, als er mit einer Zigarre von der Klinik die Allee am Fluß entlangschritt — gemütlicher als sonst, denn die Ausarbeitung seiner Antrittsvorlesung war in diesen Tagen fertig geworden —, begegnete ihm Doktor Markwaldt. Er hatte den ehemaligen Arbeitsgenossen vom Bakteriologischen Institut seit langem nicht gesehen, denn in der klinischen Gesellschaft zeigte er sich, seit er verheiratet war und an seinen wissenschaftlichen Nebenarbeiten übergenug zu tun hatte, so gut wie gar nicht mehr. Die Begrüßung war von[S. 382] Perthes' Seite sehr freundlich, von seiten Markwaldts noch überdies sehr respektvoll, mit einer kleinen Dosis nicht schlecht gemeinten, sondern eher bewundernden Spottes für den famosen Streber, der seine klatschbeflissene Nußknackerei so lange zum Narren gehalten hatte. Sie unterhielten sich eine Strecke Wegs. Vor der neuen Brücke, wo sie sich, wie in alten Tagen, trennten, fühlte sich Markwaldt noch zu einem Kompliment gedrungen.
„Im übrigen, Herr Kollege, der indische Verkaufsstand Ihrer Frau Gemahlin auf dem Basar — einfach tadellos!” Er schnalzte voll Anerkennung mit der Zunge.
Perthes, der schon Markwaldts gepolsterte kleine Hand losgelassen, blieb erstaunt stehen.
„Sie wollen mir wohl zum Abschied eine Ihrer berüchtigten Neuigkeiten aufschwatzen?” erklärte er ruhig und lachend. „Meine Frau ist ja gar nicht dort.”
„Na, da hört sich aber die totale Weltgeschichte auf! Wenn jemand flunkert, sind — verzeihen Sie mir — Sie das! Vor noch nicht zwei Stunden war ich in der Festhalle, um mir den Klimbim mal anzusehen und habe von Ihrer Frau Gemahlin einen mächtigen indischen Topfscherben — vermutlich aus Berlin SO — für unglaubliches Geld erstanden. Von der Gräfin Hüningen —”
Perthes war erdfahl geworden.
Markwaldt, nichts ahnend, hielt inne und sah ihn dumm-verdutzt an.
Doch schon im nächsten Moment hatte Perthes eine vorbeifahrende Droschke angerufen. Mit einem hastigen „Entschuldigen Sie!” verabschiedete er sich von dem fassungslosen Bakteriologen und saß im Wagen.
„Nach der Festhalle!” befahl er dem Kutscher.
[S. 383] In fünf Minuten hielt der Wagen vor dem Portal. Wie er war, stürmte Perthes die Treppe hinauf. Ohne Rücksicht auf das Geflüster der festlich geschmückten jungen Mädchen, die im Vorraum die Köpfe zusammensteckten, um dann, wie aus der Pistole geschossen, mit ihren Programmbüchern, Konfitüren und Losen auf ihn zuzuschießen; ohne rechts oder links einen der zahlreichen Bekannten zu begrüßen, ja ohne auch nur, trotz des hellen Rufes der Kassiererin, eine Karte zu lösen, eilte er in den Trubel des Saales und drängte sich beinahe barsch durch die lachende, schwatzende Menschenmenge. Sein blasser, schwarzbärtiger Kopf, in diesem Moment wirklich räuberhaft, überragte die meisten Besucher.
Bei einer der girlandenumwundenen Säulen, nahe der Komiteeloge mit ihren Fahnen und Blumengewinden, blieb er stehen. Er hatte den indischen Stand entdeckt. Inmitten eines Schwarmes von Käufern — Offizieren, Studenten, Akademikern — sah er seine Frau.
In einer glanzvollen Phantasierobe, lachend und schwatzend, verhandelte sie eben über eine bronzene Vase mit dem schlitzäugigen Prinzen von Siam, den er vom Feldberg kannte, und der gegenwärtig die byzantinisch angebetete Zierde derer um Hupfeld war ...
Der Schweiß trat ihm kalt auf die Stirn. Seine Augen schweiften, wie Halt suchend, über das Gewirr der Menschen, an den Buden längs der Wände hin. In einem Verkaufsstand glaubte er einen Augenblick neben Frau Geheimrat Achenbach Marga und Elli Richthoff zu erkennen. Es war nur eine Fiktion. Seine Zähne knirschten. Er drehte sich gewaltsam um. Er spürte, wie seine Leidenschaftlichkeit in ihm aufwallte. Seine Liebe für Alice war[S. 384] immer ein eigenartiges Gemisch widerstrebender Empfindungen gewesen. Heute brach die Wut, unstreitig die Wut aus ihm hervor. Er hätte auf Alice zustürzen, er hätte sie zu Boden schlagen können. Der Haß des Edeltieres Mann gegen das Ewigweibliche im Sinn des Ewigtierischen verdunkelte seinen Sinn. Mit dem letzten Aufwand seiner Energie rannte er aus dem Saal, wie er gekommen war. Er erreichte sein Haus, ohne zu wissen wie ...
Frau Perthes, die von seinem unerwarteten Auftauchen Kunde erhalten, zog es vor, bei ihren Eltern zu übernachten. Sie war überzeugt, daß sein Groll bis zum Morgen verraucht sein würde. So ein Pech! Sie hatte sich so sicher geglaubt! Wie war er, der sich um nichts dergleichen mehr gekümmert, nur auf den Einfall gekommen, in die Festhalle zu gehen! Gott — erfahren hätte er es wohl auch so. Bestenfalls konnte er jetzt etwas länger grollen ...
Perthes ließ sich am anderen Morgen auf der Klinik „verhindert” melden. Er wartete auf Alice.
Seine heiße Wut hatte einer kälteren, bestimmteren Platz gemacht.
Vergnügt, gleichgültig, spitzbübisch, als wäre nichts geschehen, kam sie gegen Mittag heim.
Er stellte sie mit dürren Worten zur Rede. Sie blieb höchst gelassen. Du lieber Himmel, sie hatte das dumme, überspönige Versprechen von Weihnachten nicht so ernst genommen! Sie hatte ihn ja weiter gar nicht mehr belästigt. Was wollte er denn überhaupt? Die ganze Ausstattung der indischen Bude hatte sie sich von Papa schenken lassen! Damit war doch die Sache erledigt ...
Perthes war angesichts ihrer vollendeten Skrupellosigkeit,[S. 385] dieser moralischen Stumpfheit einer unschuldigen kleinen Wilden, eines verbildeten, unartigen Kindes sprachlos. Er wollte aufbrausen. Aber sein Zorn fiel in sich zusammen. Seine Stimme versagte. Was er da vor sich hatte: das war ja die immer gesuchte, immer wieder vertuschte und verschobene Lösung des Rätsels. Hinter den lockenden Irrlichtaugen, den Gamingrimassen, den tollen Gassensprüngen — die Leere! die vollendete Hohlheit! Er hatte seinen Irrwisch in der Hand: es war ein kleines, schwarzes, unscheinbares Nichts, von dem niemand begriff, wie es zu seinem Leuchten kam ...
Er schickte Alice weg.
Hier war nichts mehr zu ändern. Hier gab es nur eines: handeln. Die Umgebung, vielleicht war es nur die Umgebung, die sie ruinierte. Aus ihr mußte sie heraus. Mit ihm. Mit dem Kind, ehe sie auch dieses vernachlässigte oder gar mit ihrer Oberflächlichkeit ansteckte!
Mit der Heftigkeit seines Temperaments drang er vom Entschluß zur Tat.
Am Nachmittag ging er zu Hupfelds.
Exzellenz war gerade von einer Reise zurückgekommen, von einer auswärtigen Konsultation, die ihn sehr abgespannt hatte. Eigentlich empfing er niemand. Ziemlich widerwillig machte er mit seinem Schwiegersohn eine Ausnahme.
Als Perthes eintrat, lag er auf seinem Diwan ausgestreckt. Mit überlegener, etwas nervöser Ruhe hörte er den Sachverhalt an. Er konnte die Aufregung des „lieben Jungen” verstehen. Er verstand ja alles. Er sagte ihm das, fügte aber hinzu, man müßte gerecht sein. Das „arme Kind” brauchte nun mal seine Extravaganzen. Im[S. 386] übrigen würde die Ehe das Ihrige tun, um sie noch mehr zu zähmen, seine Hummel. Mein Gott, das waren so die kleinen Evolutionen, die jede Ehe durchmachte! Nur sie nicht als Revolution betrachten! Dadurch machte man sie erst dazu!
Perthes hörte ehrerbietig zu. Aber er opponierte. Er glaubte aus den und den Gründen, daß die Sache ernsthaft sei. Er hatte noch immer nicht begriffen, daß „Ernst” im Hause Hupfeld nur eine höchst relative Größe war. Und er rückte geradeswegs mit seinem Wunsch heraus: Der Geheime Rat solle einwilligen, daß er mit Alice nach auswärts ginge, wenn es nur für ein paar Jahre wäre. Eine andere Assistenz oder eine Anstaltsleitung ließe sich gewiß für ihn finden.
Hupfeld sah seinen Schwiegersohn groß an. So, wie man jemand ansieht, an dessen normalem Befinden man zweifelt.
„Lieber Junge,” begann er dann herablassend und mild, „du bist überreizt. Das sind — verzeih — das sind Ausgeburten eben einer überreizten Phantasie. Du hast dir das auch nicht ernstlich überlegt. Erstens kann ich es als Vater nicht zulassen. Wir wollen Alli nicht entbehren. Zweitens brauch' ich meinen Assistenten. Drittens würde damit deine ganze Laufbahn in Frage gestellt. Was du selbst einsehen mußt.”
Perthes sah nichts ein. Hartnäckig blieb er bei seinem Wunsch. Er brachte ihn mit Nachdruck, beinahe heftig, von neuem vor. Er wollte und mußte weg von hier, um Alices, des Kindes und um seinetwillen.
Exzellenz richtete sich halb vom Diwan auf. In den blassen Augen schimmerte ein grüner, zorniger Blitz. Die[S. 387] hohe, leere Stirn faltete sich und die sonst so getragene Stimme wurde unangenehm scharf, fast bösartig.
„Niemals!” erklärte er mit der abschneidenden Gebärde des großen Mannes. „Davon wünsche ich nichts mehr zu hören! Niemals!” Und mit einer Bonhomie, die verletzender war als dieser herrische Zorn, weil sie Perthes kraß seine Stellung gegenüber dem Mann zeigte, der ihn „gemacht” hatte, setzte Exzellenz nach einer Pause hinzu: „So haben wir nicht gewettet, mein lieber Junge! Merk dir das gefälligst! Und laß mich jetzt ausruhen! Ich bin halb tot! Adieu!” Er reichte Perthes die berühmte, molluskenweiche Hand, die dieser frostig berührte.
Die Audienz war beendet.
Als Perthes wieder auf der Straße war, war er versucht, seine Arme zu heben, zu schütteln. Mußte man nicht die Ketten klirren hören, die er sich selber geschmiedet? In denen er sich selber gefangen? Er — der Streber mit Willen! Gefangen, zusammengekettet mit einem leuchtenden Nichts! Er mit seinem verwundeten, niedergetretenen Stolz! Mit seiner Seele, die er sich abgeschafft und die sich doch nicht abschaffen ließ, sondern klagte, forderte, rief und schrie! ... Seine Leidenschaftlichkeit half ihm nichts mehr. Die dämonische Lust half nicht mehr. Es gab kein Springen mehr. Er mußte schreiten. Was er sein ganzes Leben nicht gekonnt: jetzt mußte er es können! Und er lernte es. Jahraus, jahrein besser — und für ein ganzes Leben, wenn es sein sollte.
Noch im Spätherbst, nach der Habilitation, verschaffte ihm sein Schwiegervater ein Douceur. Für die rauhe Weigerung gewissermaßen ein liebenswürdiges Heilpflaster.[S. 388] Er erhielt den Titel außerordentlicher Professor. Schon anderthalb Jahre später wurde er etatmäßig.
Doktor Max Perthes, etatmäßiger außerordentlicher Professor an der Universität ..., erster Assistent an der Chirurgischen Klinik und stellvertretender Leiter. Wie hübsch das klang! Er hatte Karriere gemacht ...
Der Kindergarten in der Bergfelderstraße gedieh.
Im ersten Jahr mußte man noch vom Kapital zusetzen. Im zweiten verdiente man und hätte mehr verdient, wenn nicht eine Scharlachepidemie die Kleinen ferngehalten hätte. Im dritten hatten, einer ernsthaften Konkurrenz zum Trotz, Marga und Elli Richthoff „den” Kindergarten für die Herrchen und Dämchen der besseren Gesellschaft. Das bescheidene, aber für sie so wichtige Werk war gelungen.
Nicht zuletzt war es nach wie vor der feste und treue Rückhalt an den Freunden des einstigen Hauses am Wenzelsberg, der den Schwestern ihre Stellung auch äußerlich erleichterte. Sie bewegten sich frei und gleichberechtigt im alten gesellschaftlichen Kreis, und die Achtung, die sie dort genossen, wirkte auch bei Fernerstehenden nach. Jene kleinen, oft schmerzhaften Schikanen und Zurücksetzungen, mit denen die Gesellschaft noch manchmal die Frauen bedenkt, die sich mutig auf ihre eigenen Füße stellen, blieben ihnen so gut wie ganz erspart. Die Jahre gaben ihnen in dem Häuschen an der Bergfelderstraße ein richtiges, behagliches Heimgefühl, und sie konnten sich ihr Leben ohne die erfrischende Tätigkeit, ohne die Freiheit innen und außen kaum mehr denken.
[S. 389] Marga war jetzt längst stark und klar genug, um auch die Erinnerung an die Vergangenheit nicht mehr zu scheuen. Sie gedachte ihrer Liebe und ihres Leids ohne Bitterkeit. Elli hatte es lange vermieden, von sich aus an jene Geschehnisse zu rühren. Als ihr dann zufällig einmal ein Wort entschlüpfte, das auf den Sommer in der Mühle Bezug hatte, wollte sie darüber forteilen. Aber Marga knüpfte selbst an ihre Bemerkung an, und seither sprachen sie mehr als einmal darüber, und je mehr die Zeit sie davon entfernte, um so geklärter und gelassener. Nicht nur ihre eigenen Gefühle, sondern auch den Mann, der sie ihr gegeben und genommen, sah sie in gerechtem und versöhnendem Licht. Sie hatte begriffen, daß jene Liebe — die Wonne, die sie ihr geschenkt, und das Weh, das sie ihr bereitet — für sie ein Stück notwendiger Entwicklung hatte sein sollen: sie wollte keines von beiden missen. Mußte es für ihn nicht dasselbe gewesen sein? Wenn Elli Perthes' Charakterlosigkeit, seinen treulosen Verrat, seine Unaufrichtigkeit und unverantwortliche Schuld mit den ihr eigenen Kraftausdrücken belegte, ließ es Marga nicht gelten. Ihr gereiftes Urteil verstand gerade das Herbste, das, was Elli am entschiedensten verdammte: seine jähe Wendung von ihr zu einer so anders gearteten Frau, einer der Richthoffschen so unähnlichen und entgegengesetzten Welt. Sie verstand sie aus den tiefen Gegensätzen seiner damals nur scheinbar, nur mit Gewaltsamkeit ausgeglichenen Natur. Sie ahnte, was er schon in seinem Abschiedsbrief angedeutet: Perthes hatte Seite an Seite mit ihr zu einem höheren, innerlicheren Menschentum emporgestrebt. Aber er hatte sich über seine Kraft getäuscht, als er den Zwiespalt in sich niederhalten wollte.[S. 390] Er konnte sein Naturell nicht zum Gleichschritt mit ihr, und darum auch überhaupt nicht in ihre Bahn zwingen. Als er das eingesehen, war er mit einem verzweifelten Entschluß in ein anderes Geleise gesprungen, das ihn nach der entgegengesetzten Seite führte.
Ob Perthes dort gedieh? Ob er die ihm angemessene Bahn gefunden? Ob ihn diese Bahn abwärts mitnahm oder auf einem schweren Umweg auch zu einer Höhe, zu seiner Höhe führte? Vor solchen Fragen machte Marga halt. Sie wollte nur das Notwendige auch für ihn als Notwendiges anerkennen und achten. Weiter durfte sie nicht denken. Das verbot ihr ihr Stolz.
Sie forschte nie nach ihm. Das Äußerliche seines Lebens trug ihr ab und zu ein Gespräch oder eine Bemerkung anderer zu. Dafür war die Stadt zu klein, die akademische Gesellschaft, trotz ihrer verschiedenen, sich gegeneinander abschließenden Sphären zu eng, als daß es hätte anders sein können. Daß er verheiratet war, daß er ein oder zwei Kinder hatte, das er sich habilitiert hatte und jetzt Professor war, das waren Dinge, die sie hörte wie eine Fremde von einem Fremden. Gleichgültige Dinge, die nicht bis in ihre große Stille drangen. —
Bei einem kleinen Zwischenfall sollte Marga nach Jahren beweisen, daß ihr inneres Gleichgewicht kein gemachtes, sondern ein echtes und dauerndes war.
Es war an einem Vormittag im späten Frühling. Die Kleinen waren eben aus ihrer fröhlichen Schule abgezogen. Elli und Marga saßen in behaglichen Liegestühlen im Grasgarten unter den Bäumen, die ihre letzten Blüten auf die dichten Grasbüschel streuten, und plauderten. Da meldete das Dienstmädchen, das sie sich[S. 391] jetzt zur ständigen Hilfe leisten konnten, eine Dame mit ihrem Jungen.
Elli, die die Anmeldungsgeschäfte gewöhnlich erledigte, stand auf und ging nach vorn.
Das Zimmer zwischen Wohnzimmer und Schulstube diente zum Empfang. Dort erwartete die Dame sie und erhob sich bei ihrem Eintritt vom Sofa, während ein Junge, ein kräftiges Bürschchen mit großen schwarzen Augen, einer kecken Stupsnase und zottigen, schwarzen Haaren, sehr resolut auf seinem Stuhl sitzen blieb. Elli glaubte sie nicht zu kennen.
„Frau Alice Perthes!” stellte sie sich mit leichtem Nicken vor. „Ich komme, um Ihnen meinen Jungen vorzuführen,” fuhr sie in kühlem, etwas herablassendem Ton fort. „Der kleine Kerl soll etwas Räson lernen — er wird meinem Mann und mir zu wild.” Das „meinem Mann” erfand sie. Denn Perthes wußte nichts von diesem Schritt seiner Frau. Sie folgte da nur ihrer Laune und dem Bedürfnis, durch das Kind nicht belästigt zu sein.
Elli war zuerst betreten. Sie erinnerte sich jetzt sofort dieses beweglichen Gesichts mit seinen glimmenden Augen, der gestülpten Nase, dem spottsüchtigen Mund, das ihr ja vom Sehen bekannt war. Es war für sie eine ausgemachte Sache, daß sie diese Frau Perthes mit ihrem Sprößling abwimmeln würde. Mit der Sicherheit, mit der Frauen, besonders solche, die keinen Grund haben, sich wohlgesinnt zu sein, einander durchschauen, erriet sie, daß von Alices Seite auch eine frivole Neugierde mit im Spiel war. Sie wollte sich bei der Gelegenheit so en passant mal diese Richthoffs, von denen die eine ihres Mannes Flamme[S. 392] gewesen, etwas näher ansehen. Das prickelte in den umherschweifenden Augen ...
„Sie kommen leider zu keiner ganz glücklichen Zeit, gnädige Frau,” erklärte Elli korrekt, aber rund heraus, nachdem sie ihr gegenüber Platz genommen.
„Wieso?” fragte Alice.
„Wir haben für das laufende Halbjahr schon so viele Kinder angenommen, daß es beim besten Willen nicht gehen wird.”
„Sie werden mich doch nicht abweisen wollen, Fräulein?” Alice lächelte und sah Elli malitiös und ungläubig an. Sie hatte heraus, daß es sich um eine Ausrede handelte und war jetzt erst recht entschlossen, beharrlich zu sein. Sie versuchte sich noch entschiedener in der gönnerhaften Selbstgewißheit der großen Dame. Man hatte ihr den Richthoffschen Kindergarten empfohlen. Sie ließ die Namen von Exzellenz Papa, den gräflichen Herrschaften von Hüningen beiläufig einfließen und wollte Elli offenbar klar machen, daß die beiden Fräuleins sich nur geschmeichelt fühlen dürften, wenn sie ihren Jungen brächte. Sie stellte die Protektion gewisser erster Kreise in verlockende Aussicht.
Das hieß bei Elli gerade Öl ins Feuer gießen. Sie wäre am liebsten grob geworden. Die hochtrabende Manier, die Alice sich gegen die Töchter eines Kollegen ihres Vaters herausnahm, reizte sie. Doch sie besann sich. Sie ließ Alice ausreden. Der Schalk in ihr siegte über den Unmut, den sie empfand.
„Aber das hilft ja alles nichts,” sagte sie dann vergnügt. „Und wenn Sie uns einen leibhaftigen Prinzen brächten, gnädige Frau, wir haben uns mal vorgenommen, mehr Kinder einstweilen nicht aufzunehmen. Es wird[S. 393] nicht gehen!” Sie wechselte mit Frau Perthes einen Blick, der diese nicht im Zweifel lassen konnte, daß ihr die Exzellenzen und Grafen ganz und gar nicht imponierten.
Der Junge, der aufmerksam zugehört hatte, kletterte von seinem Stuhl herunter. Ihm schien die Sache jetzt reif für seine persönliche Einmischung. Er erklärte auf eigene Faust, sehr flott und selbstbewußt: „Denn nicht! Komm, Mama! Ich will fort!”
Das „Denn nicht” hatte er jedenfalls von seiner Mama gelernt. Alice selbst, die über die Entscheidung ihres Jungen boshaft lächelte, hätte am liebsten auch mit einem geringschätzigen „Denn nicht” das Feld geräumt. Aber ihre ursprüngliche Absicht, den Jungen, der im Haus lästig wurde, los zu werden, war ihr nun doch zu wichtig. Gewandt wie sie war, unterdrückte sie ihren Ärger. Sie gab dem Kleinen einen leichten Klaps für seine Ungezogenheit und verlegte sich aufs Bitten. Sie wurde beinahe zutraulich. Allerhand Reisen standen ihr bevor. Sie war gesellschaftlich sehr in Anspruch genommen. Sein Vater hatte wenig oder gar keine Zeit für den Jungen. Das Kinderfräulein würde nicht immer mit ihm fertig. Kurz: sie wünschte, daß er einige Stunden am Tag unter guter Aufsicht war und etwas Sitzleder bekam.
„Ich denke, Sie werden ihn trotz der Überfüllung nehmen!” schloß sie, bedeutend liebenswürdiger und zuvorkommender, als sie begonnen.
Elli blieb gleichwohl fest. Sie wollte nicht.
Für sich und noch mehr für Marga sträubte sich ihr Gefühl gegen die Aufnahme gerade dieses Perthesschen Jungen, die überdies nur dem eigensüchtigsten Wunsch der Mutter dienen sollte. Sie machte kein Hehl daraus,[S. 394] daß ihre Schule den Kindern nicht das Heim ersetzen könne noch wolle. Zudem schien ihr der Junge — so aufgeweckt und kräftig er war, mochte er noch nicht vier Jahre zählen — entschieden zu jung. Sie nahmen grundsätzlich keine zu kleinen Kinder mehr. Und dann führte sie noch einen ganzen Wall von anderen Gründen auf, um nur unter keinen Umständen nachgeben zu müssen.
Alice Perthes war im Begriff, mit einer unartigen Wendung nun doch die Verhandlung abzubrechen und ihrerseits zu danken, als sie nebenan, in der Klasse, zu der die Tür angelehnt war, Schritte hörte.
„Elli,” ertönte es von dort mit gedämpfter, fragender Stimme.
Es war Marga, die sich das lange Ausbleiben Ellis nicht erklären konnte und sie an einen Besuch bei Wilmanns, den sie beide vor Tisch noch zu machen hatten, erinnern wollte.
Elli und Alice erhoben sich gleichzeitig.
Elli hatte keinen anderen Gedanken, als dies Zusammentreffen zu verhindern.
Aber Alice war die Besonnenere und Entschlossenere.
„Ihre Fräulein Schwester wird vielleicht nicht ganz so hartnäckig sein!” meinte sie lächelnd.
Auf die Gefahr hin, unfreundlich zu werden, wollte Elli dazwischen treten. Aber Frau Perthes hatte schon die angelehnte Tür geöffnet. Und da stand Marga, ihr gegenüber, nichts ahnend, ruhig, nur nach dem Geräusch der Stimmen und Bewegungen in ihr Dunkel lauschend.
Wie um sie zu schirmen, flog Elli an dem verhaßten[S. 395] Eindringling vorbei auf die Schwester zu. Sie war bleich vor ohnmächtiger Wut.
„Marga, ich sagte der Dame schon, daß wir unmöglich, so leid es uns tut, noch ein Kind annehmen können,” stieß sie erregt hervor. Sie hatte ihren Arm von rückwärts auf Margas Schulter gelegt und suchte ihr durch den Druck ihrer Hand irgend ein Zeichen zu geben.
Der kleine Junge, der erst neugierig vorgetreten war, zog sich vor den fremden, blicklosen Augen Margas mit der allen Kindern eigenen Scheu vor dem Ungewohnten hinter seine Mutter zurück.
Alice, die die Blinde mit einem Gemisch von Interesse und Befriedigung durch ihren bekannten Blick von unten nach oben gemessen, ließ sich durch nichts beirren.
„Sie vergessen Ihrer Fräulein Schwester zu sagen, wer ich bin,” bemerkte sie halb höflich, halb spöttisch zu Elli. Sie war nicht bösartig. Aber in diesem Moment verfiel sie dem kleinen, niederträchtigen Weibsteufel, dem Frauen unter sich und zumal unter ähnlichen Umständen kaum wehren können. „Alice Perthes”, sagte sie mit eigentümlich klangvoller Betonung, die sonst ihrer hastigen, schnoddrigen Redeweise durchaus fremd war.
Das Geschoß war abgeschnellt.
Elli ließ trostlos, empört die Arme sinken. Sie hatte es nicht hindern können. Unruhig und ängstlich wanderten ihre Blicke zwischen Alice und der Schwester hin und her.
Der kleine Benno stand jetzt mit seinen großen, schwarzen Augen mutig neben seiner Mutter, fuchtelte mit seinem Spazierstöckchen und setzte dann eigenmächtig den breitrandigen Strohhut auf, den er vorher in der Hand gehalten.
Marga hatte die Farbe gewechselt. Ihre Augen[S. 396] hatten sich auf den Boden geheftet. Sie fühlte auf sich den herausfordernden Blick dieser Frau, die sie nicht kannte und die ihr das Glück ihres Lebens zerstört hatte. Alte Gefühle des Schmerzes und der Bitterkeit drangen in einer heißen Welle zu ihrem Herzen und zerkrampften es, als wollten sie ihren Mut, ihre Haltung vernichten. Aber die Welle brach sich an ihrem Willen.
Einige Sekunden hatte das unbehagliche Schweigen gedauert.
„Ich glaube, wir könnten den kleinen Mann doch noch aufnehmen, Elli,” sagte Marga dann gelassen und fest. Nur ihr bewegterer Atem ließ eine vorausgegangene Erschütterung erraten. „Meine Schwester hat wohl vergessen, daß heute morgen ein Mädchen abgemeldet wurde. Es wird gehen, nicht wahr, Elli? Wenn Sie uns den Jungen anvertrauen wollen, bitte ich darum, gnädige Frau!” Sie sprach jetzt so klar und korrekt, als gelte es eine abgemachte, rein geschäftliche Sache höflich zu beendigen.
Alice war nicht leicht zu verblüffen. Aber diese Ruhe und sanfte Bestimmtheit, wo sie eine pikante, demütigende Verwirrung erwartet hatte, war so sehr der Gegensatz ihres eigenen zerfahrenen Wesens, daß sie eine gewisse Verlegenheit nicht unterdrücken konnte.
Mit einem höflichen „Ich danke Ihnen, ich werde meinen Jungen morgen schicken,” verbeugte sie sich und nahm den Kleinen bei der Hand.
Vor der Tür drehte sie sich noch einmal um.
„Um wieviel Uhr doch gleich?” fragte sie mit einer halben Wendung des Gesichts, mit dem wiedergewonnenen Ausdruck ihrer unzerstörbaren Nonchalance, der zeigte, daß ihre Gedanken über dies Intermezzo schon hinwegeilten.
[S. 397] „Im Sommer um neun Uhr,” gab Marga zurück.
Als sich die Tür hinter Alice Perthes geschlossen, stürzte Elli außer sich an Margas Hals.
„Aber Margakind! Was hast du da gemacht?! Wie konntest du diese abscheuliche Person, die ich glücklich abgewimmelt hatte, diesen verzogenen, ungebärdigen Bengel von einem Jungen — ich versteh' dich nicht! Ich mache nicht mit! Ich will nicht! Wie konntest du nur?” Sie zitterte vor Aufregung und Empörung.
Marga zog sie mit einem verlorenen Lächeln noch enger an sich.
„Verstehst du das wirklich nicht, Kleinchen?” fragte sie leis.
Und Elli sah zu ihr auf, in ihre Augen, die mit der Sicherheit eines Sehenden eine weite unendliche Ferne faßten, mit der ihre Stille eins war.
Und sie verstand Marga ...
Am anderen Morgen kam der kleine Perthes mit seinem Kinderfräulein.
Er war wild, jähzornig, eigenwillig. Aber er war nicht der erste seiner Art und nicht der letzte. Zwei, drei Wochen konnte das vielleicht dauern. Dann saß er da und lauschte, sprang und sang, jubelte und spielte, ein harmloses Kind wie die anderen. Was bedeutete da noch sein Name?
Der Geheime Rat hatte seinen Schwiegersohn im Automobil an die Bahn gebracht.
Perthes war zu einer Konsultation nach Konstanz berufen worden. Da Hupfeld in diesen Tagen seinen[S. 398] Sommerurlaub antreten und zunächst auf Nieburg, späterhin irgendwo in der Schweiz oder Tirol möglichst ungeschoren sein wollte, gab es zwischen beiden noch allerhand zu besprechen.
Seite an Seite schritten sie auf dem Bahndamm auf und ab, ganz in ein berufliches Gespräch vertieft.
Hupfelds hohe Gestalt, mit den Jahren etwas vornübergebeugt, aber immer noch sehr repräsentativ mit dem glatten, ebenmäßigen Gesicht, den gebietenden Gebärden, dem verjüngenden blauen Jackettanzug, machte Aufsehen wie immer. Der nicht ganz so große Professor Perthes in seinem Reisehabit aus grauem Loden wirkte nicht so distinguiert und hatte nichts von der weltmännischen Liberalität der Exzellenz. Die frühere gesunde Bräune seines Teints hatte einen bleiernen Ton bekommen. Der Ausdruck der Züge hatte die einstige jugendlich-unbekümmerte Brigantenhaftigkeit verloren. Ein starrer Ernst gab ihm auf dem ersten Blick einen abweisenden, fast hochmütigen Anschein. Doch dagegen zeugte das tiefe Auge, das noch immer, wenn auch selten und mit Beherrschung, in dunklem Feuer aufleuchten konnte. Wenn er mit wiederholter, hastiger Gebärde die Mütze lüftete und sich über die dichten, schwarzen Haare fuhr, las man auf der Stirn aus starren, rissigen Falten ebenso viel rastlose geistige Arbeit wie in sich verschlossene Bitternis. Der Mund hätte die gleiche Sprache gesprochen, wäre er nicht in dem krausen Bart zurückgetreten, dem sich da und dort frühgraue Fäden eingesponnen hatten.
Es wurde zum Einsteigen abgerufen.
Hupfeld und Perthes verabschiedeten sich mit einem[S. 399] Händedruck, der mehr korrekt als herzlich war. Während der D-Zug aus der Halle rollte, schritt der Geheime Rat den Bahnsteig zurück nach seinem Automobil. Auf der Fahrt zur letzten Fakultätssitzung des Sommersemesters saß er nachdenklich in seiner Ecke. Ohne einen Gruß zu versäumen, dachte er an seinen Schwiegersohn. Nach dem Ausdruck seiner Mienen waren es nicht ausschließlich freundliche Gedanken, die ihn beschäftigten. Diese Konsultationen nach auswärts, die durch den steigenden Ruf des Jüngeren sich mehrten, begannen ihm lästig zu werden. Seine Eitelkeit, die wahrhaftig in einem Leben voll glänzender Erfolge auf ihre Kosten gekommen war, witterte längst in Perthes den Kommenden, der ihn, den Gehenden, vielleicht abzulösen berufen war. Er hatte die Fähigkeiten des um mehr als eine Generation jüngeren Mannes „entdeckt”, wie er sich schmeichelte. Er hatte ihn „gemacht”. Vielleicht würde er gegenüber seinem Schwiegersohn Regungen der Mißgunst doch unterdrückt haben; vielleicht hätte er sich sogar mit den Jahren direkt überwinden und seinen Nachfolger selbst auf den Schild heben können. Aber die Ehe seiner Tochter — das konnte auch ihm, dem Optimisten, längst kein Geheimnis mehr sein — war nicht, was er sich und Alli gewünscht hatte. Der junge Mann, den er „gemacht” hatte, entwickelte einen Charakter, dem nach seiner Auffassung die Weite und Freiheit weltmännischen Denkens abging. Als ewig nachgiebiger Vater stand er durchaus auf seiten seines Kindes. Alices skrupellose Lebenslust war ein Zug seines eigenen Wesens, wenn er auch in ihm sich stilisiert hatte. Ihre spitzbübische, spottsüchtige, wechsellüsterne Art zeugte von Humor, Gesundheit des Geistes, jugendlicher Frische. Dagegen sah[S. 400] er bei Perthes eine Rechtschaffenheit, ja trockene Ledernheit — besonders in wirtschaftlichen Fragen, die ihm kleinlich vorkam. Er traf sich mit Alli durchaus in einer Auffassung, die in jeder konsequenten Folgerichtigkeit und Festigkeit nur Pedanterie und Spießertum belächelte. Wie oft beklagte er in seinen Gesprächen mit der körperlich immer schwerfälligeren Mama Hupfeld das „arme Kind”. Bei dieser Klage war er auch in seinen Reflexionen angelangt, als sein Auto vor der Universität hielt. Er versäumte trotzdem nicht, dem strammen Pedellen, der mit gezogener Mütze in Front stand, huldvoll zuzunicken, während er ausstieg. Durch die Gruppen grüßender und starrender Studenten schritt er fürstlich nach dem Fakultätszimmer, wo die Korona der Kollegen das große Tier noch eben durchgehechelt hatte, nun aber mit übertriebener Ehrerbietung empfing. —
Perthes fuhr inzwischen in seinem D-Zug südwärts.
Er saß allein in seinem Abteil. Reichlich mit wissenschaftlichem Lesestoff versehen, kümmerte er sich nicht um die sommerlich-frohe Natur vor den Fenstern. Er war ja früher ein leidenschaftlicher Naturliebhaber gewesen. Wie oft hatte er auf einer Fußwanderung, wie oft rudernd und sportbeflissen sich seinen seelischen Gleichmut wieder herzustellen gesucht. Er hatte sich diese Naturschwärmerei abgewöhnt. Wie er sich im Lauf der Jahre auch die seelischen Aufregungen abgewöhnt hatte. Nicht von heute auf morgen; auch nicht mühelos und leicht. Es hatte Kämpfe gekostet. Sein explosives Temperament gab sich nach den ersten Enttäuschungen seiner Ehe nicht zufrieden: Perioden der Gleichgültigkeit wechselten mit solchen lauter, zorniger Auflehnung; Perioden blinder Verliebtheit mit[S. 401] anderen, in denen er Alice durch Güte, Vernunft, eiserne Strenge erziehen wollte. Vorübergehend meinte er die Quelle alles Übels in der Umgebung zu sehen, die ihn selbst zuerst bestochen hatte. In sich hatte er längst die Freude an all dem blendenden, geselligen Treiben ausgerottet. Dabei half ihm die wachsende Arbeit. Aber es kostete ihn doch mehr, als er sich je gestand. Er hatte von Natur nichts weniger als die Anlage zur Einseitigkeit. Eine gewisse Besonderheit hatte er immer geliebt. Doch sie war himmelweit entfernt von jenem Philistertum, das man mit Recht so nannte. Um Alices willen stritt er gegen dies Milieu mit seiner öden Oberflächlichkeit, seinem Taumel der Mode und Sensation, seiner erlogenen Freiheit und Götzendienerei des Geldes, der Grafenkronen, der Flottheit und Zeitgemäßheit um jeden Preis. Doch sie — sie dachte nicht daran, sich ihrem Element abspenstig machen zu lassen. Mit ihrer Geschmeidigkeit, ihrer mehr als vorurteilslosen Bosheit, ihrem girrenden Lachen widerstand sie allen Versuchen, sie zu ändern. Sie wollte so sein, wie sie war, weil sie gar nicht anders konnte. Sie entwand sich ihm und schnitt eine Grimasse gegen seine besten Absichten. Die Erkennung, die dauernde und absolute, vollendete sich. Der Räuberhauptmann war ihr ein gräulicher Philister, ein lebensfeindlicher Grämling geworden. Hinter dem Irrlicht sah er, nüchtern und für immer, das seelenlose Nichts. Noch eine Spanne argwöhnischen Belauerns — und eines ging kühl und fremd neben dem anderen, überließ es seiner Torheit, lebte nur noch für sich und in sich selbst.
Alice war nicht zu entwickeln und entwickelte sich nicht. Aber er, Perthes, vollzog mit sich eine langsame,[S. 402] qualvolle Wandlung. Die Gebundenheit, unerbittlich wie die öde ziehenden Jahre, zwang ihn zu einer strengen Beherrschung, die sich im Anfang von Stunde zu Stunde üben mußte. Er lernte mit Schmerzen den Schritt, er, dessen gegensatzvolle Natur nur immer den Sprung gekannt hatte. Ohne seinen Beruf, ohne die peinlich gepflegte, später natürliche und echte Liebe zur Wissenschaft hätte er diese aufreibende Wandlung nicht durchgehalten. Er wäre verzweifelt und verkommen. So war ihm die Umbildung gelungen. Er ging in seinem nur geistigen Dasein, seiner einseitigen Starre eines Gelehrten wie in einer Rüstung. Freilich war sie schwer; sie litt kein Rechts und Links, keine heftige Bewegung nach außen und innen. Seine Sinne hatten zu schlafen und erst recht seine Seele. Da gab es keine Vergangenheit. Da gab es keine Natur, wie die, die sonnig mit tannenschwarzen Tälern, mit bunten Wiesen, mit goldgelben Kornhängen am Fenster des Zuges vorbeiflog. Er war blind. Viel blinder als jemand, den er gekannt — vor langer, langer Zeit ...
In Konstanz hatte Perthes noch am Abend die Konsultation, zu der man ihn gerufen.
Am anderen Morgen rettete er dank seiner richtigen Diagnose und der Kraft seiner Hand das Leben eines zwanzigjährigen jungen Menschen. Mit dem gutmütigen Lächeln, das seine starken weißen Zähne unter dem Bart vorblinken ließ, diesem Lächeln, das er so selten und nur noch im Beruf, in einem Moment selbstvergessener Zufriedenheit fand, konnte er dem geängstigten Vater im Vestibül der Klinik die nach menschlichem Ermessen geglückte Rettung mitteilen.
[S. 403] Er entzog sich den lebhaften Danksagungen. Aber sie klangen mit der Freude über die gelungene Operation doch noch in ihm nach, als er später durch die alten, ehrwürdigen Straßen von Konstanz schlenderte. Er mußte einen Abendzug abwarten. Was er sich sonst kaum vergönnen wollte und konnte, ein paar müßige Stunden, sie wurden ihm hier aufgedrängt. Er hatte es seit langem aufgegeben, seinen Stimmungen nachzuhängen. Aber auf der Terrasse des Inselhotels und nachher am Hafen, beim Blick auf die sanfte, klare Wasserfläche, überraschte ihn, den Entwöhnten, ein weiches, versöhnliches Gefühl. Einer jener Augenblicke, in denen ein Hauch der Ewigkeit alle Bitterkeit von Menschen und Verhältnissen wegzuspülen scheint. Er überließ sich halb schmerzlichen, halb süßen Träumereien. Gab es keine, auch nicht eine Möglichkeit des Glücks, in der er und die Frau, die er nun einmal zur Gefährtin seines Lebens gemacht, sich zusammen finden konnten? Es fiel ihm ein — woran er bis jetzt nicht gedacht —, daß Alice nach ihren letzten Nachrichten vielleicht kaum einige Stunden entfernt war. Sie wollte, wie sie geschrieben, acht Tage einer Einladung der Gräfin Hüningen folgen, die auf der Schweizerseite des Bodensees ein Landhaus besaß. Er rechnete die Tage nach. Seine Frau, die in Straßburg bei dem Bruder ihres Vaters, dem Obersten Hupfeld und Cousine Hilla zu Besuch war, mußte jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach drüben, jenseits des Sees, bei den Hüningens sein.
Eine fiebrige Unruhe gesellte sich zu seiner Stimmung.
Wenn er, so wie jetzt mit sich, mit ihr spräche? Wenn sie beide es doch noch einmal, in Ruhe und Vernünftigkeit, wie zwei Leute, die sich kennen und keine Illusionen[S. 404] mehr haben, versuchten, zu einer erträglichen Einigung zu kommen? Zu einem kühlen, sachlichen Frieden, aber doch zu einem Frieden! Schon um des Jungen willen. Für den er keine Zeit hatte, und den er doch zärtlich liebte. Der zwischen ihnen verkümmern und verderben mußte ...
Seiner aufwallenden Stimmung folgend, saß Perthes eine Stunde später auf dem Verdeck eines Dampfers. Er wußte, daß er nicht „klug” handelte, sondern sich nur von einer jähen, unklaren Regung bestimmen ließ. Vielleicht würde er Alice gar nicht treffen; oder sie würde seinen Besuch, seine Vorschläge mit Achselzucken als Sentimentalitäten beiseite schieben, gar in seinem Überfall eine mißtrauische Absicht sehen. Aber die abendliche Fahrt auf dem sanftbewegten, blauen See mit dem Blick auf ferne Alpengipfel hielt einen Schimmer jugendlicher Vertrauensseligkeit in ihm wach.
In Rorschach stieg er aus.
Zu Fuß ging er, nach den nötigen Erkundigungen, aus der Stadt am Strand entlang.
Als er die Villa des Grafen Hüningen gefunden, zögerte er beim Anblick der herabgelassenen Jalousien, die dem Haus hinter dem hübschen, herrschaftlichen Garten ein verlassenes Aussehen gaben.
Er zog an der Torklingel.
Der Gärtner öffnete. Er berichtete, die Herrschaften wären gestern abgereist.
Perthes war niedergeschlagen und ernüchtert. Er nannte seinen Namen und erkundigte sich, ob seine Frau dagewesen sei. Die Frau des Gärtners, die dazukam, wußte Bescheid. Die Dame, die bei den gräflichen Herrschaften zu Besuch gewesen, war einen Tag früher als die Herrschaften[S. 405] selbst abgereist. Wohin wußte sie nicht. Aber richtig! Daß sie das nicht vergaß! Das traf sich ja gut: eine Depesche wäre für die Dame heute morgen noch abgegeben worden. Da sie keine Adresse gehabt, hätte sie sie einstweilen liegen lassen müssen. Die Gärtnersfrau holte sie. Perthes nahm sie gleichgültig an sich, grüßte und ging mechanisch zurück nach der Stadt.
Die Stimmung, die ihn hergebracht, war mit der Enttäuschung verflogen. Wahrscheinlich war Alice wieder nach Straßburg zurückgekehrt. Doch er wußte nichts Genaueres über ihre Pläne. Er öffnete die Depesche, die ihm vielleicht darüber Aufschluß gab. Sie lautete in lakonischer Kürze: „Bin morgen Baden-Baden. Ballonfahrt Dienstag.” Der Ort der Aufgabe hatte französischen Klang. Die Nachricht kam wohl aus der Westschweiz. Eine Unterschrift fehlte.
Wenn das Wort Ballonfahrt nicht gewesen wäre, hätte Perthes das Telegramm so gleichgültig wieder zu sich gesteckt, wie er es mitgenommen und gelesen. So öffnete, las und schloß er es zu wiederholten Malen. Er kümmerte sich so gut wie nicht mehr um das, was Alice tat oder ließ. Aber zwei Dinge hatte er ihr, als sich danach ihre Gelüste regten, ein für allemal verboten. Rennen und Ballonfahrten. Er hatte erfahren, daß sie im Frühjahr in Iffezheim am Totalisator gespielt hatte. Wie er sie kannte, gab es für sie keine gefährlichere Verlockung als das Spiel, und da die Ausgaben das einzige waren, über das er wachte, verbot er ihr den Besuch von Pferderennen aufs entschiedenste. Ebenso wußte er, daß sie sich längst sehnlich wünschte, an einer Ballonfahrt teilzunehmen. Diesen Wunsch verweigerte er ihr, nicht nur weil der Ballonsport[S. 406] ihm zu kostspielig war, sondern weil er die Mutter seines Kindes nicht leichtsinnig der Gefahr ausgesetzt wissen wollte. Die Depesche, die ihm jetzt in die Hände geraten war, verriet ihm, daß sie hinter seinem Rücken nicht daran dachte, seinen Willen zu respektieren.
Gern hätte sich Perthes auf der Rückfahrt mit dem Dampfer nach Friedrichshafen, und von da mit dem Nachtschnellzug heimwärts, wieder nichts sehend und nichts hörend, in seine gelehrte Fühllosigkeit, seinen dichten, schweren Panzer gehüllt. Doch immer wieder tauchte diese Depesche vor ihm auf. So gewiß, als sie unbekümmert um sein Verbot, sich zu einer Ballonfahrt verabredete, würde sie auch sicherlich an den Rennen teilnehmen und spielen, so oft sie wollte. Wenn er erst dahinter kam, daß ihre Ausgaben wieder ins Ungemessene gingen, gab es Mittel und Wege, ihr seinen Willen deutlich zu machen. Möglich auch, daß sie sich nach wie vor von ihren Eltern manches bestreiten ließ: er hatte die beschämende Kontrolle darüber längst aufgegeben. Nur mit seinem Willen durfte das nicht sein. Es war auch vollends einerlei, ob sie Ballon fuhr oder nicht! Und doch — jetzt — wo er sie durch einen Zufall ertappte, gerade bei einem Sport, den er ihr streng versagt hatte — schaffte die törichte Nachricht in ihm. Wenn Alice alles tat, was sie wollte, warum er nicht? Noch vor einigen Tagen hatte er den Brief einer auswärtigen medizinischen Fakultät erhalten, der ihn — einstweilen als Extraordinarius, aber mit der sicheren Aussicht auf das Ordinariat — an eine norddeutsche Universität berief. Er hatte sich die Angelegenheit noch kaum überlegt. Wollte sie auch nicht weiter überlegen, denn er mußte, wollte er nicht mit seinem Schwiegervater, mit[S. 407] Alice einen Sturm bestehen, doch ablehnen. Aber mußte er denn wirklich? Wenn seine Frau handelte, wie es ihr beliebte — brauchte er sich seinen Weg durch Rücksichten verlegen zu lassen? In dem brausenden, hämmernden Nachtzug, im Gedanken an diese malitiöse Depesche, erwachte doch noch einmal sein Widerstand gegen die ewige Unfreiheit, der er verschrieben sein sollte. Er hatte heute nachmittag, in einer schwächlichen Stimmung, von einem kleinstmöglichen Glück geträumt. Mit Träumen war da nichts ausgerichtet! Wenn er handelte?! Wenn er, allen Widerständen zum Trotz, seine Frau nun doch noch aus ihrer unseligen Umgebung herausriß und verpflanzte? Wenn nicht mehr zu seinem und ihrem Heil, so zu dem des Jungen! Darüber brütete er ...
Daheim, nach einigen Stunden Schlafs, wurde sein Entschluß fest. Er wollte die Gärung, die mit der Unterbrechung seines mechanischen Arbeits- und Lebensganges in ihm erregt worden war, benutzen. Er knüpfte Verhandlungen mit der auswärtigen Fakultät an, die ihn rief. Als er den nötigen Brief abgesandt, ging er elastischer als sonst in seine Klinik.
Merkwürdig — die belanglose Depesche, die er vom Bodensee mitgebracht, verfolgte ihn weiter. Schließlich konnte es ihm gleichgültig sein, mit wem sich Alice in Baden-Baden traf. Mit den Hupfelds aus Straßburg, mit ihrem Bruder oder mit anderen Bekannten. Nichtsdestoweniger beschäftigte ihn die Frage.
Auf dem Nachhauseweg traf er gegen Abend den Grafen Hüningen. Er sprach fast nie mit dem wappennärrischen Gardeüberrest, der so geschäftig und gelehrt tat. Heute fragte er ihn höflich nach dem Befinden der Gräfin.[S. 408] Sie war wohlbehalten mit Edith Hammann zurückgekehrt. Der Graf selber war den Seinigen entgegengefahren und hatte sie in Friedrichshafen abgeholt. Er sprach auch von dem Besuch Alices in Rorschach. Perthes schämte sich fast zu fragen, wohin seine Frau gereist sei. Er murmelte eine unverständliche Ausrede und tat es doch. Alice hatte auf Nachrichten aus Freiburg gewartet, wie der Graf sich entsann. Als sie nicht eintrafen, war sie aufs Geratewohl zu ihrem Bruder gereist.
Nun wußte Perthes, daß sie sich höchstwahrscheinlich mit dem Leutnant nach Baden-Baden verabredet hatte. Von ihm mochte die Depesche sein.
Zu seiner Verwunderung erhielt er noch am selben Abend eine Ansichtskarte von seinem Schwager Moritz aus dem Engadin, von einer Hochgebirgstour. Also konnte der es doch nicht sein, mit dem sie zusammentreffen wollte. War sie gar nicht nach Freiburg gereist? Sondern direkt nach Baden-Baden gefahren oder ... Er sträubte sich gegen seine alberne Grübelei. Aber so töricht er sich vorkam, er hatte keine Ruhe.
Sehr gegen seine Gewohnheit ging er am nächsten Nachmittag mit seinem Jungen um die Teestunde nach Stift Nieburg. Man nahm ihn freundlich auf. Besonders der Kleine war stets willkommen und wurde stets mit Kuchen vollgestopft. Wo Alice gerade war, wußten Hupfelds nicht. Sie hatten zuletzt eine Karte vom Bodensee gehabt. Die Gräfin Hüningen kam zum Tee. Sie brachte Grüße von Alice und erzählte Wunder von ihrem famosen Aussehen.
Dann sprach man von unzähligen Dingen, die Perthes nicht interessierten, die er aber aus Artigkeit mit anhörte.
[S. 409] Der Geheime Rat fragte die Gräfin beiläufig nach Professor Hammann, ihrem Schwiegersohn. Sie wußte nicht viel von ihm. „Überarbeitet” wie er gewesen, hatte er einige Wochen vor Semesterschluß seine Vorlesungen und Studien abgebrochen und Touren in der französischen Schweiz gemacht. Auf dem Genfer See hatte ihn eine Regatta gelockt. Der Sport war nun einmal sein Steckenpferd. Und auf der Rückreise wollte er, so viel sie wußte, noch ein oder zwei Ballonfahrten in Baden-Baden mitmachen. — Edith, seine Frau, war, da sie einem freudigen Ereignis entgegensah, mit den Hüningen am Bodensee gewesen und jetzt daheim — indolent und schön wie immer, wie die Gräfin selbst lachend hinzusetzte.
Es war an sich nichts Besonderes, was Perthes auf Nieburg hörte. Und doch versetzte es ihn in gesteigerte Unruhe. Daß die Depesche an Alice aus der französischen Schweiz kam, konnte der reine Zufall sein. Daß sie und Hammann sich eventuell mit dritten Bekannten in Baden-Baden zu einer Ballonfahrt trafen, war möglich, aber für ihn jedenfalls uninteressant.
Und doch konnte er es auf dem ganzen Heimweg von Stift Nieburg nicht unterlassen, seine einmal entfesselte Spürkraft weiter zu üben. Er spottete über sich und seinen spielerischen Eigensinn und kam gleichwohl nicht davon ab.
Der kleine Benno, den er an der Hand hatte, war sehr ungehalten, daß sein Papa ihm oft gar keine oder ganz unzureichende Antworten auf seine zahlreichen, höchst wichtigen Fragen gab. Er rief gebieterisch. Wenn Perthes dann aufschrak aus seinem Sinnen, war er wütend über den Jungen und über sich. Was ging denn[S. 410] mit ihm vor? Wollte er sich zum Detektiv ausbilden? Wollte er einen neuen Giftstoff in seine ohnehin vergifteten Beziehungen zu Alice hineinpraktizieren? Entdeckte er in sich ein Talent zur Eifersucht? Jetzt noch, wo ... Verächtlich biß er sich auf die Lippen. Es fiel ihm die Geschichte ein, die ihm seine Frau seinerzeit als Tauschobjekt für seine mißlungene und abscheuliche Beichte über sich und Marga Richthoff angeboten und später auch wirklich erzählt hatte. Wahrscheinlich kam er darauf, weil Benno, jetzt schon zum dritten Mal eine ihm sehr bedeutend scheinende, Perthes sehr ungelegene Erzählung aus dem Richthoffschen Kindergarten mit wachsender Bestimmtheit vortrug. Er hörte daneben deutlich das saloppe Tauschgeständnis, das Alice damals abgelegt: wie sie mit diesem kleinen, patenten Hammann, dem gut gepflegten Sportsmann und Auchbakteriologen, geflirtet hatte; wie sie sich beide ganz nett hätten leiden können, aber eines Tages bei dem Gedanken an Verlobung und Heirat „auseinandergelacht” hätten. Ob es für Alice ein größeres Vergnügen hätte geben können, als zu wissen, daß er sich in solchem Zusammenhang an ihre Geschichte erinnerte? Daß er sich nun auch noch auf die abgegriffene Spezialität der Eifersüchtelei verlegen wollte? Das Vergnügen wollte er ihr denn doch nicht gönnen! —
Daheim ließ Perthes den Jungen zu Bett bringen und warf sich entschlossen auf seine Arbeit.
Keine Minute länger durfte diesem müßigen und kläglichen Spintisieren gehören.
Er arbeitete bis tief in die Nacht. Erfüllt von wissenschaftlichen Ideen, völlig abgezogen von den Torheiten der letzten Tage, legte er sich zu Bett.
[S. 411] Er schlief sofort ein, mit der bleiernen Schwere, die der erschöpfte Kopf gab ...
Nach wenigen Stunden fuhr er beklommen in die Höhe. Ein Traum, ein hämischer, raffinierter Traum hatte ihn aufgeschreckt. Alle Klügeleien, seine eingestandenen und verborgenen Verdächtigungen hatte dieser Traum mit folgerichtiger Teufelei zu einem höhnischen Bild vereinigt, das ihn mit seiner alpdrückenden Gewißheit aufjagte. Er rang nach Atem, nach Beruhigung. Er suchte seine Beklemmung abzuschütteln. Aber sie wich nicht. Seine Phantasie arbeitete fort, ob er wollte oder nicht. Er wußte gar nicht, ob er überhaupt wach geworden war, oder ob er weiterträumte. Bestimmte Einzelheiten, Äußerungen, die er vergessen, mit halbem Ohr gehört, Szenen des Zusammenseins mit den Hammanns bei seinen Schwiegereltern, bei jenen selbst, hier im eigenen Haus — sie standen in einem neuen, verfänglichen Licht vor ihm. Besonders war es ein Wort Alices, das sie bei einer Schmauserei mit ihrem göttlichen Leichtsinn in die Unterhaltung geworfen und das jetzt mit beinahe physischer Leuchtkraft vor ihm brannte. „Edith, wie wär's, wenn wir uns heute mal so richtig übers Kreuz amüsierten, du mit meinem, ich mit deinem Kreuzritter?!” Hatte es dabei nicht boshafter und tückischer denn je in ihren Augen geflackert? Und sie hatten alle vier darüber gelacht. Er sah und hörte dies Lachen. Er lachte aus Höflichkeit, Edith Hammann belustigt in ihrer stumpfen, so gar nicht abenteuerlustigen Art, Alice kurz und aufreizend, wie sie es gern tat, und Hammann mit verlegener Lautheit ...
Perthes war aufgesprungen.
[S. 412] Mit behender Hast, immer unter dem Zwang dieser Wahnvorstellungen, halb träumend, halb wach, warf er sich in seine Kleider. Es dämmerte noch kaum, und er zündete ein Licht an. Er war sich keiner bestimmten Absicht bewußt und handelte doch von Sekunde zu Sekunde mit der exakten Konsequenz eines Nachtwandlers.
Er stieg die Treppe hinunter.
Dann betrat er das Zimmer seiner Frau neben dem Speisezimmer. Vor ihrem Schreibtisch machte er halt und setzte seine Kerze nieder.
Für einen Augenblick lichtete sich sein Bewußtsein. Wollte er eine Schlechtigkeit tun? War er wahnsinnig geworden? Wo war er? Was trieb er?
Doch schon faßte ihn wieder der Zwang. Gewißheit um jeden Preis mußte er haben!
Er riß an der verschlossenen Schublade des Schreibtisches. Der Widerstand entfachte nur seine Wut. Mit seiner ganzen, in der Anspannung gewaltigen Körperkraft erbrach er sie. Alice hätte in diesem Moment erfahren können, daß der Räuberhauptmann in ihm noch nicht vom Philister völlig verschlungen war!
Er wühlte in dem wahllosen Durcheinander von Rechnungen, Briefpapier, Einladungen.
Schließlich, ganz zu hinterst, aber gar nicht etwa versteckt, fand er Briefe mit Hammanns unpersönlicher Schrift. Einen, zwei, die nichts von Belang, nichts Überzeugendes enthielten. Dann eine Briefkarte, mit Bleistift geschrieben — sechs, acht Zeilen — die ihn auf den Stuhl vor dem Schreibtisch taumeln ließen.
Das war die Gewißheit, die er gesucht hatte. Alice hatte ihn mit Ludolf Hammann betrogen ...
[S. 413] Mit der Gewißheit kam für Perthes das Erwachen aus dem dämmerhaften, halbwachen Zwang, der ihn zu einer häßlichen Gewaltsamkeit fortgerissen hatte ...
Wie lange er so gesessen, wußte er nicht. Die Wahrheit, grausam, hämisch, konsequent, wie der Traum, der ihn gepeinigt — erst tobte sie in ihm mit Gefühlen der Verachtung, des Schmerzes, des entwürdigten Stolzes, die in seinem Innern stritten und die Vorherrschaft vor seinem Verstand begehrten; dann gab sie ihm einen kalten, nüchternen Entschluß, mit dem er sich erhob.
Er nahm die Briefe an sich, ging zurück in sein Schlafzimmer und machte sich fertig.
Früh am Morgen, viel früher als sonst, schallte seine Stimme mit ungewohnter Schärfe durch das Haus. Er überschüttete die Dienstboten, das Kinderfräulein mit einer Flut von Befehlen, so daß sie in heller Bestürzung umeinander liefen.
Das dauerte etwa eine Stunde.
Dann verließ er mit seinem Jungen die Villa. Nicht einen Tag länger konnte er unter diesem Dach bleiben. Die Lüge seiner Ehe, eines trugvollen, jahrelangen Scheinlebens war zu Ende und sollte es auch äußerlich sein.
Erst wollte er sich mit seinem Kind in einem Hotel einquartieren. Doch die Besonnenheit riet ihm von diesem zu auffallenden Schritt ab. Er erinnerte sich an sein Junggesellenquartier bei Fräulein Eschborn. Dorthin schleppte er seinen verstörten, heulenden Jungen. Dort fand er — da das Semester vorbei war und die Studenten fehlten — ein Notquartier. Im ersten Stock: ein Arbeitszimmer und ein Schlafkabinett für ihn, eine Stube für[S. 414] Benno und das Kinderfräulein, das nachkommen sollte — war alles, was er einstweilen brauchte. In weniger als einem halben Tag war der Auszug vollendet ...
Die Wochen des Kriegs begannen.
Es waren entsetzliche Wochen, in denen das Herz aus allen Wunden blutete und der Kopf doch Meister bleiben mußte.
Die erste kategorische Fehdeanzeige fiel nach Nieburg wie eine Bombe. Mama Hupfeld legte sich, wie immer bei aufregenden Gewittern, sofort zu Bett. Exzellenz, von der Unschuld seiner Tochter überzeugt, schäumte. Er schrieb an Perthes, den Mann, den er „gemacht” hatte, einen Brief voll hochfahrenden Zorns, in dem er seinem aufgespeicherten Groll gegen das Geschöpf seiner Gutmütigkeit ohne jede klassische Bezähmung freien Lauf ließ. Er wollte seinen Schwiegersohn demütigen und zur Räson bringen. Als Antwort schickte dieser die Abschrift der belastenden Briefkarte von Hammann. Der Geheime Rat stutzte. Er wurde vorsichtig, denn er witterte Skandal, und den mußte er um jeden Preis vermeiden. Noch hoffte er, daß die Rückkehr Alices, die stündlich bevorstand, eine andere Erklärung geben und das Beweismaterial ihres Mannes erschüttern würde. Alice kam. Sie war ein bißchen erstaunt. Ein bißchen bestürzt. Ein bißchen empört. Im Grund fand sie die erbrochene Schublade das beste, was ihr Mann nach Jahren einmal wieder geleistet hatte. Was für Exzellenz das Schlimmste war: sie tat ihm nicht den Gefallen, ihre Beziehungen zu Hammann zu beschönigen. Sie leugnete nichts. Zerknirscht war sie auch nicht. Das Abenteuer mit[S. 415] Hammann war eine Laune gewesen, die sie, gelangweilt von ihrem Mann und von aller Regelmäßigkeit, früher oder später kosten mußte. Skrupel empfand sie dabei nicht. Das Unangenehme, das daraus entstand, wurde durch das Neue, das es brachte, aufgewogen. Spaßhaft hätte sie es gefunden, wenn sich Perthes und Hammann um ihretwillen geschossen hätten. Darauf wartete sie auch. Vielleicht war es doch etwas Galgenhumor, was sie zur Schau trug, jedenfalls ein Galgenhumor, der diesmal sogar ihren Vater fast zu zorniger Verzweiflung brachte ...
Perthes hatte in der Tat daran gedacht, Hammann zur Verantwortung zu ziehen. Eine Zeitlang begehrte sein Blut diese knallende Lösung. Aber dann übermannte ihn der Ekel. Sollte er sich für ein Chimäre schlagen? Die Ehre von Alice war längst nicht mehr die seine. Mochten Splitterrichter des Duellkomments, dem er für einen würdigeren Fall die Berechtigung nicht versagte, ihn verdammen. — Den Eklat eines Prozesses scheute er nicht. Doch dagegen kämpfte der Geheime Rat mit allen Mitteln. Sogar denen einer höflichen, bittenden Überredungskunst. Diese war es nicht, die bei Perthes verfing. Aber die ruhigere Erwägung sagte ihm, daß er selbst durch einen grellen Skandal mehr verlieren als gewinnen konnte. Auch noch seine wissenschaftliche Laufbahn zu opfern — dazu fühlte er sich nicht bemüßigt und, im Hinblick auf sein Kind, nicht berechtigt. Bis zum Herbst dauerte das Hinüber und Herüber der feindlichen Lager. Dann brachte der Vorschlag des Hupfeldschen Rechtsanwalts die Lösung, die beide Parteien — mit Einverständnis der sehr degoutierten Gräfin Hüningen, des kleinlauten[S. 416] Professor Hammann und der verstörten, so gar nicht nachtragenden Edith — annehmen konnten und mußten. Perthes, der den Ruf nach Norddeutschland endgültig angenommen hatte, würde dorthin mit Benno übersiedeln. Alice sollte sich weigern, den neuen Wohnsitz mit ihm zu teilen. Seine wiederholte Aufforderung, ihr Widerstand erzielten dann innerhalb der gesetzlichen Frist den Scheidungsgrund, der ihm das Kind ließ und vor der Öffentlichkeit den Skandal annähernd verschleierte.
Mit einer Komödie sollte symbolisch die Ehe von Max und Alice Perthes ihren Abschluß finden.
Es war Oktober geworden.
Ein warmer, milder Herbst lag über dem Land. Sanft bräunten und röteten sich die Laubwälder an den Hängen und auf den Kämmen der Berge. Wehmütig hängte sich die dunkelgoldene Sonne an die erstarrende Erde. Sie spielte melancholisch mit den Wellen im Fluß, die unerwärmt unter ihrem liebkosenden Schein davonliefen. Es war wieder die große, stille Zeit des Abschiednehmens gekommen, in der so viel Reife und Tiefe der Stimmung liegt. Es ist im eisknirschenden Winter, im knospensprengenden Frühling, im kornknisternden Sommer nicht so viel Musik als im Herbst: aber es ist die Musik der Heimlichen und Reifen; die Musik derer, die vom Sterben die Kraft nehmen und die Lust zum Leben; es ist die Musik der großen Stille ...
Das luftige Giebelzimmer über der Stadt und dem Fluß, in dem Perthes als Junggeselle gewohnt hatte,[S. 417] war frei geworden. Trotz der Gegenvorstellungen von Fräulein Eschborn, die das Quartier für ihn nicht mehr standesgemäß finden mochte, war er in den letzten Wochen aus dem ersten Stock dort hinaufgezogen. In einer Zeit, wo alles um ihn wankte und niederbrach, empfand er das hartnäckige Bedürfnis, sich an diese Giebelstube von einst zu klammern. Er hatte dabei nicht erst seine Gefühle und Erinnerungen umständlich befragt: daß er nicht stimmungsselig da oben würde, dafür sorgten die Aufregungen dieser Zeit des Kampfes, des Abschlusses seiner klinischen und akademischen Pflichten, die zahlreichen Schreibereien und Abmachungen, die die Übersiedlung an einen neuen Ort der Tätigkeit, in andere Bedingungen des Lebens notwendig machten.
Erst in der zweiten Woche des Oktobers trat eine kurze Pause und unfreiwillige Ruhe für ihn ein. Er hatte sich auf der Klinik verabschiedet. Der Kampf um die Scheidung von Alice, so aufreibend und nervenzehrend, war abgeebbt. Seine neue Stellung war in allen Teilen gesichert. Nur die kleinen Geschäfte, die mechanisch und nichtssagend sind, Formalitäten verschiedener Art hielten seinen Fortzug noch um einige Tage auf. In der Entspannung, die jetzt unmerklich während dieser gezwungenen Mußezeit seinen Geist und sein Herz überkam, beschlich es ihn doch manchmal eigen in seinem Junggesellenzimmer, und wenn er sich über die Brüstung des Fensters lehnte, hörte auch er vom Fluß herauf, über die sonnenglänzenden Dächer weg, herunter von den tannenbescheitelten und laubwaldumkränzten Bergen die heimliche, tiefe Musik des Herbstes. Erst vernahm er nur ihre ersterbende Wehmut: allein, mit leerem[S. 418] Herzen, gebrochen, ärmer als er einst eingezogen, zog er jetzt durch dieselbe Tür wieder davon. Er wehrte den Erinnerungen, aber sie gaben ihn nicht frei: seine jungenhaft-törichte Schwärmerei für Hilde König; sein unfähig-gewaltsames Ringen nach der Höhe, wo Marga gestanden und sein schwacher, schuldvoller Absturz; seine tolle, trügerische Taumel- und Leidensgeschichte mit Alice — Erlebnisse dieser Jahre hatten leer- und totgefegt, was in ihm war. Aber dann hörte er heller, deutlicher. Hörte hinter die Töne der Wehmut: aus der traurigen Weise des Sterbens löste sich leise, aber fest eine andere. War er nicht doch reicher geworden bei all der Armut? Da war seine Liebe zur Wissenschaft, eine dauerhafte, echte Liebe, die nichts mit dem haltlosen Hin und Her früherer Neigungen gemein hatte. Da war sein Junge, Fleisch von seinem Fleisch, ein Ziel und eine Hoffnung, auch wenn er Blut von ihrem Blut hatte. Und da war er selbst, ein Mann, ein Wollender, einer der sich kannte und beherrschte, der nicht sprang, sondern schritt — vielleicht doch empor — nicht mehr zu der Höhe, die Marga gehörte, aber doch zu einem, zu seinem Gipfel: zu der Persönlichkeit, die er werden konnte. Er hörte etwas, auch er, von der Musik der Heimlichen und Reifen, derer, die vom Sterben die Kraft nahmen und die Lust zum Leben ...
In solchem Lauschen war er eines Morgens versunken, als das Kinderfräulein mit Benno bei ihm eintrat. Sie hatte den Kleinen vor kaum einer halben Stunde in den Kindergarten gebracht. Fragend wandte sich Perthes nach den beiden um.
Der Junge machte ein verschlossenes, eigensinnig-finsteres[S. 419] Gesicht und zerrte sein Fräulein am Rock, als wollte er sie hindern, zu reden. Das junge Mädchen sah verlegen und unschlüssig aus, als traute es sich nicht zu sprechen und auch nicht zu schweigen.
Perthes, der seinem Jungen mehr Aufmerksamkeit schenken konnte als sonst, musterte ihn und das Fräulein.
„Was gibt's?” fragte er mit knapper Stimme. „Die Schule ist doch noch nicht zu Ende?”
„Nein, Herr Professor, aber —”
„Laß mal das Fräulein los! Setz dich artig auf einen Stuhl! — Nun, aber?”
„Die Damen sagten — Fräulein Richthoff sagte — er solle nicht wiederkommen!” stammelte das Mädchen ratlos.
„Was heißt das?” Perthes runzelte die Stirn. „Ich versteh' das nicht. Ist etwas vorgefallen? Reden Sie doch!” Er näherte sich dem Fräulein und warf gleichzeitig einen besorgten Blick auf den Kleinen, der zwischen Trotz und Tränen auf seinem Stuhl schwankte. Er hatte seinerzeit erst nachträglich von Alice erfahren, daß sie den Jungen in den Richthoffschen Kindergarten gebracht. Es war ihm peinlich gewesen, aber er hatte es nicht mehr ändern können. Wenn Benno von dort erzählte, beschränkte er sich meist auf das Zuhören und lenkte ihn bald ab. Auch das jetzige Thema kam ihm ungelegen, und er hätte es gern so schnell wie möglich abgetan.
Das Kinderfräulein rückte schüchtern mit vielen Wenn und Aber heraus. Benno wäre gestern unartig gewesen; er hätte die Damen erzürnt; die Jüngere hätte heute entschieden erklärt, er dürfe nicht mehr kommen.
Perthes horchte betreten auf.
[S. 420] Er schickte das Fräulein aus dem Zimmer. Dann nahm er seinen Jungen vor. Eine harte Arbeit. Der kleine, schwarzköpfige Wicht mit seinen brennenden Augen war verstockt. Aus dem dunklen Blick leuchtete die Heftigkeit des Vaters, und um den kindlichen, tiefroten Mund spielte etwas von Alices launischer Selbstwilligkeit. Erst gab es ein verlegen-hartnäckiges Schweigen. Dann ein lautes, zorniges Geheul. Endlich ein aufgelöstes, schluchzendes Gestammel, dem Perthes nur allmählich Sinn abgewinnen konnte. Zwei Namen wechselten in der jammervollen Beichte am deutlichsten ab. Tante Elli und Tante Marga. Der kleine Bursche wußte nicht, wie hart und unselig gerade diese beiden von ihm endlos wiederholten Namen in die Ohren seines Vaters klangen. Und was nachkam, traf Perthes noch schlimmer. Aus all dem Gestammel und Geschrei wickelte sich heraus, daß er, offenbar in einem Anfall von Jähzorn, die eine Tante geschlagen hatte — Marga. „Ein ganz klein wenig nur,” wie er mit erneutem Aufschluchzen versicherte. Er erwartete offenbar von diesem Schluß- und Hauptstück seines Geständnisses das äußerste, denn er duckte sich in sich zusammen und würgte noch zweimal „ein ganz klein wenig nur” hervor. Aber er mußte mit Staunen die Wahrnehmung machen, daß sein Vater ganz still und stumm blieb. Er sah schüchtern zu ihm hin. Aus Perthes' Gesicht war alles Blut gewichen. Eine erschreckende Verzweiflung und Traurigkeit, wie sie der Missetäter im Matrosenkittelchen noch nie an einem Menschen gesehen, malte sich in seinem Antlitz. Bewegungslos, mit herabhängenden Armen und geschlossenen Augen saß er vor dem Kleinen, und dem wurde dies Starren und Schweigen[S. 421] unheimlich, viel unheimlicher als das heftigste Schelten. Er brach von neuem in Tränen aus.
Perthes stand auf.
Er rief das Kinderfräulein und ließ den Jungen, ohne ein Wort an ihn zu richten, in die andere Stube führen.
Als er allein war, setzte er sich vor seinen Schreibtisch. Er nahm seinen Kopf zwischen seine beiden Hände und preßte ihn, als wollte er ihn zerdrücken ...
Das Schwerste und Trübste, was in seiner Seele geschlummert, woran er auch in seinen wehmütigsten Abschiedsgedanken nur aus ängstlicher Ferne vorbeigestreift war, wie an einem kranken, schmerzhaften Glied — das hatte sein eigener Junge mit seiner kindlichen Untat grell und rücksichtslos aus ihm heraufgezerrt. Die kleine Hand, die sich da im Jähzorn erhoben, was hatte sie im Grund anderes verübt, als was er, der Vater, vor einigen Jahren so viel brutaler, härter, grausamer getan: Marga geschlagen! — Wie das traf! Wie es schmerzte! Wie es von der verstecktesten Wunde seines Lebens, der größten, mitleidslos den Notverband riß und das Blut quellen und quellen ließ. Die Erinnerung an Marga, Stunde um Stunde fast des Vergangenen, umtoste ihn. Aus gespenstiger Weite, aus der Verbannung von Jahren war ihr Bild nahe gerückt, so nahe, daß es ihn mit seiner Deutlichkeit betäubte. Es war ihm wie gestern, daß er sie verloren, verlassen und preisgegeben hatte! An jener Wegscheide, zwischen Stift Nieburg und der Sägemühle im Tal, war er fehlgegangen. Weit und weiter in die Irre ...
Doch das war ja nur der Schrei seiner Seele, auf[S. 422] den er horchte. Ein Schwelgen in nutzloser Sehnsucht nach Verscherztem und Verlorenem. O — er hatte immer nur an sich gedacht! Was Marga gelitten, hatte er es je in seinem vollem Umfang ausgemessen? Hatte er seine Schuld — ja, einen Teil davon hatte er abgetragen! In sich selbst! Aber vor ihr und an ihr war er so schuldig wie damals. Er hatte ja gewartet, bis die Hand seines Jungen sich kindisch an ihr verging, als sollte sich das Wehetun vererben vom Vater auf den Sohn. Wie schmerzhaft er geschlagen, davon wußte der Kleine nichts. Dafür trug sein Vater die Verantwortung.
Ruhelos gefoltert, die Stunden vergessend, schritt Perthes in seinem Zimmer auf und nieder.
Genugtuung konnte er Marga keine geben. Für das, was geschehen war zwischen ihr und ihm, gab es keine Genugtuung. Konnte er trotzdem nichts, gar nichts tun?
Natürlich mußte er für den Jungen um Entschuldigung bitten. Er warf ein paar Zeilen aufs Papier. Am Nachmittag legte er sie beiseite und schrieb einen Brief, der mehr, der ein Bekenntnis seines ganzen Lebens wurde. Daraus machte er von neuem — jedes Pathos und jede Floskel verachtend — ein knappes Billet, das nichts besagte. So ging es nicht! Er zerriß alles, was er geschrieben. Wenn er etwas tun wollte, mußte es etwas anderes sein.
War er denn feig? Zu feig um das zu versuchen, was einfach anständig war?
Er, er selbst mußte gehen, er mußte seinen Jungen zu ihr führen.
Als ob er das nicht längst gewußt hätte?! Nicht immer wieder fortgeschoben und umgangen hätte?!
[S. 423] Vielleicht ließ sie ihn abweisen, vielleicht — doch das war es nicht, was ihn bestimmen durfte. Es gab nur diesen Weg. Keinen sonst. Den mußte er gehen. Als Mann von Ehre und Gewissen. —
Am nächsten Morgen war er mit sich fertig.
Mit seinem Kleinen hatte er nicht wieder gesprochen. Nicht einmal „Gute Nacht” hatte er ihm gesagt. Jetzt teilte er ihm in kurzen Worten mit, was geschehen sollte. Sie beide würden um elf, ehe die Schule zu Ende war, zu Tante Marga gehen. Und Benno würde vor den Kindern sie laut und deutlich um Verzeihung bitten. Jedes Sträuben war ausgeschlossen.
Der Junge machte ein langes Gesicht. Fast eine Grimasse wie seine Mutter. Aber er war zu zerknirscht. Er hatte zu viel geweint und fürchtete die traurig-entschlossenen Augen seines Vaters zu sehr, um ein Wort des Widerwillens oder auch nur eine Gebärde dagegen zu finden.
Dann gingen sie zur festgesetzten Stunde in die Stadt.
Perthes hatte sich den Weg beschreiben lassen. Trotzdem ging er in unbekannten Straßen fehl. Auf den Jungen war kein Verlaß. Er war ebenso stumpf und ängstlich, wie sein Vater erregt war.
Sie irrten an dem Haus am Wenzelsberg vorbei, das frisch gestrichen, fremd und abweisend in der Straße stand.
Es schlug elf Uhr, ehe sie sich zurechtgefunden hatten.
Der lachende und schwatzende Kinderschwarm quoll aus der Tür des Vorgartens, bevor sie das kleine Haus in der Bergfelderstraße erreichten.
[S. 424] Perthes stand unschlüssig vor dem Zaun, hinter dem die buntblütigen Astern in freundlichen Beeten leuchteten.
Sollte er umkehren? Sollte er den Gang auf den Nachmittag verschieben?
Das widerstrebte ihm. Er trat ein.
Das Dienstmädchen, das ihm die Glastür öffnete, sah ihn und den Kleinen verdutzt an.
Sie wies ihn ins Schulzimmer und wollte die Damen rufen.
Inmitten der kleinen Bänke blieb er harrend stehen. Er atmete schwer und hielt den Jungen mit einem harten Griff an seiner Seite. Es hämmerte in seinen Schläfen und zuckte vor seinen Augen, so daß er nichts um sich sah.
Nach geraumer Weile öffnete sich die Tür. Es war Elli.
Das Mädchen, das den kleinen Perthes kannte, hatte sie benachrichtigt. Perthes hatte versäumt, sich mit Namen zu nennen, aber sie war keinen Augenblick im Zweifel, daß er selbst es war. Mit klopfendem Herzen, nicht wissend, was sie tun oder lassen sollte, war sie herbeigeeilt. Ohne Marga zu verständigen, die im Garten auf und ab ging. Nun stand Elli sprachlos dem Mann gegenüber, der ihr vor Jahren ein vertrauter Bekannter gewesen. Ihre sonst so frische, nicht leicht einzuschüchternde Art versagte bei diesem unerwartetem Wiedersehen. Sie konnte ihn nur durch eine Bewegung bitten, seine Wünsche zu äußern.
Auch Perthes war einen Moment betroffen und stumm dagestanden. Jetzt erklärte er sich mit fester Stimme.
„Fräulein Richthoff, mein Junge und ich sind gekommen, um Ihr Fräulein Schwester um Verzeihung zu[S. 425] bitten. Ich hörte mit Entrüstung, was für eine große Unart sich der Kleine geleistet hat!”
„Meine Schwester — Sie wollen meine Schwester selbst — sprechen?” stammelte Elli.
„Ich bitte darum,” erwiderte er mit einem leisen Vibrieren des Tones.
„Ich fürchte, daß —” Elli suchte nach einer Ausrede, um Marga dies Wiedersehen zu ersparen, aber Perthes hatte seinen Blick mit einer so zwingenden Bitte auf sie gerichtet, daß sie verstummte. Ein hastiges, bebendes „Ich will nachsehen!” und sie huschte aus dem Zimmer.
Es dauerte wieder eine geraume Zeit.
Perthes dünkten die Minuten Ewigkeiten zu werden. Er ließ den Kleinen los und lehnte sich gegen das Kreuz des nächsten Fensters.
Er hörte im Flur Schritte, die sich näherten. Auf seine Sinne legte es sich wie Nebel. Die Dinge rückten vor seinen Augen in eine dunstige Ferne. Das Kind trat mechanisch von einem Fuß auf den andern. Weit ab sah er jetzt eine Tür sich öffnen. Er erkannte eine Gestalt, nur in Umrissen, während eine zweite sich abseits, an einem Schrank zu schaffen machte. Die erste, die stillstand, mußte Marga sein. Er löste sich von dem Fensterkreuz und trat einige Schritte vor. Seine Stimme klang ihm fremd wie die eines anderen.
„Sie wissen schon, weshalb wir hier sind. Ich danke Ihnen, daß Sie uns hören wollen. Eigentlich wollte ich, daß der Junge vor seinen Kameraden ihnen Abbitte tun sollte. Er hat sich abscheulich vergangen!” Perthes stockte. Die stoßweise vorgebrachten Sätze preßten seinen Atem. „Benno, tu wie ich dich geheißen!” Er tappte[S. 426] neben sich nach der Schulter des Kleinen und schob ihn vorwärts. „Geh, und bitte Fräulein Richthoff um Verzeihung!”
Der Junge setzte sich zögernd in Gang.
Marga stand blaß und ernst bei der Tür. Sie mußte hinter sich, am Türrahmen, Halt suchen. Ihr Kopf hatte sich auf die Brust geneigt, ihre Augen sich geschlossen. Sie wollte dem Kleinen entgegengehen, um die peinliche Szene so schnell wie möglich zu beendigen. Aber sie konnte nicht.
Der Junge blieb auf halbem Weg wie angewurzelt stehen. Trotz und Angst ließen ihn schwanken.
„Benno!” mahnte Perthes mit Anstrengung.
Das Kind rührte sich nicht. Die Hände auf dem Rücken verschlungen haltend, wich es nicht von der Stelle.
Perthes griff sich an den Kopf. Dann ging er mit schleppenden Schritten, ohne den Boden unter sich zu fühlen, vorwärts, dorthin, wo die in Nebel verlorene Gestalt stand.
„Also werde ich für dich um Verzeihung bitten!” Er nahm alle Energie zusammen. „Der Junge ist verwildert. Seine Mutter — kurz er hat keine Mutter mehr. Und ich kann mich zu wenig um ihn kümmern. Ich bitte Sie, ihm zu verzeihen!”
Perthes stand jetzt kaum zwei Schritte von Marga entfernt. Er wollte sagen, daß das Kind selbstverständlich nicht mehr in die Richthoffsche Schule kommen dürfe; er wollte in einer kurzen, verbindlichen Form all das vorbringen, was er sich zurecht gelegt. Aber die Worte blieben ihm aus. Er hatte seine Kraft überschätzt und konnte nicht weiter. Er stand so steif und unbeweglich wie sein Kind.
[S. 427] „Ich verzeihe ihm gern,” kam es leise von Margas Lippen. Die ganze, weiche Fülle ihres Wesens klang zitternd mit. Es war der alte, warme, stille, einfache Ton, der über Jahre hinweg an Perthes Ohr drang. Der Dunst vor seinen Augen zerstob. Er sah sie. Nahe wie sie ihm war. Die blauen, tastenden Augen, das erblaßte, schlichte Gesicht mit seinen sanften, weichen Zügen unter dem fahlen, gescheitelten Haar.
Und mit einem Mal schüttelte es seinen großen, starken Körper wie ein Sturm. Seine Hände öffneten und schlossen sich wie im Krampf. Er schwankte zur Seite, ergriff eine der kleinen Kinderbänke, die da standen und ließ sich mit einem dumpfen Laut niederfallen.
Der Junge, von Angst und Schreck erfaßt, lief strauchelnd auf Marga zu: „Verzeihen! Verzeihen!” würgte er unter einer Flut von Tränen hervor, während er sich an sie drängte, die Hände emporstreckend, Schutz und Hilfe suchend vor einem Unbegreiflichen, das um ihn vorging, und das sein Herz und sein Verstand nicht faßten.
Marga beugte sich über ihn und streichelte das dichte, zottige Haar.
Elli war an ihrer Seite und hob ihn empor. Instinktiv trug sie ihn in das anstoßende Zimmer ...
Perthes und Marga blieben allein in der großen, fröhlichen Stube, die die gedämpfte Herbstsonne mehr und mehr in ihr sattes Mittagslicht tauchte.
Eine Weile war nichts hörbar als der schwere, keuchende Atem des Mannes, der mit verzweifelter, schamvoller Kraft gegen die Gefühle rang, die ihn überwältigen wollten. Und dann erlag er doch, dem unsagbaren und grausamen Leid seiner Seele. Das ganze Weh seines[S. 428] Lebens, die mit unnatürlicher Anspannung zurückgehaltenen Schmerzen der letzten Monate, Bitterkeit, Reue und Verzweiflung befreiten sich in jenem harten, dumpfen Schluchzen, das den Zusammenbruch des Mannes grausam, erschreckend und erschütternd macht, wie ein Ereignis der Natur ...
Leise, wie ein Schatten, löste sich Marga von der Wand, an der sie noch immer stand.
Sie ging nach dem Stuhl, auf dem sie sonst vor ihren Kindern saß; von dem aus sie vor den glänzenden Augen der andächtigen Kleinen ihre Märchen erzählte. Dort setzte sie sich und faltete die Hände im Schoß. Zuerst war es auch ihr, als müßte ihr zuckendes Herz in Tränen sich befreien. Aber dann senkte es sich über sie wie eine machtvolle, alle menschliche Klage versöhnende Feierlichkeit. Ihr inneres Gesicht verklärte sie: sie sah sich wie einst an einem Nachmittag, nach bangem Morgen, über einen Hang schreiten, über einen unabsehbaren Hang von blauen Glockenblumen. Sanft neigten sie sich im Sommerwind und begannen zu läuten mit ihren zarten, dünnen, verheißungsvollen Stimmchen. Je weiter sie schritt, um so lauter war das Geläut. Ein Jubeln, ein Jauchzen wurde daraus, in das ihre Seele einstimmte. Und wieder war da ein Fluß. Breiter, tiefer, strömender als der von einst. Über den mußte sie setzen. Sie wußte, daß er drüben stand, am Ufer. Daß er sie erwartete. Es mußte so sein. Und das Geläute mußte sie auf seinen Schwingen tragen, hinüber über das Vergangene, hinüber über das Gegenwärtige, bis sie an seiner Seite stand ...
Seine Stimme erweckte sie. Er hatte sich mit einer gewaltsamen Aufraffung gesammelt.
[S. 429] „Was werden Sie von mir denken, Fräulein — Fräulein Marga!” Er konnte sie nicht anders nennen. „Was werden Sie von mir tränenseligem, erbärmlichem Weichling denken!” stieß er rauh hervor. „Ich wollte Ihnen nur sagen, daß Sie mir — mir unendlich viel mehr zu verzeihen haben als meinem dummen, trotzigen Kleinen. Das war es.”
Marga schüttelte den Kopf.
„Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen. Und wenn es noch etwas gewesen wäre, so hätten Sie es in dieser Stunde für immer gutgemacht!”
Perthes war aufgestanden. Auch Marga hatte sich erhoben.
Sie bot ihm ihre Hand. Er beugte sich tief darüber mit seinem dunklen Kopf und küßte sie stumm. —
Er rief nach seinem Jungen.
Elli brachte ihn getröstet herbei. Sie wußte nur durch ihr Gefühl, was vorgegangen war.
„Benno will am Nachmittag wieder in die Schule kommen,” meinte sie mit einem strahlenden, liebkosenden Blick auf den Kleinen.
„Und immer wieder will ich kommen!” erklärte überzeugt der kleine Mann.
„Wenn die Damen es erlauben — solange du noch hier bist,” sagte Perthes, dankbar auf Elli schauend. Dann ließ er ihn sich von Marga verabschieden, nahm ihn bei der Hand und verließ mit einem ernsthaften Gruß das Zimmer ...
Elli warf sich in Margas Arme. Während draußen die Gittertür knarrte und die Schritte des kleinen und des großen Perthes straßabwärts verhallten, standen sie[S. 430] schweigend beisammen. Elli wagte nicht, Marga zu stören, deren Augen verloren ins Weite schweiften und eine schimmernde Ferne faßten. Es war die große Stille, die über Zeit und Raum dort hinüberfloß. Und es war wieder die Freude in ihr und das Läuten der blauen Glocken von Stille zu Stille. Das Wie wußte sie nicht und nicht das Wann. Aber sie wußte, daß sie und er sich wiedersehen würden, um sich nicht mehr zu trennen. Denn sie waren wieder Gefährten eines Wegs und eines Willens ...
Und beide rangen sie mit dem Leben, bis daß es sie segnete.
| [S. 431]Im Cotta'schen Verlage erschien von | |
| Heinrich Lilienfein: | |
| Gebunden | |
| Ideale des Teufels | |
| Eine boshafte Kulturfahrt. 2. Aufl. | M. 5.50 |
| Von den Frauen und einer Frau | |
| Erzählungen und Geschichten. 2. Aufl. | M. 5.— |
| Die große Stille | |
| Roman. 9.-11. Auflage | M. 8.50 |
| Der versunkene Stern | |
| Roman. 4. und 5. Auflage | M. 9.— |
| Ein Spiel im Wind | |
| Roman. 4. und 5. Auflage | M. 8.— |
| Die feurige Wolke | |
| Roman. 1.-5. Auflage | M. 9.50 |
| Der Herrgottswarter | |
| Ein Drama in drei Aufzügen | M. 4 — |
| Die Herzogin von Palliano | |
| Ein Drama in drei Akten | M. 4.50 |
| [S. 432]Der Kampf mit dem Schatten | |
| Drei Akte eines Vorspiels zum Leben | M. 4.— |
| Der schwarze Kavalier | |
| Ein deutsches Spiel in drei Akten | |
| Olympias. Ein griechisches Spiel in drei Akten | |
| Beide Dramen in einem Band | M. 5.— |
| Der Stier von Olivera | |
| Ein Schauspiel in drei Akten. 2. Aufl. | M. 4.50 |
| Der große Tag | |
| Ein Schauspiel in fünf Akten | M. 4.— |
| Der Tyrann | |
| Ein Drama in vier Akten | M. 4.50 |
| Hildebrand | |
| Ein Drama in drei Akten und einem Vorspiel. 2. Auflage | M. 4.— |
| Das Gericht der Schatten | |
| Vier Einakter: Die Botschaft — Das Fest der entblößten Seelen — Die mondhelle Stunde — Die Fessellosen | M. 4.— |
Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart
End of the Project Gutenberg EBook of Die große Stille, by Heinrich Lilienfein
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE GROßE STILLE ***
***** This file should be named 53283-h.htm or 53283-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/3/2/8/53283/
Produced by Peter Becker and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.