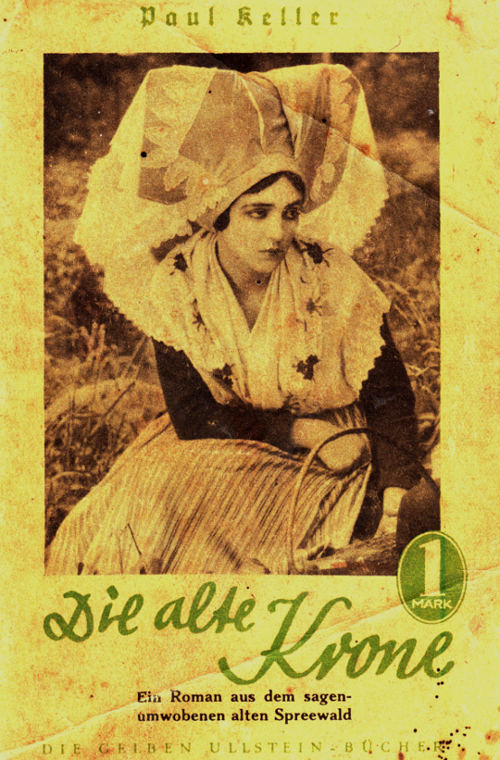
The Project Gutenberg EBook of Die alte Krone, by Paul Keller
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Die alte Krone
Ein Roman aus dem Spreewald
Author: Paul Keller
Release Date: April 10, 2016 [EBook #51722]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE ALTE KRONE ***
Produced by Peter Becker and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt.
Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so ausgezeichnet.
Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
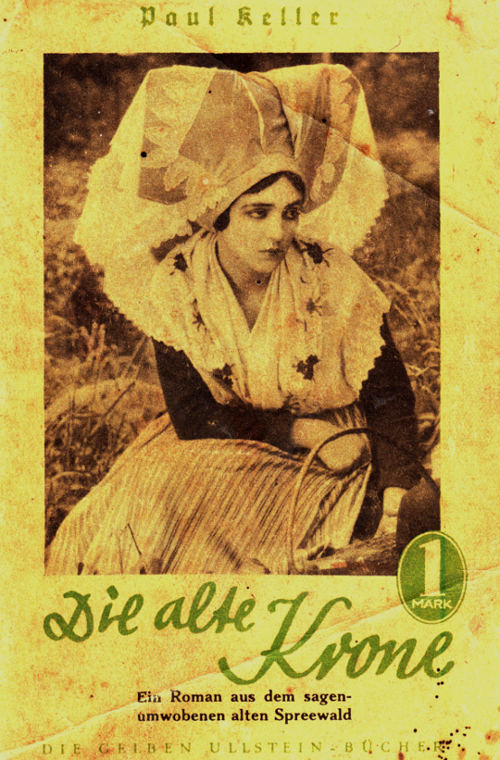
Die gelben Ullstein-Bücher
Ein Roman aus dem Spreewald
von
Paul Keller

Im Verlag Ullstein / Berlin
Umschlagbild: Die Filmschauspielerin Carmen Boni / Phot. Ufa
Copyright 1909 by Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau
Printed in Germany
Die Spree ist ein Heidekind. Ihre Jugend ist arm und ohne Wagemut, ihre Kraft gering und ihre Lustigkeit schüchtern. Frühzeitig – als halberwachsen Ding – muß sie in Dienst nach der anspruchsvollsten Stadt der Welt, nach Berlin, wo man ihr, einer jungen, billigen, schmucklosen Dienerin, auf die schwachen Schultern viel Last und Qual ladet.
Aber auch sie hat eine grüne Heimat und eine grüne Jugend. Gar nicht fern von dem schreienden, lachenden, gellenden Berlin wohnt die große Stille in hohen Föhrenwäldern, ist eine andere Welt, wohnt ein anderes Volk, ist eine andere Zeit. Gar nicht fern von dem prangenden Reichtum der glänzenden Weltstadt ziehen arme Sandwege durchs Land, stehen hohe Farnkräuter an alten Ziehbrunnen; nur wenige Stunden von dem Mittelpunkt kaltherziger Weisheit, heißblütiger Genußsucht sieht das Volk auf den Blättern der Pflanze cerweny drest die Blutstropfen Christi glänzen, saugen die Kinder süßen Saft aus weißen Birkenstämmen, legen die Leute das Freundschaftskraut »kokoski« unters verwitterte Strohdach, um am grünenden oder welkenden Kräutlein zu erkennen, ob das ferne liebe Leben eines Freundes noch frisch und grün oder im Tode verblichen sei.
Das ist das Land, wo ein kecker Hase, der ins Dorf kommt, den Leuten ein Feuer verkündet, wo man neun Sünden verziehen bekommt, wenn man eine Maulwurfsgrille tötet, wo der Mann sich eine krabbelnde Fledermaus unter die Mütze steckt, um im Spiele Glück zu haben, wo das Mädchen dem jungen Burschen, dessen Liebe sie gewinnen will, einen Apfel zu essen gibt, den sie eine ganze Nacht lang in der Schulterhöhle getragen hat.
Das ist das Land Wendei. Keine rote oder blaue Grenzlinie kennzeichnet das Wendenland auf einem Kartenbild; jahrhundertelang war es ein Spielball der Brandenburger, Sachsen und Böhmen, und auch heut noch muß man von der sächsischen Stadt Bautzen die böhmische Grenze entlang durch die schmale schlesische Lausitz bis hin in den brandenburgischen Spreewald wandern, wenn man die Wendei kennenlernen will.
Ein anderes Volk als in Berlin, der deutschesten aller deutschen Städte, die nur wenig Bahnstunden entfernt ist – ureingesessene Slawen, die in grauer Vorzeit den ganzen Osten unseres Vaterlandes bis an die Ostsee beherrschten, dann zurückwichen Schritt um Schritt und die trotz jahrtausendelanger Abhängigkeit, in die sie alsbald gerieten, sich ihre trotzige Eigenart in Sprache und Sitte, in Kleidertracht, Häuserbau und Gemeindeanlage bewahrt haben. Jetzt aber ist Wendenland eine kleine, zerbröckelnde Slaweninsel im brausenden deutschen Meere, das an seiner Küste zehrt, seine geistigen Springfluten über das Land gießt und es bald bis zum letzten Brocken aufgezehrt haben wird.
Sorben, oder – wie sie die Deutschen nennen – Wenden. Eines von den Völkern, die jahrtausendelang bestehen, ohne eine Geschichte zu haben, die alt werden, ohne je jung gewesen zu sein, Blutsverwandte der Tschechen und Schicksalsverwandte der südslawischen Stämme der Slowenen und Kroaten, die auf den mageren Ziegenweiden des felsigen Karstlandes ihre Jahrhunderte verträumten.
Kein Hoheslied, kein Heldenbuch, keine steinerne Tafel mit unvergänglichen Gesetzen, keine Ruhmeshalle mit Ewigkeitsphysiognomien großer Menschen und großer Geschehnisse kennzeichnete den Weg, den diese Nationen durch die Geschichte schritten. Ihre Spur verlief im Sand. Die Weltgeschichte vermerkt ihre Namen nur in nebensächlichen Fußnoten. Einige Grenzplänkeleien mit dem großen Karl, dem schlauen Heinrich, dem Markgrafen Gero, den Meißener Bischöfen, den dänischen Herrschern, nicht viel mehr von eigener Geschichte.
Eine recht dürftige Historie. Geschickte, fleißige Forscher und[7] Sammler haben dagegen Mythen, Sagen, Märchen, Volkslieder, Schnurren, Eigentümlichkeiten in Sitte und Brauch getreulich niedergeschrieben, Dinge, die Zeugnis geben von dem Leben, das einst im wendischen Völkerwald war. Schmaler, Andree, Schulenburg, Veckenstedt, Tetzner und andere tüchtige Männer wurden unsere Lehrer über das Wendentum. Aber es sind nur Einzelheiten, Forschungsergebnisse, abgerissene Töne und Klänge, die sie einfangen. Ein ganzes Bild haben sie nicht zusammengestimmt; selbst die Sage vom König der Wenden liegt bei ihnen in Schutt und Trümmern.
Die deutschen Dichter sind an diesem einsamen Heide- und Flußwald, an dieser geschichtlichen Trümmerburg vorbeigegangen. Die Wenden selbst waren immer stille Leute. Kein politischer Alarmruf ging von ihnen aus, kein kraftvoller Dichter erstand aus ihrer Mitte. Ein tausendjähriges Volk sind die Wenden, ohne Geschichte, ohne Literatur, ohne bildende Kunst, kleine Ansätze abgerechnet.
Wenn mich, den Schlesier, das Heidegeheimnis meiner Heimat reizte, so lag das nahe. Ich bin mit ganzer Liebe an das Werk gegangen, habe nach den Trümmerbildern, die ich fand, die Sage vom Wendenkönig rekonstruiert und hoffe, daß mich das deutsche Herz nirgends, wo zwischen Nationalitäten abzuwägen war, zu einer Sünde ungerechter Parteilichkeit verführt hat.
Kraft, geistige und körperliche Fruchtbarkeit, Entwicklungsfähigkeit, Wollen zur Höhe, Schätze und Kräfte sonder Zahl waren auch im Volke der Lausitzer Sorben. Die Kinder Gottes sind alle zur Herrschaft berufen. Aber den Wenden fehlten die Führer. Die Könige, die Führer, die Befreier kommen von selbst ihre lichte Straße daher oder sie kommen nicht, mag das Volk auch tausend Jahre am Boden knien und rufen: »Tauet Himmel den Gerechten!«
Gegen versagte Gnade, die im Weltplan begründet ist, hilft kein Wollen, kein Beten, kein Toben. Der Führer kommt nicht, das Volk verträumt seine Zeit, es altert und vergeht, ohne daß es jung war. – –
Heutigen Tags hat der Donner der Lokomotiven, das Sausen der Automobile, die durch die Wendei rasen, die Lutchen und andere Zwerggeisterlein, die Mittagsfrau und die Kobolde vertrieben; der scharfe Wind geistiger Aufklärung, der schneidend über alles Land fegt, hat die blauen Traumlichter romantischen Glaubens in den Herzkammern der Wenden ausgelöscht; die Sucht nach Gold und Lust hat das Heidevölklein aus seinen stillen Wald- und Wiesenwinkeln herausgelockt ins breite allgemeine Gefild, in die große Stadt, wo die jungen Burschen ihre Kraft, die jungen Mütter die Milch ihrer Brust verkaufen; der moderne Fabrikbetrieb verlangt viele Kräfte; die malerischen Volkstrachten mit ihrer soliden Pracht haben vielfach schäbigem modischen Zeug aus billigen Bazaren Platz gemacht; die wendische Sprache hört mehr und mehr auf: bald wird die ganze Wendei nichts mehr sein als eine historische Reminiszenz.
Aber in der Zeit, von der dies Buch erzählen will, in den Jahren 1860 bis 66, da war es doch noch ganz anders. Damals begann die Zersetzung des Wendentums erst, die jetzt beinahe vollendet ist.
Rot glüht der Wald über die Heide. In den Wellen der stillen Spree schwimmen die ersten gelben Weidenblätter wie lange, gelbe Schifflein. Eine kleine Flotte, mit der der junge Herbst spielt. Weiden den ganzen Fluß hinab, auch auf den Moorwiesen, die sich lang im Abendsonnenschein dehnen. Torf schläft in der schlammigen, quabbeligen Erde, saures Gras wächst darüber, und zahllose Wollblumen wiegen leicht die Perückenköpfe. Hoch und ragend aber steht der Föhrenwald. Das Auge blickt tief hinein; denn die Stämme sind schlank, die Föhre duldet kein Unterholz. Wie ein Heer von Kriegern stehen die Stämme und sind alle rot wie in blankes Kupfer gepanzert.
Und erst die Kronen! Wie Burgen türmen sie sich in der Luft; das Abendsonnengold vermischt sich dem dunklen Grün, und die Burgen haben alle Wände und Dächer von grünroter Patina bedeckt.
Alt, ehrwürdig, kostbar ist das alles.
Kein Laut. Nur irgendein schwarzgefiederter Burgwart gibt manchmal den Brüdern ein Signal, die draußen auf der Wiese noch nach Beute suchen.
Der erste Stern taucht auf.
Da treibt der Gänsehirt seine schnatternde Herde heim.
Das zweite Sternlein erglimmt.
Ein alter Wende blinzelt hinauf, erkennt sein Zeichen und treibt zehn Schweinchen, die er aufs Feld geführt hatte, in den Stall.
Das dritte Sternlein schimmert im Osten.
Da singt der Schafhirt zur Heimkehr.
Ein vierter Stern ersteht leuchtend am Himmel.
»Geht ein, Rote, Schwarze, geht ein!« ruft der Kuhhüter und strebt nach dem Dorfe.
Das fünfte Sternlein strahlt friedlich hernieder. Da hören die Kinder auf zu spielen, schließen sich den Herden an und helfen sie heimführen.
Draußen, wo die stille Spree schläfrig zwischen den Weiden rinnt und wo die alte Landstraße weit hinausführt – Gott weiß, wohin! –, wird es nun ganz still, und wie der Mond aufsteigt, findet er nichts Lebendes auf den weiten Wiesenplänen als ein paar Birken, die die weißen schlanken Leiber biegen und die herrlichen Lockenköpfe zu leisen Liedern zierlich bewegen. –
Eine Wolke verhüllt das strahlende Himmelslicht, und dunkle Schatten legen sich auf das Gelände und auf die alte Landstraße, die weit hinausführt, Gott weiß, wohin.
Da schleicht durch die Schatten der Waldbäume ein Gespenst. Es hat einen brennenden Leib, greift mit zuckenden Armen irr in der Luft herum, dehnt sich zur Höhe, kauert sich zu Boden, huscht zu den Birken, verbirgt sich hinter den Weiden, schaut ins Wasser, springt wieder über die Wiese und zittert plötzlich entsetzt empor, als ein zweites brennendes Gespenst ihm nahe kommt.
Da gibt es eine wilde Jagd weit über den Moorgrund. Das erste Gespenst duckt sich zusammen, versteckt sich, wird aufgescheucht, jagt davon, schlägt Zacken wie ein gehetztes Wild, springt zwischen die Bäume, und das zweite setzt ihm nach, langt nach ihm mit gierigen, flackernden Händen. – Horch! Ein Knarren kommt die Landstraße daher. Ein Wagen wird sichtbar. Darin sitzen Menschen. Ganz langsam geht das Pferd, fast unhörbar auf dem grasbewachsenen Wege. Der Kutscher hebt seine Peitsche und weist nach den brennenden Gespenstern.
»Ty newetko pormorski!«
»Fluche nicht, Lobo!« sagt die eine Frau, die im Wagen sitzt, leise und ängstlich. »Gott schütze uns! Es sind Jakub und Merten. Gott sei ihnen gnädig!«
»Gott sei ihnen gnädig!« brummt auch der eingeschüchterte Knecht.
Da recken sich die Gespenster, langen noch einmal mit brennenden Armen hinauf gen Himmel und verschwinden. Langsam schleicht das Fuhrwerk weiter. Nun, da es eine Wegbiegung erreicht, atmet die Frau auf und sagt zu der jüngeren Begleiterin, die neben ihr sitzt, im Flüsterton: »Es waren Jakub und Merten. Jakub hat seinen Vater Merten, der bei ihm im Auszug war, mit einem Strick erdrosselt, weil er ihm zu lange lebte, und dann hat ihn der Gewissensteufel geplagt, und da hat er sich mit demselben Strick erhängt. Jetzt irren die armen Seelen über dem Moor. Hast du gesehen, wie der Vater den Strick in der Hand hält und den Sohn damit treibt?«
Das Mädchen schmiegt sich fröstelnd an die Alte.
»Ich fürchte mich«, sagt es leise.
»Es ist unsere böse Gegend hier, Hanka«, fährt die Ältere fort. »Um alles will ich hier nicht sein zur Abendzeit. Und wir wären längst daheim, wenn sich Lobo, der Liederlich, nicht betrunken hätte.«
Der Kutscher hört die Anklage und brummt für sich. Langsam schleicht das Gefährt dahin. Wer will in verrufener Gegend den bösen Jäger wecken oder in rascher Fahrt dem Nachtfuhrmann begegnen? Ist nicht selbst der himmlische Fuhrmann, dessen Wagen am Firmament steht, auf zu rascher Fahrt an eine Mauer der Hölle angefahren, so daß die hintere Achse aus dem Quadrat wich und sich die Deichsel für alle Ewigkeit verbog?
Langsam schleicht das Gefährt. Neue Wiesenflächen tauchen auf. Die alte Bäuerin sagt furchtsam, beklommen: »Hanka, erschrick nicht; aber ich muß es dir sagen: Hier ist noch eine böse Gegend; hier wohnt die Todesgöttin Smjertniza. Gott schütze uns!« …
In einem Nebelschloß wohnt die Todesgöttin Smjertniza. Sie ist immer in weißen Kleidern. Die Tür ihres Hauses ist zweifach verriegelt, mit einer Menschenhand und mit einem Menschenfuß. Aber ob sich auch die Menschen mit Hand und Fuß gegen die Tür ihres Schlosses stemmen – wenn sie ihre[12] Lichter entzündet, schiebt sie die Riegel zur Seite und geht über die Felder bis zu den Dörfern. Die Menschen sehen sie nicht. Die Tiere sehen sie. Aber der Mensch, dem sie begegnet und den sie meint, stirbt nach drei Tagen …
Drüben liegt die Wiese mit dem dunklen Waldrand.
»Schau geradeaus, Hanka! Geradeaus! Schau nicht hinüber!«
Lobo, der Kutscher, hält durch Zurufe die Pferde zu noch langsamerem Gange an. Wie unter angstvollem Zauberbann schleicht der Wagen dahin.
Da schallt Hundegebell übers Feld. Die Frauen horchen erschreckt auf.
»Es ist Tyra, unser Hund!« sagt Lobo. »Ich kenne ihn an der Stimme. Er hat sich losgerissen von der Kette.«
Zwei Tiere jagen aus dem Busch am Wegrand, ein Reh, ein Hund dahinter. Sie springen dicht vor dem Gefährt auf die Straße. Die Pferde bäumen auf. Das Reh bleibt zitternd stehen. Der Hund steht, keucht. Die Pferde stehen. Die alte Frau schreit gellend auf:
»Die Smjertniza, die Todesgöttin!«
Drüben über der Wiese, weit drüben steht das Nebelschloß – Lichter blitzen drin –, eine weiße Gestalt löst sich von dem Schlosse los –
»Die Smjertniza! Die Tiere – sehen – sie –«
»Ty newetko pormorski!« flucht da der Knecht, schlägt auf die Pferde wie rasend, die Pferde gehen durch, jagen die Straße entlang, springen über einen Graben querfeldein auf ein Dorf zu –
Beim Eingang des Dorfes schlägt der Wagen um – zerbirst an einem Prellstein – die Insassen fliegen heraus – Pferde reißen sich los, jagen davon –
Schreiende Leute kommen gelaufen. Sie richten Lobo, den Knecht, und Hanka, das Mädchen, die wenig verletzt sind, auf und tragen die Bäuerin, die am Sterben ist, nach ihrem Gehöfte.
Wie ein Herrensitz ist das Gehöft des Scholta[1] Hanzo. Hoch ragt das schindelgedeckte Wohnhaus, das nach wendischer Art mit der schmalen Giebelseite der Dorfstraße zugekehrt ist. Die Dorfstraße ist ziemlich weit vom Hause entfernt. Eigener Zufuhrweg, Teich und Anger liegen zwischen ihr und dem Gehöft; das wendische Angerdorf ist breit und geräumig angelegt. Muster von Lindenblättern, mit Sternen durchwirkt, schmücken den Giebel des Hauses, ein Kreuz schaut ernst aus dem Blattgerank, und ein Spruch, der darunter steht:
zeigt an: hier wohnen starke, selbstbewußte Menschen. Es ist eines der wenigen Bauernhäuser der Wenden, die groß, geräumig und von einem gewissen Luxus sind. Ein Mann hat es gebaut, der ein Withas[2] werden wollte, der aber doch ein Bauer blieb. Eine hohe Mauer, ein festes Tor schließen den Hof und den Vorgarten ab, der steinerne Stall, die hölzerne Scheune ragen darüber empor. Der Großgarten trennt das Gebäude vollends von jeder unmittelbaren Nachbarschaft.
Es ist spät. Um diese Stunde wacht sonst im Gehöft kein Mensch mehr, es sei denn ein Wächter in unsicheren Zeiten, wenn Brandleger in der Gegend auftauchen.
Heute aber sitzen unter dem zweiten Hauptgebäude, das dem Wohnhaus gegenüber liegt, in einem Laubengang zischelnde Leute, Knechte und Mägde des Großbauern. Sie hocken auf niederen Schemelchen oder kauern am Boden und schauen hinüber nach den erleuchteten Fenstern.
»Ich hab' schwarze Holzklötzer in der Spree schwimmen sehen«, sagt ein Knecht.
»Und ich hab' weiße Männer fahren sehen in einem Kahn«, sagt eine Magd.
»Es meldet sich immer an«, sagt ein drittes.
Dann Stille.
»Erzähl' es noch einmal, wie es war, Lobo!«
»Es war ganz einfach«, sagt einer. »Lobo war besoffen!«
»Hognity kjandros« – fährt Lobo auf den Sprecher los. Aber der wehrt ihn gemütlich ab.
»Ich bin kee abgefaulter Baier, ich bin höchstens a abgefaulter Schläsinger.«
»Cerwiško! Aas!« fährt der Wende abermals auf und geht auf den Deutschen zu.
»Ruhe! Tormy gótuju. Die Wolken türmen sich!« mahnt ein alter Wende. »Drüben liegt die sterbende Frau. Ruhe!«
Ein Weilchen Stille.
Dann: »Erzähl' es noch einmal, wie es war, Lobo!«
Und Lobo erzählt von den Feuermännern, von dem Hund und dem Reh, von der Todesgöttin Smjertniza.
»Ich dachte, es wär' Tyra, unser Hund. Es hat mich aber genarrt, es war nicht Tyra. Es war auch kein richtiges Reh. Es waren Tiere von der bösen Meute.«
»Gott schütze uns!«
Tiefe Stille. In den niederen Wendenstirnen arbeiten die Gedanken. Der Riesenarm des Ziehbrunnens streckt sich drohend zum Himmel.
Da flattert eine Gestalt über den Hof. Eine Magd ist es, die aus dem Herrenhause kommt.
»Wie geht es, Anna, wie geht es der Frau?«
Die Magd macht eine klagende Gebärde. Dann sagt sie flüsternd:
»Wir wollen die Probe machen.«
Sie zeigt ein Stück Speck.
»Du hast ihr die Fußsohle damit gerieben?«
Die Magd nickt.
Da stehen alle wie auf ein heimliches Kommando auf, gehen auf den Zehenspitzen und schleichen den Stall entlang bis zur Hundehütte. Tyra fährt knurrend aus dem Schlafe, beruhigt sich aber, als er die bekannten Gesichter sieht.
Die Magd wirft ihm das Speckstück hin.
»Zeig' es an, Tyra, zeig' es an! Friß!«
Der Hund beschnuppert den Speck und läßt ihn liegen.
Da geht ein leiser Schreckensruf durch die kleine Schar.
»Er frißt ihn nicht! Die Frau muß sterben.«
»Tyra ist krank!« wendet der deutsche Knecht ein. »Er frißt schon zwei Tage lang nichts.«
Sie sehen ihn zornig an und schleichen nach dem Laubengang zurück.
»Die Frau muß sterben!«
»Sie ist erst fünfzig Jahre. Sie könnte noch viel arbeiten. Sie muß noch lange nicht in den Auszug. Was stirbt sie schon?«
»Man sollte es ihren Söhnen nach Breslau schreiben.«
»Sie haben vielleicht jetzt keine Ferien.«
»Ty bamlak! Braucht man Ferien, wenn die Mutter stirbt? Und überhaupt, richtige Studenten haben immer Ferien.«
»Der Großbauer will morgen früh einen Brief an die Söhne schreiben.«
»Ja, und indes vergehen die drei Tage, die ihr die Smjertniza noch läßt, und die Söhne kommen zu spät.«
»Wie Gott will!«
Der eine Knecht entkorkt eine Branntweinflasche, nimmt einen tiefen Schluck und reicht die Flasche weiter.
»Wie Gott will!« sagt der letzte, als er getrunken hat.
»Und nun müssen wir alle neue weiße Trauerkleider haben.«
»Die kauft der Großbauer.«
Als die Mägde von den neuen Kleidern hörten, mischte sich in ihren jungen Herzen mit der Trauer um die Frau ein heimliches Entzücken.
»Grinst nicht so vergnügt, ihr eitlen Frauenzimmer«, fuhr der alte Knecht Kito sie an. Er war sonst der lustigste Patron trotz seines Alters; aber heute war er völlig gebrochen.
»Erzähl' es noch einmal, Lobo, wie es war.«
»Wir wissen es schon!«
»Nein, wie es dort war, in dem Dorfe, von wo ihr kamet.«
»Es war gut. Es gab viel zu essen. Drei Tage sind wir dort gewesen. Es gab reichlich zu essen; nur der Schnaps war etwas zu wässerig. Es war kein Rum darin.«
»Und dann fuhr das fremde Mädchen mit?«
»Sie ist eine Verwandte vom Großbauern, freilich, das Wasser von der siebenten Windel. Und sie heißt Hanka.«
»Warum hat die Frau die Reise gemacht, zwei Tage mit dem Wagen hin, drei Tage dort, zwei Tage mit dem Wagen zurück? Mit der Eisenbahn fährt sie nicht. Eine ganze Woche war sie fort, jetzt in der Arbeitszeit.«
»Sie kann tun, was sie will, sie ist die Frau. Und es sind Verwandte. Das fremde Mädchen bleibt jetzt hier.«
»Ja, sie wird den Juro heiraten, den Erbsohn«, sagte eine junge Magd, »denn sie ist aus dem könig –«
Eine Hand preßte sich dem Mädchen auf den Mund, und alle Wenden sahen auf den deutschen Knecht.
Der stand auf und machte eine abweisende Handbewegung.
»Tut nicht so albern! Ich weiß soviel wie ihr!«
Er entfernte sich langsam und ging über den Hof.
Die anderen fielen über die junge Magd her.
»Wie kannst du, Worsla, du Plappermaul? – Vom König spricht man nicht! Noch dazu, wenn ein Fremder dabei ist. Das ist das heilige Geheimnis!«
Das hübsche junge Mädchen brach in Tränen aus.
»Ich wußte es nicht. Ich glaubte, er gehört zu uns.«
»Er ist ein guter Kerl,« sagte einer, »aber er ist ein Deutscher.«
»Ein hognity kjandros ist er«, lallte Lobo, der bereits wieder betrunken war.
»Sie ist verliebt in Wilhelm,« sagte giftig eine Magd; »sie hat ihm drei Haare vom Nacken und ein Stück Haut vom Knie in den Osterkuchen gebacken. Nun ist er in sie vernarrt.«
»Es ist nicht wahr«, schluchzte Worsla, »es ist nicht wahr!«
»Ruhe!« kommandierte der alte Kito. »Heute ist keine Zeit für Liebessachen!«
Es entstand eine Pause. Man hörte nichts als gelegentlich den glucksenden Ton, wenn einer Branntwein trank.
Da sprach der Alte:
»Ich will nicht, daß die Frau stirbt. Sie ist noch jung und sie ist gut. Vor dreißig Jahren bin ich mit ihr auf den Hof gekommen. Ich will nicht, daß sie stirbt. Ich werde sie anräuchern. Noch ehe die Sonne aufgeht, werde ich auf den Kirchhof gehen und Gras abschneiden von einem Kindergrabe. Und ich werde dabei zählen: neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So werde ich zählen. Und am Morgen werde ich das Gras anzünden und die Frau beräuchern. Das wird ihr helfen. Das wird ihr helfen, oder – oder …«
Er machte eine Handbewegung. Starr blickte er vor sich hin und fuhr dann fort:
»Ich bin alt. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, oder ob mich die Toten dort behalten. Zeit ist es längst. Es gibt auch Leute, die mir das Leben nicht mehr vergönnen. Wenn eines mit mir auf den Kirchhof gehen will, so soll er es sagen. Er darf aber auf dem Wege kein Wort sprechen.«
Sie duckten sich alle zusammen, als ob plötzlich ein eisiger Wind sie gefaßt hätte.
Nur die junge Magd Worsla sagte:
»Vater Kito, ich gehe mit dir. Du bist sonst so lustig und immer gut.«
Der Alte nickte und sah sie an.
»Wenn sie – wenn sie mich dort behalten, dann lege mir gleich zwei Steine auf die Augen.«
Schritte klangen über den Hof. Wilhelm, der deutsche Knecht, kehrte zurück.
»Will keiner einspannen und nach dem Doktor fahren?« fragte er.
Sie wehrten alle ab. Der Arzt bringe den Tod. Der Bader sei bei der Frau, die Smjertniza sei auf dem Felde, der Doktor solle fortbleiben.
Der Deutsche wurde wütend.
»Gebt mir den Schlüssel zum Pferdestall!« rief er zornig.
»Hognity kjandros!« fuhr Lobo auf.
Da erhielt er eine Ohrfeige, daß er taumelte.
Mit Mühe wurden die beiden auseinandergebracht. Aber[18] vergebens versuchte der deutsche Knecht, den Schlüssel zum Pferdestall zu erlangen.
»So werde ich nach der Stadt laufen.«
»Das Hoftor ist zu. Den Schlüssel bekommt er nicht!«
Wilhelm lächelte verächtlich. Aber er fuhr zusammen, als er leises Weinen hörte. Worsla, die junge Magd, hob die Hände zu ihm.
»Geh nicht! Die Smjertniza geht um! Geh nicht! Es ist nicht nötig! Ich gehe mit Kito zum Friedhof. Wir holen heiliges Gras von einem Kindergrab. Da räuchern wir die Frau an, und sie wird gesund werden.«
Sie streckte ihm, alle Scheu vergessend, beide Hände hin, er aber wehrte sie unwirsch ab und sagte:
»Du bist auch so eine Gans!«
Ging über den Hof und schwang sich über die Mauer.
Die weiten Matten des Riesengebirges sind dort am breitesten und schönsten, wo der große Elbstrom seine Quellen hat. Runde dichte Knieholzgebüsche sind über den kurzen Rasen verstreut wie dunkelgrüne Kränze.
Ein leichter milder Abendwind ging über die sich weit hindehnende Elbwiese und erquickte einige Wandersleute, die, vom Gipfel des Hohen Rades herkommend, sich am Boden lagerten.
»Kolossale Fläche«, sagte ein stattlicher Fünfziger und ließ die fröhlichen, stahlgrauen Augen rundum schweifen.
»Grandiose Fläche! Und das liegt nun alles hier oben viertausend Fuß hoch und hat keinen Zweck.«
»Aber, Papa, das ist doch so schön!« entgegnete ihm seine schlanke Tochter; »sieh mal, wie sich diese weiten Wiesen hindehnen und eine so friedlich schöne Brücke sind zwischen den zwei großen Gebirgskämmen …«
»Jawohl«, unterbrach sie der Alte sarkastisch und mit imitiert flötender Stimme. »Diese epische, ruhige Breite, nur hin und wieder unterbrochen durch die Lyrismen winziger[19] märchenhafter Knieholzwälder, deren Baumstämmchen nur so groß sind wie die Kinder und so verträumt sind wie die Kinder.«
»Papa!«
»Tja! Herrschaften, denken Sie nu ja nicht etwa, die Stelle von der epischen Wiese und von den lyrischen Kniehölzern is von mir. Keine Spur! Hier steht sie, die diese Stelle gedichtet hat – meine Tochter Elisabeth von Withold. Es hört sich großartig an sowas. Man kann sich zwar nischt dabei denken, aber es klingt nach was!«
»Papa, du hast …«
»Ich habe jar nischt. Dein Papa ›hat‹ nie! Nämlich spioniert! Er hat sich lediglich erlaubt, direkt auf dem Wege ein Notizblatt zu finden, das seine poetische Tochter verloren hatte und das er hiermit submissest zurückerstattet, weil er keine Verwendung dafür hat.«
»Gnädiges Fräulein, die Stelle von der epischen Ruhe dieser großen hohen Wiesenflächen und ihrer lyrischen Unterbrechung durch die kleinen Büsche mit ihren bizarren Zwergstämmchen und den wunderlichen Kronen ist herrlich. Bitte, schenken Sie mir das Blatt!«
Der das sprach, war ein junger, schlanker Mann. Der Alte lachte fröhlich.
»Bravo, Herr Juro, bravo! Man hört Ihnen gleich an, daß Sie Ackerbau studieren und künftiger Scholta und Großbauer im Wendenland sind. Jawohl, das ist unsere moderne Landwirtschaft! Der Landwirt stellt sich an die Wiese und phantasiert von epischer Ruhe und lyrischer Unterbrechung, und die Ochsen zu Hause verhungern und die Wirtschaft geht sachte zum Deibel.«
»Lieber Vater …«
»Lieber Sohn?! Sei du man stille! Denn du bist erst der rechte!«
Heinrich von Withold, ein zweiter junger Mann, nickte seinem Vater gemütlich zu und pfiff eine kurze musikalische Sentenz.
»Pfeif nur, Bürschel, pfeif nur! War wohl wieder von dem[20] verrückten Kerl, von dem Wagner? Ich sage – einmal und nicht wieder!«
Niemand fragte, was er meine. Alle wußten, er meine, einmal habe er eine der neuen Wagnerschen Opern angehört und tue das nie wieder.
»Auf keinen Fall!« fuhr Herr Withold zornig beteuernd fort. »Jetzt – was soll ich machen, daß der Junge, der Heinrich da, sich viel mehr mit musikalischen Faxen abgibt, als daß er Volkswirtschaft und Agrikultur studiert, wofür ich ihn, Himmeldonnerwetter, nach Breslau zur Universität geschickt habe?! Was soll ich machen?«
»Ach, wir können die Kinder nach unserm Sinn nicht formen. So wie Gott sie uns gab, muß man sie halten und lieben,« entgegnete Heinrich, der Jüngling. »Siehst du, Papa, diese Verse sind auch dichterisch, zwar nicht von meiner Schwester Elisabeth, aber von Goethe, von Johann Wolfgang von Goethe.«
»Affe!« sagte der Alte. (Er meinte seinen Sohn Heinrich, nicht Goethe.) »Affe!« wiederholte er, »ihr habt Glück, daß ihr so einen schafsgutmütigen Vater habt, sonst – Donnerschlag ja …! Ich amüsier' mich schon immer, wenn ich so 'ne Visitenkarte von einem Studenten sehe: ›stud. med.‹, ›stud. jur.‹, ›stud. phil.‹, ›stud. agric.‹ und was da alles draufsteht. – Da sag ich mir immer, das erste ›stud.‹, das is das, was der Kerl im allgemeinen nicht macht, und das, was dahinter kommt, das is das, wovon er sich ganz besonders drückt. Herr Gott, dahier stehen zwei Studenten, cives academiae, wie es so stolz heißt – Herr Juro und Herr Heinrich, mein vielbegabter Herr Sohn; beide sollen in Breslau Agrikultur studieren, beide sollen ja einmal große Güter übernehmen. Gut! Kommen wir also hier an diese kolossalen Bergwiesen. Müßte man denken – halt – Studenten des Ackerbaues – halt! – was werden die machen? Werden sich gewiß hinstellen und sagen: Bis zu dem Gebüsch da soundsoviel Huben, bis zur Baude soundsoviel Huben und so weiter. Und dann: Verflixt ja, wenn ich diese Prachtwiesen unten im Gelände hätte – das Kroppzeug von Knieholz rodete ich aus – Klee? – Ruchgras? – Luzerne? –[21] Zum mindesten Buchweizen? – Wollen mal sehen! – Aber die Wiesen liegen nu mal hier oben. Viertausend Fuß hoch. Nichts zu machen mit Talbepflanzung. Aber mit Almenwirtschaft, zum Donnerwetter, mit rationeller Almenwirtschaft! Schande und schade um so herrliche Flur! Jawohl, so müßte man denken, würden zwei Studenten sagen, die Ackerbau studieren. Ach, du oller Döskopp! Einer spricht von epischer Breite und lyrischer Unterbrechung und einer pfeift 'ne Melodie, nach der nicht mal sein letzter Pferdeknecht tanzen mag.«
»Herr von Withold, Sie haben ganz recht. Was mich angeht, so befinde ich mich sicher an ganz falschem Platze. Ich habe eben für die Landwirtschaft nicht das mindeste Talent.«
»Na, Juro, so schlimm wird ja das nicht sein. Hauptsache, Sie geben sich Mühe. Seh'n Sie mal, das schöne Gut wartet doch auf Sie! Ein Rittergut können Sie aus der alten wendischen Scholtisei machen, wenn Sie's vernünftig anstellen. Ihr Großvater und Ihr Vater haben ja kolossal zugekauft. Wie groß ist denn Ihr Väterliches jetzt?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Juro achselzuckend.
»Sie – Sie wissen das nicht? Ja, erlauben Sie mal, das – das ist arg! Studiert Ackerbau und weiß nicht mal, wie groß das väterliche Gut ist. – Das ist ja unglaublich! Als ich so alt war wie Sie, kannte ich auf unserem Gute sozusagen jedes Rind, jedes Schaf, jeden Hahn persönlich mit seiner ganzen Lebens- und Familiengeschichte. Und Sie wissen nicht mal – ja, dann ist's allerdings am besten, Sie hängen die Geschichte an den Nagel.«
»Ich möchte wohl, wenn ich es könnte.«
»Aber Mensch, Christ, Bürger, Sie haben doch Traditionen zu erfüllen! Sie können doch nicht mir nichts dir nichts eine so wunderbare Sache fahren lassen. Donnerwetter, bei Ihnen ist ja von Bauernwirtschaft gar keine Rede mehr, das ist doch ein großes Gut! Ja, Mensch, wollten Sie denn lieber ein ärmlicher Stubenhocker sein, als über eigenen Grund und Boden schreiten als freier Mann, dem niemand auch nur ein Wörtlein zu sagen hat, der lebt wie ein König?«
»Wie ein König der Wenden!«
»Red' mir nicht hinein, Heinrich! König der Wenden, das gibt's nich! Das is eine von den vielen alten Sagen, die die Wenden haben. Unsere Wenden sind gute Preußen, haben ihren König in Berlin, wie andere Preußen, ihren Bramborski Kral. Aber ein König in seiner Art ist jeder freie Landwirt, und nur er, alle anderen bis zum Minister und General hinauf sind abhängige Diener.«
Er nahm einen Schluck aus der Reiseflasche und fuhr fort: »Und Heimat – ist Heimat gar nichts mehr? Irgendein Tand, den man leichten Herzens aufgibt? Sehen Sie, Juro, Ihre Wendenheimat ist schön! Nicht lauter Kernboden – nein, viel Sand und auch Moor dazwischen. Aber doch gutes, treues Land, auf das man sich immer noch verlassen kann. Ja, und ich – ich bin ja eigentlich ein Fremder dort zu Lande. Na, schütteln Sie nich den Kopp! Ich bin ein deutscher Rittermäßiger, der sich im Wendenland sein Gut gekauft hat. Ja, ich kann mich nicht beschweren, die Wenden sind gute Leute. Saufen ja 'n bissel – das tun wir auch – sind auch sonst nicht gerade große Säulenheilige – das sind wir auch nicht –, aber sind fleißige Arbeiter und ehrliche Leute. Juro, ich bin ein Deutscher, aber ich möcht aus dem Wendenland nicht raus; es is mir zur Heimat geworden, wenn ich mir auch jetzt noch mit jedem wendischen Wort die Zunge verrenke. Und Sie – Sie sind doch ein geborener Wende!«
Juro ließ den Kopf sinken und zupfte mit den Fingern an dem kurzen Grase. Der Wind spielte leicht mit seinen schlichten blonden Haaren, und eine tiefe Röte bedeckte seine Wangen. So sprach er:
»Ach, Herr von Withold, Sie wissen nicht, woran Sie da rühren. Das sind ja die Kämpfe, die ich seit vielen Jahren führe mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit mir selbst, auch mit meinem Bruder Samo. Daß ich für die Landwirtschaft kein Talent und kein Interesse habe, ist ja von meiner Nationalität ganz unabhängig und hat damit gar nichts zu tun. Ich studiere ja auch in der Hauptsache Medizin und höre nur nebenbei einige[23] landwirtschaftliche Vorlesungen. Was mich grämt, ist aber, daß sie mich zu Hause alle als einen Abtrünnigen ansehen, als einen, der sein Wendentum verrät und ein Deutscher wurde.«
Der junge Mann stand auf. Eine große Erregung überkam ihn.
»Ich will's ja nicht leugnen, ich bin ein Deutscher in meinem Herzen. Aber ich wehre mich dagegen, daß ich das Wendentum verraten haben soll. Was sind die Wenden noch? Ein winziges Häuflein, eingesprengt ins große deutsche Volk. Und wie ist ihnen zu helfen? Dadurch, daß sie sich feindselig und eigensinnig absperren? Dann müssen sie verhungern, vor allen Dingen auch geistig verhungern. Wir haben keine große Nationalliteratur, keine nationale Kunst, keine nationale Wissenschaft, keine großen nationalen Schulen, nicht einmal nationale Geschäftsbetriebe. Auf unseren Walddörfern sitzen wir in Armut, und wenn einer hinauskommt und nichts kann als seine wendische Sprache, die niemand versteht, dann wird er ein Helot, und das ganze Volk wird ein Helotenvolk werden. Das will ich nicht, dagegen wehr' ich mich, eben weil ich die Meinigen liebe, und darum müssen wir, die selbst zu schwach sind, uns an ein stärkeres und reicheres Volk anschließen, müssen wir eine Sprache haben, die ins weite Land klingt und auf vielen Märkten und in vielen Hörsälen verstanden wird.«
Er hielt inne und blickte hinunter ins tiefe Elbtal, das den preußischen und den böhmischen Kamm des Riesengebirges trennt. Steil fallen die Felsenwände des böhmischen Krokonosch hinab zum Fluß. Juros Blicke schweiften hinüber zum böhmischen Land. Und er sprach das, was in seinem jungen Grüblerherzen sich in vielen einsamen Stunden gebildet und immer wiederholt hatte, was er wie sein eigenes Evangelium konnte:
»Anschluß an ein glücklicheres Volk, als wir sind, denen das Schicksal durch alle Jahrhunderte die Größe und Selbstherrlichkeit versagt hat! Kapitulation in Ehren! Aussöhnung mit gegebenen Notwendigkeiten, Aussöhnung, die uns nicht schändet, die uns vorwärts führt. Heimatsuchen in weitem Gefild, Heimatsuchen, das meinen stillen, gutmütigen Brüdern[24] und Schwestern nicht schwerfallen wird … Aber nicht dort drüben, nicht bei den Tschechen, die unsere Vettern heißen, die viel glücklicher waren als wir, in viel reicherem Lande wohnen und die doch trotz aller Großmannssucht den Weg zu einer hohen Staffel der Menschheit nicht fanden. Wir wollen Deutsche sein, im Deutschtum vorwärtskommen und ehrlich mithelfen, das, was uns am Deutschtum nicht gefallen kann, zu ändern und zu bessern.«
Der alte Withold reichte Juro gerührt die Hand, und der Mund des jungen, leidenschaftlich erregten Wenden zuckte.
Im Silberlicht des Mondes spielte die junge Elbe auf der Bergwiese. Und sie plauderte harmlos wie alle Bächlein, die mit Gräsern spielen und mit lachendem Glick-Glack und Hopp-Schlock über wichtigtuende Hölzchen wegsetzen, die sich ihnen neckend in den Weg legen. Das spielende Königskind, das zu Großem berufen ist, zur Beherrscherin weiter Lande und mächtiger Städte, tändelt hier in seiner Jugendheimat, lacht, tanzt und plaudert wie ein armes Wiesenwässerchen, das im nächsten Dorfteich mündet.
Aber eine ungestörte Jugend haben Königskinder nicht. Alte Leute, die von ihrer großen Mission wissen, nehmen sie von Zeit zu Zeit vom Spielplatz weg, bekleiden sie mit Größe und Würde, mit Brokatgewändern und goldenen Kronen, trichtern ihnen ein trutzig und altklug Sprüchlein ein und stellen sie so dem Volk zur Schau.
»Seht da, das Königskind! Seht die Würde und Größe, die in ihm ruht!«
Also geschieht es auch mit der jungen Elbe. Ihre Wässerchen werden in einem großen Wasserbehälter aufgefangen, der dicht an einem felsigen Abgrund liegt, und wenn der ganze Behälter voll ist und wenn genug Volk da ist, das geneigt ist, seinen Tribut zu entrichten, dann zieht der Wärter, der Gouverneur des jungen Königskindes, eine Schleuse, und das Kind, das eben noch silbern lachte, spricht plötzlich mit donnernden[25] Herrscherworten, entrollt seinen tausendfaltigen Demantmantel, steigt mit Riesenschritten hinab ins Tal.
Freilich, es ist nur ein höfisches Theater, es ist nur, um dem Volk ein Schaustück zu stellen. Kaum ist das Königskind im Tal angelangt, so zieht es den wallenden Demantmantel wieder aus, hört auf, seinen eingelernten Donnerspruch zu sagen, und spielt tändelnd wieder wie andere Kinder. – –
Einsam lag die Gebirgsbaude an der Felsschlucht, wo der alte Wärter am Wasserbassin lehnte und wartete, ob er um ein Stücklein Trinkgeld den »Elbfall« noch einmal »ziehen« können würde. In der Baude saßen Gäste, lachten beim böhmischen Wein. Ein Fiedler spielte, sein Weib schlug die Gitarre. Sie sangen »Gott erhalte Franz den Kaiser« und »Heil dir im Siegerkranz«.
Die drei Künstlermenschen, das Geschwisterpaar Withold und der junge Wende Juro, wanderten draußen durch den lichten Abend, sahen den Himmelskuß des Sternenlichtes auf den Stirnen der Berge, sahen das tiefe dunkle Elbtal hinab einen weißen Nebelschwaden fahren, der war wie ein silberner Kahn auf dunklem Strom. Als die drei zu einem schmalen, steinigen Fußsteig kamen, der in die Elbschlucht führt, sagte Heinrich zu Juro und Elisabeth:
»Steigt ein Stücklein da hinab. Ich gehe hinüber zum Wärter, er muß den Fall noch einmal ablassen. Das wird schön aussehen jetzt im Mondenschein.«
Da standen Juro und Elisabeth erst zögernd still, dann gingen sie beklommen den dunklen, schmalen Felsenweg hinab. Sie waren jung. Sie waren Träumer. Sie liebten sich, und ihre Seelen waren unverdorben. Da war die herzschlagende Scheu in ihnen, die bange Furcht und doch auch die schmerzliche Sehnsucht: jetzt in dieser lichten Abendstunde möge die Zeit gekommen sein, wo das goldene Tor zum Allerheiligsten ihrer Seele aufspringen und sich das Wunder offenbaren würde, das wohlgehütet da wohnte – ihre Liebe.
Langsam stiegen sie den holprigen Pfad hinab, und wenn der Mann dem Mädchen die Hand reichte, dann glühten die[26] Hände ineinander wie im Fieberfeuer, oder sie trafen sich kalt wie in Schreck und Angst.
Als sie endlich stehenblieben, war ein Baumstamm zwischen ihnen, aber sie fühlten ihre Nähe, und es war, als ob tausend weiche Wunderfäden sich um sie und den Stamm rankten und sie in weltferne Wonnen einspännen. Ein Nachtvogel huschte vor ihnen auf; sonst war alles in tiefer, feierlicher Ruhe.
Da kam ein Plätschern, ein Rauschen, dann ein Brausen, und donnernd fiel eine Silberflut vor ihren Augen durch die Nacht, und eine Siegeshymne dröhnte an ihr Ohr. Eine Fülle von Schönheit, Größe, Kraft ward vor ihnen aufgetan, ein Siegesjubel, ein jauchzender Glaube an Glück und Freude durchschütterte sie …
Der Strom überdröhnte den Schlag ihrer Herzen, und sie lagen sich in den Armen zum ersten langen heißen Kuß.
Sie sprachen kein Wort. Den ganzen großen jubelnden Inhalt ihrer Herzen sang der silberne Fluß in gewaltiger Melodie.
Erst als der Strom versiegte, als ein dünnes Rinnlein einen leisen Epilog zu dem großen Schauspiel sprach, da erwachten sie zur Menschensprache und gaben sich in stammelnden Fragen und wirren Antworten, mit leisem Seufzen und glückseligem Lachen Kunde von ihrer Liebe.
»Ich gehöre dir für immer und ewig!«
Diese Worte sprach Juro fest und mit feierlichem Ernst. Es war ein Gelöbnis, das aus der Gegenwart herauswuchs und an keine Kämpfe der Zukunft dachte.
Der Wendensohn und das deutsche Mädchen hatten sich verlobt. – – –
Heinrich kam, merkte sogleich, was geschehen sei, drückte dem Freund und seiner Schwester die Hand und übernahm es, oben auf dem Wiesenplan die Verwirrung der beiden jungen Leute durch seine Munterkeit zu verbergen.
Die Eltern und alle anderen Gäste waren aus der Baude gekommen, und nun wurde im Freien eine große Polonaise[27] geschritten, zu der der Böhme und sein gitarreschlagendes Weib gar lieblich musizierten.
Ein später Wanderer kam vom Hohen Rad herüber. Er war schon weit gegangen, hatte in vielen Bauden Einkehr gehalten und überall dieselbe Frage getan. Nun wies ihn die Spur, der er folgte, nach der Elbfallbaude, die da endlich vor ihm lag. Er hörte Musik, sah tanzende Gestalten, hörte ein deutsches Lied singen und blieb stehen. Den Hut hielt er in der Hand, der Mond bestrahlte seinen Kopf.
Schlichtes, schwarzes Haar, in die Stirn gekämmt, etwa wie es die Russen tragen, breite Wangen, zwei kleine dunkle, bewegliche Augen. Die Figur klein, aber kräftig, ein wenig krummrückig, so daß der Hals kurz, gedrückt erschien. Er war jung, ohne recht jung auszusehen, über dem scharf und energisch geschnittenen Mund war kein Barthaar zu sehen.
Wieder tönte das Lied herüber. Da kniffen sich die kleinen Augen zusammen, und der Fremde sprach in fremder Sprache:
»Tolle Deutsche auf slawischem Boden!«
Im Weitergehen summte auch er ein Lied:
»Kde domov muj?«
Es war das tschechische Heimatlied: »Wo steht mein Vaterhaus?«
So kam er an die Baude heran. Mit finsterem Blick schaute er dem fröhlichen Tanze zu, blickte er besonders auf Juro, der mit Elisabeth tanzte und die Ankunft des Fremden gar nicht bemerkte.
Da faßte ihn dieser am Arm, hielt das Paar an.
»Hör auf zu tanzen!«
Er sagte es in der fremden Sprache.
Juro wandte sich ihm bestürzt zu.
»Was – was ist? – Samo – du? – Du – Samo? – Ja – was – was willst du denn?«
»Daß du aufhörst zu tanzen!«
»Was fällt dir ein? – Wo kommst du her? – Kennst du[28] denn Fräulein von Withold nicht, die Tochter von Herrn von Withold aus unserem Nachbardorf?«
Der Fremde machte Elisabeth eine leichte, mürrische Verneigung.
»Ich habe mit meinem Bruder zu reden«, sagte er kurz.
»Samo, ich verbitte mir diesen Ton! Ich verbitte mir, daß du mich hier mitten im harmlosen Tanz überfällst.«
»So tanze weiter! Indes liegt unsere Mutter daheim im Sterben!«
»Du bist – du bist wohl wahnsinnig?«
Der andere reichte ihm ein Depeschenblatt hin.
»Mutter tödlich verunglückt –«
»Samo – was – was – das ist ja nicht möglich – o Gott, Samo, das ist doch nicht wahr? Sag doch, was das ist – sag doch, was du weißt –«
»Ich weiß, daß ich das Blatt in Breslau bekam, daß ich hierhergefahren bin und daß ich dich den ganzen Tag gesucht habe.«
Juro brach in ein mühsam unterdrücktes Schluchzen aus und wollte sich dem Bruder an die Brust werfen. Der wehrte ihn ab.
»Hol deine Sachen und komm!«
Eine Weile stand Juro fassungslos da, indes seine Hände das böse Blatt zerknitterten, dann wandte er sich zu Elisabeth.
Die stand mit todblassem Gesicht neben ihm. Die anderen drängten heran, die Musikanten brachen das Spiel ab, eine kurze Auskunft wurde gegeben, eine Flut bedauernder Worte wogte durcheinander.
Da ging Juro nach der Baude, holte sein geringes Reisegepäck. Als er vor Elisabeth zum Abschiednehmen stand, sagte er leise zu ihr:
»Nun bleib mir treu! Jetzt brauche ich dich mehr als früher!«
Sie wollte etwas sagen, aber ihre Lippen zuckten nur. Doch sie drückte ihm die Hand.
Bald darauf wanderten die beiden Brüder der preußischen Grenze zu.
Drüben im Wendenland kämpft die verunglückte Frau mit dem Tode.
»Es geht zu Ende! – Nehmt mich aus dem Bett! Holt frisches Stroh. – – – Weine nicht so sehr, Hanka! – Wenn ich tot bin, weine nicht auf meinen Sarg – – sonst müßte ich kommen und dich zu mir holen – –«
Eine lange, bange Pause. Dann fährt die Kranke fort: »Kommt Juro? – Habt ihr ihm geschrieben? – – Ich muß noch mit ihm reden – – und ich will ihn sehen –«
Der alte Scholta tritt ans Bett seiner Frau.
»Juro kommt und auch Samo kommt.«
Die Kranke lächelt und reicht ihrem Gatten die Hand.
»Hanzo! Ich danke dir, daß du mich zu deiner Frau genommen hast! Das war eine Gnade von Gott!«
Über das scharfgeschnittene, bartlose Gesicht des alten Wenden geht ein tiefer Schmerz; aber er sagt nichts als: »Gott helfe dir!«
Die Frau richtet den Blick nach der Wand, wo der Glasschrank steht. Er ist aus gelbgestrichenem Kirschbaumholz und hat eine Tür mit drei Glasscheiben, durch die man ein Gewirr bunter Dinge steht. Da sind Porzellan- und Glasgefäße vom Ahn und Urahn her. An alle knüpfen sich Familienerinnerungen, auf manchem steht ein alter Name, eine alte Jahreszahl, ein alter Segensspruch, der noch immer wirkt, wenn man ihn liest. Da sind noch die Tabaksdose und die Korallenkette, die der Alte Fritz den Urgroßeltern geschenkt hat, als er einmal in der Scholtisei gerastet hat; da ist Großvaters eiserner Ehering vom Jahre 1813. Wie die Kaffeetassen glitzern mit ihren goldenen oder hellroten Aufschriften! Dazwischen liegt ein altes Stück Holz. Es stammt von der uralten Hejka, der Hammerkeule, die der erste Scholta der Familie als Zeichen seiner Macht führte, mit der er sich verteidigte, als er in bösen Zeitläuften des langen Krieges von Kroaten überfallen wurde. Die Kroaten erschlugen ihn, zerschlugen seine Hejka. Aber das Holz der Hejka liegt immer noch als Heiligtum im Glasschrank unter den schönen feierlichen Kaffeetassen, das Andenken des Urahnen ist[30] immer noch im Segen, und die Kroaten werden wohl gestorben und verdorben und verloren sein, wie alle bösen Menschen verlorengehen.
Die schlimmen Schmerzen kommen wieder, die Kranke verliert das Bewußtsein.
Hanka, das junge Wendenmädchen, schreit laut auf, Hanzo tritt ruhig ans Bett und schiebt das jammernde Mädchen beiseite. Der alte Knecht Kito schleicht durch die Tür herein. Er hat ein Büschel Kirchhofgras in der Hand.
Die Kranke erwacht wieder zum Leben. Und nachdem ihre Augen lange in Fieber und Schmerz an der Stubendecke herumgeirrt sind, richtet sie wieder den Blick nach dem Glasschrank und reicht ihrem Manne die Hand.
»Hanzo, es war eine Gnade –!«
Dort im Glasschrank ist noch der kleine Rautenkranz, den Hanzo bei der Hochzeit auf dem Kopfe trug. Weil er »cysty« war – ehrbar. Und der Kranz ist ihm nicht abgefallen den ganzen Tag, nicht einmal beim Tanze. Nun ist der Kranz freilich braun und dürr, aber die grünen und weißen Seidenfäden, die von ihm herunterhängen, sind noch immer weiß und grün. Da steht noch ihre eigene farbengeschmückte Brauthaube, da ist noch ihr eigener Kranz, da ist noch der Taler, den ihr die Mutter in den Brautstrumpf steckte, damit sie immer im Leben Geld habe. Da sind noch zwei Kerzenstümpfe, die gebrannt haben von dem Augenblick der Geburt ihrer beiden Söhne Juro und Samo an bis zu deren Taufe. Nun kann der Teufel keine Macht über sie haben ihr Leben lang.
Grüne, schöne Zeit! Die scheidende Seele geht am letzten Herbsttag immer zu ihrem Frühling zurück.
»Sie stirbt! Sie stirbt!« schreit Hanka, das Mädchen, wieder leidenschaftlich auf und neigt sich über die bleiche Kranke. Die fährt mit irren Fingern nach dem Verband an ihrem Kopf, und ein rotes Rinnsel fließt über Auge und Wange.
»Sie stirbt! Sie stirbt!«
»Geh weg, Mädel!«
Der alte Knecht Kito steht am Bett. Er hat Gras geholt vom[31] Kirchhof und es trocknen lassen. Nun zündet er die dürren Gräser und Blumen an, läßt den Rauch hingehen über die Kranke und spricht:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes!«
»To pomogaj si bóg wósc, bóg syn a bóg swety duch«, wiederholt der alte Scholta. – –
Da fährt ein Wagen in den Hof. Ein Herr springt heraus, stellt draußen einige Fragen und tritt in die Stube.
»Tag! Also, was ist los?« So fragt er barsch.
Die beiden alten Wenden und das junge Mädchen starren den Fremdling an. Der geht auf das Krankenbett los …
»Also, wollen mal sehen!«
Und streckt die Hand nach der Kranken aus.
»Herr, wer sind Sie? Was wollen Sie hier?« fragt der alte Scholta.
»Ja, Mann, ich bin doch der Arzt – Dr. Brehler. Sie haben mich doch rufen lassen.«
»Ich habe Sie nicht rufen lassen.«
»Na, hört sich alles auf! Kommt so'n Kerl, Wilhelm Tielscher oder so ähnlich – also Ihr Knecht – kommt der mitten in der Nacht, klingelt mich raus und sagt, ich müsse sofort zu seiner verunglückten Frau kommen. Na, ich hab' den Morgen abgewartet und bin nun hier. Die Fahrt durch Ihre Sandgruben und Schlammgräben ist doch kein Vergnügen. Ist das nu Ihre Frau?«
»Ja! Und verunglückt, schwer verunglückt ist sie auch – ja! Aber Sie rufen lassen habe ich nicht – nein!«
»Das ist stark! Mich hierher in dieses weltverlorene Nest – Ja, Mann, sehen Sie nicht, daß die Frau stirbt?«
»Ja, das sehe ich!« sagt der Scholta ganz leise.
»Und Sie lassen die Frau so liegen? Was ist denn das für ein schauderhafter Qualm hier?«
Der alte Kito tritt vor.
»Ich habe die Frau angeräuchert und das Blut besprochen«, sagt er mit großem Ernst.
»Beräuchert? Besprochen? Ja, Menschenkinder, gibt's denn im neunzehnten Jahrhundert wirklich noch solch schafsdämliche Gesellschaft? Seid ihr denn verrückt?«
»Herr Doktor! – Herr Doktor! – Herr Doktor!«
Mehr bringt der weißhaarige Alte nicht heraus. Aber mit seinem angebrannten Grasbüschel fährt er dem Arzt vor dem Gesicht herum.
»Herr Doktor – ich habe – im Namen Gottes –«
»Im Namen Gottes wird der hellste Blödsinn vollführt seit ewigen Zeiten!« schrie der Doktor. »Macht das Fenster auf! – Und Sie – Sie sind doch der Mann von der Frau? Soll ich sie nun untersuchen oder nicht?«
Der Scholta senkte den Kopf und schwieg.
»Also – da – da macht doch, was ihr wollt!«
Zornschnaubend wandte sich der Arzt nach der Tür. Da eilte ihm Hanzo nach.
»Herr Doktor – können Sie – können Sie meiner Frau wirklich das Leben retten?«
»Natürlich kann ich. Dafür bin ich Doktor! Aber ihr mit eurem blödsinnigen Quatsch macht ja alles zuschanden. Adieu!«
»Herr Doktor! Herr Doktor! Ich bitte so sehr! Ich gebe alles, was Sie wollen, wenn Sie es wirklich können!«
»So! Auf einmal! Erst wird man behandelt wie'n Schuhputzer, und dann –«
Er kehrte um, tat einige barsche Fragen und enthüllte dann die bewußtlose Frau, um sie zu untersuchen.
Der alte Hanzo wandte sich ab. Er schluchzte, und seine Brust krampfte sich zusammen. Der Sohn der Heide litt darunter, daß ein fremder Mann seine Frau sah. Der alte Kito schlich mit seinem Grasbüschel hinaus.
Eine lange schmerzliche Pause. Die Sonne sah zum Fenster[33] herein und vergoldete den Rautenkranz, den der Scholta bei seiner Trauung getragen, und in dem alten Glasschrank war Licht und Glanz, und in der keuschen Seele des Bauern war Nacht und Qual.
»Hm! Da ist nichts mehr zu machen! Da ist es vorbei!«
»Herr! – Und da – da – da – haben Sie erst –«
»Was habe ich?«
»Sie – Sie – Mariana –«
Der alte Scholta sinkt am Bett nieder und deckt alles, was er mit seinen zitternden Händen erlangt, hastig über seine Frau.
»Ja, Mann, was wollen Sie eigentlich?«
Der Scholta springt auf.
»Können Sie – können Sie ihr nicht helfen?«
»Nein! – Es ist vorbei –!«
»Und Sie haben –«
»Was habe ich?«
»Sie erst – erst – erst –«
»Also, Mann, brüllen Sie mich nicht an! Ich hab' die Sache endlich satt. Adieu!«
Mit kraftlos herabhängenden Armen, an denen sich die Fäuste ballten, sah der alte Wende dem Arzte nach. – –
Oh, es war schade!
Es war schade, daß kein besserer Arzt, kein besserer Deutscher, kein besserer Mensch in diese wendische Krankenstube trat. Und es war schade, daß der deutsche Knecht Wilhelm Tielscher sechs Wochen lang ins Gefängnis gesteckt wurde, weil er den Arzt, den er auf der Heimfahrt begleitete, unterwegs aus dem Wagen gezogen, durchgeprügelt und zu Fuß hatte heimgehen lassen.
Als der Abend kam, sagte die kranke Frau: »Nehmt mich aus dem Bett. Holt das Sterbestroh und legt mich darauf!«
Alle wehrten ab.
»Ich muß sterben,« sagte die Frau, »und es möchte niemand[34] mehr in den Betten schlafen, in denen ich gestorben bin. Legt mich auf das Stroh!«
Sie verlangte den alten wendischen Brauch, der das Bettzeug nicht unbrauchbar werden lassen will, weshalb der Kranke vor seinem Verscheiden neben das Bett auf Stroh gelegt wird.
»Es ist schade um die Betten!« sagte die sparsame Frau. »Ihr müßtet sie verbrennen!«
Hanzo neigte sich über sie und sagte:
»Weißt du nicht, wer du bist?«
Da flog ein stolzes Lächeln über das Antlitz der Kranken, und sie sagte wieder:
»Hanzo, es war eine Gnade!«
Dann sprach sie stolz zum alten Kito und zu Hanka:
»Ich sterbe im Bett, weil mein Mann der Kral[3] ist.«
Sie nahm ihn an der Hand und flüsterte:
»Ich werde noch so lange leben, bis Juro kommt. Ich muß noch mit ihm reden wegen Hanka und vom Kral.«
Er nickte und saß am Bette und hielt ihre Hand.
Und so warteten die beiden auf ihre Söhne und auf den Tod.
Aber zwischen alles schwere Leid und alle Erwartung mischte sich immer der Königsgedanke. Der Königsgedanke war im ganzen Haus – bei der Frau als die stolzeste Erinnerung ihres entfliehenden Lebens, bei dem Manne und bei allen Wenden in Haus und Hof.
Es war die Gewißheit, hier geschehe etwas anderes, Größeres, als wenn sonst eine wendische Frau starb.
Die Frau des Kral starb, die heimliche Königin der Wenden schied aus dem Leben.
Dieser Gedanke ging durchs Dorf: der alte Briefträger trug ihn über die Heide; ein Händler fing die Kunde auf und trug sie weiter; am Ackerpflug, am Webstuhl wurde er besprochen, und bald sagten sich die Schiffer und Fischer drunten im Niederland an der Spree wie auch die Schafhirten im Oberlande heimlich und scheu: »Die Frau des Kral stirbt!«
Als dieser Abend weiter vorschritt und der Nachtwind ans Fenster klopfte, schrie die Frau auf:
»Oh – der Nachtjäger!«
Die Mägde stürzten mit neuem Tee herbei, mit Wohlverleih und Schwarzwurzel, die da gut sind für die Wunden, und sie brachten Bitterklee gegen das Fieber.
Im Wundfieber sprach die Frau vom König der Wenden. Wirr waren ihre Worte: vom verblühten Flieder sprach sie, von der ledernen Brücke, von toten Kindern und vom Spinnen und Weben – abgerissene, harte Worte vom Untergang, und dann lachte sie dazwischen, rief nach Juro und Samo, gab Befehle für die Milchwirtschaft und kam wieder auf den Kral und sprach von einer silbernen Schaufel, von einer weißen Wolke und einem weißen Fisch …
Es ist aber dieses die
Sage vom Wendenkönig.
Es war vor tausend und vielen Jahren. Der Winter war mit seinem Eis bis auf den Grund der Spree gedrungen und sprach mit knirschenden Worten zu den Waldbäumen, die, in silberne Panzer gezwängt, seine Fronsleute waren.
Da ritt vom verrufenen Kreuzweg her der Nachtjäger Sturm gegen die gepanzerten Bäume. Er hatte das Gesicht im Nacken und pfiff mit gellem Ton seinen sieben Wolfshunden. Die hatten Schweinsköpfe und kamen mit fliegenden Flanken und triefenden, behaarten Zungen dahergejagt. Das pechschwarze Roß des Nachtjägers sprang zur Höhe, daß Funken von den Hufen auf das Eis des Weges sprühten, und gelbes Feuer brach aus den Nüstern des Rosses.
So ritt der Nachtjäger Sturm. Ein Beben ging durch den Wald, und alle Panzer klirrten, und alle Bäume duckten sich angstvoll und gramvoll nieder.
»Hallojoho! Hallojoho! Hallojoho!«
Eine Peitsche knallte, die Rüden bellten heiser und hohl. Der Nachtjäger lachte. Wo er vorüberritt, verhüllten sich alle Sterne. Wo er vorüberritt, kam das Sterben über das Vieh, erblindeten alte Leute, ging Jungfrauenehre verloren, ringelten sich graue Stricke gleich lockenden Schlangen in die Hände verzweifelnder Menschen.
»Hallojoho! Hallojoho!«
Die Luft dröhnt und brüllt, Raben flattern zuckend am Boden, die ersten Bäume brechen zusammen.
Hallojoho! Der Nachtjäger ist da! – –
Da tritt ein Mann aus dem Wald. Er trägt einen Pilgermantel und einen Stecken als Stab.
»Hallojoho! Ich reite dich zu Blut und Knochenbrei, und meine Hunde fressen dir Auge und Herz!«
Der Fremdling aber hebt seinen Stab und steht plötzlich in großer Stille, steht in silbernem Mondenlicht und lächelt. Da bäumt das Roß des Nachtjägers hoch auf, da dreht sich der Kopf des wilden Reiters in wüstem Wirbel, da heulen die Hunde wie unter grausamer Peitsche, da wendet sich der böse Troß zu jäher Flucht.
Die Wolken zerreißen, Mondenschein und Sonnenlicht fällt auf die Wiese, der Wald richtet sich auf, und der Wanderer geht auf ein kleines Haus zu, in dem ein Licht brennt.
Am knorrigen Ast des Apfelbaumes vor dem Hause hing ein alter Mann. Die Glieder zuckten noch im Todeskampf. Der Fremdling knüpfte den Gehenkten los, stellte ihn auf die Füße, stützte ihn mit jugendstarkem Arm und fragte nach einer Weile:
»Warum wolltest du sterben?«
Der Greis keuchte etwas von Not und Elend, von Krankheit unter dem Vieh, vom harten Winter und harten Hunger.
»Der Nachtjäger hat dich betört! Komm ins Haus!«
In der Hütte saß die Frau des alten Mannes. Sie war blind.
»Warum bist du blind?« fragte der Fremdling.
»Weil ich so viel geweint habe!«
»Und warum hast du geweint?«
Sie machte eine müde Gebärde.
Da zog der Fremdling eine goldene Schale aus der Tasche, darin war eine kristallklare Flüssigkeit, und er strich mit der Flüssigkeit über die Augen des alten Weibleins, und sie jauchzte und lachte mit ihren wieder geöffneten Augen.
Der alte Mann aber kniete am Tische nieder und sagte: »Du bist der König der Wenden!«
Und das alte Weiblein kniete am Tische nieder und sagte: »Du bist unser Kral.«
»Ja, ich bin der Kral der Wenden«, sagte der Fremde mit Feierlichkeit.
Dann zog er eine Spindel aus der Tasche und ein Säckchen mit Leinsamen und belehrte die alten Leute, wie sie Flachs bauen und spinnen sollten. Und wenn erst alle Leute Flachs bauten und spännen, dann würde die Not fort sein aus dem Wendenlande.
Diese Leute hatten aber eine schöne Tochter. Sie war groß gewachsen und üppig gebildet, hatte helle Haare und ein rotes Gesicht; ihre Arme waren stark und ihre Füße flink.
Sie trat nun in die Stube und sah den Fremdling, und er sah sie. Und sie sahen beide ihre junge Gesundheit und ihre schöne Kraft und liebten sich alsobald.
»Ich höre, daß die Krankheit unter dein Vieh gekommen ist«, begann der Fremde.
»Ja, es ist so«, antwortete das Mädchen.
»So komm mit mir in den Stall!«
Sie gingen in die Winternacht hinaus nach dem Stalle, in dem die Kühe krank die Köpfe hängen ließen.
Der Fremde ließ die Tiere an einem Salz lecken, hob dann die Hand und sagte:
Da wurden die Tiere gesund.
Am nächsten Tage, als es Mittag war und die Sonne klar über das weiße Feld strahlte, nahm der Fremde das Mädchen an der Hand, führte es in den kleinen Garten vor der Hütte und sagte:
»Ich schenke dir diesen Stab, den ich hier in die Erde stoße. Er wird zu einem Baume werden, an dem tausend Blumen blühen werden. Und der böse Jäger wird nimmermehr Macht haben über euch.«
Das Mädchen dankte ihm, und als sie der Fremde so sah in ihrer Schönheit und Stärke, sagte er:
»Du bist schön und gefällst mir wohl, und ich möchte dich zum Weibe nehmen, wenn du mir in Wahrheit sagen kannst, daß du eine reine Jungfer bist.«
Da erglühte das Mädchen, und dann wurde es blaß, und es sah auf den herrlichen Jüngling und zögerte noch drei Herzschläge lang und sagte dann:
»Wohl, ich bin eine reine Jungfrau!«
Er fragte weiter:
»Sage mir noch, wer der Mann war, den ich gestern abend von deinem Hause schleichen sah, ehe ich bei euch eintrat.«
Sie antwortete:
»War es keiner vom wilden Heer, so war es wohl ein Dieb.«
Darauf nahm er sie in seine Arme, küßte sie und sagte: »Am Tage des nächsten Vollmondes soll unsere Hochzeit sein.« –
Nach drei Tagen war aber im Kretscham des Dorfes Spiel und Tanz. Da war auch der Fremde dabei, und er tanzte mit seiner Braut bald zierlich, bald keck und feurig, bis die Sterne hoch standen.
Dann aber fielen die Burschen des Dorfes, die von einem eifersüchtigen jungen Manne aufgehetzt waren, über den Fremden her, um ihn zu töten.
Er aber warf sie – hundert an der Zahl – mit Riesenkräften der Reihe nach auf die Straße, und den einen, der das Messer nach ihm zückte, schlug er mit einem Fausthieb nieder.
Da riefen die draußen auf der Straße: »Weh', er hat ihren Buhlen erschlagen!«
Der Fremde sagte zu den Spielleuten, der Tanz sei aus, und ging in den Wald.
Am anderen Tage, als wieder die Mittagssonne klar übers Feld schien, kam er zurück in die Hütte seiner Braut, nahm das Mädchen bei der Hand und führte sie nach dem Garten, wo der Wanderstecken in der Erde steckte.
Und er fragte sie mit strenger Stimme:
»Hatten jene recht, die sagten, ich habe deinen Buhlen erschlagen?«
Weil aber das Mädchen nicht »nein« sagen konnte, riß er den Stecken aus der Erde und schlug sie nieder.
Noch ehe sie starb, fragte er:
»Warum hast du mich belogen?«
Da sagte sie, daß sie ihn ja früher nicht gekannt hätte, daß sie ihn aber mit Treue geliebt hätte, als sie ihn sah. Und sie starb.
Der Fremdling stand drei Stunden neben ihr in tiefem Nachdenken. Dann holte er eine Schaufel, begrub das Mädchen und steckte den Stecken auf ihr Grab. Am selben Abend noch zog er fort in die Welt.
Als der Frühling kam, wuchs aus dem Stecken ein Fliederbaum. Und der Flieder war fortan im Wendenland. Die Blüten waren hold und lieb in jedem Jahr, und ihr Duft war süß und zart; aber wer sie pflückte, dem welkten sie an der Brust, noch ehe die Frühlingssonne unterging.
Nach vielen Jahren kam der König wieder ins Wendenland. Als er die Heimat betrat, wurde sein Antlitz rot und jung; er war wieder ein Jüngling.
Auf dem Sandwege im Föhrenwald begegnete ihm ein wendisches Mädchen. Sie war zierlich und schlank und trug ein Bündel unter dem Arm.
»Wie heißest du? Woher bist du? Wohin gehst du? Und was trägst du unter dem Arm?«
»Das sind viele Fragen. Ich heiße Trudetzka, ich bin aus Burg und reise nach der reichen Stadt, um mein Garn zu verkaufen.«
»Zeige mir dein Garn.«
Er prüfte es und fand es fein und regelmäßig gesponnen.
»Wer hat euch diese Kunst gelehrt?«
Sie erzählte ihm vom Kral.
Er hörte versonnen zu und fragte am Schlusse nur: »Blüht der Flieder?«
»Ja, der Flieder blüht im ganzen Lande.«
Darauf besann sich der König eine Weile lang und sagte dann:
»Verkaufe dein Garn nicht an die Deutschen. Behalte es und gehe heim. Ich werde mit dir gehen und dir das Geld geben, das du verdienen wolltest.«
Das Mädchen ging mit ihm, und sie kamen nach langer Wanderung nach Burg, das an der Spree liegt. Dort kaufte sich der Wendenkönig ein Haus. Und er baute alsbald mit kundiger Hand einen Webstuhl und wurde ein Leinweber.
Da kamen die Wenden aus allen Häusern und Wäldern. Sie kamen auf Kähnen und auf Rossen, besahen sich den Webstuhl und kehrten heim. Viele aber erkannten den starken, klugen Mann, und sie flüsterten unter sich: »Er ist unser Kral.«
Es geschah aber, daß Boten des Markgrafen Johannes, der an der Grenze herrschte, in das Haus des Kral traten und ihn fragten, ob er nicht Dienste nehmen wolle bei den deutschen Kriegern. Ein Obrist solle er sein mit goldenem Stern und funkelndem Degen.
Der Kral wies das Angebot stolz von sich. Er wollte kein Diener sein und sich auch nicht trennen von Trudetzka, um deren Lieblichkeit willen er nach Burg gekommen war.
Sein Ansehen wuchs von Tag zu Tag, und bald sagten die Leute in den Spinnstuben:
»Der Leinweber in Burg ist der König der Wenden. Er ist uns nachgekommen aus dem fernen Asia. Er wird uns reich und groß machen.«
Trudetzka aber, die goldene Münzen am Mieder trug, die ihr der Kral geschenkt hatte, sie führte den Kral an einem rotseidenen Faden wie einen Narren, und einmal lockte sie ihn in eine einsame Waldgegend und verriet ihn an Häscher des Markgrafen Johannes.
Der Kral schlug die Häscher tot. Das Mädchen aber trug er sieben Stunden weit bis an den tiefsten Sumpf. Dort senkte er Trudetzka hinein.
Und er tat einen Fluch gegen Wendenland und ging in die Welt.
Nach drei Menschenaltern saß der Kral in einer Herberge des Morgenlandes. Er war zum Greise geworden. Ihm gegenüber saß ein Mann mit dunklem Haar und stechend schwarzen Augen.
Der Kral hob den Kopf und sagte zu dem Fremden:
»Bist du aus Armenia?«
Da lachte der Dunkle und wies gen Norden:
»Droben im Nordland ist meine Heimat. Ich bin ein Sorb, ein Slaw; denn ich habe ›slovo‹, das Wort, und die Deutschen sind ›njemski‹, das ist stumme Hunde, denn sie können meine Worte nicht sprechen.«
Da erschrak der Kral und sagte:
»Erzähle mir von deiner Heimat!«
Und der Fremde begann:
»Es ist ein Fluß, der heißt Sprewja, und es ist ein Ort daran, der heißt Burg. Weithin bis nach der berühmten Stadt Budissin dehnen sich Felder, Wälder und Wiesen. Dort wohnen die Sorben, die von den njemski Wenden genannt werden. Das Volk war arm, aber nun ist es reich und stark, denn ein Kral ist erstanden, ein Retter und Erlöser, der hat das Volk nützliche Künste gelehrt, die es groß und reich gemacht haben.«
»Ein Kral sagst du?« fragte der Alte. »Ist er noch unter euch? Ist er jung und stark?«
Die Stirn des Fremden umwölkte sich.
»Der Kral ist lange nicht mehr bei uns. Er ist aufgegangen[42] an unserem Himmel wie eine Sonne und ist untergegangen hinter zwei schwarzen Wolken!«
»Hinter zwei schwarzen Wolken?«
»Ja! Siehe, der Mann ist ein Stern, der auf die Erde scheint, und das Weib ist die Wolke, die von ihm vergoldet wird, die ihn weiß umrahmen, die ihn aber auch nächtlich verdecken kann. Es standen zwei schwarze Wolken an unserem Himmel, das waren zwei unwürdige Töchter unseres Volkes. Dahinter verschwand der Kral.«
Der Alte seufzte und fragte:
»Ist nun das Land ohne Fürsten?«
Da schwieg der Fremde lange, als kämpfe er mit tiefem Gram. Dann berichtete er:
»Das Land war so groß und reich, daß es einunddreißig Fürsten hatte. Aber an der Grenze lauerte der stumme Hund. Der njemz! Der Deutsche. Es war ein Markgraf, Gero mit Namen –, der tat freundlich den Wenden. Der lud die einunddreißig Fürsten auf sein Schloß zu üppigem Mahl und flößte ihnen einen Teufelswein ein, der sie trunken und ihre Hände schlaff machte, und er ließ dreißig erschlagen. Ein einziger entkam.«
Aufsprang der Kral in weher Wut.
»Und der eine – der letzte – er hat das Volk gesammelt, er hat an dem njemz Rache genommen, sein Blut vergossen, seine Burg zerstört, sein Land verwüstet – gesiegt –«
»Schweig, ehrwürdiger Greis – schweige, denn ich ertrage deine Worte nicht – die Schamröte verbrennt meine Wangen, wenn du so redest – – der letzte, der einunddreißigste, floh vor hundertfacher Übermacht und sitzt, ein beschämter Pilger, an deinem Tisch.«
»Du bist es?«
»Ja, ich!«
Still und traurig ging die Stunde weiter. Der Dunkle legte den Kopf auf den Tisch, der Alte deckte die Hände über die Augen, und seine Tränen tropften.
»So ist das Volk ohne Führer?« fragte er endlich mit tiefer Traurigkeit.
»Es ist allein. Wer bin ich, ihm zu helfen? Ein einziger könnte ihm helfen – – der Kral. Aber die Sonne ist untergegangen, und die Flur der Wenden liegt in Nacht.«
Da stand der Alte auf und sprach mit Feierlichkeit:
»Ich bin der König der Wenden.«
Und der Fremde sah ihn erschrocken an und sank am Tisch in die Knie und fragte erschüttert:
»Du bist der König der Wenden?«
»Ich bin es! Und wenn mich mein Alter trägt durch die fremden Länder bis zur Heimat, dann will ich für mein Volk kämpfen und dann sterben!«
Sie saßen lange beisammen in der Herberge des Morgenlandes. Und der Fremde sagte:
»Großer Kral! Das Volk wartet auf dich. Ich bin nichts als Morkusky, dein Diener. Aber Morkusky ist ein nützlicher Diener. Er ist jahrelang bei einem großen Meister gewesen und nun selbst geheimer Kräfte Meister.«
Am folgenden Morgen reiste der Kral mit Morkusky gen Norden.
Als er in seine Heimat kam, wurde er mit jedem Tage um ein Jahr jünger. Dieses Heimatwunder dauerte so lange, bis der Kral wieder ein starker, schöner Jüngling war. – –
Auf seiner Reise kam er gen Schorbus. Dort ist ein Berg, auf dem zwei Felsblöcke liegen. Auf dem einen Stein saß Bely Bog, der weiße Gott, der den Menschen, die über den Berg wanderten, die Hände mit guten Gaben und das Herz mit guten Gedanken füllte; auf dem andern Stein saß Zarny Bog, der den Menschen die guten Gaben nahm und in den Schmutz warf, die guten Gedanken in alle Winde stieß.
Und der Kral wußte nicht, zu wem er sich wenden sollte. Denn ob er gleich wieder ein Jüngling war von Gestalt und Aussehen, so war doch sein Herz alt und kalt geblieben, hatte böser Jahre und bösen Verrats nicht vergessen und war hart und ohne Liebe.
Und der Kral stand mitten zwischen den beiden Göttern, nicht um Haaresbreite dem einen näher oder entfernter.
Da kam von der anderen Seite her den Berg herauf ein junger Mann, fast noch ein Knabe. Er war blond und schön, und seine Augen blühten wie blaue Blumen. Er ging nach der Seite des guten Gottes hin und grüßte nach Art der Deutschen.
»Wohin willst du, deutscher Jüngling?« fragte finster der Kral.
»Ich suche den König der Wenden.«
»Was willst du vom Kral?«
»Ich komme für Gero, den Markgrafen. Er lud dreißig wendische Fürsten zu sich auf sein Schloß. Er sprach gütlich mit ihnen. Sie aber tranken und prahlten mit der Deutschen Tod. Da wurden sie getötet.«
»Er hat sie gemeuchelt«, schrie der Kral und trat einen Schritt nach der linken Seite.
»Er hat sie alle dreißig im Kampf selbst erschlagen.«
Da trat der Kral drei Schritt weiter auf den schwarzen Gott zu.
»Was faselt der Knirps? Ein Deutscher hätte dreißig Wenden erschlagen? Drückt ihn der Plon?[4] Was willst du hier, Knabe?«
»Ich bin kein Knabe; ich bin fünfzehn Jahre alt. Aber Gero ist alt geworden. Alle Nächte kämpfen die dreißig Wenden mit ihm. Er ist in sieben frommen Klöstern gewesen, er ist nach Rom gewallfahrtet und findet doch keine Ruhe. Darum suche ich den Kral.«
»Was willst du vom Kral?«
»Ich will, daß er meinem Vater das gibt, wonach er alle Nächte seufzet: die Versöhnung mit den Wenden.«
Als die Menschen so redeten, schwiegen die Götter. Nun aber erhob sich Bely Bog, der gute Gott, und er streckte seine weißen Hände aus, die eine über Wendenland, die andere dem Lande der Deutschen zu, und hob dann die Hände über sein Haupt und[45] wob aus Sonnenschein zwei goldene Ringe der Eintracht. Die hielt er wortlos den beiden hin.
Zwei zögernde Schritte ging der Kral auf den guten Gott zu. Aber auch der deutsche Jüngling nahm nur zögernd den Ring.
Und er sagte dabei:
»Es ist um Geros Ruhe willen!«
»Um Geros Ruhe willen, sagst du? Verabscheust du selbst die Tat nicht?« fragte der Kral.
»Nein, Gero ist krank geworden am Gemüt. Wäre ich wie er gewesen, ich hätte in Mannentreue die Wenden erschlagen und es nie bereut.«
Da schrie der Kral auf, da stürzte er zum schwarzen Gott; da griff Zarny Bog unter seinen Steinsitz und zog eine Schlange hervor, die sich in ein Schwert verwandelte, und gab das Schlangenschwert dem Kral.
Der stieß es dem Jüngling ins Herz.
»Hier steht der Kral der Wenden!« –
Das junge Herzblut rann, die blauen Augen verblühten, und eine Knabenstimme sprach:
»Ich bin Geros einziger Sohn.« –
Der gute Gott schlug seine weißen Hände vors Angesicht, der Zarny Bog aber wuchs wie eine schwarze Wolke zum Himmel, und der Kral lachte ein schmerzliches wildes Gelächter.
Die goldenen Ringe rollten die zwei Bergseiten hinab und sanken ins tiefste Wasser.
Gero, der Stadt und Kloster Gernrode gebaut hatte und mit müdem, krankem Sinn daselbst alter Blutschuld nachhing, erfuhr von dem grausamen Tod seines Sohnes.
Oft zertritt die Göttin des Leids mit schwerem Tritt das Gewürm nagender Zweifel.
So auch hier. Gero erwachte aus langem Angsttraum, der alte Mut, der alte Haß lohte auf in seiner Brust, und sieben Tage, nachdem die Todeskunde nach Gernrode gedrungen war, rauchten im Wendenlande die ersten Trümmerhaufen.
Gero verwüstete das Land, und seine Mannen verfolgten den Kral durch die Heide, durch alle Wälder und verborgensten Winkel, über Seen und Moräste.
Und der Kral hatte weder ein Roß noch einen Kahn. Wie ein Hirsch floh er durch die Wälder, wie ein Fisch schwamm er durch den Fluß. Kam er aber an ein Wendenhaus und bat um Schutz und Einlaß, dann schlossen die Leute die Tür vor ihm und jagten ihn fort, denn sie fürchteten die Rache des Markgrafen und fluchten dem Kral, um dessentwillen alles Unheil über das Land gekommen sei.
Gehetzt von den Deutschen, verraten von seinem Volk, mit zerrissenen Füßen, mit durchnäßten, zerfetzten Kleidern, die Augen fieberglänzend von Anstrengung und Hunger, so brach einmal bei herandämmernder Nacht der Kral zusammen, als dreißig deutsche Reiter hinter ihm her waren. Aber noch ehe der erste vollends herankam, brach in donnerndem Ritt ein schwarzer Reiter aus dem Gebüsch, erfaßte den Kral, hob ihn auf sein Roß und ritt durch die Luft mit ihm davon.
Und der schwarze Reiter drehte das Gesicht in den Nacken und bleckte den Deutschen eine lange behaarte Zunge heraus, und als er das Gesicht dem Kral wieder zuwandte, war es Morkusky, sein Begleiter aus Morgenland.
»Morkusky, du bist der Nachtjäger?« rief der Kral entsetzt.
»Ich bin wer ich will«, zischte der Schwarze. »Willst du keine Gemeinschaft mit mir? Willst du es mit den Wenden oder mit den Deutschen halten?«
»Ich fluche den Wenden wie den Deutschen!« schrie der Kral. Da lachte der Nachtjäger.
An der Spree türmte der Nachtjäger einen Berg, grub einen tiefen See rundum, ließ gelbe giftige Lichter um den Uferrand erbrennen und baute in einer Nacht für den Kral auf dem Berge mitten im See ein festes Schloß.
Zum jenseitigen Ufer führten nur eine lederne Brücke und ein blutroter Kahn. Die Deutschen wollten das Schloß[47] erstürmen, aber die meisten von ihnen gingen in einem Sumpf elend zugrunde.
Der Wendenkönig wurde nun ein Räuber. Er sammelte eine Horde verkommener Leute um sich, raubte, brannte und mordete und feierte mit seinen Spießgesellen, mit Hexen und schlechten Weibern auf seiner Burg teuflische Feste. Weit breitete er seine Macht aus. Die Wenden plünderte und unterdrückte er, den Deutschen aber stahl er Kinder. Die Mädchen schlachtete er und fraß sie auf, die Knaben steckte er in sein Räuberheer und machte sie zu Unholden. Zuletzt wurde er so schlimm wie Morkusky, sein Meister.
Und als dieser ganz zufrieden mit ihm war, verließ er ihn, um nach anderen Ländern zu reiten und dort Zwietracht zwischen die Völker zu säen – zwischen Wenden und Deutschen war Morkuskys Werk getan.
Der Kral wurde oft verfolgt von Wenden wie von Deutschen. Aber er schlug seinem Rosse die Hufeisen verkehrt auf, so daß er seine Verfolger täuschte. In höchster Not flüchtete er in sein Schloß, indem er über die lederne Brücke ritt, die sich hinter ihm aufrollte.
Da geschah es, daß der König einmal ein wunderholdes Mädchen raubte. Das hieß Rinetta und war zehn Jahre alt. Und es saß unter einem Fliederbaum, als er es stahl. Während nun der Kral heimritt mit seiner jungen Beute, war eine blühende Nacht. Alle Wege grün und bunt, die Sterne so träumerisch am Himmel, der sanfte Wind wie ein heiliger, heilender Strom.
Das Kindlein weinte in des Räubers Arm, aber allgemach schlief es ein, ruhte an der Brust seines Mörders und sagte im Traum zu ihm: »Du guter Vater!«
Da sah der König erschrocken auf das Kind. Er sah es mit finsterem Auge an. Aber er sah es zweimal und dreimal, und durch die Mainacht kamen in Sternenglanz und Mondschein[48] alte Freunde, Jugendfreunde seiner Seele: reine, wundersame Gedanken. Nur weil er so versonnen war, nur weil er wie in müdem Traum durch den Wald ritt, wies er sie nicht ab.
Und er sah das Kindlein noch einmal an, wie es im Glanz des Himmelslichtes in seinem Arm lag, und wandte in Sinnen versunken langsam sein Roß und trug das Kind in das Haus seiner Eltern zurück.
Die schrien, als sie den Kral erkannten. Das erwachte Kind aber, als es sich wieder bei seinen Eltern sah, lächelte und sagte:
»Oh, er hat mir nichts getan; er hat mich nur ein wenig auf seinem Pferde reiten lassen.«
Da ging der Kral rasch von dannen.
Und die gute Tat ging dem Kral nach in sein böses Leben. Wohl blieb er ein wilder Räuber, aber er stahl keine Kinder mehr. Und wenn das bittere Heimweh kam, das alle bösen Herzen von Zeit zu Zeit überkommt, wenn es nicht wich bei Raubzug und Zechgelag, dann lenkte der Kral sein Roß zu dem Hause der Rinetta, die lieblicher aufblühte von Jahr zu Jahr.
Zuletzt faßte den Kral eine so verzehrende Liebe zu dem Mädchen, daß er einsam wurde und wochenlang aus seiner Burg nicht herauskam.
Seine Spießgesellen murrten. Viele jagte der Kral davon, andere zogen auf eigene Faust in die Fremde. Am Ende war der Kral allein, und am nächsten Tage kam Rinetta zu ihm als seine Frau. Von da an tat er keinen Raubzug mehr.
Und es geschah ein großes Wunder im Wendenland, als Rinetta dem Kral einen Sohn schenkte. Da ward der Kral dem Lande ein gütiger Vater. Er verteilte von den ungeheuren Geldschätzen, die er gesammelt hatte, er baute Weiler und Dörfer, er wurde ein Feind und Vernichter aller Räuber, die noch im Lande waren.
Einmal, als der Kral auf einer Wiese ein Fest feierte, fiel[49] vor ihm eine silberne Kugel vom Himmel. Alles Volk sah das Wunder. Und es kam ein Mann aus dem Walde, der hob die Kugel auf und fing an, sie zu kneten und zu drücken, als sei sie aus Wachs, und er formte aus dem Silber eine Krone.
Die Krone übergab er kniend dem Kral. Der setzte sie aufs Haupt, und alle Wenden jauchzten ihm zu.
Der Mann, der die Krone geformt hatte, verschwand und ist nicht mehr gesehen worden.
Einzelne von den ehemaligen Spießgesellen des Kral aber hatten in der Welt Morkusky, den Nachtjäger, getroffen und hatten ihm gesagt: »Freue dich, es ist Friede zwischen den Deutschen und den Wenden, und der Kral sitzt bei seiner Frau und singt ihrem Sohne Wiegenlieder.«
Da brach der Nachtjäger zornschnaubend auf und sammelte in allen verrufenen Spelunken der Welt, in den Felsgründen wilder Gebirge und auf unwirtlichen Straßen ein großes Räuberheer. Damit fiel er im Wendenlande ein. Als er an die Spree kam, verwandelte er sich in einen Adler, der so groß war wie ein Pferd, flog zwölfmal um die Burg und tat beim dreizehnten Mal einen Zauberspruch, durch den das Schloß mit allem, was darin war, in die Erde sank und der See austrocknete, so daß nur einige kleine Wässerchen übrigblieben.
Der Kral aber, der durch einen guten Geist gewarnt worden war, war mit seiner Frau und seinem Sohne ausgezogen.
Er wanderte mit ihnen in einen tiefen Wald. Dort vergrub er die Krone in einen Hügel und sprach:
»Hier soll die Krone liegen, bis eine Jungfrau sie mit einer silbernen Schaufel ausgraben wird.«
Es kam zu der großen Schlacht der Wenden gegen die Räuber. Das Blut floß derart in Strömen, daß es eine Wassermühle in Bewegung setzte, die die Blutmühle heißt bis auf den heutigen Tag. Und die Heide färbte sich rot und bleibt rot[50] für alle Ewigkeit. Die Verwundeten selbst kämpften, auf ihre Schilde gestützt. Die Wenden siegten; alle Räuber wurden getötet. Der Kral selbst erschlug ihrer hundertundeinen.
Zuletzt aber sprengte der Nachtjäger gegen den Kral an, wie er es schon einmal vor vielen Jahren getan, als der junge König nur den Fliederstecken trug.
Auch jetzt hob der Kral den Arm gegen den wilden Jäger. Aber das Schwert, das er aufhob, triefte von Blut, und der Nachtjäger floh nicht wie damals, sondern schrie höhnisch:
»Wiegenliedsänger! Kinderfresser! Sieh, was ich habe!« Er hatte das Schlangenschwert, mit dem der Kral ehemals seine Untaten vollführt und das er nach seiner Bekehrung in einen Sumpf geworfen hatte.
Dieses Schlangenschwert stieß der Nachtjäger dem Kral ins Herz. – –
Eine weiße Wolke stieg von dem Leichnam des Kral zum Himmel. Diese weiße Wolke wandert immerzu über das Wendenland. Auch an ganz sonnenhellen Tagen ist sie tief im Blauen am Himmel zu sehen.
Die Königin Rinetta aber hatte am Tage der Wendenschlacht ein weißes Roß bestiegen und war über die Heide gejagt, um dem geliebten Gemahl beizustehen, wenn er in Not sei. Als sie an die Spree kam, traten ihr drei wendische Männer entgegen, klagten und riefen: »Unser Kral ist tot!« Da sprang das Roß der Königin in die Spree und versank mit ihr. Nichts war mehr von beiden zu sehen. Nur ein weißer Fisch schwamm im Wasser.
Und der weiße Fisch sah aus dem Wasser, und die weiße Wolke hielt still am Himmel, wenn der junge Königssohn am Uferrande spielte.
Es geschah aber, daß die Deutschen, als sie hörten, der Kral sei gefallen und sein Schloß sei versunken, in das Land kamen und es unter ihre Herrschaft brachten. Die Wenden waren zu schwach, um ihnen zu widerstehen. Die Deutschen forschten nach dem Königskinde, aber niemand hat es verraten, obwohl alle Leute im Wendenlande es kannten.
Und der Sohn des Kral wurde ein Bauer. Er hatte sechs Söhne, und dem ältesten von ihnen zeigte er den Ort, wo die silberne Krone begraben lag, und sprach:
»Bewahre das Geheimnis, und vererbe es auf den ältesten Sohn! Wenn die Zeit erfüllt ist, wird die weiße Wolke in den Himmel verschwinden, wird der weiße Fisch ins Meer schwimmen bis dorthin, wo das Meer in den Himmel fließt, und eine reine Jungfrau wird kommen und mit einer silbernen Schaufel die Krone ausgraben. Der, der dann Kral sein wird, wird die Krone tragen und unser Volk zum ersten der Erde machen. Wenn ich tot bin, bist du der Kral. Und wenn du tot bist, wird dein ältester Sohn der Kral. So soll es sein und bleiben durch alle Zeit.«
Der Nachtjäger aber wagt sich nur noch in den sieben bösen Nächten, die zwischen Weihnachten und Neujahr sind, ins Wendenland. Dann ist die weiße Wolke hinter undurchdringlichen Nebeln verborgen, der weiße Fisch wohnt in einem festen Haus von Eis, und die silberne Krone liegt tief unter dem Schnee im Walde.
Das ist die Sage vom Kral, die durch tausend und viele Jahre im Wendenvolk lebt und die an dem Abend, da Hanzos Frau am Sterben war, wieder lebendig wurde, von den Heidewiesen des Oberlandes an bis tief hinunter in die Strohhütten an der Spree, so daß sich die Fischer im Niederland wie die Hirten im Oberland es zuraunten: »Die Frau des Kral stirbt.«
Wieder einmal stand das Volk an einer Wende. Nur wenig änderte der schmale Weg, den seine Geschicke durch das Land der Geschichte nahmen, seine Richtung.
Nur die Frau des Kral starb. Ein derbes, tüchtiges Bauernweib ging dahin. Der Kral selbst lebte.
Er ging durch den Hof und durch die Zimmer so steiffeierlich wie immer. Nichts war anders an seiner hohen Gestalt. Und die schmalen Lippen des bartlosen Gesichtes waren so fest, so ohne sichtbare Linie des Grams zum Schweigen aufeinandergepreßt wie in den Tagen der Freude, wo auch kaum ein leises Lächeln um seinen Mund, ein heimliches Leuchten in seine Augen kam.
Nur die Frau des Kral starb!
Aber sie war für den Königsgedanken wichtiger als alle. Ihre Frauenseele hatte das große Geheimnis am besten betreut. Weil ihre Kindlichkeit an alle jene nationalen Wunder am festesten glaubte. Nicht, daß sie die Hoheit des Gedankens erfaßt hätte. Sie war keine Heldin, sie war eine Hausfrau. Sie hütete den Königsgedanken wie ein kostbares Erb- und Prunkstück.
Es war ein Unglück für wendisches Volkstum, daß diese Frau starb. Die alte Art fing an zu vergehen. Die jungen Burschen lachten über den Nachtjäger; und wer bei der Garde gedient hatte, erwartete vielleicht, daß ihn sein Kral grüße. Die Mädchen, kaum fürchteten sie noch. Und die alten Sagen standen nur lebendig wieder auf, wenn etwas Schreckliches kam: ein wildes Wetter, der bleiche Tod oder die bleiche, unglückliche Liebe.
Dann wurden auch für die jungen Herzen die alten Wunder wieder wach. –
In lichten Augenblicken, wenn das Fieber etwas nachließ, betete die Frau mit lauter Stimme zu ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus. Sie hatte jenes Christentum, das den Alten eigen war, die im Walde immer noch ihre heidnischen Geister huschen hörten, wenn sie gläubig zur christlichen Kirche schritten,[53] oder wie jene Heilandsleute, die in Christus den größten Helden und in seinen Aposteln Ritter und Reisige voll Kraft und Mut verehrten.
Und zwischen ihrem Beten lenkte die Kranke das Ohr lauschend nach dem Hoftor, ob die Söhne nicht kämen.
»Ich muß mit Juro reden wegen Hanka und vom Kral.«
Dann kam das Fieber wieder, und sie sprach von ihrer Brauthaube, von der Heyka des Urvaters und von Morkusky, dem bösen Zauberer.
Es war schon tief in der Nacht, als ein Wagen in den Hof fuhr. Das Hoftor war seit dem Morgen weit geöffnet geblieben.
Die Dienstboten huschten aus dem Gesindehaus; der alte Scholta erschien in der Haustür.
Juro und Samo, mit Staub bedeckt, entstiegen dem Wagen. Sie waren die ganze Nacht gewandert, den ganzen Tag gefahren.
Der Scholta ging seinen Söhnen entgegen.
»Ihr kommt noch zur rechten Zeit. Morgen früh wäre es zu spät gewesen.«
Da schmiegten sich die Söhne an den Vater, und er schlang die Arme um sie, und es war ein Bild einträchtiger Liebe zu der einen.
Leise gingen sie dann nach der Krankenstube, und die jungen Männer knieten nieder am Bett der kranken Frau, die bewußtlos war. Sie weinten, wie heimkehrende Söhne weinen, wenn sie die Mutter im Sterben finden.
Bis an die zartesten Wurzeln unseres Seins rührt der Tod, wenn er uns die nimmt, die uns das Leben gaben oder denen wir das Leben gaben. Aber wenn beim Tode einer Frau der Gatte mehr leidet als ihre Kinder, ist das Entartung?
Wer litt hier am tiefsten? Samo, der sich leidenschaftlich schluchzend an den Bettpfosten klammerte – Juro, dessen Brust zuckte und dessen Hände irr über das blasse Gesicht fuhren – oder der alte Scholta, der am Tische lehnte, seine Frau betrachtete und sich nicht rührte?
Diese drei dort, die beiden Jünglinge und die Frau, sind[54] ein Fleisch und ein Blut, sind sich innig verbunden von der ersten Sekunde ihres Seins an.
Er, Hanzo, ist nicht ihr Fleisch und Blut, er hat sie vor kaum dreißig Jahren nicht einmal gekannt.
Und wenn sie jetzt geht? Wenn ihr Leben ausgelöscht wird wie eine Kerze? Wird nicht dennoch auf dem Wege jener beiden bald ein neues Licht leuchten, und wird nicht der alternde Mann seine dunkle Straße allein ziehen?
Feine, stille Grenzen sind im Menschenland. Und die volle Lebenskameradschaft hat doch ein weiteres Gelände, als die Erbgebiete des Blutes sind. –
Die Söhne erhoben sich, setzten sich auf zwei Stühle. Sie waren müde. Müde von der langen Reise und von Angst und Groll, die sie gequält hatten.
Hanka trat ins Zimmer. Die Jünglinge reichten ihr die Hand. Sie kannten sie kaum. Vor vielen Jahren hatten sie das Mädchen einmal gesehen, als sie noch heranwachsende Burschen waren und die Hanka noch ein Kind war. Aber sie wußten, daß sie eine entfernte Verwandte war, drüben aus dem Sächsischen. Eine aus der Familie, die nach der Tradition als die königliche galt. Auch die Mutter war von dort her. Wie kam das Mädchen hierher?
Der Vater gab flüsternd eine kurze Aufklärung. Nun erst erfuhren die Söhne, auf welchem Wege die Mutter verunglückt war.
Beklommen standen sie dem Mädchen gegenüber.
Die Kranke begann wieder zu sprechen.
»Eine reine Jungfer muß es sein – die mit der silbernen Schaufel nach der Krone gräbt …«
»Nicht die, die unter dem Flieder liegt …«
»Ja, der Lobo ist ein Süffling – ja …«
»Aber Juro – Juro und Hanka …«
»Ich will mit ihm reden – wegen Hanka und vom Kral.«
Da erwachte sie.
»Juro! – Samo! – Seid ihr da? Seid ihr gekommen? – Seid ihr gesund? – Geht es euch gut? Habt ihr schon zu essen bekommen?«
Sie herzte die Söhne, sie hörte ihre Liebesworte. Sie herzte sie wieder. Sie sah Juro forschend an.
»Ich wollte – wollte – etwas mit dir reden – ich weiß es nicht mehr – was wollte ich doch mit dir reden …?«
Dann plötzlich schrie sie:
»Macht das Fenster auf!«
Und sie versank in den Todeskampf.
Der Scholta wurde blaß bis auf die Lippen. Aber er ging ohne Schwanken zum Fenster und öffnete es.
Noch als er sich an dem einen Flügel festhielt, starb die Frau.
Und der Mann glaubte zu fühlen, wie die erlöste Seele vom Bette herschwebte, ihm noch einmal die Stirn berührte und sich dann durch das geöffnete Fenster aufschwang zum Firmament, das mit Millionen winkender ferner Heimatlichter herniedergrüßte.
Hanka und die Söhne knieten weinend am Bette.
Der alte Hanzo trat heran und drückte der Toten die Augen zu. Er nahm ihre rechte Hand zwischen seine beiden Hände zum Abschied und zum Gebet. Dann wandte er sich ab, nahm ein großes Tuch, verhängte den Spiegel, der an der Wand hing, und hielt die Uhr an. Das alles tat er mit ruhiger Gewissenhaftigkeit.
Zuletzt ging er in den Hof und rief das Gesinde zusammen.
»Die Frau ist gestorben!« sagte er schlicht und stand hochaufgerichtet im mondbeschienenen Hofe. Nach den wenigen Worten ging er nach dem Hause zurück. Der alte Knecht Kito aber trennte sich von dem jammernden Weibsvolk, ging nach den Viehställen, trieb die schlummernden Tiere auf und rief mit seiner alten Stimme durch den Stall:
»Die Frau ist gestorben!«
Da brüllten ein paar Kühe auf, und die Pferde klirrten mit den Halfterketten.
Kito ging weiter bis in den Großgarten, wo die Bienenstöcke standen, klopfte dreimal an jedes Bienenhaus und sagte dann laut und deutlich:
»Die Frau ist gestorben!«
Da kam es wie ein leise summendes Geflüster aus den Bienenstöcken.
Kito ging an die Hundehütte.
»Tyra, die Frau ist gestorben!«
Das Tier rührte sich nicht. Es war tot.
Zitternd ging der alte Knecht in seine kleine Stube, wo in einem kleinen Bauer ein schlafender Kanarienvogel saß. Er weckte das Tierchen, das ihn müde anblinzelte, und sagte ihm:
»Die Frau ist gestorben!«
Da sang der Vogel eine wehmütige kurze Melodie und schlief wieder ein.
Am Tage vor dem Begräbnis ritt Heinrich von Withold, Elisabeths Bruder, in den Hof des Scholta. Er sprang vom Pferde und reichte die Zügel einem Mädchen hin, das eben in die Haustür trat. Es war Hanka.
»Bind mal den Gaul an einer passenden Stelle fest, schönes Kind!« sagte Heinrich leutselig.
Das Mädchen errötete, und ihre hohe Gestalt straffte sich.
»Ich werde einen Knecht oder eine Magd rufen«, sagte sie.
Da sah Heinrich von Withold ein, daß er wohl eine Unhöflichkeit begangen habe. Er stammelte eine Entschuldigung und band sein Roß selbst fest.
»Ich bitte um Verzeihung, verehrtes Fräulein«, sagte er dann; »ich bin ja hierzulande nicht fremd, aber ich kann mir die Abzeichen der Wendentracht partout nicht merken. Wollen Sie mir sagen, meine Gnädigste, ob ich den Herrn Scholta sprechen kann?«
»Da kommt er schon.«
Der wendische Großbauer und der deutsche junge Edelmann[57] traten sich gegenüber. Heinrich geriet in Verlegenheit, aber dann nahm er all seinen Schliff zusammen und sagte:
»Herr Scholta, ich erlaube mir, Ihnen namens meiner Familie einen Kondolenzbesuch abzustatten und Ihnen anläßlich des Hinscheidens Ihrer Frau Gemahlin unser herzlichstes Beileid auszudrücken. Mein alter Herr würde dieser traurigen Pflicht selbst nachgekommen sein, aber er ist noch verreist. Wollen also mit dieser Stellvertretung gütigst vorliebnehmen.«
Auf diese geschniegelte Rede hin wußte der alte Wende nichts zu sagen. Er nahm verlegen seine Kappe ab und sagte:
»Ja – ja, die Frau ist gestorben!«
Darauf wußte wieder Heinrich von Withold nichts zu sagen. Und so entstand eine peinliche Pause. Zum Glück kam Juro aus dem Hause. Heinrich eilte auf ihn zu, umarmte ihn, küßte ihn und drückte ihm dann warm die Hände.
»Alter Junge, das hat mir aber scheußlich leid getan!« sagte er bewegt.
Nach diesem studentischen Freundschaftsausbruch besann er sich aber gleich wieder auf seinen höflichen Ton und erklärte Juro:
»Ich habe mir erlaubt, dem Scholta, deinem alten Herrn, anläßlich des Hinscheidens deiner Frau Mutter die Kondolation unserer Familie zu überbringen.«
Es entstand wieder eine Pause, und Heinrich erklärte also, er habe bloß seine Mission ausrichten wollen, werde jetzt nicht weiter stören und gestatte sich also, sich zu empfehlen. Darauf begann endlich Hanzo, der Scholta, zu reden. Er sagte wohl an die zehnmal: »Nein, nein!« Der gnädige junge Herr müsse ins Haus treten und dürfe eine kurze Gastfreundschaft nicht verschmähen. Der Scholta selbst band Heinrichs Pferd los, um es nach einem Stall zu führen. Der höfliche junge Mann suchte diesen Dienst auf alle Weise zu hindern, was ihm aber mißlang, und ging schließlich selbst mit nach dem Stall, wo er über die dort befindlichen Pferde enthusiastische Urteile abgab, die in der Mehrzahl Unsinn waren und von gar keiner Sachkenntnis zeugten und die der Scholta schweigend anhörte.
»Und der Blauschimmel, Herr Scholta, der Blauschimmel! Ein Götterroß!«
Der alte Hanzo rückte verlegen an seiner Kappe.
»Ich habe das Pferd für eine Forderung eingetauscht«, sagte er. »Es wird wenig benutzt. Ich brauche es nur fürs Osterreiten. Und sonst ist es für die Jungen, wenn die mal zu den Ferien sind.«
»Ein Götterroß, Herr Scholta! Ich kann mir's denken; es ist vom alten Hinzberg, von dem deutschen Rittermäßigen, der überall Schulden hatte, natürlich auch bei Ihnen.«
Hanzo antwortete nicht. Sie verließen den Stall.
»Ich möchte riesig gern noch etwas mehr von Ihrer Musterwirtschaft sehen, Herr Scholta«, sagte Heinrich darauf. »Wissen Sie, wenn man nun mal Landwirtschaft studiert, interessiert einen das mächtig. Aber die Veranlassung meines Besuches ist zu trauriger Art.«
Hanzo machte eine Handbewegung und führte dann Heinrich durch sämtliche Wirtschaftsräume, zeigte ihm alle Wirtschaftsgeräte, führte ihn bis hinter das Gehöft, von wo man einen großen Teil der Felder übersah, und erklärte alles mit einer ihm sonst ganz ungewöhnlichen Gesprächigkeit. Hanzo wäre kein wendischer Bauer gewesen, wenn er das nicht getan hätte.
Und als er seinen Gast endlich in ein kleines Stübchen geführt hatte, wo seine Söhne und Hanka mit einem Frühstück warteten, ging er selbst nach »der guten Stube«, wo seine Frau aufgebahrt war. Und es war, als ob die tote Bäuerin lächelte.
»Hast du ihm auch alles gezeigt? Nicht wahr, es hat ihm gefallen? Es muß ihm ja gefallen!«
Juro begleitete seinen Freund nach Hause. Sie legten die gute Wegstunde zu Fuß zurück. Das Reitpferd führte Heinrich am Zügel. Sie gingen lange schon über die Felder, da fragte Heinrich:
»Ist das hier noch euer Besitz, Georg?«[5]
»Ich glaube wohl; aber es ist erst dazugekauft worden von meinem Vater und Großvater. Das waren tüchtige Landwirte. Und deshalb muß ich ja durchaus landwirtschaftliche Studien machen, obwohl ich doch Mediziner bin.«
»Ja, ich weiß es. Sie wollen einen gelehrten Herrn auf großem Besitz aus dir machen. So 'ne Art kleinen ›König der Wenden‹.«
Juro errötete und schwieg.
»Und was wird jetzt werden?«
»Ich möchte – wenn das möglich wäre – Jura studieren und Theologie und Medizin und möchte alles tun für die braven Leute, die hier wohnen, und möchte sie so recht heimisch machen und vorwärtsbringen im deutschen Vaterland.«
Heinrich lachte.
»Ein guter Prediger würdest du sein. Wenn du willst, sprichst du mit Schwung. Und ernst bist du. Eigentlich doch ein Grübler. Es ist ein reines Wunder, daß du mit einem so leichten Huhn, wie ich bin, dich befreundet hast.«
Er wartete keine Antwort ab.
»Übrigens, dein Bruder Samo – du, der hat mir heut wieder Augen gemacht! Höflich war er ja – na ja, weil ich der Gast war, aber Augen – – du, wenn der mich fressen könnte, mich und alle Deutschen!«
»Es ist seine unglückliche Art«, sagte Juro.
»Und dem willst du dieses ganze Königreich abtreten?«
»Ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen. Ich passe sicher besser in die Stadt. Und dann – dann ist es wegen Elisabeth.«
»Stimmt! Die paßt allerdings besser in die Stadt als in eure Scholtisei. Obwohl sich das Mädel für alles interessiert. Sie spricht sogar ziemlich gut wendisch, was z. B. mein Vater und ich nie kapieren. Übrigens, das Fräulein aus eurer Verwandtschaft, die Hanka, ist ein süperbes Mädel. Ein Urbild von Gesundheit. Leider habe ich es mit ihr gleich von vornherein verdorben. Erstens halte ich Esel sie für eine hübsche Magd und sage ihr, sie solle mein Pferd anbinden, zweitens faselte ich von[60] Irrlichtern und Nebelgebilden, als sie so gläubig von den brennenden Gespenstern und dieser weißen Todesgöttin sprach. Sie glaubt daran.«
»Ja, sie glaubt daran, wie meine Mutter daran geglaubt hat.«
»Und dein Vater?«
»Er hat noch keinen in sein Herz sehen lassen. Wie Samo! Vor dessen Verstand und Bildung hielt natürlich der ganze alte Aberglaube nicht stand, aber im innersten Herzen hängt er daran wie der einfachste Wende. Aus Nationalität – jawohl! So etwa, wie die Schweizer am Tell hängen oder alle Völker an mancherlei Geschehnissen, Heldentugenden, Herrschertaten, die nie gewesen sind.«
»Alle diese Selbsttäuschungen machen doch aber sehr glücklich.«
Juro wehrte heftig ab.
»Nein, sie halten auf, sie hemmen! Sie sind toter Ballast, der die Schiffe der Völker unnütz beschwert. Es sind vorgespiegelte Reichtümer, erträumte Erbschaften, die den Nationen einen falschen Begriff von ihrer Größe geben und in denen der Chauvinismus, der größte Feind aller Völkerverbrüderung und des menschlichen Fortschritts, am tiefsten wurzelt.«
»Sprechen wir von etwas anderem«, sagte Heinrich, der des schweren Themas schon müde war.
Im Park der Witholdschen Besitzung traf Juro mit Elisabeth zusammen und blieb mit ihr allein. Heinrich hatte sein Pferd davongeführt.
»Du bist sehr blaß, Elisabeth? Du trauerst um meine Mutter.«
Sie saßen auf einer Holzbank unter einem alten Baume.
»Erzähle mir von deiner Mutter«, bat das Mädchen. »Ich habe sie nur zweimal in meinem Leben gesehen. Sie hatte sehr gute Augen.«
Er erzählte. Er sprach wie ein guter Sohn. Und das deutsche[61] Mädchen sah mit feuchten Augen der Seele der wendischen Frau nach in das blaue Dämmern, das über ihnen war.
Sie küßten sich nicht. Aber sie hielt seine Hand. Und der Schmerz, der in ihm war, wurde milder und stiller in der Gegenwart dieses lieben Mädchens.
Er sagte es ihr. Da antwortete sie:
»Wenn es anders wäre, würde ich wohl nicht für dich taugen.«
»Du bist viel klüger, viel erfahrener, als sonst Mädchen in deinem Alter sind«, meinte er.
»Das ist, weil ich keine Mutter gehabt habe! Weil sie so früh starb! Da muß ein Mädchen vieles, was ihm sonst die Mutter abnähme, selbst tragen und selbst erleben.«
Er schwieg eine Weile und sagte dann:
»Elisabeth, ich werde dich in ein Geheimnis einweihen, das du wissen mußt. Du könntest mich sonst nicht ganz verstehen und auch nicht die schwere Aufgabe ermessen, die dir werden wird, wenn du meine Frau sein wirst.«
Und Juro erzählte Elisabeth die Sage vom Wendenkönig. Er entrollte ihr das alte, ehrwürdige Gemälde, das, im Allerheiligsten des Tempels wendischen Volkstums gehütet und gehegt, sonst kein »Njemz« zu ersehen bekam. Das Mädchen hörte zu mit verwunderter Seele, und allmählich kam eine Angst und plötzlich kam ein Schreck über sie …
Und sie erkannte, daß Juro der zukünftige Kral der Wenden war. –
Da tat sie das, was die Frauen großen Erkenntnissen gegenüber tun – sie weinte.
Er sah es nicht, er beachtete das Leid der Geliebten nicht. Die große Idee des Königtums war über ihn gekommen, ein Sonnenmeer von Erleuchtung war plötzlich über ihn geflutet.
Als er der Erwählten die heimische Sage erschloß, hatte er sie selbst das erstemal ganz erfaßt, wie wir Menschen ja alle erst dann recht und wahr und tief lernen, wenn wir uns ehrlich bemühen, zu lehren, wie wir immer dann den rechten Weg am ehesten finden, wenn wir ihn getreu einem andern zeigen wollen.
Die Schönheit des Königsgedankens brannte nun im Herzen Juros, und er sprang auf und ging weit den Waldweg entlang, kam ganz langsam zurück. Die tote Mutter, die Braut, sein ganzes bisheriges Leben mit allem Großen und Kleinlichen waren in diesen Augenblicken vergessen, da Juro den Waldweg auf und ab wandelte.
Endlich blieb er vor Elisabeth stehen.
»Ich will dir einiges sagen,« sprach er mit einer Stimme, die hart klang; »ich war nahe daran, ein Schwächling und Feigling zu sein. Drüben bei uns im Wendenland, da ist vieles nicht so, wie es ein feiner, zarter Träumer sich wünscht. Da ist leibliche und körperliche Not. Da ist Dummheit und Aberglaube und neben der Knechtseligkeit die heimliche Großmannssucht. Da sind alte Weiber die Ärzte, unter deren Plunderformeln die Kranken elend verscheiden. Betrunkene Bauern machen die Politik. Der alte Webstuhl ist unsere glänzendste Maschine, und die Leute, die mit langen Ruderstangen im Schlamm der seichten Gewässer wühlen, daß die Blasen aufsteigen, die halten sich für Schiffer. Mit ihrer Sprache finden sich die Leute knapp zum nächsten Wochenmarkt, wo sie der dämlichste deutsche Händler übers Ohr haut. Bücher haben sie nicht, es seien denn jämmerliche Übersetzungen. Und die sind noch in fünffacher Orthographie. Da gibt es eine oberwendische, eine niederwendische, eine tschechische, eine evangelische, eine katholische Rechtschreibung. Falsch sind sie alle. Es gab eine Zeit, wo es als ein ehrendes Zeugnis galt, wenn einem jungen Handwerker bescheinigt werden konnte: er ist kein Wende. Es gab eine Zeit, wo jeder Wende geschlagen werden durfte. Es ist heute noch nicht viel besser. Immer in die Heide gedrückt bleibt der Wende, immer auf der mageren Scholle sitzt er. Und wenn er einen Schweinestall bewohnt, nennt er ihn schon stolz sein Haus. Die Armut ist der scheußlichste Bundesgenosse dieses Volkes. Unsere jungen Mütter nähren die Kinder der Reichen in Berlin oder Breslau, und derweil stirbt das eigene Kind zu Haus aus Hunger oder unter dem Beistand abergläubischer Quacksalberinnen. Wäre ein guter Arzt sofort zur Stelle gewesen, meine[63] Mutter lebte noch! So ist sie gemordet worden durch die gutmütige Unvernunft, die bei uns Volksreligion ist. Nicht wahr, und einem solchen Volk den Rücken zu kehren, das ist leicht? Da putzt man sich die Kleider ab, räuspert sich, bürstet sich den Bart und geht achselzuckend davon. Und ist ein feiner Mann!«
Juro lachte höhnisch über sich selbst.
»Oh, siehst du, so ein Held war ich! Ich ließ den Widerwillen über mich kommen. Und weißt du, was Widerwille ist? Widerwille ist Feigheit der Schwäche gegenüber. Also die elendeste Feigheit. Das weiß ich jetzt. Aber ich war ein Feigling. Ich wollte Reißaus nehmen; ich wollte mir ein nettes deutsches Mädel nehmen und in ein recht elegantes Quartier in der Hauptstadt ziehen und als Arzt unter tausend anderen Ärzten von reichen Leuten Geld verdienen. Mich mein Leben lang nicht mehr um die Wenden kümmern! Das wollte ich! Das war eine Schurkerei! Und die ist mir erst aufgedämmert, als meine Mutter starb, und ist mir jetzt völlig klar geworden, da ich dir diese Kralssage erzählte.«
Er hielt inne und setzte sich auf die Bank. Aber er sprang bald wieder auf.
»An meinen Bruder wollte ich das väterliche Gut preisgeben. An Samo! An ihn, der wie ein polnischer Schlachziz auf dem Gute hausen würde, ein gnädiger Herr, der sich von ungewaschenen Mäulern die Hand lecken ließe, der das Volk sorgsam in seinem Aberglauben lassen und sich das obendrein als eine nationale Tat anrechnen würde. Oh, das ist der verfluchte Standpunkt, der die slawischen Völker so tief gehalten hat, daß alle die, die ihm die Fenster der niederen Hütten vernagelten – die Intelligenten im Lande: Adel, Geistliche, Advokaten, Juden –, daß die sich als die Führer des Volkes mästeten und sich – das will ich ja zugeben – auch dazu berufen fühlten. Keiner kam, der das Volk ans Licht führte, keiner, der den Leuten die frohe Kunde brachte: Ihr, ihr das Volk, seid die Hauptsache, ihr sollt reich, stark, gesund, klug sein, ihr sollt euch wohlfühlen, und die Regierenden sollen sich abrackern, wie sie das zustande bringen! Es ziemt sich nicht, daß der eine Mensch[64] wohne wie ein Gott und der andere wie ein Tier, und überall, wo das der Fall ist, herrscht ein verbrecherischer Götzendienst, auch wenn er tausendmal sanktioniert ist. Und wehe am Ende, wehe vor Gott und allen guten Menschen den gemästeten Götzen! Arme Slawen!«
Elisabeth weinte nicht mehr, sie hörte Juro zu, wie er so erregt sprach, sah mit Bewunderung, wie plötzlich eine Mission über ihn gekommen schien, wie wieder einmal aus dem Brunnen der Tradition ein Wundertrank geschöpft worden war, der den Blinden sehend, den Träumer zum Helden machte.
Aber eine tiefe Trauer war in dem Mädchen.
»Alle deine Vorwürfe richten sich gegen die Deutschen?« fragte sie langsam.
Da besann er sich auf sie, wachte auf wie aus einem Traum.
»Mein deutsches Mädel!« sagte er, »wie kannst du so sprechen? Weißt du nicht, daß ich die Deutschen lieb habe? Nicht deinethalben! Ich hatte sie von Jugend auf gern. Ich liebte ihre Stärke, ihre Gründlichkeit und verlässige Pflichttreue, ihren starken, wunderbaren Fleiß. Ich vergöttere ihre Kunst und finde auch einiges Hübsche in ihrer Geschichte. Ich wohne in Preußen, ich habe alles, was ich körperlich und geistig besitze, von Preußen. Also bin ich ein Preuße! Nicht, daß ich die Fehler dieses Volkes nicht sähe, daß mich sein plumpes Spartanertum nicht oft ärgerte; aber es ist besser, menschlich besser bei ihnen als bei den Slawen, aus deren Blut ich bin. Besser als bei den Russen, die in jahrtausendelanger Totenstarre liegen, besser als bei den Polen, die mit all ihren herrlichen Gaben zu lange vor den selbstgeschaffenen Götzenbildern lagen; besser als bei den Slowaken, Slowenen, Kroaten und Serben, die trüb und müd in ihrer Armut dahinleben und nur manchmal kraftlos mit der Bettlerhand drohen; besser endlich als bei den Tschechen, die es trotz ihres reichen Landes, trotz der günstigsten Entwicklungsmöglichkeiten auf keinem Gebiet über die Mittelmäßigkeit hinausgebracht haben. An alle diese soll mein Wendenvolk keinen Anschluß suchen und sucht auch keinen trotz der Anstrengungen, die von Moskau, Warschau und Prag her gemacht werden,[65] trotz der Bemühungen einiger faselnder Panslawisten unter uns.«
Juro hatte hastig, erregt, die Worte oft überstürzend, gesprochen. Er war einer, der viel dachte, aber auch viel redete, der gern Ideen, Absichten, Probleme entwickelte: er war bereits ein Deutscher. Das Mädchen war klug und ernst. Es war wohl fähig, solchen Worten zu folgen, aber ihr Herz war jetzt weit von den Schicksalen slawischer Stämme, es war nur bei dem einen, der sprach, und bei ihrem eigenen Schicksal.
»Juro, du wirst der Kral der Wenden werden«, sprach sie.
Es klang wie ein Schluchzen, das aus gequälter Seele kam.
Juro war zu versonnen, als daß er den Jammer der Geliebten bemerkt hätte.
»Ja, der Kral!« rief er. »Es ist nur eine imaginäre Würde; ich glaube nicht an sie; aber die Wenden sprechen sie mir in aller Heimlichkeit zu. Tausende hängen mit stumpfem Gewohnheitssinn daran, einige mit kühnen Hoffnungen; alle wünschen die Erhaltung dieser uralten Tradition. Alle, bis auf mich! Ich halte solche Traditionen viel eher für ein Hemmnis als für eine gesunde Wurzel. Und deshalb wollte ich meiner Wege gehen. Wollte Samo neidlos und kampflos den Platz überlassen. Bis die Mutter starb, bis ich dir, Elisabeth, die alte Volkssage erzählte und es mich plötzlich überkam, ich müsse wirklich der Kral werden, der Einfluß hat auf das Volk und der seine Aufgabe darin erblickt, dem Volk aus Armut und Aberglauben aufzuhelfen, das Wendenvolk vollends zu Deutschen zu machen.«
Das Mädchen faßte ihn am Arm.
»Erschrick nicht, Elisabeth! Es ist kein Verrat! Es ist die einzig vernünftige Tat, die geschehen kann. Was ist klüger: eine alte Kaluppe, die jeden Augenblick vom Wind über den Haufen geworfen werden kann, immer neu zu stützen, die klaffenden Löcher mit Lehm zu verschmieren, die zerschlagenen Fensterscheiben mit Papierfetzen zu verkleben – oder die ganze Bude kurzweg niederzureißen und ein festes, gesundes Haus an seine Stelle zu setzen? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein, nicht wahr? Die Wenden üben alle Staatsbürgerpflichten auf das[66] gewissenhafteste, haben aber nicht vollen Genuß staatsbürgerlicher Vorteile. Das ist, weil ihnen ihre Tradition anhängt. Ihre schmucke Volkstracht ist in den Augen der Welt doch weiter nichts als das Proletenkleid zurückgebliebener Leute; ihre isolierte Sprache macht sie unfähig zu vielem, macht sie befangen, furchtsam; der alte Aberglaube hält ihre Stirnen umwölkt. Fort mit all diesem Plunder! Heraus aus dem Sandwald ins grüne Land! Heran an den großen deutschen Tisch! Gleiche Rechte! Gleiches Gepräge!«
Mit den flammenden Prophetenaugen begeisterter Jugend stand er vor ihr. Und sie war auch jung, und ihr Herz erglühte im Glauben an ihn und an seine Sache.
»Du bist edel, Juro! Du bist klug! Du hast recht!«
Da faßte er sie fest an den Händen.
»Elisabeth, wirst du es mit mir wagen, was ich vorhabe? Wirst du die Frau des letzten Wendenkrals sein, der sein Volk zur wahren Freiheit führen will?«
»Ja, Juro! Als ich erkannte, wer du eigentlich bist, erschrak ich und glaubte, ich könne nicht deine Frau werden. Ich glaubte, wenn du der König der Wenden bist, müßtest du auch eine Wendin heiraten. Aber so, wie du es vorhast, ist es doch anders. Wenn du die Wenden zu Deutschen machen willst, sollst du selbst eine deutsche Frau haben! Und die will ich von Herzen gern sein!«
Sie küßten sich auch jetzt nicht.
Aber sie ging weit mit ihm über die Felder, als er heimkehrte, und hielt ihn fest an der Hand.
Als Juro allein war, brannten ihm die Wangen. Und in seiner Lebhaftigkeit sprach er mit sich selbst von seinen Aufgaben, seinen Zielen, die ihm klar vor der Seele standen. Er blieb oft stehen, und seine Arme fuhren durch die Luft, als er so mit sich selbst sprach.
»Pomogaj Bog wam!«
Er erschrak und sah eine alte Frau vor sich stehen.
»Bog žekujscho«, antwortete er.
»Gott helfe Euch!« hatte sie gegrüßt. »Gott vergelte es!« hatte er wendisch geantwortet. Er besann sich kurz und redete die Alte in deutscher Sprache an.
»Nun, Mütterchen, habt Ihr Pilze gesucht? Es gibt heuer recht viele, weil das Wetter naß ist.«
Sie machte eine Gebärde mit der Hand, die bedeuten sollte, daß sie nicht Deutsch verstehe. Dann kicherte sie und sagte wendisch:
»Der Sohn des Kral spricht deutsch mit mir!«
Es erschien ihr wie ein Scherz, den Juro mit ihr trieb. Er sah, daß sie eine alte Frau sei und also wohl wirklich kein deutsches Wort verstehe. Sie verfiel augenblicklich in einen weinerlichen Ton, klagte, daß nun die gute Frau gestorben sei, bei der sie hätte sich alle Tage ein Töpflein Milch holen können. Juro sagte ihr, er wolle anordnen, daß sie die Milch auch fernerhin bekäme.
Da haschte sie nach seiner Hand, um sie zu küssen. Er aber entzog ihr die Hand heftig und sagte in wendischer Sprache:
»Mütterchen, habt Ihr ein Kreuz zu Haus, woran dem Herrn Jesus die Hände genagelt sind?«
Sie nickte.
»Die Hände dürft Ihr küssen, wenn Ihr an die wirklichen Hände des Herrn Jesus denkt. Aber nicht meine. Ich bin kein Gott!«
»Auch nicht dem Herrn Pastor? Oder dem gnädigen Herrn?«
»Auch diesen nicht! Ihr sollt es durchaus nicht tun!«
»Aber Eurem Herrn Bruder Samo habe ich vor einer Stunde beide Hände geküßt, weil er mir zwei Dreier geschenkt hat.«
»Ihr sollt es nie wieder tun, weder ihm noch einem andern Menschen.«
Er schenkte ihr eine Silbermünze. Da schnappte sie doch wieder nach seiner Hand.
»Ihr sollt es nicht!« rief er erzürnt. »Hunde lecken die Hände, nicht Menschen!«
Da erschrak sie, steckte die Silbermünze ein und sagte wieder: »Pomogaj Bog wam!« Dann huschte sie über eine schmale Wasserrinne in den Wald. Aber Juro hörte noch, daß sie bei sich brummte:
»Er tut, als ob ich ein giftiges Maul hätte!« – –
Nach drei Tagen ging in den Dörfern das Gerücht, Juro habe die alte Domasch einen Hund genannt und halte sich arme Leute stolz vom Leibe.
Langsam ging Juro nach seiner Begegnung mit der alten Frau seines Weges. Es war, als ob er sich fürchte, heimzukommen zur Mutter. Was war sie für eine eifrige, gläubige Wendin gewesen! – Aber seine Seele straffte sich wieder und schüttelte den Kleinmut von sich.
Da sah er auf einem schmalen Raine, der zwischen den Feldern seines Vaters hinlief, Hanka, das fremde Mädchen. Die schritt rüstig aus, hatte die Schürze hochgebunden, hielt in der linken Hand einen Topf und machte mit der rechten die Bewegung des Säens. Juro wußte, was sie tat. In dem Topf war das Wasser gewesen, mit dem sie die tote Mutter gewaschen hatten. Nun hatten sie dem Topf den Boden ausgeschlagen, und das Mädchen säte durch den Topf Hirsesamen auf die Felder. Da würde im nächsten Jahr kein Vogel ein Körnlein von diesen Feldern picken. Ein Widerwille erfaßte den jungen Mann. Er wartete, bis Hanka näherkam, und rief sie an. Sie erschrak, als sie Juro sah, kam aber zu ihm.
»Was tust du da?« fragte er in deutscher Sprache.
»Ich säe den Totensamen! Es ist besser, wenn es ein Mädchen tut, als wenn es ein Mann tut!«
Sie hatte wendisch geantwortet.
»Sprichst du nicht Deutsch, Hanka?«
Sie sah ihn verwundert an.
»Warum sollte ich das wohl tun? Ich bin doch eine Wendin!«
»Ja, Hanka! Wir werden noch später darüber sprechen. Ich hoffe, wir werden uns verständigen, denn du bist ja ein kluges Mädchen. Sag mir, warum säst du den Totensamen? Glaubst du daran?«
»Glaubst du denn nicht daran?« gab sie verwundert zurück.
»Ich bitte dich, gib mir den Topf!«
Sie reichte ihm den Topf, und Juro warf ihn auf einen nahen Steinhaufen, daß er zerbrach.
»Was tust du? Ich bin noch lange nicht fertig mit allen Feldern!« rief sie erschrocken.
»Laß die Felder und laß die Vögel! Siehst du den Schwarm Sperlinge? Sie werden die Hirse fressen, die du gesät hast.«
»Ja, sie kosten davon und kommen dann nie wieder!«
»Sie kommen wieder, Hanka, davon wirst du dich selbst bald überzeugen können. Und warum sollten wir sie vertreiben? Der Mensch soll nicht geizig sein gegen die kleinen Kostgänger des Herrgotts!«
»Ich bin nicht geizig!« sagte sie trotzig, »es sind nicht meine Felder!«
»Ich will dich auch nicht kränken, Hanka!« sagte er milder. »Aber – nicht wahr, der Nutzen könnte doch nur klein sein, und wir wollen keinen Nutzen ziehen aus dem Tode eines Menschen!«
»Der Nutzen ist nicht für mich; er ist für euch!«
Sie bückte sich über den Steinhaufen und nahm einen größeren Scherben auf.
»Was willst du damit, Hanka?«
»Aus dem Scherben weitersäen!«
»Das wirst du nicht tun! Ich will es nicht! Es ist schmählich! Ich verbiete es dir!«
Er stampfte mit dem Fuß auf. Sie sah ihn mit ihren stahlblauen Augen hart an.
»Du bist grob!« sagte sie und wandte sich ab.
»Hanka!« rief er zornig, »du wirst das Säen sein lassen! Begreifst du denn nicht, was du damit ausdrückst? Daß das[70] Wasser, mit dem meine Mutter gewaschen wurde, kleinen unschuldigen Tieren – einen – einen Ekel einflößen soll? Ich verbiete es dir!«
»Du hast mir nichts zu verbieten! Jemand anders hat mir befohlen, den Samen zu säen!«
»Wer? – Wer ist so töricht? – Ich will ihn zur Rechenschaft ziehen …«
Bei dieser Frage erbleichte sie und rannte, so schnell sie konnte, den Feldrain entlang.
Zornig schritt Juro weiter, dem väterlichen Gehöft zu. Er begegnete seinem Bruder Samo. Der wartete ab, bis ihn der Bruder grüßte, und gab eine mürrische Antwort.
»Samo, siehst du das Mädchen dort drüben – die Hanka? Sie sät aus dem Topf, aus dem die Mutter gewaschen worden ist, ›Totensamen‹ auf die Felder! Wer hat ihr diesen greulichen Unsinn befohlen? Ich will ihn zur Rechenschaft ziehen! Wer hat es angeordnet?«
»Die Mutter selbst!« antwortete Samo kurz und hart.
Juro wich einen Schritt zurück. Samo betrachtete ihn mit einem schadenfrohen Zucken im Blick.
»Juro, du würdest besser tun, dich nicht in diese Dinge zu mischen, die Leute bei ihren alten Gebräuchen zu lassen. Sie ehren unsere Toten weit besser als zum Beispiel dein deutscher Freund heute mit seinem albernen studentischen Geschwätz!«
Er ließ den Bruder stehen. Wie ein Geschlagener ging Juro den Weg entlang. Ein Schwarm Schwalben flog hoch in der Luft immer im Kreis herum. Die Vögel dachten ans Abschiednehmen.
Im Großgarten lehnte der Vater regungslos an einem Apfelbaum und starrte in die sinkende Abendsonne.
Das Glöcklein vom Kirchturm begann zu läuten.
Dort in der Stube mit dem verhangenen Fenster schlief die Mutter den letzten Abend auf dieser Erde.
»Pusty wjecor«, sagen die Wenden.
»Der öde Abend!«
Der letzte Trauergast war an den schwarzen, weißgeränderten Sarg getreten, in dem die tote Frau in ihrer Brauttracht lag, hatte sein stilles Vaterunser gebetet, den Anverwandten sein Beileid ausgesprochen und war dann nach der großen Gesindestube gegangen, wo Kaffee und Kuchen, Käse und Branntwein zu haben waren.
Endlich war es Zeit zum Aufbruch. Vater und Söhne nahmen bewegten Abschied, und die Tote wurde im offenen Sarg aus der Stube getragen, mit den Füßen voran, damit sie nicht »zurückschauen könne«. Der Spiegel wurde enthüllt, das Fenster geöffnet, die Stühle, auf denen der Sarg gestanden hatte, wurden umgestürzt.
An der Haustür wurde der offene Sarg hingestellt. Die tote Bäuerin, deren Augen halboffen waren, blinzelte noch einmal in ihren Hof hinein. Es war alles sauber und ordentlich. Die zwei Mägde, die das Vieh im Augenblick des Abschieds füttern mußten, rannten so eilig mit ihrem Heu, als fürchteten sie immer noch einen Tadel der Frau. Ein paar junge Mädchen rückten an ihrer Plachta[6], ob sie auch ordentlich säße; einige alte Leute nickten der Toten zu: »Du kannst stolz sein, daß du ein so großes Grabgeleite hast!«
Unter der weißgekleideten Trauergesellschaft standen zwei in schwarzen Gewändern: Elisabeth und ihr Bruder Heinrich. Samo, der einmal die Augen aufhob und die beiden Deutschen sah, dachte bei sich: Sie sind wie schwarze Flecken auf weißen Kleidern.
Die Herbstsonne schien auf den bevölkerten und doch so stillen Hof. Da trat der alte Scholta an den Sarg heran, nahm den Hut ab und sprach laut:
»Vater, in deine Hände befehle ich meine Frau!«
Dann wurde der Sarg geschlossen und nach dem hochgelegenen Friedhof getragen, wo ein Glöcklein mit blechernem Klang läutete. – – –
Alle einfachen Menschen haben das Bedürfnis, zu lärmen,[72] wenn sie einmal eine Zeitlang haben still sein müssen. Nach dem Begräbnis wurde die Dorfstraße überaus lebhaft.
Die Mägde sprachen von dem »prachtvollen Leichenputz«, den die Tote getragen, von den blütenweißen Brusttüchern und der breiten gestickten Seidenschärpe, vor allem aber davon, daß sie in der linken Hand statt des üblichen Sträußchens eine Zitrone gehabt habe.
»Nun, sie war eine Reiche!«
»Und was für eine! Sie ist sogar im Bette gestorben!«
»Arme Leute könnten das nicht!«
»Dürften es auch nicht. Es wäre gegen die Schicklichkeit.« –
Die Burschen waren noch lebhafter. Sie behandelten insbesondere eine Standesfrage.
Zu den Leichenträgern gehörten auch ein Halbbauer und ein Häusler; sogar der Schäfer. Der Großbauer Klin hat nicht mit »Träger« sein mögen deshalb. Sie haben müssen herumschicken. Da ist der Gregorek für den Klin eingesprungen.
»Der Klin hat ganz recht. Bauersleute sollen nur von Bauern getragen werden. Anderen Leuten kommt das nicht zu«, sagte ein junger Bauernsohn stolz.
»Du schmutziger Bengel, du bist der richtige!« fuhr ein anderer dazwischen. »Der Tod macht alles gleich. Und dem Toten ist es ganz gleich, wer ihn trägt.«
Der Bauernsohn geriet in Hitze.
»Wenn ich nicht meinen guten Anzug anhätte,« sagte er, »würde ich dir eine ›Pflaume‹[7] geben, an der du zu kauen hättest – du – du Demokrat du!«
»Warte nur den Abend ab«, entgegnete der andere. »Die Pflaume kommt zurecht. Sie wird desto blauer und saftiger werden – für dich.«
»Pst!« machte ein dritter. »Sie war die Frau des Kral. Da ist es etwas anderes. Da haben alle Anteil am Begräbnis. Der Branntwein war gut. Es wird ein Leichenschmaus, wie ihr noch keinen erlebt habt.«
Darauf sprachen sie von Mädeln und von Manövern. –
Zwei alte Weiber humpelten zusammen.
»Mein Gott«, sagte die alte Wičaz, die Mutter des Knechtes Lobo, »man kommt im Leben zu nichts. Ich hab' doch so viel Wanzen in meinem Bett, und da hab' ich ein paar gefangen und in eine Federspule gesperrt und die Spule an beiden Enden mit Wachs verklebt. Ich wollte sie in den Sarg stecken, daß ich alle Plagegeister los würde. Aber ich habe ja nicht allein an den Sarg kommen können. Es waren ja immer Leute da. Nun ist gar das Wachs von der Spule in meiner Tasche abgegangen, und die Viecher sitzen mir im Kirchenkleide. Ein armer Mensch hat kein Glück.«
»Wart, bis der alte Kito stirbt«, tröstete die andere. »Der macht's nicht mehr lange. Und bei dem sind nicht viel Leute. Der nimmt die Wanzen mit.«
»Hast du nicht deine Wanzen dem Merten mitgegeben?«
»Ja, aber sie haben nicht mit ihm gehen mögen, weil der sich doch gehangen hat und in die Hölle gekommen ist. Sie sind wiedergekommen.«
»Also warten wir, bis der alte Kito stirbt. Auf den hat man sich immer verlassen können!« – – –
Juro ging mit den beiden Deutschen vom Kirchhof zurück. Sie redeten nicht viel. Es war nur, daß die Gäste nicht allein blieben. Am Kretscham stand Heinrichs Fuhre. Dort nahmen sie bald Abschied. Elisabeth sagte leise zu Juro:
»Es tat mir weh, daß ich am Grabe deiner Mutter allein so fremd war. Die Leute sahen mich an, als ob ich nicht dahin gehöre, und ich gehörte doch gewiß dahin.«
»Ich danke dir, daß du gekommen bist, Elisabeth. Es wird eine schwere Sache, die wir übernehmen wollen, weil wir nicht zu den Leuten hingehen, weil wir sie zu uns herüberziehen müssen. Aber wir wollen mutige Kameraden sein.«
Sie reichten sich die Hände und schieden. – –
Samo ging mit Hanka. Sie sprachen eine Weile nicht, dann hob Samo den Kopf, wies nach vorn und sagte:
»Da gehen die Deutschen. Sie sind aufdringlich. Wie alle[74] Deutschen! Gestern das studentische Gefasele dem Vater gegenüber war direkt ekelhaft. Sie sind hinter Juro her.«
»Wie meinst du das?« fragte das Mädchen arglos wie ein Kind.
»Es ist nicht schwer zu raten. Sie wollen ihn für das deutsche Mädchen.«
»Für diese da? – Als Mann? Als Ehemann?«
»Ja natürlich!«
Hanka schüttelte den Kopf und sagte ruhig:
»Das darf er nicht. Eure Mutter hat es mit meinen Eltern ausgemacht, daß Juro mich heiratet. Das muß er nun doch tun!«
»Nimmst du ihn gern?«
»Ich weiß es nicht. Er spricht nicht mit mir. Gestern hat er mich ausgeschimpft und mir den Leichentopf zerschlagen. Eigentlich fürchte ich mich vor ihm. Aber er ist ein hübscher Mann.«
»Ja! Und er ist ein Glückspilz!« knirschte Samo zwischen den Zähnen.
Hanka senkte traurig den Kopf.
»Ich möchte am liebsten wieder heim. Es ist so schön zu Hause. In der Spinnstube war ich schon die Kantorka[8], und ich bin doch erst achtzehn Jahr.«
Samo blieb vor ihr stehen und sah sie an. Und die Trauer wich auf ein paar Sekunden aus seiner Seele, und er sah, daß Hanka schön und lieblich sei.
»Man sollte dich auf Händen tragen, Hanka!«
»Sie sind alle gut zu mir. Nur Juro ist streng. Er schalt mich gestern, daß ich wendisch sprach.«
Da kollerte ein leises, grimmes Lachen über Samos Lippen.
»Der zukünftige Kral!« sagte er verächtlich. »Nun, ich bin da und will aufpassen. Gehen wir durch die Seitengasse, Hanka. Ich will nicht am Kretscham vorbei. Ich mag diese Deutschen nicht grüßen.«
»Aber ich will das Mädchen sehen«, sagte Hanka. »Sie ist ein Fräulein, man sieht es gleich.«
Samo ging allein durch die Seitengasse. – – –
Der Kral schritt hochaufgerichtet seines Weges. Sein Gesicht war ebenmäßig feierlich. An diesem schweren Tage seines Lebens brach eine rote Sonne durch graue Nebel des Schmerzes, zeigte sich seine Königswürde.
Bis von Muskau her im Nordosten waren Trauergäste gekommen, viele aus dem Spreewald von Burg, Leipe und Lehde, auch von den Städten Lübbenau und Kottbus. Dann welche aus Wittichenau und den Dörfern um Hoyerswerda, endlich viele aus dem Sächsischen, und sogar der berühmte und gelehrte Herr Buchdrucker Schmaler aus Bautzen hatte den weiten Weg nicht gescheut. Er ging jetzt neben dem Kral, und seine Brille funkelte, und sein Slawenherz freute sich dieser einmütigen Kundgebung des Wendenvolkes. Er sprach vom reinen Slawentum, und daß es wohl vereinbar sei mit der preußischen Königstreue.
Alle aber, die von weither gekommen waren, drängten sich an den Kral heran, wollten genau sehen, wie er ausschaue, und daheim Kunde geben vom König, dessen Bild auf keiner Münze und in keinem Buche stand. Eine Röte stieg dem Kral in die Wangen und verdrängte die bleiche Trauer. Und Dankbarkeit war in seinem Herzen für die Frau, die jetzt eingescharrt wurde. Zweimal in seinem Leben hatte er durch sie sein Königtum deutlich gefühlt, am Hochzeitstag, da er sie bekam, und heute am Begräbnistag, da er sie verlor. Beide Male hatte das Wendenvolk seine Vertreter zum Kral geschickt aus allen Dörfern und Städten.
»Gebt uns die Ehre!« hatte der Kral zu allen gesagt, die ihn begrüßten. Der König lud sein Volk zum Mahle. Im Großgarten waren lange Tafeln aufgeschlagen; in allen Stuben, selbst in der Scheune waren Tische und Stühle. Das[76] war kein gewöhnlicher zakopowane[9] mit gelber Suppe und etwas Branntwein und Butterbrot, das war ein großes Mahl mit gekochtem und gebratenem Fleisch. Es gab Bier, Branntwein und Tabak für die Männer und Kaffee mit Kuchen und Schokolade für die Frauen. Selbst Zuckererbsen für die Kinder gab es wie bei einer Hochzeit. Der Kral ging ein paarmal durch die Reihen der Schmausenden, hörte viel Gerede an und sprach selbst selten ein Wort.
Samo setzte sich der Reihe nach zu allen Leuten aus fremden Ortschaften, war freundlich und vertraulich mit ihnen.
Hanka herrschte über die Küche und die Speisenträger. Die Burschen sahen sie mit Entzücken, die Mädchen mit Neid. »Ob sie heut abend im Kretscham mittanzen wird? Denn getanzt muß werden bei einem so großen Begräbnis.«
»Jawohl! Aber das Mädchen ist zu nahe verwandt, sie wird nicht tanzen. Sie wird Juros Frau werden. Deswegen ist sie hier.«
»Wo ist Juro?«
»Der ist nicht zu sehen. Sein Bruder macht sich viel gemeiner«[10]. – – –
Juro ging einsam durch die Felder. Der Totenschmaus war ihm zuwider. Kaum, daß das Totengeläut verhallt ist, geht das Klingen der Gläser an. Barbarisch ist das, abscheulich! Es ekelte ihn.
Er ging weiter den Feldrain entlang und hing in Gedanken der Mutter nach, dachte an lichte Kindertage, da ihre Liebe sein junges Leben vergoldet hatte.
Schließlich mußte er doch umkehren.
Da sah er ein bewegliches Männlein den Weg entlangkommen. Juro kannte den Mann sehr gut. Schmaler, der Buchdrucker aus Bautzen, war er. Juro wußte seine ganze Geschichte. Wie er mit einem Stipendium des preußischen Königs studiert, wie er dann seine ganze Lebensarbeit der Erhaltung des wendischen[77] Slawentums gewidmet hatte. Ein Mann, der seine kleine Buchhandlung hatte, der ein wendisches Blättchen herausgab, selbst redigierte, die meisten Artikel selbst schrieb, das Blatt selbst druckte und versandte. Ein seltsamer Mann. Wenige seiner großen buchhändlerischen Kollegen waren so weit bekannt wie dieser Zeitungs- und Bücherkrämer. In Moskau kannte man ihn, aus Prag wallfahrteten tschechische Politiker, Schriftsteller, Studenten zu ihm. Er trug auch heut am Begräbnistag an seinem schwarzen Rock den russischen St. Annenorden zweiter Klasse. Er war der Mann, auf den die Panslawisten aller Völker für das »Slawentum an der Sprewja«[11] ihre Hoffnungen setzten.
Inzwischen trafen sich die beiden Männer, Schmaler, der wirkliche, geistige Kral der Wenden, und Juro, der nominelle Erbe des wendischen Königtums.
»Sie werden sehr vermißt!« sagte Schmaler in wendischer Sprache.
»Ich kann diese Totenschmausereien nicht ertragen«, antwortete Juro deutsch.
Schmaler sah überrascht auf ihn.
»Sie sprechen deutsch mit mir?«
»Ja, Sie sind aus Bautzen, und Bautzen ist, denke ich, eine deutsche Stadt.«
»Sie wissen sehr wohl, wer ich bin, werter Herr, und Sie wissen auch, daß Budissin[12] eine uralte wendische Stadt ist. Was verdrießt Sie an den Wenden? Man hat mir schon gesagt, daß Sie kein Freund der Wenden sind.«
Schmaler hatte ruhig und mild gesprochen; Juro entgegnete heftig:
»Ich bin kein Freund der Wenden? Wer Ihnen das gesagt hat, Herr Schmaler, ist ein Lügner! Wer Ihnen das gesagt hat, ist ein Schuft!«
»Nun, nun, es kommt viel auf die Auffassung an. Wir[78] können ja ganz ruhig miteinander sprechen. Und wenn Ihnen heute eine Aussprache nicht paßt, so verstehe ich das wohl und will Sie gewiß nicht quälen.«
»Wir können miteinander sprechen, Herr Schmaler, aber ich fürchte, wir werden uns nicht verstehen. Ich kenne Sie und Ihr Werk, und ich habe Hochachtung vor Ihren Talenten, Ihrer Ausdauer, Ihrem Opfermut. Sie sind ein Freund der Wenden in Ihrem Sinne, ich bin ein Freund der Wenden im gerade entgegengesetzten Sinne. Ich glaube nicht, daß so scharfe Gegensätze, wie sie zwischen uns sind, sich oft wiederholen.«
»Das soll heißen,« sagte Schmaler düster, »daß Sie alle meine Bestrebungen um die Erhaltung sorbischen Slawentums in der Lausitz verwerfen, wenn nicht gar bekämpfen wollen.«
»So ist es!« sagte Juro aufrichtig.
Schmaler schwieg eine Weile, dann sagte er:
»Ich könnte Sie um die Begründung Ihres Urteils fragen, aber ich kenne alle Einwände, die gegen mein Werk erhoben werden. Sie halten es für vergeblich.«
»Ja! Für so vergeblich, wie wenn Sie in heißen Frühjahrstagen mit einem eisernen Haken eine Eisscholle in der Spree festhalten wollten. Die Wenden schwimmen im deutschen Fluß, und unter der deutschen Kultursonne wird Ihnen die Scholle, die Sie festzuhalten sich bemühen, trotz aller Haken und Anstrengungen zerrinnen.«
Wieder entgegnete Schmaler nicht gleich. Dann sagte er:
»Sie wissen, daß alle Gleichnisse hinken. Ich könnte Ihnen hundert andere entgegenstellen, z. B. daß es mir lieber ist, als armer Häusler in eigener Hütte zu wohnen, als daß ich als Dominialknecht zu einem großen Herrn zöge.«
»Knechte sind die Wenden nur so lange, als sie Wenden bleiben. Werden sie Deutsche, so sind sie freie Kinder des freien Hauses.«
»Mein Gott, so spricht der zukünftige Kral!«
»Herr Schmaler, Sie wissen, daß unser Königtum eine Illusion ist.«
»Nehmen Sie die Illusion aus der Welt, und die Staaten[79] und die Gemeinschaften und die Familien und alles individuelle Leben geht in Trümmer. Fällt Ihnen nie ein, was für Kulturwerte versinken, wenn dieses Volk untergeht? Glauben Sie nicht, daß nur im Individualismus die Welt schön und liebenswürdig sein kann? Glauben Sie nicht, daß es zum Sterben langweilig wäre, wenn auf der Welt überall dieselbe Art Menschen wohnte?«
»In der Welt ja; aber ein Reich ist nur in einer Einheit bewundernswert. Das weiß sonst niemand besser als die Panslawisten.«
Juro sagte es mit einem Seitenblick auf Schmaler. Der entgegnete ruhig:
»Ich bin ein Panslawist. Es sind mir oft in slawischen Ländern gute, wohlbesoldete Stellen angeboten worden; ich bin im sächsischen Budissin geblieben, habe dort meine Kraft, meine Gesundheit, mein Vermögen zugesetzt im Dienst der wendischen Sache. Aus Eitelkeit, werden meine Feinde sagen, aus der Sucht heraus, ein Eigenbrötler zu sein, der Beachtung findet. Das mögen sie sagen; ich verachte es.«
»Ich meine, daß Ihre ehrlichen Gegner an Ihren Idealismus glauben, Herr Schmaler; ich jedenfalls gehöre zu diesen.«
»Danke! Das eine kann man mir auch jedenfalls nicht bestreiten, daß ich ein loyaler sächsischer Untertan bin.«
»Sehen Sie, Herr Schmaler, das würde ich bestreiten. Ich glaube, daß Sie Ihre staatsbürgerlichen Pflichten erfüllen, aber Ihre Seele gehört hinüber zu den Tschechen, mit denen Sie eine Spracheinheit anstreben, mit denen Sie ständig sympathisieren.«
»Was soll ich tun? Sie selbst sagen, daß meine Scholle zerbröckelt. Festigkeit, geistigen Inhalt für meine Sache kann ich nur bei unseren slawischen Brüdern suchen. Ich suche Stärkung bei den Slawen für unser wendisches Volkstum, aber ich suche keinen politischen Anschluß an sie. Ich will die Erhaltung des sorbischen Slawentums innerhalb der bestehenden Staatsverbände. Ist das Landesverrat?«
»Landesverrat nicht! Nein! Sicherlich aber auch nicht[80] Patriotismus, der die Wurzeln seiner Kraft nicht im Auslande hat.«
»Vaterland? – Welches Blut haben uns unsere Väter vererbt? Wo zieht es uns hin?« –
Sie waren inzwischen nahe an das Gehöft gekommen, wo festliches Treiben war. Mitten aus dem Lärm hob sich das widerliche Geschrei eines Betrunkenen ab:
»Njet hordujo ta kóža přepita!«[13]
»Hören Sie! Hören Sie!« keuchte Juro. »Ist das nicht eine Roheit sondergleichen? Ist das nicht gemeiner Kannibalismus! Wenn ich den Kerl erwische, schlage ich ihn nieder!«
Er wollte voran. Schmaler faßte ihn am Arm und hielt ihn fest.
»Es ist roh! Ja, es ist widerlich roh! Aber der Mann ist betrunken!«
»Oh, es wird nicht lange dauern, da brüllen sie alle dieselbe Gemeinheit!«
»Nicht doch! Denken Sie daran, daß solch arme Leute jeden öffentlichen Anlaß zu einer Festlichkeit benutzen, weil ihr Leben so wenig Feste hat.«
»Da sind sie voll von diesem eklen Kannibalenfraß, da dürfen sie von einer edlen Toten sprechen wie von einem geschlachteten Tier! Ich halte es nicht aus! Ich werfe sie hinaus; ich werfe sie alle hinaus!«
»Es sind die Gäste Ihres Vaters! Roheiten kommen überall vor. Beruhigen Sie sich! Es ist ein ungebildetes Volk! Sie denken sich nichts so Schlimmes dabei!«
»Prosit! Prosit!« scholl es vom Großgarten her, und wieder kam der rohe Satz:
»Njet hordujo ta kóža přepita!«
Da überfiel Juro ein starker physischer Ekel; ein Brechreiz würgte ihn, dann riß er sich los und eilte nach dem Großgarten. Er sah eine Gruppe zechender Männer.
»Prosit, Juro, prosit!« schrien sie. »Njet hordujo …«
»Wollt ihr schweigen, ihr – ihr – Schweine!«
Juro brüllte es.
»Ist das ein Sauffest? Dürft ihr so von meiner Mutter sprechen? Hinaus, sage ich, hinaus mit euch besoffenem Pack!«
Die Gesellschaft erschrak. Blöde, ernüchtert sahen sie den tobenden jungen Mann an.
»Was – Was sagt er?« grunzte einer.
»Was ich sage? Daß ihr eine besoffene Horde seid, die sich benimmt wie die Wilden!«
Nun ging ein Skandal los.
»Wir haben doch den Branntwein nicht gestohlen!«
»Wir sind doch nicht zum Spaß so weit hergelaufen!«
»Er ist ein aufgeblasener Bengel!« – »Er hat uns beim Totenschmaus der eigenen Mutter verjagt!« – »Pfui, er ist geizig!«
»Da – da hast du dein Fett!«
Und es warf einer das Schnapsglas nach Juro, das haarscharf an seinem Kopf vorbeisauste. Mit einer unflätigen Beleidigung stampfte der Kerl davon. Eine Anzahl anderer warf die Gläser ebenfalls ins Gras und ging davon.
Der Kral kam schnell heran und sagte laut:
»Ich bin hier der Herr! Wer mein Gast ist und wem es hier gefällt, der bleibt!«
Aber wenige blieben. Juro ging zitternd vor Aufregung ins Haus.
Schmaler trat an den Scholta heran und sprach einige aufklärende Worte.
»Es hat mir auch wehgetan, wenn sie so brüllten«, sagte der alte Hanzo; »aber es ist eine Redensart seit alters her. Und Gäste soll man nicht vertreiben.«
»Juro ist kein Wende mehr«, sagte Samo, der auch herangetreten war. »Er hat sich so mit Haut und Haaren den Deutschen verschrieben, hat sich so an geschniegelte Kreise angeschlossen, daß ihm alles in der Heimat zu roh ist, daß er sich zimperlich benimmt wie ein Frauenzimmer. Mit den Deutschen[82] ist er gegangen; mit einem Wenden hat der feine Herr nicht gesprochen.«
»Nur mit mir!« sagte Schmaler. »Freilich haben wir gestritten. Ich kehre bedrückten Herzens heim, weil ich gesehen habe, wie der zukünftige Kral über das Wendentum denkt.«
Ein Seufzer kam aus der Brust des alten Hanzo, und er wandte sich, ohne weiter ein Wort zu sagen, wieder zu seinen Gästen. Eine Anzahl kam zurück. Es wurde weiter geschmaust und getrunken, aber es ging stiller her. – Schmaler und Samo gingen nun ein Stück den Feldweg entlang. Sie verstanden sich besser.
Schmaler erzählte mit Begeisterung von Prag.
»Ich kann es nicht begreifen«, sagte Samo, »daß mein Vater darauf bestand, ich müsse in Breslau studieren. Mir ist das deutschgewordene Nest, das Slawen gegründet haben, zuwider. Wir wendischen Studenten gehören nach Prag. Denn die Lausitz gehört ebenso wie Schlesien geschichtlich und rechtlich zur ›Koruna ceska‹«[14].
Schmaler schüttelte den Kopf.
»Ich gehe nicht so weit, ich fasse unsere Stellung zu den verwandten Tschechen anders auf!«
»Was man will, muß man ganz wollen, Meister Schmaler. Los von den Deutschen! Die deutsche Länderkrume, die uns von den tschechischen Brüdern trennt, ist dünn genug, daß man sie durchbrechen kann. Wir müssen nur ausharren, festhalten, hier treu bleiben auf dem slawischen Vorposten. Jahrhundertelang hat unser armes Volk den deutschen Druck ertragen und ist slawisch geblieben im fremden Joch, im fremden Land. Sehen Sie dagegen auf die Deutschen! Alle fremden Sprachfetzen lesen sie auf, die vom Schneidertisch anderer Nationen fallen, behängen sich damit und glauben sich geschmückt. Ihre Nationalität hält im fremden Land nicht vom Vater auf den Sohn. Weil sie nichts taugt! Und deshalb werden unsere tschechischen Brüder Tag um Tag weiter vordringen gen[83] Norden, und eines Tages werden wir mit ihnen vereinigt sein. Dann wird man sowohl vor den Mauern Berlins wie vor den Mauern Wiens die slawische Sprache hören.«
»Sie gehen zu weit, Sie gehen viel zu weit in Ihren Plänen und Hoffnungen«, sagte der vorsichtige Schmaler besorgt.
»Ich setze mir ein Ziel: Erhaltung des Sorbentums als Vorposten der siegreich vordringenden Slawen.«
Schmaler schwieg. Er mochte sich zu solch kühnen Worten nicht äußern.
»Liegt es nicht an der Feigheit unserer Intelligenz, wenn das Sorbentum leider Gottes zurückgeht?« fuhr Samo fort. »Wenn wir solche Führer haben wie meinen Bruder Juro, dann Gnade uns Gott!«
»Auch ich fürchte von ihm viel«, sagte Schmaler.
»Er darf kein Führer werden; er darf es nicht! Ich werde es verhindern. Gott sei Dank, ich glaube, er will es auch nicht. Er ist zu feig und oberflächlich dazu. Ich sah mit scheelen Augen darauf, daß er hinter einer Deutschen herlief. Ich war ein Esel. Ein Glück ist diese Liebschaft! Er soll sich nur sein bleichsüchtiges Ding nehmen, nach Berlin ziehen und alle zehn Jahre einmal nach Hause zur Kirmeß kommen. Öfter gehört er auf unsern Hof nicht! Da ist er unmöglich! Vollends mit seiner deutschen Zierpuppe. Auf unsern Hof gehöre ich!«
»Er ist der Erbsohn«, warf Schmaler ein. »Er ist auch nach der Tradition der zukünftige Kral.«
»Haben nicht andere abgedankt als er, wenn sie unfähig waren für ihre Sache? Er wird abdanken!«
»Ich will mich in einen Familienstreit nicht mischen«, sagte Schmaler wieder vorsichtig.
»Das ist kein Familienstreit, das ist eine Sache, die alle angeht und die Sie unterstützen sollten, wenn eine Unterstützung nötig wird.«
»Ihr Vater ist noch jung. Wir müssen die Entwicklung der Dinge abwarten.«
»Die Dinge werden sich rasch entwickeln. Denken Sie an Hanka! Sie ist das letzte Mädchen aus dem Geschlechte, das[84] uns als das königliche gilt. Meine Eltern und ihre Eltern haben sie für Juro bestimmt. Und wenn er sich um seiner deutschen Liebsten willen weigert, das Mädchen zu nehmen? Wenn er mit seiner deutschen Frau als Arzt nach irgendeiner Stadt zieht? Nach allen seinen Äußerungen glaube ich bestimmt, daß er das tun wird. Nun, irgend jemand wird wohl die Sache hier übernehmen müssen.«
Schmaler drückte Samo die Hand.
»Sie wissen, daß ich Sie hundertmal lieber als Herr auf dem Hofe sehen würde als Ihren Bruder.«
»Das genügt mir!« sagte Samo, und seine dunklen Augen funkelten.
Dann sprach er von der Zeitung, die Schmaler herausgab, von der »Sorbske Nowiny«. Er lobte Schmalers Bestreben, die deutschen Fremdwörter und Lehnformen aus der wendischen Sprache auszurotten und überall da, wo ein rein wendisches Wort nicht vorhanden war, tschechische Formen einzuführen. Er versprach auch, selbst an der »Sorbske Nowiny« mitzuarbeiten, zog ein Zeitungsblatt aus der Tasche und wies auf einen Artikel.
»Den müssen Sie abdrucken. Der trifft das Richtige!«
»Sie lesen Russisch?« fragte Schmaler.
»Ja, ich habe mich von Kindheit an mit dieser Sprache befaßt.«
Schmaler, der ebenfalls des Russischen mächtig war, las:[15] »Wir Slawen bewundern den Genius der Semiten auf dem Gebiete religiöser Schöpfungen, den der Griechen auf dem Gebiete der Wissenschaften und Künste, den Genius der Römer auf dem Gebiete des Rechts und der Politik; wir bewundern den begeisterten Schwung des Spaniers und Italieners, das gesellschaftliche Talent und den Geschmack des Franzosen, die schöpferische Kraft und die Erfindungsgabe des Engländers. Was kann dagegen der Deutsche für sich beanspruchen? Was ist an ihm genial, was ideal, was vollendet? Ist sein Glaube[85] nicht abstrakt und sein Unglaube kühl, seine Philosophie phantastisch und seine Poesie philosophisch? Seine soziale Existenz, sein Feudalismus, sein Junkertum, sind sie nicht die Negation der Menschenrechte, die organisierte Gewalttat? Können seine gute militärische Disziplin, seine Mäßigkeit und Akkuratesse, sein kaltes, herzloses, maschinenartiges Ausführen dessen, was ihm befohlen wird, selbst auf Kosten der geheiligten Gefühle der Großmut und des Mitleids – können sie dieses Volk erheben und Liebe erregen? Können seine Arbeitsamkeit und Pünktlichkeit den Mangel an Humanität und schöpferischer Kraft ersetzen? Möge die geschichtliche Vorsehung die Slawen vor dem Wege der Entwicklung bewahren, auf dem sie den Deutschen ähnlich werden könnten!«
»Haben Sie das selbst geschrieben?« fragte Schmaler.
Samo zuckte die Achseln.
»Geschrieben oder nicht, es ist meine Meinung. Und Sie sollen den Artikel abdrucken.«
»Nein«, sagte Schmaler, »er ist zwar geistreich, aber er schießt über das Ziel hinaus. Die Russen können unmöglich den Deutschen den Vorwurf kalter Herzlosigkeit, Unfreiheit und schöpferischer Unproduktivität machen. Solche Angriffe verfehlen ihren Zweck.«
Samo zuckte die Achseln.
»Wer dieses Volk angreift, hat immer recht. Die ›Nàrodni listi‹ in Prag sollten Sie sich zum Muster nehmen. Das Blatt nennt das Ziel, stellt die Aufgabe klar, wenn es schreibt: ›Wir werden immer auf seiten jenes Volkes stehen, das gegen die Deutschen den Krieg unternimmt, weil der Feind unseres Feindes stets unser Freund ist.‹ Sehen Sie, Pàn Schmaler, das ist stark und zielbewußt! Für Ihre ›Sorbske Nowiny‹ aber werde ich nichts schreiben können, weil ich fürchte, dies Blatt ist zu deutschfreundlich.«
Das mußte sich der alte Wendenführer von dem jungen Manne sagen lassen. Als er gen Bautzen nach Hause fuhr, mußte er sich eingestehen, daß er sich mit keinem der beiden Söhne des Kral verstanden hatte, mußte er sich sagen, es sei[86] doch eine mißliche Sache, in Prag und Moskau als Vertrauensmann zu gelten und daheim dem König von Preußen ein Wendenbuch zu widmen.
An dem Begräbnis hatten auch Hankas Eltern, wohlhabende Bauersleute aus dem Sächsischen, teilgenommen. Am Abend noch sprach der Scholta zu ihnen: »Herr Vetter und Frau Muhme, ich hätte euch eine herzliche Bitte auszusprechen. Meine Frau hat sich eure Tochter Hanka auf ein paar Wochen zum Besuch ausgebeten. Es war unser beiderseitiger Wille, daß die Jungfer und mein Sohn Juro sich wiedersehen sollten, damit, wenn Gott es will, ein Paar aus ihnen werde. Nun ist mir die Frau gestorben …!«
Er hielt nach dieser langen Rede müde inne und machte eine Handbewegung, die bedeuten sollte: alles andere könnt ihr euch wohl selbst denken. Die Mutter Hankas verstand ihn auch.
»Der Herr Vetter meint, weil das Hauswesen jetzt ohne Frau ist, so sollten wir in Gottes Namen die Hanka auf längere Zeit hierlassen, daß er nicht ganz allein ist, wenn die Herren Söhne wieder fortziehen, und daß eine weibliche Aufsicht wäre.«
Hanzo nickte der Frau dankbar zu. Er freute sich, daß sie ihm das weitere Sprechen und Bitten ersparte.
Die Frau aber schwieg jetzt, und auch ihr Mann schwieg. Sie brauchten sich ihre Gedanken nicht mitzuteilen. Sie dachten alle drei dasselbe: daß Hanka an einem Unglückstage in dies Dorf eingezogen, daß ihr unterwegs die Smjertniza begegnet war. Der alte Scholta suchte endlich die Bedenken zu zerstreuen, indem er sprach:
»Bog te swoje žiwńe gromadu zwežo!«[16]
Diesem Spruche dachte die Frau nach, und ihr Mann wartete, wie sie sich entscheiden werde.
Endlich sprach die Mutter Hankas:
»So wollen wir das Mädchen in Gottes Namen hierlassen, bis der Herr Vetter seine Wirtschaft gerichtet hat.«
Der Mann sah seine Frau an, als wollte er sagen: Ich hätte erwartet, daß wir uns anders entscheiden würden. Aber die Frau sagte: »Gott hat das Kind behütet und auch mit tollen Pferden gesund hierher geführt, es mag hierbleiben.«
Hanka wurde nun herbeigerufen, und der Familienbeschluß wurde ihr mitgeteilt. Da rannen ein paar helle Tränlein über die roten Wangen des Mädchens.
»Es war so schön zu Haus. In der Spinnstube war ich schon die Kantorka!«
»Du wirst hier auch die Kantorka werden!« tröstete die Mutter. Das Mädchen aber hielt die Hände vors Gesicht. Da stand die Mutter auf und sagte recht barsch:
»Höre, Hanka, ich will nicht hoffen, daß dir ein Kerl von zu Haus im Kopfe steckt.«
Das Mädchen sah sie groß an.
»Nein! Wie wäre das möglich? Ich denke, ich soll den Juro heiraten!«
Da nickten sich die drei Alten befriedigt zu: »Sie ist ein folgsames Kind!«
Ein Weilchen war's still, dann seufzte die Frau und sagte:
»Der Herr Juro hat ein gar hitziges Blut!«
Ihr Mann wollte nun auch was sagen und sprach:
»Das muß so sein bei den Herren Studenten.«
Die Frau sah ihn an und sagte nichts. Aber der Mann wußte, daß sie bei sich dachte: Was faselst du? Du hast in deinem Leben keine fünf Studenten gesehen. Das war wahr, und der Mann nahm sich vor, ein andermal mit Reden nicht so voreilig zu sein.
»Er wird ein schweres Leben haben, wenn er erst auf dem Gut ist und so hitziges Blut hat«, nahm die Frau das Thema wieder auf.
»Er wird älter werden!« sagte der Kral.
»Und er hatte ganz recht«, rief Hanka, halb noch in Tränen.[88] »Ich habe auch einem von den Kerlen, die so lärmten, eine Flinka[17] gegeben.«
»Du?!«
»Ja, es kam einer an die Küchentür und sagte den gemeinen Spruch: ›Jana stawa baba‹.«[18]
»Der Kerl! Da hattest du recht, daß du ihm eine Flinka gabst. Was sagte er?« fragte die Mutter.
»Ach, er lachte und meinte: Ei sieh, das Kätzchen gibt die Pfote!«
»Und du?«
»Ich gab ihm noch einmal die Pfote!« sagte Hanka und lachte auch.
Die Eltern sahen stolz auf den Scholta: »Sieh, was für eine Schwiegertochter du bekommst!«
»Juro ist streng!« sagte Hanka nachdenklich, »er hat auch auf mich schon sehr geschimpft. Aber er ist schöner als alle!«
Da sahen die Eltern wieder auf den Scholta: »Nehmt euch diese Perle wahr!« Hanzo nickte.
Als die Eltern Hankas an die Heimreise gingen, schieden sie in Zufriedenheit, obwohl sie sich von ihrem zukünftigen Schwiegersohn Juro nicht einmal verabschieden konnten, weil er nirgends zu finden war. So hatte Juro mit ihnen außer einer kurzen Begrüßung bei der Ankunft überhaupt kein Wort gesprochen.
Der Scholta brauchte drei Tage und drei Nächte, ehe er sich zu dem Entschluß aufraffte, mit seinen Söhnen Rücksprache über die Zukunft zu nehmen. Endlich saß er mit ihnen in dem kleinen Stübchen, in dem sein uralter Schreibtisch stand, der so hoch war wie ein Schrank.
Der alte Hanzo schloß das Fenster und verriegelte die Tür.[89] »Meine Söhne,« sagte er dann mit der ihm eigenen Feierlichkeit, »es hat sich in unserer Familie ein so großes Unglück ereignet, daß wir jetzt daran denken müssen, wie in Zukunft alles werden soll. Ich habe hier auf dem Papier alles aufgeschrieben, was die Mutter eingebracht hat, und es kommen jetzt nach ihrem Tode auf jeden von euch sechstausend Taler Mutterteil.«
Die Söhne sagten übereinstimmend, daß sie das Geld vorläufig aus dem Gute nicht herausziehen wollten.
»So werde ich euch jedem eine Hypothek auf das Geld eintragen lassen; denn es muß Ordnung sein«, sagte der Vater.
Damit – meinte er – sei alles erledigt, und er wollte die Tür wieder aufriegeln. Aber beide Söhne sagten, sie hätten noch mit dem Vater zu reden und wollten bald alles abmachen.
»Nun, so kommt zuerst Juro an die Reihe«, sagte der Scholta. Er sah gespannt auf den Sohn. Der redegewandte Juro stockte erst und brachte auch dann seine Sätze nicht ganz glatt heraus.
»Vater, du weißt, daß ich in meinem Berufsstudium hinter Samo zurück bin, obgleich ich ein Jahr eher auf die Universität kam als er. Er hat gleich von Anfang an Medizin studiert, und ich habe erst zwei Jahre mit der Jurisprudenz verloren, ehe ich auch zur Medizin umsattelte. Ich konnte aber nicht Advokat oder Richter werden; ich hatte mich in mir getäuscht. Nun wird Samo schon vor nächsten Ostern fertig, und ich werde noch ein und ein halbes Jahr brauchen, ehe ich approbiert bin. Es kommt dazu, daß ich auf deinen und der Mutter Wunsch nebenbei auch landwirtschaftliche Vorlesungen höre.«
»Wozu erzählst du das?« sprach Samo dazwischen, »das wissen wir doch.«
»Es gehört zum Ganzen«, sagte Juro. »Du weißt, Vater, daß ich mich für die Landwirtschaft bisher wenig interessiert habe; ich habe euch zuliebe diese Vorlesungen gehört, obwohl ich es für ganz unnütz hielt, und ich will dir gestehen, daß ich im Ernst gar nicht daran dachte, einmal Landwirt zu werden.«
Der Vater entgegnete nichts; er kannte die Interesselosigkeit des Sohnes an der Landwirtschaft.
»Aber, Juro, weshalb erzählst du das?« fragte Samo wieder. »Wir alle wissen, daß du kein Landwirt bist und also auch später einmal das Gut nicht übernehmen kannst.«
Juro wandte sich seinem Bruder zu, und der Haß blitzte auf in seinen Augen, und ein Lächeln der Schadenfreude spielte um seine Lippen.
»Und wer wird es übernehmen?« fragte er kalt. »Fremde Leute?«
»Ich bin auch noch da – ich –«
Juro brach in ein Gelächter aus.
»Du?! – Ja, du! – Ich verstehe! – Ich konnte es mir denken!«
Dann stand er auf und schrie den Bruder an:
»Nein, du wirst es nicht übernehmen! Ich bin der Erbsohn! Ich!! Ich bin der zukünftige Kral der Wenden!«
»Das bist du!« sagte der Vater und stand auf und sah mit leuchtenden Augen auf seinen Sohn, der ihm wie ein Wunder erschien in seiner plötzlichen Verwandlung.
Samo aber sah seinen Bruder ganz erschrocken an.
»Du – du – was fällt dir auf einmal ein?«
»Jetzt rede ich erst!« sprach der Vater mild, aber fest, und wandte sich an seinen ältesten Sohn.
»Dir hat Gott geholfen, Juro, er hat dir gezeigt, was du tun sollst, weil du der Kral der Wenden sein wirst. Die Mutter hat sich großen Kummer gemacht. Sie wollte noch mit dir reden, aber sie starb zu rasch. So werde ich dir sagen, was nötig ist. Wir wollen, daß du ein guter Hausvater und ein treuer Kral wirst, und wir haben bestimmt, daß du unsere Jungfer Hanka zur Frau nimmst.«
»Ich – was? – Ich – Hanka? – –«
Der Jüngling brachte keinen Satz zustande. Er stand blaß vor dem Vater, und es war, als ob sein Hirn lahm und seine Glieder starr geworden wären.
Samo schlug ein lautes Gelächter an.
Der Vater verwies Samo dieses Lachen mit strenger Gebärde.
Juro gewann endlich die Herrschaft über sich zurück. Er[91] sprach nicht gleich, aber man sah an seinem Gesicht, wie rasch die Gedanken arbeiteten.
Schließlich sagte er mit ruhiger Stimme, durch die kaum ein merkliches Beben lief:
»Vater, der Eltern Wille ist in Ehren! Und das Mädchen, die Hanka, ist in Ehren! Aber ich werde Hanka nicht heiraten, denn ich habe bereits eine Braut.«
Der Vater sah ihm steif ins Gesicht und sprach:
»Du kannst keine Braut haben, Juro, denn ich weiß nichts davon. Es ist Sitte von alters her in unserer Familie, daß der Sohn mit seinem Vater spricht, ehe er mit einem Mädchen von der Ehe redet, und es ist Sitte, daß kein braves Mädchen mit sich von der Ehe sprechen läßt, ehe sie weiß, daß der Bursch mit seinem Vater einig ist.«
Juros Gesicht wurde dunkelrot. Aber er sprach mit ruhiger Stimme:
»Die Zeiten ändern sich, Vater! Unsere Zeit macht die Menschen schnell selbständig. Unselbständige Leute vernichtet sie. Ich bin schon lange mündig, ich habe so viel gelernt, um zu wissen, was ich tue, und ich werde nur das Mädchen heiraten, das ich mir selbst gewählt habe. Es ist Elisabeth von Withold.«
»Wer?«
»Elisabeth, die Tochter unseres Nachbarn!«
»Des Rittermäßigen?«
»Ja!«
Da ging der Vater auf den Sohn zu, tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust und sagte:
»Weißt du, daß du ein Bauernjunge bist?«
»Ich weiß, daß ich ein gebildeter Mensch bin!«
»Das vergiß nicht, Vater!« rief Samo höhnisch dazwischen.
Der Bauer setzte sich an den Tisch. Er sah starr auf Juro und fragte dann:
»Und du hast es wirklich gewagt, das dem deutschen Edelmann zu sagen?«
»Ich habe es ihm noch nicht gesagt, weil es noch nicht möglich war, aber ich werde es alsbald tun!«
Da sprang der alte Wende auf, und eine Energie kam über ihn, die seltsam von seiner Art abstach. Seine sonst so ruhige Stimme wurde scharf:
»Du wirst es nicht tun! Du wirst uns die Schande nicht machen, daß der deutsche Edelmann den wendischen Bauernjungen mit den Hunden hinaushetzt!«
»Das wird er nicht! Das kann er nicht!« lächelte Juro.
»Er wird es tun! Er gehört zu den Deutschen, die die Wenden verachten! Er ist ein Ritter, und wir sind Bauern!«
»Laß das meine Sorge sein, Vater!«
»Nein, es ist meine Sorge. Ich bin der Vater! Die Schande kommt über uns alle!«
Da hielt Juro eine lange Rede. Er sprach von der Emanzipation des Wendenvolks, von seiner Gleichberechtigung mit den Deutschen, von dem Ausgleich zwischen den Ständen. Er sprach mit herzlicher Liebe und mit großer Begeisterung von Elisabeth und von ihrer Liebe zu ihm. Und er schloß:
»Wendin oder Deutsche – es ist gleich; adelig oder nicht adelig, es ist kein Hindernis für die Liebe! Wir lieben uns, weil wir uns lieben müssen, unsere Herzen haben zusammengeschlagen, ohne daß alte Vorurteile es hindern konnten. Die Zeiten, wo Menschen ihr Glück mit selbstgeschaffenen Ketten erwürgten, sind gottlob vorbei!«
Der alte Wende hörte ihm starr zu. Zuletzt schlug er die Hände vor's Gesicht und sagte:
»Ich wollte, ich wäre bei der Mutter!«
Juro sah ihn erschüttert an.
»Willst du mich nicht verstehen, Vater?«
»Nein, ich verstehe eure Welt nicht, in der alles ohne Sitte und Ordnung ist, alles von unten nach oben gedreht wird!«
»Vater, du warst immer gerecht. Du kannst kein hartes Urteil fällen über ein Mädchen, das du nicht kennst. Oder hast du je etwas Schlimmes von ihr oder ihrer Familie gehört?«
»Nein! Aber es sind Edelleute. Und ein Fräulein paßt nicht zu einem Bauernsohn!«
»Warum hast du uns studieren lassen, Vater? Doch darum, daß wir vorwärts kommen sollen in der Welt!«
»Ja, aber nicht so! Die Wenden haben keinen Arzt, keinen Advokaten, der ihre Sprache spricht, nicht einmal genug Geistliche und Lehrer, die Wendisch können. Da war es doch meine Pflicht als Kral, daß ich euch auf die Schule gab. Einer sollte Advokat werden, einer Arzt!«
»Nun werde ich auch Arzt. Aus innerer Neigung. Und ich werde mich ganz den Wenden widmen, die der ärztlichen Hilfe so nötig bedürfen!«
Samo, der mit feuerrotem Gesicht der Unterredung zuhörte, sagte nun dazwischen:
»Er wird die Kranken kurieren oder auch nicht kurieren – je nachdem –, und das gnädige Fräulein von Withold, die dann eine Bauernfrau geworden ist, wird indes zu Hause die Schweine füttern!«
Juro sah den Bruder kalt an.
»Wir haben uns nicht vertragen, als du noch glaubtest, ich würde dir Platz machen; wir werden uns natürlich erst recht nicht vertragen, nachdem du weißt, daß ich nicht dir zu Lieb' auf mein Erbe verzichte!«
Samo sprang auf.
»Bin ich ein Erbschleicher?«
Juro sah ihn mit strengen Augen an und zuckte die Achseln. Da holte Samo zum Schlage gegen ihn aus. Der alte Scholta aber hieb mit der Faust auf den Tisch.
»Wie benehmt ihr euch? Was erdreistet ihr euch in meiner Gegenwart? Geht hinaus! Beide!«
Die Söhne mußten das Zimmer verlassen, und der Vater blieb allein und sprach drei Tage lang mit keinem Menschen ein Wort.
Dann aber ließ er die Söhne wieder zu sich rufen.
»Ich will dich fragen, Juro, ob du es dir überlegt hast, daß ein adliges Fräulein nicht in unseren Hof als Bäuerin ziehen kann!«
»Elisabeth wohnt jetzt auch auf dem Hofe ihres Vaters. Sie[94] interessiert sich für die Landwirtschaft und verträgt sich aufs beste mit allen Leuten!« entgegnete Juro kleinlaut.
»Sie haben ein herrschaftliches Schloß, einen Park!«
»Das brauchen wir nicht! Aber ich wollte dich allerdings bitten, Vater, daß ich mir hinter unserem Großgarten ein neues Wohnhaus bauen darf: nicht groß und prunkvoll, aber gesund und bequem!«
»Das soll heißen, Vater,« fiel Samo ein, »er baut nebenan ein deutsches Herrenhaus, und du darfst hier in der wendischen Kaluppe weiterwohnen und seinen Großknecht spielen!«
Es drohte wieder ein Streit auszubrechen, aber die Gegenwart des strengen Vaters hielt die Brüder im Zaum.
»Ich beabsichtige,« sagte Juro, »von hier aus meine ärztliche Praxis auszuüben und mich – soweit mir Zeit bleibt – unter deiner Leitung in die Verwaltung des Gutes einzurichten.«
»Und das Fräulein?«
»Sie wird zufrieden sein und dir eine gute Tochter sein.«
Der Alte schüttelte den Kopf.
»Sie ist eine Deutsche!«
»Gott sei Dank!« sagte Samo.
»Was meinst du damit?« fragte ihn der Vater.
»Ich meine, es ist gut, daß sie eine Deutsche ist. Sie paßt zu Juro, denn er ist auch ein Deutscher, ein Stockdeutscher.«
Der Vater sah mit forschenden Augen dem Sohne ins Gesicht.
»Er hat die Wenden oft unfreundlicher behandelt, als ich wünschte, aber deshalb kann noch kein Mensch behaupten, daß er ein Deutscher geworden ist«, sagte der Alte.
Juro, der erkannte, auf welches Geleise ihn der Bruder geführt, verschmähte es, sich zu verstecken.
»Ja, ich bin ein Deutscher«, rief er. »Ich will es, ich mag es, ich kann es nicht verheimlichen.«
»Und – und dein Wendentum?«
»Ich liebe die Wenden; aber ich sehe kein anderes Heil für sie, als daß sie Deutsche werden.«
»Ihre Sitte, ihre Sprache, ihre Gebräuche, ihr Volksglaube?«
Juro wartete einige Sekunden. Dann sagte er fest:
»Sie sind dem wahren Fortschritt der Wenden hinderlich. Darum müssen sie ausgetilgt werden.«
»Juro – Juro, bist du das – ist das mein Sohn, der so redet?«
»Ich kann nicht anders. Bei Gott, Vater, es ist meine Überzeugung!«
Er wollte auf ihn zugehen; aber der Vater wehrte mit beiden Händen ab.
Bleich und gesenkten Hauptes ging der alte Mann zur Tür. Dort blieb er stehen und sagte noch:
»Das ist das Schwerste, was ich im Leben hören mußte! Da gehört viel Zeit dazu, ehe ich das fassen kann.«
Juro streckte die Hände nach ihm aus, aber der Vater schloß die Tür von draußen. – –
»Das ist ein schönes Lied, Töchterchen«, sagte die alte Wičaz zu Hanka. Sie saß mit ihr im Hofe.
»Ein schönes Lied, und du hast eine schöne Stimme.«
»Zu Hause war ich schon die Kantorka«, erwiderte Hanka und seufzte. »Hier singt man wenig.«
»Wer soll singen?« sagte die Wičaz. »Ich weiß einen, der singt schöner als alle Burschen; das ist mein Sohn Lobo.«
»Dein Lobo trinkt zu viel Branntwein. Wäre er nicht betrunken gewesen, hätte vielleicht der Wagen mit der Tante nicht umgeworfen. Palenc je walenc!«[20]
Die alte Wičaz schüttelte den grausträhnigen Kopf. Sie war als die Sprichwörter-Wičaz bekannt, da sie beständig Sprichwörter in lehrhaftem Ton gebrauchte, ärgerte sich aber, daß ihr jetzt das Mädchen mit dem verdrießlichen Vers: »Palenc je walenc« kam, denn sie hielt auf ihren Sohn Lobo.
»Töchterchen, das redest du so«, meinte sie ärgerlich. »Du kennst gewiß nicht den richtigen Spruch:
»Woda wšitko zhloda!«[21]
»Hättet ihr mit einem verhungerten Kutscher fahren wollen? Mein Lobo ist gut und stark und hat eine schöne Stimme. Gegen die Smjertniza konnte er euch freilich nicht helfen, obwohl er stark war. Sonst – ist er so fromm wie der Kater beim Quarge.«
»Da – da habt Ihr Euren Sohn! Er singt schöne Lieder!«
»Töchterchen, der Gesang muß lustig sein; sonst ist er kein guter Gesang. Es muß Schmalz darin sein! Siehst du, dort kommt er, mein Lobo. Er ist doch ein schöner, starker Bursch!«
»Betrunken ist er schon wieder am Vormittag. Pfui! Ich gehe ins Haus!«
Sie verschwand.
»Ich sehe dich, Mutter!«[22] rief Lobo von weitem, trank aus einer Flasche und kam dann heran. Er blieb vor der alten Frau stehen, sah sie beinahe schadenfroh an und sagte unvermittelt:
»Mutter, wir müssen fort!«
»Wir? Fort? Was? Was faselst du? Wohin?«
»Das weiß ich nicht. Der Neue, der Juro, will uns rausschmeißen.«
»Rausschmeißen? Uns? Mich?«
Das alte Weib grunzte vor Überraschung.
»Ich bin mein Lebtag auf diesem Hofe gewesen. Ich gehöre hierher! Bist du verrückt, du Süffling?«
Lobo zuckte die Achseln. »Wenn Ihr schimpft, erzähl' ich nichts mehr.«
»Erzähl es, sag es, Lobo!« besänftigte sie ihn.
»Nein!«
»Erzähl es, Lobo, mein Söhnchen! Ich habe noch sechs Dreier in der Ulmer, die geb' ich dir«, bat sie.
»Sechs Dreier? Und Ihr sagtet, Ihr hättet kein Geld? Sechs Dreier sind zu wenig.«
»Ich habe noch zwei Silbergroschen, die geb' ich dir.«
Der Trunkenbold blinzelte die Mutter an.
»Es ist wegen der Frau. Weil die Smjertniza den Wagen umgeworfen hat. Der Juro hat keine Religion, er sagt, die Smjertniza ist dummes Zeug.«
Das Weib schlug die Hände zusammen.
»Daß ihn der Teufel hol!«
»Er wird ihn schon holen!« sagte Lobo grimmig, »ihn und den alten Kito, diesen abgefaulten, alten Lumpen. Kito weiß, daß Ihr ihm unsere Wanzen mit in den Sarg geben wollt, wenn er stirbt. Die Wanzen will der Kito nicht annehmen. Er vermacht dem abgefaulten Baier, dem Wilhelm, zehn Taler, und der wird Wache beim Sarge halten, wenn Kito stirbt.«
»Ah, der schlechte Kerl! Der Wanzenwächter! Aber, mein[98] Söhnchen, deshalb ziehen wir nicht aus. Da werde ich eben die Wanzen behalten.«
»Behalten oder nicht, fort müssen wir doch! Denn sie haben dem Juro die Wanzengeschichte erzählt und auch erzählt, daß Ihr immer mit einer Federspule um den Sarg der toten Frau geschlichen seid, und da heißt es jetzt: fort!«
»Wer sagt das?«
»Juro sagte es zu mir. Wir müßten raus. Er wird nicht ruhen, bis wir raus sind. Er hat uns Schweine genannt.«
Das Weib schlug die Hände zusammen.
»Der Grobian! Ach, er ist dazu imstande; er tut's! Hat er doch sogar die reichen Leichengäste hinausgeworfen.«
»Ich sehe dich, Mutter«, lallte Lobo und trank ihr zu. »Ich werde den Juro totschlagen.«
Da faßte ihn seine Mutter an der Hand.
»Rede nicht so laut, mein Söhnchen; ich werde dir auch drei Silbergroschen schenken.«
»Der Wilhelm, der abgefaulte Baier, wird auch rausgeschmissen«, grinste Lobo. »Den schmeißt der andere raus – der Samo.«
»Was sagst du, Samo hat den Wilhelm fortgejagt, den Deutschen?«
»Ja, Juro hat gesagt, ich und du werden rausgeschmissen, und Samo hat gesagt, Wilhelm wird rausgeschmissen.«
Die Alte grinste.
»Die zwei werden den ganzen Hof ausräumen.«
»Ja, es fehlte nicht viel, daß sie sich prügelten, die feinen Herren. Es wär' mir recht gewesen. Den Juro wollt' ich schon besorgen. So habe ich bloß meine Hacke weggeschmissen und bin abgezogen. Alle fünf streck ich gerade und mach' keinen mehr krumm. Ich sehe dich, Mutter!«
»Lobo, mein Söhnchen, geh' arbeiten, daß dich der Scholta nicht sieht. Auf ihn kommt es an. Laß mich nur machen.«
Der Bursche torkelte erst nach vielen Bitten und Versprechungen nach dem Felde zurück. Die Alte blieb allein auf der Bank sitzen. Sie hatte heut keine »Tour«. Sonst ging sie[99] als Botenfrau nach der Stadt, kehrte in vielen Häusern unterwegs ein, besorgte für die Leute allerhand Aufträge. Hier im Schulzenhofe hatte sie ein kleines Stübchen, in dem sie mit ihrem Sohn Lobo schlief.
Die Alte war klug und schlau auf ihre Weise. Sie kam viel bei Leuten herum, hörte mancherlei und wußte es für sich zu benutzen. Sie stand im Rufe der Wahrsagekunst und bekam viel Geld für das Besprechen von Krankheiten an Menschen und Tieren.
Jetzt blinzelte sie ins Sonnenlicht und dachte nach. – –
Hanka sang im Hause. Die Alte hörte aufmerksam zu und sprach bei sich:
»Mit dem Mädel wird vielleicht etwas zu machen sein.«
Nun hörte sie drinnen ein Gespräch. Samo unterhielt sich mit Hanka.
»Das ist ein hübsches Lied. Wir singen es etwas anders. Du hast es von den Böhmischen«, sagte Samo.
»Ich weiß es nicht, ich habe es so gelernt«, erwiderte Hanka.
»Weißt du, was es bedeutet?«
Sie lachte.
»Meinst du, ich bin so dumm, daß ich nicht weiß, was ich singe?«
»Oh, das Lied ist gar nicht so leicht zu verstehen. Oder was denkst du dir unter dem Pfau, der seine Federn verliert, und unter dem Mädchen, das den Rautenkranz flicht?«
»Nichts! Es ist eben ein Pfau. Ich weiß, daß es eigentlich etwas Trauriges ist, weil der Rautenkranz sowohl der Brautkranz wie der Totenkranz ist; aber ich will nicht daran denken.«
»So – ja so! Ich finde, Hanka, du bist blässer, als du sonst warst. Schläfst du nicht gut oder fehlt dir sonst etwas?«
Sie seufzte.
»Ich weiß nicht, was mir fehlt. Ich kann nicht mehr so lustig sein. Vielleicht habe ich die Heimkrankheit.«
»Hanka, ich möchte so gern, daß es dir bei uns gefällt. Ich möchte dir alles verschaffen, was du willst, dir alles von den Augen absehen.«
»Ja, Samo, du bist ein guter Mensch!«
Er lachte bitter.
»Guter Mensch! Ich habe kein Glück. Ich bin nicht so schön und fein und geschniegelt wie – wie zum Beispiel mein Bruder Juro. Nicht wahr, der gefällt dir gut?«
»Er muß mir wohl gefallen. Es ist ja meine Pflicht, da ich ihn doch heiraten soll!«
Das Mädchen sagte es mit stockender, beklommener Stimme.
»Kein Mensch kann dich dazu zwingen, kein Mensch«, sagte Samo erregt. »Es ist dein freier Wille. Du kannst ebensogut einen – einen andern nehmen.«
Das Mädchen stieß einen langen Seufzer aus. Da trat jemand in die Stube, und das Gespräch brach ab.
Am Nachmittag desselben Tages traf die alte Wičaz wie von ungefähr Samo auf einem Feldweg.
»Laß die Geschichte mit den Wanzen,« sagte er zu ihr; »mein Bruder Juro will euch rauswerfen; aber ich werde schon sehen, daß ihr eure Kamorka[23] behaltet.«
sagte die Sprichwörter-Wičaz. »Der Herr Samo ist ein freundlicher Herr. Vielleicht kann ich ihm dankbar sein. Ich habe die Karten aufgeschlagen und weiß wohl manches, was für den Herrn Samo gut wäre, auch zu wissen.«
Er machte eine abwehrende Handbewegung.
»Laß nur das mit den Karten! Ich will das nicht!«
Das Weib ging ein Weilchen schweigend neben Samo her. Plötzlich sagte sie halblaut:
»Zwei Adler fliegen aus dem Wendenland. Einer kommt zurück und baut sein Nest. Einer stürzt in den Lóbjofluß«[25].
»Was meinst du damit?« fragte Samo überrascht.
Die Alte antwortete mit einem Spruch:
Samo blieb stehen und sah der Alten scharf ins Gesicht.
»Ich glaube, daß ich dich verstehe. Aber ich weiß nicht, ob ich dir trauen darf.«
»So erlaube mir der junge Herr, daß ich ihm die Karten lege. Ich werde dann in seine Seele sehen und er in meine.«
Samo sah sich um. Es war niemand in der Nähe. Er setzte sich also auf einen Rand des tiefen Feldweges und wies mit stummer Gebärde der Alten ihren Platz gegenüber an. Sie zog ein Päckchen schmutziger Karten, auf die allerhand mystische und allegorische Bilder gezeichnet waren, aus der Tasche, mischte sie und ließ Samo abheben. Er tat es und wischte sich gleich darauf die Hand am Grase ab.
Die Alte breitete die Karten vor sich auf den Wegrand, kniete davor, fuhr mit dem Finger über die Karten, brummte allerlei vor sich hin und sagte dann:
»Der junge Herr wird bald sein Examen sehr gut bestehen.«
Samo lachte.
»Das denkst du dir. Da hast du was davon läuten hören.«
»Es steht in den Karten«, sagte die Wičaz ernst.
Dann suchte sie wieder lange mit ihrem dürren gelben Finger und fuhr fort:
»Der junge Herr liebt ein wendisches Mädchen!«
Sie sah dabei Samo an, der sehr rot wurde. Da war die Alte schon wieder bei den Karten.
»Das Mädchen ist für einen andern bestimmt; der junge[102] Herr wird viel Kämpfe bestehen müssen, aber er wird das Mädchen erringen, weil es das Volk will.«
»Was heißt das: weil es das Volk will?«
Samo fragte es schnell und erregt.
»Der junge Herr wird der Kral werden!« sagte die Alte sehr ernst.
Da sprang Samo auf, und seine flackernden Blicke suchten die Umgebung ab.
»Bist du toll, Wičaz,« sagte er im Zischton, »du weißt, daß ich einen älteren Bruder habe.«
»Mit dem Kopfe werfen wie ein Herrenpferd, das frommt nicht zum Glück. Das Volk wird ihn nicht mögen, es wird den Herrn Samo wollen. Zwei Adler fliegen aus vom Wendenland. Einer kommt zurück und baut sein Nest, der andere ertrinkt im deutschen Fluß.«
»Du redest ja wie eine Weise, Weib!« rief Samo in höchster Überraschung. »Woher hast du diese Gedanken?«
Die Alte lächelte.
»Ich lese in den Karten und ich lese auch in den Herzen. Ich komme weit herum. Ich kenne viele Leute und sage ihnen ihre Zukunft. Soll ich Euch noch mehr prophezeien?«
Er wehrte ab. In angestrengtem Nachdenken saß er da. Ein tiefes, grünes Feuer glimmte in seinen Augen, die einen neuen Weg sahen.
Eine ganze Weile sagte er nichts.
»Ihr legt vielen Leuten die Karten?« fragte er dann.
»Es sind wenig Bauern auf dem Wege von hier nach der Stadt, und es ist keine Bäuerin, der ich nicht die Karten gelegt hätte. Alle jungen Männer kommen zu mir, auch viele Burschen, und in der Stadt habe ich eine Stube, wo ich alle Freitage und an jedem 7., 13. und 17. des Monats die Karten aufschlage; da sind oft an die dreißig, ja fünfzig Leute bei mir.«
»Wenden?«
»Ich spreche nicht Deutsch.«
Samo nickte.
»Ihr verdient viel Geld?« fragte er leichthin.
Sie lächelte.
»Vom Botengehen wollte ich nicht leben. Die Bäuerin gibt mir für einen schweren Korb, den ich ihr aus der Stadt mitbringe, einen Silbergroschen, und wenn ich ihr auf ein paar Minuten die Karten aufschlage, gibt sie fünf Silbergroschen. Nur mein Lobo darf nicht wissen, was ich verdiene. Ich will ihm einmal eine kleine Wirtschaft kaufen, wenn er erst ein ordentliches Weib hat.«
»Wenn Ihr Geld habt, warum wohnt Ihr in der kleinen Kamorka bei uns?«
Die Wičaz lächelte überlegen.
»Die Kartenlegerin muß arm sein,« sagte sie, »muß in einer Kamorka wohnen. Und sie muß Wanzen haben. Das gehört dazu. Und in Eurer Kamorka wohne ich, weil ich eben beim Kral wohne.«
»Ah – ich verstehe Euch!«
Samo betrachtete das Weib mit steigender Verwunderung und mit großem Interesse. Aber er beherrschte sich und sagte wieder leichthin, ja spöttisch:
»Nun, ich kann mir wohl denken, was die Leute auf dem Herzen haben und was Ihr ihnen weissagen müßt: ob man das čelatko[26] großziehen oder besser dem Fleischer verkaufen soll, wieviel Junge die ranca[27] bekommen wird, und vor allem, ob der Jakub der Maruška treu ist und ob der Pilip die Marja kriegen wird.«
Die Alte war nicht gekränkt.
»Ja, das fragen sie wohl. Die Burschen fragen mich, ob sie beim Militär Gefreiter werden können, und die Mädel, ob sie im grünen Rautenkranz zum Traualtar gehen werden; die Männer, ob ihre Wirtschaft in die Höhe gehen wird, und die Weiber, was sie tun sollen, daß sie der Mann nicht prügelt. Und ich sag' ihnen immer das Richtige. Sie fragen mich auch, wo der billigste und beste Kaffee zu haben ist und von welchem[104] Kaufmann die Schürzenbänder am besten halten. Sie zahlen immer fünf Silbergroschen dafür. Und die Kaufleute wissen mich zu schätzen. Ich habe stets besseren Kaffee getrunken als die Frau Mutter.«
Samo staunte über die menschenkundige Alte.
»Ihr seid ein siebenmal schlaues Beest«, sagte er. »Aber warum wollt Ihr nur durchaus beim Kral wohnen?«
»Alles, was vom König kommt, hat Ansehen.«
»Habt Ihr auch manchmal Botschaften zu bringen – ich meine wendische Nachrichten?«
»O ja – der Herr Vater hat mir immer vertraut. Ich habe manches auszurichten gehabt, und einmal hat ein Deutscher in der Stadt auf mich gesagt: Sieh da – das ist der wendische Staatskurier, das ist die Geheimrätin Wičaz! Ich habe ihn ausgelacht und gesagt, der Scholta vertraue mir nicht einmal an, ein paar Hühner zu verkaufen.«
»So seid Ihr verschwiegen. Nun sagt mir, von wem habt Ihr das Gleichnis von den zwei Adlern?«
»Ich habe es aus den Karten gelesen.«
Samo machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Nun, so nehmen wir an, es ist mir eingefallen, wenn ich auf den weiten Wegen allein war, und es fiel mir immer ein, wenn ich in den Hof des Kral kam. Da sah ich es mit offenen Augen.«
»Erzählt Ihr dieses Gleichnis auch anderen Leuten?«
»Ich habe es noch nicht erzählt. Ich wollte es nicht sagen, daß der eine in dem Lóbjofluß ertrinken wird; sie würden sich sonst zu sehr freuen.«
»Freuen? Über diesen Untergang?«
»Ja; denn der eine Adler hat scharfe Krallen und läßt sie die Wenden fühlen, wo er nur kann. Er kratzt, bis es blutet.«
Samo nickte und sah die Alte versonnen an.
»Und der andere?« fragte er leise.
»Der andere wird im Wendenland wohnen und herrschen.«
Sie schwieg. Und er schwieg.
»Ihr könnt Euch auf mich verlassen, alte Wičaz«, sagte er endlich und gab ihr einen Taler.
Da sah sie ihn durchdringend an und sprach:
»Ich werde die Geschichte von den zwei Adlern jetzt überall erzählen, in allen Bauernstuben, allen Kleinbauern und Häuslern – auch den Wenden in der Stadt.«
Er gab ihr noch einen Taler.
Eine Woche später trat Juro durch das Feldtürchen in den Großgarten. Es war Abendzeit. Die stille Melancholie des Herbstes war über allen Feldern und Wegen und war auch in dem Herzen des jungen Mannes, der drüben bei der Geliebten gewesen war und von ihr Abschied genommen hatte.
Morgen reiste er nach Breslau zurück. Die Ferien neigten sich dem Ende zu.
Er hatte wieder mit Elisabeth gesprochen: von seinen Plänen, von der Zukunft. Er hatte ihr nicht gesagt, wie sehr der Vater gegen die Heirat sei; denn er hoffte, den stillen Mann schon noch für sich zu gewinnen, aber er hatte ihr doch wieder schwere Kämpfe in Aussicht gestellt.
Und da hatte sie ihn das erstemal gefragt: ob er denn sein Werk nicht zu heftig angreife, ob er nicht mit mehr Geduld und Nachsicht die Herzen der Wenden eher gewinnen und besser an sein Ziel kommen werde.
Herzlich hatte er gelacht, als sie sagte, sie ängstige sich oft um ihn; denn es gebe doch rohes, rachsüchtiges Volk. Nein, hatte er gesagt, er wolle nicht mit Geduld ans Ziel kommen. Geduld sei etwas für müde, rückständige Leute. Die Geduld, mit der die Regierung diesen Verhältnissen seit Jahrhunderten zuschaue, die Geduld, mit der der Wende seit tausend Jahren schläfrig und denkfaul in seinem Waldwinkel hocke, sie sei schuld an diesen Zuständen. Er kämpfe wie ein Deutscher, er erkläre laut und rücksichtslos den Krieg und greife dann den Gegner von vorn an ohne Maske und Schliche, nachdrücklich und kaltblütig.
So hatte er wieder einmal in Worten und Ideen geschwelgt.
Dann aber war die fernere Zukunft ganz in die Ferne entwichen und in ihrem jungen Herzen nur das lebendig gewesen, was ihnen unmittelbar bevorstand.
Seufzer und Küsse, Zärtlichkeiten und Treueschwüre, die Vereinbarung einer Stunde, in der sie täglich aneinander denken würden, wo und in welcher Lage sie sich auch befänden, eine Blume, ein blaues Band, eine Locke – alle diese Dinge, die in den Abschiedsstunden junger deutscher Liebesleute ihre süßschmerzliche Rolle spielten, sie hatten auch hier nicht gefehlt.
Und nun, als Juro in den heimischen Garten trat, war er wie in der Fremde, das Herz war ihm so voll von Liebe und Leid und Zukunftsträumen, und die Gedanken gingen die abendlichen Wege zurück zu der Geliebten, die ihm nun mit ihrer süßen Mädchenliebe gewiß traurig nachschaute. – – –
Der leise Gesang schreckte Juro auf. Er sah Hanka drüben in der Nähe der Haustür unter einem Baume sitzen. Sie bürstete Schuhe ab. Und als er näher kam, sah er, daß es seine eigenen Schuhe waren, die er tags zuvor getragen hatte, als er bei Elisabeth war, und die auf regendurchweichtem Wege recht schmutzig geworden waren.
Es war ihm arg unangenehm, das zu sehen, und ob er sonst wenig, fast nie mit dem Mädchen sprach, blieb er jetzt bei ihr stehen und sagte halb freundlich und halb ärgerlich:
»Das sind ja meine Schuhe! Warum bürstest du sie ab? Das kann doch ein anderer machen. Wozu sind denn die Dienstleute da?«
Sie war bei seiner Ankunft erschrocken. Nun wurde sie so knallrot, daß er bei sich dachte, sie habe doch eigentlich ein recht gewöhnliches Gesicht. Sie gab keine Antwort.
»Warum machst du das?« fragte er wieder und nahm ihr[107] den Schuh aus der Hand. Er wußte gar nicht, daß er wendisch mit ihr sprach.
»Mache ich es nicht gut?« fragte sie.
»Darauf kommt's nicht an! Es ist keine Arbeit für dich. Du bist meine Verwandte!«
Da sah sie ihn groß an, und ihr Gesicht wurde blässer und schöner, und sie sagte:
»Laß mich's nur tun! Ich tue es gern.«
Und dann schluckte sie ein paarmal und brachte heraus:
»Denn ich bin doch deine Braut!«
Da trat er langsam einen Schritt zurück und lehnte sich an den Baum.
»Was sagst du? Wer – wer hat dir das gesagt? Hat dir das wirklich jemand gesagt?« fragte er mit erstaunter, schmerzlicher Stimme.
Nun kam die Scham über sie, und sie wollte ins Haus laufen. Er hielt sie aber zurück.
»Bleib, Hanka, es ist gut, wenn wir miteinander reden. Morgen muß ich fort.«
Sie nickte traurig.
»Du hast fast nie mit mir gesprochen. Du bist so fein und so stolz!«
»Ich bin nicht fein und stolz. Ich will mit dir alles ordentlich und vernünftig besprechen. Komm mit, dort unter den Nußbaum!«
Sie gingen tiefer miteinander in den Großgarten hinein. Unter dem Nußbaum war eine Bank. Er setzte sich und lud sie ein, neben ihm Platz zu nehmen. Aber sie weigerte sich und blieb mit gesenktem Haupte vor ihm stehen. Durch das Gezweig des Baumes fielen rote Lichtfunken auf ihren schlichten, blonden Scheitel, und Juro sah, daß Hanka ein kraftvolles, gesundes, hübsches Mädchen war. Da faßte ihn ein Unbehagen und eine Trauer, und er sagte:
»Ich finde es unerhört, dir solche Dinge vorzureden. Nicht wahr, Hanka, du selbst hast nie daran gedacht?«
»Wie sollte ich wohl? Ich habe dich gar nicht gekannt!«
»Und wer hat dir das vorgeredet?«
»Deine Mutter hat es mit meinen Eltern besprochen, als sie mich abholte, und dein Vater hat es auch gesagt.«
Er nahm den Hut ab und fuhr sich nervös durch die Haare.
»Wie alt bist du, Hanka?«
»Achtzehn Jahre.«
»Das ist sehr jung! Aber das weißt du doch, daß zwei Menschen nicht von Vater und Mutter miteinander verheiratet werden können, daß es auf sie selber ankommt?«
»Ich habe meinen Eltern immer gehorcht.«
Er haschte nach ihrer Hand. Hart und schwer lag sie in seiner feinen Rechten.
»Du bist ein gutes Kind, Hanka! Aber sieh mal, wenn man sich heiraten soll, muß man sich doch liebhaben, nicht wahr? Du hast gewiß einen schönen Burschen in deiner Heimat lieb.«
Sie erglühte.
»Siehst du, Hanka, und du brauchst mir das gar nicht zu sagen. Aber ich verspreche dir, daß ich dafür sorgen werde, daß dich niemand mehr mit solchen Dingen belästigt; ich verspreche dir, dafür einzutreten, daß du deinen Liebsten heiraten kannst.«
Da sagte sie:
»Ich habe keinen Liebsten!«
»Du hast keinen?«
»Nein, ich habe immer gehört, daß ich – daß ich …«
»Daß du mich heiraten mußt!« vollendete er. »Aber, Hanka, das ist nicht so, dazu kann dich kein Mensch zwingen, auch dein Vater und deine Mutter nicht. Dazu bist du nicht verpflichtet, weder vor Gott noch vor den Menschen! Am wenigsten bist du es mir schuldig! Damit du aus allen Zweifeln herauskommst, will ich dir sagen, Hanka: ich habe schon eine Braut!«
Da hob sie jäh den Kopf und starrte ihn erschrocken an.
Sie brachte kein Wort heraus.
»Ja, Hanka, ich muß es dir sagen, daß du im klaren bist. Freust du dich denn nicht, daß du jetzt frei bist, daß du mich los bist?«
Er versuchte in scherzhaftem Tone zu fragen.
»Ja, liebes Mädel, jetzt bist du frei, jetzt kannst du alles auf mich schieben. Auf meinem Rücken hat viel Platz!«
Sie zupfte an ihrem Brusttuch und sagte kein Wort. Er fragte betroffen:
»Ja, bist du denn nicht einverstanden? Freust du dich nicht?«
Da stammelte sie:
»Ja, – ja – ich freue mich – ich wäre ja auch viel – viel zu gewöhnlich …«
»Hanka, davon ist nicht die Rede! Ich hatte doch meine Braut schon, ehe ich dich sah!«
Ihre Augen flogen noch mit ein paar flackernden Blicken zu ihm hin, dann sagte sie:
»Ich muß hinein!«
Und sie ging trotz seines Zurufes.
Am späten Abend lehnte Juro am offenen Fenster seiner Giebelstube. Die Herbstnacht war dunkel, ein müder Wind ging durch welkes Laub und dürres Gras.
Dort vom Berge her grüßte der Hochwald.
Dahinter lag das Haus der Geliebten.
Morgen war er weit.
Wie still es war! Einmal nur klagte ein Vogel, dann war tiefe Ruhe.
Da drang leises Weinen an Juros Ohr.
Unten aus dem Garten.
Lehnte nicht dort ein Mädchen?
War das nicht Hanka?
»Hanka!« rief Juro leise hinab. »Hanka!«
Eine Gestalt huschte in tiefes Dunkel, und nichts regte sich mehr. Juro lehnte noch eine Weile am Fenster, ehe er es fröstelnd schloß.
»Budže bohu skoržene! Zrudna wutoba!« sagte er in seiner wendischen Muttersprache zu sich.
»Gott sei es geklagt: Ein trauriges Herz!«
Ehe der Kral in die große Wendenschlacht zog, vergrub er die Krone, die er zu Burg vor allem Volk getragen hatte, an einem sicheren Orte. Im tiefsten Wald hat der Kral die Krone vergraben, an einer Stelle, wohin kein Weg noch Fußpfad führt. Einen kleinen Hügel hat er über dem Grabe des Königsschmuckes errichtet. Den haben die Kiefern mit langen, braunen Nadeln zugedeckt.
Der Kronenhügel ist ein heiliger Ort.
Der Holzschläger achtet seinen geweihten Bannkreis auf hundert Schritt. Was am Kronenhügel wächst und steht, welkt oder fällt, entsteht und vergeht nach den Gesetzen des Urwalds.
Kein Jäger schießt am Kronenhügel ein Wild. Dort ist Gottesfriede für Mensch und Tier.
Die alten Weiblein, die Pilze suchen, die Kinder, die im Walde spielen, fürchten sich, allein zum Kronenhügel hinzugehen.
Selten steht ein ernster Wende sinnend an dem Hügel; die meisten wissen gar nicht den Weg zu ihm. Sie wissen nur, in welchem Walde er liegt, und mancher, dem sonst die Kappe fest auf den Ohren sitzt, lüftet sie in heimlicher Stunde, wenn er einsam an dem Walde vorbeikommt. Auf dem Hügel ist ein einzelner Stein. Er sieht aus wie ein altersgrauer Grenzstein. Ein Hufeisen ist darauf eingedrückt.
Der Nachtjäger hat einmal Sturm geritten gegen den Hügel; aber als das Roß den Huf auf den Stein setzte, ist ihm das Eisen glühend geworden, und es ist mit dem Nachtjäger davongerast, und der wilde Jäger hat sich nimmer getraut an selbigen Ort.
Seit tausend Jahren liegt die Krone des Kral in jenem kleinen Hügel.
Wann wird die Jungfrau mit der silbernen Schaufel kommen, nach ihr zu graben?
Gott weiß es! Aber dann wird Wendenland groß und mächtig werden.
Indessen schlafe in Gottes Hut, alte Krone! Das Volk denkt an dich! Der Schiffer tief drunten an der Spree träumt[111] manchmal von dir, wenn er in langsamer Fahrt durch das stille Wasser zieht; der Pflugtreiber, der sich auf sandigem Hügelfeld im Oberland um geringen Lohn quält und müht, ermißt in seinen einsamen Gedanken deinen Wert; im heimlichen Kreis der winterlichen Spinnstuben wird von dir geraunt und geflüstert, und keines dieser treuen armen Menschenkinder wird dich je verraten.
Schlaf in Gottes Hut, alte Krone, bis der junge Morgen tagt, da du auferstehst aus deinem ehrwürdigen tausendjährigen Grabe!
Inzwischen wird die weiße Wolke, die über Wendenland segelt, oft über dir halten und im Abendrot auf dich herniederglühen, wird der weiße Fisch in der Sprewja im stillen Wasser stehen und nach dem grünen Walde hinüberlugen, wo du schläfst.
Samo und die alte Wičaz, die sich wieder einmal von ungefähr auf dem Felde getroffen hatten, sahen von ferne den grünen Kronenwald.
Da wies die Alte nach dem Walde hin und sagte:
»Daran will er sich auch vergreifen!«
»Woran? Doch nicht an dem Kronenhügel?«
»Ja, an dem Kronenhügel.«
»Wer? Juro?«
»Ja!«
»Pah! Das ist Unsinn! Daran wagt sich keiner!«
Die Wičaz zuckte die Achseln.
»Ich weiß es!«
»Das ist nicht möglich. Aber erzähle, was du weißt!«
Er gab ihr wieder ein Geldstück.
Die Alte duckte sich ein bißchen zusammen, wandte den grauen Kopf zu Samo hin und sagte:
»Drin in der Stadt hat ein Kaufmann hinter seinem Laden eine Weinstube. Da hat der Herr Juro mit seinem Freunde Heinrich von Withold gesessen. Und sie haben fünf Flaschen Wein zusammen getrunken. Ihi! Die Wenden saufen. Palenc[112] je walenc! Die Deutschen saufen nicht. Wein ist wohl kein Umwerfer – wie? Wein ist teuer, die Deutschen sind reich; Branntwein ist billig, der Wende ist arm.«
»Alle Völker saufen!« sagte Samo verächtlich. »Halte mich nicht auf, erzähl, was ich hören will!«
»Wie sie schon etwas betrunken waren, hat der Herr Juro wieder davon gesprochen, daß er die Wenden deutsch machen will, hat über das Wendische geschimpft und hat auch vom Kronenhügel angefangen. Das sei ein blöder Ameisenhaufen, hat er gesagt.«
»Das hat er nicht gesagt«, fiel Samo ein, »dafür ist er zu klug.«
»Er hat es gesagt. Und dann hat er von einem deutschen Bischof angefangen, einem ganz alten, der hat einmal eine Eiche umgehackt.«
»Bonifacius?«
»Jawohl – so hieß er. Ich konnte den deutschen Namen nicht behalten. Die Eiche ist den Leuten dort heilig gewesen. Und der Bischof hat sie umgehauen, daß die Leute sehen sollten, die Geschichte mit der Eiche sei Lüge und Plunder.«
Samo tat drei rasche Atemzüge.
»Und so – so will sich Juro an dem Kronenhügel vergreifen? Etwa nachgraben? Den Leuten beweisen, daß keine Krone in dem Hügel liegt, dadurch ihren Volksglauben, ihre ganze Hoffnung, ihre Nationalität zerstören?« Er sprach mehr zu sich selbst. Aber die alte Wičaz antwortete:
»Ja, er wird den Hügel aufreißen. Er hat es gesagt.«
»Wer hat es gehört?«
»Der Kaufmann. Sonst niemand! Denn der Lehrling, den er hat, versteht nicht Deutsch.«
»Und der Kaufmann – wird er es nicht weitererzählen?«
»Nein. Er hat gewartet, bis ich in seinen Laden kam, und es erst mir erzählt; denn ich verschaffe ihm viel Kundschaft. Und er weiß, daß Juro der Sohn vom Kral ist, bei dem ich wohne. Ich habe ihm gesagt, er dürfe es niemand weitererzählen, was er gehört hat.«
»Warum?«
Die alte Wičaz zuckte die Achseln.
»Ich wollte Euch erst fragen, Pan Samo!«
Er antwortete nicht. Er blieb stehen, und seine Augen hafteten am Boden.
»Wenn Ihr wollt, Pan Samo, so wissen es in acht Tagen alle Wenden«, sagte sie in lauerndem und vertraulich klingendem Tone.
Er wehrte heftig ab.
»Nein! Es darf niemand wissen, – niemand – hörst du? – Oder du fliegst aus dem Hof, – hörst du? – Ich will es nicht! – Er ist mein Bruder! – Und ich – ich glaube überhaupt nicht, daß er das gesagt hat. Geh jetzt!«
Er machte wieder seine wegwerfende Handbewegung. Die alte Wičaz starrte ihn an und wußte nicht, was sie zu dieser Veränderung sagen sollte.
»Tý plundrawa![28] Scher' dich zum Teufel!«
Sie wandte sich erschreckt ab.
Da rief er sie noch einmal an.
»Ich will keine Vertraulichkeiten mit dir, verstehst du? Das ist selbstverständlich! Das gibt es nicht! Ich habe mit dir nichts zu schaffen. Gar nichts! Natürlich nicht! Und was du mir gesagt hast, ist alles Unsinn! Altweiberquatsch! Wičaz, ich sage dir, halte dich fern von Juro und mir! Sage nicht so – sage nicht anders. Sage gar nichts! Dann kannst du auf dem Hof wohnen bleiben, und es bleibt alles, wie es war. Sonst – du weißt, ich bin der einzige, der dich halten kann.«
Er wandte sich ab und schlug rasch einen Seitenpfad ein. »Herrendienst ist rund«, sagte bestürzt die »Sprichwörter-Wičaz«. Aber nach einer Weile, als sie nachgedacht hatte, sprach sie schlau blinzelnd bei sich selbst: »Stóž je z kóčdu wločil, najljepe wje kak čelńe.«[29]
Über die ehrwürdige Karlsbrücke im »goldenen Prag« gingen zwei junge Männer. Es war bereits Nacht. Die »argandischen Lampen« der damaligen Straßenbeleuchtung erhellten den Weg nur schwach und unvollkommen; hin und wieder nur blitzte die Laterne eines Kahns vom dunklen Moldauwasser herauf; der Hradschin aber, die heilige Akropolis von Prag, lag in Sternenlicht und hob sich zauberisch schön von dem dunkelblauen Nachthimmel ab.
»Wie fühlst du dich in der Tschamarka?« fragte der eine der jungen Männer.
»Ich bin glücklich!« sagte darauf der andere.
Es war Samo. Er war, ehe er nach Breslau zurückkehrte, nach Prag gefahren, um einige Tage bei guten Freunden zu sein, die er früher in Breslau kennengelernt und mit denen er einer slawischen Geheimverbindung angehörte.
Der andere betrachtete ihn von der Seite.
»Sie kleidet dich trefflich. Ha, sie haben uns auch diese Nationaltracht nehmen wollen; jahrelang durften wir uns in der Tschamarka nicht sehen lassen, – jetzt wird es wieder anders!«
Samo betrachtete sich. An dem bunten, mit vielen Schnüren, Bändern und Litzen verzierten Rock schaute er hinab bis auf die Stiefel, die ihm bis an die halbe Wade reichten. Und er rückte an dem runden slawischen Hut, den er trug.
»Ich fühle mich wohl in diesem slawischen Ehrenkleide, und ich wünschte, daß alle Böhmen es trügen«, sagte er.
»Hab nur Geduld; bald wird es so sein.«
Bei der Nepomuk-Statue blieben sie stehen.
»Es ist eigentlich schade, daß ihr Protestanten seid«, sagte der Prager.
Samo zuckte die Achseln.
»Religion läßt sich ändern, Nationalität nicht«, sagte er gleichgültig.
»Das heißt, – verstehe mich nicht falsch«, rief der zweite darauf, »ich meine nur, es ist schade für die Einheitsbestrebungen! Sonst weißt du wohl, daß ich kein Freund der[115] Pfaffen bin. Ach du, – wenn wir noch Hussiten wären! Da wäre alles anders!«
Sie lehnten sich an die Brückenbrüstung und schauten hinunter zur dunklen Moldau.
»Ich sage dir, Samo, ich kann keine Hussitenfahne sehen, ohne daß ich toll werde. Und wenn die pamatka mistra Jana Husi[30] kommt, da weiß ich, da wissen Tausende und aber Tausende hier im Lande, zu welcher Religion wir eigentlich gehören sollten. Dann wallt sie wieder auf, die schwarze Fahne mit dem roten Kelch, und ich sag' dir, Tausende von treuen Papisten kommen in inneren Zwiespalt, weil sie den als religiösen Ketzer verdammen sollen, den sie als nationalen Helden vergöttern müssen. Denn so wie Jan Hus hat selten einer die Deutschen gehaßt.«
»Keiner, es sei denn Ziška«, sagte Samo. »Wie Hus mit Hilfe Wenzels alle deutschen Studenten aus Böhmen verjagte, wie er am Tage ihrer Vertreibung einen Jubelhymnus von der Kanzel sprach, das war herrlich!« Der andere seufzte.
»Die Jesuiten haben die vertriebenen deutschen Hunde wieder zurückgebracht, und heute bellen sie frecher als je.« Eine Weile schwiegen die Jünglinge. Da schlang der Prager den Arm um Samos Nacken und sprach: »Oh, Samo, wenn ich den Brüdern sagen könnte, wer du bist! Wenn ich jetzt auf unserer großen Beseda den Brüdern zurufen könnte: Sehet da einen slawischen Königssohn, sehet da den zukünftigen Kral der Lausitzer Sorben, sehet da den König unserer unerlösten Brüder an der Sprewja!«
»Ich bin es nicht«, entgegnete Samo finster; »mein Bruder ist es, der Renegat.«
»Du bist es, und dein Bruder wird es nie sein!« sagte der andere feierlich.
Darauf gingen sie weiter und traten zuletzt in den hell[116] erleuchteten Hausflur eines Gasthauses der Altstadt. An der Treppe bereits kamen ihnen einige Leute entgegen, die auch die tschechische Tschamarka trugen, und begrüßten sie mit Herzlichkeit. Die Tür eines großen Saales war mit Lindenzweigen und vielen kleinen rot-weiß-blauen Fähnchen geziert. Die Wände des Saales waren festlich geschmückt. Überall rot und weiß, die tschechischen Nationalfarben, überall Zweige von der Linde, dem heiligen Baum der Slawen. Das rote und gelbe Herbstlaub nahm sich bunt und schön aus auf dem grünen Untergrund von Tannenzweigen. An einer Wand war ein Podium mit einer Rednertribüne aufgeschlagen. Über der Podiumswand prangte die goldene Wenzelskrone; darunter waren die Wappen der »slawischen« Länder: der böhmische weiße Löwe, der Adler Mährens, der schwarze schlesische Aar, der gekrönte weiße Adler Polens, auch das Schachbrettwappen der Kroaten und der doppelköpfige Aar der südslawischen Serben. Was aber Samo mit tiefer Rührung erfüllte, war, daß auch die Wappen seiner wendischen Heimat nicht vergessen waren, die Oberlausitzer goldene Mauer im blauen Feld und der Niederlausitzer rote Stier auf weißem Grund. Auf einer Seite des Podiums die rot-weiße böhmische Flagge, auf der anderen die rot-weiß-blaue »slawische Trikolore«.
Ein buntes Menschengewühl im Saal. Viele Männer in der böhmischen Tschamarka, viele in der komödiantenhaft bunten Tracht der nationalen Sokolvereine, hier ein Pole in der Konfederatka, dort ein Hanak in grellrotem Gewand mit blauem Mantel, da ein Bulgare mit der Tschubaramütze aus Pelzwerk; sogar ein Montenegriner ist da, dem Dolch und Pistole im Gürtel stecken. Die Mädchen tragen slawische Mieder, mit rot-weiß-blauen Bändern und Schleifen geschmückt, viele haben Kränze von Lindenlaub im Haar.
Man spricht nur das Tschechische, das auch die anderen slawischen Stämme notdürftig verstehen. Samo, der die tschechische Sprache völlig beherrscht, wird von seinem Freunde Bohuslaw vielen Leuten vorgestellt, von allen mit großer Freundlichkeit und vielem Interesse behandelt.
Wie es mit der deutschen Bedrückung bei den sorbischen Brüdern an der Spree stehe, ob es wahr sei, daß Budissin in Sachsen noch eine ganz slawische Stadt sei, und ob die Lausitzer auch nie vergessen würden, daß sie zu Böhmen gehören, slawisches Blut zu slawischem Blut, slawisches Land zu slawischem Land? Hier im »goldenen Prag« seien die nördlichen Brüder unvergessen, wie ja auch ihre Wappen an der Wand andeuteten. Samo redete wenig, aber er drückte allen mit leuchtenden Augen die Hand.
Dann begann die Feier. Sie wurde mit dem alten Wenzelsliede eingeleitet, das alle Anwesenden stehend sangen: »Svaty Václave«.
Stolz stehen sie da und singen das alte Kirchenlied. Aber sie denken wohl nicht an den frommen, milden Heiligen, der so demütig war, daß er den Weizen selbst säte, erntete, mahlte, aus dem er die Hostien buk, daß er den Wein selbst kelterte, den er zum heiligen Opfer brauchte. Vergessen das Bild frommen Friedens; Wenzeslaus ist diesen Leuten der geistige, politische Führer geworden, weil er der Träger der Wenzelskrone war.
Und die glühenden Augen hängen an dem Abbild der alten Krone, die dort zwischen Heimatsfahnen und Lindenlaub zu sehen ist; der milde Heilige ist zum Bannerträger geworden, zum Schutzpatron im Kampfe gegen die Deutschen; und in dem Liede, das vom Heiligen Geist spricht und von der Schönheit des Himmels, bitten diese Leute um irdisches Heil, um politischen und sozialen Sieg.
Das Lied verhallt. Die Menge setzt sich nieder. Ein ziemlich junger Mann besteigt die Rednertribüne.
»Heil dem slawischen Volke!« beginnt er und begrüßt »die slawischen Brüder«, die zum Teil weither gekommen seien[118] vom fernen Südland, wo der rohe Türke die Brüder knechte seit Jahrhunderten, und vom Norden, wo es am Fluß der Sprewja den Slawen nicht viel besser ergehe.
Die Menge klatscht Beifall; viele Leute sehen auf Samo. Der sitzt regungslos da. Er möchte mit dem Kopf nicken; aber er bringt es nicht fertig, weil ihm im gleichen Augenblick sein Vater einfällt, der ein zufriedener Preuße ist.
Bedrückung überall, fährt der Redner fort, Ungerechtigkeit, Vergewaltigung durch die rohe Übermacht! Nicht die geistige Übermacht! Denn geistig waren die Slawen den Germanen immer überlegen!
Ein starker Beifallssturm der anwesenden Slawen bestätigt diese bescheidene Behauptung.
Als die Deutschen noch lebten wie die Tiere, als sie Eicheln fraßen, sich in Felle hüllten und Ochsenhörner auf dem Kopfe trugen, waren die Slawen längst in viel höherer Kultur. Und wir Slawen sollen unseren geistigen Besitz den Deutschen verdanken?
Stürmischer Widerspruch.
Eingenistet haben sie sich in dieses Land, das Gastrecht haben sie gemißbraucht! Denn den Slawen ist der Gast heilig. »Hast du einen Gast im Haus, so hast du Gott im Haus«, das ist immer und ewig der slawische Grundsatz gewesen. Aber der Gast betrog uns, er machte sich zum Herrn!
Er betrog uns um die Herrschaft, um unser leibliches Gut. Wie haben aber die Deutschen erst geistig gestohlen und gefälscht! Wer ist der Feldherr Wallenstein, der ihr Land vor den Ausländern rettete? Ist er nicht der Tscheche Valdstyn? Wer ist ihr gefeierter Feldmarschall Radetzky, dem sie so ungeheuer viel verdanken? Ist er nicht unser slawischer Bruder Hradecky? Hat nicht ein Tscheche die Buchdruckerkunst erfunden? War nicht der große Jan, der diese unsterblichste aller Künste erfand, ein Ausgewanderter aus unserer böhmischen Stadt Kuttenberg? War es nicht eine Frechheit sondergleichen von den Deutschen, anno vierzig die Buchdruckerkunst als ihre Erfindung zu bezeichnen, aus einem Jan Kuttenberg einen Johann Gutenberg[119] zu machen? Aber laßt sie nur ihr ›Gott erhalte Franz den Kaiser‹ brüllen; Joseph Haydn hat die Melodie den Tschechen gestohlen, und das wird noch an den Tag kommen! Was haben die Deutschen nicht alles von uns! Stammt nicht ihr Dichter Lessing aus dem wendischen Dorfe Kamenz; ist er also nicht ein Slaw? Hat nicht Karl Maria von Weber seinen »Jungfernkranz« den Tschechen gestohlen? Und da wollen die Deutschen sagen, wir hätten keinen großen Dichter, keinen großen Musiker?« Es gab wieder starken Beifall. Nur Samo und sein Freund Bohuslaw saßen mit niedergeschlagenen Augen da. Bohuslaw wußte, daß die kuriose Beweisführung des Redners seinem klugen Freunde peinlich war.
Der Redner fuhr fort: »Wofür sollen wir uns bei den Deutschen bedanken? Dafür, daß sie uns zu knebeln versuchten, daß sie unsere Sprache, unsere Sitte, unsere Freiheit verfolgten, unsere Söhne auf ihre Schlachtfelder schleppten, dafür, daß der preußische Barbar Friedrich II. unseren heiligen Hradschin beschoß, allein an einem Tage eintausendfünfhundert Kugeln gegen unseren Dom richten ließ, dafür, daß wir selbst die Gebeine des heiligen Jan von Nepomuk vor ihm in Sicherheit bringen mußten?«
Tosende Zwischenrufe. Der Redner erhob die Stimme zu größter Kraftentfaltung. Er brüllte:
»Sollen wir uns bei den Deutschen dafür bedanken, daß sie uns unseren großen Magister Jan Hus heimtückisch ermordeten?«
Brausende Bewegung.
»Warum haben sie ihn ermordet? Wegen seiner kirchlichen Lehre etwa? Manch einer hat freiere Dinge gelehrt und blieb am Leben und blieb in Ehren. Warum haben sie Luther geschont und Jan Hus verbrannt? Weil Luther ein Deutscher war und Jan Hus ein Böhme!«
Jetzt sprangen viele auf. Auch Samo und Bohuslaw. Und sie standen da mit wogender Brust und leuchtenden Augen. Spazierstöcke mit dem Ziška-Knopf wurden hochgehoben, und das Symbol der Hussitenkeule schwebte in der Luft.
»Darum haben sie ihn ermordet«, rief der Redner, »weil er die Deutschen haßte, wie sie es verdienten, weil er eines Sinnes, einer Seele war mit dem slawischen Volk, weil seine Donnerstimme die deutschen Studenten aus dem Lande scheuchte, weil er den deutschen Ratsherren in Prag das Handwerk legte, weil er für unsere Muttersprache eintrat, weil er gesagt hat: ›So wie Nehemias, als er hörte, jüdische Kinder sprächen halb Azotisch und könnten nicht mehr rein Jüdisch sprechen, diese geißelte, so verdienen die Prager gegeißelt zu werden, die halb Deutsch reden!‹ Hatte er nicht recht, meine Brüder?«
Stürmische Zustimmung.
»Slawische Brüder! Jan Hus ist verbrannt worden, weil er der Feind der Feinde seines Vaterlandes war!«
Der Redner griff blitzschnell in die Rocktasche und zog eine kleine schwarze Fahne heraus, die Hussitenfahne mit dem roten Kelch.
Ein Teil der Versammelten heulte laut auf vor Jubel, ein anderer schwieg. Ein katholischer Priester sprang auf das Podium, verschaffte sich durch eine Handbewegung Schweigen und rief:
»Im Namen der heiligen Kirche muß ich protestieren gegen die Entfaltung dieser Fahne!«
Der Redner sah ihn an.
»Nun gut«, sagte er, »ich will nicht Zwietracht säen unter die Brüder. Ich stecke die Fahne ein. Aber ich sage, es ist notwendig, an ein Konzil zu appellieren, daß die Akten des Jan Hus noch einmal revidiert werden. Wir können uns in nationaler Beziehung von diesem großen Mann nicht trennen.«
Niemand widersprach.
Noch einmal kam der Redner zu sprechen auf die großen welt- und kulturgeschichtlichen Leistungen der Slawen. Belisar, der dem Kaiser Justinian die Schlachten gewann, war ein Slawe, eine Unmenge deutscher Städte sind slawische Gründungen, ja die erste Kultur Oberitaliens war slawisch. Venedig ist weiter nichts als eine ursprünglich slawische Stadt.
Samo rückte wieder ungeduldig auf dem Stuhle hin und her. Weiter prahlte der Redner. Es sei heute eine Binsenweisheit, daß vor Christoph Kolumbus längst ein polnischer Seefahrer von Island aus Amerika entdeckt habe; in der Geschichte Christians II. von Dänemark sei das nachzulesen. Neuerdings würde auch geprüft, ob das berühmte Buch »Von der Nachfolge Christi« nicht einem Slawen statt Thomas a Kempis zuzuschreiben sei. Schließlich kam der Redner auf Rußland zu sprechen, von dessen Stärke allein die Auferstehung slawischer Macht zu hoffen sei. Hoffen wir auf den Zaren!
»At' žije!«[31] rief die Menge begeistert dazwischen.
»Ja,« schrie der Redner, »ich halte es mit unserem großen Havlitschek-Borowsky: ›Lieber die russische Knute als die deutsche Freiheit!‹«
Es gab Beifall, in den allerdings die anwesenden Russisch-Polen nicht einstimmten.
Eine Schlußapotheose des Slawentums, die dem sprachgewandten Redner gut gelang, und in der sich die Schönheit und der Reichtum der tschechischen Sprache offenbarte.
Und der Redner schloß, indem er zu singen anhub:
»Kde domov muj?«
»Wo steht mein Vaterhaus?«
Die Versammlung sang das sehr schöne tschechische Heimatlied mit. – –
Ein älterer Mann stieg auf die Rednertribüne. Er sprach gemäßigter, sprach von den strengen tschechenfeindlichen Erlassen Josephs II., erörterte allerhand schikanöse Anordnungen der Wiener Regierung, unter anderem, daß die Tschechen in ihrem eigenen Lande nicht in tschechischer Sprache telegraphieren dürften, während dies in allen möglichen fremden Sprachen erlaubt sei. –
Da erscheinen zwei männliche Gestalten auf dem Podium, die das Erstaunen aller aufs höchste erregen. Der eine ist bunter als ein Pfau. Er trägt einen stechend grünen Rock,[122] knallrote Weste, hellgelbe Hose, braune Stiefel, eine riesig lange weißrote Krawatte und einen scheckigen, rot-weiß-blauen Hut. Sein Begleiter hat einen Zottelpelz an, Holzschuhe und trägt auf dem Kopf eine riesige Pudelmütze. »Slawische Brüder,« schreit der Bunte mit krähender Stimme, »nehmt es nicht übel, wenn wir hier reden und wenn uns eure schöne Sprache nicht so gut vom Munde fließt, wie es bei euch Göttlichen der Fall ist! Wundert euch nicht über uns! Ich bin ein Masur, und dieser mein Bruder in der Pudelmütze ist ein Lette. Und das, was wir hier anhaben, sind unsere neuen Nationaltrachten, die erst in diesem Jahre ein berühmter und sinnreicher Schneider in Warschau für uns erfunden hat. Ich hoffe, wir Slawen aus dem gottvergessenen Ostpreußen dürfen uns in eurem edlen Kreise einfinden.«
Der Bunte und die Pudelmütze wurden akklamiert.
»Slawische Brüder, mit Staunen haben wir in diesem gelehrten Kreise von unseren berühmten slawischen Männern gehört, von dem slawischen Dichter Lessing und von dem herrlichen Nasensammler Sobeslaw. Unser Herz hat höher geschlagen. Heil den Polen, die Amerika entdeckt haben! Heil den Tschechen, die die Buchdruckerkunst erfanden! Ich komme aber, um euch Kunde zu sagen von ganz neuen Entdeckungen, die ein berühmter und eifriger Forscher und Gelehrter unseres masurischen Volkes, das gleich eurem stets der Wissenschaft diente, gefunden hat …
… Nero, das römische Kaiserscheusal, war ein Deutscher!«
Bewegung.
»Wohl war Agrippina seine Mutter, aber das verbuhlte Weib hat ihn gezeugt mit einem deutschen Söldling aus der Umgegend von Köln. Weiter: Pontius Pilatus, der den größten und schändlichsten Mord der Welt auf dem Gewissen hat, war ein Deutscher!«
Einige Stirnen im Saal runzeln sich, einige Augen werden scharf.
Der Bunte fährt unbeirrt fort:
»Das heißt eigentlich auch nur ein Halbdeutscher. Aber was[123] für einer! Er war der heimliche Sohn des Kaisers Augustus und Thusneldas, der gefangenen Gattin Hermanns des Cheruskers!«
Einige tschechische Studenten treten dicht vor das Podium und sehen den Redner scharf an. Harmlos spricht der weiter:
»Ich berichte hier nur das, was unser Forscher entdeckt hat. Die Beweisführung muß ich seiner Weisheit und Gewissenhaftigkeit überlassen. Aber wenn auch seine Resultate verblüffend sind, wenn sie auch unsere Feinde, die bluthündischen Deutschen, schwer ärgern müssen – sollen sie deshalb unausgesprochen bleiben? Nein, nein, nein!«
Zustimmung. Die Studenten treten vom Podium zurück.
»Und so sage ich euch: auch Judas Ischariot war ein Deutscher! Es ist klar erwiesen, daß sein Großvater als Kriegsgefangener von Julius Cäsar nach Rom gebracht wurde und durch Abschiebung nach Kairot ins Morgenland kam; denn Judas Ischariot ist eben Judas aus Kairot. Ich will die Ehrenliste deutscher Helden hier nicht verlängern; die Forschungen unseres Meisters, ob nicht auch der bethlehemitische Herodes deutsches Blut in den Adern hatte, sind noch nicht abgeschlossen!«
Wieder treten einige Studenten erregt vor.
»Laßt mich ein Wort sagen, slawische Brüder, über die Knechtung unseres Volkstums in Ostpreußen. Über neunzig Prozent unserer Kinder unterliegen dem Schulzwang; im slawischen Dalmatien brauchen bloß zwei Prozent der eingestellten Rekruten lesen zu können!«
»Was soll das heißen?« rief ein Student dazwischen.
»Das soll heißen, daß wir Slawen uns nicht in die deutsche Bildungszwangsjacke pressen lassen wollen. Haben wir das nötig? Neuerdings hat ja sogar ein Wiener Gelehrter zugegeben, daß das tschechische Gehirn das relativ schwerste ist, fünfzig Gramm schwerer als das deutsche!«
»Stimmt! Dr. Weisbach in Wien!« schrie einer.
Einige Studenten fixieren den Redner scharf.
»Ich bin fertig!« sagte dieser; »ich danke, daß Sie mich[124] meine bescheidenen Ausführungen haben machen lassen. Vergönnen Sie nun auch meinem lettischen Bruder und Nachbar einige wenige Minuten!«
Der Lette wiegt die riesige Pudelmütze hin und her und sagt stockend: Als Lette sei er, wie man wohl wisse, ein Germanoslawe. Aber jetzt habe er den Germanen abgestreift und stehe als Slawe hier. (Lebhafter Beifall.) Leider beherrsche er sehr wenig die tschechische Sprache, wolle aber nicht zurückhalten mit einer Entdeckung, die ein berühmter und eifriger Forscher seines Stammes gemacht habe. Das Grundgesetz, auf dem alle moderne Kultur beruhe, in dem das Judentum, das Christentum und der Islam eine gemeinsame Grundsäule hätten, seien offenbar die zehn Gebote Mosis. »Sie alle wissen, daß der Finger Gottes die Gebote auf zwei steinerne Tafeln geschrieben hatte, daß aber Moses die Tafeln zerschlug, als er die Israeliten beim goldenen Kalbe erwischte. Nun, unser Forscher hat jahrelang am Sinai nachgegraben, hat die Scherben der Tafeln gefunden, hat sie zusammengesetzt und entdeckt: Die zehn Gebote waren von Gott in urslawischer Sprache geschrieben!«
»Was soll das heißen? Was sagt er?«
Stühle rücken. Eine große Bewegung greift Platz. Samo spricht erregt auf seinen Freund ein.
»Ja, wenn ich nicht sagen darf, was mein Volk glaubt!« fährt der Lette fort, »so will ich schweigen. Sie wissen, daß viele Polen glauben, der Papst spreche Polnisch. Und haben Sie die Argumente unseres Forschers schon nachgeprüft? Haben wir Ihnen nicht auch die Erfindung der Buchdruckerkunst geglaubt? Man hatte uns gesagt, auf der tschechischen Beseda könne man reden, was man wolle. Ich danke Ihnen, daß Sie mich bis hierher angehört haben!«
Er verließ verärgert mit seinem masurischen Freunde das Podium, und beide gingen der Tür zu. Alle sahen den beiden nach. An der Tür stieg der Lette auf einen Stuhl und rief:
»Eines bitte ich noch sagen zu dürfen: Die zehn Gebote, wie Sie sie kennen, haben eine Lücke: Es muß heißen: Siebentes Gebot: du sollst nicht stehlen; achtes Gebot: du sollst kein[125] falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten, das heißt also: du sollst kein Tscheche sein!«
Ein Schrei! Der Masur reißt die Pudelmütze ab. Eine deutsche Studentenkappe kommt zum Vorschein.
»Leben Sie wohl!« schreien die beiden in deutscher Sprache und sind zur Tür hinaus. Ein wahnwitziges Geschrei geht los. Hunderte von Menschen drängen zur Tür. Sie verlegen einander den Weg. Unten auf der Straße fährt ein Wagen rasch davon. Im Saale herrscht die grimmigste Empörung. Mehr als eine halbe Stunde vergeht in ohnmächtigem Toben und Fluchen. Viele Frauen weinen. Da steigt einer aufs Podium.
»Slawische Brüder! Laßt eure Feier nicht stören durch diese deutschen Lausbuben!«
Großer Beifall!
»Sind sie nicht ausgerissen wie Feiglinge?«
Stürmischer Beifall.
»Wir werden sie und ihresgleichen zu treffen wissen!«
Geschrei.
»Wieder einmal ist es erwiesen, daß die Deutschen die Friedensstörer, die Provokateure sind, die sich selbst zu so friedlichen Slawenfesten wie dieses heimtückisch einschmuggeln. Lasten wir uns nicht stören; der Tag der Vergeltung kommt.«
»Šusnelka nám piše.«
Er stimmte den beliebten Gassenhauer an, der davon redet, die Deutschen hätten alle gefährliche Bauchschmerzen, und die Versammlung sang mit.
Die Erregung legte sich allgemach etwas; nur einzelne Studentengruppen führten unter sich aufgeregte Debatten. Man beschloß eine große Demonstration vor der Karlsuniversität.
Und nun trat »Plzenske piwo« in seine gewaltigen Rechte. Pilsener Bier. Je erregter der Mann, desto tiefer der Trunk. Nur, daß der köstliche Trank das innere Feuer nicht löschte, sondern immer mehr anfachte.
»Diese elenden Frankfurter!«[32]
»Jauche haben sie gegossen in unseren slawischen Verbrüderungswein!«
»Der eine sah aus wie ein bunter Hanswurst, der andere wie ein Urmensch aus der Eiszeit. Und das nannten sie slawische Nationaltracht! Und der Kerl, der Lette, sagte ausdrücklich, eigentlich bin ich ein Germanoslawe, aber ich habe den Germanen abgestreift und stehe jetzt als Slawe hier. Und wir klatschen Beifall dazu. Eine Schmach! Eine Schmach!«
Der junge Student, der das sagte, vergoß Tränen.
Da stimmte jemand das Lied von der Aussiger Schlacht an: »Bitwa před Ustim.«
Die Studenten hörten mit finsteren Gesichtern zu. Heut war der Ruhm, wie sie die Deutschen aus dem Felde geschlagen hatten, klein.
Selbst als ein paar hübsche Mädchen etliche der wunderherrlichen Volkslieder der Tschechen vortrugen, die für Trauer und Sehnsucht des Menschenherzens in stillen Worten und tiefen reichen Melodien so ergreifenden Ausdruck finden, kam keine rechte Stimmung mehr zustande.
Die Beseda war verunglückt.
Es war kaum zehn Uhr, als Samo aufbrach. Sein Freund Bohuslaw folgte ihm. »Ich ersticke in diesem Saal!« sagte Samo draußen. »So ist es selten einmal durchtriebenen Hallunken geglückt, die Gegner zu äffen.«
»Mein Herz leidet, daß es geschah, Samo«, antwortete der sanfte Bohuslaw. »Wenn es nun einmal geschehen sollte,[127] dann doch nie in deiner Gegenwart. In dir ist der slawische Königsgedanke beleidigt worden.«
Der junge Mann hing an Samo mit einer Art ehrfürchtiger Liebe. Er ehrte in ihm mit tiefer Überzeugung den heimlichen Königssohn.
Schweigend gingen die beiden jungen Männer weiter. Als sie in eine schmale, winklige Straße kamen, zeigte Bohuslaw auf das Erkerfenster eines Eckhauses. Mattes Licht schimmerte durch die kleinen bleigefaßten Scheiben des Fensters.
»Dort wohnt mein Onkel Krok, von dem ich dir erzählte. Wenn es dir gefällt, so gehen wir zu ihm hinauf. Wohin sollen wir jetzt in dieser Stimmung?«
»Es ist zu spät für einen Besuch.«
»Mein Onkel Krok würde um Mitternacht aufstehen und dir sieben Meilen entgegengehen, wenn er wüßte, du wolltest ihn besuchen. Erlaubst du, daß ich klopfe?«
Samo zuckte die Achseln.
»Tu, was du willst.«
Bohuslaw klopfte mit dem eisernen Schläger an die Tür, und bald erschien an dem Erkerfenster der Kopf eines alten Mannes.
»Wer klopft? Bist du es, Bohuslaw? Und wer ist der andere?«
»Das ist Samo. Unser Samo!«
»Unser – unser …«
Dem Alten stockte die Stimme. Er warf den Fensterflügel zu und erschien bald in der Tür mit einem Licht. Eine in einen weiten Schlafrock gehüllte schmächtige Gestalt eilte auf Samo zu und beugte sich tief vor ihm.
»Fjersta! Fjersta!«[33] rief der Alte zitternd, und ehe es sich Samo versah, küßte er ihm ehrfurchtsvoll die Hände. »In Gottes Namen, willkommen! Gesegnet der Tag, da meinem Hause diese goldene Ehre widerfährt!«
Samo war bestürzt, daß er kaum etwas zu antworten[128] wußte. Wie im Traum trat er durch die schmale Tür, stieg er eine schmale Stiege hinauf. Der Alte, der ihm leuchtete, stammelte unausgesetzt Worte freudigen, ehrfurchtsvollen Willkommens.
Sie traten in das sehr geräumige Erkerzimmer. Es war erhellt durch eine große Hängelampe von auffällig schöner Schmiedearbeit. Der große Tisch unter der Lampe war mit Büchern und Manuskripten bedeckt. Sonst machte das Zimmer den Eindruck des Lagerraums eines Altwarenhändlers oder des ungeordneten Saales eines Museums. Alte Möbel, Waffen, Bilder standen und lagen umher, von der Decke hingen seidene Tücher mit bunten Malereien, an den Wänden waren kostbare Stickereien, in Glaskästen allerhand kleine historische Pretiosen, geschichtliche Reliquien und Sonderbarkeiten.
»Heilige Madonna, ich danke dir, daß ich diesen Tag erlebte! O Fjersta! Fjersta!«
Und wieder wollte der Alte Samo die Hand küssen.
Dieser wehrte ihn freundlich ab.
»Ich freue mich, daß ich bei Euch bin; aber ich bin nichts als ein wendischer Student.«
»Ich weiß, wer Ihr seid! Der sorbski kral, der kommen wird. O seht, wenn ich auf unserer heiligen slawischen Erde reise und sehe, wie schön und reich sie ist, ich finde alles: ich finde große Berge und weite Ebenen, Städte mit alten Domen und heiligen Gräbern, Wiesenflächen mit singenden Dörfern, ich finde alte Nationalschätze und habe davon manches gesammelt, ich finde eine stolze Jugend, die an ihr Slawentum glaubt, ich finde Dichterwerke und Weisheitswerke und Silber und Gold und Edelstein – aber ich finde das nicht, wonach ich mit meinen alten Augen immer noch suche: ich finde keinen slawischen König. Und nun ist er hier! Und nun ist er hier!«
Der Alte fing so heftig an zu zittern, daß ihn sein Neffe nach einem der großen Lehnstühle führen mußte. Auch Samo faßte es an wie ein Taumel, und er setzte sich langsam und schwer auf einen Stuhl an dem großen Tisch.
Eine tiefe, tiefe Stille kam. Der Alte blickte auf den jungen[129] Königssohn wie ein Vater, dem in frühen Jahren ein Sohn, das Kleinod seiner Ehre und seiner Hoffnung, geraubt worden ist, dem die goldene Wahrheit und Gewißheit seines Lebens in graue, neblige Ferne entwich, der mit heißen Augen und nimmermüdem Fleiß suchte durch die besten Jahre seines Lebens und endlich müde heimkehren mußte mit winzigen Andenken und ungewissen Anhalten, ein Träumer sitzt am einsamen Tisch – und dem mitten in der Nacht im Sternenschein der Sohn als ein kommender Sieger wiederkehrt.
»Fjersta!«
Samo eilte auf den Alten zu – sie liegen sich in den Armen. – – –
Endlich sagte Samo:
»Ihr überschätzt mich! Ich bin nur der zweitgeborene Sohn des sorbski kral.«
Der Alte schüttelte den Kopf.
»Die, die sich um die Slawen kümmern, wissen, wer Ihr seid. Euer Bruder, der den slawisierten Germanennamen Juro trägt, ist nicht der Kral. Ihr heißet Samo, Ihr tragt den Namen, der als einziger aus dem ersten Schöpfungstag tschechischer Geschichte zu uns herüberleuchtet. Samo, der Slaw, der die Avaren schlug, an die sich Kaiser Karl vergeblich gewagt hatte, Samo, der die Tschechen heimisch machte in diesem Lande Gottes – Ihr könntet keinen schöneren Namen haben als diesen!«
»Der Name macht es nicht; obwohl ich zugebe, daß Ihr, der Ihr Krok heißt, gewiß mit dem alten Tschechenherzog Krok, dem Klugen und Gerechten, vieles gemeinsam habt.«
»Ich bin ein alter Mann, der nicht viel mehr für seine slawischen Brüder tun konnte, als daß er sein Leben lang um sie litt. Und der ein wenig sammelte. Freilich, es sind nicht die Schätze vom Karlstein.«
Der Alte wies auf seine Raritäten.
»Waret Ihr im Karlstein, Pán Samo?«
»Nein, ich komme erst zum zweitenmal in meinem Leben nach Böhmen.«
»Zürnet nicht, Herr, wenn ich sage, daß das nicht gut ist.«
»Ich weiß es. Ich hätte in Prag studieren sollen, nicht in dem deutschen Nest Breslau. Hier in Prag ist der Nährboden für starkes, echtes Volkstum. Aber ich war nicht unabhängig. So habe ich auch den Karlstein noch nicht gesehen.«
Das Auge des Alten strahlte.
»Der Karlstein! Vieles ist zerfallen, viele Edelsteine, die die Mauern bedeckten, sind ausgebrochen, die Fenster sind jetzt aus Glas, aber doch ist der Karlstein noch immer unsere Gralsburg, wie sie Meister Mathias von Arras schuf. Ich denke jetzt nicht an die Rittersäle, die großen Höfe; an eine der Kapellen denke ich, an die Kreuzkapelle. Und ich sehe, wie Karl IV. barfüßig in das Heiligtum tritt, nachdem vier eiserne Türen, neunzehn Schlösser geöffnet worden sind. Und die Kapelle erstrahlt im Glanz von eintausenddreihundertunddreißig Lichtern, indes der Probst die Messe zelebriert. Die vergoldeten Wände funkeln, die Jaspise und Karneole blitzen, durch die Halbedelsteinfenster fällt das Licht hinaus ins Land, bis an den Fluß hinunter. Rund herum, als wenn sie lebten, die großen Bildnisse von einhundertfünfundzwanzig Heiligen, die aus ihren reinen Augen nach dem Altar schauen; und im Hochaltar, hinter goldenen Gittern, die alte, heilige Wenzelskrone, die Insignien des Reichs. Karl, der Böhmenkönig, der als Kaiser das ganze deutsche Reich beherrscht, liegt hier auf den Knien, betet zu Gott um Schutz für die Krone, und draußen ruft der Wächter am Tor alle Stunden ins Tal: ›Bleibet der heiligen Burg fern, ihr Wanderer, sonst ereilt euch Unheil und Tod!‹«
Über der Kapelle prangt die Schrift:
»Herr Christus, mächtiger Herr, behüte du selbst diese Kleinodien bis zum letzten Tage[34]!«
»War das nicht eine große, schöne Zeit?«
Samo blickte den Alten, der so begeistert redete, versonnen[131] an. Sein Gesicht war finster. Der alte Krok erzählte nun von vielen anderen Schätzen der Burg Karlstein, von kirchlichen und weltlichen Reliquien kostbarer Art.
»Haltet Ihr diese Dinge für echt?« fragte Samo.
»Ja! Und wenn mir ein Zweifel kommt, jage ich ihn eilends davon. Zweifel macht arm und verödet das Herz; er ist der Bilderstürmer im Dom unserer Seele, dessen Altäre er entkleidet und von dessen Wänden er Glanz und Schönheit nimmt. Was dann übrigbleibt, ist kahle Armut, sind harte, nüchterne Trümmer. Und der rauhe Wind, den sie Wahrheit nennen, der dann schneidend durch die zerschlagenen Fenster fährt, kann uns nicht trösten, wenn der Tabernakel des Heiligsten beraubt ist und die ewigen Lampen verlöscht sind. Oh, Pán Samo, an alten Symbolen hängt der Gedanke, und der Gedanke stirbt mit dem Symbol; denn wir Menschen schauen aus leiblichen Augen.« Samo stand auf und ging ein paar Schritte hin und her. »Es mag schön sein, so zu glauben und zu träumen wie Ihr, Pán Krok. Ich kann es nicht. Ich habe ohne Neid von dem Glanz der Wenzelskrone gehört, ich habe mit Freude davon gehört; aber es ist doch bitter, wenn ich daran denke, wie bettelarm dagegen mein eigenes Volk war. Kennt Ihr die Sage vom Wendenkönig?«
»Ich kenne sie.«
»Seht, Pán Krok, der Wendenkönig konnte sich keine bleibende Burg bauen, keine goldene Kapelle errichten, wo er seine Schätze verwahrte, für ihn gab es noch keinen Pán Krystus, dessen Schützernamen er über seine Tür schreiben konnte. Als er in die entscheidende Schlacht zog, hatte er niemand, der seine Krone verwahrte; in den armen Sand der Heide mußte er sie vergraben, unter die Bäume des Waldes. Eine Grube zwischen Erde und Steinen war unsere Kronenstätte.«
Der Alte stand auf, und seine milden Augen ruhten liebevoll auf Samo.
»Gott selbst hat einen blauen Dom über Eure Krone gewölbt, Pán Samo, und seine Sterne werden nicht weniger hell gefunkelt haben als unsere Karneole. Und hat Euch nicht[132] Gott wunderbar erhalten? Unser Königtum ging verloren, das Eure blieb!«
»Es wird verloren sein für immer und ewig«, sagte Samo düster.
»Das darf nicht sein, Pán Samo, das darf nimmer geschehen! Ihr werdet es aufrechterhalten; denn Ihr müßt der Kral werden, geschehe auch, was wolle!«
Die milde Hoheit war von dem Alten gewichen, ein fanatischer Eifer sprühte aus seinen grauen Augen. –
»Die Deutschen verseuchen unser Volkstum«, fuhr Samo fort; »sorbisch geht der Bursch zum Militär, verdorben, deutsch kommt er zurück; der deutsche Gutsherr, der deutsche Krämer, der deutsche Gastwirt bohren sich wie die Maden in die slawische Frucht; unsere Gebildeten liegen in einem Halbschlummer; sie träumen noch ein wenig vom Slawentum, aber vor der Welt sind sie gehorsame Diener des deutschen Herrn. Die wendischen Geistlichen und Lehrer sterben aus; sie waren die besten und letzten Hüter unseres Volkstums, ihre Nachfolger sind Pioniere des Deutschtums. Das Volk kehrt sich vom heimischen Ackerbau ab, strebt in den Frondienst deutscher Fabriken. Es ist – es ist aus mit uns droben in der Lausitz!«
»Das ist ein düsteres Bild, das ist ein zu düsteres Bild!«
»Schreien möchte ich, Pán Krok, daß es so ist! Tausend Jahre lang hat unser sorbisches Volk der Lausitz seine slawische Art bewahrt mitten in Kampf und Not. Die Herren haben gewechselt, die Bedrücker sind geblieben, aber auch das Slawentum ist geblieben. Keine Gewalt, keine List, keine leibliche und geistige Aushungerung hat es vernichtet. Der arme, starke Sandwald hat es geschützt. Und welche Hoffnung blieb uns? Unsere Zahl schmolz zusammen. Wir konnten nicht mehr hoffen, ein eigenes Reich zu errichten, wie es die alte Sage verheißt.«
»Ihr müßt das hoffen, Pán Samo,« rief der Alte; »Ihr dürft diese Hoffnung im Herzen des Volkes nicht untergehen lassen. Man darf einen Stern nicht ableugnen, weil man nicht nach ihm greifen kann. Genug, wenn er leuchtet. Der felsenfeste Glaube an die große Zukunft muß dem Volk erhalten[133] bleiben. Ohne großes Ziel keine Religion, kein aufstrebendes Volkstum, nicht einmal irgendein gutes Einzelwerk!«
Samo zuckte die Achseln.
»Wir müssen uns an die realen Verhältnisse halten. Was zu tun ist und immer zu tun war, ist das eine: das Slawentum in der Lausitz zu erhalten, bis die deutsche Kluft, die zwischen uns und den Tschechen liegt, überbrückt ist, mit einem Wort, das Wendentum zu konservieren, bis das deutsche Nordböhmen slawisiert ist und wir Lausitzer Sorben unmittelbaren territorialen Anschluß an die böhmischen Tschechen haben.«
»Und das kommt doch! Das kommt doch!« rief der alte Krok begeistert. »Tausend Jahre habt ihr ausgehalten, wollt ihr in letzter Stunde unterliegen, da der Sieg so nahe ist? Ja, ihr seid auf einem gefährlichen, auf dem bedrohtesten Vorposten; aber, ihr Brüder, ihr seht doch, daß euch die siegreiche Hauptarmee Stunde um Stunde näherkommt!«
Samo entgegnete finster:
»Die Pflicht erkenne ich so wie Ihr, Pán Krok. Aber die Verhältnisse liegen so, wie ich Euch sagte. Und es fehlen uns die stolzen Erinnerungen, die großen Symbole. Was wir davon haben, wird angezweifelt, soll vernichtet werden.«
»Laßt nur das nicht geschehen, nur das nicht, Pán Samo! Nur nicht an die Tradition tasten! Ich muß noch einmal von ihrem unermeßlichen Wert reden. Gestattet, daß ich in einem Gleichnis spreche. Seht, da war eine Edelfamilie, die hegte als großen Schatz einen alten, goldenen Ring. Den Ring, so erzählte die Familiengeschichte, habe ein Ahn von einem edlen Moslem erhalten, in dessen Gefangenschaft er zur Zeit der Kreuzzüge geraten war. Der Ahn war von so herrlicher, edler Art, er war in allen Dingen von so bezwingender Menschlichkeit, daß er das Herz seines Kerkermeisters gewann und dieser ihm eines Tages die Freiheit schenkte und ihm den Ring mitgab mit den Worten: »Denke meiner in deiner Heimat, du bewunderungswürdiger Mann, gönne mir ferner deine Freundschaft, die ich ehren werde bis zu meinem letzten Tage.« Und in der[134] Familie wurde der Ring geachtet und geliebt. Der Vater hielt ihn dem Kinde aufs Haupt, wenn es getauft wurde; der Jüngling gelobte bei dem Ringe, brav und edel zu sein, ehe er in die Welt ging; die Jungfrau bekam ihn bei der Trauung an den Finger gesteckt; der Sterbende trug ihn an der Hand, wenn er sie zum letztenmal um Erbarmen zu Gott aufhob. – – Da erschien eines Tages ein Mann, der sagte, er sei ein Gelehrter, prüfte das Kleinod und wies nach, der Ring stamme gar nicht aus der Zeit der Kreuzzüge, er sei aus einem späteren Jahrhundert und offenbar fränkische Arbeit. Und er ging davon mit stolzgeblähter Brust und dem eitlen Gedanken, er habe diesen Leuten die historische Wahrheit gebracht. – Wißt Ihr, Pán Samo, daß dieser Mann ein Verbrecher war? Was war der Unbekannte, der das Symbol erfand und ihm durch einen tiefen Gedanken eine Wundermacht verlieh, die durch viele Generationen wirkte, doch für ein besserer Mensch als dieser Aufklärer!«
Samo sagte dazu nicht »Ja« und nicht »Nein«. Er schwieg eine Weile, dann aber sagte er mit gepreßter Stimme:
»Und mein Bruder Juro wird den Sorben ihren goldenen Ring entwerten.«
»Das darf er nicht!« rief der Alte vor Zorn bebend. »Eher sei er geächtet! Eher werde er getötet! Ihr müßt ihm, Pán Samo, mit allen Mitteln entgegenstehen!«
»Das werde ich!« sagte Samo und reichte dem alten Krok die Hand.
Die ganze Nacht saß Samo mit seinem Freunde Bohuslaw beim alten Krok. Die betagte Wirtschafterin hatte so köstlichen Wein gebracht, wie Samo noch nie zuvor getrunken hatte. So war auch er mitteilsamer geworden und hatte von seinen letzten Erlebnissen im wendischen Vaterhause erzählt. Der kluge Alte hörte ihm mit glühendem Interesse zu, und so wie seine Zuneigung für den alten Hanzo, für Hanka, vor allem aber für Samo selbst wuchs, so loderte sein Haß auf gegen[135] Juro, den »Renegaten«. Bis in die Einzelheiten mußte Samo erzählen, selbst seine Unterredungen mit der alten Wičaz verschwieg er nicht.
Später zeigte und erläuterte Krok einen großen Teil seiner Sammlungen. Er tat es mit dem Feuereifer des überzeugten Slawen, aber auch mit der strahlenden Freude des erfolgreichen Sammlers, dem die Eitelkeit nicht fremd ist.
Oh, es war ein hoher Genuß für die beiden jungen Männer, den Worten des begeisterten Alten zu lauschen, der an oft unscheinbaren Dingen in leuchtenden Einzelbildern böhmische Geschichte entwickelte. Andenken aus der Zeit der Kämpfe des Christentums und Heidentums; ein Pilgerstecken, den der heilige Cyrillus trug, der große Heilige, große Held, große Gelehrte, der Moses der Slawen; das Hufeisen, das das Roß Swatopluks von Mähren verlor, als er vor den Böhmen flüchten mußte; ein Gürtel der gottlosen Königin Drahomira, die von der Erde verschlungen wurde; Kriegstrophäen aus den Kämpfen mit den Polen und Ungarn; eine Pergamentschrift des ersten böhmischen Chronisten Cosmas; ein Stein aus dem Schwertgriff des unglücklichen Ottokar, der im Kampfe gegen den ersten Habsburger Krone und Leben verlor; ein Schild aus der ruhmreichen Zeit, da Heinrich von Kärnten verjagt wurde; ein Evangelienbuch der ketzerischen Beguinen; viel Andenken an den Vater Böhmens, Karl IV., darunter ein Teil der Biographie, die dieser Herrscher über sich selbst schrieb. Endlich vielerlei historische Andenken aus der Zeit der Hussitenkriege und des Dreißigjährigen Krieges: Waffen, Trommeln, Panzerhemden, Keulen, Pistolen, ein silberner Hussitenkelch, eine eigenhändige Handschrift Wallensteins; dazu viele Dinge von kulturhistorischem Wert: alte Stickereien, alte Gewebe, Glasmalereien, Goldschmiedearbeiten, bunt gemalte Abschriften aus Benediktinerklöstern, Möbel-, Haus- und Feldgeräte, Wappen, Münzen, Petschafte.
Alle diese Dinge waren in dem geräumigen Erkerzimmer und einem anstoßenden großen Raum untergebracht.
Samo staunte über den Reichtum.
»Mein Familiengut«, lächelte Krok. »Das andere ist in alle Winde; aber dieses, das Wertvollste, hat sich erhalten!«
Er brachte eine große Familienchronik heran. Die Eintragungen reichten in sehr alte Zeit zurück. Insonderheit war über Erwerb und Herkunft der historischen Reliquien genau und treulich berichtet.
»Meine Ahnen«, sagte Krok, »hatten Sinn für das Alte, Kostbare, Wesentliche. Mein Vater war ein lustiger Herr; er lebte mehr in Wien und Paris, als unserem Familiengut günstig war. So ging es verloren. Burg, Dorf, Wald, Feld mußten verkauft werden; mir, dem Sohn, blieb gerade genug, nach dem Tode meines Vaters das Leben zu fristen. Aber mir blieb auch diese Sammlung. Alles hat mein Vater preisgegeben, nur dieses da nicht. Er hat nicht so gehandelt wie der leichtsinnige Sigismund, der den Karlstein entweihte, dessen kostbare Steine er ausbrach und an Händler verkaufte, um Geld für sein Schlemmerleben zu haben, oder gar wie jener deutsche Braunschweiger, der die silbernen Apostelfiguren zu Talern einschmelzen ließ und dabei die lästerlichen Worte sprach: ›Gehet hin in alle Welt und predigt den Heiden!‹ Mein Vater hat mir keine andere Herrschaft hinterlassen als diese; aber ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch.«
Als die Zeiger der alten Uhr schon in die Morgenstunden hineinrückten, wurde Krok plötzlich schweigsam. Die Jünglinge wollten fortgehen, aber der Alte hinderte sie und wurde heftig, als sie abermals davon sprachen.
Lange und unverwandt blickte er oft von seinem Lehnstuhl aus auf Samo. Als draußen der Tag schon graute, sprach er:
»Jeder Mensch hütet ein Geheimnis in seinem Herzen. Ist es nur für ihn, so mag es sterben, wenn er stirbt; ist es aber für andere, dann muß der Mensch Erben seines Geheimnisses suchen. Ich bin alt, und eines Morgens, wenn der Tag graut, wird er mich tot finden bei diesen Reliquien, ich selbst eine Reliquie, das geringwertige Überbleibsel einer alten Zeit. Was Wissenswertes ist von diesen Dingen, die hier verwahrt sind, ist aufgeschrieben. Eines aber möchte ich in eure Herzen[137] schreiben, ihr edlen Jünglinge, und da soll es verwahrt sein für den Fall meines Todes.«
Der Alte stand auf und stellte sich ans Fenster. Das Licht des aufdämmernden Tages spielte blaß um seinen grauen Kopf. Und Krok sprach langsam und feierlich:
»Ehe ich euch mein Geheimnis überliefere, müssen eure Seelen mit meiner Seele rückwärts wandern den ganzen heißen, arbeitsreichen Tag der böhmischen Geschichte entlang bis zu der Stunde, da das herandämmernde Licht der beginnenden Tschechenherrschaft seine ersten Strahlen über das Land schickte, wie jetzt da draußen die Sonne über unser heiliges Prag. Samo, der Gewaltige, schlug die Avaren, Krok, der Gerechte, gab das erste Gesetz. Krok hatte drei weisheitsvolle Töchter. Als er zum Sterben kam, wußte er nicht, welcher der drei Töchter er das Reich vererben sollte. Und er warf das Los, und das Los fiel auf Libussa, die weiseste und machtvollste der Königstöchter. Libussa gründete die Stadt Prag und regierte klug und streng. Die Böhmen waren glücklich unter ihr, aber eines Tages verlangten sie, die Königin solle einen Gatten nehmen, der mit ihr regiere. Da sandte Libussa eine Reiterschar ab und befahl dieser: ›Wo ihr einen Mann findet, der von einem eisernen Tische ißt, so bringet ihn; er soll mein Gatte und soll König sein!‹ Der Reiterschar gab sie ihr eigenes Roß mit, und dieses Roß setzte sich an die Spitze der Schar und schlug den Weg ein gen Staditz.
Es war aber an die fünfzigtausend Schritt von Prag, da saß ein Bauer auf dem Felde. Es war just ein schöner Frühlingsmorgen; die Lerchen sangen, das Gras und die junge Erde dufteten. Der Bauer saß lachend auf dem Felde und aß sein Frühstück von der blanken Pflugschar. Da wieherte das Königsroß und fiel auf die Knie, und alle Rosse knieten nieder, und die Reiter stiegen ab und knieten nieder und riefen dem Bauern zu: ›Du bist unser König!‹ Der Bauer, welcher Przemisl hieß, stand auf, ließ Acker und Pflug im Stich, zog nach Prag und wurde der Gatte der Königin. Libussa ließ ihm eine silberne Krone machen; sie selbst aber trug eine goldene[138] Krone, denn sie war an Macht über ihm. Jahrhundertelang haben die Nachkommen von Przemisl und Libussa die Schicksale Böhmens gelenkt.
Libussa aber hatte eine Schar von Dienerinnen sorgsam erzogen, und die Schönste und Klügste von ihnen, Wlasta, empörte sich gegen die Herrin, gewann ein Heer von Frauen und führte den Mägdekrieg. Libussa flüchtete bis ins Riesengebirge, und weil sie verfolgt wurde, warf sie ihre goldene Krone in den Zackenfluß, der in donnerndem Fall von den Bergen springt, und unter diesem Wasserfall liegt die Krone noch jetzt. –
Przemisl kehrte in seine Heimat zurück. Die Mägde suchten nach seiner silbernen Krone, aber sie fanden sie nimmer.« –
Krok schwieg. Er senkte das Haupt und stand in tiefem Nachdenken da. Dann sagte er:
»Wartet ein Weilchen, bis ich wiederkomme!«
Er verschwand durch die Tür und kam nach nicht langer Zeit zurück.
»Kommt.«
Sie gingen durch den Nebenraum, der auch mit Altertümern angefüllt war, und kamen an eine eiserne Tür, die jetzt sichtbar war, weil Krok eine große, alte Stickerei an dieser Stelle fortgenommen hatte. Krok öffnete die Tür, und die Jünglinge blickten in eine Kapelle.
Eine große Anzahl von Kerzen brannte, in drei silbernen Lampen glimmte rotes Licht, ein Altar stand in einer Nische, darauf war ein Tabernakel. Rundum die Wände waren mit Stickereien und seidenen Tüchern behangen, ein großer Teppich bedeckte den Fußboden. Viele Bilder schmückten die Wände. Gestalten aus der Heiligen- und der profanen Geschichte Böhmens: Wenzeslaus mit der Fahne, Cyrillus und Methodius, die heilige Ludmilla, Johann von Nepomuk, dann das große Bild Karls IV., ein Bild von Libussa und von Przemisl am Pflug. Diese Gemälde hingen über dem Altar; in der Mitte war ein altes, eisernes Kreuz. An den Seitenwänden die Taufe Borzivois, die Gründung des Bistums Prag durch Boleslaw[139] den Frommen, Herzog Udalrich bei der Kaiserwahl Konrads II.; die deutschen Kaiser Heinrich IV. und Barbarossa, die Böhmen die Königswürde verliehen; einzelne hervorragende Äbte berühmter Orden, die sich um das Land verdient machten; mehrere Bilder des großen Ottokar: als Herr in Kärnten, als Gründer der Stadt Königsberg, sein Tod auf dem Marchfeld; dann die Ermordung Wenzels III., des letzten Przemisliden. Aus der späteren Geschichte hauptsächlich wieder Erinnerungen an Karl IV.: die Moldaubrücke, der Karlstein, die Unterwerfung von Brandenburg und Schlesien, die slawische Universität. Wallensteins Bildnis fehlt nicht, auch einige Dichter und Redner sind vertreten: der Psalmensänger Streyc, Kotwa, der »böhmische Cicero«, der Hofpoet Simon Lomnicky.
Ganz nahe der Tür, halb im Dunkel hängen einige Bilder aus der Hussitenzeit: Jan Hus, Ziska, Prokop, Wecleff, Amos Comenius, der Brüderbischof. –
Manche der Bilder haben einen beträchtlichen Wert, manche sind billige Reproduktionen, nur ihres Inhalts, nicht ihres Kunstwertes wegen da. –
Hoch an der Altarwand, dicht unter der Decke, sind die Worte geschrieben: »Pán Krystus, neymnocnegssj pán, racz techto klenotuw, ostrzjhati sam, až do neypos ednegssho dne!«
Der alte Krok blieb mit seinen Begleitern dicht an der Tür stehen. Die jungen Männer waren so überrascht, daß sie kein Wort zu sprechen vermochten. Auch Krok stand stumm neben ihnen. Erst nach langer Zeit sagte er in tiefer Ergriffenheit, leise flüsternd:
»Mein Karlstein! Meine Kreuzkapelle!«
Und er wies auf die Schrift über dem Altar: »Pán Krystus!«
»Herr Krystus, mächtigster Herr, behüte du selbst diese Kleinodien bis zum letzten Tage!«
»Das ist das Wort vom Karlstein,« sagte Krok, »das Wort, das über meiner Wohnung und über meinem ganzen Leben schwebt.«
Und Tränen rannen in seinen grauen Bart.
Scheu gingen die Jünglinge die Wände entlang, betrachteten[140] die Bilder. Der Alte schritt zum Altar, kniete nieder und preßte die Hände vors Gesicht, wie zu inbrünstigem Gebet. Auch Bohuslaw kniete nieder. Samo stand mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf.
Da stieg der alte Krok die Stufen des Altars hinauf und öffnete den Tabernakel. – –
In dem Tabernakel lag auf einem seidenen Kissen eine alte silberne Krone …
Und Krok wandte sich mit der Krone um. Mit bewegter, tränenerstickter Stimme sagte er:
»Seht da, das Kleinod! Das ist die silberne Krone Przemisls I., des Königs vom Pflug. Das ist die Urväterkrone unseres böhmischen Volkes!«
Die Hände des Alten zitterten so, daß er die Krone auf den Altar niederlegen mußte. Langsam beruhigte er sich:
»Zweifelt nicht an der Krone! Sie ist die echte, heilige Krone Przemisls! Ehrwürdige Urkunden ehrwürdiger Männer bestätigen sie bis in die älteste Zeit.«
Bohuslaw trat einige Schritte näher. Samo stand regungslos wie eine Statue.
Da rief ihm der alte Krok zu:
»Pán Samo, kommt an den Altar.«
Mit schweren Schritten gehorchte ihm Samo.
»Pán Samo, zukünftiger Kral der Lausitzer Sorben, ich begrüße Euch an dieser heiligen Stätte. Bin ich auch kein geweihter Diener Gottes, so habe ich doch die Weihe einer Familie, die von der Vorsehung ausersehen war, durch Jahrhunderte dieses Heiligtum zu hüten und zu hegen. Samo, ich setze Euch diese Krone aufs Haupt, nicht daß ich Euch zum König von Böhmen kröne, sondern als ein Unterpfand Eurer eigenen zukünftigen Würde.«
Und Krok setzte Samo die Krone aufs Haupt. Das alte Silber berührte kühl die heiße Stirn des Mannes. Ein paar Herzschläge lang stand Samo so im königlichen Schmuck; dann ergriff er die Krone, küßte sie, legte sie auf den Altar und ging eilends aus der Kapelle.
Krok und Bohuslaw fanden ihn bald darauf im vordersten Zimmer fassungslos in einem Lehnstuhl sitzen.
»Pán Samo,« sagte Krok, »nicht umsonst weihte ich Euch in das größte Geheimnis meines Lebens ein. Alles hat einen Sinn, und alles geht darauf hin, unserem Slawentum zu dienen. Pán Samo, vergeßt dieses nicht: Symbole sind nötig; Gedanken, vom Symbol losgelöst, verfliegen im Wind. Kommt noch einmal allein zu mir, ehe Ihr abreiset; ich habe Euch etwas zu sagen, das mir in dieser Nacht eingefallen ist.«
Spätherbst droben im Wendenlande.
Die letzten Sommerfäden nahm der Wind; der letzte Singvogel zog fort.
Irgendwo in der Welt gibt es sonnige, glänzende Fluren, irgendwo gibt es laute, große Städte.
Das muß weit von hier sein. Denn hier wohnt die graue Einsamkeit. Spät dämmert der müde Tag, früh geht er zur Rüste. Oft liegt der Waldweg die ganze Woche einsam. Kein Wanderer kommt daher.
Und doch wäre es ein Weg, wo einer den Frieden suchen könnte, wo müde Augen ruhen und wilde Herzen stille werden könnten.
Hier wandeln in den tiefen Wäldern, wie im Traum hinhören auf die knisternden Sagen der Föhren, am alten Heidenhügel früherer Zeit nachdenken, an die Lutchen denken, die Zwergmännlein, die jetzt selbst zur Mittagszeit die Zipfelkappe fest über die dicken Köpfe ziehen und bei sinkender Sonne fröstelnd in ihr warmes Haus flüchten tief unter der Erde! O ja, das täte den klugen, unglücklichen Menschen draußen gut!
Nur wer eine wehe Reue im Herzen trägt, dürfte hierher nicht kommen; die Smjertniza könnte ihm begegnen. –
Drunten im Spreewald führte ein junger Bursch zur Abendzeit seinen Kahn heim. Ihm gegenüber saß seine einzige Schwester. Sie war von großer Schönheit; aber nun war sie[142] traurig und blaß und sah immer ins Wasser hinein, in dem die letzten bunten Blätter des Waldes schwammen.
Da fing der Bursche an zu singen:
»Sla je holčka po wodu …«
Das Mädchen sah den Bruder bittend an, er möge schweigen; aber er sang das Lied:
Der Bursche schaute finster auf den Boden des Kahnes, das Mädchen saß gebrochen vor ihm und hatte die Hände vor dem Gesicht.
Die Abendglocke läutet. Oh, der Küster weiß nicht, daß der Bursch auf den Kirchturm geschlichen ist und in die Glocke den Namen des Mannes, der seiner Schwester Glück und Ehre nahm, geschrieben hat, dort, wo der Klöpfel anschlägt. Nun geht mit jedem Glockenschlag der Name des Schelmen über alles Land und hinauf zum Himmel, und wenn Liza stirbt und die Glocke läutet, dann wird durch ihr Wimmern der Name des Verführers an Gottes Ohr klingen.
Nicht überall ist es zur Herbstzeit so trüb im Wendenlande.
Droben im Oberland der alte Weber Domasch ist ein friedlicher Mann. Vor seinem Häuschen steht ein wilder Apfelbaum,[143] der einzige Baum, den er besitzt. Domasch läßt die Holzäpfel immer bis tief in den November hängen. Dann verlieren sie zwar etwas an Saft, sagt er, aber sie werden mürber und lassen sich besser beißen. Nun ist er mit seinem Weibe auf den Apfelbaum gekrochen. Die beiden Alten hocken sich auf zwei Ästen gegenüber.
»Eine schöne Ernte!« lächelt der Weber.
»Eine Gottesernte!« sagt das Weiblein.
»Wenn's nur der Küster nicht zu kurz macht, daß wir sie gut herunterkriegen. Siehst du, Mutter, weil wir unsere Äpfel nur immer beim Abendläuten geschüttelt haben, deshalb hat uns auch Gott alle Jahre so reichlich beschert.«
»Ja, so ist es!« sagt die Frau.
Nun beginnt die Glocke zu läuten, und nun fangen die beiden an zu schütteln. Die verrunzelten kleinen Äpflein prasseln zur Erde; die beiden verrunzelten Alten schütteln, so viel sie können. Denn der Küster läutet gewöhnlich nicht lange, und wenn der letzte Ton verhallt, muß die Arbeit beendet sein. Deshalb herrscht eine ganz bestimmte Strategie, eine genaue Einteilung; jedes von den zweien weiß, welche Äste es zu schütteln hat.
Oh, wie das prasselt! Hastig steigen Mann und Frau von einem Ast zum andern und schütteln mit ihren dünnen Armen. Endlich sagt der Alte:
»Hör auf, Mutter, für die Eichhörnchen muß auch noch was drauf bleiben; der Mensch soll nicht genußsüchtig sein und nicht alles für sich haben wollen.«
Und sie klettern die Äste und die kurze Leiter hinab. Noch immer tönt die Glocke.
»Der Küster macht's aber heute lang«, sagt die Frau.
»Ja,« lächelt der Mann schlau, »das weißt du gar nicht: Ich hab' ihm heut früh gesagt, daß ich Äpfel schütteln will, und hab' ihn einmal schnupfen lassen.«
Darauf lesen die beiden glücklich ihren sauren, armen Herbstsegen zusammen, aber in ihrer goldenen Zufriedenheit finden sie ihn süß und reich.
»Es hat schon zu Abend geläutet«, sagte der alte Knecht Kito, als er zu Hanka in die Stube trat.
Das Mädchen, das ganz allein war, saß am Tisch bei der Lampe und war mit einer Näharbeit beschäftigt.
»Ja, Kito, ich habe es gehört, wenn wir auch schon die Doppelfenster haben.«
»Es ist erst fünf, es wird jetzt zeitig Abend.«
»Ja, bis zur pšaza[35] sind noch zwei Stunden Zeit. Füttern die Mägde schon?«
»Sie haben angefangen. Deine Spinnstube ist gut, Hanka. Du bist die einzige Kantorka hier, die keine schlechten Lieder duldet.«
Das Mädchen errötete.
»Ich mag solche Lieder nicht leiden; ich habe sie auch zu Hause nicht zugegeben.«
Der Alte nickte.
»Ja, es geschieht an den Spinnabenden mancherlei. Voriges Jahr sind drei Mädchen aus unserem Dorf unglücklich geworden. Eine hat noch geheiratet, die anderen …«
Er machte eine bedauernde Handbewegung.
»Wie ich noch jung war,« fuhr er fort, »da hab' ich auch solche Schelmenlieder gesungen. O ja – was für welche! Wenn man dann alt ist, gefällt einem das nicht mehr. Aber du bist noch jung, Hanka, jung und hübsch!«
»Was soll das bedeuten?« sagte Hanka und sah verwundert auf. Der Alte stand auf, redete hin und her, dies und das, von der Wirtschaft allerlei.
»Du hast etwas auf dem Herzen, du willst etwas«, sagte Hanka.
Kito wandte sich ab und stopfte seine Tabakspfeife. Endlich setzte er sich wieder. Aber er richtete die Augen starr auf die Tischplatte.
»Hanka, du kennst die Bibel. Du weißt, daß Abraham[145] seinen Knecht Elieser ausgesandt hat, um für seinen Sohn Isaak eine Frau zu suchen. Elieser war nur ein Knecht, aber er bekam doch dieses wichtige Amt.«
»Wo soll das hinaus?«
Kito zündete sich aufs neue seine Pfeife an, stand wieder auf und spuckte dreimal hinter den Ofen, ehe er weitere Worte fand.
»Ich sagte dir, Hanka, daß ich auch einmal jung war. Ich habe bei der kremuša[36] drei Tage lang gegessen und getrunken und drei Nächte lang mit den Mädeln getanzt. Ja, das habe ich! Ich hab' bei der ›verheirateten Männerkirmes‹ als lediger Bursch auf einem fremden Dorf getanzt, und es ist nicht herausgekommen. Jawohl, das war ich! Ich war der Anführer der ›Wurstbrüder‹, und wehe dem Bauern oder der Schenke, wo wir nicht unseren Speck bekommen hätten, wenn wir ankamen! Jawohl, das war ich! Und weißt du, wer ich noch war? Der Jan beim Johannisfest war ich! Der tollste Reiter! Bei den Husaren habe ich gedient, und wenn ich der Jan war, da hatte ich aus Birkenrinde eine Larve[37] vorm Gesicht und den ganzen Buckel voll Blumengirlanden – ei ja, schön war ich! Über und über Blumen, bis zum Hute! Und dann aufs beste Pferd! Ohne Sattel und ohne Zaum! Wie der wilde Reiter durchs Dorf! Beim letzten Hause hat sich das ganze Dorf aufgestellt. Sie machen eine Kette. Sie woll'n mich aufhalten. Ich aber wie der Blitz durch die Kette! Sie schreien, sie laufen. Ich kehre blitzschnell um. Vom Pferd runter. Alle Weiber fall'n über mich her. Jede will 'ne Blume. Die verheirateten, daß sie starke Kinder kriegen, die ledigen, daß sie 'n Mann kriegen. Und ich immer rechts und links mit beiden Armen und Händen das ganze Weibsvolk abgestreift. Und hinauf auf die Linde geklettert bis zum obersten Aste. Und von oben eine Predigt gehalten. Dunderwetter, eine Predigt gehalten! Ich bin ein Prediger, hab' ich gesagt! Denkt ihr, ein Prediger wie der[146] invalide Unteroffizier, den der alte Fritz den Wenden schickte? Drei Jahre lang predigte dieser Mann alle Sonntage dieselbe Predigt, die er sich auswendig gelernt hatte. Und als drei Jahre um waren, gingen die Wenden zum alten Fritz und sagten, sie wollten einen anderen Prediger, weil der Alte bloß immerfort dasselbe predigte. Nun, was predigt er denn? fragte der alte Fritz. Ja, da kratzten sie sich auf dem Kopfe und wußten nichts. Nun, sagte da der alte Fritz, so soll nur der Mann noch ruhig seine zehn Jahre weiterpredigen! Dunderlitzen, so ein Prediger war ich nicht! Ich hab' von meiner Linde gepredigt, daß sie unten rot und blau wurden, daß sie manchmal schrien: ›Pfui Deibel!‹ Die Frauvölker, die Kerle, der Schulze, die Schöffen, ja sogar die Frau Pastorin, alle kriegten was ans Bein. Rot und blau wurden sie. ›Hurra!‹ schrien die einen, ›Haut ihn!‹ die andern. Ja, so ein Prediger war ich! Bis ich mich selbst von der Linde herunterpredigte. Dunderlitzen, wie ich gerade eine Kraftstelle sage, daß die eine Hälfte lacht und die andere Hälfte flucht, fall' ich runter von meinem blätterigen Predigtstuhl und breche mir die Hüfte. Und wenn man die Hüfte gebrochen hat, sage ich dir, ist es mit dem Reiten und kräftigen Predigen vorbei.«
Kito seufzte schwer und trommelte mit seinen stumpfen, dicken Fingern auf dem Tisch. Hanka sah ihn lächelnd an. »Hanka, denke nicht an den palenc[38]. Drei Gläschen habe ich getrunken; aber drei Gläschen sind nötig zu dem, was ich vorhab'.«
»Ja, was hast du denn eigentlich vor, alter Kito?«
Kito stand auf, stieß mit dem Mittelfinger dreimal in die abermals erloschene Pfeife, ging zum Feuer, um einen neuen Span zu entzünden, spuckte dreimal hinter den Ofen und sagte dann passend:
»He, was ich vorhab'? Wenn das so glatt rauszukriegen wäre, da säß ich doch nicht so lange hier und versäumte bei einem Mädel dummerweise meine Zeit!«
Er setzte sich wieder an den Tisch.
»Ja, Hanka, das Lied ist auf mich gemacht:
Herr, meine Zeit, was habe ich als Junge alles angerichtet! Es ist schwer zu glauben. Da muß ich dir einen Witz erzählen, Hanka! Es waren einmal drei Jungen, die hatten einen Käse gefunden. Und weil sie nicht einig wurden, wem der Käse gehören sollte, so wollten sie wetten. Und sie machten es also aus: Wer von uns dreien die größte Lüge sagt, der kriegt den Käse! Sie logen nun die Sterne vom Himmel herunter, aber sie konnten nicht einig werden, wer den Käse bekommen sollte. Da kam der Herr Pastor gerade vorbei und fragte die Jungen aus, um was sie sich so händelten. Und da er alles angehört hatte, machte er die Stirn runzelig und sagte: ›Pfui, ihr Lügner! Als ich ein Junge war, wie ihr, hab' ich nie gelogen!‹ Und richtig – so ein frecher Schlingel gibt ihm den Käse und sagt: ›Sie haben gewonnen, Herr Pastor.‹ Ja, und diese Range war ich!«
Hanka sah überrascht auf.
»Ih, du bist ja ein kurioser Kauz gewesen, Kito!«
Kito schüttelte melancholisch den Kopf.
»Kauz hin – Kauz her – es ist doch aus! Jetzt – jetzt lauert bloß die alte Wičaz, daß sie mir ihre Wanzen in den Sarg stecken kann. Aber ich werd' ihr was … Hanka, ich schlag' mit allen vieren aus, daß der ganze Sarg umkippt, wenn die alte Schraube mit ihrer wanzigen Federspule angerückt kommt.«
Hanka suchte ihn zu beruhigen.
»Ach, Kito, du bist noch rüstig. Du machst es noch länger als die Wičaz.«
Kito wehrte ab.
»Nein, nein! Was nutzt alles! Die Frau habe ich mit heiligem Gras angeräuchert, weil ich das so gehört habe, aber[148] genutzt hat es nichts. Siebzig Jahre laufe ich hier im Wendenland herum. Eigentliche Wunder habe ich wenig bemerkt. Den Vampyr habe ich manchmal gesehen – jawohl, aber nur, wenn ich lange in der Schenke gesessen hatte. Da hatte ich am nächsten Morgen blasse Lippen. Da hatte er mir das Blut ausgesaugt. Und oft bin ich geprellt worden. Wenn man nachts um zwölf Uhr auf der Wiese kleine Flämmchen brennen sieht, da brennt Geld. So hat es mir meine Großmutter erzählt. Da braucht man dann bloß sein Erspartes zwischen die Flämmchen zu werfen und fortzugehen. Am anderen Morgen hebt man einen Schatz. Ja, ich hab' mein Vierteljahreslohn unter die Flämmchen geworfen, und am anderen Morgen war alles futsch – der Schatz und der Lohn.«
»So hast du den Ort vergessen«, warf Hanka ein.
»Ort hin – Ort her! Ich bin auf meine alten Tage ungläubig geworden. Seit das Gras bei unserer guten Frau nichts geholfen hat, denk ich mir das meine. Und siehst du, der domjacy[40], der Juro, der glaubt auch nicht an solche Dinge und ist doch bald ein Pán doctor.«
»Schlimm genug, daß er nichts glaubt«, sagte Hanka.
»Mädchen, der Juro ist der allergrößte Prachtkerl. Das war er schon als Kind. Da war ich doch sozusagen sein Erzieher. Offen und ehrlich ist er, ein bißchen Hitzkopf und Eigensinn, aber auch gutherzig. Und ein richtiger Kerl. Der könnte den Jan beim Johannisfest machen!«
Hanka seufzte tief und schwer. Kito lachte plötzlich über sich selbst.
»Das heißt, ich bin schon wirklich der allerdümmste Kerl auf Gottes weiter Welt. Red' ich nicht dahier gegen mein eigenes Maul?«
Er schwieg. Dann brachte er stoßweise heraus:
»Hanka, schenke mir einen Branntwein ein!«
Das Mädchen war ganz verwundert über den Alten.
»War es das, was du auf dem Herzen hattest?«
»Nein, Hanka, nein! Der Branntwein ist bloß dazu, daß ich es leichter herauskriege, was ich zu sagen habe. Ich versitz' dahier sonst bloß unnütz meine Zeit.«
Hanka schloß einen Wandschrank auf, goß ein Glas Branntwein ein, nippte der Sitte gemäß erst selbst davon und stellte es dann vor den Alten.
»Ich sehe dich, Hanka«, sagte der und trank ihr zu.
»Nun komm aber auf das, was du vorhast«, sagte das Mädchen.
»Jawohl, jawohl! Es ist gar nicht so einfach, wie du wohl bemerkt hast.«
Er zündete sich erst seine Pfeife wieder an und spuckte hinter den Ofen.
»Also, Hanka, du kennst die Geschichte vom Elieser. Er war nur ein Knecht und hatte doch ein wichtiges Amt: er sollte für den Sohn seines Herrn die Braut werben. Als ich noch jung war, bin ich auch oft Brautwerber gewesen. Du kennst das ja. Im Oberlande heißt man's družba, im Niederlande pobratz (Brautwerber). Na, du kannst glauben, Hanka, es ist nicht so einfach, wenn man für einen anderen auf die Brautschau geht. Man kann nicht mit der Tür ins Haus fallen. Man muß erst über alles mögliche andere schwatzen, und dann muß man politisch und fein und sachte hintenrum mit seiner Absicht rausrücken. Und man geht immer so um die Abenddämmerung. Da fällt's nicht so auf, wenn man rausgeschmissen wird.«
Hanka stand auf. Ganz erregt sagte sie:
»Ich frag' dich jetzt, Kito, was soll das ganze Gerede bedeuten?«
»Immer sachte, Jungfer, immer sachte, man kann doch nichts überstürzen. Neunmal bin ich Freiwerber und Zurater gewesen in meinem Leben; siebenmal haben sie mich rausgeschmissen, aber zweimal ist was aus der Sache geworden. Nun, man hat seine Erfahrungen!«
»Kito, jetzt sprichst du endlich oder ich gehe hinaus!«
Da stand Kito erschrocken auf, und sein Gesicht wurde plötzlich sehr ernst, und er faltete die Hände auf dem Tische.[150] Er stockte noch eine Minute lang, dann sagte er mit bewegter Stimme:
»Wie der Elieser um die Rebekka geworben hat, so werbe ich in Gottes Namen um dich, Jungfrau Hanka, für unseren Gutssohn Samo.«
Hanka saß regungslos hinter dem Tisch. Sie schluckte ein paarmal, und ihr Gesicht war bleich.
»Bist du – bist du toll?« fragte sie stockend.
»Es ist heiliger Gottesernst, Hanka«, entgegnete der Knecht.
Er setzte sich die Brille auf, zog einen Brief aus der Tasche und las mit feierlicher Stimme:
Breslau, am 20. November 1860.
Mein lieber alter Freund Kito!
Nach dem alten, schönen Brauche unseres lieben sorbischen Volkes bitte ich dich, daß du der Freiwerber für mich bist bei unserer ehrbaren Jungfrau Hanka. Wir sind von derselben Abstammung und gehören zueinander, nachdem mein Bruder Juro ein Deutscher geworden ist und auch ein deutsches Mädchen heiraten wird. Aber ich wähle auch die Hanka, weil ich sie von Herzen lieb habe, weil sie ein braves sorbisches Mädchen ist. Du sollst erst mit meinem Vater sprechen und dann für mich werben. Ich werde dir stets dankbar sein. Gott möge dir helfen!
Samo.
Dem Alten rannen die Tränen übers Gesicht, wie er so las. Ohne auf das fassungslose Mädchen zu achten, sprach er dann:
»Ein braver Bursch! Ich bin bloß ein Knecht, aber er nennt mich ›mein alter Freund‹. Er hält sich an die alte Sitte. Das werden ihm alle Leute hoch anrechnen, wenn sie es hören werden.«
Hanka stand auf.
»Wo willst du hin, Hanka?«
»Hinaus!«
»Und gibst du mir keine Antwort?«
Sie war schon draußen. Der alte Kito steckte seinen Brief ein. Betrübt senkte er den weißen Kopf.
»Und ich glaubte, ich hätte es so lustig, so ausführlich und so gut gemacht!«
Die Spinngesellschaft war abgesagt worden. Die Gutstochter Hanka war krank.
Fünf Tage schon war das Mädchen allein in ihrer Stube. Eine Magd brachte ihr Essen, das fast immer unberührt zurückkam. Tee wollte die Kranke nicht trinken; alle Hilfsmittel verschmähte sie.
Am sechsten Tage schlich sich die alte Wičaz bei Hanka ein. Das Mädchen wollte anfangs nichts von ihr wissen; aber schon nach einer Viertelstunde lagen die Wahrsagekarten ausgebreitet auf dem Tisch. Hanka sah mit großen Augen vom Bett her auf die Alte. Ihr Gesicht war in der kurzen Zeit blaß und schmal geworden.
»Wuše stupaš, dale widžiš«, begann die Alte; »je höher du steigst, je weiter du siehst.«
Dann machte sie eine lange Pause, bohrte die grauen Augen in die Kartenbilder, fuhr mit den gelben, knochigen Fingern darüber, zuckte mit den Lippen.
Dann sprach sie:
»Ich sehe zwei junge Adler und ein junges Adlerweibchen. Der eine Adler kommt an das Nest des Weibchens, kreischt es an und hackt es mit seinem scharfen Schnabel, daß es blutet. Dann fliegt er fort und paart sich mit einer Krähe. Und sie fliegen bis an den Lóbjofluß. Da werden sie erschossen und sinken ins Wasser. Der andere Adler gewinnt das Adlerweibchen, und sie bauen sich ein gutes Nest auf dem höchsten Baume und verjagen alle Krähen. Wuše stupaš, dale widžiš. Je höher du steigst, je weiter du siehst.«
Hanka hörte der Alten staunend zu.
»Woher weißt du das?«
»Ich lese es in den Karten, und mehr kann ich nicht sagen.«
Die Wičaz stand auf und ließ Hanka allein. – –
Am Nachmittag desselben Tages kam der alte Scholta zu Hanka.
»Kannst du es nicht über dich bringen?« fragte er.
Hanka schlug die Hände vors Gesicht.
»Juro ist für uns verloren,« sagte der Alte traurig; »nicht bloß für dich, auch für mich, auch für uns alle. Was er will, kann ich nie zugeben.«
Der Scholta stand am Fenster und schaute in den herbstlichen Großgarten.
»Ich brauch' dich so notwendig hier wie das tägliche Brot«, sagte er nach einer Weile. »Das weißt du wohl, Hanka. Wo keine Frau im Hof, da ist der Böse im Hof. Ich müßte aber doch jetzt sagen: ›Fahr wieder heim, Hanka!‹ Doch ich schäme mich, ich schäme mich!«
Er legte den Kopf an die Fensterscheiben. Das Mädchen begann bitterlich zu schluchzen. Der alte Hanzo fuhr fort:
»Meine selige Frau hat es mit deinen Eltern ausgemacht, die Leute hier auf dem Hofe wissen es; ich mag dich nun so nicht heimgehen lassen.«
Da richtete sich das Mädchen halb auf.
»Ja, es wär' – es wäre eine Schande für mich! Sagt mir, sagt mir das eine in Gottes Wahrheit: will mich Samo bloß aus Barmherzigkeit nehmen, weil mich Juro nicht mag?«
Da leuchteten die Augen des Alten auf.
»Nein, weil er dich gern hat, weil er dich lieb hat! Wer sollte dich auch nicht gern haben? Er hat es mir geschrieben, und er hat es mir schon gesagt, als er noch hier war.«
Drei Minuten wohl lag das Mädchen mit geschlossenen Augen, dann sagte es leise:
»Ich werde dankbar sein und den Samo nehmen.«
Hanzo ergriff freudig ihre beiden Hände und küßte Hanka dreimal auf die Stirn.
Dann stand er aufrecht und feierlich da, und er, der sonst scheu und schweigsam war, sprach:
»Hanka, wenn du einen Sohn bekommst, wird er der Herr auf diesem Hofe und der Kral der Wenden sein! Wenn auch Juro darauf vergißt, wir anderen wollen es nicht vergessen, daß du in Wahrheit eine Königstochter bist, aus älterem Geschlecht als manche Prinzessin. Darum sollst du den Kopf hochtragen und nicht mehr weinen.«
»Nan!«[41]
Das eine Wort sagte das Mädchen und schlang die Arme um den Hals des Alten …
Hanzo stieg glücklich in den Hof hinab. Unten traf er seinen Altknecht Kito.
Er drückte ihm die Hand und sagte:
»Kito, sag den Leuten, nächsten Sonntag ist noch eine kleine Kirmes. Tanzen dürfen sie hier im Hof nicht, weil Trauerjahr ist, aber im Kretscham werde ich alles bezahlen.«
Kito erschrak aufs heftigste und versuchte dann einen kleinen Freudensprung, der infolge seiner lahmen Hüfte mißriet.
»Hat sie – hat sie?«
»Ja, sie wird ihn nehmen! Du kannst es Samo schreiben, denn er hat dich zum Brautwerber gemacht.«
Kito ging freudetrunken über den Hof, wackelnd wie ein lahmer Enterich. Am Ziehbrunnen blieb er stehen.
»Zehnmal bin ich jetzt družba gewesen; siebenmal haben sie mich rausgeschmissen, dreimal ist es geglückt. Schade, daß ich schon so alt bin; ich könnte noch viel Gutes stiften.«
Zum Unglück kam die alte Wičaz daher. Kito, der sonst ihr erklärter Widersacher war, ging auf sie zu, erfaßte unversehens ihre rechte Hand, hob die Hand über ihren Kopf und drehte die Frau etliche Male blitzschnell um ihre Achse.
»Was fällt dir denn ein, du verrückter Kerl?« fragte die Alte schnaufend.
»Ach, ich wollte wieder mal mit einem jungen Mädchen serska reja[42] tanzen und sehe eben, daß ich mich vergriffen habe.«
Die Alte sah ihn neugierig forschend an und ging dann schimpfend davon. Kito aber begab sich nach dem Kretscham, der gleichzeitig das Kaufhaus des Dorfes war, trank erst drei Gläser Schnaps, kaufte dann Tinte, Feder und Papier und schrieb am selben Abend noch an Samo folgenden Bericht:
Lieber Freund Samo!
Ich habe es mir ehrenvoll entledigt. Drei Gläser palenc hatte ich getrunken, und eines hat die Hanka gegeben und selbst zugetrunken. Sie ist nicht übel. Über den alten Fritz und den Pastor mit dem Käse hat sie sehr gelacht. Die alte Wičaz hat mit mir serska reja tanzen müssen. Oh, die hat geflucht! Aber sie soll nur mit ihren Wanzen kommen! Ich fühle mich wieder ganz jung. Ich sterbe noch sehr lange nicht. Und sie wird schon wieder gesund werden. Denn solche Mädel haben solche Mucken, das war immer so. Die Spinnstube ist abbestellt. Aber auf den Sonntag ist eine kleine Kirmes. Wenn ich noch auf die Linde könnte, würde ich schon eine starke Predigt halten. Womit ich schließe als dein treuer Freund und Brautwerber
Kito.
Die Spinnstube Hankas war wieder eröffnet. Zwei Mädchen, denen die ehrbare pšaza Hankas zu »langweilig« war, hatten die Unterbrechung benutzt, sich einer lustigeren Spinngesellschaft anzuschließen. Für die eine kam die Reue gar bald und gar schmerzlich. Hanka war verändert. Ihre große Kindlichkeit war ausgelöscht, der wissende Ernst lag auf ihrer Stirn, eine leise Trauer, aber auch eine feste Entschlossenheit leuchtete aus ihren Augen. Sie war stiller geworden. Eine Herbheit war in ihrem Wesen, die oft in Stolz überging. Sie weinte nie mehr, auch nicht, wenn sie allein war. Mit Samo wechselte sie alle Wochen einen Brief. Er schrieb zärtlich, sie antwortete freundlich-kühl.
Um sieben Uhr des Abends kamen die zehn Mädchen, die noch zu ihrer pšaza gehörten, mit ihren Spinnrädern und Flachsrocken. Bald saßen alle Mädchen in einer Reihe im Halbkreis, und die Rädlein schnurrten und die Mäulchen[155] schnurrten noch mehr. Erzählen, lachen, singen und dabei spinnen, spinnen!
Ein schönes Bild. Rote, jugendfrische Gesichter, gesunde, kernige Gestalten, schmucke Gewandung. Bunt gestreifte, weite Röcke haben sie alle, pralle Sammetmieder, zierliche Brusttüchlein, manche hat einen besonders feinen Brustlatz aus Brokat. Große Tücher sind um die Köpfe gewunden mit weitausgreifenden Flügeln nach beiden Seiten. Wenn eine schöne Strümpfe ihr eigen nennt, so steckt sie bald den linken, bald den rechten Fuß unauffällig unter dem Kleid hervor.
Ein lustiges Kienspanfeuer im Kamin liefert die Beleuchtung; außerdem brennen noch zwei Öllämpchen. Heimlich und traulich ist es in der Spinnstube, indes draußen der Sturm über die Heide pfeift oder der Regen an die kleinen Fenster klopft, leise wie mit Geisterfingerlein.
Die Mädchen schwatzen von der Dorfchronik. Die Gromada[43] des Thomastages steht bevor. Da läuft das Amtsjahr des Gemeindedieners, des Dorfschmiedes und des Nachtwächters ab. Entblößten Hauptes müssen sie am 21. Dezember im Kretscham vor der Gromada erscheinen und um ihre Wiederanstellung bitten, sich auch fein höflich bedanken, wenn sie solche erhalten haben.
Nun hat sich der Nachtwächter als ein Rebell erwiesen. Er hat zwar im Vorjahre bei der Gromada die Mütze abgenommen und etwas gebrummt, was man bei viel gutem Willen für eine Bitte um Wiederanstellung hätte halten können, aber er ist, nachdem ihn das Wohlwollen der Dorfväter auf ein neues Jahr bestätigt hatte, ohne Dank und Gruß davongestampft, ja er soll eine Äußerung getan haben, die mit Respekterzeigung in einem greulichen Gegensatz steht. Er ist ein roher Kerl, dieser Nachtwächter!
»Diesmal wird er abgesetzt«, sagt ein Mädchen, die Tochter eines der starsi[44].
»Hurra!« schreit da der alte Kito, der in der ›Ofenhölle‹ sitzt, »da werd' ich ein Spitzbube. Denn einen neuen Nachtwächter kriegen sie nicht, wo er bloß sechs Dreier auf die lange Nacht bekommt. Dafür möchte ja nicht mal mein Napolium wachen.«
Er wies auf einen großen Hund, der neben ihm lag. »Napolium« gähnte und schüttelte sich, so daß alle Mädchen laut auflachten.
»Sechs Dreier sind auch Geld«, sagte die Schöffentochter verärgert. »Überhaupt, mein Vater sagt, es ist eine ganz schlechte aufsässige Zeit. Unser Knecht hat sich Strümpfe gekauft! Strümpfe! Ein Knecht! Wo mein Vater in Fußlappen geht oder auf Stroh in den Stiefeln, kauft sich der Knecht auf dem Jahrmarkt ein Paar Strümpfe!«
Kito nickte nach dem Feuer hin.
»Ja, ja,« seufzte er, »der Untergang der Welt kann nicht mehr weit sein. Napolium, scharr dich nicht!«
Die Mädchen waren des politischen Gesprächs schon wieder müde. Eine Liebesgeschichte machte tuschelnd die Runde, und es wurde viel heimlich gelacht und viel Spott getrieben. Ein Mädchen wurde durchgehechelt.
»So eine Schlafliese hat Glück. Die stieß die Dřemotka[45] schon immer um halb neun in den Nacken. Und kriegt einen solchen Burschen!«
»Sie hat sich sogar abkonterfeien lassen.«
Kaum war das Wort gefallen, so stimmte Kito ein Lied an. Mit meckriger Stimme sang er:
»O du Hund! Kaum fang' ich an zu singen, so beißt mich dieser Lump von Napolium in die Waden.«
»Ach, Kito, du hast doch gar keine Waden mehr«, lachte ein Mädchen.
»Soll ich sie zeigen?«
Kito machte Miene, einen Stiefel auszuziehen.
»Pst, keinen Unfug!« wehrte Hanka ab. Kito seufzte.
»Napolium, Napolium, heutzutage sind die Jungen frumber als die Alten. O jerum!«
Auch die Mädchen seufzten verstohlen. Eine wendische Spinnstube nach ihrem Geschmack war das nicht. Da mußte es schon anders hergehen. Nun ja, zweimal waren die Burschen zu Besuch dagewesen und hatten auch Branntwein mitgebracht, aber tanzen durfte man hier nicht, und sonst war auch nicht viel Spaß erlaubt. Am ersten Spinnabend hatte es einen feinen Gänsebraten gegeben, das ist wahr! Und alle Abend um dreiviertel neun Uhr gab es Kaffee. Das konnten sich nur so reiche Leute leisten. Und die schönsten Lieder gab es hier. Ganz neue Lieder hatte das fremde Mädchen mitgebracht. Auch heute versprach Hanka, zwei neue Lieder zu singen. Es waren aber diese:
Die entlaufene Mutter.[47]
Und das andere Lied war dieses:
Die Leichtsinnige.[48]
Die Lieder wurden gelobt, der Text wurde gelernt, die Weise eingeübt; noch am selben Abend wurden die beiden Lieder gemeinsam gesungen.
Dann wurde Kito aufgefordert, Scherze zu erzählen.
Er wollte vom Alten Fritz und dem Prediger anfangen, aber alle wehrten ab. Das sei eine ganz alte Geschichte. Auch der Pastor mit dem Käse wurde abgelehnt sowie die Erzählung, wie Kito von der Linde predigte.
Schließlich sagte er: »Ein Deutscher sagte einmal zu einem Wenden im Kretscham: ›Aus vier Wenden[49] baut man einen Schweinestall‹.«
»Ja, und er sperrt ein deutsches Schwein hinein!« riefen die Mädchen alle zusammen.
»Oh, Kito, bei deinen Geschichten hat Adam zu Paten gestanden!«
Kito schüttelte den grauen Kopf.
»Die Welt ist neuerungssüchtig und verderbt. Der Knecht kauft sich Strümpfe, und wendische Mädel woll'n neue Geschichten!«
Er fing nun an zu singen:
aber auch dieses schöne Lied fand keinen Beifall, weil es alt und abgeleiert sei.
Selbst einer seiner schönsten Späße wurde mäßig gelobt, daß er nämlich einer Herde von Weibern, die neugierig durch ein Gasthausfenster dem Tanze zusahen und dichtgedrängt standen, heimlich die bauschigen Röcke aneinandergenäht hatte und daß sie am Ende nicht auseinander konnten, was viel Geschrei und Spektakel ergab.
»Wer weiß eine Gespenstergeschichte?«
Das war etwas. Die Mädchen rückten näher zusammen. Und eine sprach halb im Flüsterton:
»Bei Leipa drunten in der Mühle hat es gespukt. Alle Nächte sind eine greuliche Menge Katzen gekommen und haben um Mitternacht einen großen Spektakel gemacht. Alle Leute aus der Mühle sind ausgezogen. Da ist einmal ein Scharfrichter durch Leipa gekommen, der hat von der Mühle gehört. Und er ist hineingegangen, hat sich in der großen Stube an den Tisch gesetzt, zwei Lichter vor sich gestellt und sein Richtbeil vor sich gelegt und um den ganzen Tisch mit Kreide einen Kreis gezogen. Und so hat er gewartet. Dann haben draußen alle Wächter zwölf gepfiffen, und da ist es losgegangen. Das hat gerasselt und gepoltert und gefaucht, und an die hundert böse Katzen sind hereingekommen und haben sich alle auf den Scharfrichter stürzen wollen. Aber keine einzige hat sich über den Kreis getraut. Geh du rüber! Geh du rüber! haben sie zueinander gesagt. Aber keine hat sich's getraut. Bloß eine große, gelbe Katze hat die Pfote in den Kreis hineingestreckt. Da hat schnell der Scharfrichter sein Beil genommen und sie blutig gehackt. Da sind alle[160] Katzen winselnd fortgelaufen. Und am andern Tag hat die Frau des Amtmanns von Leipa eine verbundene Hand gehabt und hat gesagt, sie hätte sich aus Versehen mit einem Messer einen Finger abgeschnitten. Aber die Leute haben jetzt gewußt, daß sie eine Hexe war!«
»Da werd' ich auch etwas von einer Hexe erzählen«, sagte eine andere. »Die hat in einem Dorfe gewohnt, und abends hat sich immer ihr Geist auf den Feldern und in den Gassen herumgetrieben, während ihr Leib im Bette lag, und der Geist hat die Leute geängstigt. Da ist einmal der Schulmeister von Saßleben dem Gespenst begegnet und hat es mit einem Stock jämmerlich durchgeprügelt. Am andern Morgen hat eine Bauersfrau nicht aufstehen können, weil sie ganz grün und blau geprügelt war. Und das war die Hexe.«
Kito seufzte in seiner Ofenhölle.
»Ja, ich bin auch einmal so eine Hexe gewesen.«
»Du, eine Hexe? Das ist nicht möglich!«
»Doch! Und es war auch so ein Abenteuer mit einem Schulmeister. Ich ging damals noch in die Schule und saß auf der Schulbank. Das heißt, es sah nur so aus, als ob ich dort säße. In Wirklichkeit spukte ich. Denn der Mensch besteht aus Leib und Geist. Und mein Geist, der war nicht mit in der Schule, der war im Walde und fing mit Sprenkeln Rotkehlchen. Da fing plötzlich der Schulmeister an zuzuhauen. Aber er hieb nicht auf den Geist ein, sondern der Leib bekam die Hiebe persönlich. Grün und blau war er aber auch.«
Kito wird ein alter Narr genannt und ausgescholten. Teufelsgeschichten kommen an die Reihe: wie der Teufel Asche in Gold verwandelte, wie er als dreibeiniger Hase herumhüpfte, wie er mit zwei schwarzen Ochsen die Spree pflügte und die Ochsen immer so ungebärdig hin und her sprangen, daß die Spree ganz krumm geworden ist.
Und mit scheuen Augen erzählt eine von dem Mädchen, das im Rautenkranz zur Kirche ging und mit Rosen geschmückt auf einem Stuhl vor dem Altar saß. Da kam plötzlich ein Kind vom Altar her, setzte sich dem Mädchen auf den Schoß und[161] sagte: »Ich will bei meiner Mutter sein!« Da gestand die erbleichende Braut, daß sie heimlich ein Kind geboren und getötet habe. Und das Kind nahm die Seele ihrer Mutter mit. Die Braut fiel tot vom Stuhl, der Rosenkranz aber flog auf den Kirchhof hinaus. Dort wuchs ein großer Rosenbusch, der noch heute zu sehen ist. Und das ist in Gahlen geschehen vor zweihundert Jahren.
Lauter schaurige Geschichten erzählen die Mädchen, indes der Wind an die Scheiben poltert und das Feuer im Herde knistert.
Wißt ihr die Geschichte von dem Schatz im Totenkopf? Wißt ihr, wie der Tod in Luckau den Dreißigjährigen Krieg vorhergesagt hat?
Wer weiß die Geschichte von dem Riesen, der ein dreieckiges Gesicht hatte? Er hat viel Übles getan. Die kleinen Ludki haben ihn im Schlaf erschlagen. Und er wurde begraben, aber er spukte in jeder Nacht, und alle Leute fürchteten sich sehr. Da haben die Leute die Leiche des Riesen ausgegraben, ihr einen Nagel in den Kopf und einen Pfahl durchs Herz getrieben, und dann hatten sie Ruhe.
Von brennendem Feld wird erzählt, von weißen Männchen, von dem unglücklichen Mädchen, das der Nix in sein Wasserschloß holte, von der Mittagsgöttin, die allen denen mit der Sichel den Kopf abschneidet, die sie zur Mittagszeit im Felde trifft und die ihre vielen Fragen nicht beantworten können, von unverwundbaren Wölfen, gespenstigen Kälbern.
»Heda! Kito, der Swinigel, sucht dem Hunde Flöhe ab!« Die Mädchen kreischten, sprangen auf, traten zurück.
»Was schreit ihr?« sagte Kito gemütlich. »Eure Geschichten sind so blutig, daß ich mir dazu eine blutige Arbeit gesucht habe.«
Die Mädchen schimpften alle auf ihn ein. Er sei ein unerhörter Swinigel. »Pfui, pfui!«
»Tut nur nicht so,« verteidigte sich der Alte; »ich werfe sie alle ins Feuer, und wenn ja einer der Schwarzen zu einer von euch springt, die kann ihn morgen wiederbringen, wenn sie ihn unter den eigenen herauskennt.«
Ei, wie gingen die Mäulchen! Hanka tat einen Schiedsspruch; Kito mußte das Liebeswerk an seinem »Napolium« einstellen, und bald schnurrten die Rädchen wieder und ging das Erzählen.
Da knurrte der Hund, und von draußen kam ein feines Läuten.
»Hört, hört, was ist das? Hört ihr es läuten?«
»Bože džječo! Bože džječo!«[50] rief da ein Mädchen, und alle Rädlein standen still, und über alle jungen Gesichter ging der helle Schein der Freude.
»Bože džječo! Still, still! Fleißig, fleißig, daß wir es nicht verscheuchen!«
Und die Rädlein schnurrten wie nie zuvor, und die Mäulchen standen ganz still.
Da wurde die Tür geöffnet, liebliches Schellengeläut ertönte im Hausflur, und eine feine Stimme fragte:
»Sind fleißige, gute Mädchen in der Spinnstube?«
»Nein!« schrie Kito von der Ofenhölle aus, und sein »Napolium« bellte.
»Ja, ja, ja!« riefen die Mädchen, »gute, fleißige Mädchen!«
Da kam das Gotteskind in die Stube. Es war ganz weiß gekleidet, das Gesicht verschleiert, auf dem Kopf trug es eine Krone aus Goldpapier. In der einen Hand hatte es die Schelle, in der anderen eine Rute. Es war von einem Weihnachtsmann begleitet, der einen großen Korb in der Hand und einen Sack auf dem Rücken trug und sich ganz greulich vermummt hatte. Das Hofgesinde drängte in die Stube, auch der Hausherr Hanzo erschien. Hanka machte erstaunte Augen; sie hatte von der Veranstaltung nichts gewußt.
»Hausvater,« fragte das Gotteskind, »sind das fleißige, brave Spinnmädchen?«
Der Hausvater bejahte es.
Da ging das Gotteskind von einem Spinnrad zum andern, prüfte das Garn, lobte die, die wenig, und tadelte die, die noch zuviel Flachs am Rocken hatten.
Dann sprach es: »Singt die Kantorka mit euch gute Lieder?«
Die Mädchen standen auf, Hanka stimmte an, und alle sangen:
Die Mädchen standen mit gefalteten Händen hinter ihren Spinnrädern und sangen das Lied andächtig und schön. Das Kaminfeuer warf einen roten Schein über sie und über das »Gotteskind« in seinem feierlichen, weißen Kleid.
Nun packte der Weihnachtsmann mit großem Gepolter seine Gaben aus und fuhr mit einem alten Besen derb unter dem Mannsvolk herum, wodurch er den Zorn des Hundes »Napolium« erweckte, der beständig nach seinen Waden schnappte, was viel Hallo gab. Es gab für eine »Vorbescherung« ganz unerhört kostbare Dinge; denn die eigentliche Bescherung kam erst am Heiligabend. Die Spinnmädchen bekamen alle kleine silberne Anhängsel: ein Herzchen, ein Kreuzchen, einen Stern, die Knechte und Mägde wurden reichlich mit Kleidungsstücken bedacht, Kito erhielt eine silberbeschlagene Tabakspfeife, der Hausvater bekam die schön ausgeführten Wappen der Ober- und Niederlausitz, beide unter einem geschnitzten Lindenkranz vereinigt. Von wem ging diese Bescherung aus? Die Antwort ergab sich bald.
Zur Tür herein kam Samo. Er war am späten Nachmittag heimlich angekommen.
»Darf ich auch bei der Bescherung sein?« fragte er, nachdem er gegrüßt hatte. Hanka wurde blaß und hielt sich an dem Spinnrocken fest. Errötend gab sie Samo die Hand.
Plötzlich aber stieß sie einen lauten Freudenschrei aus. Ihre Eltern waren in die Stube getreten. Das Mädchen hing an ihrem Halse und lachte und weinte vor Freude.
Da stand Kito auf und gebot mit lauter Stimme Ruhe. Er nahm Hanka an der Hand und sagte:
»Setz dich auf deinen Platz! Es muß Ordnung sein!«
Und dann stellte er sich mitten in die Stube und sprach:
»Ihr kennt alle die Bibel. Als Abraham für seinen Sohn Isaak ein Weib haben wollte, schickte er seinen Knecht Elieser aus, ein solches zu suchen; denn er dachte wahrscheinlich, daß Elieser das besser verstände als er und Isaak. Elieser war nur ein Knecht, aber er hatte doch dieses wichtige Amt bekommen. Er war ein družba. Hier seht ihr auch einen družba stehen. Zehnmal bin ich schon Zurater und Brautwerber gewesen; siebenmal haben sie mich – aber davon will ich nicht reden. Kurz und gut, dreimal ist es geglückt. Und dazu gehört dieses Mal. Ihr dürft nicht glauben, daß es nur der palenc war, der meine Zunge so geschmeidig und siegreich gemacht hat; denn ich habe schon von der Linde gepredigt. Kurz und bündig: durch Gottes Gnade und meine Hilfe ist es geglückt, von unserer ehrbaren Jungfrau Hanka für unseren ehrbaren Junggesellen und Gutssohn Samo das ›Jawort‹ zu bekommen.«
Ein Ruf allgemeiner Überraschung ging durch die Stube. Die Spinnmädchen umdrängten Hanka, und es wurde ein solcher Lärm, daß Kito sich nur durch die Anwendung von Grobheit wieder Ruhe schaffen konnte.
»Und so will ich nun die achtbaren Eltern unserer Jungfrau Hanka bitten und fragen, ob sie in Gottes Namen ihre Einwilligung zu der Verbindung geben wollen.«
Die Frage wurde bejaht.
»Und so frage ich unseren achtbaren Hausvater, ob auch er in Gottes Namen seine Einwilligung geben will.«
»Ja!« sagte Hanzo.
»So frage ich nun, ob diese Zeugen hier genügen, oder ob ich noch andere Zeugen holen soll.«
»Sie genügen.«
»Nun, so bitte ich für meinen Freund Samo alle, die er beleidigt hat, um Verzeihung. Jetzt aber tretet ihr zwei hierher!«
Samo und Hanka traten in die Mitte der Stube, der Brautwerber legte ihre Hände ineinander und sprach die vorgeschriebenen Worte:
»Ich verlobe euch öffentlich vor diesen Zeugen in Gottes Namen. Es sei mit euch beiden der Gott unserer Väter und segne euch mit den Gütern, mit denen er unsere Väter gesegnet hat. Amen!«
Darauf sangen alle Anwesenden das Lied:
Als das Lied zu Ende war, trat das weiße »Gotteskind« vor Hanka, gab ihr einen goldenen Ring und sprach dazu:
Samo küßte Hanka auf die leise bebenden Lippen. Die zwei waren nach wendischem Brauch verlobt. –
Nun brach die Tollheit des lebenslustigen Wendenvolkes sich Bahn. Boten eilten in die anderen Spinnstuben des Dorfes, und nicht lange, so wimmelte es von Burschen und Mädchen. Die fremden Burschen drangen in die Stube; einer hatte ein langes Messer in der Hand, damit »erstach« er den Rocken Hankas. Und nun nahmen die anderen Burschen den Mädchen die Rocken weg, und aller Flachs, der noch dran war, wanderte ins Feuer.
Ein Ungetüm sauste in die Stube. Es sollte einen Schimmel darstellen und hatte einen Kopf aus Stroh. Es wurde weidlich durchgeprügelt und machte wilde Sprünge und Purzelbäume.
Ein paar wollten anfangen zu tanzen. Da aber trat Kito, der Brautwerber, wieder auf, und nachdem er sich mühsam Ruhe verschafft hatte, rief er:
»Hochgeachtete Gäste!«
Er wurde unterbrochen; denn sein Hund »Napolium« hatte sich mit dem Schimmel verbissen, und es gab ein tolles Gelächter.
»Laßt sie, laßt sie! Es ist wie im Zirkus!«
Nachdem der Kampf der Bestien vorüber war, rief Kito abermals:
»Hochgeachtete Gäste! Dieweilen dies hier ein Trauerhaus ist, seid ihr gebeten, in den Kretscham zu gehen und euch dort zu Ehren des Brautpaares etwas zu erfreuen.«
Da zog das Völklein jauchzend ab, und das helle Lachen und Singen klang vom Kretscham her die ganze Nacht, bis der Tag graute.
Hanka saß indes aufrecht in ihrem Bett. Sie allein lachte nicht.
Auch Juro kam zu den Weihnachtsferien nach Hause. Er traf zwei Tage später ein als Samo. Als er bald nach seiner Ankunft dem Bruder begegnete, sagte er:
»Warum hast du mir von deiner Abreise aus Breslau nichts gesagt? Konnten wir nicht zusammen reisen?«
»Von uns zweien findet jeder den Weg für sich«, antwortete Samo unliebenswürdig.
»Jawohl, das weiß ich!« sagte Juro und wollte sich abwenden. Aber Samo sprach ihn noch einmal an.
»Ich will dir etwas sagen, ehe du es von anderen Leuten hörst: ich habe mich vorgestern mit Hanka verlobt.«
»Was?«
Juro starrte ihn an.
»Ich habe das Mädchen lieb,« fuhr Samo fort, »und es muß die Tradition in unserer Familie gewahrt werden. Im übrigen bin ich dir ja wohl weitere Rechenschaft nicht schuldig.«
»Du – du bist wohl verrückt?«
»Nein, im Gegenteil, recht vernünftig! Ich weiß, was ich will!«
Da faßte Juro sein Zorn.
»Samo – Mensch – ist das wirklich wahr? Hast du dich wirklich mit dem unerfahrenen Mädchen verlobt?«
»Wie ich dir sagte …«
»Und – und du schämst dich nicht – eine so gemeine Komödie …«
»Hüte dich, du deutscher Lümmel!«
Juro ballte die Faust.
»Noch so ein Wort, und ich schlag' dich nieder, du – du Erbschleicher!«
Samo lachte ihm höhnisch ins Gesicht.
»Schlag' nur zu! Es ist die deutsche Art, etwas zu beweisen, was nicht zu beweisen ist. Aber es nützt dir gar nichts! Deine Rolle ist hier verspielt!«
Er ging aus dem Zimmer und warf die Tür zu.
Juro suchte in höchster Erregung seinen Vater auf.
»Vater, ist das wahr, das von Samo und Hanka …?«
»Sie sind seit vorgestern verlobt!«
Juro wurde bleich.
»Und du hast das zugegeben?« fragte er fassungslos.
»Ja, ich habe es sogar gewünscht. Ich will nicht, daß ein so braves Mädchen wie Hanka verachtet wird, ich will mich vor ihren Eltern und allen Leuten nicht lächerlich machen.«
»Und das Mädchen?«
»Es hat eingewilligt.«
»Aber siehst du denn nicht ein, Vater, was Hanka für großes Unrecht geschieht, daß Samo sie nur nimmt, weil es in seine Berechnungen paßt, daß es eine Schmach für das Mädchen ist, so – so – als Spekulationsobjekt behandelt zu werden?«
»Wieso Spekulation?«
»Es liegt doch auf der Hand, daß Samo, der im Grunde genommen immer alles Bäuerische mißachtet hat, weil seine Gedankenflüge zu hoch gingen, jetzt durch seine wendische Heirat nichts anderes will, als sich hier auf dem Gut als künftigen Herrn festsetzen.«
Das Gesicht des Vaters wurde noch ernster, als es schon war.
»Das Gut bekommt er sowieso – mein Testament ist gemacht.«
»Dein – Testament – – für Samo? Und – und mit – mit welchem Recht schließest du mich aus?«
»Ich schließe dich nicht aus. Was dir zukommt, wirst du bekommen in barem Geld.«
Juro schlug ein bitteres Gelächter an.
»Bares Geld? Und das Heimatsrecht?«
»Du hast dich selbst von deiner Heimat losgesagt.«
»Das ist nicht wahr!«
»Sprichst du so mit deinem Vater?«
»Ja, auch mit dir! Es ist nicht wahr, es ist beim allwissenden Gott nicht wahr, daß ich mich von meiner Heimat losgesagt habe.«
»Du willst von den Wenden nichts wissen, Juro; ich habe es selbst gehört!«
»Ja, ja, ich will von ihnen wissen; ich will ihnen ja mein ganzes Leben, meine ganze Arbeit, meine ganze Fürsorge weihen, ich will ja nichts anderes erstreben, als ihnen zu helfen, sie geistig zu heben, ihre Lage zu verbessern, sie vorwärtszubringen in der Welt.«
»Dadurch, daß du sie deutsch machst«, sagte der Vater finster.
»Jawohl, dadurch! Vater, ich beschwöre dich, ich bitte dich, sieh es doch ein, gib es doch zu, daß das das Beste, das Richtige ist! Unsere geringe Anzahl, kaum hundertfünfzigtausend Seelen, sie kann sich doch nicht halten, sie kann doch ihr Volkstum nicht behaupten in unserer jetzigen Zeit; wir können doch mit dem Festhalten an alten, längst überlebten Bräuchen, mit dem Verharren in albernem Aberglauben …«
»Schweig!« schrie ihn der Vater an; »hier steht der Kral der Wenden, die du beschimpfst.«
Juro fuhr sich ein paarmal über die Stirn. Dann sagte er erschöpft:
»Der Kral der Wenden bist du; es kann niemand beweisen, daß du es nicht bist! Aber das Königtum ist uns genommen; der wendische König, der heute regiert, heißt Wilhelm von Hohenzollern und wohnt in Berlin.«
»Das weiß ich«, sagte der Alte ernst. »Und ich bin sein treuer Untertan. Ich tue meine Pflicht. Ich bin kein Hochverräter. Aber Gott führt die Schicksale der Menschen, und ich brauche die Würde, die er mir gab, im Herzen nicht aufzugeben und die Leute, die zu mir halten, mir nicht abtrünnig machen zu lassen von meinem eigenen Sohne, solange unsere alte Krone noch ruht im heiligen Hügel.«
»Ich glaube nicht daran, daß in dem Hügel eine Krone liegt; es ist eine Sage wie alle. Ich kann nicht an sowas glauben.«
»Und du wagst es, zu sagen, daß du dich nicht von deiner Heimat losgesagt hast?«
»Nicht von der Heimat, nicht von dir, nicht von allen Wenden. Nur von dem, was ihnen schadet, was sie tiefhält, was nicht wahr ist! Und das sage ich dir, Vater, Samo glaubt an alle diese Dinge so wenig wie ich. Aber er heuchelt und hat den Vorteil, und ich sage die Wahrheit und verliere dich und verliere alles.«
»Samo lügt nicht. Samo beachtet unsere Gebräuche bis ins kleinste. Für dich aber ist alles, was uns heilig ist, Aberglaube und Dummheit. Und deshalb ist Samo an deine Stelle getreten. Mit Fug und Recht, Juro; ich habe es in vielen schlaflosen Nächten mit mir abgemacht.«
»Und meine Erbfolgeschaft als künftiger Kral?«
»Die vor allen Dingen wirst du an Samo abtreten.«
Da kam der Zorn wieder über Juro, und er richtete sich auf und sagte:
»Das werde ich nicht! Dein Gut kannst du vermachen, wem du willst, es ist dein Eigentum, und die preußischen Gesetze werden[170] dafür sorgen, daß dein wendisches Testament bis ins kleinste erfüllt wird. Aber das Recht der Erstgeburt, das kannst du mir nicht nehmen und kein Gericht, das behalte ich! Das behalte ich!«
»Du, der nicht an das Königtum glaubt?«
»Ja, ich! Ich bleibe doch der künftige Kral. Ich werde den Einfluß, den ich dadurch habe, nicht aufgeben. Denn ich will der Kral sein, der sein Volk aus der Gefangenschaft finsterer Vorurteile herausführt, und dazu brauche ich Ansehen, sei es auch eingebildetes Ansehen. Niemand anders als der Kral selbst kann den Leuten zeigen, daß es keinen Kral gibt!«
»Du Verräter!«
»Vater, ich bin noch weniger ein Verräter an den Wenden als du ein Hochverräter am König von Preußen bist, dem du Treue geschworen hast.«
Einige Augenblicke standen sich Vater und Sohn noch gegenüber, Kälte im Blick, Kälte im Herzen; dann sagte Hanzo:
»Wir sind fertig miteinander!«
Und er ging hinaus.
Juro war allein. Ein paarmal ging er ratlos hin und her mit unsicheren Schritten, dann sank er auf einen Stuhl und weinte vor Zorn und vor Schmerz.
Aber es gibt keinen stärkeren Trost in den Bitternissen des Lebens als die Erkenntnis, daß einem Unrecht geschehen ist. So erhob sich Juro nach kurzer Zeit, und seine Gestalt straffte sich wieder zu ihrer schlanken Schönheit.
Er stieg hinauf in seine Kammer und holte Mantel, Stab und Hut.
Und er zog fort aus seinem Vaterhause.
Es war ein trüber Abend angebrochen. Juro ging langsam das Dorf hinab. Die spitzen Giebel der Häuser schauten ernst auf seinen Weg. Hin und wieder begegnete ihm ein Bursch, der seine Mütze zog. Starke, gutmütige Menschen. Aber die Sonne einer höheren Erkenntnis scheint nicht in ihre Heimat, ihre Gedanken irren nur immer um ihre schmalen Felder, und ihre Wünsche gehen nicht weiter als bis in eine Mädchenkammer oder an einen Wirtshaustisch. Und die Hütten der Kleinen! Wie[171] armselig liegen sie unter ihren Strohdächern. Der kümmerliche Rauch, der aus dem windschiefen Schornstein steigt, stammt vielleicht von einem Bündel Holz, das der Mann aus dem Walde des Reichen zur Nachtzeit mit pochendem Herzen holte, damit die Kinder nicht zu frieren brauchten in dieser strengen Zeit, damit die Hände nicht steif würden, die spinnen und weben mußten. Und viele der Kinder, die jetzt auf der Gasse noch vom Christkind plauderten, hatten am Weihnachtsabend auch nicht die kleinste Gabe und starrten ins Dunkle und fragten sich, warum der holde Himmelsgast denn nicht zu ihnen komme, ihnen auch nicht ein einziges buntes Lichtlein schicke. O ihr Träumer, wacht auf! Draußen ist eine reichere Tafel für euch und eure Kinder gedeckt, draußen ist eine weitere, lichtere Heimat! Und hat sie auch noch tausend Mängel, dort steht doch die Freiheit vor der Tür, dort gibt es hundert Ansätze zum Sprung auf die Staffel der Menschenwürdigkeit. Wacht auf, ihr Träumer, seid wie die anderen, fordert wie die anderen euer Menschenrecht, werdet im Anschluß an die anderen glücklich! Dann aber müßt ihr heraus aus der Enge; denn eure wendischen Stammelrufe hört niemand, versteht und beachtet niemand in der Welt. Von Branntwein und Hexengeschichten könnt ihr nicht leben, und der Sand der Heide macht euch nicht satt! – –
Das letzte Haus war vorbei, der holperige Feldweg führte hinaus ins Dunkle. Da kam wieder ein Schwanken in Juros Gang, da klangen ein paar Stimmen in seinem Ohr, die ihm einmal lieb waren, da gingen ein paar Heimatsmelodien traurig durch sein Herz.
Aber er zog den Hut fester auf den Kopf, stampfte mit dem Stock stark auf die gefrorene Erde und schritt rasch vorwärts.
Zuerst hatte Juro mit Elisabeth gesprochen. Sie hatte ihm in ihren letzten Briefen immer wieder die eine Frage vorgelegt: ob er nicht zu stürmisch, zu ungeduldig zu Werke gehe, ob es notwendig sei, immer seine herausfordernde Meinung so[172] laut zu sagen, oder ob nicht klugem Abwarten eine bessere Aussicht auf Erfolg beschieden sei.
Nun, da der Bruch geschehen war, sagte sie von allen diesen Dingen kein Wort. Sie sagte nur, daß sie treu zu ihm halte und hoffe, daß sich Juro mit seinem Vater werde aussöhnen können, damit er unter diesem Zwiespalt nicht leide. Und sie sagte das, was der Mann in schweren Kämpfen vom Weibe hören muß: »Ich glaube an dich; deine Sache ist gerecht!«
Der alte joviale Herr von Withold nahm die Sache nicht sehr ernst. Mit Juro und seinen beiden Kindern Heinrich und Elisabeth saß er an dem runden Tisch der mit alter solider Biederkeit traulich ausgestatteten Wohnstube seines Herrenhauses, tat einen tiefen Trunk und sagte:
»Also, da wollen wir einen feierlichen Familienrat halten. – Es sind Dickköppe!«
Damit meinte er die Wenden.
»Aber sehen Sie, Juro, die Leute imponieren mir auch. Lassen sich nischt vormachen. Halten am Alten. Sind stockkonservativ bis auf die Knochen. Eigentlich mein Fall!«
Juro wollte etwas erwidern, aber Herr von Withold winkte ab.
»Nee, jetzt rede ich erst! Also, Juro, das mit dem Deutschreden ist richtig. Das Wendische hat der Teufel erfunden. Ich krieg' das Niesen, das Schlucken und den Keuchhusten, wenn ich es sprechen soll. Es ist ganz verrückt schwer, in jedem Dorfe ist es anders, und für den Verkehr taugt so was gar nischt. Also Deutsch! Selbstverständlich! Mit dem Humbug, den sie sonst machen, Volkssitten, Märchen und so – na, da soll man nich so strenge sein. Das schadet nischt. Aber das mit dem sogenannten Vorwärtskommen, das ist gefährlich! Nur keene Parvenüs züchten! Ich kann meinem Großknecht nich Polstermöbel in die Stube stellen und meine Kühe nich mit Mandelseife waschen lassen. Das ist moderner Unfug! Das sind so Schnurrpfeifereien von Leuten, die nischt verstehen von der Sache. Volkshygiene! In meinem Leben hab' ich von so was nischt gehört, bis Sie kamen, Juro. Na, Sie wissen, ich bin kein[173] Unmensch; ich gönne meinen Leuten alles Gute. Bauen wir also jetzt das neue Arbeiterhaus, gut, soll's größer werden; gut, soll jede Familie zwei Stuben und 'ne Kammer haben; gut, soll'n sogar große Fenster rein, obwohl ich das für 'n kolossalen Luxus halte. Aber seh'n Sie, Juro, da Sie nu eben mal mein zukünftiger Schwiegersohn sind, da möcht' ich nich gern, daß Sie bei sich denken: der Alte is 'n altmodischer Furchenklecker. Also, es wird werden!«
Er tat wieder einen Trunk und fuhr fort:
»Und jetzt von dem Königtum. Da haben Sie mich also eingeweiht! Ehrenwort, ich sag' nischt weiter! Aber, Juro, mit dem Kral, das is – das is – ja, wenn ich sagen würde, es is Blech, wär' es zu grob – also sag' ich, es is nich Blech – bloß, es hat keenen Zweck! Jawohl, jawohl, ich weiß, unser Großer Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der hat nach dem Kral suchen lassen. Seine Häscher hatten auch den richtigen Kral rausgespürt, einen jungen, hübschen Mann. Also so einen Ahnen von Ihnen, Juro. Sie wollten ihn nach Berlin unter die Soldaten für immer verschwinden lassen. Da kam gerade im kritischen Moment 'n alter, wendischer Bauer vorbei. Der hieb plötzlich dem jungen, hübschen Mann 'ne Ohrfeige runter, weil er behauptete, der hätte ihn nicht pflichtschuldig gegrüßt, und die Häscher sagten sich: ›Aha, das ist nicht der Kral; denn sonst hätte ihn kein Wende geohrfeigt.‹ Und der Kral war gerettet, und der Kurfürst in Berlin saß da mit seiner langen Nase, die ohnehin lang genug war. Jawohl, das ist Tatsache! Das ist Geschichte! Das hat sich keiner aus den Fingern gesogen. Und auch der Alte Fritz hat vom Wendenkönig gewußt und aufgepaßt, daß die Wenden ihm nicht etwa mit den verfluchten Tschechen ›Kaprusche‹ machen. Also das steht alles fest. Und sind Ihre Ahnen, Juro! Alle Achtung! Wissen Sie, 'n preußischer Edelmann hat für so was Verständnis. Aber jetzt, Juro, jetzt ist mit dem Kraltum nischt mehr zu machen. Aus und vorbei ist es!«
»Es ist noch nicht aus und vorbei«, entgegnete Juro. »Fast das ganze Wendenvolk glaubt noch an den Kral und hängt noch[174] am Kral. Und deshalb darf nicht mein Bruder Samo der Kral der Wenden werden, weil er ihren alten Aberglauben aus Selbstsucht erhalten würde, sondern ich muß der Kral sein, der die Leute aufklärt und sie zu einem menschenwürdigeren Dasein führt. Ich suche es im Deutschtum, weil es mir am nächsten ist. Freilich müßte sich die Hinüberführung lohnen.«
»Sie brauchen nicht zu sticheln, Juro; die Fenster im Arbeiterhause werden groß genug sein. Ich geb' ja zu, früher, wie wir noch die alte Fronordnung hatten, da ist es ja den Bauern nicht gerade berühmt gegangen. Aber die Güter waren gut! Gut waren sie! Oh, es war doch eine schöne Zeit!«
Er versank ins Nachdenken, tat wieder einen tiefen Trunk und schüttelte ein paarmal wehmütig den Kopf, wie er so an die »gute, alte, liebe Fronzeit« dachte. Dann raffte er sich auf.
»Na, die alte Zeit ist nu leider mal vorbei. Halten wir uns an die Gegenwart. Sie sind nu von Hause fortgegangen, Juro. Ich kann's Ihnen nicht verdenken, wenn es auch nicht gerade erfreulich ist, daß es so kommen mußte. Aber, Juro, 'n vernünftiger Plan war da überhaupt nich. Ihre Väterei in Ehren, Juro, sie is 'ne Staatsbesitzung; kein anderer Wende hat 'ne solche. Aber, Juro, Sie und meine Liese paßten dorthin wie die Faust aufs Auge. Darein müssen Bauersleute.«
»Das sag ich auch,« warf der junge Heinrich dazwischen, »und deshalb möchte ich jetzt einen sehr vernünftigen Vorschlag machen.«
»Deine vernünftigen Vorschläge sind unvernünftig«, lehnte sein Vater ab. »Leute, die Zigaretten rauchen, haben überhaupt keine Vernunft. Meine Ansicht ist die, Juro, Sie geben die Geschichte da drüben in Ihrer Heimat auf, setzen sich, wenn Sie Ihr Staatsexamen und Ihren Doktor gemacht haben, in irgend 'ne große deutsche Stadt als Arzt, gründen da Ihren Hausstand und pfeifen auf die ganze wendische Geschichte.«
»Das kann ich nicht und das werd' ich auch nicht, Herr von Withold. Ich werde meine wendische Heimat nicht im Stich[175] lassen. Es ist mein Ideal, den Wenden zu helfen, ihnen zu dienen, und das werde ich durchführen. Ich werde mich als Arzt in irgendeinem wendischen Ort niederlassen und von da aus wirken.«
Herr von Withold schnitt ein saures Gesicht.
»Arzt im wendischen Ort? – So 'ne Sache! Wo? In Hoyerswerda oder in Burg? Kottbus wär' etwas oder Bautzen. Aber da haben sie deutsche Ärzte, und die Städte sind deutsch, sind da bloß an der Peripherie der Wendei. Und mitten im Land wird Ihr Bruder Samo als Arzt sitzen wie die Spinne im Netz und wird Ihnen Ihre Mücken abfangen.«
»Darf ich jetzt endlich meinen vernünftigen Vorschlag machen?« warf Heinrich wieder ein.
»Donnerwetter, der Junge läßt keine Ruhe. Wenn wenigstens seine Zigaretten nicht so stinken möchten. Also schieße los!«
Heinrich, der mit seinem Vater sehr kordial stand, blies ihm eine Rauchwolke ins Gesicht und sagte:
»Stück zwei Dreier!« Dann wurde sein hübsches, weiches Gesicht, das von einer Fülle wirrer »Künstlerlocken« umrahmt war, sehr ernst, und er sagte:
»Was ich vorzuschlagen habe, ist mir nicht erst jetzt eingefallen, sondern meine Lieblingsidee seit langem. Ich will es kurz heraussagen, einen Sturm gibt's sowieso. Also, mit dem Landwirt ist's für mich ein für allemal nichts. Ich würde unglücklich werden und es mein Lebtag zu nichts bringen. Ich habe die ganzen Jahre nebenher Kunstgeschichte und Musik studiert. Das Vernünftigste ist, ich widme mich ganz und gar der Musik und erobere mir eine Stellung in der Welt, die mir zusagt. Juro wird Arzt, heiratet die Liese, wohnt mit ihr hier in diesem weitläufigen Gespensterbau, doktert ein bißchen (denn viel zu tun wird er nicht haben), reformiert seine Wenden, richtet sich in die Gutsverwaltung ein und übernimmt als Eigentümer das Gut, wenn sich der Vater zur Ruhe setzt. Dann ist uns allen geholfen.«
Da schlug der alte Withold auf den Tisch, daß die Gläser klirrten.
»Habt Ihr's gehört? – Er ist verrückt! Jagt mir nichts dir nichts das väterliche Gut in die Binsen, präsentiert es einem andern wie eine Zigarette für zwei Dreier. Oho, Bürschchen, oho! Ich werd' schon dafür sorgen, daß es dir in dem weitläufigen Gespensterbau nicht zu eng wird. Ja, glaubst du denn, dafür hat man einen Sohn, einen Stammhalter?«
»Lieber Vater, den Stamm kann ich dir ja woanders erhalten; das muß doch nicht gerade hier sein. Und von Wegschenken ist keine Rede; ich laß mich natürlich auszahlen.«
»Auszahlen – wie ein Weib! Pfui Teufel! Das macht der verfluchte Wagner! Die Liese wird ausgezahlt als Tochter – verstanden? Du gehörst hierher! So ist es Brauch und Recht.«
»Es ist natürlich gänzlich ausgeschlossen,« sagte Juro, »daß durch meine Lebensschicksale die Familiengeschichte Withold in dieser Weise beeinflußt werden soll.«
»Natürlich, Juro, du bist ja vernünftig. Wir werden uns schon vertragen. Na, man könnte z. B. das Jagdschlößchen für euch beide recht hübsch herrichten lassen, und da könntest du von hier aus deinen ärztlichen Bezirk haben. Das läßt sich ja alles einrichten. Aber wenn einem sein einziger Sohn so kommt, das ist stark! Das übersteigt alle Begriffe!«
Er ging aufs höchste verärgert aus der Stube, und bald darauf hörte man ihn unten im Hofe herumschimpfen.
Heinrich schritt gelassen ins Nebenzimmer, wo ein großer Flügel stand, und vertiefte sich in die Schönheit der Wagnerschen »Gralserzählung«.
Juro und Elisabeth waren allein. Das Mädchen küßte dem Geliebten Mund, Stirn und Augen. Dann lehnte sie an seiner Schulter und sprach tröstende und zärtliche Worte zu ihm. Er lächelte glücklich; nur ein paarmal irrte sein Blick zum Fenster hinaus. Dort in der Richtung, wo der bleiche Mond stand, lag das Vaterhaus, das er verlassen hatte.
sang Heinrich im Nebenzimmer mit Begeisterung.
Es war am Nachmittag, zwei Tage vor Weihnachten. Frostwetter mit leichtem Schneefall. Elisabeth von Withold war allein auf der öden Landstraße. Der Vater war mit Juro und Heinrich auf der Jagd. So hatte sie unbemerkt von Hause fortgekonnt.
Nach einstündigem scharfen Zuschreiten stand Elisabeth vor dem Heimatsdorfe Juros. Das Herz schlug ihr heftig, eine brennende Röte stieg in ihre Wangen, aber ihre Füße wanderten darum nicht weniger schnell.
Es mußte noch vor dem Heiligen Abend geschehen. Irgend jemand mußte zu dem alten wendischen Vater gehen und ihm ein gutes Wort geben, damit sein Herz nicht so vergrämt sei am Fest der Liebe.
Und es mußte Juros wegen geschehen. Sein Stolz fand den Heimweg nicht, aber seine bange Sehnsucht nach dem alten Manne, der sein Vater war, irrte oft hin zu der Heimat. Er sollte am Heiligen Abend Frieden haben.
Nun war das erste Gehöft erreicht. Kinder, Burschen, Mägde stürzten in Fenster und Tür und starrten das fremde Fräulein an, das hier ins Dorf kam. Ein paar Leute kannten sie, und es entstand ein Tuscheln.
Das Mädchen faßte Angst und Scham. Sie war mit Juro noch nicht einmal öffentlich verlobt und wagte diesen Schritt. Aber ihr tapferes Herz trieb sie vorwärts.
Nur als Juros Vaterhaus auftauchte, ging sie langsam. Vor dem kleinen Hoftürchen blieb sie ein paar Minuten lang stehen und zupfte aufgeregt an ihren Kleidern und an ihrem Schleier.
»Helfe mir Gott!«
Und sie trat in den Hof. Vor der Haustür stand Hanka und schaute verwundert auf.
Die Mädchen kannten sich von dem Begräbnis her. Und sie kannten sich aus ihrem stummen Herzenskampf. Jetzt, da sie sich sahen, erschraken sie beide tödlich, und das deutsche wie das wendische Mädchen preßte die Hand aufs Herz und jede stieß einen Schrei aus, und kein Gott hätte einen nationalen Unterschied in ihrem Empfinden und Gebaren herausgefunden.
Elisabeth blieb bestürzt stehen, und Hanka rannte wie gehetzt zur Haustür hinein.
Eine Minute lang war es Elisabeth, als müsse nun auch sie fliehen, fliehen aus diesem Hof, wo sie nicht nur eine Fremde, wo sie eine Gehaßte war. Aber die Kraft ihrer starken Frauenseele kam wieder, und sie trat entschlossen in das Haus.
Ein großer Hund kläffte sie wütend an. Sie blieb ratlos stehen. Kein anderer Gruß wurde ihr als das Gekläff des Hundes. Da kam jemand schlürfenden Schrittes die Kellertreppe herauf.
»Napolium, halte die Schnauze! Je, je, ein Fräulein …«
Der Hund bekam einen Fußtritt.
»Das Fräulein von Withold!«
»Ja. Und Ihr – Ihr seid wohl Kito?«
»Kito! Kito! Kito!« sagte der Alte in höchster Verlegenheit und machte eine Menge Verneigungen.
»Ich möchte ein paar Augenblicke mit dem Herrn sprechen.«
»Mit dem Scholta! Der ist zu Haus. Herr Samo ist in der Stadt. Wenn das gnädige Fräulein so gnädig wäre, ins gute Stübel zu kommen, wir müssen freilich über die Treppe …«
»Es ist nicht nötig, Kito! Ich warte hier.«
»Hier im Hausflur? O nein, nein! Auch nicht in der Wohnstube! Ein gnädiges Fräulein …«
Hinter der Küchentür hatte Hanka alles mit angehört. Zu dem Schreck, den sie erlitten, kam jetzt die weibliche Angst, der alte Pulverkopf Kito möchte wirklich die – die Fremde ins »gute Stübel« führen. Das war ungeheizt, und der ganze Fußboden des fast nie benutzten Raumes lag voll Winteräpfel und Walnüsse. Diese Schande ertrug Hanka nicht. Kurz entschlossen trat sie in den Hausflur.
»Pomogaj Bog wam!« grüßte sie wendisch. »Gott helfe Euch!«
»Bog žekujscho!« dankte Elisabeth. »Gott vergelte es!«
»Es – es – in der Oberstube ist es kalt«, stammelte Hanka und öffnete die Wohnstubentür. Elisabeth trat in den großen Raum, in dem das Kaminfeuer brannte.
»Ich möchte nur einige Augenblicke den Herrn sprechen.«
»Ja. Er wird kommen.«
Die Mädchen standen noch ein paar Augenblicke voreinander. Jede wollte etwas sagen; keine brachte ein Wort heraus. Endlich sagte Hanka in deutscher Sprache, aber mit schwerem Akzent:
»Bitte sich zu setzen. Ich werde den Herrn rufen!«
Elisabeth war allein und blieb lange allein. Sie fröstelte am Kaminfeuer. Als sie endlich einen Männertritt hörte, überfiel sie große Furcht.
Der alte Hanzo trat ein. Er hatte sich offenbar erst frisch gewaschen und gekämmt und trug seinen langen blauen Staatsrock. Auch er war schwer befangen. Als er aber das zitternde Mädchen sah, das sich an die Stuhllehne klammerte, sagte er in deutscher Sprache:
»In Gottes Namen willkommen! Es ist mir eine große Ehre, daß mich das gnädige Fräulein besucht.«
Elisabeth ging zwei Schritte auf ihn zu.
»Verzeihen Sie – verzeihen Sie –«
Dann brach sie in Tränen aus.
Hanzo kam an sie heran, faßte sie an der Hand und führte sie auf einen Stuhl. Da brachte sie mühsam hervor:
»Ich habe es – es gewagt, weil – weil – es nicht sein kann, daß Heiliger Abend ist und daß Sie und Ihr Sohn –«
Weiter kam sie nicht.
Der alte Hanzo suchte nach Worten. Endlich sagte er:
»Mein Sohn Juro ist als Gast bei Ihrem Herrn Vater. Er hat es mir geschrieben.«
Und nach einer kleinen Weile fragte er:
»Weiß es – weiß es Juro, daß Sie –?«
»Nein, niemand weiß es. Nur Gott weiß es, daß ich nicht anders konnte als herkommen. Ich – ich wollte Sie bitten, daß Sie keinen – keinen Groll auf mich haben. Sonst könnte ich nicht mehr glücklich sein.«
Da wurden die Augen des alten Hanzo mild und warm.
»Sie sind gut!« sagte er schlicht.
»Aber hauptsächlich komme ich wegen Juro«, fuhr Elisabeth etwas gefaßter fort. »Er ist unglücklich, denn er hat Sie sehr lieb.«
Hanzo schlug finster den Blick nieder. Eine lange Pause kam.
»Das ist eine andere Sache«, sagte Hanzo endlich.
Hier klopfte es leise an die Tür, und dann trat Hanka ein.
»Ich möchte das gnädige Fräulein fragen, ob ich ein Glas Wein oder ein Glas Milch bringen darf«, sagte sie schnell heraus.
Elisabeth wehrte freundlich dankend ab. Aber der Hausherr meinte:
»Eines wird uns Wenden immer gelassen, unsere Gastfreundschaft. Es geht kein Gast von uns, dem wir nicht etwas Bescheidenes anbieten.«
Da sagte Elisabeth:
»Ich werde gern trinken, wenn Fräulein Hanka mit uns trinken will.«
Hanka sah auf, als sie sich beim Namen genannt hörte, und verschwand eiligst.
Hanzo trommelte leise auf den Tisch, dann sagte er:
»Gnädiges Fräulein, ich habe Sie bis jetzt nicht gekannt. Nur so vom Sehen habe ich Sie gekannt. Ich hätte auch nicht zugegeben, daß mein Sohn Juro die Augen zu Ihnen erhebt, aber jetzt sehe ich ein: Gott hat ihn gesegnet!«
Elisabeth schlug die Augen nieder. Hanzo fuhr fort:
»Juro wird Ihnen alles gesagt haben. Er muß das auch, da er Ihr Bräutigam ist. Und Sie werden ihm recht geben, nicht wahr?«
Elisabeth blickte angstvoll auf.
»Ich – ich kann es ja nicht leugnen: – ja, ich gebe ihm recht.«
»Das ist ganz richtig!« entgegnete Hanzo milde. »Sie als deutsches Fräulein können gar nicht anders. Sie halten zu Ihrem Volk; das wird Ihnen niemand verdenken. Aber anders ist es mit Juro. Der ist ein Wende, oder vielmehr, er war ein Wende; denn er ist abtrünnig!«
Da sagte sie mit ruhiger Bestimmtheit:
»Er hat seine Überzeugung und handelt nach seiner Überzeugung; wenn er das nicht täte, wäre er kein Mann.«
Nun schlug Hanzo die Augen nieder. Elisabeth fuhr fort:
»Ich bitte Sie, daß Sie sich mit ihm versöhnen, daß Sie zugeben, er muß nach seiner Überzeugung handeln.«
»Nein, das kann ich nicht«, sagte Hanzo fest und bestimmt.
»Geben Sie nicht zu, daß er bloß der inneren Macht folgt, die ihn leitet? Glauben Sie, er sei schlecht?«
Hanzo sah vor sich hin.
»Das ist eine schwere Frage«, sagte er beklommen.
Elisabeth stand auf. Ihre Stimme floß jetzt ruhiger, aber es war ein bitterer Ton darin, als sie sagte:
»Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin noch ein unerfahrenes Mädchen, aber ich habe immer gehört, man dürfe zwar eine fremde Meinung bekämpfen, aber man dürfe den, der sie hat, nicht für schlecht halten, nur weil er anders denkt als man selbst denkt.«
»Wollen Sie sich nicht wieder setzen, gnädiges Fräulein?«
»Ich kann nicht. Wenn Sie glauben, daß ich der Schlechtigkeit das Wort rede, kann ich ja nicht hier bleiben.«
»Gnädiges Fräulein, ich denke von Ihnen das Allerbeste. Und ich will auch nicht sagen, daß Juro schlecht ist. Aber er ist so betört, er hat sich selbst so von uns getrennt, daß er für uns alle verloren ist, auch für mich.«
»So bin ich umsonst gekommen«, sagte Elisabeth in tiefer Niedergeschlagenheit und setzte sich langsam wieder auf ihren Stuhl.
»Vielleicht hat es Gott so gefügt, gnädiges Fräulein,« entgegnete Hanzo bewegt, »daß Sie doch gekommen sind, daß Sie diese gute Tat vollbracht haben, damit mir altem Mann ein Trost wird, denn ich habe den Trost sehr nötig.«
Das Mädchen saß regungslos da.
»Das eine können Sie Juro sagen, daß ich über die Verbindung mit Ihnen glücklich bin und daß ich euch Gottes Segen wünsche.«
»Vater Hanzo!«
Das deutsche Mädchen sprang auf. Zitternd stand sie vor dem wendischen Bauern, und plötzlich umschlang sie seinen Hals.
»Gott segne Sie, Elisabeth!« sagte Hanzo und küßte das Mädchen ehrfürchtig, aber auch zärtlich auf die Stirn. Ein schönes, stilles Weilchen blieben die beiden so, dann sagte Elisabeth:
»Und darf ich ihm auch sagen, daß Sie keinen Groll auf ihn haben?«
Hanzo antwortete ausweichend:
»Sagen Sie ihm, ich wünsche ihm Gottes Segen zu allem, was er tut, ausgenommen das, was er gegen die Wenden tun will.«
»Er will nach seiner Überzeugung gar nichts gegen die Wenden, alles für die Wenden tun.«
»Diese Überzeugung verwerfe ich. Gott wird sie zunichte machen.«
Dabei blieb es. Hanka kam. Sie brachte eine Flasche Wein und drei Gläser. Auf Geheiß des Hausherrn setzte sie sich, aber sie setzte sich ganz abseits. Der alte Hanzo füllte die Gläser und trank Elisabeth zu:
»Herzlich willkommen!« sagte er warm.
Auch Hanka stieß mit Elisabeth an. Das Glas zitterte leise in ihrer sonst so kräftigen Hand, und ihr »Willkommen« war kaum vernehmbar. Auch Elisabeth war wieder verwirrt. Sie suchte nach irgendwelchen Worten.
»Nicht wahr – Sie – Sie haben sich dieser Tage verlobt? Darf ich Ihnen Glück wünschen? Es kommt von Herzen!«
Hanka sah zum Fenster hinaus.
»Ich danke!« sagte sie.
»Es war in derselben Stube,« erzählte Hanzo, nur um die peinliche Spannung zu unterbrechen, »das ist nämlich unsere Spinnstube!«
Dann fragte er nach der letzten Ernte des Vaters. Elisabeth gab freundliche Auskunft, und die Spannung ließ etwas[183] nach. Sie sagte auch, daß der Vater Herrn Hanzo gut kenne; sie seien schon einigemal Wahlmänner zusammen gewesen, auch einmal Geschworene.
»Ja, das stimmt«, sagte Hanzo. »Ich hätte nicht geglaubt, daß sich der gnädige Herr darauf erinnert.«
So ging es noch eine kleine Weile. Da stand Elisabeth auf.
»Ich muß jetzt gehen. Es wird so zeitig finster.«
Da ging Hanka rasch hinaus. Nicht lange darauf fuhr ein Wagen vor. Es war Hanzos guter Glaswagen mit den beiden Kutschpferden, das Staunen aller wendischen Kleinbauern. Der deutsche Knecht Wilhelm saß auf dem Bock.
»Elisabeth, erlauben Sie mir, daß ich Sie so weit fahren lasse, bis Sie in Sicherheit sind, und daß ich Sie begleite. Der Weg ist lang und einsam.«
»Ich bin Ihnen dankbar,« sagte Elisabeth erfreut, »wenn ich mich auch nicht fürchte. Es geschieht selten eine Schlechtigkeit in der Wendei.«
Hanzo lächelte, sagte aber nichts. Mit tadelloser Höflichkeit, die er sich in den langen Jahren eines an öffentlichen Ehren nicht armen Lebens angeeignet hatte und die auch der Güte seines Charakters entsprach, geleitete er Elisabeth zum Wagen, nachdem er ihr nochmals für ihren Besuch gedankt und ihr gesagt hatte, er werde ihr ihn nie vergessen.
An der Haustür trafen Hanka und Elisabeth noch einmal zusammen.
»Leben Sie wohl, Fräulein Hanka, und haben Sie vielen Dank.«
»Ich wünsche glückliche Heimfahrt, und wir danken für den Besuch«, sagte Hanka, die die Stelle der Hausfrau vertrat.
Einen Augenblick ruhten die Hände der Mädchen ineinander. Bald darauf fuhr der Wagen zum Hofe hinaus. Unterwegs plauderte Hanzo mit Elisabeth über alltägliche Dinge. Erst, als sich der Weg zu Ende neigte, wurden beide wieder sehr ernst.
»Kommen Sie doch einmal mit zu uns«, bat das Mädchen. »Und wenn es auch nur auf eine Viertelstunde wäre.«
»Nein, Elisabeth, das kann ich nicht. Das brächte ich jetzt nicht fertig. Wenn Juro fort sein wird, werde ich Ihnen und Ihrem Herrn Vater einen Besuch machen.«
»Darf ich – darf ich – gar keine Hoffnung mitnehmen?«
Hanzo antwortete nicht gleich.
»Wenn Juro von seiner Idee lassen würde, dann wär' alles gut.«
»Das tut er nicht.«
»Nun, da bleibt uns nichts übrig, als auf die Zeit zu hoffen.«
Sie erreichten einen Seitenweg, der nach dem Witholdschen Schlosse führte, das jetzt ganz nahe war; da stieg Elisabeth aus, und der Wagen kehrte um.
Hanzo sah noch einmal aus dem Fenster auf das Mädchen, das ihm in tiefer Traurigkeit nachschaute.
Samo war aus der Stadt zurückgekehrt und hatte gehört, wer dagewesen sei und daß der Vater im guten Wagen den Gast nach Hause geleitet. Samo war mit rotem Kopf nach Hause heimgekommen. Er hatte in einem Gasthaus für das Slawentum der Wenden große Reden gehalten und dabei viel getrunken. Nun rief er nach Hanka. Barsch stellte er eine Frage wegen des Besuches. Das Mädchen gab ihm ruhige Auskunft. Da blitzte es zornig auf in den Augen Samos. Grimmig fuhr er das Mädchen an:
»Du führst die Deutsche selbst ins Haus, du rufst ihr den Alten herbei, du trägst ihr Wein zu, du bestellst ihr die Fuhre – was hat sie dir denn für Trinkgeld gegeben?«
»Samo!«
Das Mädchen richtete sich beleidigt auf.
»Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe nur das getan, was die Gastfreundschaft gebietet.«
»Gastfreundschaft gegen Deutsche gibt's nicht«, rief Samo. »Gastfreundschaft gibt es gegen Hottentotten, Indianer, Kannibalen und sonst noch einigermaßen achtbare Völker, aber[185] nicht gegen Deutsche! Wendische Gastfreundschaft gegen Deutsche ist die Gastfreundschaft der Schafe für den Wolf!«
Hanka wandte ihm ohne Antwort den Rücken und ging fort.
Als der Vater nach Hause kam, erneuerte sich der Streit. Der alte Hanzo wurde blaß.
»Mir scheint,« sagte er, »noch bin ich der Herr in meinem Hause, und wenn es so anfängt, dann will ich mir doch noch alles anders überlegen.«
Samo zuckte die Schultern.
»Es muß doch anders kommen. Schon fängst du an nachzugeben. Schon versuchen sie mit List und Schmeichelei das zu erreichen, was sie mit Gewalt nicht bekommen können. Die Wenden sind dann verloren.«
»Sie sind nicht verloren! Ich habe um keinen Fuß breit nachgegeben. Was das Mädchen getan hat, war gut und brav, und deine Anschuldigung fällt auf dich zurück. Mir scheint, Gott hat mir zwei wackere Schwiegertöchter zugedacht; was ich aber von meinen beiden Söhnen denken soll, weiß ich nicht mehr.«
Auch der Vater ließ ihn stehen.
Da lief Samo aufs Feld hinaus, wo es bereits dunkelte. Er traf die alte Wičaz, die mit Paketen aus der Stadt kam.
»Nun, Alte, was sagen die Leute zu meiner Verlobung?«
»Die meisten freuen sich.«
»Die meisten? Nicht alle?«
»Hm – es gibt doch viele, die schon halb deutsch sind, die beim Militär gewesen sind oder in deutschen Dienststellungen. Denen gefällt der Herr Juro gar nicht schlecht.«
»So, er hat also wendischen Anhang? Großen Anhang?«
Die Alte zuckte die Achseln.
»Tu nicht so einfältig, alte Wičaz. Was habe ich dir angetan?«
»Nichts habt Ihr mir angetan. Dem Kito, dem alten Scheusal, habt Ihr einen Pelz angetan, einen richtigen Kuppelpelz –«
»Ach ja – ich verstehe – für dich kommt's auch noch –«
Die Alte sah ihn von der Seite her listig an.
»Was ihm – dem Juro – die Leute am meisten übelnehmen, ist, daß er sich am Kronenhügel vergreifen will.«
Samos Augen glimmten auf. Ein Schein wilder Freude flog über sein Gesicht.
»Wissen denn die Leute von dieser Absicht?« fragte er möglichst ruhig.
»Es spricht sich so langsam herum.«
»Es könnte nichts schaden, wenn es sich etwas schneller herumspräche«, sagte Samo und schenkte der Alten einen Taler.
Sie nickte.
»Früher wolltet Ihr das nicht! Aber man kann das schon machen.«
»Also mache es! Daß ich nicht geizig bin, weißt du!«
Er nickte ihr zu und ging allein weiter.
»Oho,« sagte er bei sich, »ich wäre ein Esel, wenn ich es mir so dumm verderben würde wie Juro. Ich muß sehen, daß ich die Geschichte mit Hanka und dem Alten wieder ins Geleise bringe.«
Wie mag nur ein Winter im Föhrenwald vergehen, wenn alles so tot und still ist draußen und dieselben Menschen immer zusammenhocken in derselben niederen Stube? Zuletzt lachen sie wohl nicht mehr, reden wohl nicht mehr, wissen sich nichts mehr zu sagen!
Sind sie nicht wie Gefangene? Weg und Steg verschneit, das liebe Brot schmal, der Beutel leer, das Herz leer.
Dann sind wohl manche wie stumpfe Tiere, die mit der Kette an magerer Krippe hängen, dumpf hinstarren vor sich in die grausige Langeweile. Und die anderen, die die Sehnsucht kennen, wandern aus. Im fahlen Schneelicht reist ihre Seele nach großen Städten, wo die prangenden Theater sind, wo die schönsten Frauen der Erde in lichtstrahlenden Sälen tanzen, oder nach den Ländern des Südens, wo jetzt die blauen Schwalben fliegen über roten Blüten.
Wie mag nur ein Winter im Föhrenwald vergehen? Im Unterland, wo die Sprewja breit und vielfach verzweigt ist, ist jetzt lustige Zeit. Da laufen selbst die alten Weiber auf Schlittschuhen, und jeder Bursch fährt seine Liebste auf dem Schlitten. Die Unterländer sind lustig, aber leichtsinnig; die ernsteren Oberländer haben das immer behauptet und immer etwas auf die Spreewaldleute herabgesehen.
Doch auch sie wollen ihr Vergnügen, und auch in ihren stillen Stuben stirbt das Lachen nicht in der langen einsamen Zeit. – –
Der alte Kito steht im Hof und unterhält sich mit einem Sperling.
»Was, wrobel[52], was sagst du? ›Lieber Kito, 'ne Ähre‹? Das sagst du? Und was sangst du im Sommer? ›Dem Kito 'n Strick, dem Kito 'n Strick!‹ Und was sangst du noch im Herbst: ›Korn ist Dreck, Korn ist Dreck!‹ Wart, wrobel, ich schmeiß dich tot!« Und er warf nach ihm mit fünf Haferkörnchen.
Es ist doch gut, daß die Lieder sind und die alten Sagen und die alten Bräuche. So schläft die Seele nicht ein. Und auch der Magen fühlt sich wohl dabei. Am Sebastianstag muß auch der Ärmste sein Pfund Fleisch essen, sonst wird das Vieh krank, muß geschlachtet werden, und es gibt bald Fleisch in Fülle.
Dann kommt die lustige Faschingszeit. Welcher Spaß ist größer, wo in der Welt wird herzlicher gelacht, als wenn in den Spinnstuben am cazowečor[53] sich die Burschen und Mädel gegenseitig die Gesichter mit Ruß schwärzen? Am Faschingsdienstag gar schallt der stille Föhrenwald wider von jubelndem Lachen, wenn die Burschen »zampern« gehen, alle als Weiber verkleidet, jeder mit einem großen Korb, in dem er Speck und Eier einsammelt. Wer ein einziges Mal den alten Kito in der Tracht eines jungen Mädchens gesehen hat mit dem gestickten Busentüchlein und der großen Bänderhaube und dem bunt[188] gestreiften Rock, der vergißt es sein Lebtag nicht. Dieses Jahr ist er aber nicht als junges Mädel, sondern als alte Wičaz gegangen, hat mit verklebten Federspulen, in die er gelbe Sandstückchen getan hatte, die wie Wanzen aussahen, überall Schrecken und Angst erregt, zumal er die Spulen den Weibern in den Nacken steckte. Auch hat er Karten gelegt und unerhörte Dinge geweissagt, so, daß auf den Sonntag der Montag treffen wird und daß ein Dreierlicht auch dann noch einen Dreier kosten wird, wenn das Wachs aufschlagen sollte. Die wirkliche Wičaz ist ihm nachgegangen, und die beiden Wičaze, die echte und die unechte, sind sich in die Haare geraten, und so ein schöner Spaß ist noch nie und nirgends dagewesen. Oh, es lebt sich lustig und herrlich zur Winterzeit im Föhrenwald! Und »am Ostermorgen tanzt die Sonne«.
Hanka hat mit ihren Spinnmädchen am Karfreitag draußen gestanden auf dem freien Feld, sie sind feierlich im Kreise zusammengetreten und haben gesungen: »Nět daj moj Jezus dobru noc«, »Nun gib, mein Jesus, gute Nacht«, und als am Karsamstag Mitternacht vorbei war, haben die Burschen in allen Dörfern geschossen; Hanka aber ist, noch ehe die Sonne aufging, schweigend mit einem Krüglein zur stillen Spree gegangen und hat Osterwasser geholt; das wird sie nun gesund erhalten das ganze Jahr. Viele Mädchen und Frauen sind ihr begegnet, keine hat ein Wort gesprochen.
Ja, am Ostermorgen tanzte die Sonne! Winter war aus, neues Leben kam in die Heide.
Und auch der Sommer verging.
Hanka war zu ihren Eltern zurückgekehrt, als ihr Bräutigam Samo als »Pán doctor« nach Hause gekommen war.
Mit gewaltigem Respekt betrachteten die Dorfleute den jungen Arzt. Ja, es kam so weit, daß die Bäuerin Pösch, die die Rose bekam, allen Ernstes daran dachte, sich den neuen Doktor rufen zu lassen, wenn sie es zuletzt doch nicht vorgezogen hätte, sich lieber von der Wičaz »besprechen« zu lassen.
Samo war nicht lange zu Hause geblieben, sondern wieder nach Prag gefahren. Von dort war er erst nach Monatsfrist zurückgekehrt.
So ging der Sommer vorbei. Wieder spielte der junge Herbst mit den gelben Blättern, die auf der Spree schwammen, wie mit kleinen Schifflein. Ein Jahr und einen Tag war es nun her, seit Mariana, die Frau des Scholta, gestorben war.
Da war die Trauerzeit zu Ende.
Und zwei Tage später war die Hochzeit Samos mit Hanka. Sie fand in Hankas Heimatsort statt. Kito als Brautführer war schon einige Wochen vorher daselbst eingetroffen, um alles vorzubereiten. Denn der Bräutigam hatte ausdrücklich gewünscht, daß bei seiner Hochzeit alles genau nach der Väter Sitte hergehe. Und alle Leute lobten den Bräutigam, der, obwohl er ein Pán doctor war, sich nicht stolz von ihnen und ihrer Art absonderte.
So erschien Samo in wendischer Bauerntracht, den kleinen Rautenkranz auf dem Kopf, am Hochzeitsmorgen vor der Tür der Braut. Alle Männer, die ihn begleiteten, trugen lange, buntbebänderte Stöcke. Eine Musikbande war auch dabei. Ein Fiedler strich die husla, die dreisaitige wendische Geige; ein anderer Musikant entlockte seiner tarakawa schreiende Oboetöne, die Hauptsache aber war der Dudelsackpfeifer, dessen kozol mit einem mächtigen gehörnten Ziegenbockkopf gekrönt war.
Kito, der družba, klopfte an die verschlossene Tür des Hochzeitshauses, begehrte Einlaß und verlangte die Braut heraus. Ein altes Weib mit einem mächtigen Höcker wurde durch die Tür geschoben.
»Was, das soll die Braut sein?« schrie der družba. »Ich schlag' ihr den Buckel entzwei.«
Und er schlug mit seinem Stock auf den Buckel, der auch wirklich zersprang, weil er aus einem untergebundenen Topf hergestellt war.
Nun wurde ein junges Mädchen durch die Tür geschoben. Aber auch jetzt schrie Kito:
»Das ist nicht die Braut! Das ist nur die družka[54]. Der zagolka[55] soll sie bekommen.«
Endlich kam Hanka im Brautstaat. Sie war blasser als sonst, aber sie lächelte. Mit großem Lärm wurde sie empfangen. Nun ging es ins Haus hinein zum Frühstück. Der Bräutigam mußte sich von der Braut fernhalten; nur der družba hatte das Recht, ihr Kavalier zu sein. Kito strahlte vor Stolz und Freude. Und er sorgte für alles. Er fragte die Mutter, ob sie der Tochter auch einen Taler in den Strumpf gesteckt, ob sie ihr auch Salz in den Schuh geschüttet habe, damit der Reichtum nicht ausbleibe, und ob sie auch nicht vergessen habe, ihr ein Äpflein mitzugeben, damit der Kindersegen nicht fehle. Er wolle gewiß drei Bissen Brotes unterwegs essen, damit die Ehe eine glückliche werde.
Alles war erfüllt. Alle Vorzeichen waren gut. Zunehmender Mond war, und es war Dienstag, der beste Tag für eine Hochzeit.
Zur Trauung ging es zu Wagen, und wieder war Kito der Begleiter der Braut. Kinder und große Leute standen am Wege, Zuckerwerk und kleine Münzen wurden ausgestreut, und es war Jubel aller Enden.
Unterwegs geschah aber etwas, worüber sie alle erschraken. Eine Kuhherde kreuzte den Weg. Der Brautwagen mußte anhalten. Das war kein gutes Zeichen. Kito aß nun neunmal drei Bissen trockenes Brot, um den Zauber abzulenken, und sagte nach dem siebenundzwanzigsten Bissen: »Jetzt bin ich zwar satt, und das ist schade an einem solchen Tage, zumal, wenn man sein Lebtag nicht immer an der Bratenpfanne gesessen hat; aber nun wird doch alles gut gehen in der Ehe.«
Hanka nickte freundlich. Sie war sehr still in allen diesen Tagen und ließ alles schweigend über sich ergehen.
Bei der Rückkehr aus der Kirche hielt der Wagen vor dem Tor. Die Mutter kam aus dem Hof. Sie hielt einen neuen Topf mit Milch in der Hand. Daraus tranken Bräutigam und[191] Braut, und der družba zerschellte darauf den Topf an einem Stein. Nun ging die ganze Hochzeitsgesellschaft in den Hof; der družba hielt eine Rede, in der er wieder Abbitte leistete für alles etwa geschehene Unrecht, dann setzte die Musik ein, und es wurde im Hofe getanzt.
Und dann wurde geschmaust und gegessen den ganzen Tag lang und in der Schenke die ganze Nacht getanzt.
Es waren aber zu dieser Hochzeit Gäste von nah und fern gekommen, Gäste, die nicht zur Verwandtschaft und nächsten Freundschaft gehörten, sondern Ehren halber als Vertreter großer Gemeinden oder Bezirke vom Kral eingeladen worden waren.
Einer von diesen Leuten traf bald nach dem Essen mit Hanzo im Großgarten zusammen und sagte:
»Höre Kral, ich muß dir etwas sagen. Da wir nun zu diesem frohen und schönen Feste so viele Dorfväter beisammen sind, so wollen wir etwas besprechen und abmachen, was allen von uns sehr am Herzen liegt. Dein Sohn Juro ist nicht hier, obwohl sein einziger Bruder Hochzeit hält.«
Hanzo errötete leicht.
»Juro ist auf einer Reise,« sagte er; »er ist jetzt in Italien.«
»Ja, und er ist vier Wochen vor der Hochzeit dorthin gereist. Aber das geht uns nichts an. Etwas anderes müssen wir mit dir abmachen. Sieh, Hanzo, du bist noch nicht alt, und Gott soll dir noch viele Jahre schenken. Aber deine Frau war auch nicht alt und starb doch. ›Ihr wisset weder den Ort noch die Stunde‹, sagt die Bibel. Wenn du nun einmal den Tod finden wirst, müssen unsere Leute wissen, wer ihr Kral ist. Und ihr Kral kann dann nur Pán Samo sein.«
Hanzo schwieg.
»Er hat heute«, fuhr der andere fort, »die Hanka geheiratet, das einzige Mädchen, das noch aus der Familie des alten Kral ist. Er hält zu uns, er beachtet unser Volk; er soll unser Kral sein.«
Hanzo entgegnete darauf:
»Der Erbsohn ist Juro, und er hat sein Recht nicht abgetreten und will es auch nicht abtreten.«
»So müssen wir ihn absetzen, und zwar werden wir ihn heute absetzen.«
»Nicht heute«, wehrte Hanzo ab.
»Warum nicht heute? Heute ist der richtige Tag. Wann werden wir wieder so viele beisammen sein, die da mitzureden haben?«
»Wir können uns am Martinimarkt in der Stadt treffen.«
»Wozu willst du den Aufschub?«
»Ich möchte es nicht hinterrücks tun. Ich will meinem Sohn Juro schreiben, was ihr vorhabt; dann kann er sich verteidigen.«
Der andere sagte mit finsterer Miene:
»Er kann sich nicht verteidigen. Er hat offen und vielmal gesagt, daß er kein Wende, daß er ein Deutscher ist; er hat sogar gesagt, er werde den Kronenhügel aufgraben, um den Wenden zu zeigen, daß ihr Glaube Dummheit ist, daß in dem Hügel keine Krone ist, sondern nur Erde und Steine. Und das kann ihm nicht verziehen werden.«
»Er hat es doch nicht getan! Er scheut sich doch und weiß, es wäre ein Verbrechen.«
»Aber er wird es tun«, sagte der andere. »Er hat es bestimmt gesagt.«
»Wissen viele Leute davon?« fragte Hanzo trostlos.
»Alle!« entgegnete der andere.
»Woher wissen sie es? Er schreit es doch nicht auf die Straße.«
»Das kann ich nicht sagen. Es ist in aller Mund. Und alle wissen, was Juro gegen die Wenden gesagt und getan hat – alle! Es ist alles gegen ihn. Und es wird täglich schlimmer.«
Sie schwiegen beide. Dann fuhr der andere fort:
»Bezwinge dich, alter Hanzo! Es mag schwer sein, aber es muß sein! Treten wir zusammen, die wir hier sind, und machen wir es aus. Einmal muß es doch sein.«
»Heute nicht! – Njok!«
Mit diesem »Njok!«, diesem messerscharfen, endgültigen: »Ich will nicht!« schnitt der Kral die Unterhaltung ab. Kein Widerspruch erfolgte mehr.
War auch die Zeit längst vorbei, wo der Kral eine heimliche Kopfsteuer erhielt, so war doch sein Einfluß so stark, sein Wille so mächtig, daß alle anwesenden »Volksvertreter« sich dem »Njok!« Hanzos fügten und die »Absetzung« Juros, sein Ausschluß von der Kralswürde, auf eine große Gromada am Martinimarkt vertagt wurde.
Im Kretscham saß Samo auf der Bank und sah dem Tanz zu. Mit seiner jungen Frau durfte er nicht tanzen. Auch mit den Brautjungfern durfte er sich nur dann im Kreise drehen, wenn es der allmächtige Družba erlaubte. Der Bräutigam ist im Wendenland an seinem Hochzeitstag rechtlos.
Es war Samo ganz lieb so. Am liebsten wäre er fortgegangen, hinaus in die Nacht. Es war ihm eigen zumute. Wenn er Hanka ansah, die nun seine Frau war, dann sagte er sich wohl, daß sie ihm gefalle. Von Liebe wußte er nichts, hatte er nie etwas gewußt. Das war töricht Zeug für Schwärmer und unreife Menschen, nichts für ihn.
In seiner Brust herrschte nur das eine: maßloser Ehrgeiz. König sein, wenn auch ein heimlicher König, wenn auch nur ein König über ein kleines, unterjochtes Volk! Aber im Glauben eines Volkes an erster Stelle stehen! Der Mann sein, auf den auch die Slawen anderer Länder mit ehrfürchtiger Scheu sahen, dem alte Leute die Hand küßten und für den der gelehrte Krok die Krone Przemisls aus dem Tabernakel nahm!
Oh, das war etwas Großes, das zu erstreben sich lohnte! Und dann den heimlichen, zähen Kampf führen mit dem Soldatenkönig in Berlin! Sich äußerlich bescheiden und doch wissen: ich stehe auf Vorposten gegen dich und bahne den slawischen Brüdern einen Weg vor die Mauern deiner Stadt! Um das zu erreichen, nahm man alles, was Geschmack und[194] Bildung schwer genießbar machten, willig hin, ließ man sich von einem Družba tyrannisieren, trank man mit den Burschen ein Glas Branntwein ums andere. – –
Am selben Tage, da Samo und Hanka im Wendenlande Hochzeit hielten, saß Juro mit seinem Freunde Heinrich von Withold auf dem Posilip bei Neapel. Und er träumte hinüber zu den silbernen Städten Castellamare und Sorrent und nach Capri und Ischia. Die schönste Inselflur der Welt lag vor ihm. Weit hinaus dehnte sich das blaue Meer. Da war es ihm, es geschähen Wunder vor seinen Augen, als seien Märchen zur Wahrheit geworden, Träume in Erfüllung gegangen; Märchen und Träume, denen seine junge Seele nachging, als er noch einsam im Wendenwald war.
Ja, hier war die Welt schön und darum groß und reich. Und war auch das Volk ärmlich gekleidet, es war dennoch reich, denn es hatte immer Herrlichkeiten leibhaftig vor Augen, von denen selbst Königspaläste nur mit matten Bildern ihre Wände schmücken konnten.
Aber es geschah, daß die Seele des Wendensohnes beim Rauschen des blauen Südmeeres und beim Duft der roten Mandelblüten das Heimweh überkam nach den Sandwegen der Wendei, nach den Föhren an der stillen Spree. Und das geschah, weil er nicht nur von der Heimat weg eine Reise getan, sondern weil man ihn aus der Heimat verbannen wollte.
Das Menschenherz lenkt auch im glänzendsten Exil seine Sehnsucht nach Hause. –
Seit Weihnachten hatte Juro mit seinem Vater mancherlei Briefe gewechselt. Er war ihm aber dadurch nicht näher gekommen, nein, die Kluft hatte sich noch vertieft. Schließlich hatte ihm der Vater sogar gegen seinen Willen sein mütterliches Erbteil auszahlen lassen.
Das war der Bruch; damit sollte Juro völlig ausgeschlossen werden von dem heimischen Hof.
Eine tiefe Bitternis war über Juro gekommen. Seine frohe,[195] selbstbewußte Art drohte in finsteren Trotz umzuschlagen. Er war oft schweigsam und müde wie ein Kranker. Da kam Samos Hochzeit immer näher heran. Samo lud den Bruder erst auf ausdrücklichen Befehl des Vaters zu dem Fest; er tat es in der denkbar kältesten Form. Juro schlug die Einladung aus, und um allen Peinlichkeiten zu entgehen, um sich andererseits zu zerstreuen und wieder einmal Sonne in die Seele zu bekommen, begab er sich mit seinem Freunde auf die Reise.
Oh, wohl war es schön in Florenz und Rom, wohl war es ein Genuß, mit Heinrich, der seit Jahren Kunstgeschichte studiert hatte, durch die Museen zu wandern, wohl war es herrlich hier am alten Posilip! Aber die Bitterkeit wich nicht ganz aus Juros Herzen, und als einmal Musikanten ein italienisches Volkslied sangen, sagte er:
»Wir haben ein ähnliches Lied; ich finde es sogar schöner.«
Und er sang dem Freunde leise das Lied vor – in wendischer Sprache. – – –
Nach zwei Monaten kehrten sie heim. Da fand Juro in seiner Breslauer Wohnung einen Brief des Vaters vor. Der Vater machte ihm die Mitteilung, daß die Vertreter der wendischen Gemeinden beschlossen hätten, ihm die künftige Kralswürde abzusprechen auf Grund seines feindlichen Verhaltens gegen das Wendentum und vor allen Dingen auf Grund seines geäußerten Vorsatzes, den Kronenhügel aufzugraben und das Nichtvorhandensein der alten Krone der Wenden nachzuweisen. Am Martinitage mittags solle in dem und dem Lokal die Ausschließung Juros von der Kralswürde erfolgen. Es sei Juro anheimgestellt, bei dieser großen Gromada zu erscheinen und daselbst seine Sache zu führen, wolle er aber klug handeln und seinem Vater einen Schmerz ersparen, so solle er vorher durch freiwilligen schriftlichen Verzicht das traurige Schauspiel unnötig machen.
»So wirf ihnen doch die ganze Geschichte hin«, sagte Heinrich, der mitanwesend war und den Brief ebenfalls las. »Das ist doch alles Humbug! Darum wirst du dir doch nicht das Leben verbittern!«
»Nein!« rief Juro, »nein! Ich gebe nicht nach!«
»Aber, Mensch, du siehst doch, daß du sowieso keinen Einfluß auf die Wenden hast. Wozu also dieses trotzige Festhalten an dieser phantastischen Würde? Bei denen wirst du nichts ausrichten, auch wenn du der eingebildete zukünftige Kral bleibst.«
»Ich werde etwas ausrichten, denn ich bin nicht ohne Anhang. Die Jungen, die einmal ins Land hinausgerochen haben, die sind denn doch anders als die alten Nesthocker. An die Jungen muß ich mich wenden. Ich werde jetzt wirklich den Kronenhügel aufgraben!«
»Das laß nur hübsch bleiben! Das könnte dir schlecht bekommen!«
»Mir kann nichts mehr schlechter bekommen als dieser Brief meines Vaters. Vor allem aber weiche ich meinem Bruder Samo nicht, dessen Hand ich hinter all diesen Machenschaften deutlich sehe. Die Wenden allein wären viel zu schläfrig, viel zu indolent, um so vorzugehen. Es ist einer, der hetzt und das alles leitet, und das ist Samo.«
»Das ist allerdings auch meine Ansicht. Tue also, was du nicht lassen kannst!«
Ein niederes, aber sonst geräumiges Hinterzimmer in einem wendischen Gasthof. Um einen ungedeckten Tisch sitzen zwölf Männer, darunter Hanzo und Samo. Jeder hat ein Glas Wein vor sich stehen, das Hanzo bestellt hat. Es herrscht bedrücktes Schweigen. Die Rathausuhr draußen schlägt zwölf. Da tritt Juro ein.
»Pomogaj Bóg wam!« grüßt er. Er hat sich nach langem Überlegen zu dem wendischen Gruß entschlossen.
»Bóg žekuscho!« kommt es bedrückt zurück.
Juro geht auf seinen Vater zu und streckt ihm die Hand hin, die dieser langsam ergreift. Nun reichen auch die anderen Männer zögernd die Hand. Seinen Bruder Samo übersieht Juro völlig.
»So wollen wir in Gottes Namen beginnen«, sagt der alte Hanzo mit etwas zitternder Stimme. »Ihr habt mich zum Leiter dieser Versammlung gewählt. Es ist Klage gegen Juro, meinen ältesten Sohn. Die Klage will ich nicht selbst vorbringen, sondern das wird der Bur Klin tun.«
Der Bauer Klin war sonst ein Wichtigtuer und Maulheld. Heute aber stotterte er und versprach sich oft, als er Juro, der für ihn der gelehrte und gebildete Mann war, die Anklage ins Gesicht sagen mußte. Aber er stammelte doch die Anklage heraus: Juro sei gegen das Wendentum, er habe in diesen und diesen Fällen Wenden schwer beleidigt, er habe die wendischen Gebräuche nicht nur selbst gemieden, sondern auch gesagt, er wolle sie ausrotten, er habe die wendische Sprache geschmäht, er habe öffentlich erklärt, er wolle alle Wenden zu Deutschen machen; endlich, er wolle sich am heiligen Kronenhügel vergreifen und nachweisen, daß es überhaupt keine wendische Krone gebe. Darum sei das Volk eines Sinnes, daß ein solcher Mann nicht der zukünftige Kral sein könne.
»Hat noch jemand der Anklage was hinzuzufügen?« fragte Hanzo.
»Ja«, rief Samo. »Die Hauptsache ist, daß er sich im Wendenland festsetzen und den Einfluß, den er als erstgeborener Sohn des Kral hat, dazu mißbrauchen will, unser Kraltum zu vernichten und die Wenden den Deutschen auszuliefern.«
Nun bekam Juro das Wort.
»Ich möchte zuerst fragen: Ist mein Bruder Samo ansässiger Bürger oder Bauer der Wendei, hat er in einer Gemeinde bereits Sitz und Stimme?«
»Nein!«
»Also gehört er nicht hierher, und ich bitte, ihn von dieser Versammlung, in der er nichts zu suchen hat, auszuschließen.«
Es ging ein Tumult los. Es wurde durcheinandergeredet. Der Erfolg war, daß Samo bleiben durfte.
»Gut,« sagte Juro, »so bleibt er gegen alles Recht. Ich werde annehmen, daß auf seinem Platze eine Säule nicht ganz reiner Luft sei!«
Samo sprang auf, es gab neuen Tumult; Hanzo verwies Juro die getane Beleidigung aufs strengste und forderte ihn auf, sich zu der Klage, die der Bauer Klin im Namen aller hier vorgebracht habe, zu äußern.
Da überkam Juro seine Spottlust.
»Pán Klin,« begann er, »Ihr habt eine gewaltige Rede gegen mich geführt, und deshalb sage ich: Ihr müßt in den Landtag gewählt werden.«
Hanzo stand auf. Seine Augen funkelten zornig.
»Juro, es ist höchst unangebracht, hier zu spotten; es ist uns heiliger Ernst!«
»Es ist mir auch Ernst«, erwiderte Juro. »Um aber noch einmal auf den Landtag zu kommen; warum habt ihr Wenden keinen Vertreter dort, warum seid ihr politisch so rechtlos? Warum habt ihr nicht einmal versucht, eure Stimme zu erheben? Weil ihr rückständig seid, weil ihr eure Zeit verträumt und selbst nicht so viele Rechte in Anspruch zu nehmen wagt wie alle anderen Kinder des Staates.«
Unwilliges Murren.
»Wenn ihr auch murrt, die Wahrheit muß ich euch sagen. Und wie ihr keinen wendischen Abgeordneten habt, so habt ihr auch keinen wendischen Arzt …«
»Samo!« schrien sie. »Samo!« Juro zuckte die Achseln.
»Habt ihr keinen wendischen Arzt,« wiederholte er, »keinen Advokaten, keine Gelehrten, kein großes Kaufhaus, kein Theater oder sonstiges Kunstinstitut. Warum seid ihr so arm? Oh, nicht ihr, die ihr hier seid! Ich weiß, jeder von euch ist ein Bur und hat soundsoviel Hufen Landes. Aber die Mehrzahl, warum ist sie so bettelarm? Warum wohnen so viele in windschiefen Hütten, essen so schmales Brot, haben so wenig Freude? Weil ihr Wenden seid! Wäret ihr Deutsche, es ginge euch allen zehnmal besser!«
»So haben uns die Deutschen unterdrückt!« sagte einer.
»Das ist nicht wahr! Die Deutschen haben stets in Frieden mit euch gelebt und ihr mit ihnen, bis eine gewissenlose Hetze eingesetzt hat. Ich frage euch, was wollt ihr eigentlich? Ewig[199] sitzen bleiben auf euren paar Dörfern, da man eure Sprache schon in Bautzen oder in Kottbus nicht mehr richtig versteht? Da in den Hauptstädten der Länder, zu denen ihr gehört, in Berlin und Dresden, die meisten Leute nicht einmal recht wissen, was ein Wende ist, geschweige, daß sie je ein wendisches Wort gehört hätten?! Könnt ihr paar Leute heutzutage noch daran denken, einen eigenen Staat zu bilden? Seht ihr nicht ein, daß das lächerlich ist? Ein Staat, wo ihr nicht einmal einen Abgeordneten zustande bringt? Aber freilich, ich kenne Leute, die hinüberschielen zu den Tschechen. Nicht ihr! Ihr habt euch euer Leben lang nicht um die Tschechen gekümmert, trotz aller Versuche, die von dort gemacht worden sind. Die Tschechen waren euch hundsegal; es gibt sogar viele, die dem wendischen Schmied Stosch recht geben, der den Buchdrucker Schmaler für einen Todsünder erklärt, weil er in eure Gesangbücher die tschechische Schreibweise eingeführt hat. Ihr seid von Kindheit an brave, zuverlässige Preußen oder Sachsen gewesen, und so wie ihr waren es eure Väter und Urväter. Ist das so?«
»Ja, das ist so!«
»Nun denn, wenn ihr gute Preußen oder gute Sachsen seid, warum wollt ihr es nicht auch äußerlich sein in Kleidung und Sitte, hauptsächlich aber in der Sprache, damit auch ihr mit euren Kindern besser fortkommt in der Welt? Und wenn euch jemand zur Vernunft, zum eigenen Nutzen rät, sagt an, ist er nicht in Wahrheit euer Freund?«
Ein alter Bauer stand auf.
»Ich bin ein guter Preuße, und mein Vater und Großvater waren gute Preußen. Aber wir waren auch gute Wenden. Und dabei soll es bleiben.«
Juro wurde wieder erregt.
»Das ist die alte – die alte – ich will es nicht aussprechen. Niemand kann zweien Herren dienen! Das wißt ihr schon aus der Bibel! Man soll nur eines sein und das eine ganz! Alles andere ist Zwiespältigkeit oder schlimmer: Hinterhältigkeit. Ja, ich glaube, daß der Staat nichts verliert, wenn er euch euer Wendentum läßt. Er nicht! Er, der Staat, hat eine fleißige,[200] genügsame, ruhige Bevölkerung in einer Gegend, wo sonst nicht viel zu holen ist. Oh, der Staat ist zufrieden! Darum auch nicht die Spur von Unterdrückung, darum das Eingehen auf eure, ach so bescheidenen Wünsche. Ihr seid ja schon selig, wenn euch das Dresdener Kabinett einmal eine Verfügung in wendischer Sprache schickt. Der Staat fährt gut dabei; aber ihr fahrt schlecht, weil ihr nicht die gleichen Aussichten, nicht die gleichen Möglichkeiten habt wie die anderen. Nehmt mich zum Beispiel! Ich bin wendischer Geburt. Als ich auf die Schule kam, ist es mir viel schwerer geworden fortzukommen als den deutschen Mitschülern, weil ich das mühsam erst lernen mußte, was diese schon mitbrachten. Solcher Beispiele gibt es Tausende. Denkt an jeden Kaufmann, jeden Gewerbetreibenden, ja sogar jeden Rekruten. Die Sprache, die sonst allen eine Helferin ist, ist uns ein Hemmnis!«
»Und das ist,« rief Samo erregt dazwischen, »weil wir in einem fremden Lande wohnen. Gehörten wir zu den Tschechen, so verstände eure Sprache jedermann. Deutschland ist nicht unser Land; wir sind Slawen und gehören zu den Slawen!«
»Ich will nicht von Hochverrat reden,« sagte Juro, »der euch vereidigten Ortsvorstehern ja ganz fern liegt; ich bin auch weder Aufpasser noch Denunziant; ich will nur die ungeheure Dummheit der Tschechenillusion beleuchten. Hier hängt zu meiner Freude eine Karte von Europa an der Wand. Nun seht einmal her! Dieses kleine Fleckchen ist also Böhmen. Darin wohnen Tschechen, d. h. nur zur reichlichen Hälfte Tschechen. Die anderen sind deutsch. Nähmen wir nun wirklich zu dem kleinen Fleckchen auch Mähren hinzu, das noch weniger Tschechen hat als Böhmen, und ein bißchen slowakisches Hinterland – was käm' heraus? Ein Weltstaat, nicht wahr?! Eine kolossale Macht?! Nein, ich sage euch, es wäre ein Kleinstaat mehr, noch dazu sprachlich und national zersetzt, ein Staat, der für sich gar nichts bedeutete, der im Norden, Westen und Süden von Deutschen umklammert wäre, im Osten die Polen hätte, mit denen sich die Tschechen mäßig, und die[201] Ungarn, mit denen sie sich gar nicht vertragen. So könnte aus dem Ganzen nichts anderes werden als ein russischer Vasallenstaat, eine russische Provinz, und da wir wieder nur ein Provinzchen dieser Provinz sein könnten, so wären wir die Aftermieter der Aftermieter, und der Hausherr säße in Petersburg. Wir danken für eine solche Ehre! Wir wollen lieber deutsche Einwohner des großen deutschen Landes sein!«
Nun stand Samo auf.
»Des großen deutschen Landes,« lachte er höhnisch; »wo gibt es ein großes deutsches Land? Wo gibt es etwas Zersplitterteres, etwas Uneinigeres als dieses deutsche Land, wo gibt es etwas Lächerlicheres als diese »Frankfurter«? Wohin deine Sprache weist, da steht dein Vaterhaus, da ist deine Heimat, da ist dein Vaterland!«
Der Streit hatte sich zu einem Wortgefecht zwischen Juro und Samo ausgewachsen, das über die Köpfe der Bauern wegbrauste. Die meisten saßen mit verdrossenen Gesichtern gelangweilt da. Das bemerkte Samo eher als Juro; darum spielte er einen guten Trumpf aus:
»Wollt ihr jetzt zum deutschen Händler gehen, eure schöne Volkstracht einhandeln gegen einen schäbigen deutschen Anzug, sollen eure Frauen und Töchter nicht mehr ihre herrlichen Wendenkleider tragen dürfen, sollen die Spinnstube, die Kirmes, das Osterreiten aufhören, soll euer alter wendischer Gruß verboten sein, sollen eure wendischen Gesangbücher verbrannt, soll …«
Er wurde unterbrochen.
»Nein, nein, nein! Wir sind Wenden! Wir bleiben Wenden!« schrie es durcheinander. Alle Schläfrigkeit war vorüber.
»Wir bleiben Wenden!« rief ein alter Bauer zitternd.
»Und – und wer sich der wendischen Tracht und der wendischen Sprache schämt, der soll – der soll gehen …«
Alle stimmten ihm zu. Juro sah, wie alle seine Behauptungen und deren Beweise vor alter Gewöhnung in nichts zerflossen.
»Nun, so ist euch nicht zu helfen«, sagte er. »Die Kultur wird weitergehen auch gegen diese Gromada, und die Betrogenen seid allein ihr!«
»Und – unsere alte Krone?« fragte ein Bauer.
Alle sahen gespannt auf Juro.
»Das Kraltum ist eine Sage,« sagte er ausweichend, »eine Sage, die sich jahrhundertelang erhalten hat, von der sogar hohenzollersche Fürsten gewußt haben, die aber durch nichts und in nichts anderem begründet ist als in der Einbildung unseres Volkes.«
Der alte Hanzo sprang auf.
»Du – du – du …«
Die Stimme brach ihm.
»So stellst du mich – mich – als einen Lügner, als einen Theaterspieler hin – vor diesen – diesen Leuten …«
»Gott behüte mich – nein! Wahr spricht, der das spricht, was er glaubt!«
»Und du glaubst nicht, daß ich der Kral bin?«
»Ich weiß es nicht!«
Alle standen auf, ein großer Lärm entstand, Gläser wurden umgeworfen, einzelne Männer liefen gestikulierend in der Stube herum, alle sahen voll Abscheu auf Juro.
»Und – unsere alte Krone?« fragte nun Hanzo. »Jetzt weichst du nicht aus – jetzt frage ich dich: Unsere alte Krone?«
»Existiert nicht!«
»Der Kronenhügel …«
»Ist leer!«
»Hast du – hast du nachgegraben …«
»Nein! Aber wenn ich es täte, würde ich nichts finden als Steine und Erde!«
»Gottloser Mensch du!«
Hanzo sank auf seinen Stuhl zurück, unfähig, weiterzusprechen.
Da sprang der älteste der anwesenden Männer auf wie ein Jüngling und rief:
»Er wird es nie wagen, an den Kronenhügel zu rühren.«
Juro warf trotzig den Kopf zurück.
»Ich werde es wagen! Ich werde es nun bestimmt tun. Ich werde beweisen, daß ich recht habe!«
»Hinaus mit ihm! Das ist eine Gemeinheit! Hinaus!«
Sie drangen auf Juro ein.
Der wehrte sie ab.
»Ihr habt hier kein Gastrecht«, schrie er sie an. »Wehe dem, der mich anrührt!«
Da wichen sie zurück. Der alte Wende aber sprach:
»Wie es in der Bibel steht, so frage ich jetzt: Was haben wir noch Zeugen nötig?«
»Jawohl,« rief Juro, »so könnt ihr fragen. Die in der Bibel so fragten, waren die Pharisäer, und die Frage geschah vor dem elendesten Gerichtshof der Welt. Die paßt hierher!«
Der Alte beachtete das nicht. Er sprach mit erhobener Stimme, indem er auf Juro mit dem Finger zeigte:
»Wer mit mir der Meinung ist, daß dieser da mit den Wenden nichts mehr zu tun hat und nicht unser künftiger Kral sein kann, der stehe auf!«
Alle erhoben sich.
»So ist er für immer und ewig von uns abgesetzt!«
Juro lachte laut auf.
»Setzt mich doch ab, soviel ihr wollt! Ihr habt gar kein Recht dazu. Wer gibt euch dieses Recht? Von wem habt ihr's? Von euch selbst oder von jenem Schleicher da, der euch aufgehetzt hat?«
Es entstand ein solcher Skandal, daß Juros Worte untergingen. Schließlich hatte er zu tun, einige tätlich auf ihn Eindringende abzuwehren. Er nahm seinen Hut. An der Tür rief er noch:
»Wenn zwölf über einen herfallen, wird wohl der eine gehen müssen. Aber das sage ich euch: ich bin und bleibe der zukünftige Kral, der euch beweisen wird, daß es keinen Kral gibt!«
Es war tiefe Nacht. Nur selten brach ein Mondstrahl durch das dichte schwarze Gewölk. Es war so still im Föhrenwald, daß man das leise Murmeln der Spree hören konnte.
In der Nähe des »Kronenhügels« hockten zwei Männer.
»Bis es Morgen ist,« sagte der eine, »bin ich tot vor Angst.«
»Du hast doch eine Axt.«
»Was nutzt mir die Axt, Kito, wenn der Nachtjäger kommt? Ich sage dir, Morkusky nimmt mir die Axt und spaltet mir den Kopf. Und ich hab' einen sehr schwachen Kopf!«
»Man soll einen Schneider nicht zum Wächter machen«, sagte Kito.
»Du hast leicht reden, Kito; du bist ein Junggeselle, und ich habe sieben Kinder.«
»Warum zogst du mit auf die Wache?« fragte der alte Knecht.
»Was soll ich machen – wenn sie's doch verlangten? Sie sind doch alle meine Kunden, von denen ich leben muß. Und eine Nacht kommt jeder daran.«
»Ja, solange noch der Juro drüben sitzt beim Withold, muß hier gewacht werden.«
»Er ist ein gottloser, schrecklicher Mensch! Wenn er es nun wirklich tut? Der alte Kral wird aus seinem Grabe aufstehen und ihn mit seinem Schlangenschwert erstechen. Der alte Kral hat hier die silberne Krone selbst vergraben vor der Wendenschlacht.«
»Ja,« sagte Kito traurig, »und nur eine Jungfrau mit silberner Schaufel soll sie heben, und dann wird das Wendenvolk stark sein.«
Er schüttelte schmerzlich den weißen Kopf.
»Er war so ein guter Junge, immer aufrichtig, nie hat er gelogen, auch immer freundlich, gut zu Mensch und Tier. Und nun – und nun …«
Er preßte eine Hand über die Augen. Kito hatte viel Kummer auf seine alten Tage. Die gute Frau tot, der Herr blaß und schweigsam, Hanka gar nicht die fröhliche, glückliche Frau, wie er es gedacht und gewünscht hatte, selbst Samo ein[205] wunderlicher Mann. Er lief so viel in den Städten und auf den Dörfern herum, saß so viel bei den Männern in der Schenke, war schon vierzehn Tage nach seiner Hochzeit wieder nach Prag gefahren. Was wollte er immer in Prag?
»Bis morgen früh bin ich tot vor Angst«, begann der Schneider wieder. »Horch – horch – hörst du's rascheln?«
»Ich höre nichts.«
»O Kito, wenn du allein wachtest! Wenn du mich nach Hause gehen ließest! Ich würde dir auch gern meine Axt hier lassen.«
»Ich brauche keine Axt. Aber wenn du willst, geh nach Haus. Hier nützest du doch nichts.«
»Wirst du es auch niemand verraten?«
»Nein!«
»O Kito, ich mache dir deine neue Weste ganz umsonst.« Und fort war er.
Nun Kito ganz allein war, überkam auch ihn Furcht und Grauen. Die Nacht war so unheimlich still, so unheimlich dunkel. Und alle alten Sagen und bösen Geschichten wurden lebendig im Herzen des Alten.
Da hörte er ein Geräusch. Hatte er sich getäuscht? Da war wieder das Geräusch. Jetzt hörte er Tritte, deutliche Tritte. Kito lehnte sich an einen Baum. Eiskalter Schweiß rann ihm von der Stirn. Mühsam hielt er sich aufrecht.
Da – eine dunkle Gestalt, noch eine, noch eine. Drei oder vier.
Kito fing laut an zu ächzen.
»Ist hier jemand?« fragte eine Stimme. Es war die Stimme Juros.
»Da ist ein Mann. Kito – Kito – bist du es?«
»Pán Juro!«
Der Alte wimmerte.
»Was wimmerst du? Fürchte dich nicht! Hier ist nichts zu fürchten. Wir tun dir nichts. Was machst du hier?«
»Ich – ich soll – soll bei dem Kronenhügel wachen.«
»Wer hat es dir befohlen?«
»Die Gromada.«
»Aah!«
Juro lachte leise.
»Höre, Kito, ich bin mit diesen drei Männern gekommen, den Kronenhügel aufzugraben.«
»Tut es nicht, Pán Juro, tut es nicht!«
Der Alte lag vor ihm auf den Knien.
»Steh auf, Kito, ich kann das nicht sehen! Deine Bitten nützen nichts. Sieh, das sind drei wendische Männer, Ehrenmänner, die haben sich in der Welt umgesehen, und die werden nun Zeugen sein, daß in dem Kronenhügel nichts ist als Erde, Sand und Stein. Und so werden die Wenden von einem alten Aberglauben erlöst werden.«
»Tut es nicht, Pán Juro, tut es nicht!«
»Hör auf zu bitten; ich sagte dir schon, es nützt nichts. Oder willst du ins Dorf gehen und Skandal schlagen?«
»Ich müßte es eigentlich tun; es wäre meine Pflicht. Aber, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht; die Bauern kämen und schlügen Pán Juro tot.«
»So stelle dich beiseite und warte! In weniger als einer Stunde wirst du sehen, daß ich recht habe, und dann werden alle Wenden es sehen. Du bist mir der willkommenste Zeuge.«
»Tut es nicht, Pán Juro; es geschieht ein Unglück!«
Juro schob den Alten beiseite. Er winkte den drei Männern. Jeder hatte Spaten und Hacke. Auch Juro trug diese Werkzeuge.
»Ans Werk!«
Die drei Wenden zögerten. Da sah Juro sie lächelnd an. Dann sagte er:
»Nun wohl, ich werde die ersten dreißig Spatenstiche selbst tun, und wenn ihr seht, daß kein Morkusky und kein Kral sich einmischt, wird euch der Mut schon kommen.«
»Tut es nicht, Pán Juro!«
Kito warf sich auf den kleinen Hügel.
»Nehmt den Alten weg!« befahl Juro. Die drei Männer zogen Kito empor und führten ihn abseits.
Einen Augenblick später tat Juro den ersten Spatenstich in den heiligen Kronenhügel.
Weinend kniete Kito beiseite mit gefalteten Händen, die er zum Himmel hob. Die drei Männer schauten mit ernsten Gesichtern zu. Juro grub und grub. Da kam erst einer der Männer und half ihm graben, und dann halfen alle drei. Der Mond brach durch die Wolken, es wurde ganz hell, und man hörte nichts als das schwere Atmen der Arbeitenden, das leise Wimmern Kitos.
Eine gute Weile verging – – –
Da … »Da liegt was!« schreit ein Mann und springt aus der Grube.
»Da – da ist ein Topf!«
»Eine Urne!«
»Um Jesu willen, Pán Juro, den Hügel zu – den Hügel zu!«
»Weg mit euch! Es gibt viel Urnen in der Welt!«
Juro hebt ein altersgraues Gefäß aus der Erde, er setzt es neben die Grube, löst den Deckel, schaut hinein …
»Was – was – was …«
Er stammelt – er röchelt – er stöhnt …
»Um Jesu willen, Pán Juro …«
Der greift in die Urne, nimmt etwas heraus, richtet sich auf, wendet sich gegen das Mondenlicht, steht so drei Herzschläge lang und bricht, wie vom Blitz erschlagen, mit einem markerschütternden Schrei zusammen.
In der rechten Hand hält er eine alte Krone. –
Die vier Männer knien zitternd, stammelnd, ächzend am Boden. Kito nimmt zitternd die alte Krone auf, küßt sie scheu am Rande und ruft weinend:
»Du Heilige – du Heilige – du Heilige – um Gottes willen, verzeih uns!«
Und bettet die Krone wieder in die Urne, schließt mit zitternden Händen die Urne und senkt sie in die Erde.
»Zuschütten! Den Hügel zuschütten! Schnell zuschütten! Sonst richtet uns Gott!«
Wie die Rasenden arbeiten die Männer. In ganz kurzer Zeit ist der Hügel geschlossen.
Dann läuft einer fluchtartig waldein. Die zwei andern helfen dem alten Kito, Juro aufzuraffen.
»Lebt er?«
»Sein Herz schlägt!«
»Er ist so weiß wie eine Leiche. Er kann jeden Augenblick sterben.«
»Helft ihn tragen!«
Sie tragen ihn mühsam ins Dorf. – – –
Vor dem Tor seines Vaterhauses wird Juro auf die Erde niedergelegt. Er schlägt die Augen auf.
»Was – was ist? Wo? – Wer?«
Plötzlich verzerrt er sein Gesicht.
»Die alte Krone!«
Und er sinkt in die Ohnmacht zurück.
Der alte Kito wird über den Gartenzaun gehoben und dringt ins Haus. Er klopft an die Tür des Scholta.
»Kommt herunter, Herr – vors Tor – es ist ein Unglück geschehen …«
Mehr bringt er nicht heraus.
Vor dem Tor findet der alte Hanzo seinen Sohn. Er starrt ihn an und fragt dann mit eisiger Stimme:
»Hat er nach der Krone gegraben?«
»Ja.«
Der Alte lehnt sich an das Tor.
»Und …?«
»Und er hat sie gefunden!«
Die drei Männer beugen vor dem Kral das Haupt.
»Er hat sie gefunden!« wiederholt der Kral langsam. Trotz seiner schweren Herzensnot tritt ein sieghaftes Leuchten in seine Augen, die sich zu stummem Dank gen Himmel richten.
»Er hat sie gefunden! Die alte Krone ist da! Gott sei gelobt in Ewigkeit! Amen!«
Eine lange feierliche Stille. Dann sagt Kito:
»Herr, Euer Sohn …«
Hanzo streckt die Hand aus gegen Juro.
»Dieser ist nicht mein Sohn. Er ist ein Verbrecher. Ob er tot ist oder noch lebt, schafft ihn aus dem Dorf!«
»Wohin sollen wir mit ihm?«
»Wohin ihr wollt! Zu den Deutschen, die ihn verführt haben, oder irgendwohin; mir ist es gleich!«
»Er ist schwerkrank. Wir müssen einen Wagen haben für den weiten Weg.«
Hanzo besann sich eine kleine Weile; dann sagte er:
»Den Wagen könnt ihr haben. Er steht schon hier am Tor.«
Da faßte ihn Kito am Arm.
»Herr, nicht auf den alten Bretterwagen, nicht den Sünderwagen, auf dem die Gehängten auf den Kirchhof gefahren werden!«
»Es ist der rechte Wagen für diesen da! Einen anderen gebe ich für ihn nicht. Spannt ein Pferd an, legt eine Schütte Stroh auf den Wagen und schafft ihn fort!«
Weinend schob Kito mit den anderen den alten Bretterwagen auf den Weg hinaus; behutsam und sacht holte er das Stroh und ein Pferd. Mit finsterem, starrem Angesicht sah Hanzo noch zu, wie Juro auf das Stroh gebettet wurde; dann schloß er das Tor, indes der alte Kito draußen von dannen fuhr.
Oh, das war eine traurige Fahrt! Die Nacht so öde, der Weg so lang. Und so dahinfahren in Schande und Herzeleid mit einem, den man lieb hat! In seinem langen Leben hatte der alte Kito keine Stunde gehabt, die so bitter gewesen wäre wie diese. Und er zergrübelte seinen alten Kopf, wie er's nun anstellen sollte. Es war noch finster. Was würden die Leute auf der deutschen Herrschaft sagen, wenn er mit einem solchen Fuhrwerk daherkäme? Wie sollte er, der Knecht, sich vor die Augen eines gnädigen Herrn trauen und ihm sagen: »Auf dem Stroh meines Bretterwagens liegt Ihr Herr Schwiegersohn!«
Wie hatte es nur der alte Hanzo tun können! Was für einen[210] wilden Zorn mußte er in seinem Herzen haben, daß er dem Sohn diese Schande antat!
O Gott, was sollte er nur tun, der alte Kito? Vielleicht war der, den er so langsam dahinfuhr, schon gestorben.
Da hielt Kito an, da wandte er sich um nach dem Wagen, kniete bei Juro nieder und tastete mit seinen stumpfen Fingerspitzen nach Juros Herzen. Es dauerte lange, ehe er einen schwachen Herzschlag fühlte.
Dann fuhr er weiter in müdem, schleppendem Tempo. Und als er an den Seitenweg kam, der nach dem Witholdschen Schlosse führte, fuhr er daran vorbei. Er hatte zu viel Angst, mit einem solchen Auftrage dem deutschen Herrn vor die Augen zu treten.
Weiter ging es den Sandweg entlang. Was war das für eine Nacht! So gab es wirklich die alte Krone der Wenden! So war Hanzo wirklich ein König! Und seinen ältesten Sohn hatte der Schlag getroffen, als er sich an der Krone vergriff. Heilig war sie! Mochte Gott allen vergeben und alle schützen vor der Gewalt des Nachtjägers! Der Morgen kam. Ein kalter Morgen. Vielleicht begegneten Kito Leute vom Schloß, denen er Juro übergeben könnte. Da – da sprang auch wirklich jemand über den Graben …
»Heda – heda!« schrie der alte Kito.
Ein Mann kam näher. Es war Heinrich von Withold. Er trug eine Büchse über der Schulter.
»Was ist los? – Was schreien Sie?«
»O Gott – gerade der gnädige junge Herr!«
»Nun, was ist da weiter? Wohin wollt Ihr?«
»Ich soll – ich will – Gott schütze mich!«
»Aber Mann, was macht Ihr für Gerede?«
»Sehen Sie, sehen Sie einmal in meinen Wagen!«
»Juro!«
Die Büchse fiel auf den Weg.
»Ja – was – was ist denn? Ist er verunglückt? Wo bringt Ihr ihn denn her? Was ist geschehen? Juro! Juro!«
Heinrich kletterte auf den Wagen, griff nach der Stirn Juros, fühlte nach seinem Puls.
»Der Schlag hat ihn getroffen«, sagte Kito.
»Nein, er scheint nur ohnmächtig zu sein – Gott sei Dank, nur ohnmächtig …! Spannen Sie das Pferd aus, damit es nicht anrückt! Dann helfen Sie mir! So! – Den Kopf tief betten – er ist ja leichenblaß – und nun die Arme und die Beine reiben – tüchtig!«
Heinrich flößte dem Kranken Kognak aus seiner Feldflasche ein und rieb ihm die Herzgrube.
Dabei fragte er Kito:
»Wo habt Ihr ihn gefunden?«
Stammelnd, unter vielen Tränen, sagte der Alte:
»Er hat – hat – die alte Krone ausgegraben, und da hat ihn der Schlag getroffen.«
»Die alte Krone? Seid Ihr irre?«
»Ich war selbst dabei. Ich hatte am Kronenhügel Wache.«
»Und er hat wirklich eine alte Krone gefunden?«
»Ja, in einem alten grauen Topf.«
»Das ist nicht möglich!«
»Ich habe es gesehen, Herr! Ich hab' die Krone ja selbst wieder in den Topf getan und sie wieder eingegraben.«
»Kräftiger reiben! Kräftiger! – Und er fiel also ohnmächtig um? – Die Nerven! Er war schon so aufgeregt vorher. Er hat nächtelang nicht geschlafen! – Ja, Mann, wie kommt Ihr denn zu dem Wagen?«
Kito gab jammernd Auskunft.
»Was – auf einen Mist- – auf einen Schand- und Schinderwagen – der eigene Vater?! – – – Bande! Bande! Bande!«
Juro schlug die Augen auf. Da lachte Heinrich gezwungen.
»Na also, alter Junge! Du machst schöne Geschichten! Aber es ist nichts dabei, wird bald vorüber sein! Da trink mal!«
»Wo bin ich? Was ist?«
»Davon reden wir später. Jetzt trink mal!«
Juros Auge wanderte umher; seine Stirn runzelte sich zu angestrengtem Nachdenken, und dann sagte er erschauernd:
»Die Krone! Die Krone!«
»Laß das jetzt, Juro! Ich weiß alles. Laß das jetzt! Spannen Sie ein, Mann! Dann den Weg rechts hinab!«
»Es ist schrecklich, Heinrich! Sie ist da! Es ist alles – alles wahr! Sie ist da!«
»Sei jetzt ruhig! Wir wollen nach Hause.«
»Ich schäme mich – ich hab' ein Heiligtum geschändet – ich bin schlecht!«
Sie fuhren einen Weg hinab. Kurz vor dem Schloß half Heinrich dem Kranken vom Wagen. Juro stützte sich auf die beiden Männer und trat durch eine Hintertür ins Schloß.
Es waren etwa zwei Wochen vergangen. Da ließ sich Heinrich von Withold beim alten Scholta Hanzo anmelden. Er wartete im Kretscham auf Antwort. Es dauerte zwei Stunden ehe die Nachricht eintraf, daß der Scholta Heinrich erwartete. Die beiden Männer begrüßten sich stumm. Der Scholta wies auf einen Stuhl.
»Ich danke,« lehnte Heinrich ab; »ich habe nicht viel zu sagen. Allerdings, was ich zu sagen habe, ist wichtig. Mein Freund und Schwager Juro hat, gehetzt durch die aufgestachelte öffentliche Meinung und in der Überzeugung, daß eine alte Krone der Wenden nicht existiere, nach ihr gegraben und zu seiner schweren Überraschung eine Krone gefunden. Da ist er dem Schreck, einem plötzlichen Nervenanfall, erlegen – er ist ohnmächtig geworden.«
»Gott hat ihn geschlagen!« sagte Hanzo ernst.
Heinrich beachtete den Zwischenruf nicht, sondern fuhr fort:
»Als ich Juro auf Ihrem Düngerwagen liegend fand, hatte ich zuerst vor, die ganze Sache der Behörde anzuzeigen.«
»Das konnten Sie! Von uns aus ist nichts Unrechtes geschehen.«
»Ich weiß nicht,« entgegnete Heinrich kalt, »wieweit sich die beiden Würden eines preußischen Schulzen und heimlichen Wendenkönigs miteinander vertragen, jedenfalls habe ich die Anzeige unterlassen, weil ich mich zu solchen Dingen nicht eigne. Aber ich habe etwas anderes getan: ich habe mir die Krone auch einmal angesehen! Hier ist sie!«
Er zog unter dem weiten Kragen seines Mantels ein Paket hervor und legte es auf den Tisch.
»Was – was – was sagen Sie? – Was ist das?«
Heinrich löste die Umhüllung, eine alte Krone, ein schmaler silberner Stirnreif wurde sichtbar.
»Da! – Das hat Juro gefunden!«
Der alte Hanzo streckte entsetzt die Hände aus gegen den Tisch.
»Das – das – die Krone! – Sie haben es gewagt – Sie …«
»Regen Sie sich nicht auf,« sagte Heinrich ruhig; »die Krone ist gefälscht!«
Der alte Wende sank auf einen Stuhl; die Zähne schlugen ihm aufeinander.
»Ist das – ist das – die Krone aus dem Hügel?«
»Ja, und sie ist nicht die alte Kralskrone, sie ist gefälscht!«
»Sie haben sie ausgegraben?«
»Ja – unter der Zeugenschaft von zwei gebildeten Männern.«
Da stürzte der alte Hanzo mit geballten Fäusten auf Heinrich los, schlug auf ihn ein, rang mit ihm und mußte doch von dem Angegriffenen halb gehalten werden, damit er nicht niederfiel. Schließlich sank er völlig gebrochen, kraftlos und erschöpft auf seinen Stuhl.
Da öffnete sich die Tür, und Samo trat ein.
»Was geht hier vor?«
»Ich habe dem Scholta die Krone gebracht, die mein Freund Juro neulich gefunden hat.«
Samo wurde bleich.
»Wie kommen Sie zu der Krone?«
»Ich habe sie ausgegraben mit noch zwei gebildeten Männern; ich habe sofort erkannt, daß es sich um eine wertlose Imitation handelt, und habe mir meine Ansicht durch ein Sachverständigenurteil in Berlin bestätigen lassen. Hier ist eine beglaubigte Abschrift!«
»Sie sind ein Lump!« schrie Samo heiser.
»Es ist mir eine Ehre, von Ihnen beschimpft zu werden,« erwiderte Heinrich mit eisiger Kälte; »denn ich bringe Sie mit dem schmählichen Betrug, der hier vollführt wurde, in Verbindung.«
»Herr! Sie werden mir mit der Waffe Genugtuung geben. Diese Schmach kann nur Ihr Tod sühnen!«
»Ich schlage mich nicht mit Verbrechern!« sagte Heinrich verächtlich.
Da fiel Samo über ihn her, Heinrich aber schleuderte ihn beiseite und verließ rasch das Haus.
»Vater!«
Samo beugte sich über den Alten, dessen Kopf auf der Tischplatte ruhte. Hanzo hob das Haupt. Er sah seinem Sohne starr ins Gesicht und sprach:
»Samo, hast du's gehört? Hast du es auch gehört, was der Mensch Schreckliches sagte, oder ist alles ein Spuk, oder bin ich irrsinnig geworden durch all die schwere Zeit?«
»Ich habe es gehört, und da ist die Krone!«
»Die Krone!«
Furchtsam starrte der Alte wieder auf den silbernen Reif.
»Er sagt – er sagt – sie ist falsch!«
»Er ist ein deutscher Hund!« schrie Samo zornig; »einer, dem nichts heilig ist, einer, der auf unseren Grund und Boden eindrang und die Krone stahl.«
»Ist das – ist das wirklich die Krone aus dem Hügel?«
»Frage Kito – er hat sie gesehen.«
Kito wurde gerufen. Als er auf dem Tisch die Krone sah, wollte er an der Tür umkehren. Gespenster, nichts als Gespenster in seinen alten Tagen! Aber er mußte in die Stube, mußte an die Krone herantreten.
»Es ist die Krone aus dem Hügel«, sagte er bebend. »Ich kenne sie genau wieder.«
Da traten alle drei Männer von dem Tische zurück.
»Da liegt ein Papier,« sagte Hanzo endlich scheu, »auf dem soll stehen, die Krone ist gefälscht.«
»Willst du es lesen, Vater?« fragte Samo und hielt ihm das Blatt Papier hin, das Heinrich dagelassen hatte. »Lies es!«
»Nicht hier, nicht bei der Krone!« wehrte der Vater ab.
»Weißt du, was auf solchen Papieren von Deutschen schon alles gestanden hat?« fragte Samo. »Daß es keinen Gott gibt, daß es kein Vaterland gibt, daß es kein Eigentum gibt, daß es kein Recht der Slawen gibt, ja daß es überhaupt keine Welt gibt, daß alles Einbildung, Täuschung ist. Alle solche Dinge haben auf deutschen Urkunden von sogenannten deutschen Sachverständigen schon gestanden. Auf diesem Papier da wird zur Abwechslung stehen, es gibt keinen Kral der Wenden, und der tausendjährige Beweis, die Krone, ist falsch. Es gibt nur eine deutsche Herrschaft, eine deutsche Krone! Können wir von unseren Feinden ein anderes Urteil erwarten? Kann ein Urteil, das unsere Widersacher bei ihresgleichen bestellt und bezahlt haben, anders ausfallen?«
»Nein!« sagte Hanzo, »du hast recht!«
Er zerriß das Papier in viele kleine Teile.
»Die Krone ist genug beleidigt«, sagte er. »Gehet jetzt hinaus. Laßt mich allein!«
Und der Kral blieb bei der Krone mit einer großen königlichen Andacht im Herzen.
Am Nachmittag desselben Tages wurde der Kronenhügel noch einmal aufgegraben, und zwar in Gegenwart Hanzos, Samos und dreier Zeugen aus dem Dorfe. Die Männer überzeugten[216] sich, daß der Hügel nunmehr leer sei, und Hanzo gab den Befehl, daß er der Erde gleich gemacht werde.
»Tausend Jahre lang hat er unsere heilige Krone beherbergt,« sagte er ergriffen; »nun ist seine Ruhe gestört und entheiligt worden, nun soll er nicht mehr sein!«
Dann ging er mit den Zeugen nach seinem Hause, zeigte ihnen die Krone und sagte:
»Das ist die Krone der Wenden! Ihr Silber ist vom Himmel gefallen, ein gottgesandter Mann hat sie geformt. Der Urkral hat sie getragen. Aus ihrem tausendjährigen Hause ist sie vertrieben worden. Sie soll zurück in die mütterliche Erde. Denn nicht ist die Jungfrau mit der silbernen Schaufel gekommen und hat sie ans Licht geholt, Frevlerhände haben es getan. Ich werde die Krone wieder begraben an einem anderen Ort. Den soll aber niemand wissen als mein Sohn Samo und ich, als immer der Kral und sein ältester Sohn. Was ihr gehört und gesehen habt, dürft ihr den Wenden erzählen, aber keinem Deutschen.«
Die Männer gelobten das und gingen in größter Erregung von dannen. – – –
Als Hanzo mit Samo allein war, sprach er:
»Unter der Kirchhoflinde, dort, wo die Mutter liegt, werden wir eine Grube graben, dahin werden wir die Krone legen. Sie wird dann über Mutters Kopf sein und bald auch über meinem.«
Samo wandte sich ab.
Er stand am Fenster und schaute hinaus auf die Straße. Sein Atem ging rasch. Endlich wandte er sich um.
»Wähle einen anderen Ort, Vater! Der Kirchhof ist die Stätte der Toten. Unsere Krone aber ist lebendig, und unsere Hoffnung knüpft sich daran, die Hoffnung, daß wir Slawen noch einmal loskommen von diesem elenden Lande der Deutschen. Deshalb muß die Krone lebendig bleiben, Vater. Ganz lebendig vor aller Augen und in aller Herzen! Daran, an diesem Glauben, hängt unsere Zukunft. Wähle einen anderen Ort!«
Der Vater blieb bei seinem Vorsatz.
»Die in der Kirchhofserde liegen,« sagte er, »sind nur tot[217] für eine Zeit, dann wird sie unser Herr Christus auferwecken. Und auch unsere Krone wird eines Tages auferstehen. Du wirst sie mit mir dort begraben, wo ich dir gesagt habe. Sie ist dort sicher; denn sie hat dort Wächter, an die sich nicht leicht jemand wagt.«
»Ich werde dir gehorchen!« sagte Samo.
Auf dem Bahnhof zu Prag stand Hanka. Sie sah sich verängstigt um. Ihre Stirn war weiß, aber auf ihren Wangen brannten große rote Flecken. Da stellte sie plötzlich das Paket hin, das sie getragen, und begann heftig zu zittern.
»Da – da – ist er – Samo!«
Samo kam auf sie zu und küßte sie scheu auf den Mund.
»Samo! Samo!«
»Pst – still! Nur keinen Namen nennen! Hier lauern überall Polizeihunde. Komm weiter!«
Er zog Hanka aus dem Bahnhof hinaus und nahm einen geschlossenen Wagen. Im Wagen fiel sie ihm um den Hals und weinte leidenschaftlich.
»O Samo – Samo! Endlich seh' ich dich wieder!«
Er sagte etwas, was sie nicht verstand.
»Ist es dir nicht lieb, Samo, daß ich dir nachgekommen bin?«
»Warum soll es mir nicht lieb sein? Aber ich fürchte, dir wird es nicht lieb sein, daß du es getan hast, wenn du erst siehst, wie ich lebe!«
Er sprach mit abgewandtem Gesicht.
»Ich gehöre zu dir; ich bin dein Weib. Oh, warum hast du uns so lange nicht geschrieben? Fast zwei Jahre! Was haben wir ausgestanden um dich!«
»Ich konnte nicht! Ich mußte glauben, daß ihr mich verfluchtet!«
»Das haben wir nie getan. Von Anfang an nicht! Du warst nie schlecht!«
Samo sah finster zur Seite. Eine Weile schwiegen sie. Nur Hanka weinte leise vor sich hin.
»Also, er ist nicht tot?« begann Samo wieder. Seine Stimme war düster.
»Nein, er war kaum zwei Monate lang krank.«
Samo schüttelte den Kopf.
»Merkwürdig! Ich weiß doch als Arzt, wo das Herz sitzt. Und ich hab' aufs Herz gezielt. Das Messer muß abgeglitten sein.«
»Sprich nicht davon, Samo, sprich nicht davon!« rief Hanka erschauernd.
»Ja, ich spreche nur davon! Ich hab' in den ganzen zwei Jahren eigentlich nichts anderes mit mir selbst verhandelt als immer das eine. Ich glaubte, er sei längst vermodert.«
»Samo, sprich nicht so Schreckliches!«
»Hätte er sich mit mir duelliert,« fuhr Samo fort, »wäre es anders gekommen. Vielleicht hätte er dann eine Kugel in diesen heißen, unglücklichen Schädel geschossen, und es wär' gut gewesen.«
»Samo!«
»Aber er verachtete mich! Er behandelte mich wie einen Hund. Er schickte meinen Zeugen heim. Er beleidigte mich aufs neue, als ich ihn persönlich stellte. Da bekam er das Messer in die Brust. Ich konnte nicht anders. Meine Hand tat es von selbst.«
»Er hat dich schwer beleidigt, Samo, wir wissen es; er hat sich auch frech an unserer alten Krone vergriffen; er hat die meiste Schuld gehabt!«
»Sie haben einen Steckbrief hinter mir erlassen?«
»Ja, der alte Withold hat's nicht gewollt – um Juros willen – wegen des Namens –, aber der Staatsanwalt ist gekommen, und es hat sich nichts ändern lassen. – Juro hat damals seine Verlobung aufgelöst –«
»So?«
Samo schwieg eine Weile.
»Weil sein Name geschändet war – weil ich den Bruder seiner Braut – nun ja, ich kann mir's denken!«
»Das Mädchen, die Elisabeth, ist aber dem Juro nachgegangen nach Breslau. Sie hat ihn nicht losgelassen. Jetzt sind sie schon verheiratet.«
»Na also! Ist Hochzeit zu Haus gewesen, und man hat nichts davon gewußt!« lachte Samo gezwungen. »Wo wohnt denn das junge Paar? Beim Vater zu Haus auf der Scholtisei?«
»Nein, unser Vater und Juro sind noch in Feindschaft. Der Vater verzeiht es Juro nicht, daß er sich an der Krone vergriffen hat, wie er dir alles verzeiht, weil du doch die Krone verteidigt hast.«
Samo sah zum Wagenfenster hinaus.
»Die verfluchte Krone!« sagte er leise und ingrimmig.
»Was – was sagst du, Samo?« fragte Hanka erschrocken.
»Ja, Weib, ahnst du denn, was ich ausgestanden habe? Kannst du nur ein wenig einsehen, was das heißt, zwei ganze Jahre mit einem Ermordeten zu ringen, was das heißt, verbannt, geächtet, verfolgt zu sein, ein Mordbube zu sein, dem jeder Straßenpassant gefährlich und verdächtig erscheint, was das heißt, wenn einem so das ganze Leben und alle Hoffnung zusammenbricht?«
»Der junge Withold ist nicht tot«, sagte Hanka.
»Aber ich habe es geglaubt; ich habe darum nicht an euch geschrieben, hab' mich verkrochen in die elendesten Spelunken Prags unter falschem Namen, als Vagabund zu den Vagabunden, bis ich es nicht mehr aushielt, bis ich euch doch eine Nachricht gab.«
»Jetzt wird es besser werden, Samo, lieber Samo!«
»Besser – vielleicht! Es kann aber nicht mehr gut werden. Der Schatten freilich wird mich jetzt in Ruhe lassen; aber die Heimat ist verloren, die Ehre ist verloren, das Leben ist zerbrochen.«
Er preßte die Fäuste vor die Augen. Sie schlang den Arm um seinen Hals.
»Samo, ich hab' dich lieb!«
Er nickte versonnen und sah mit verlorenem Blick vor sich hin.
»Das ist das Sonderbare! Als es mir gut ging, hattest du mich nicht lieb, da liebtest du den Juro.«
Sie wurde rot.
»Und jetzt bist du mir nachgekommen ins Elend. In ein viel schlimmeres Elend, Hanka, als du meinst. Du wirst es nicht aushalten.«
»Ich werde alles aushalten, Samo! Ich hab' dich lieb!«
Er schob sie sacht beiseite.
Es war ein elendes Quartier, das Samo in einer Vorstadt Prags bewohnte, die Parterrestube eines schmutzigen Hauses. Ein Bett stand in dem sonnenlosen Raum, ein wackeliges Sofa, ein Tisch und ein paar Stühle. An der Wand waren einige Kleiderhaken, auf einem Stuhl stand ein halbzerbrochenes Waschbecken.
»Also, da wohne ich!« sagte Samo. »Das ist die Residenz des zukünftigen Krals der Wenden.«
Er lachte höhnisch und bitter. Hanka flog ein Schauer durch Leib und Seele. Sie, deren ganzes Sinnen von Jugend an auf Ordnung, Reinlichkeit und behaglichen Wohlstand gerichtet war, erschrak vor dieser liederlichen Höhle.
»Hier wohnst du?« fragte sie tonlos. »Die ganzen Jahre?«
»Seit einem halben Jahr. Meine frühere Wohnung war noch schlimmer; zeitweise hatte ich überhaupt keine Wohnung.«
Da brach sie in Tränen aus.
»Es wird jetzt besser, Samo; ich bringe dir Geld mit von deinem Vater – sechstausend Taler!«
Samos Augen blitzten auf.
»Geld? – Sechstausend Taler? – Ah, mein Mutterteil! Das ist nicht schlecht!«
Er lächelte vergnügt.
»Geld habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber sag' das niemandem, Hanka, das darf niemand wissen! Das würde gleich Verdacht erregen. Ich bin hier der verbummelte und[221] verarmte Journalist Wenzel Halek. Das darfst du nie vergessen. Ich heiße Wenzel Halek.«
Sie setzte sich müde und traurig auf einen Stuhl.
»Ja, ja, Hanka, so weit kann es kommen. Selbst den Namen muß man sich schließlich erschachern oder stehlen. Ich habe einem verbummelten Kerl seine Papiere abgekauft. Um fünfzig Kreuzer! Die fünfzig Kreuzer hat er noch vertrunken, und am anderen Tage ist er am Delirium in einem Spital gestorben, ohne noch einmal zur Besinnung zu kommen.«
»O Gott, o barmherziger Gott!«
»Ja, Hanka, ich will dir von vornherein sagen, in was für eine Welt du kommst. Ich sagte dir schon, du wirst es nicht ertragen. Ich – ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich passe schon hierher!«
»Samo!«
»Ich heiße Wenzel! Vergiß das nicht! Samo ist tot – der neue Wenzel Halek ist ein Lump – er sauft ebenso wie der alte Wenzel Halek.«
»Samo, Samo, was – was redest du –«
»Ich will dich nicht belügen. Ich bin ein Süffling geworden. Es gab Zeiten, wo ich durchschnittlich in der Woche siebenmal betrunken war. Das wird so, wenn man mit – mit Schatten kämpft und wenn man alles, was einem lieb war, verloren hat.«
Er stieß es rauh, brutal, unbarmherzig heraus. Hanka sank mit dem Kopf auf den Tisch.
Da öffnete sich die Tür, ohne daß angeklopft worden war. Eine dicke, alte Tschechin trat ein. Sie besah sich mit frecher Neugier Hanka.
»Also – das ist die Frau Halek? Das ist das neue Frauchen? Ein schmuckes Frauchen! – Nu, Herzchen, wie gefällt es Ihnen hier? Ja, mein Fräulein, das Zimmer ist nicht groß, aber es ist gemütlich!«
»Mach, daß du hinauskommst, alte Schwarte«, tobte Samo.
»Oho, das ist meine Stube! Und Sie sind noch zehn Gulden schuldig.«
»Kriegst du morgen! Und nun hinaus, murguta Myrlawa!«[56]
Er schob die Alte zur Tür hinaus.
»Wer – wer ist diese Frau?« fragte Hanka betroffen.
»Meine Wirtin.«
»Was will sie? Sie nannte mich Fräulein. Hast du ihr nicht gesagt, daß ich deine Frau bin?«
»Ich hab' es ihr gesagt. Aber solches Volk glaubt das nicht. Hier läuft alles durcheinander.«
Sie nahm ihn ängstlich an der Hand.
»Nicht wahr, Samo, wir werden eine ordentliche Stube nehmen und ein ordentliches Leben führen?«
Er machte sich achselzuckend los von ihr.
»Das geht nicht so auf einmal. Das fällt doch auf.«
»Du kannst doch sagen, ich – ich habe dir das Erbteil mitgebracht –«
»Vorsichtig müssen wir sein. Ich werde sehen, was sich wird machen lassen.«
Ein und ein halbes Jahr waren seitdem wieder vergangen. In eine »ordentliche Stube« waren Samo und Hanka gezogen, hoch in den oberen Stock eines sauberen Hauses. Aber ein »ordentliches Leben« führten sie nicht.
Samo war liederlich geworden.
Er hielt es nicht aus in der engen Klause, wo das stille Weib saß und mit heimwehkranken Augen zum Fenster hinausstarrte, hinauf zu den Wolken, die am Himmel wanderten. Er wußte, daß ihre Sehnsucht immer mit auf die Reise ging, hinstrebte nach der wendischen Heimat, die für ihn und sie auf immer verloren war.
Und er hatte keine geordnete Beschäftigung. Am Anfang hatte er manchmal Bücher aus einer Bibliothek besorgt und[223] etwas studiert. Aber was nutzte ihm das Studieren? Er interessierte sich in der Hauptsache für medizinische Schriften, und was in aller Welt sollte ihm noch die medizinische Wissenschaft nutzen? Wenzel Halek war nicht approbiert, Wenzel Halek hatte nur das Äußere mit Samo ziemlich ähnlich gehabt; geistig war er ein verlumpter Kerl gewesen, der sich keinerlei Qualifikationen erworben hatte. Das elende Leben Haleks, das im Delirium geendet war, mußte Samo nun fortsetzen.
»Hat der erste Wenzel Halek gesoffen, kann auch der zweite Wenzel Halek saufen«, sagte er oft zynisch und brutal.
Hanka vermochte nichts über ihn. Sie war ihm geistig nicht gewachsen; er unterhielt sich auf die Dauer nicht gern mit ihr, zumal sie nicht viel anderes zu reden wußte als von ihrer wendischen Heimat. Einmal hatten ihre Eltern auf Besuch kommen wollen; sie hatte es auf Samos Wunsch verhindern müssen.
So war Hanka in schwerster Verlassenheit.
Samo lief viel in die Wirtshäuser. Und er verkehrte in untergeordneten, schlechten Vorstadtlokalen. »Damit es nicht auffalle, daß er plötzlich mehr Geld habe«, gab er als Grund an. In Wirklichkeit hatte er – seit er aus der besseren Gesellschaft ausgestoßen war – einen Haß auf alles, was sicher, ordentlich, anständig erschien; er degradierte sich in tollem Grimm über sein Schicksal, ja in Haß gegen sich selbst mehr und mehr. Schließlich gewöhnte er sich an die wilde Gesellschaft.
Pöbel saß in den niederen Gaststuben. »Flamender« werden diese Vagabunden des Lebens in Prag genannt: Diebe, Zuhälter, entlassene Sträflinge, Bettler, Trunkenbolde, Dirnen und dazwischen die große Schar der Entgleisten aus guten Familien: verbummelte Literaten und Studenten, Musiker, fortgelaufene Schüler, herabgekommene Komödianten, bankerotte Kaufleute. Der Massenhaftigkeit dieser Existenzen war es zuzuschreiben, daß in demselben Jahre in Prag, das damals zweihunderttausend Einwohner zählte, über zwanzigtausend Leute verhaftet wurden, also immer der zehnte Mensch. Und da wurde noch geklagt, die Polizei sei zu nachlässig! –
Der Tabaksqualm war heut ärger denn je. Die schmierige[224] Wirtin, der fettquabbelnde Wirt liefen her und hin, Fusel tragend und schlechten Wein. Zweimal war schon eine Prügelei gewesen, einmal war die Polizei einem Taschendieb nachgegangen, der sich hierher flüchtete, hatte ihn weggeholt und bei dieser Gelegenheit noch einen andern Kerl und ein Frauenzimmer mitgenommen.
Jetzt war verhältnismäßig Ruhe. Ein paar Individuen unterhielten sich in der »Hantyrka«, der Gaunersprache, und manch ein Ohr lauschte hin, um etwas von dieser Kunst zu profitieren.
Am Tisch bei Samo saßen noch zwei Männer, beide in schäbigen, abgetragenen Kleidern. Ihre Gesichter waren zerdunsen, von vielen schlimmen Leidenschaften entstellt. Aber jene Linien im Menschenantlitz, die aus den besten Jahren des Lebens stammen und deren tiefe Schönheit durch nichts von der Stirn wegzuwischen ist, waren auch noch in den Gesichtern jener Männer.
Draußen läutete eine tiefe Glocke. Da sagte der eine:
»Das ist die Veitsglocke! Ich erkenne sie am Klang. Sie hat mich oft genug zur Kirche gerufen.«
»Du bist Katholik?«
»Ich meine schon. Ich habe in jener Kirche ungezählte Male das Hochamt gesungen.«
»Ach, du warst Priester?«
Der andere zuckte die Schultern.
»Prosit!« sagte er und trank seine ganze Flasche leer.
»Siehst du, Pfäfflein,« sagte der zweite, »ich hab' mich mein ganzes Leben lang mit den Schwarzen nicht vertragen. Als ich noch Bezirksrichter war, habe ich ihnen zu schaffen gemacht. Jetzt ist's anders. Da sitze ich gemütlich hier mit dir. Laß mich einmal aus deiner Flasche trinken, Brüderlein! Pfui, leer – na also, die Kirche hat immer noch einen guten Magen.«
Er lachte unflätig.
»Ja,« fuhr er fort, »da sitzt man hier mit sechs Kreuzern in der Tasche. Wo sind nun die Mündelgelder, die ich geschluckt haben soll? Der Teufel hol' die ganze Gesellschaft!«
»Ein Cikán! Ein Cikán!«
Ein Zigeuner trat in die Stube und verlangte Schnaps. Er hatte ein schwarzes Weibsbild mit, das alsbald die Karten aufschlug oder aus der Hand weissagte. Sie erhielt nur einige Kreuzer für ihre Kunst; aber alles lauschte gespannt und gläubig ihren Worten. Sie mischte ihre Vorhersagungen aus buntem Glück und schwarzem Unheil, prophezeite goldene Reichtümer oder auch den Tod am Galgen. Da gab es Gelächter und Zähneknirschen. Auch der frühere Geistliche hielt ihr seine Hand hin. Sie sah ihn einige Augenblicke forschend an. Dann sprach sie:
»Du bist der Luzifer, der vom Himmel in die Hölle gefallen ist. Und du wirst dort liegen bleiben!«
»Hallo, sie weiß alles! Der Luzifer! Das ist nicht schlecht! Er ist ein Pater gewesen! Aber das ist doch lange keine Hölle hier, Zigeunerweib?! Oder doch eine lustige Hölle! Laßt uns trinken!«
Auch an Samo trat die Zigeunerin heran. Er dachte an die alte Wičaz zu Haus, die ihm einmal geweissagt hatte, und hielt seine Hand hin. Die Zigeunerin betrachtete erst sein Gesicht, dann seine Hand und sagte:
»Es sind zwei Blutflecken in deinem Leben. Einer ist von einem Fremden, der andere ist von deinem eigenen Blut. Es ist ein anderer schuld, daß du hier bist. Du wirst dich an ihm rächen.«
Samo nickte düster.
»Du scheinst deine Sache besser zu verstehen als die alte Wičaz. Was faselte sie von den zwei Adlern? Nun wird wohl nicht der eine im Lóbjofluß ertrinken, sondern der andere in der Moldau.«
Er warf der Zigeunerin einen Gulden hin.
Da setzte sie sich auf sein Knie, küßte ihn auf die Wange und flüsterte ihm dann ins Ohr:
»Mach dir nichts aus dem, was ich dir gesagt habe. Aber wenn du einen Feind hast, räche dich!«
In der Nähe der Tür saß ein Slowak. Er war aus dem fernen ungarischen Karpathenwald vor Jahr und Tag ausgewandert[226] und hatte Weib und Kind daheim gelassen. Mit Mausefallen hatte er gehandelt, sich durch Drahtbinden seine Kreuzer sauer verdient. Er hatte fast allen Verdienst erspart, nur von übriggebliebenem Essen anderer gelebt und war nun, da er sechzig Gulden im Beutel hatte, ein wohlhabender Mann, der in seine arme Heimat zurückkehren und sich dort ein Häuschen kaufen wollte.
Nun war er müde an der Tür eingeschlafen. Er saß auf bloßer Erde; die anderen ließen ihn nicht bei sich sitzen, denn er trug sein fettgetränktes Hemd schon ein ganzes Jahr. Aber als die Zigeunerin herumging, stand einer der Gäste auf, trat an den Slowaken heran und rüttelte ihn.
»He, Slowak, wach auf, laß dir eine Grafschaft prophezeien.«
Einige lachten. Der müde Slowak brummte etwas und schlief weiter.
Da kam ein »Kastelmann« in die Stube, ein Händler mit Kämmen, Knöpfen, Spiegeln, Tabakspfeifen und anderem Kleinkram. Er machte geringe Geschäfte. Während er noch schacherte, erwachte der Slowak und fing plötzlich laut an zu schreien.
Sein Geldbeutel mit den sechzig Gulden, an denen er fast zwei Jahre fern der Heimat gespart hatte, war verschwunden. Der arme Mann schrie, jammerte, warf sich auf die Erde, schlug verzweiflungsvoll mit Armen und Beinen.
»Der Cikán! Der Cikán!« schrie einer.
Der Zigeuner und die Zigeunerin waren verschwunden.
»Nein, nicht der Cikán!« rief Samo, »sondern dieser da, der vorhin den Slowaken gerüttelt hat. Heraus mit dem Geld!«
Der Angegriffene tobte und fluchte und ging auf Samo los. Samo aber rief in das Lokal hinein:
»Wir sind alle arme Leute! Wir müssen auf uns halten. Hier darf keinem was passieren. Da könnte sich keiner mehr hertrauen.«
Nun hatte er die meisten für sich. Dem Dieb wurde der[227] Beutel, den er in der Tat hatte, entrissen, und der Slowak kam zu seinem Gelde.
Er fiel vor Samo auf die Knie und küßte ihm die Hand.
»O danke, Pán, o danke, Pán!« – – –
Von der Tür aus sah ein hochgewachsener junger Mann der Szene zu. Als Samo aufschaute, erkannte er seinen früheren Freund Bohuslaw, den Neffen des alten Krok.
Er machte sich rasch von dem Slowaken, der immer noch seine Hand hielt, los, bezahlte seine Zeche und trat mit Bohuslaw auf die Straße.
»Das war wieder einmal echt königlich«, sagte Bohuslaw draußen.
»Was willst du hier?« fragte Samo unwirsch.
»Ich habe dich überall gesucht! Seit langer, langer Zeit haben wir nichts mehr von dir gehört; wir glaubten schon, du seist gar nicht mehr in Prag.«
»Ich habe bei euch nichts zu suchen! Ihr seid ja anständige Leute!«
Er lachte höhnisch. Sie gingen ein Stückchen die Straße entlang. Da setzte sich Samo auf eine niedere Gartenmauer.
»Weiter gehe ich nicht mit dir!« sagte er.
Bohuslaw setzte sich neben ihn.
»Sollten wir nicht lieber in ein besseres Lokal –«
»Ich gehöre in kein besseres Lokal. Dort in die Spelunke gehöre ich! Da brauche ich mich wenigstens vor den andern nicht zu schämen.«
»Du brauchst dich überhaupt nicht zu schämen, Samo!« sagte Bohuslaw traurig.
»Nicht?! Verzeih, daß ich lache. Aber du bist zu gütig! Ich brauche mich nicht zu schämen? Das ist gut! Nein, nein, Pán Bohuslaw, das steht doch anders! Aber es wird noch mancherlei dazukommen! Vorhin hat mir eine Zigeunerin geweissagt. Unsinn. Oder vielleicht nicht Unsinn – ich weiß es nicht! Das eine, was sie sagte, stimmte: Ein Fremder ist schuld an meinem Unglück, und an dem soll ich mich rächen! Und dieser Fremde ist dein elender, verfluchter Onkel Krok.«
»Samo!«
»Ist dies nicht die Wahrheit?! Ich war ein ehrlicher Kerl; ich wollte meine slawische Überzeugung mit ehrlichen Waffen durchkämpfen; da ist dieser verrückte Altertumskrämer in mein Leben getreten und hat mich auch verrückt gemacht! Mit seinem Kerzengeflimmer und Altarklimbim hat er mich so sentimental, so duselig, so toll gemacht, daß ich schließlich auf seine hirnverbrannten Ideen eingegangen bin.«
»Samo, darf ich etwas zur Verteidigung des alten Krok sagen?«
Samo antwortete nicht. Da fuhr Bohuslaw fort:
»Erinnere dich, Samo, wie die Sache eurer Lausitzer Sorben stand, als du meinen Onkel kennen lerntest. Du selbst gabst ihre Sache fast verloren. Und den Hauptschlag gegen das Slawentum an der Sprewja fürchtetest du von deinem Bruder Juro, der gedroht hatte, den Kronenhügel aufzugraben und so den einfachen Leuten da oben den Beweis zu erbringen, daß es eine wendische Krone nicht gäbe. Da hat dir der alte Krok gesagt: Symbole sind für das Volk alles. Sieht das Volk, daß das Symbol fehlt, dann vergeht ihm der Glaube, dann ist die slawische Sache der Lausitz verloren, dann wird die Lausitz deutsch!«
»Was wärmst du den alten Kohl auf?«
»Um Krok zu verteidigen. Er hat es ehrlich gemeint.«
»Ehrlich! Indem er mich zu dem ungeheuren Betrug verleitete.«
»Er hielt es nicht für Betrug. Die wendische Krone ist in Wahrheit da, die ideelle Krone, das war und ist seine Überzeugung. Die Kralswürde ist echt. Und der Glaube daran darf nicht an der äußerlichen Tatsache scheitern, daß die substanzielle Krone fehlt oder wenigstens dort fehlt, wo man sie vermutete.«
»Ja, und also haben wir uns eine Krone machen lassen und sie im Kronenhügel eingegraben. Eine kluge und herrliche Tat fürwahr! Oder vielleicht auch eine romantische Schufterei.«
»Krok hat doch alles anders geraten, als du es ausgeführt hast. Er hat dir doch geraten, nachdem die Krone eingegraben[229] war, dafür zu sorgen, daß du selbst sie vor vielen Zeugen ausgraben und nach einem würdigeren Platz bringen solltest, etwa nach eurer Heimatkirche. Dann war der Glaube befestigt, dann konnte auch nichts passieren, dann konnte ja nichts entdeckt werden.«
Samo sprang von der Mauer herab.
»Siehst du, Bohuslaw, und das brachte ich nicht fertig. So einen Quark, so einen betrügerischen Schmarren, den hier in Prag ein Pfuscher gemacht, nach dem Altar unserer Heimatkirche bringen, das vermochte ich nicht. Ich ließ es darauf ankommen. Grub Juro den Hügel nicht auf – nun gut – dann war alles nicht nötig. Grub er ihn auf, dann war ihm die Überraschung zu gönnen, und der Beweis für unsere Leute war gebracht. Aber das Ding, das mir dein Onkel gegeben hat, war ein elendes Pfuschwerk, dessen Unechtheit ein simpler deutscher Student erkannte.«
»Die Kopie der Krone wurde getreu nach der alten Krone Przemisls gemacht; mein Onkel hat die Arbeit selbst Tag und Nacht überwacht.«
»Ja, weil er um seinen Schatz fürchtete. Warum gab er nicht seine echte, alte Krone, wenn ihm so viel daran lag, den slawischen Gedanken an der Sprewja zu befestigen? Weil er ein selbstsüchtiger Geizhals ist! So wurde ein Stümperwerk geschaffen, das mich ins Verderben brachte.«
»Krok hat gewollt – ich sage es noch einmal –, du selbst solltest den Wenden die Notwendigkeit klarmachen, die Krone auszugraben und nach einem sicheren Ort zu bringen, da sie durch Juro bedroht sei. Hättest du das getan, wär alles gut.«
»Und – ich sag' es auch noch einmal – ich konnte es nicht! Ich brachte es nicht fertig, den Quark ans Licht zu ziehen und in unsere Kirche zu bringen. Oh, und dann hat mich doch – doch der Vater gezwungen, das falsche Ding auf dem Kirchhof zu begraben über dem Kopf meiner Mutter. Und das, Mensch, das ist es, was mich wie ein Fluch verfolgt, das war es, was mir schon am nächsten Tag den Sinn so verwirrte, daß ich den Feind niederstach, der die Fälschung entdeckt hatte. Das ist es,[230] was mir noch jetzt keine Ruhe läßt. Ich sehe in den Nächten nichts anderes als den Totenkopf meiner Mutter mit der falschen Krone. Ich sage dir, ein schlechter Spaß ist das, ein sehr schlechter Spaß ist das! Und wenn ich noch verrückt werde, werde ich darüber verrückt!«
Bohuslaw seufzte schwer auf.
»Und deswegen,« fuhr Samo ingrimmig fort, »deswegen bin ich hier, bin ich ein Säufer, ein Verfolgter. Aber ich werde das tun, wozu mir die Zigeunerin riet, ich werde mich an dem alten Krok rächen, der mich vom geraden Pfade ehrlichen Kampfes abbrachte und mit allerlei blödem romantischem Geschwätz auf diesen elenden Irrweg lockte. Leb wohl, ich gehe nach dem Wirtshaus zurück.«
»Samo!«
Er ließ sich nicht halten; er ging wieder nach der Kaschemme.
Drei Tage später war Hanka wieder allein. Samo war schon am frühen Morgen fortgegangen. Es war wieder eine schreckliche Nacht gewesen. Erst spät war er nach Hause gekommen, mehr betrunken als sonst. Und er hatte wieder soviel laut geredet im Schlaf. Das Schrecklichste war, wenn er schrie:
»Mutter, nimm die Krone vom Kopf, nimm die Krone vom Kopf! Mutter, sie drückt dich! Mutter, ich kann es nicht leiden, daß du die Krone auf dem Kopf hast!«
Dann sprang er oft aus dem Bett, dann zitterte er und streckte die Hände entsetzt von sich, dann schluchzte und weinte er, bis er erwachte und erschöpft ins Bett zurücksank. Was er nur mit der Krone hatte! Er sprach niemals ein gutes Wort von ihr; sein Gesicht wurde finster, wenn die Krone nur erwähnt wurde.
Und doch, war er nicht ein Märtyrer der alten Krone? Hatte er sie nicht verteidigt gegen Frevlerhände, mußte er nicht Schmach und Verachtung für sie erdulden, war es nicht die Krone, um derentwillen er Heimat und Ehre verlor?
Um dieses Martyriums willen liebte Hanka ihren Mann, hatte sie für seine Verirrungen nichts als liebendes Bedauern.
Nun saß sie wieder einmal allein. Sie nähte an kleiner Wäsche für das Kind, das sie erwartete. Sie freute sich auf dieses Kind. Vielleicht würde Samo erlauben, daß ihre Eltern zur Taufe kämen. Das würde doch ein Lichtblick sein in ihr so dunkles, einsames Leben; vielleicht würde Samo gar ordentlicher werden, mehr zu Haus bleiben, wenn erst das Kindchen da war. Dann würde Hanka zufrieden sein.
Da klopfte es an die Tür, und es stürzte ein alter Mann in höchster Aufregung ins Zimmer.
»Sind Sie – sind Sie Frau Halek?«
»Ja, – was wollen Sie?«
»Sind Sie die Frau Samos?«
»Mein Mann heißt Wenzel Halek.«
»Ja, gut, gut; aber ich weiß, wer er ist, woher er stammt. Wo ist Ihr Mann?«
»Das weiß ich nicht! Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
»Wo ist Ihr Mann?« schrie der Alte.
»Ich weiß es nicht!«
»Sie wissen es bestimmt! Sie wissen auch, wo die Krone ist! Wo ist meine Krone? Meine kostbare Krone?«
Der Alte brüllte es. Hanka sah ihn erschrocken und verängstigt an. Sie glaubte, einen Irrsinnigen vor sich zu haben. Verzweiflungsvoll fuhr sich der Mann mit beiden Händen über den kahlen Kopf.
»Wenn Sie es nicht sagen, dann hole ich die Polizei! Dann lasse ich alle einsperren – alle!«
»Was wollen Sie eigentlich von meinem Mann?«
»Die Krone hat er mir gestohlen. Aus dem Altar heraus hat er sie mir gestohlen. Hat sich eingeschlichen, weil er meine Wirtschafterin kennt!«
»Was für eine Krone? Was redet Ihr immer von einer Krone?«
»Die Krone Przemisls. Die echte Krone! Das Heiligtum! Die Krone, nach der Ihre wendische Krone gemacht worden ist.«
Noch immer sah ihn Hanka fassungslos an.
»Die wendische Krone gemacht worden ist –?« wiederholte sie verständnislos.
»Nun ja, ich hab' doch meine echte böhmische Krone hergeliehen, daß sich Samo eine Krone machen lassen konnte –«
»Eine Krone machen lassen konnte – –? Wozu braucht Samo jetzt eine Krone?«
»Jetzt?! Frau, verstellen Sie sich nicht! Wer redet von ›Jetzt?‹ Damals – als er die Krone für den wendischen Königshügel brauchte, – als er sich die Krone machen ließ –«
»Für – für unseren – unseren Hügel?!«
Hanka fragte es mit entsetzt starrenden Augen. Ein grausiges Licht ging ihr auf.
»Nun, natürlich für Ihren Hügel – Sie verstellen sich doch bloß – Sie müssen doch das wissen als seine Frau. Und das ist der Dank, daß er mir –«
Er hielt inne. Die Frau vor ihm war ohnmächtig zusammengesunken.
»Was ist das? Was ist mit ihr? – Aah – Sie erschrak vor der Polizei! O hätt' ich doch – hätt' ich doch – meine Krone –«
Er begann die ganze Stube zu durchsuchen, öffnete den Schrank, riß die Schübe auf, wühlte alles durcheinander. Darüber kam Samo nach Haus.
»Was geht hier vor? – Was macht der alte Halunke? – Stiehlt er? – Ahnt' ich es doch!«
Er schloß die Tür hinter sich ab.
»Meine Krone will ich – meine Krone will ich – wo hast du sie – du – du …« brüllte der Alte. Samo schob ihn beiseite.
»Hanka – was ist mit Hanka? Hat sie der Lump erschlagen?«
»Sie ist von selbst umgefallen. Ich habe ihr nichts getan.«
»Hast du es ihr gesagt, daß wir unsere Krone nach deiner …«
Der Alte nickte. »Ich glaubte, sie wüßte es! Und es ist alles egal – alles egal – meine Krone will ich.«
»Oh, du – du – du Lump – auch das noch – auch das noch!«
Samo schüttelte den alten Mann, daß ihm der Atem ausging. Dann raffte er Hanka auf und legte sie aufs Bett. Dabei erwachte sie. Sie schaute entsetzt auf Samo:
»Ist es wahr, was jener Mann dort …«
»Ja,« stieß Samo heiser heraus, »es ist wahr! Nun sollst du's schon wissen!«
Da schloß Hanka die Augen und rührte sich nicht mehr.
»Meine Krone will ich, meine heilige Krone will ich!« heulte wieder der Alte.
Samo stieß ihn auf einen Stuhl.
»Deine heilige Krone habe ich verkauft!«
Der Alte schrie auf.
»Ich habe sie an einen Matrosen verkauft, der hier zu Besuch war und jetzt über alle Berge ist.«
»Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein,« heulte Krok; »das gibt Gott nicht zu!«
»Laß Gott aus dem Spiel, alter Lump! Deine Krone wird in irgendeinem Hafenort verschachert oder eingeschmolzen werden. Fünf Gulden habe ich dafür bekommen. Da hast du das Geld!«
Er warf es dem Alten vor die Füße. Der schnappte nach Luft, brachte aber kein Wort mehr heraus.
»Siehst du, alter Krok, das ist meine Rache! Eine viel zu winzige Rache. Ich habe dir einen alten Silberscherben genommen, der tot und leblos war; du hast mir die lebendige Krone meines Volkes vom Haupte gerissen, du hast aus dem künftigen Wendenkral einen versoffenen Vagabunden gemacht. Wenn ich sage, wir sind quitt, bin ich großmütig. Ich zerstörte dir eine Marotte, du zerstörtest mir das Leben.«
Nun schlug der alte Krok einen andern Ton an:
Mit gefalteten Händen stand er vor Samo:
»Erbarme dich, Samo, erbarme dich! Sei großmütig, wirklich großmütig! Gib mir die Krone wieder!«
»Gib du mir meine Krone wieder, wenn du kannst!«
»Sieh es ein, Samo, ich habe es gut mit dir gemeint. Denke an die schöne, feierliche Nacht, da du zuerst bei mir warst.«
»Ich verfluche diese Nacht; sie war der Anfang zu meinem Verderben.«
»Es mußte doch so sein, wenn das Slawentum bei euch gerettet werden sollte – sieh es doch ein!«
»Nein, es mußte nicht so sein!«
»Ich habe es dir anders geraten …«
»Ich weiß, was du mir geraten hast. Selbst sollte ich die Krone ausgraben oder von dieser Frau dort, die damals noch ein Mädchen war, mit einer versilberten Schaufel ausgraben lassen und die Krone nach meiner Heimatkirche übertragen. – Ich konnte es nicht; ich brachte diese elende Komödie nicht fertig …«
»Völker sind oft durch Komödien geleitet worden, Samo, tausendmal sind Völker durch ein Spiel, das ihre Phantasie ergötzte, zum Glück und zur Größe geführt worden. Wer das nicht wagt, was kleine Leute Betrug nennen, kann nicht der Führer eines Volkes sein; denn die Völker wollen und müssen von Zeit zu Zeit betrogen werden. Es gibt keinen Staat der Welt, wo so etwas nicht bewußt geschehen wäre.«
»Das ist deine Sophistik!«
»Du hast ihr zugestimmt. Und dann ist das Ganze an deiner Schwäche gescheitert.«
»An meiner Ehrlichkeit!«
»Nenne es, wie du willst! Aber wenn du ehrlich bist, gib mir die Krone wieder, die du aus meiner Kapelle geholt hast. Ich bitte dich um Himmel und Erde willen, gib mir die Krone!«
Hanka sprang vom Bett auf. Finster schaute sie auf Samo.
»Gib ihm die Krone zurück! Sei wenigstens kein Dieb!« sagte sie hart.
»O gute Frau! O brave Frau Hanka!«
Samo lachte laut und lange. Er wandte sich an Hanka:
»Nun hast du mich also ganz erkannt, Hanka! Ein Prachtkerl, nicht wahr? Und das, was ich bin, bin ich durch diesen[235] Mann. Schau ihn an, den kahlen Affen! Er hat kein anderes Ideal als alten Kram, in dem er sich wohlfühlt. Ich wußte, daß ich ihn nicht ärger treffen konnte, als daß ich ihm seine alte Krone nahm; deshalb nahm ich sie ihm, und deshalb bleibt sie ihm genommen.«
»Samo, erbarme dich …«
Der Alte fiel vor ihm auf die Knie.
Da nahm Samo seinen Hut und stürmte davon. Der Alte lief ihm wimmernd und händeringend nach.
Der trübe Tag verging, eine sternenlose Nacht folgte ihm. Und als auch sie vorüber war und das fahle Morgenlicht durch die Straßen schlich wie ein zu früh gewecktes, müdes Kind, das auf Arbeit ausgehen muß, da verließ Samo das Wirtshaus, in dem er so lange gewesen war, und irrte erst ziellos durch die Gassen und kam schließlich, von innerem Drang geleitet, an das Haus des alten Krok.
Was er dort wollte, wußte er nicht; er wollte sich wohl mit dem alten Manne weiter streiten. Es tat ihm wohl, mit ihm Händel zu haben. So klopfte er an die Tür.
Nur wenige Minuten, und die alte Haushälterin kam und erschrak so vor Samo, daß sie sich auf die Treppe setzen mußte. Samo schloß die Tür von innen und ließ die Alte sitzen, nachdem er ihr unter einer rauhen Drohung verboten hatte, Lärm zu schlagen. Das Weiblein duckte sich zitternd und heulend zusammen.
Oben im Eckzimmer war Licht, auch der Nebenraum war erleuchtet. Aber Krok war nicht zu sehen. Da ging Samo nach der Kapelle.
Sie war hell erleuchtet. Ungezählte Kerzen flammten.
Der beraubte Tabernakel des Altars stand offen.
Und auf den Stufen des Altars lag lang dahingestreckt der alte Krok und war tot.
Regungslos stand Samo, starrte mit stumpfem Sinnen[236] in das Kerzengeflimmer und dann wieder auf den toten Greis. Lange stand er so. Dann aber war es, als würden die Heiligen und Helden an den Wänden lebendig.
Wenzeslaus schwenkte seine Fahne, der große König Karl stieg aus dem Bilde, Wallenstein zückte den Degen, Przemisl, der König, dessen Krone geraubt worden war, sprang auf von seinem Pflug.
Da lief Samo davon, die Treppe hinab, hinaus auf die Straße.
Die kühle Morgenluft ernüchterte ihn. Er ging zwei oder drei Straßen weiter, dann setzte er sich müde auf die Stufen, die zu einer Kirchenpforte emporführten.
Krok war tot. Weil er die Krone verloren hatte! Weil das alte Heiligtum nun ein wüster Matrose irgendwo versetzte und das Geld, das er dafür bekam, verliederte.
Ei, alter Krok, dir ist es schlecht ergangen!
Aber ich habe auch keine Krone. Ich bin auch tot.
Tröste dich! Siehe, der dort auf der Straße dahertorkelt, der war früher ein Priester. Siehst du, wie er stehen bleibt? Siehst du, wie er ein paar Sekunden lang her auf die Kirche sieht? Da hat er früher Hochamt gehalten, und an seinem Altar brannten viele Lichter.
Er hat auch eine Krone verloren.
Viel, viel Menschen verlieren eine kostbare, alte Krone, sinken von einem Thron in den Pfuhl.
Tröste dich also, alter, toter Krok! Ich will jetzt nicht mehr bös auf dich sein. Davon hast du schon etwas; denn ich bin doch ein Königssohn. Weißt du noch, wie du mich vergöttert hast? Wie du mir die Hand küßtest? Es ist dumm genug, daß alles so kommen mußte!
Als es heller wurde, ging Samo nach Hause.
Nun kam noch ein ernstes Wort mit dem Weibe. Am Ende war der auch Unrecht geschehen. Aber Unrecht muß geschehen, Hanka, muß! Hast halt auch Unglück gehabt. Glaubtest, einen künftigen König zu heiraten, und bekamst einen Lumpen …
Die Stube war leer. – – –
Auf dem Tische lag ein Zettel. In Hankas wenig geübten Schriftzeichen stand darauf zu lesen:
»Ich habe bei dir ausgehalten, weil ich glaubte, du seiest im Recht. Jetzt gehe ich fort. Ich will unser Kind ordentlich erziehen oder es doch zu guten Leuten bringen. Deiner mag sich Gott erbarmen. Hanka.«
Samo las den Zettel zweimal, dann nickte er mit dem Kopf.
»Es stimmt!«
Ein paar Minuten starrte er stumpf vor sich hin. Dann öffnete er die Kommode und durchsuchte sie. Dabei brummte er:
»Es war doch – es war doch – ein Strick im Schube! – – Wo ist er nur – ist er nur? Immer, wenn man was braucht, findet man's nicht. Wo ist nur der Strick?«
Beim Suchen fiel ihm eine Geldbörse in die Hand.
»Das Geld hat sie dagelassen – hat sie dagelassen – o ja, anständig war sie …«
Er trat ans Fenster und stand dort regungslos wohl eine Viertelstunde. Der junge Morgen leuchtete ihm ins Gesicht.
Da steckte er die Börse und einige Papiere zu sich, verließ das Zimmer, schloß es ab und trat wieder auf die Straße.
Es war an einem regnerischen Märzabend des Jahres 1866. Eine Frau erschien an der Tür Juros, der in einer ansehnlichen deutschen Stadt als Arzt lebte. Die Frau begehrte den Herrn Doktor zu sprechen.
Das Dienstmädchen öffnete eine Tür.
»Sie wünschen?« fragte der Doktor.
Die Frau rührte sich nicht. Sie blieb an der Tür stehen. Da kam ihr Juro näher.
»Womit kann ich Ihnen – – Hanka! Hanka! Hanka! – Bist du es wirklich? – Komm – nimm meinen Arm! Setze dich! Aber, Hanka, reg dich doch nicht so auf! Sei doch ruhig! Wir wollen ja ganz ruhig sprechen. Rege dich nicht auf![238] Wir kommen schon zum Ziel. Sei doch ruhig – fürchte dich nicht!«
»Ich komm – ich komm um Verzeihung bitten – ich …«
»Was? Laß das, Hanka! Werde erst ruhig! Laß mich lieber fragen. Du warst bei Samo, bei deinem Manne, nicht wahr?«
»Ja – er – er hat – hat alle betrogen – er hat – hat die Krone eingegraben – und sie war – war gefälscht!«
Sie weinte leidenschaftlich. Juro faßte sie an beiden Händen.
»Liebes Kind, das weiß ich schon, das ist mir ja nichts Neues – reg' dich doch darum nicht so auf! Das ist eine alte Geschichte für mich, die nun endlich vergessen sein soll.«
»Ich bin – bin bei ihm geblieben, bis ich das wußte. Aber jetzt – jetzt konnte ich nicht mehr.«
»Du bist fort von ihm?« sagte Juro düster. »Du hältst es bei ihm nicht aus?« Weiteres mochte er nicht fragen.
Hanka aber sagte unter einem Strom von Tränen:
»Er ist – ist ganz liederlich geworden – er erträgt es nicht, daß er so ausgestoßen ist – und ich – ich erwarte ein Kind – und das Kind kann da nicht aufwachsen, nicht bei diesen schrecklichen Menschen in Prag – nicht, wo ich jetzt alles weiß …«
Juro sah sie mitleidig an. Er streichelte ihr den Kopf, und sie schwieg eine lange Weile, ehe sie sich fassen konnte. »Und nun bin ich gekommen,« fuhr sie dann fort, »um Verzeihung zu bitten – dich und deine Frau und deinen Schwager Heinrich und unsern alten – alten Vater Hanzo.«
Da stand Juro auf.
»Nein,« rief er, »nein, Hanka, der Vater darf davon nichts wissen, der darf nie, nie erfahren, daß die Krone gefälscht war.«
»Er muß es doch erfahren!«
»Nein, Hanka! Sieh, ich bin nicht mehr der alte. Wohl erkenne ich jetzt noch meine Prinzipien als richtig, wohl glaube ich jetzt noch, daß für unser Wendenvölklein allein im innigsten Anschluß an die Deutschen das Heil liegt, aber ich weiß auch, daß ich nicht unschuldig bin an allem, was geschehen ist. Ach,[239] Hanka, uns arme Menschen quält alle eine Schuld. Keiner von uns ist weiß wie Schnee, keiner von uns ist schwarz wie die Nacht.«
Er sah ein Weilchen vor sich hin, dann fuhr er fort: »Mein Jugendungestüm, oder sage ich ruhig, mein geistiger Hochmut, hat mich verleitet, rücksichtslos mein Ziel zu verfolgen, hat alles kluge Abwarten vereitelt. Daß ich den Hügel aufgrub, war nicht recht! Die Schicksale der Völker gehen ihren Weg wie die großen Ströme; es ist töricht, unsere paar Hände voll Sand gegen sie zu werfen. Und es ist sündhaft, altes, gläubiges Vertrauen ohne Not niederzureißen. Selbst Gottes Sonne schmilzt ja altes Eis nicht an einem Tag.«
Wieder machte er eine Pause, ehe er weitersprach:
»Dem Vater muß sein Vertrauen zu der alten Krone erhalten bleiben. Was nützt es, seinem sinkenden Tag das Abendgold zu nehmen? Und so wie er ist sein wendisches Volk. Dessen langer mühsamer Tag geht zur Neige. Es stehen noch ein paar rote Träumerwolken an seinem Himmel; ich habe erkannt, daß es unrecht ist, den Wenden dieses letzte Glück zu nehmen.«
Hanka hörte auf zu weinen, als er so redete. Nach einiger Zeit beruhigte sie sich so weit, daß sie einen Bericht über die zwei letzten Jahre ihres Lebens geben konnte. Sie stockte oft und brachte die Worte nur mühsam heraus, und als sie der letzten Tage gedachte, mußte sie alle Kraft zusammennehmen. Als sie geendet hatte, sagte Juro:
»Hanka, auch du darfst das Vertrauen nicht verlieren. Du darfst nicht so in bitterem Groll an deinen Mann denken. Schon um deines und seines Kindes willen darfst du es nicht. Hanka, ich bin überzeugt, daß Samo, als er die Krone eingrub, glaubte, er tue etwas, das unerläßlich sei, er begehe nichts als eine Kriegslist, zu der ich ihn gezwungen hatte. Mit diesem Gedanken ist er von dem alten Manne aus Prag zurückgekehrt. Und, Hanka, was er gefehlt hat, hat er bitter büßen müssen. Er ist ja so unglücklich geworden!«
»Ich kann nicht zu ihm zurück; sein Leben ist schrecklich!«
»Du sollst und du darfst auch jetzt nicht zu ihm. Vielleicht findet er später noch eine friedliche Stätte.«
Hanka schüttelte traurig den Kopf.
»Er hat wirklich sehr an seiner Heimat gehangen; er findet sich draußen nicht zurecht.«
Juro grübelte. Er hatte längst Erkundigungen eingezogen, ob denn keine Aussicht sei, daß durch des Königs Gnade die Gefängnisstrafe, die Samo zu gewärtigen hatte, wenn er zurückkehrte, in Festungshaft umgewandelt werden könnte. Er hatte nichts Tröstliches erfahren. Daß Samo nach der Tat geflohen war, und daß er sich nicht selbst gestellt hatte, daß er unter einem falschen Namen sich so lange verborgen hatte, machte die Sache aussichtslos.
Armes Weib! So jung und so tief in der Verlassenheit. Armes Kind, das zum Leben strebte und schon jetzt keinen Vater mehr hatte!
Juro suchte nach freundlichen Trostworten; er fand keine. Es würgte ihn an der Kehle, er brachte nichts Ordentliches heraus. Endlich sagte er:
»Du mußt bei uns zu Gaste bleiben, Hanka!«
Sie wehrte mit beiden Händen ab.
Nein! Nein! Sie wollte bloß ihre Pflicht tun, Aufklärung geben, Abbitte leisten und dann sehen, ob ihre Eltern sie aufnehmen würden. Sie wolle bald wieder fort.
Da ging Juro hinaus und holte seine Frau. Elisabeth eilte herbei. Ach, diese kleine deutsche Frau lachte und weinte und lachte wieder und war so offenbar glücklich, Hanka zu sehen, daß sich das arme Weib ihren Zärtlichkeiten nicht entziehen konnte.
Juro schlich hinaus. Nach einem Weilchen kam er mit einem Kindchen zurück.
»Sieh, Hanka, das ist unser Kind. Es ist sechs Monate alt.«
Da nahm Hanka das Kind auf ihre Arme, und das Gefühl einer großen heiligen Versöhnung überkam sie. Schwere, erlösende Tränen quollen aus ihren Augen, aber ihre Augen glänzten durch diese Tränen. Eine süße Vorahnung eigenen[241] Mutterglücks ward in ihr lebendig und tilgte das Herzeleid und machte die Stunde schön und lieblich.
Während die Frauen später an der Wiege des kleinen Mädchens saßen und Elisabeth echte Töne des Trostes und der Beruhigung für Hanka fand, saß Juro in seinem Arbeitszimmer und schrieb einen ernsten Brief in wendischer Sprache.
Lieber Vater!
Dein Sohn Juro klopft an Deine Tür und bittet Dich um Verzeihung für all das, was Du Bitteres durch ihn erfahren hast. Ich habe eingesehen, daß der Weg, auf dem ich meine Prinzipien in Tat und Wahrheit umsetzen wollte, nicht der richtige war, daß überall da, wo zwischen Menschen und Völkern der Kampf geführt wird, der beglückende wahre Sieg fehlen muß, wenn als Kampfmittel nur Klugheit und List, Energie und sachliche Überlegenheit oder gar Gewalttat und Rücksichtslosigkeit eingestellt werden, wenn die Liebe fehlt, die allein zu versöhnen, zu überzeugen und zu gewinnen vermag. Ich habe geirrt; es tut mir leid. Ich will nicht mehr dessen gedenken, was auf der Gegenseite verschuldet wurde; ich will auch die Schande, die mir widerfahren ist, als ich auf jenem Wagen aus dem Dorfe gefahren wurde, hinnehmen als eine Strafe, die der Vater dem Sohne aufzuerlegen für gerecht fand. Ich rede nur von mir und bekenne mich in vielen Dingen für schuldig.
Von dem Versöhnungsgedanken getrieben, ist heute Hanka in meinem Hause eingekehrt. Sie sitzt, während ich diesen Brief schreibe, mit meiner Frau an dem Bettchen unseres Töchterchens, Deines ersten Enkelkindes. Hanka ist mit uns im Frieden. Auch sie wird ein Kind bekommen in der nächsten Zeit. Sie hat aber doch ihren Mann, unseren Samo, verlassen müssen, weil sein Leben zu unsicher ist und Hanka in ihrer schweren Zeit nicht bei ihm bleiben konnte. Sonst ist Samo gesund, und wir alle hoffen, daß er noch einmal eine friedliche Stätte findet und daß Hanka dann mit ihrem und seinem Kinde zu ihm zurückkehren kann.
Um den Stein des Anstoßes zwischen uns zu begraben, verzichte ich für mich und meine Nachkommenschaft auf die Erbfolge an der wendischen Kralswürde, und zwar zugunsten des zu erwartenden Kindes meines Bruders Samo und seiner Frau Hanka.
Gott gebe Dir, lieber Vater, versöhnliche Gedanken!
In Liebe: Dein Sohn Juro.
Drei Tage später stand der alte Hanzo unter der Tür seines Sohnes Juro. Er hielt den Hut in der Hand und sagte: »Darf ich zu euch herein? Ich möchte zu meinen Kindern.«
Sommer 1866. Der Deutsche Krieg brach los. Die preußischen Heere drängten durch die Pässe des schlesischen Gebirges und zogen den Elbstrom hinab nach Böhmen. Auch die Wenden zogen in den Kampf. Was diesseits der preußischen Grenze war, für Preußen, was drüben in Sachsen wohnte, für Österreich. Das Völkchen der Wenden in zwei Lager zerrissen. Da standen sich oft Bruder und Bruder gegenüber. Der alte »Kral« Hanzo litt schwer in diesen Tagen um sein kleines, getrenntes Volk.
Juro machte den Feldzug als preußischer Militärarzt mit. Er war einem Regiment, in dem besonders viele Wenden waren, als Hilfsarzt zugeteilt.
Und wo er auf dem Schlachtfeld einen fand, der seine Schmerzen in wendischen Lauten beklagte, da fragte er nicht: »Sprichst du auch Deutsch?« Da kniete er bei ihm nieder und erquickte ihn nicht nur mit ärztlicher Hilfe, sondern auch mit dem süßen Trost der Muttersprache.
Ganz gleichgültig ist es auf dem Felde der Leiden, auf welcher Seite der verwundete Mann gefochten hat. Juro, der auf der Sprachgrenze der Obersorben und Niedersorben aufgewachsen war, erforschte mit feinem Ohr die Gegend, aus der der Verwundete stammte, und sprach zu ihm in seinem[243] heimischen Dialekt, und ehe es ans Sterben kam, betete er mit dem Mann aus dem Oberlande: »Wótcě naš, kiž sy w njebjesach« und mit dem Mann aus Niederland: »Woschz nas, kenž sy na niebju«, und es hieß immer: »Vater unser, der du bist im Himmel.« – Da trat mitten im großen Völkerschicksal das eigene Schicksal wieder an Juro heran.
Als der Krieg eben sein rasches Ende gefunden hatte, schrieb ihm ein Freund und ärztlicher Kollege aus Königgrätz: »In unserem Spital liegt dein Bruder Samo. Er ist bei Sadowa im böhmischen Heer schwer verwundet worden. Er nennt sich Wenzel Halek. Aber ich kenne ihn doch von früher. Wenn du ihn noch sehen willst, eile – er ist verloren!«
Nun, es ließ sich machen, daß Juro Urlaub bekam.
Und die beiden Brüder sahen sich wieder …
»Bruder Samo!«
Samo wandte das Gesicht zur Seite.
»Willst du mir nicht die Hand geben?«
»Es ist keine Ehre, mir die Hand zu geben.«
»Es ist eine Ehre! Du bist ein tapferer Krieger gewesen!«
»Tapferer Krieger?«
Samo lachte gequält, dann wandte er sich halb um: »Als gemeiner Mann, als Wenzel Halek eingestellt! Ein lustiger Krieg – nicht wahr? Deutsche gegen Deutsche! Es ist die alte Katzbalgerei, die Mode ist bei dieser großen Nation!« Er schwieg erschöpft. Juro war erschüttert. Nach so langer Zeit, nach so vielen schweren Schicksalen sahen sich die Brüder wieder, und sofort begann Samo seine alte Weise. Das Reden fiel ihm schwer; aber er bezwang sich und sprach mit dem alten Haß in der Stimme:
»Die alten deutschen Herzöge haben sich geprügelt, die Grafen und Ritter haben sich geprügelt, die deutschen Kaiser haben mit den deutschen Gegenkaisern gerauft, der Dreißigjährige Krieg ist gewesen, dies große Schauspiel der Schande, Maria Theresia hat mit dem preußischen Friedrich gerungen, die katholischen deutschen Bayern haben die katholischen Tiroler gemetzget, der Schlesier Blücher hat die sächsische Stadt[244] Leipzig genommen – alles – alles – alles Deutsche – und jetzt wieder – wieder dasselbe – und das ist die Nation der wir uns – uns unterwerfen sollen.«
Kraftlos schloß er die Augen. In steigendem Fieber hatte er geredet.
Juro legte ihm die Hand auf die Stirn.
»Samo – streng dich doch nicht an – du bist krank –«
Samo schlug die Augen auf. Er lächelte verächtlich.
»Krank? Ich bin morgen früh tot. Das weiß ich. Die preußische Kugel ist mir – mir in den Unterleib – weißt du, das ist das Gescheiteste – was – was die Preußen seit langem gemacht haben, – daß mich – daß mich einer getroffen hat.«
»O dieser unglückselige Krieg!«
Samo schüttelte den Kopf. Erst nach einer Weile konnte er wieder sprechen, die Schmerzen quälten ihn sehr.
»Der Krieg ist gut – gut – gut – er spaltet die Deutschen – und durch den Spalt – braust – braust frische Luft – ins slawische Feuer!«
Er blieb bis zum Tode derselbe. Draußen auf der Straße marschierten preußische Krieger vorbei; die Kapelle spielte »Heil dir im Siegerkranz!«
»Hörst du sie –? Das ist die Trostmusik, die sie uns spielen, uns Sterbenden! Aber laß sie schmettern! Besiegt ist das Deutschtum, zersprungen in zwei Hälften; die Zeit der Slawen ist näher als sonst. Dieser Krieg war gut. Die Deutschen haben ihn geführt, die Slawen haben den Sieg davongetragen.«
Juro mochte ihm in nichts mehr widersprechen. Er stand mit gesenktem Kopf am Lager Samos und wartete, ob ihm denn nicht ein Erinnern kommen würde an seine Heimat. Aber länger als eine halbe Stunde sprach Samo mit vielen Pausen noch von dem Niedergang des Deutschtums, dem Sieg der Slawen. Endlich fragte er doch ganz schüchtern, ganz furchtsam:
»Lebt der Vater noch?«
Er fragte es mit abgewandtem Gesicht.
»Er lebt und denkt an dich ohne Groll.«
»Weiß er –?«
»Nein, er weiß es nicht«, unterbrach ihn Juro rasch. »Er wird es nie erfahren. Der Glaube an sein Kraltum soll ihm nicht genommen werden.«
»Das sagst du? Da hast du dich geändert.«
»Ich habe mich in mancherlei geändert – ja!«
»Aber ein Deutscher bleibst du?«
»Ja.«
Samo seufzte tief, er sagte, ihn schmerze seine Wunde. Als er ruhiger wurde, sagte Juro mit tiefbewegter Stimme:
»Ich habe auf die Kralswürde verzichtet. Ein anderer wird Kral sein – dein Sohn!«
Samo starrte ihn mit weitaufgerissenen Augen an. Er sagte kein Wort.
»Hanka hat im Mai einen Knaben geboren, Samo!«
Noch immer sah ihn Samo starr an. Endlich sprach er leise:
»War es ein Knabe? – – Ich fürchtete immer, es werde ein Mädchen sein.«
»Ein gesunder Knabe!«
Da schloß Samo die Augen. Juro stand regungslos. Die große Feierlichkeit, da ein scheidendes Leben erfuhr, daß ein Kind, ein Teil seines Wesens, auf der Erde zurückbleiben würde, durfte kein Wort stören. Die Hände Samos falteten sich auf der Bettdecke. Gott allein wußte, wo die Gedanken waren. Endlich tastete die Rechte nach Juros Hand. Ein leiser Druck. Lange schwere Feindschaft war ausgelöscht. Die Lippen bewegten sich. Juro beugte sich tief über den Bruder.
»Wie heißt er?«
»Er heißt Hanzo wie sein Großvater.«
Samo nickte.
»Es ist gut, daß er nicht heißt wie ich.«
Noch einmal zuckten die Lippen.
»Er soll gesegnet sein!«
Dann rief er laut und ängstlich:
»Mach das Fenster auf!«
Juro öffnete das Fenster. Als er ans Lager zurückkehrte, lag Samo im Todeskampf. – – –
Als es überstanden war, drückte Juro dem toten Bruder die Augen zu. Und er, der Deutsche, übte den wendischen Totenbrauch; er hielt die kleine Wanduhr an und deckte über den winzigen Spiegel, der auf dem Tisch lag, ein Taschentuch.
Vor dem Fenster saß ein kleiner Vogel und sang.
Zu dem sagte Juro mit tränenerstickter Stimme:
»Der Herr ist gestorben!«
Da flog der kleine Vogel davon.
Vielleicht flog er nach der Heimat.
Die Jahre gingen dahin, der Französische Krieg war geschlagen, die Wenden hatten ihre alte Tapferkeit bewiesen im Kampfe für das große Vaterland. Und es war Friede geworden im deutschen Land, alter Hader beglichen, alte Wunden vernarbt.
Auch im Wendenland war Friede. Keinerlei Auflehnung und Untreue des kleinen stillen Völkchens, keinerlei Bedrückung, kein unfreundliches Wort von seiten der Deutschen. Noch flatterten die großen Haubenbänder im Wind, noch schnurrten in den Spinnstuben die Rädchen und die Mäulchen, noch ritten die Osterreiter übers Feld, noch klangen die alten wendischen Lieder. Und mit Liebe und Sorgfalt gingen gelehrte Gesellschaften und Einzelpersonen daran, zu sammeln, zu hegen, daß nichts Wertvolles, nichts Köstliches aus diesem Völkerleben verlorengehe oder vergessen werde. Und diesen Leuten stehen alle Deutschen nahe, die guten Willens sind.
Stilles friedliches Einvernehmen! Die Schönheit des wendischen Spreewalds wurde den Leuten im weiten Lande durch Hunderte von Bildern kundgetan, und bald besannen sich die klugen Berliner, daß ihre Spree, an deren »grünem Strand« sie wohnen, ja doch irgendwoher kommen müsse, und kühn wie die Sucher der Nilquellen drangen sie stromaufwärts, gerieten in den Spreewald und staunten, daß da ein wundersames Lagunenland war, märchenhaft wie das alte Venedig, mit[247] hohen grünen Walddomen und Gondolieren, die auf leisen Nachen den Fremden durch verträumte Wasserstraßen fahren.
Auch ins noch stillere Oberland kam manch ein Maler, mancher Künstler und Volksfreund.
Und die deutsche Sprache kam mit ihnen. Aber die Wenden suchten sie auch selbst auf den Märkten, in den Fabriken, in den Studiersälen. Aufgezwungen darf sie nicht werden. Nationalität ist Liebe, und Liebe kann nicht erzwungen werden!
Friede war auch bei den Menschen, von denen dies Buch erzählt hat.
Hanka war die aufrechte, starke Herrscherin auf dem Hof des alten Scholta Hanzo. Als sie von dem Tode ihres Mannes erfahren hatte, legte sie weiße Trauerkleider an und trug sie ein Jahr und einen Tag. Sie sprach nie von Samo, aber sie wies alle Freier, die sich an sie drängten, herb und kurz ab. Selten versah sich jemand von ihr eines übermäßig freundlichen oder gar scherzenden Wortes; sie hielt strenge Zucht, und sogar der alte Kito bekam öfters seinen Tadel. Aber sie war gerecht. In ihrem ganzen Haus und Hof war nichts Unordentliches, nichts Unsauberes. Die alte Wičaz mit ihrem Sohn hatte fortziehen müssen. Der Scholta überließ Hanka mehr und mehr das volle Regiment, und der Wohlstand mehrte sich von Jahr zu Jahr.
Über ihrem Söhnchen Hanzo wachte sie mit äußerer Kühle, aber desto innigerer Herzenssorge. Einmal, als der Knirps eben fünf Jahre alt geworden war, trat er vor seine Mutter, hatte einen Papierhelm auf dem Kopfe und einen Holzstecken als Schwert an der Seite und sagte: »Mutter, ich bin der Kral!«
Da erschrak Hanka so, daß sie erst kein Wort herausbrachte. Dann berief sie den alten Kito und fuhr ihn hart an. Es stellte sich heraus, daß Kito unschuldig war; die Knaben auf der Gasse hatten dem kleinen Hanzo zugerufen, daß er der Kral sei.
Da sagte Hanka kein Wort mehr über diese Sache, aber sie gewöhnte ihren Sohn noch mehr als früher an Bescheidenheit und friedfertiges Wesen.
Zweimal im Jahre ließ sie die gute Kutsche anspannen und fuhr zu Besuch auf den Hof des Herrn von Withold. Und der alte Edelmann nannte sie »gnädige Frau« und küßte ihr die Hand. Mit Elisabeth verband sie seit den Tagen von Breslau eine stille Freundschaft. Von Juro hielt sie sich ferner. Sie fragte ihn nie um Rat, auch nicht wegen der Erziehung ihres Sohnes, dessen Pate er war. Desto größere Zärtlichkeit brachte sie seinem Töchterchen entgegen, das das einzige Kind seiner Ehe geblieben war. Juro lebte mit seiner Frau auf dem Gut seines Schwiegervaters. Sein Schwager Heinrich hatte seinen Willen, sich ganz der Musik zu widmen, durchgesetzt. Er war Kapellmeister in einem kleinen Hoftheater geworden. Er hatte eine Oper geschrieben, die allerdings durchgefallen war; aber sein Leben war nicht ohne Glanz, denn sein Heros Richard Wagner hatte ihn einmal auf die Schulter geklopft und »Mein lieber, geschickter Freund!« zu ihm gesagt. Von solcher Hocherinnerung ließ sich leben.
Juros ärztliche Praxis war nicht bedeutend. Es gab immer noch viele Wenden, die ihre Krankheiten besprechen ließen oder sich mit Hausmitteln behalfen. Immerhin: nach geraumer Zeit sickerte durch, daß der »Pán doctor« selten für seine Hilfe Geld beanspruche, ja daß er bei armen Leuten eher etwas aus eigener Tasche zulege. Und nun mehrten sich die Patienten. Juro sprach mit den Leuten wendisch. Manchmal – wie von ungefähr – sprach er deutsch. Und das war immer ein leises Examen. Endlich kam eine Zeit, wo ihn die Leute fragten, was sie mit ihren Kindern beginnen sollten, wenn sie aus der Schule entlassen wurden. Dann gab er ihnen die Ratschläge, die seine Überzeugung ihm vorschrieb. – –
Eines hatte die Großbäuerin Hanka lange gequält. Ihr Schwiegervater Hanzo hatte einmal in einer ernsten Stunde zu ihr gesagt:
»Hanka, ich muß dir etwas anvertrauen, was eigentlich nur eine Sache für Männer ist. Aber seit Samo tot ist, stehst du an seiner Stelle. Der kleine Hanzo ist ein Kind, mit dem ich über solche Dinge nicht reden kann. Und Juro hat verzichtet und steht[249] abseits. So will ich dir sagen, wohin unsere alte Krone gekommen ist, als sie aus dem heiligen Hügel gerissen wurde, damit du es deinem Sohne anvertraust, wenn er groß ist und ich nicht mehr bin. – Die alte Krone habe ich mit Samo in nächtlicher Zeit unter unserer Kirchhoflinde begraben, dort, wo die Mutter liegt und wo ich einmal liegen werde. Und die Krone wird über unsern Häuptern sein, wenn wir da schlafen. Niemand weiß das; die Kronenstätte ist dem wendischen Volke fortan unbekannt. Nur der Kral darf sie wissen und sein Erbe. Das ist dein Sohn. Und bis er es erfahren kann, sollst du es wissen!«
Nach dieser Aussprache war die Großbäuerin Hanka tagelang bleich und vergrämt umhergegangen, so daß die Leute unter sich flüsterten: »Die Frau ist krank!« Das war aber, weil kein Schlaf mehr über ihre Augen kam. Denn in der Nacht, wenn Hanka in halbwachem Traumschlummer lag, trat Samo an ihr Bett, sah sie mit heißen, verängstigten Augen an und rief:
»Die Mutter muß die Krone vom Kopfe nehmen!«
Das war wie in den schrecklichen Tagen von Prag. Und wenn der Morgen kam, grübelte Hanka, was sie tun solle. Ein einziger Mensch war, den sie hätte um Rat fragen können, das war Juro. Aber sie fragte ihn nicht. –
Nach sieben bangen Tagen und sieben schweren Nächten hatte es Hanka mit sich ausgemacht.
Heimlich verließ sie zur Nachtzeit Haus und Hof. Gestählt durch ihren bewußten Willen, ging sie zum hochgelegenen Gottesacker. Alles, was an Furcht- und Spukgestalt seit der Kindheit Tagen in ihrem Herzen lebte, war besiegt. Und sie ging zu der Linde, unter deren Krone die Frau ruhte, mit der sie in dies Dorf gezogen war. Sie stach mit ihrem Spaten vorsichtig den Rasen ab. Sie grub. Das Herz bangte ihr, der Spaten werde den Sarg jener Frau treffen, aber es geschah nicht. So arbeitete Hanka zwischen Grabsteinen und alten Holzkreuzen im Mondenlicht.
Und sie fand zwischen den Wurzeln des Slawenbaums, der Linde, die silberne Krone. Die putzte sie mit ihrer Schürze ab[250] und legte sie beiseite. Dann schloß sie die Grube, fügte den Rasen auf seine Stelle.
Eine kleine Weile stand sie an dem Grabe und sprach in ihrem Herzen:
»Ich wollte deine Ruhe nicht stören, gute Mutter, aber ich mußte diese Krone holen, weil es dein Sohn Samo verlangt. Nun sollt ihr beide in Gottes Frieden ruhen!« Die Krone trug Hanka auf ihrer Brust unter dem großen Umschlagtuch davon.
Und sie ging auf Seitenwegen hin zur Spree.
Dahinein senkte sie die Krone.
Leise und langsam floß das stille Wasser darüber. – –
Hanzo aber, der alte »Kral«, ging noch oft auf den Gottesacker zum Grabe seiner Frau und träumte beim leisen Rauschen der Linde von einer tiefen, stillen Ruhe da unten im Schmuck einer strahlenden Krone.
Und er war nicht getäuscht. Das wußte auch Hanka.
Eine Krone würde über seinem Haupte sein, wenn er da unten schlief:
Die alte, unvergängliche Krone, in deren Glanz und ewigem Schmuck alle die ruhen, die auf Erden die Wahrheit gesucht und das Recht geliebt haben.
[1] Schulzen.
[2] Rittermäßiger
[3] König.
[4] Alp.
[5] Juro ist der wendische Name für Georg.
[6] Großes weißes Tuch.
[7] Ohrfeige.
[8] Vorsängerin.
[9] Totenschmaus.
[10] ist viel herablassender, freundlicher.
[11] Spree.
[12] Slawischer Name für Bautzen.
[13] Jetzt versaufen wir das Fell! (der Verstorbenen).
[14] Böhmischen Krone.
[15] Aus der russischen Zeitung »Golos«.
[16] Gott führt die Seinen wunderlich zusammen.
[17] Ohrfeige.
[19] Nach dem böhmischen Volksgesang. »Stoji hruška w širem poli«.
[20] Der Branntwein ist ein Umwerfer.
[21] Wasser macht hungrig (schwach).
[22] Wendische Formel beim Zutrinken.
[23] Kämmerchen.
[24] Andere Hand – anderes Glück.
[25] Elbe.
[26] Kälbchen.
[27] Sau.
[28] Du Plunderliese.
[29] Wer mit der Katze gepflügt hat, weiß, wie sie zieht.
[30] »Gedächtnistag des Meisters Johann Hus.« Der 6. Juli. Hus wurde bekanntlich am 6. Juli 1369 geboren und am 6. Juli 1415 zu Konstanz verbrannt.
[31] Er lebe!
[32] Slawische Bezeichnung der Deutschen während der Zeit des Frankfurter Parlamentes.
[33] Fürst! Fürst!
[34] Pán Krystus, neýmocnegssj pán, racz techto klenotuw ostrzjhati sam, až do neyposlednegssho dne.
[35] Spinngesellschaft.
[36] Kirmes.
[37] Maske.
[38] Branntwein.
[40] Sohn des Hauses.
[41] Vater!
[42] Wendischer Nationaltanz.
[43] Gemeindeversammlung.
[44] Gemeindeschöffen.
[45] Schlafgöttin.
[46] »Stoz 'ce so swjeci prolowac.«
[47] »Ceknena mać.«
[48] »Lóchko zmýslena!«
[49] Wänden!
[50] Das Gotteskind (Christkind).
[51] Nach dem Lied: »Pšadla Marja kudželku.«
[52] Spatz.
[53] Rußabend.
[54] Brautjungfer.
[55] Brautgeselle.
[56] Schmutzige Hexe.
Beachten Sie
bitte die folgenden
Seiten!
Von
PAUL KELLER
erschien in gleicher Ausstattung
Heimat
»Ein Roman aus den schlesischen Bergen, ein sehr starkes Werk des Dichters, der seine Menschen aus dem Innern, aus dem Herzen zeichnet.«
Frankfurter Nachrichten
DIE GELBEN ULLSTEIN-BÜCHER
RUDOLF HANS BARTSCH
Hannerl und ihre Liebhaber
Das Schicksal einer lustigen, kleinen Wienerin, die im Glauben, über der Liebe zu stehen, an ihr zugrunde geht.
ELISABETH RUSSELL
Urlaub von der Ehe
Ein sonniger, humorvoller Ferienroman aus einer oberitalienischen Villa, in der einige Frauen und Mädchen glauben, den Männern entfliehen zu können.
P. O. HÖCKER
Die Sonne von St. Moritz
»Saison in St. Moritz, das mondäne Treiben des Luxushotels, der sport- und klatschlüsternen ›Welt‹ geben den Rahmen dieser neuen Erzählung Höckers. In dieser strahlenden Umgebung erfüllt sich das Schicksal zweier Menschen, um endlich, nach mancherlei Verwicklung, zu einem versöhnlichen Ende zu führen.«
Nürnberger Zeitung
CARL ROESSLER
Wellen des Eros
»Roeßler hat hier mit der Gabe außerordentlich scharfer Charakterisierung ein Buch geschaffen, wie es nur einer kann, der all' die Figuren bis ins Innerste kennt.«
Neue Freie Presse
PAUL FRANK
Das Liebesschiff
Das Liebeserlebnis einer schönen, vielumworbenen Frau, die sich bis zum geheimnisvollen Verschwinden eines Mannes für keinen ihrer zahlreichen Verehrer entscheiden kann.
HERMANN LINT
Horizont der Liebe
»Am Horizont der Liebe geistert eine schöne Frau, rätselhaft verschwunden, rätselhaft auftauchend in neuer, verhängnisvoller Erscheinung.«
Hannoverscher Kurier
LUDWIG THOMA
Krawall
Eine Reihe köstlicher Burlesken von der kochenden bayrischen Volksseele, von Richtern, Bauern und Städtern, von Krach und Krawall vor Gericht.
P. G. WODEHOUSE
Der schüchterne Junggeselle
Eine der amüsantesten Schöpfungen des großen englischen Humoristen. Die Handlung spielt auf dem Dachgarten eines New-Yorker Wolkenkratzers und schildert »schreckliche Abenteuer«, die ein sehr sympathischer, sehr blonder, sehr junger, sehr schüchterner Mann mit bösen Schwiegermüttern, eleganten Kartenlegerinnen und lyrischen Polizisten zu bestehen hat.
EDMUND SABOTT
Jan Fock, der Millionär
»Diese lustige, leichtbeschwingte und amüsante Diebskomödie läßt die Sympathien des Lesers von Seite zu Seite wachsen.«
Hamburger Fremdenblatt
JEDER BAND 1 MARK
Gedruckt
im Ullsteinhaus
Berlin
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtlich fehlerhafte Zeichensetzung wurde stillschweigend korrigiert.
Die Darstellung der Ellipsen und der Gedankensprünge wurde vereinheitlicht.
Sofern hier nicht aufgeführt, wurden unterschiedliche Schreibweisen beibehalten.
Korrekturen:
S. 28: daß → daß du
Ich verbitte mir, daß du mich hier
S. 38: zuckte → zückte
das Messer nach ihm zückte
S. 44: Haaresbre te → Haaresbreite
nicht um Haaresbreite dem einen näher
S. 57: ber → aber
alle Weise zu hindern, was ihm aber mißlang
S. 67: gib → gibt
Es gibt heuer recht viele
S. 67: Geberde → Gebärde
Sie machte eine Gebärde mit der Hand
S. 74: übscher → hübscher
Aber er ist ein hübscher Mann
S. 76: us → aus
der Buchdrucker aus Bautzen
S. 79: bewunderswert → bewundernswert
ein Reich ist nur in einer Einheit bewundernswert
S. 79: Baudissin → Budissin
ich bin im sächsischen Budissin geblieben
S. 82: chlesien → Schlesien
ebenso wie Schlesien geschichtlich und rechtlich
S. 96: Wicaz → Wičaz
Sie war als die Sprichwörter-Wičaz bekannt
S. 123: sie → Sie
ich danke, daß Sie mich
S. 124: sie → Sie
Vergönnen Sie nun auch meinem lettischen Bruder
S. 147: Strin → Stirn
machte er die Stirn runzelig und sagte
S. 149 druzba → družba
Oberlande heißt man's družba
S. 179: hat → Er hat
Er hat es mir geschrieben
S. 180: der → oder
ob ich ein Glas Wein oder ein Glas Milch bringen darf
S. 181: ber → aber
fremde Meinung bekämpfen, aber man dürfe
S. 200: n → an
Denkt an jeden Kaufmann, jeden Gewerbetreibenden
S. 201: wischen → zwischen
Wortgefecht zwischen Juro und Samo ausgewachsen
S. 218: hiner → hinter
einen Steckbrief hinter mir erlassen
S. 229: war → wär
Hättest du das getan, wär alles gut
S. 243: nd → und
er bezwang sich und sprach
End of the Project Gutenberg EBook of Die alte Krone, by Paul Keller
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE ALTE KRONE ***
***** This file should be named 51722-h.htm or 51722-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/1/7/2/51722/
Produced by Peter Becker and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.