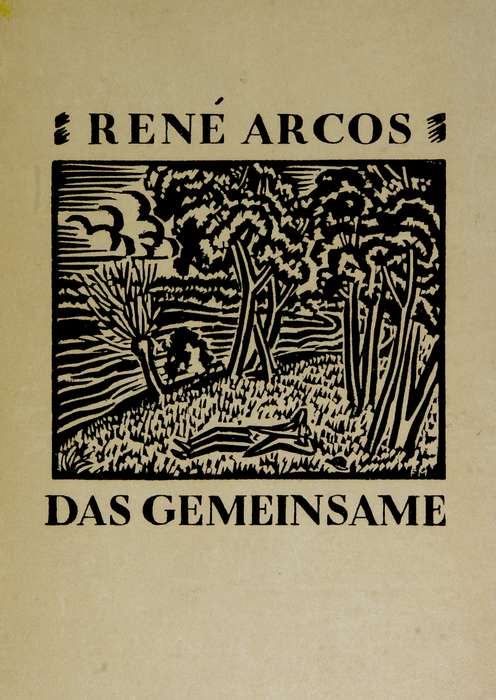
The Project Gutenberg EBook of Das Gemeinsame, by René Arcos This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Das Gemeinsame Author: René Arcos Illustrator: Frans Masereel Translator: Friderike Maria Zweig Release Date: August 3, 2015 [EBook #49582] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS GEMEINSAME *** Produced by Jens Sadowski
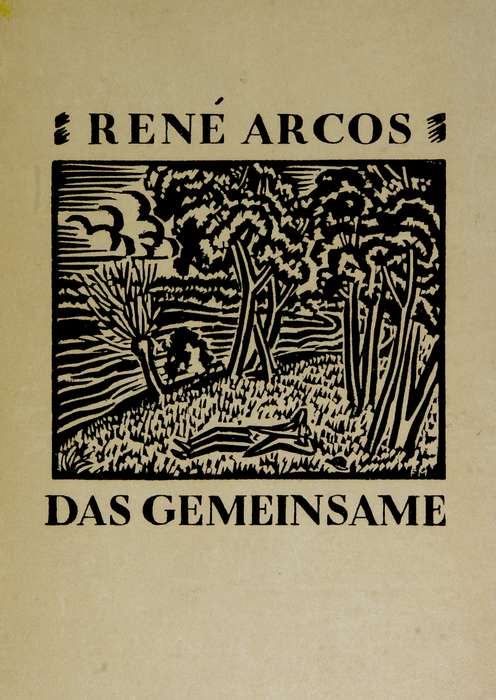

RENÉ ARCOS
ÜBERTRAGEN
VON
FRIDERIKE MARIA ZWEIG
MIT 27 HOLZSCHNITTEN VON FRANS MASEREEL
IM INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG
Mit ähnlichem Getöse, als wenn in Wäldern gewaltsame Sturmstöße das Pfeifen des Windes durchbrechen, rollt die Untergrundbahn ihrem Endziel zu. Wie eine längliche schwarze Perle schlängelt sie sich durch den Tunnel, um in der Station dann einer großen leuchtenden Perle zu gleichen. Strahlend und atemlos hält sie inne. In die aquariumartigen Glashallen fallen schwere und dunkle Gegenstände nieder, andere leichtere gleiten und heben sich in den Labyrinthen der Stiegen und Gänge, als bewegte sie die Abendluft, die um den Rachen des Tunnels flattert. Das Aus und Ein genau scheidend, klappt jede der Falltüren wie das Holzmesser eines Bäckers unerbittlich und unaufhörlich auf und ab.
Es ist in einem der letzten Züge, zu später Stunde an irgendeinem Werktag.
In einem der Waggons befindet sich ein einziger Fahrgast, ein junger Mann, der, in eine Ecke geschmiegt, vor sich hinsinnt. Tagsüber hat es reichlich geregnet. Noch haften an den Fensterscheiben Tropfen und Rinnsal des Regens, der den Zug auf den Boulevards, dort wo er aus der Erde hervorkam, ansprühte. Die Schmutzspuren eines ganzen Tages bedecken den Fußboden.
Der junge Mann verfolgt die Entwicklung einer Gedankenreihe, die sich in ihm zu regen begonnen, kaum daß er Platz genommen hatte. In seinen Gliedern drückt die Müdigkeit eines langen Tages, an dem er viel gegangen ist und viel gesprochen hat; jedoch die nie aussetzende Lebendigkeit seines Geistes läßt ihn den Körper und seine Abspannung vergessen. Er hebt kaum den Kopf in den Stationen, die wie Illustrationen einer Lektüre sind, zu denen etwa das Hineilen im Tunnel der Text wäre.
Ein dumpfer dicker Geruch schwelt in den Waggons, die den ganzen Tag über mit Menschenmassen vollgepackt waren.
Stunde und Ort flößen Ekel ein und stimmen traurig. Der junge Mann aber, ganz hinter seine Gedanken verschanzt, gibt aus sich fast nichts an diese augenblickliche Umgebung. Er sieht weder die Orangenschalen und zweifelhaften Papiere unter den Bänken, noch die Fingerspuren auf den Scheiben. Er bemerkt weder das plötzliche Aufblinken der elektrischen Lampen auf den angebröckelten Wölbungen des Tunnels, noch den Namen der Stationen, die der Zug eben verläßt. Halb unbewußt hören seine Ohren das Zufallen einer Tür. Leise wird sein Auge von der Vision einer nahenden Frau berührt, die sich nun setzt, vielmehr ihm gegenüber auf einen Platz sich hinsinken läßt. Er besieht das neue Bild und kehrt zu den Gedanken zurück, die ihn beschäftigen. Doch wie der Schwimmer, aus dem Wasser tauchend, die Barke, die er ergreift, unter seinem Gewicht herabdrückt, hängt sich eine lebendige Kraft, aus namenloser Stunde und verworrenen Lauten geboren, an den Rand seiner Gedanken.
Er macht den Versuch, sich zu befreien, aber das fremde Wesen, das sich plötzlich neben ihm aufhob, dringt gewaltsam mit seiner ganzen Gegenwart auf ihn ein. Er muß den Kopf wenden. Da überrascht sein Blick den der Fremden, der auf ihn gerichtet ist.
Der junge Mann sah anfangs nur zwei große sanfte Augen in einem ovalen Gesicht, das von jener Blässe war, die er liebt. Mit Aufmerksamkeit und Vergnügen prüft er dies feine Antlitz. Sein Blick begegnet nun oft dem der jungen Frau, der nicht ausgesprochen gleichgültig bleibt. Es gelingt ihr nicht, völlig unbeteiligt zu sein. Schon wird der Austausch ihrer Blicke lebendiger. Frage und Antwort richten die beiden aneinander, halten Zwiegespräche, von denen der Körper nichts weiß. Der junge Mann, der bald das aussichtslose Vergnügen dieses Spieles erschöpft hat, überläßt seinen schweifenden Geist anderen Träumereien. Seine Gedanken gleichen einem Wolkenhimmel, er ist der Wanderer auf einer Straße und betrachtet mit zerstreutem Blick das Wechselspiel der Wolken. Da aber breitet sich weißer Schimmer, ja Helle, über den farblosen Himmel. In den Körper des jungen Menschen kommt Bewegung, er regt seine Hände, sein Gesicht verrät plötzlich innere Aufwallung. Alles, was an tätigem Leben in ihm schlummerte, kocht auf in ihm, steigt unaufhaltsam an, überschwemmt seinen Geist, der, gleichsam gelüpft, seine Gedanken nun wie Blasen entflattern läßt. Mit einem Male hat er das Bewußtsein seiner Existenz. Er denkt: diese Minute bin ich, sie ist mein Leben, sie steht am Ende einer Ausdehnung, die all dies Leben ist, das ich schon gelebt. Ich habe mich lange fortgesetzt, ich habe Monate, Jahre gedauert, um diese Minute zu erreichen. Diese Lampen, über meinem Haupte aufgereiht, wie Fackeln einer Ehrenwache, diese dicken Mauern, wie eine Menschenmenge, die den Durchzug eines Helden erwartet, lange warten sie, auf daß ich ihnen eines Tages begegne. Diese Helle, diese metallischen Reflexe erwarteten schließlich mich nach so vielen Menschen und immer wieder nach so vielen anderen. Minuten, ja ihr, erfüllt von mir, äußere Umkleidung, die du mir Gestalt verleihst, Bewegung ohne Ende, ihr seid mein Leben! Mit meinen Augen, mit meinem Geist besitze ich euch! Oh, nie geschlossene Zeit, in dieser weit aufgetanen Minute biege ich meine Seele vor, meinen Körper spreite ich aus und stürze mich vor das Gewirre der Geräusche, dem Durcheinander von Schatten und Licht, wie Eroberer tun, an der Spitze ihrer Horden.
Dem Hineilen des Zuges entlehne ich den wilden Taumel einer im Galopp bergabwärts stürmenden Armee. Gedrängte Reiterei jagt singend hinter mir. Wäre ich allein hier, ich glaube, ich würde meine Arme ausstrecken und laut aus mir herausschreien.
Als seine Augen die junge Frau ihm gegenüber wiederfanden, war sie ihm keine Fremde mehr.
Er betrachtet sie. Dem reizenden Gesicht mit den weit ausblickenden Augen legt er ein Bild zu, das seinem Geist schon eigen ist. Er ruft sich einen Komplex von Erinnerungen wach und stellt sie einer einzigen Erscheinung gegenüber. Bei fortgesetzter Prüfung entdeckt er neue Einzelheiten und verbessert sein erstes Urteil. (Er hätte diesen Augen nicht so viel Sanftmut zugetraut.) Gerne würde er ihre Geistesart kennen lernen, und wenn er auf dem Deckel des Buches, das sie gegen sich gewendet hält und das er belauert, den Namen eines ihm sympathischen Autors entzifferte, wäre er darüber aufrichtig erfreut.
Die schöne junge Frau versucht keineswegs der Eindringlichkeit seiner Blicke zu entgehen; durfte er aus dieser Unbeweglichkeit, die Einwilligung scheint, darauf schließen, daß sie dies Betrachten mit einer scheinbar wollüstigen Geduld über sich ergehen läßt? Eine Art geheimer Vertrautheit stellt sich zwischen ihnen ein. Über das Unbekannte, das Trennende hinweg, fühlen sie sich in zarter und köstlicher Einstimmigkeit als Komplizen. Zwei losgelöste Wesen sind sie, die eine gleiche Minute umschließt. Irgend etwas, das er sich erträumt, könnte sie plötzlich vom übrigen Weltall abtrennen; nach einem furchtbaren Getöse fände er sich heil und sicher mit der zu Tode erschrockenen Frau, die sich an ihn geklammert hält, in Nacht und Dunkel wieder. Er erschafft sich das ganze Geschehnis. Sie sind in einem ausgehöhlten Raum unter der Wölbung von Balken verschüttet, die sie beschützen, sie hören das Schlagen der Hacken, die an ihrer Befreiung arbeiten und deren Tätigkeit er gleichzeitig verlangsamen und beschleunigen möchte. Den Duft ihrer Haare zu atmen, die Wärme ihres angstbebenden Körpers an dem seinen zu fühlen, berauscht ihn. Seine Stimme zittert, wie er auf ihre hundertfältigen Fragen antwortet.
Wie viel Anteil er schon an ihr nimmt!
Wenn sie auf der nächsten Station ausstiege, empfände er schmerzlich eine Verminderung seiner selbst. Jenes Bedauern überkäme ihn dann gewiß, das man fühlt, wenn man ein Wesen, das einem lieb ist, nach einem harten Wort von sich hat gehen lassen. Und doch in einer Weile wird sie ja gehen. Sie wird ihr Schicksal fortsetzen, und er das seine. Niemals wird er sie mehr wiedersehen. So ist er tausenden und aber tausenden schon begegnet. Wesen, die lange schon unterwegs sind, um ihn zu treffen, nähern sich ihm, erreichen ihn, heften zuweilen ihren Blick in den seinen und gehen über ihn hinaus, um sich im All zu verlieren. An Straßenecken und Brückenenden, wie viele tauchten da plötzlich auf, wie vom Himmel gefallen oder aus dem Erdboden erstanden. Sein Blick hat längst gelernt unter den vielen, die ihm ein Tag vorüberführt, einige zu erkennen. Im Gedächtnis behält er das Bild der Leute, die er täglich vorübergehend streift. Er hat nie mit ihnen gesprochen, dennoch sind sie in seinem Leben mehr als Fremde. Träfe er sie eines Tages anderswo, als auf den Boulevards, wo er ihnen gewöhnlich begegnet, würde das Überraschende eine Annäherung ihrer Seelen bewirken, es würde ihn gelüsten, mit ihnen zu sprechen, sich über ihre Begegnung zu unterhalten. Unter diesen Leuten ist ein Mann mit einem langen schwarzen Bart, der einen Zylinder trägt und eine Schriftentasche unter dem Arm. Er geht langsam und zuweilen mit einknickenden Knien. Dann ist da ein anderer Mann mit müdem Gesicht, der nachlässig den Fuß schleppen läßt. Er trägt einen steifen Hut, der allmählich grünlich wird. Zwischen seinen Zähnen hält er eine oft erloschene Pfeife, und an regnerischen Tagen trägt er nach Bauernart einen Regenschirm unter dem Arm. Eine Frau ist da, die immer Eile hat und deren Hüte häufig wechseln. Und eine andere Frau, deren Lächeln aus einem Kontorfenster ihm wohlbekannt ist.
Jenen allen wird er morgen, übermorgen und in vielen spätern Tagen begegnen. Aber diese Frau da ihm gegenüber, die wird er niemals wiedersehen: etwas greift ihm ans Herz.
Wenn er es dennoch wagte! Irgendeinen flüchtigen Vorwand könnte er benützen, um sie anzusprechen. Wie man eine Besitzung umkreist und versucht, durch das Gitter und Laubwerk zu spähen, könnte er Schritt für Schritt das Geheimnis ihres Lebens durchdringen, die ersten Verbindungen anbahnen, die ihm später ermöglichen würden, ihre Bekanntschaft fortzusetzen. Doch Schicklichkeit und Brauch hemmen ihn. Was der Zufall eines flüchtigen Vorgestelltwerdens gestatten würde, ist hier unmöglich. Sie brauchten die Brücke eines menschlichen Wesens, die sie beide kennen müßten, um das Geheimnisvolle dieser Hemmung zu überschreiten und einander ansprechen zu dürfen. Wenn er sie jetzt so anredete, würde er wohl nur eine Abweisung herausfordern.
Er wird nichts von ihr erfahren. In einigen Minuten wird sie aufstehen, wie einer, der nie wiederkehrt. Die Mächte, die ihr Schicksal beherrschen, werden sie in ihren Wirbel ziehen. Ein Wesen, das er jetzt schon ein wenig kennt, das augenblicklich das einzig Lebendige vor seinen Augen ist, lebendig bis an den Stoff der Bekleidung, wird in einer Weile für ihn hinsterben, so sicher wie der Tod selbst. Nein, er wird nichts mehr von dieser Frau erfahren.
Die Erinnerung an sie wird sich wie eine blasse Wolke am Sommerhimmel verflüchtigen.
Und er hüllt sie in eine Zärtlichkeit, die voll Bedauern und Trauer ist.
Der Zug hat eine neue Station durchfahren, ohne daß sie ausgestiegen wäre. Für einige Zeit noch war ihm ein Vergnügen gegönnt, und er fühlt in sich Zufriedenheit aufstrahlen.
„Oh! Ihr! Vertraute meines täglichen Lebens, augenblicklich lebt ihr für mich mit weniger Gewißheit als diese Frau, die ich zum erstenmal erblicke! Eure Worte, eure Gebärden, die Geschäftigkeit eures Daseins lebt anderswo als hier. Von diesem Augenblick meines Tages gehört euch fast nichts, eine Fremde ist zwischen uns. Ihr seid mir weit weg in einer Wirklichkeit. Ich müßte diese Frau hier erst wegstoßen, um euch die Hand entgegenzustrecken.“
Ein durchdringender und sanfter Blick der jungen Frau war ihm wie die Berührung einer Hand auf seinem bloßen Herzen. Er dachte nach und versuchte mit seinen Augen zu sagen: „Ich grüße dich und liebe dich, wie alle, die ich kenne. Oh, du! die du aus dem weiten All aufstiegst, wie jene andere aus dem Meeresschaum! Die seltsame Verwirrung, die ich empfand, als ich auf meiner Stirne die lauen Tropfen empfing wie Tränen in mystischen Grotten, ich fühle sie in diesem Augenblick wieder, da ich auf meinem Antlitz den sanften Sommerregen empfange, der aus deinen Augen taut. Ich kann dir kein Zeichen geben, mit keinem Tuch dir winken, kein Wort dieser Worte dir sagen, von denen mein Mund voll ist, denn zwischen uns ist ein neutrales Gebiet, das zu überschreiten mir verboten ist: Erblicke aber in meinen Augen alle Boten, die ich dir sende, sieh den Schmetterling, den ich zuhöchst meiner Seele entflattern lasse. Fürchte nicht, deine Augen in die meinen zu versenken und meinen Ruf zu hören. Ich empfange dich in allen Bächen meines Blutes.
Tausend Wege kannst du finden, mich zu überwältigen. Oh! Niemals hat ein Mann, der dir begegnet ist, mit solcher tiefdringender und reiner Bewegtheit dich begrüßt. Niemals grüßte ein Schiff, trotz Kanonendonner und Vivat seiner tausend Matrosen, mit solch frenetischer Begeisterung, als die meine, die Erde, das Ziel nie endenwollender Reise. Sieh, aus der Zeit komme ich, von der Erde, aus der Geschichte des Menschengeschlechtes, da ich dich erschaue: Aus einer Zeit kommend, aus der Erde, aus Vergangenheit, deren Tiefe ich nicht ermessen kann. All die unzähligen Wege, die du durch Städte, Felder, Länder gezogen, bist du nur auf mich zugegangen. Die Zeit wallt mit den Schicksalen aller Menschen weiter, wie unendliches Haar, von Ewigkeitswinden hinweggehoben, und siehe, heute berührt mein Schicksal das deine! Unter den tausenden Menschen, die ich schon in allen meinen Lebenstagen gewesen bin, unter all denen, die ich noch sein werde, ist einer, der Mensch dieser Minute, der nur dir gehört und den ich dir hinopfere. So werde ich denn nichts von dir wissen. Selbst den Klang deiner Stimme, die vielleicht süß zu hören ist, werde ich nicht erfahren. Aber ich kenne die Farbe deines Haares, und eben, obzwar meine Augen nicht mehr auf dich gerichtet waren, sah ich doch die geschwungene Form ihrer Wellen. Ich könnte das Muster der Stickerei auf deinem Kleide auswendig nachzeichnen . . . oh, ich kann mir den Druck deiner weichen Hände erträumen.“
Der Zug fuhr aufwärts. Als er aus der Erde kam, um auf der Brücke den Fluß zu überqueren, wandte der junge Mann den Kopf.
Die Vision der Stadt mit ihren Schatten und tausend Lichtern, die sich da und dort in den Himmel erhoben und wie Duft sich verflüchtigten, erfüllten ihn mit neuer Freude. Die Klarheit und die große Zahl der Lichter entzückte sein Auge. Seine Freude entzündete sich an dem ersten Leuchten, vermehrte sich an den anderen, wuchs bis zu den Sternen und vergnügte sich daran, eine Sekunde lang das ganze Gefunkel der Nacht in sich zu schließen. Große Schatten bewegten sich. Die leuchtenden Wasser des Flusses zogen majestätisch hin wie die Zeitläufe selbst. Er überschaute, die Stirne an die Fensterscheiben des Waggons gepreßt, von der Höhe der Brücke eine riesige Fläche, auf der sich lückenlos das nächtliche Zauberspiel ausbreitete. Er war ja nur ein Mensch, durch einen Zug, der unter gestirntem Himmel über einen Fluß hinfuhr, in Begeisterung geraten, dennoch fühlte er sich voll Größe und trug in seiner Seele zauberhafte Verzückung.

Er litt, als der Zug in den Tunnel einfuhr. Und aus allen Himmeln gestürzt, sank er in seine Schwermut zurück. Er betrachtete die Fremde von neuem. Er fand sie wieder, als hätte er sie schon ein wenig verloren, und der Schatten einer Befürchtung durchglitt ihn, daß sie in der nächsten Haltestelle vielleicht sich erheben würde. Zärtlich sah er sie an und lächelte leise. Das Gesicht der Unbekannten verhärtete sich, und sie wandte das Gesicht ab. Da — dachte er andere Dinge.
Der Zug durchfuhr mehrere Stationen, ohne daß sein Gedankengang gestört worden wäre. Dann wurde der Name einer Station ausgerufen, wo er umsteigen mußte, und hieß ihn aufstehen. Er trat aus dem Waggon, ohne auch nur den Kopf nach jener zu wenden, die er zurückließ. Aber auf der Plattform längs des Geleises schreitend, tauschte er im Vorübergehen einen verzweifelten Blick mit der Fremden, die er niemals wiedersehen sollte.

Vor dem Landes-Greisenasyl wimmelt schwatzend eine kleine farblose Menschenschar in Erwartung der „Alten“, die heute ihren Ausgang haben. Glücklich haben sie es nicht getroffen; denn eine schneidende Brise bläst vom Norden her, und bleierne Wolken ziehen zuhauf. Es ist einer jener traurigen Tage, wo die Lider doppelt so schwer über den Blicken zu lasten scheinen. Sogleich beginnt das Gesindel sein Gebalge bei dem Kleinkrämer, der am Straßenrand violetten Wein ausschenkt und gebratene, aufreizend riechende Würste verkauft. Zerlumpte, erschreckend blasse Kinder jagen einander im schwarzen Kot, und eine unabwendbare Trauer hängt vom verstürmten Himmel über die Ebene herab, in der kein Baum, kein Vogel lebt. Eine Glocke ertönt. Der kleine Menschenhaufe an der Tür drängt sich zusammen, Hände fassen die Stäbe der Gittertür. Aus den entfernten Höfen schart sich ein blaues Völkchen: die Pfleglinge des Asyls. Alle wenden sich mit stummen und verschlossenen Mienen dem Ausgang zu. Freudlos tragen sie die Bekleidung der öffentlichen Gastfreundschaft. Der erste erreicht nun die Tür. Sein blasses Gesicht hebt sich wie ein weißes Gebrest von dem schmutzigen Pflaster ab. Er sieht nach rechts und links, hält den Atem an, um die Gesichter, die sich vor ihm drängen, zu überprüfen. Es ist niemand da, ihn zu erwarten. Ein anderer kommt vorbei; er stellt sein Gleichgewicht mittels eines Krückstockes her. Mißtrauisch und starr wirft er auf mich seinen Vogelblick. Eine kleine Alte mit roten Bäckchen murmelt vor sich hin. Der Lärm der Holzschuhe auf dem Pflaster der Höfe erinnert an das Getöse von Wasser, das Steine mit sich rollt.
Die alten Männer und Frauen kommen jetzt in kleinen Gruppen heraus. Die Wartenden vor dem Gitter fangen von Zeit zu Zeit einen der Pfründner ab und führen ihn mit sich fort. Reichliche Umarmungen erfolgen, lärmendes Hin- und Herrufen, vertrauliches Auf-die-Schulter-Klopfen.
Sogleich beginnt das Gejammer!
„Ach das Elend, da drinnen leben zu müssen! Alles könnte man noch hinnehmen, wenn nicht das Verbot des Rauchens und die Gicht wäre! Den Vater Julius, den man im Klosett beim Rauchen ertappte, haben sie heute zurückbehalten. Ist das nicht zum Erbarmen, mit siebzig Jahren wie ein Gassenjunge bestraft zu werden!“
Da sind auch einige, die sich umwenden und die Faust gegen das riesige Gebäude ballen.
„Und dann, Sie wissen ja, was alles über die Suppe gesagt wird! Nun, meiner Seele, es ist nicht gelogen. — Letzthin . . .“
Er sieht mich, betrachtet mich mißtrauisch und hält plötzlich inne.
Immer noch kommen neue heraus. Da erscheint die Alte mit der Nase, die nach allen Weltrichtungen Auswüchse hat. Und dann jene andere, der auf der Stirn eine riesige Beule steht, rot von allen Röten des Zornes und der Schande. Ich erkenne sie alle wieder. Das ist Vater Chauffour! Jetzt hat er mich gesehen! Hurtig wird er mir wieder alle seine Unglücksfälle erzählen und seinen Kindern fluchen.
„‚Schau, daß du abfährst, alter Tagedieb‘, haben sie zu mir gesagt. ‚Laß dich dort füttern anstatt hier an uns zu zehren, bist schon weißhaarig genug dazu. Schämst du dich nicht?‘ Was ist mir da übriggeblieben? Der Sohn ist nicht schlecht, Herr, der ließe mich niemals ohne mein Päckchen Tabak weggehen, die Schwiegertochter hat schuld, diese Kreatur!“
Da ist die „Tabaret“, die Alte, die sich immer verfolgt fühlt und an der der Zorn wie Sauerteig gärt. Sie hat es satt; die Wärterin ist immer hinter ihr her. Diese Ungerechtigkeit! Alle schmutzige Arbeit muß sie leisten, auskehren, ausreiben, die Spucknäpfe reinigen und noch Ärgeres. Was hat sie denn dieser Schlampe, dieser Dirne, die man nur selten nachts in ihrem Zimmer antreffen würde, getan?
„Aber versuchen Sie nur, sich einmal zu beklagen! Der Unterdirektor sieht alles nur mit ihren Augen, und der Direktor, das ist der liebe Gott in seinem Himmel. O Elend, sich so viel in seinem Leben geplagt zu haben, um so weit zu kommen! Das ist nicht recht!“ Und die Alte zieht weinend ab.
Allmählich werden die Ausgänger seltener. Nachzügler beeilen sich, fürchtend, daß man ihnen die Tür vor der Nase schließt. Nun tritt noch ein Alter als letzter heraus. Er sieht sich nach allen Leuten um, ängstlich und verschämt. Die hohen grauen Mauern, die feuchten Höfe, das Geräusch seiner Holzschuhe auf den hohlen Pflastersteinen, der Weg über die langen Gänge, die mit Verordnungen und „Verboten“ tapeziert sind, all das scheint ihn einzuschüchtern, ja zu erschrecken. Er hat abgewartet, bis alle gegangen waren, um seinerseits allein hinaus zu kommen, so sehr leidet er unter dem Gedanken, mit diesen Leuten, die fast alle heruntergekommen und widerlich sind, verwechselt zu werden.
„Vorwärts! Sputen Sie sich, oder ich schließe die Tür“, schimpft ihm der Torwart mit den runden Spüraugen nach. Der Alte tummelt sich und senkt den Kopf tiefer. Um ihn wird alles noch feindlicher. Er geht hinaus, hebt die Augen zum Himmel empor, der geballtes Dunkel aus sich hervorwälzt; und als er dann wenige Schritte vor sich zwei Pfründner erblickt, bleibt er stehen und kehrt um. Er tut so, als suche er etwas in seinen Taschen, um ihnen einen Vorsprung zu lassen. Drei Worte mit ihnen zu wechseln, ist ihm schon zuviel. Es gelingt ihm, ohne gesehen zu werden, feldwärts in einen kleinen Pfad einzubiegen. Eine Fabrikesse, die die ganze Ebene beherrscht, speit unaufhaltsam dicken schwarzen Rauch aus. Der Alte zieht einen Brief aus der Tasche, faltet ihn auseinander und liest ihn nochmals. Sein Sohn, den er fünf Jahre lang nicht gesehen und der ihn vor zwei Monaten im Asyl überrascht hat, sein wiedergefundener Sohn hat ihn für heute nochmals zu einer Zusammenkunft eingeladen.
Diese zwei Monate ungeduldigen Wartens sind ihm länger erschienen als die vorhergegangenen fünf Jahre. Er liest abermals den Brief: „In der kleinen Buschenschenke, wo wir das letztemal zu Mittag gegessen haben . . . Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert . . . Dein Sohn, der Deiner nicht vergißt.“ Er faltet das kostbare Papier wieder zusammen und geht weiter, so rasch es seine schweren Holzschuhe und die Hindernisse des schmutzigen Weges erlauben. Dieser Sohn war das einzige Wesen auf Erden, das sich für ihn interessierte. Seine Frau hatte ihn vor mehr als fünfzehn Jahren verlassen, Johanna, seine sanfte, hübsche kleine Tochter, war in ihrer frühen Jugend hingestorben. Eine Reihe von Unglücksfällen waren dann gefolgt. Er hatte den Ozean zweimal überquert und sich auf beiden Weltteilen umhergetrieben. Die Jahre hatten sich während dieser Zeit gemehrt, und eines Tages war er mit seinem Gelde auf dem Trockenen. Wer hätte ihn da mit achtundsechzig Jahren in Dienst genommen?
Das gab ein Murmeln der Verwunderung im Eßsaal, als man hörte, wie ein wirklicher „Herr“ den „alten Bären“ Vater nannte. Geweint hatte der Alte und abermals geweint, seinen Sohn heftig umarmt und sich an ihn gehangen, als gelte es, ihn endgültig fremden, beängstigenden Gewalten zu entreißen. Er nährte jetzt die heimliche Hoffnung, daß sein Sohn ihn aus dem verhaßten Hause herausnehmen würde. Beim ersten Wiedersehen hatte er noch nicht gewagt, ihn darum zu bitten, aber heute war er dazu fest entschlossen. Wie könnte er ihm das verweigern? Er brauchte ja so wenig, ein kleines Zimmer, die notwendigsten Möbel und etwas über dreißig Franken im Monat. Das Taschengeld zu verdienen würde er schon eine Möglichkeit finden, indem er irgendwo arbeitete. Diese Hoffnung nahm er zu der Begegnung mit.
In starker Gemütsbewegung stößt er eine Tür auf und tritt in das Gärtchen der Schenke. Ob er schon da ist!? Er blickt die Lauben entlang. Noch niemand! Er empfindet eine kleine Enttäuschung, beruhigt sich aber mit dem Gedanken, daß es noch zeitig sei. Er setzt sich an einen Tisch unter einer Laube. Man hat ihn nicht eintreten gesehen, und in seine Gedanken vertieft, denkt er gar nicht daran, die Kellnerin zu rufen. Wahrscheinlich hat er die Straßenbahn benützt und wird von dieser Seite kommen, in diesem Augenblick denkt er an mich. Wenn er nur nicht gar zu spät kommt! Der Alte beugt sich vor, um auszuschauen, er nimmt seinen Brief heraus und liest ihn abermals. Ja, es stimmt: für diesen Tag. Nun meint er das Warten leichter ertragen zu können, wenn er etwas inzwischen trinkt, und er klopft auf den Tisch, um auf sich aufmerksam zu machen. Man hört ihn nicht, und er wiederholt mehrmals seinen Ruf. Die Magd erscheint endlich, und ihre Züge verhärten sich, als sie in ihm einen Pfründner erkennt. Diese Schelme haben keinen guten Ruf, sie gelten als Trunkenbolde und schlechte Zahler. Aber sie spürt doch, daß dieser da sich von den anderen vorteilhaft unterscheidet, und sagt fast besorgt:
„Im Saal werden Sie besser dran sein, es wird gleich zu regnen beginnen.“
Da er aber hier warten will, um dann später mit seinem Sohn allein zu sein, lehnt er, ein Lächeln sich abringend, sanft ab. Er wäre ja, wenn es regnete, durch die Blätter geschützt. Man müsse ja auch Luft schöpfen. Er hat sich einen Schoppen bestellt. Es bleiben ihm noch acht Sous von den zehn Franken, die ihm sein Sohn anläßlich seines ersten Besuches gegeben hat. Er hatte einige Kleinigkeiten gekauft, auch ein wenig Wäsche. Der Rest reicht gerade noch für diesen Schoppen. Sein Sohn würde ihm wohl noch etwas geben, und schon stellt er ein genaues Inventar seiner Bedürfnisse auf, um die paar Franken, die er bekommen wird, richtig zu verwenden. Er hat oft Leibschmerzen; eine flanellene Bauchbinde wird er sich anschaffen.
Der Schoppen wurde ihm gebracht. Er schenkt sich den dicken Wein ein und trinkt langsam. Es regnet immer noch nicht. Der Wind entführt die Wolken ins Weite. Die dürftigen Sträuche und Büsche winden sich unter seinen Stößen. Lärmend fährt ein Karren vorbei. Der Kutscher läßt zur Zerstreuung die Peitsche knallen. In diesem Erdenwinkel ist das Leben ja so eintönig. Regelmäßig zur selben Stunde verschlingen und speien drei große Fabriken ein freudloses Volk in farblosen Gewändern aus. In der Ferne schlägt eine Turmuhr. Nicht weit dampft ein Düngerhaufen.
Der Alte wird schließlich unruhig. Wieder zieht er den Brief hervor. Es war darin keine Stunde bestimmt. Zweimal schon ist die Kellnerin gekommen. Das erstemal hatte sie gesagt: „Ich dachte, Sie hätten mich gerufen.“ Das zweitemal verhehlte sie ihr Mißtrauen gar nicht mehr. Er verstand sie und bezahlte.
Er läßt den Blick nicht von der Straße. Wenn er jemanden in der Ferne sieht, beugt er sich vor und legt die Hand über die Augen. Doch bald wendet er, enttäuscht von unbekannten Schritten, den Kopf. Die Zeit wird immer schwerer lastend fühlbar.
Er bemerkt, daß der grüne Anstrich des Tisches, der an manchen Stellen abgeschabt ist, eine merkwürdige Zeichnung bildet. Der Singsang eines Händlers, der Hasenhäute feilbietet, entführt ihn weit weg, dann findet er sich wieder auf die Erde zurück an den Tisch und in die gleiche peinvolle Beunruhigung. Von Zeit zu Zeit trinkt er einen kleinen Schluck, um sich das Warten zu erleichtern, macht längere Zwischenpausen. Um den Wein zu sparen, sagt er sich: Ich werde immer erst trinken, sobald ich bis hundert gezählt habe, und schlürfend trinkt er dann nur einen ganz kleinen Schluck. Aber seine Gedanken nehmen ihn wieder gefangen, und er trinkt und trinkt und vergißt dabei seinen Vorsatz. Erschrocken bemerkt er, daß ihm nur noch ein kleiner Schluck bleibt, und seine Traurigkeit steigert sich. Dieser Wein hatte bisher seine Erwartung begleitet und die Zeit sein Aroma angenommen. Er fühlt, daß er viel verlassener sein wird, sobald diese Hilfe erschöpft ist. Neben einem leeren Glas wird jede Sekunde sich unendlich dehnen.

So gelobt er sich, den Rest erst zu trinken, wenn sein Sohn kommt.
Er fröstelt. „Gehen Sie hinein, um sich ein bißchen zu erwärmen“, ruft ihm der Wirt zu, der eben durch den Garten geht.
„Es geht schon an, mir ist nicht kalt“, antwortet er.
Die Worte dieses Mannes, der ihn in seinem Warten stört, verursachen ihm ein wirkliches Schmerzgefühl. Er kann es sich nicht erklären, aber es ist ihm, als betrafen sie irgendwie seinen Sohn. Mit all seiner Kraft will er ihn erwarten, ohne durch irgend etwas gehindert zu sein.
Die Zeit fließt hin, im Glase hat sich der Wein noch vermindert. Der Wirt kommt vorbei und fragt dringend: „Noch ein Schoppen gefällig?“
Peinlich berührt, wie es eben einer ist, der ein leeres Portemonnaie in der Tasche hat, antwortet er. Eine große Angst ist über ihn gekommen. Lange schon sitzt er so; der Rest des Weines genügt nicht mehr, seine Gegenwart in der Laube zu rechtfertigen. Er spürte, daß der ausgedehnte Schoppen dieses wunderlichen Alten aus dem Bürgerspital dem Wirt Beunruhigung einzuflößen beginnt.
Verlangte er ein neues Glas, so würde dieser sich besänftigen und ihm Aufschub gewähren. Ach Gott! Soll er sich eines bestellen, das sein Sohn bezahlen müßte? Nein! Etwas in ihm lehnt diese Möglichkeit ab. Zitternde Ungeduld erfüllt ihn.
Der Schank, ganz nahe hinter ihm, wird zu einem Ort voll Feindlichkeit. Und die verdammte Straße, die ihm eigensinnig seinen geliebten Wanderer vorenthält! Als wollte er einen Widerstand besiegen, bohrt er seinen Blick ins Weite, als wollte er die teure Erscheinung, die ohne Zweifel weitab hinter dem Horizont auf dem Wege ist, zu sich herreißen. Er gibt sich nicht mehr geruhsam der Zeit hin. Er lehnt sich gegen jede einzelne Minute auf. Seinen Willen möchte er ihr aufdrücken, ihren Lauf hemmen oder beschleunigen. Mit der einen Hand möchte er gegen den Schank hin ein Zeichen machen: Wartet es nur ab, beunruhigt euch nicht, mein Sohn wird kommen; und mit der anderen möchte er eine große Gebärde gegen den Horizont vollführen: So tummle dich doch, siehst du denn nicht, daß ich dein Kommen nicht mehr werde abwarten können!?
Immer noch nichts. Der Wind bläst und fegt eine schmutzige Zeitung auf die Straße hinaus.
Zwei Kutscher, die aus der Schenke kommen, werfen einen schiefen Blick zu ihm herüber in die Laube. Er schließt daraus, daß man in der Gaststube über ihn bereits schwätzt. Die Kellnerin geht zweimal sichtlich ohne Vorwand durch den Garten. Sie will ja gewiß diesen armen Alten nicht stören, den sie nur ganz harmlos bedrängt, da er ja schließlich doch hier Gast ist; aber sie ist so auffällig bemüht, ihn nicht zu bemerken, um ihn nicht zu verletzen, daß sie auf diese Art ihre heimliche Befürchtung verrät. Da endlich entschließt sich der Alte zur Auskunft:
„Ich erwarte meinen Sohn, der sich mit mir hier verabredet hat.“
„Ach so“, erwidert die Kellnerin.
„Wir haben ja hier schon einmal zu Mittag gegessen. Vor zwei Monaten, erinnern Sie sich, Sie hatten uns in den kleinen Saal gewiesen.“
Nun ist alles Mißtrauen geschwunden. Das Mädchen entsinnt sich.
„Ja natürlich, ich sagte mir ja gleich, dieses Gesicht kenne ich. Sie warten also auf Ihren Sohn. Da sollten Sie sich aber an den Ofen setzen, es ist nicht warm hier draußen.“
„Mir ist nicht kalt“, sagt der Alte, von Frost geschüttelt.
Nun hat er einen neuen Aufschub, kann dableiben, ohne daß man sich um ihn kümmert. Aus einer alten abgebrauchten Brieftasche, in der sich einige Reliquien von unschätzbarem Wert befinden, nimmt er eine Photographie, dann eine andere . . . seine Augen beginnen zu tränen. Er verschließt seine Tasche und steckt sie wieder zu sich. Rasch fällt die Nacht nieder, der Schatten unter den Büschen wird dichter, die Luft eisig. Wie schwarzes Gewässer breitet sich die Traurigkeit um den Alten. Sie durchdringt ihn manchmal so sehr, daß sie bis an sein Herz steigt und es einen Augenblick überwältigt. Er preßt seine Weste zusammen und richtet sich auf, als müßte er etwas Feindliches abwehren. Jemand eilt dort auf der Straße hin, aber er weiß wohl, es ist nicht für ihn . . . die Schritte gehen vorbei, ohne anzuhalten. Er faltet die Hände am Tisch. Auswendig sagt er den Brief wieder her, und das Fragment eines Satzes: „Falls nicht Unvorhergesehenes eintritt . . .“ läßt ihn innehalten und bleibt ihm vor Augen. Nun zweifelt er nicht mehr. Seit langem ist er da, vielleicht schon seit Stunden, aber sein Sohn wird nicht kommen. Er wird nicht kommen.
Schon ziehen die Pfründner heimwärts. Immer zahlreicher kommen sie an dem Gitter vorbei. Einige haben ihn sogar bemerkt, ohne ihn, der sich durch seine gewohnte Stumpfheit den Titel „alter Bär“ eingetragen hat, anzureden!
Er wird nicht mehr kommen! . . . Es ist gewiß kein Vergnügen für einen jungen Mann, seinen Vater im Greisenasyl zu besuchen, einen Vater, der ihm viel Übles angetan und den Namen, den auch er trägt, befleckt hat. Aus Mitleid hatte er seinen Widerwillen bezwungen und war einmal gekommen, ein armseliges einziges Mal. Er hat seine Großmut so weit getrieben, einen zweiten Besuch in Aussicht zu stellen. Aber nun weiß der Alte, daß es niemals dazu kommen wird, und mit einem Schlag wird ihm das ganze Elend seines Lebens gegenwärtig. Er fühlt in der Brust eine plötzliche Aufwallung, die sein Herz erschüttert und bis zum Halse aufsteigt und sein Gesicht verzerrt, über das mit einemmal Tränen hinrieseln.
Das kalte Naß auf seinen Wangen versiegt, und mit geschlossenen Augen sieht er die vergangenen Tage. In seinem Gedächtnis drängen sich mühelos und wirr die Erinnerungen, und er überläßt sich ihnen mit einer Art schmerzlicher Wollust.
. . . Da stehen an einem Flußrand schöne Pappeln, die all ihre Blätter im Winde regen, dann ist da plötzlich ein kleines blasses Mädchen in einem Bett hingestreckt, die Hände über der Brust gefaltet. Und flüchtige Erinnerungen: Ein Fleck an einer Wand, das Bruchstück eines einst vernommenen Gespräches, ein Keller, in dem man Gartengeräte einordnet, das schöne Antlitz einer Frau, die still in einem Fenster weint. Nun verdoppeln sich seine Tränen. In die Hände verbirgt er sein Antlitz und schluchzt laut in die Dämmerung, lange, lange. Allmählich besänftigt sich das Schluchzen. Seine Hände sinken herab. Er öffnet die Augen und erwacht in eine Welt, die alle Trauer auf sich genommen hat, in eine Welt, die still ist wie die Entsagung. Er sieht ein Zimmer wieder, mit seinen Möbeln, den glänzenden Parketten und den vom Mond bespülten Fensterscheiben, ein Zimmer, in dem er sich als Kind nachts so sehr fürchtete. Er hört in blassen Nächten die Hähne krähen, und das Weltall ist nur mehr Traum. In seinem kleinen Strohfauteuil sieht er sich wieder, zur Stunde, da der Sonnenuntergang den ganzen Garten belebte, sieht sich vor einem Fleckchen Sonne, das sich im Hintergrund des Hühnerstalles verspätet und das wehmütig in ihm Ritter und Könige aus dem Orient und ganz versunkene Epochen wachruft. Verzweiflungsvolle Visionen bedrücken ihn nun. Seine Tränen fließen von neuem. Er denkt an den Rock, den er seinerzeit getragen — — — im Krieg. Verzweiflung läßt ihn erbeben, wie er sich in Uniform sieht. Glückliche Zeit, wo die Stunde des Niederganges noch nicht geschlagen hatte. Heute ist er von aller Welt verlassen, selbst dieser Sohn, den er so sehr liebte, ist, kaum wiedergefunden, aufs neue verloren. Käme er doch! Wie würde er ihn umarmen! Wie würde er an seiner Schulter schluchzen! Ein Bild seines Kummers malte er ihm und fände so erschütternde Worte, daß sein Kind ihm in die Arme fallen würde, um mit ihm zu weinen. Komm, mein Kleiner, o komm doch! Er weiß es ja, daß er zu dieser Stunde nicht mehr kommen wird, daß er nicht mehr kommen kann. Er widersteht dieser grausamen Wirklichkeit mit der erbitterten Leidenschaft eines Menschen, der eine letzte Hoffnung hegt. Die unbeugsame Wirklichkeit wird immer fühlbarer. Er besinnt sich auch, daß er in den nächsten Tagen auf die bescheidenen Vorteile verzichten muß, die ihm die zehn Franken seines Sohnes gestattet hatten. Keinen Sous mehr in der Tasche! Verloren die Hoffnung, dies düstere Haus jemals zu verlassen. Das Weltall zieht sich um ihn zusammen, unerreichbar scheint ihm alles. Die Wesen strömen hin und her, ohne einander zu kennen. Er errät, bis zur Verzweiflung getrieben, wie unendlich fremd die Erde den Gestirnen ist. Er mag rufen, seinen Schmerz hinausschreien, niemand wird ihn hören. Auf der einen Seite des Lebens sind die Familien, die Freunde, die glücklichen Gefährten, das ganze frohlebige Dasein . . . auf der anderen Seite ist er allein: die Kälte, das dunkelste Elend, das Andenken seiner Mutter, die sanft war, lebhaft stehen sie vor seinem Geist. Er hängt sich mit aller Kraft daran. Stotternd murmelte er: Mutter, Mütterchen. Seine Kappe ist herabgefallen, seine Haare verdecken die Augen. Er möchte in der süßen Erinnerung versinken oder ihr so viel Wirklichkeit einflößen, daß er ihr ein heißes Leben erweckte, das dem seinen gliche. Er denkt an zwei kleine Flammen, die auf dem frisch entzündeten Dochte der Lampe hin und her schießen, um einander zu erreichen und sich zu vereinen. Doch dem Bemühen hingegeben, dies kostbare Bild zu verwirklichen, hat er die Vorstellung, daß die ferne Nacht mit Absicht schwiege und daß seine Gedanken in einen Trichter rinnen, der sie gänzlich aufsaugt. Die Vorstellung an Tod und Einsamkeit übermannt ihn so sehr, daß er in angstvoller Trauer schauert.
Unwillkürlich streckt er die Arme aus.
Die Glocke des Asyls beginnt zu läuten. Dreimal wird sie schlagen, dann wird das Tor geschlossen werden. Die Nachzügler werden ausgesperrt sein. Auf! Es muß wohl sein, daß er geht. Er erhebt sich, zögert aber, seinen Körper so geradeaus in die Verzweiflung zu tragen. Flüchtig und scheu verläßt er den abscheulichen Garten, den die Nacht schon erfüllt, und biegt in den kleinen Pfad, der längs der Baracken der Hadernsammler hinführt. Die Nebelpfeife einer Fabrik zeigt an, daß die Arbeiter die Werkstätten verlassen. Armselige Lichter leuchten da und dort längs der Ebene. Der Alte schreitet aus. Kaum, daß er sich auf den Weg gemacht hat, spürt er wieder den Schmerz im Bein, den er vergessen hatte. So geht er in die Nacht hin, und seine Holzschuhe schleifen den dicken Kot mit sich. Der Wind hat nachgelassen. Mit dumpfem Aufklang fallen große Regentropfen nieder. Er stößt im Vorwärtsgehen an Steine und schluchzt. Jedesmal, wenn er stolpert, richtet er Beschimpfungen gegen sich: „Krepier, alter Dummkopf, wer wird nach dir fragen? Krepiere, deine Geschichte ist zu Ende, alter Lumpensack. Hast dein Leben lang nichts als Böses vollbracht. Jetzt krepier, daß man dich in dein Loch scharrt, einsam, ohne Singsang. Ein Haufen Erde auf deinen Leib, das ist das Beste, was du von nun an erhoffen darfst.“ Doch sein heftiges Schluchzen straft seine Worte Lügen. Viele Fehler hat er zweifellos in seinem Leben begangen, aber die Strafe nun empfindet er dennoch als zu hart, ihr Ausmaß erdrückt ihn, und sein Kummer löst sich in neuerliches Schluchzen, das ihn tief erschüttert.
Nun hört er den zweiten Ruf der Glocke. Eilt er jetzt nicht, so wird er ausgesperrt, und er muß nun laufend das Haus erreichen, in das er, ach so gerne, nie wieder zurückgekehrt wäre.
„Tod, heiliger Tod, willst du mich nicht erlösen?“

Mitten in der Nacht war er aufgestanden, die Stirne schweißbedeckt, im ganzen Körper schwere Müdigkeit. Mit offenen Augen starrte er ins Dämmern der entsetzlichen Vision nach. Er hatte mit aller Kraft versucht, seine Blicke auf die Gegenstände zu heften, die das Dunkel mehr ahnen als sehen ließ, dann hatte er sich bis über den Hals in die Wärme des Bettes zurückgeflüchtet, doch der hartnäckige Traum hatte ihn von neuem ergriffen.
Er war kein Dutzendmensch, er glaubte an so manches, und um flüchtigste Dinge stritt er mit Leidenschaft. Es gab Worte, die ihn berauschten; er lächelte mit Behagen, wenn er sie aussprach. Man wußte, daß er sich mit Ausdauer Arbeiten hingab, aber das Ziel seiner Bestrebungen und die Ursache seiner Unruhe war den meisten Menschen unbekannt. Da ihm die Gesetze der Ökonomie fremd waren, verausgabte er sich ohne Rücksicht auf Nutzen. Sein Leben verbrannte um nichts, aber es glich einer Kerze vor heiligem Bildnis in nächtlicher Kirche, denn ein heimliches Feuer wohnte in ihm.
Wie alltäglich war er aufgestanden und hatte sich angekleidet. Er war den gewohnten Gefährten seines Lebens begegnet, und sein Mund war stumm, seine Blicke waren nirgends haften geblieben. Er hatte ein Buch und dann noch eines durchgeblättert, sich gesetzt und wieder erhoben. Zwanzigmal hatte er vom Fenster die Straße oder den Himmel nach geheimem Rat befragt. Immer noch beherrschten ihn beängstigende Bilder.
O Mutter! Welche dunkle verhängnisvolle Macht hat es gewollt, daß du, die du sanft, und ich, der so voll kindlicher Zärtlichkeit war, daß wir niemals Seite an Seite leben konnten. Oh, du weißt nicht, wie groß meine Verzweiflung war, wenn ich nach unseren beklagenswerten Zwistigkeiten durch die Wand des Zimmers dein Weinen vernahm. Geliebte Mutter, schon die Erinnerung an dein Antlitz läßt mich Tränen vergießen. Ach, wenn du doch um die Zähigkeit meiner Reue wüßtest, die Heftigkeit meines Schmerzes, wenn ich deiner gedenke! Du bist auf Erden das einzige Wesen, das ich liebte. Und niemals sagte ich es dir, vielleicht auch wirst du es niemals wissen. Ach, warum? Warum nur! Oft denke ich daran, daß ich dich eines Tages verlieren muß. Ich sehe mich hinter deinen sterblichen Resten schreiten, und solch eine Fülle von Trauer drückt auf mich nieder, daß ich ganz mutlos werde. Wenn du gingest, ehe die letzten Worte, die wir einander sagten, in der Wärme des Verzeihens auslöschten, würde mein Schmerz zur Unerträglichkeit.
Aus unabweisbarem Verlangen, seine Unruhe zu überrennen, war er nach dem Frühstück abgereist.
„Ist Ihnen eine schlechte Nachricht zugekommen?“ hatte man ihn gefragt. „Nein, ich muß meine Mutter aufsuchen, es ist weiter nichts . . . eine Familienangelegenheit.“
Der Zug fuhr durch die Spätherbstlandschaft dahin, mitten durch tiefen Schlaf, den er nicht aufstörte.
Es war schon lange her, daß er im Vielerlei der Geräusche und Bewegungen den Bahnhof verlassen hatte. Seine Aufregung hatte die Blicke der Zurückbleibenden auf sich gelenkt. Doch ohne Eile und mit aller Kraft hatte er sie mit sich gezogen, bis sie den Körper dem Zuge nachbogen und sogar Tränen aus ihren Augen traten. Die Blicke waren pfeilgleich, wie lange Fäden aus gespanntem Bogen, durch die Luft gefolgt, bis sie einer nach dem anderen zerrissen.
Ein wenig später hatte das Lokomotivenungeheuer, fröhlich pfeifend, die offenen Felder erreicht.
Die Reisenden drängten die schon ferne Traurigkeit der Abfahrt in ihr Gedächtnis zurück und musterten sich gegenseitig. Irgendwelche Betrachtungen, Dank und Entschuldigung wechselnd, streckten sie ihre Worte wie Hände einander entgegen. Die Reisenden, die noch eine weite Fahrt vor sich hatten und die ganze Nacht im Abteil verbringen mußten, nisteten sich sorgsam ein, standen auf, öffneten Taschen und veränderten unaufhörlich ihre Lage.
Die Gespräche waren rasch verflattert, hatten sich schließlich auf zwei oder drei Reisende beschränkt, einige Worte waren noch durch die Tür entflogen, dann war nichts mehr hörbar, als das Hineilen des Zuges, Pfeifen, der Lärm der Räder, des Puffers, der Achsen und Bremsen.
Männer und Frauen schlummerten in der drückenden Schwüle des Abteils.
Er war es, der seine Worte sparte und seine ganze Aufmerksamkeit der Landschaft zuwandte, wie sie ihm der dahineilende, in den Stationen nur atemholende Zug aufrollte.
Der Strahl des Sonnenunterganges veränderte alle Dinge, als sein Auge wieder die kleine Haltestelle wahrnahm, die in der Landschaft verloren dalag. Gewöhnlich kam man nicht mit diesem Zuge, man zog den rascheren Abendzug vor.
Niemand außer ihm stieg aus, niemand stieg ein. Aus den Türen beugten sich neugierig einige Köpfe vor, wenige Schritte weit trug er noch die Erinnerung der Gesichter mit, denen sein Blick begegnet war.
Keinerlei Gefährt wartete am Ausgang. So hatte er denn eine gute Wegstunde vor sich. Er schloß die Augen und sog diese reine Luft ein, die ihm nun wiedergegeben war. „Vorwärts also!“ Er machte sich auf den Weg.
Die letzte Abendröte des Himmels kämpfte gegen große Massen violetten Dunkels. Ein rosiges, hinsterbendes Licht färbte die Straßen, die Wiesen, die aufgepflügten Äcker und die abgemähten Felder. Die Landstraße ging bergab, bergan.
Er war bisher gegangen, ohne rings etwas zu sehen, bis die Abendfrische ihn frösteln machte und er seine Augen hob, um sie selbsttätig umherschweifen zu lassen. Rasch gab er ihrer Neugier nach. Er stand an der Flanke eines Hügels, der ein Tal überragte. In der Ebene unten sah er am Rande eines gelbgoldigen Flußbettes einen Maierhof mit seinen Nebengebäuden. Ein fast unsichtbarer Rauch stieg langsam gegen den Himmel, der nun in blassem Blau schimmerte; eine kaum fühlbare Brise hatte die Wolken hinweggefegt.
Er war ergriffen. Soweit Auge und Ohr reichen konnten, stieg etwas Lächelndes und Friedliches mit dem durchsichtigen Rauch hinan — stieg — denn es war nichts Bewegungsloses, wie etwa eine lastende Ruhe auf der Erde, sondern ein Lebendiges, ein Lebhaftes und Strahlendes, das an eine sehr langsame und feiervolle Himmelfahrt gemahnte. Das ganze Weltall war nur mehr ein wohl angemessener Rahmen um dieses Schauspiel, und die Bäume, die in ihre Blätter eingenistet waren, schienen eine Freude, uralt und unergründlich wie die Welt selbst, in sich zu wahren.
Er setzte sich auf die Böschung, pflückte ein Gras und kaute daran. Dann glaubte er das Geräusch eines Wagens zu vernehmen und erhob sich.
Er durchquerte einen kleinen Fichtenwald, der so dunkel war, daß er unwillkürlich seine Hände aus der Tasche zog. Er drehte den Kopf nach rechts und nach links. Er lebte mit einemmal in einer Art Exzeß im Innersten seines Ichs. Einmal wandte er sich aufmerksam, horchte auf und ward lebhaft bewegt. Er hatte schon den Wald verlassen, als er, die Augen aufschlagend, auf dem Gipfel einer kahlen Erhöhung einen Baum entdeckte, einsam und riesenhaft, der sich sehr stark von jenem Teil des Himmels abhob, wo die letzten Strahlen der Sonne verdämmerten, und der wie in tragischer Geste seine Zweige in alle Richtungen warf. Ein unangenehmer Eindruck machte sich ihm fühlbar, und er sah die nächtlichen Bilder wieder. Gelesenes, das von Vorahnungen handelte, die später die Tatsachen bestätigten und die ihm nichtssagend erschienen waren, gingen ihm aufs neue durch den Kopf. Sein Urteilsvermögen beschäftigte sich nicht mit diesen Geschichten, sein Verstand hatte nichts übrig für sie. Wenn sie auch plötzlich an der Oberfläche seiner Erinnerungen erschienen, er schenkte ihnen deshalb nicht mehr Aufmerksamkeit. Aber hinter den Gedanken, die in seiner Stirn lebten, nahe den Augen oder ferner, vielleicht viel ferner, meinte er unklar das Vorhandensein einer drückenden Erinnerung zu spüren.
Die Nacht war herabgesunken. Er schritt hin und dachte dabei, daß der Mensch im Dämmern beseelter sei. Ein Gefühl voll Ernst und Tiefe erregte ihn. Er fühlte sich einer Majestät zugehörig, die er sich fortan zu wahren versprach. Er bedauerte, so oft knabenhaft, ja selbst frivol gewesen zu sein. Wie hatte er sich doch diesen schalen Vergnügungen hingeben können! Er dachte mit Verachtung und Unbehagen an diese fraglichen Gefährten seiner Zerstreuungen.
Nun näherte er sich. Hier war es, wo er im dichten Gras, unweit des Grenzsteines, auf den er sich, um zu lesen, gesetzt, eine kleine Schere verloren hatte, ein Andenken, das ihm lieb war, und während er so hinging, forschte er das Dunkel ab. Das Glockengeläute kam bis zu ihm heran. Er erbebte: schon so nahe war er! Da hatte er Angst, und seine Brust schnürte sich zusammen. Er horchte erschrocken. Ein Begräbnis oder eine Hochzeit? Wer kann das unterscheiden! Als er klein war, hatte er, zum Fenster hinausgelehnt, oft diesen Glocken gelauscht. Er war nur Kind gewesen, und schon hatte Unzufriedenheit in seinem Gemüt gewohnt. Die Stirn an die Scheiben gepreßt, hatte er bei Einbruch der Nacht die Bäume, hauptsächlich jene Akazie betrachtet, die sie alle überragte. Die Gärten waren voller Schatten gewesen, und wenn er die Augen hob, hatte er die Unendlichkeit grenzenlos vor sich herfliehen gefühlt. Anders als mit dem Gedanken hätte er diesen Raum füllen wollen, über den Hügeln schweben mögen, um für immer sein Leben jenem Zentrum des Weltalls zu verschwistern, das seine Augen und sein Instinkt da oben im funkelnden Himmel errichtet hatten. Er hatte vor Traurigkeit gefroren, ein so Geringes gegenüber dem Großen zu sein, das er ahnte. Seine Mutter hatte ihn dann gerufen: diese gütige Lampe, die willkommenbietende, der Anblick der vertrauten Möbel beschwichtigten bald in ihm die Bedrückung, die die Weite und der Abend ausgeströmt.
Seither hatte er den Vorsatz und dann die Gewohnheit angenommen, sich zwecklose Betrachtungen zu untersagen. Die Stadtglocken beunruhigten ihn längst nicht mehr, und er verhöhnte böse jede romantische Schwermut. Wenn es ihm dennoch manches Abends widerfuhr, unbeweglich im Dunkel am Fenster zu sitzen, bis er allmählich alle Erdenschwere verlor, so geschah dies in einer fortgesetzten Steigerung seiner Seele nach oben, in einem Aufschwellen seines ganzen Wesens, das nach jeder Rückkehr in sich selbst die Fülle der Gegenwart wieder entdeckte.
Vor ihm strahlten Lichter auf. Dies war der Marktflecken, den seine Mutter bewohnte. Von seiner Höhe überragte er ein ganzes Gebiet von Ebenen, Flüssen und weißen Landstraßen. Die Häuser wuchsen mit dem Felsen zusammen, der sie trug. Die Kirche war ganz oben, Gott so nahe als möglich.
Er kam durch einen Garten, wo Wäsche aufgehängt war. Die Unzahl der Sterne machte den Schatten durchscheinend, und man sah, wie die Grashalme sich regten. Er vernahm ein Geräusch. Ein ihm unbekannter Hund sprang aus seiner Hütte, schnupperte an ihm, ohne zu bellen. Eine große Angst übermannte ihn. Mit jedem Blick in diesen Garten, der ihm so vertraut gewesen, lächelte ihm eine Erinnerung, die in seinem Gedächtnis schlummerte. Die Dinge schienen ihm da so voll von einem verborgenen, fremdartigen Leben, das er nie vermutet hatte. Er hielt inne, und sogleich ward er der unendlichen Stille der Nacht in all ihrer Größe bewußt. Ja, vielleicht war es die Gewalt dieser Ruhe gewesen, die seinen Schritten Einhalt geboten. Lange sog er den Duft ein, dem die Kühle der Stunde eine unirdische Reinheit verlieh.

Als er die Hand auf die Türklinke legte, kam wieder alle Angst über ihn. Irgend etwas ging für ihn von dieser Tür aus, eine Art feindseliger Gegenwart. Er öffnete die Tür, durchschritt den von einer Petroleumlampe erhellten Gang und stieg die Treppe hinan. Der staubige Althäusergeruch erweckte manche Erinnerung in ihm. Vom ersten Stock vernahm er Kinderlachen, und er blieb stehen, weniger um zu horchen, als um einen Augenblick noch zu zögern. Sein Herz schlug sehr stark, und eine plötzliche Müdigkeit machte seine Knie zittern. Aus Furcht, überrascht zu werden, schritt er weiter. Die zweite und letzte Lampe des Stiegenhauses ward sichtbar. Da sie qualmte, drehte er sie herunter. Bei jedem Schritt wurden ihm die Schuhe schwerer. Er blieb oft stehen und sah, die Hand auf dem Gitter, in den Schacht der Treppe oder in sich selbst hinab. Wieder durchlebte er seinen nächtlichen Traum, der gewiß tragischer war als alle Wirklichkeit. Sicherlich hatte er noch große Angst vor dem, was er gesehen hatte, aber bald hatte er sich wieder in der Gewalt; und wenn er es ersehnt hatte, seine Mutter zu sehen, so geschah das aus Gründen, die schließlich mit jener nächtlichen Episode nichts zu tun hatten. Eine Gewißheit würgte ihn jetzt. Er würde eine bedrückende Nachricht vernehmen. Aber was? . . . Was? . . . Oh, was denn nur?
Aber dies geruhsame Haus, in dem gelacht wurde, schien kein solches Drama erlebt zu haben. War indes dieser Friede, einzig von der Unterhaltung der Kinder unterbrochen, nicht ein neuer Beweis? Er stellte sich in diesem Augenblick die Wohnung seiner Mutter vor. Fremde gingen von einem Zimmer ins andere und sprachen mit gedämpften Stimmen. Von neuem erschien ihm ein quälendes Bild. Auf den Fußspitzen stieg er die letzten Stufen empor. Er horchte, an die Tür gedrängt; unten ging wieder das Lachen an. Seine Brust war ihm wie in zu enger Kleidung eingeschnürt, sein Hals, wie umdrosselt, tat ihm weh. Er strich über die Tür hin, denn es war eher ein Streichen als ein Klopfen und ein so leises, daß kaum die ängstliche Schwinge eines Vögelchens davor erschrocken wäre. Er wartete. Nichts. Er war darüber froh, bedeutete es doch eine Gnadenfrist. Da er nun alles erfahren würde, hatte er keine Eile. Er atmete leise, mit Methode und besonderem Genuß, so wie man etwas kostet, das man liebt. Es war finster, aber wenn er den Blick hob, sah er durch eine Scheibe ein großes Stück gestirnten Himmels und erkannte das Sternbild der Kassiopeia. Wie Wasser vom Springbrunnen fiel die unendliche Stille von den vier Türen des Flures, und er blieb unbeweglich stehen, über sich das Raunen nächtlicher Mächte. Er wußte wohl, daß man sein Klopfen nicht gehört haben konnte, aber er wartete noch, um die Zeit, da noch Zweifel gestattet war, auszudehnen. Dies dauerte kaum einige Sekunden. Nun klopfte er entschlossen und erschrak über das Geräusch. Da rührte es sich, man kam. Die Tür wurde geöffnet, und ein großes Viereck von Licht fiel in das Dunkel. Seine Mutter stand vor ihm. Er zitterte vor Staunen und konnte kein Wort hervorbringen.
„Du bist es!“ sagte sie mit leisem Zurückweichen. Und als er mit gesenktem Kopf verharrte: „So tritt doch ein.“
Sie hatten kaum zwanzig Worte miteinander gewechselt.
Seine Mutter hatte ihre Arbeit wieder aufgenommen und nähte unter der Lampe. Sie beobachtete eine scheue Zurückhaltung und wartete auf die Worte, die er hartnäckig unterdrückte, wie man auf einen Chok wartet. Und sie sammelte ihre Gedanken zum Widerstand.
Er saß abseits vom Tische. Die Lampe, deren tütenförmiger Schirm das Licht dämpfte, beleuchtete nur seine Hände und Knie. Sein ganzer Oberkörper verlor sich im Dunkel, das der unsichtbare Plafond nicht aufhielt. Und für Augenblicke floh er in dies Dunkel so tief und lange hinein, daß das Zurückfinden in dies Zimmer, in dem er saß, und vor diese Dinge, in die Wirklichkeit dieser Lampe, für ihn das Erlebnis einer tatsächlichen Rückkehr bedeutete. Seine Mutter war da. Er konnte ihr stilles Antlitz betrachten, ihre schönen grauen Haare, ihre hellen Augen, die unmittelbar ihre ganze Seele ausdrückten. Von der Lampe strahlte eine stille Glückseligkeit aus, und wenn er den Blick ihr zuwandte, war er von einem unvergleichlichen Wohlsein umfangen. Er rekelte sich vor Zufriedenheit. Im Geist sah er die Gesichter seiner Freunde. Nie hatte er sie so geliebt. Er lächelte ihnen zu, als ob sie gegenwärtig wären. Wie freudig hätte er jenem, der ihm so viel Übles angetan, jetzt einen festen verzeihenden Händedruck gespendet. Sein ganzes Wesen zerschmolz im Verlangen, gut zu sein.
Er hatte einen lächerlichen Traum gehabt. Seine Mutter! Seine gute Mutter, die er so sehr liebte! Er konnte sich nicht satt sehen an ihr. Selbstsüchtig genoß er seine unbegründete Angst. Er schob den Augenblick des Gefühlsergusses hinaus, ja, er bedurfte nicht mehr dieser Entladung.
Nur mit den Lippen antwortete er auf die Fragen, die ihm seine Mutter stellte, ohne daß hinter seinen Worten sein heimlicher Gedankengang unterbrochen wurde.
Aber einen Augenblick schwieg er so andauernd, daß seine Mutter ihn ansah. Und da er seiner Tränen sich nicht mehr enthalten konnte, da ein unüberwindliches Schluchzen seinen Hals aufschwellte, streckte seine Mutter ihm die Arme entgegen: „Lieber Junge! Dir ist vergeben, weil du heimgekehrt bist.“
Und er verschwieg seinen Traum.
Er öffnete vorsichtig das Gitter und betrat den Park. Unbeweglich leuchtete das Laubwerk im Mondlicht. Alle Dinge waren in Traum entrückt, der Wirklichkeit beraubt. Und der Kronlüster des Himmels trug auf seinen tausend Armen so viele helle Flammen, daß der junge Mann, als er den Kopf hob, ihn wieder demütig senkte, so sehr überwältigte ihn das Licht. Nichts gemahnte an die Menschen. Der Weltenraum hatte selbst die Erinnerung an sie verloren. Sie waren in die Geschichte zurückgesunken, aber in der Stille spürte man dennoch etwas von ihrem Schlummer, der nicht grundlos sich durch ihren versiegelten Mund und ihre ruhenden Körper kundtat.
Der nächtliche Besucher ahnte irgendwie, daß dieser Stunde nichts Körperliches gestattet war. Seine Gegenwart in ihr hatte etwas Unerlaubtes, das ihn seltsam wach hielt. Als einziges Lebewesen mit offenen Augen in solchem Erdenwinkel, fühlte er sich in dieser unendlichen Nacht hellsichtig und so unruhig, wie wenn man Verrat übt an einer Versprechung. Er war sicher, irgendeine Majestät zu verletzen und mit seinen unwürdigen Schritten eine heilige Stätte gestört zu haben, über der ein Verbot schwebte.
Aber die Bewegung, die sich in ihm regte, hieß ihn alles für das Wunder dieser Stunde einsetzen.
Er erreichte die ihm so wohlbekannte kleine Allee, die, von Taxus mehr als mannshoch eingerahmt, ins Dunkel mündete.
Die Erde war weich, und seine Schritte verursachten keinerlei Geräusch. Durch das Dickicht erblickte er eine Lärche, schwarz gegen den Rasen gestellt, ihr Wipfel schimmerte silbern im Mondlicht. Sie war unbeweglich, als hätte sie endlich das vollkommenste Gleichgewicht erreicht, das sie so lange im Hin- und Herwiegen gesucht.
Das Haus stand wie ein schweres Schiff in die Stille verankert. Rings kein Mensch. Der ganze Park, die Wälder, die Ebenen in der Ferne, der leuchtende Himmel, sie alle erschöpften sich in einer unübersteiglichen Trauer um ein fernes Wesen. Er setzte sich auf die Bank in der verschatteten Allee. Eine große Rasenfläche trennte ihn von dem mondbeschienenen Haus. Alle Läden waren geschlossen. Die Glasscheiben der Türen leuchteten durch die Eisenstäbe. Die Schornsteine gaben keinen Hauch mehr.
Warum war sie noch nicht da? War sie inmitten ihrer Träume eingeschlummert? (Eine Redewendung, die ihm lieb war, entstieg dem Halbdunkel seines Erinnerns.)
„Wie ein Sänger in unsagbarer Schwermut,
Inmitten seiner Lieder, den Tränen erlag.“
Auf dem sehr dunklen Weg, der den See umsäumte, bemerkte er das Phosphoreszieren eines toten Fisches, und seine Gedanken nahmen eine andere Richtung.
Die große Stille der Nacht wirkte immer weiter, als gebäre sie sich endlos aus sich selbst.
Warum, warum kam sie noch nicht? Seit dem Vorabend waffnete er angesichts des Ereignisses seinen ganzen Wortschatz. Nun begann dieses Warten seine Vorbereitungen zu zerstören. Durch das häufige Wiederholen der Worte, die er sich zu sagen vorgenommen, verwirrten sie sich allmählich, und schon zweifelte er an ihrer Wirksamkeit. Wie um ihr Kommen herbeizuzwingen, erhob er sich ungeduldig, machte zwei Schritte und ließ sich auf die Bank zurückfallen. Er litt. So würde er also nicht mehr genug Zeit haben, um mit Muße diesen letzten Abschied zu genießen, nicht mehr genug Augenblicke an ihrer Seite verbringen. Es verlangte ihn, sie noch sehr lange anzusehen. Und wie viel hatten sie einander noch anzuvertrauen! Wer weiß, was er noch alles hören, welche einzigartigen Augenblicke er noch erleben würde! Nun wußte er kaum, warum er sich zu reisen entschlossen hatte. Je mehr die Lösung herannahte, desto mehr verwunderte er sich, sie erwünscht zu haben und daß er selbst es gewesen, der mit Geschick ihre Notwendigkeit erwies. Wie leicht war ihm der Sieg geworden! Nun folterten ihn wirre Wünsche. Ehe er ging, wollte er wissen, ob denn wirklich im Grunde ihrer Seele Bedauern war. Ein letztes Mal noch konnten sie einander ihre geheimsten Gedanken ausliefern. Sie würden beide völliges Reinemachen in ihren Seelen halten. Natürlich war dies nur eine Genugtuung, die er sich verschaffen wollte, das Ergebnis einer dunklen Unruhe, die in ihm wühlte. Denn nichts mehr konnte ihn hindern abzureisen. Das Boot, das ihn entführen sollte, lag unweit verankert. Der Atem des Meeres flog bis zu ihm heran, die Seeluft salzte seine Lippen. Wenn die Nacht sich über einen neuen Tag gesenkt hat, wird er schon weit weg und alles zu Ende sein. Seine dunkelsten Gedanken werden ihm wiederkehren, und von neuem wird er diesen großen Ekel empfinden, der ihm so wohlbekannt ist. Er wird es verwünschen, der Einsame zu sein, der, dem häuslichen Leben feind, sein höchstes Vergnügen darin findet, immer wieder kaum genossenen Wonnen zu entfliehen. Wie ein Schleier wird die Traurigkeit hinter ihm herwehen, dann aber werden erlebnisreiche Tage folgen. Er war im Vergessen erfahren. Diesmal zwar hatte es ihn tief gepackt. Aber die Reise forderte ihr Recht. Diese Frau und der Ort hatten alles gegeben, er selbst alles genommen und selbst alles gegeben. Andere Tage, andere Geschehnisse warteten nun seiner. Wie in früher Zeit würde er an sich und die Dinge denken können, frei ohne Bindung, allen Zufällen bereit, andere Städte, andere Länder, andere Wesen schauen. Er wird den Klang neuer Stimmen kennen lernen. Da er nirgendwo von irgend jemandem erwartet wurde und an nichts gefesselt war, durfte er sich hoffnungsfreudig für alles erwärmen, aller Gemeinsamkeit und allem Gefühlsüberschwang sich erschließen, grenzenlos sich von neuen Wünschen treiben lassen.
Und die Vielfalt des Universums kreiste hinter seiner Stirn.
Ein Teil seines Selbst war in diesem Hause gefangen. Er würde es befreien und singend von dannen ziehen. Er hatte rasch das Sklaventum der Gewohnheit durchschaut, aber sich feige abgekehrt vor all dem, was er zerstören mußte, um sich zu befreien. Eines Tages schließlich hatte er sich gesagt: Was tue ich hier? Wie hat sich dies begeben? Er verstand, daß er hier die Freude und ihre Hilfsquelle erschöpft hatte. Er blieb aus Lässigkeit, wie einer, der unbeweglich auf dem Platze verharrt, zu dem ihn irgendein Antrieb versetzt hat. Da er von den Renten der Leidenschaft lebte, erwartete er nur mehr Zahltage. „Es ist gut, daß ich reise,“ spottete er. „Ich bin ja frei, ich habe nichts versprochen, ich habe keine Schwüre getauscht.“ Diesen Gedanken hielt er fest, er erleichterte ihn. „Wahrhaftig, wir haben einander nicht das geringste Versprechen gegeben.“ Vom ersten Tage an mußte sie diese Lösung vorausgesehen haben. Außerdem hat sie die Notwendigkeit der Trennung begriffen, sie ohne den geringsten Vorwurf entgegengenommen.
Wenn er an die Zukunft dachte, an all das, was ihm noch bereitet war und was er noch nicht besessen, litt er vor ungeduldiger Erwartung. Er dehnte sich ins Unbekannte hin. Diese unausgesetzte Spannung und dunkle Anziehung war ein Teil seines Wesens. Niemals war er ganz in der Wirklichkeit der Dinge, aus denen sich sein gegenwärtiges Leben zusammensetzte. Selbst wenn er mit anderen Menschen sprach oder Taten vollbrachte, die scheinbar die ganze Aufmerksamkeit seines Geistes beanspruchten, ließ er den größten Teil seines Wesens anderswo umherschweifen. Er redete Worte, indes seine Augen sorgsam das Antlitz des Fragenden musterten, und zu gleicher Zeit entführte sein Geist ihn zu anderen Visionen.
Zuweilen wurde dies Bedürfnis, seinem inneren Ruf zu folgen, so unwiderstehlich, daß er sich tatsächlich ganz allmählich von dem Ort entfernte, den sein Körper eben einnahm. Sein Partner, der gewahrte, daß ihm nicht mehr zugehört wurde, stellte das Sprechen ein. Erst viel später bemerkte er selbst das Schweigen.
Er schien nur in der Erinnerung oder Vorausahnung zu leben. Seine Gegenwärtigkeit, seine lebendige Seele zauberte sich ein lautlos durch nächtliche Landschaft dahinsegelndes Fahrzeug vor, dessen Fahrgäste alle in Träumen lagen.
Er wußte, daß er sich niemals irgendwo würde festsetzen können. Sein Geist hatte eines Tages einen Traum begonnen, den er nicht zu Ende führen sollte. Von Zeit zu Zeit würde er innehalten, um ihm nachzusinnen, zu kurzem Ausruhen die Augen aufschlagen und dann wieder wie von der Strömung eines Flusses erfaßt und hinweggetragen sein. Mächte seines inneren Menschen hatten ihn immer gehindert, sein ganzes Wesen hinzugeben. Ein Teil seiner Persönlichkeit blieb der Mitteilung verschlossen. Niemals würde ihn jemand kennen lernen, wie er war. Ja selbst neben jener, die er so sehr geliebt, hatte er im Überschwang der Hingabe, gleichzeitig mit dem großen Wunsch, sich in ein anderes Wesen zu versenken, in Augenblicken stürmischster Leidenschaft empfunden, daß ein Teil seines Selbst stumm und kraftlos verharrte und gleichsam seinem Abenteuer fremd blieb. Kein Mensch, den er gekannt und mit dem er verkehrt hatte, konnte die Schwelle seiner Seele übertreten. Der Mittelpunkt seines Wesens lebte geheimnisvoll in dunklen Tiefen. Er schwor oft jene Zone tätigen Lebens herbei, die er selbst kaum kannte und in der sich ein wundersames Leben entwickelte.
Er betrachtete das Haus, nichts regte sich. Wieder nahmen ihn seine Gedanken gefangen.
Vorhin hatte er ein wenig Trauer, ein unbestimmtes Bedauern empfunden. Jetzt frohlockte er, und Trunkenheit begeisterte ihn. „Dies ganze Leben, das noch nicht niedergeschrieben ist!“ dachte er. Bewegung, Zeit, die sich verflüchtigt, alle Dinge wandelnd, Glück, ein Mensch zu sein, rastlos durcharbeitet, ein Mensch, dem jeder Tag etwas nimmt und beschert! O Baum, der nicht endet im Wachstum, o Buch, in dessen zahlreichen Kapiteln endlos die Lösung hinausgeschoben ist. Nichts Abgeschlossenes bin ich, wie ein Kadaver, der zu letzten Grenzen gelangte. Zwischen meinem lebendigen Sein und den Gefilden, in denen sich mein eigenes Drama abspielt, hört der Zusammenhang nicht auf. Wie ein Quell eng von Pflanzen umschlossen, sprudle ich zwischen den Menschen. Ich setze mich mit jener eigensinnigen Regelmäßigkeit kraftvoller Meteore fort. Der kommende Tag ist mir immer ein Fenster, das sich leis auf Täler öffnet, eine Türe, die sich auf- und zutut, um einen Lichtstrahl einzulassen, den die Augen der Menschen noch nicht geschaut haben.
Möge der Atem des Weltalls ohne Unterlaß meine Einsamkeit umflügeln. Peitscht mich, ihr großen Stürme! Nichts wird jemals stark genug sein, in ein Zimmer mich zu sperren und über mich den Deckel fallen zu lassen. Ich bin die Spule, die einen Faden nährt, der endlos sich abwickelt.
Selbst mein Schlaf, in dem farbige Lichtbilder kreisen, ist nur Anschein der Ruhe.
Brenne du mein Leben! Steile und klare Flamme du, sei um sich greifendes Feuer! Stärke, Kraft du, ganz bereit, sich auszugeben, Ungeduld zu leben, all die Jugend, all dieser Schwung, für einen Körper, der zu klein ist, all dies zu fassen!
Wie langsam doch alles hinlebt und wie langmütig die Folgen aller Dinge sind. Wie doch der Weg zu dem, was verheißen, voll Schlaftrunkenheit ist! Alles verwirklicht sich so langsam, daß die Bewegung selbst unsichtbar wird, und das ganze Universum für Augenblicke eine bewegungslose Ausdehnung zu sein scheint. Hatte er nicht zuweilen das mächtige Verlangen, den Gesetzen dieses Wachstums zu entrinnen, sich durch seine Maschen zu winden, die Zeit zu überschreiten, mit einem Schlage die ganze Wirksamkeit zu erschöpfen, das ganze Kapital zu realisieren? Oh, nicht mehr von einem Tag zum andern übergehen in weichlichem Hinausschieben und Hindehnen, sondern plötzlich sein, aufrecht und bereit, ein Mensch, der neu aus sich selbst hervorsprudelt.
Aus dem Herzen der reglosen Nacht sandte mit einemmal der nächtliche Sänger, wie zum Vorspiel, einige Rufe.
In der Seele des Menschen, der sich da befand, tat sich eine weite Stille auf. Das Ohr in das Dunkel gewandt, sich seiner ganz zu erlaben, horchte er dem wunderbaren Gesang. Der Vogel ließ einige Noten fallen und hielt inne, bald drängten sich die Töne und reihten sich nun ohne Unterbrechung aneinander. Sie waren voll und wohlklingend, und der ganze Park schwelgte mit ihnen. Aus dem Dunkel stieg der Sang gegen die Helle, und die große Stille der Nacht tauchte ringsum alles in Reinheit. Das pathetische Schluchzen stieg von den Bäumen, der Erde, von den Wassern auf. Es wußte um die Märchenträume, die Wassertiefe, die Macht der Säfte. Alle Blätter zitterten darauf, es zu hören, aus der heißen Erde strömte es in die Sommernacht, drang längs der verzweigten Äste hinauf, entriß alle Pflanzen ihrer Schlaftrunkenheit, nährte sich von ihrem Mark, um dann rasch und stark, wie die großen Wasserfälle, in einem Satz die kühnen Wipfel der höchsten Pappeln zu überspringen, in den heiteren Höhen des erleuchteten Himmels sich zu verlieren.
Die Seele des jungen Menschen weitete sich mächtig. Er wuchs in seinen Tiefen. Mühelos verbreitete er sich in alle niederen Räume seines Wesens. Sein Herz in der geweiteten Brust nährte sich von einem strahlenden und herrlichen Leben. Unaufhörlich rieselte die Klage des verzweifelten Vogels hin. Sie ragte einsam in die Welt. Und der Mann, feuchten Auges im Dunkel verloren, erlebte sie, als brächte er selbst sie hervor. Ihm entströmte der Sang, und besser als irgend Worte, drückte er die Heftigkeit seiner allzu geliebten Trauer aus. Die Töne quollen bald scharf, bald dumpf, und seine plötzliche Verzweiflung vereinte sich ganz mit ihrem Wellengang. Er sah nach rückwärts gebogen die Perlenreihe der Töne endlos gegen die leuchtende Wolke aufsteigen.
„Sang, o Sang, deine unendliche Schwermut erreicht die des traurigen Mondes und vermählt sich ihr in Tränen. Ich belaste dich mit meinem unwahrscheinlichen Schmerz, mit meinen unauslöschlichen Wünschen und jenem unsterblichen Durst, der mich verzehrt. Äußerster Teil meines Selbst, wie der bebende Stengel eines Kelches bist du, der meine verzweifelt trunkene Seele der öden Unendlichkeit hinopfert. Steige, steig an! Höher noch! Verschütte weithin diesen Kelch, und möge dein bitterer Regen über die ganze Erde fallen. Blähe zornvoll deinen Hals, du dunkler Sänger, und laß deinen Hauch nicht verklingen. Schon nähern aus dem Innern der Zimmer sich den Fenstern blasse Gesichter. Männer kommen, ihre Unruhe in deinem Sang zu kühlen und von ihm Erleichterung zu erbitten.“
In dem außergewöhnlichen Frieden dieser Stunde ertönten immer wieder die Triller, und der Gesang erreichte schmerzvolle Fülle und Macht. Der Mann, der ihm lauschte, fühlte sich durch ihn für Augenblicke wie emporgehoben, auf Gipfel entführt und sanft in den Höhen gewiegt. Ganz seiner Verzückung hingegeben, sah er nicht mehr nach dem Hause, bis ein leises Geräusch ihn erbeben ließ. Die Läden der Tür öffneten sich langsam, und eine Frau erschien im vollen Licht. Er stand auf, sein Herz schlug schnell. Es war das letzte Mal! Damit sie ihn sähe, trat er aus dem Dunkel. Ihn bemerkend, überquerte sie laufend, vorgeschnellt wie ein Segel, die große Rasenfläche.
Er empfing sie in seinen Armen, die sich unwillkürlich geöffnet hatten. Auf der Bank sitzend, hielten sie sich in langem Schweigen eng aneinandergepreßt. Über ihre stummen Lippen hinweg vereinigte sich im Dunkeln ihr Geist. In der Majestät einer großen Andacht fühlten sie, wie das gelebte Leben zu ihnen zurückkehrte. Sie erahnten darin selbst den Augenblick, wo sie wieder zu sprechen beginnen mußten.
Er sog den Duft ihres Haares ein und liebkoste ihren so zarten Hals; sie aber, an seine Schulter gepreßt, rührte sich nicht. Von fernher hörten sie das Rollen eines Zuges, den langhingezogenen Schrei einer Dampfpfeife. Ihre Seelen weiteten sich an der Entfernung, dann verflüchtigten sich die Geräusche, starben wie ein Röcheln hin, und das Mondlicht schien noch mit vermehrtem Glanz in die wiedergewonnene Stille zu gleißen. Lichtpünktchen glitzerten in den Büschen, winzige Strahlenbündel entstanden und erstarben auf der Wasserfläche des Sees.

Mit kaum wahrnehmbarer Stimme brachte er Worte hervor. Doch wie verloren in die Bilder des Traumes und Halbschlummers, blieb sie unbeweglich. In der großen Stille fürchtete er so sehr den Klang seiner eigenen Stimme zu hören, daß sein Gespräch erstarb. Er machte entfernte Anspielung auf seine Abreise, unhörbar atmete sie und antwortete nicht. Ein Wort, deutlich und scharf, stach plötzlich hervor. Beschämt schwieg er, es ausgesprochen zu haben. Das Schweigen wartete. Sie warf sich zurück und hob die Augen. Dieser Abend war der letzte Abend. Ganz leise sagte sie: „Es ist das letzte Mal.“ Er antwortete nichts, denn schon quälte ihn der heuchlerische Gedanke, das Wort in die Stille, aus der es noch hervorstach, zurückzustoßen. Auch wollte er den Gedanken ersticken, der sich in ihm zu entwickeln versuchte. Er sprach und sprach, wiederholte noch einmal die Notwendigkeit seiner Abreise. Man erwarte ihn dort, er müsse fort, könne sich nicht weichlich in sein eigenes Glück einnisten. Man durfte nicht alles dem opfern, was nur so neben dem Leben hinging.
Dem Gefühl mußte man widerstehen, dem Verstand die Oberherrschaft sichern. Wohl verstanden . . . Gewiß . . . Er verlor den Boden und wurde ungeschickt, weil er ohne Überzeugung sprach.
Und haben wir denn nicht das Beste unserer Selbst getauscht? Was könnten wir uns mehr noch geben? Sie neigte zum Zeichen der Zustimmung das Haupt. Man erwartet mich dort. Ja, man wird sich schon über die Lässigkeit, mit der ich mich in Bewegung setzte, verwundern. Wie rasch doch die Zeit vergangen ist! Nun sind es schon zwei ganze Monate, seit ich da bin. Zwei Monate!
Ich werde alle die verlorene Zeit einbringen müssen . . . Verlorene Zeit . . . O nein, die Worte täten mir unrecht. Ich wollte sagen . . . aber du verstehst mich ja, du, die feinfühligste der Frauen?
Sie blieb still und schien ihn kaum zu hören. Mit welcher Ruhe nahm sie diesen Entschluß auf, der ihn jetzt schreckte. Wie wenig schien sie unter ihm zu leiden. Würde sie ihm auf seiner langen Reise auch nicht im geringsten nachtrauern? Hatte er die verbrachten Tage einem eitlen Schein geopfert, so weit sie mißbraucht? Ein bitterer Gedanke prägte sich in seine Züge ein. Doch nein, sie würde zittern, sich erregen, ihm in den Arm fallen. Er feuerte sich an, ihre Ruhe zu stören, und begann von neuem. Weil wir stark sind und es so gewollt haben, zerreißen wir lächelnd die leisen Bande, die uns vereinen. Wir werden nichts mehr gemeinsam haben. Du wirst selbst die Erinnerung an mein Gesicht verlieren. Wenn wir uns eines Tages begegnen, werden wir vorgeben, einander fremd zu sein. Wir werden uns nicht selbst betrügen und, allgemeine Gesetze verachtend, es verstehen auseinander zu gehen, wenn wir das Vergnügen erschöpft haben. Ich weiß nicht, was für ein Mensch ich später sein werde, und derjenige, der heute mit dir ist, hat keinerlei Recht auf jenen. Auch werde ich nicht anteilloser Zuschauer des Verfalles sein, der dem zerbrechlichen Bau deiner Schönheit droht. Ich trage von dir ein vollkommenes Bild, das die Zeit vergeblich schwärzen wird, mit mir fort.
Zorn entflammte ihn. Er verausgabte sich vor dieser stillen und abwesenden Frau. Verzweifelt konnte er aus seinem Kummer keinen Ausgang finden und verwundete sich an seinen eigenen Worten. Oh, daß sie doch spräche, daß sie ihm diesen Schrei entgegenschleuderte, den er mit aller Kraft ersehnte. Dieser Schrei, der aus ihrem auf immer gespendeten Sein entspränge und sie ihm für immer einen würde! War dies nicht wichtiger und wünschenswerter als alles andere? Wenn sie es zu wollen verstände, würde er nicht abreisen. Wenn sie sagte: Mein Freund, geh nicht fort, du bist ja in meinem Leben solch eine Notwendigkeit, daß ich mir ohne dich kein Dasein vorstellen kann. Meine Furcht und meine Freuden, all meine Gedanken und mein zu empfindsames Herz, all das, was ich bin, hat es so gut vermocht, in dich das Netzwerk zarter Wurzeln zu versenken und sich von dir zu nähren, daß ich wie eine Pflanze, die man abreißt, sterben werde, wenn du gehst. Du bist der stets gegenwärtige Gefährte, der Horizont, hinter dem es mir gleichgültig ist, ob Land ist oder nicht. Du bist an meiner Seite der Freund ohne Geheimnis, der immer bereit ist, die Gedanken zu empfangen, die sich eben in mir bilden. Du bist immer wieder der Beweis, aus dem sich mein Glaube nährt, der mich leben macht, und der Vorwand für jeden meiner Tage bist du! Mein Leben ist der Vasall des deinen, und ich lege meinen Kopf an deine Schultern, zum Zeichen meiner treuen Ergebung. Wie könnte ich ohne dich mich des Übels auf der Welt, und dem Tode anheimgegeben zu sein, erwehren? Nein, nein, du mein wachsamer Ritter, du wirst nicht ohne mich ziehen. Ich hänge mich an dich, ich werde dir durch alle Lande folgen. Ich hefte mich an deine Fersen, bis ans Ende der Welt.
Er berauschte sich heimlich an diesen Worten, die er so gerne aus ihrem Munde empfangen hätte. Er bemühte sich, sie hervorzurufen, und ließ gleichzeitig seinen Entschluß als unerschütterlich erscheinen. Er wollte, daß sie plötzlich aus unaufhaltsamer Notwendigkeit hervorbrächen und nicht aus der Fähigkeit, sich seinem Wunsche anzupassen. Aber das Beben seiner Stimme, das ihm für Augenblicke den Hals zuschnürte, verriet ihn. Vielleicht kannte sie seinen verzweifelten Wunsch und erwiderte ihn nicht? und er wiederholte sich: Sprich, sprich, du siehst ja schon, daß ich die Ketten trage, die du um meinen Körper legen willst. Soll ich hinknien, soll ich mich demütigen? Sprich, und wenn du es willst, werde ich geringer sein, als die Erde unter deinem Fuß. Gib nur ein Wort mir, ein armseliges Wort des Bedauerns vom Saum deiner Lippen. Durchdringe mein Schweigen, fühle mein Elend, das nicht Ausgang weiß. Warum habe ich diesen Abschied gewollt? War es nicht mein eigensinniger Hochmut oder mein geheimer Wunsch, der sie dazu gebracht hat, sie verführt hat, mich erst das ganze Ausmaß des Glückes erkennen zu lassen, das ich eben durch diese Handlung verlieren sollte! O du Spieler, den nichts verhindern kann, das Beste seiner Güter im verhaßten Spiel zu wagen. Freundin du, lies in meinen Augen! Laß mich nicht gehen! Ich bin schon jetzt in Verbannung geraten. Über den unendlichen Ozean trauere ich dir nach! O wie weit bist du, und ich werde dich niemals wiedersehen. Halte mich zurück, noch ist es Zeit. Eine schmerzvolle Traurigkeit überkommt mich, wie ich diese Einsamkeit dort drüben mir bereitet sehe. Liebe, kleine sanfte Freundin, höre mich doch!
Sie verharrt wortlos gesenkten Hauptes, scheinbar in Unkenntnis des Ortes und des Vorgangs. Kein Zweifel mehr, sie ahnt nicht einmal diesen Schmerz, der ihr so nahe ist. Er sah ein Zimmer vor sich mit vielen Tapeten. Eine Lampe verschmolz in warmer Helle die Dinge, Winter war es und Abend. Es war sehr kalt draußen. Sie las, nahe dem Kamin.
Tränen trübten seine Augen.
Seine Angebetete gab ihn auf. All seine Kraft verließ ihn und schien sich in die Erde zu verlieren. Schwach und ängstlich war er wie ein Kind. Er glaubte an nichts mehr. Er wünschte nichts mehr. Das einzige, was ihm irgend wert gewesen wäre, er hatte es nicht besessen. Er würde es nie besitzen. Die Welt schien ihm verabscheuungswürdig. Alle Erinnerungen des Lebens, die ihm wiederkehrten, stießen ihn bis zum Abscheu ab. Der Ekel malte sich in seinen Zügen. O wie war er der Welt müde, durch die so viele Menschen gegangen waren, in der so viele noch sich aufhäufen. O Welt, von aller Befleckung der gebrauchten Dinge gezeichnet, die du kein Plätzchen hast, das nicht die Spuren irgendeiner Anwesenheit aufweist, Erde, aus der die Reinheit verbannt ist, Erde, über und über beschmutzt mit Ungeheuerlichkeiten, Luft selbst, die ich atme, auch du vergiftet vom Hauch der Menschen und Tiere durch diesen schrecklichen Geruch des Magens! Azur, der jungfräuliche Azur, wie man dich nennt, auch du bist nach allen Richtungen durchstreift und durchnarbt von ihren schmutzigen Gedanken, wie fette Fleischsülze.
Er unterbrach sein Schweigen, um sehr leise zu sagen: „Die Nacht ist kalt, friert dich nicht?“ Der Klang seiner Stimme war so seltsam, daß sie die Augen hob. Sie blieb lange nachdenklich und sagte, als ob sie laut weitersänne: „Gewiß, du hattest nicht das Recht, die Vergnügungen des Augenblicks deinen großen Hoffnungen zu opfern. Ich weiß, daß es wichtigere Dinge gibt, als die kleinen Fügungen unseres eigenen Lebens, und ich denke wie du, daß es gut ist, daß ein jeder von uns sich einen Teil für unbekannte Forderungen der Zukunft vorbehalte.“ Wie sie sich seine Worte gut gemerkt hatte!
Er antwortete: Solch ein Glück, wie es immer wieder neu aus ihm erstand, forderte eben seinen Preis! „Aber meine Freude konnte nur aus der deinen entstehen. Die aber mochte spärlich gewesen sein.“
„Freund, o Freund!“
Er fühlte, wie sehr sie noch an ihm hing, und fühlte, wie sich eine Entspannung in ihm vollzog. Mit diesen süßen Gedanken würde er hinweggehen.
„Du nimmst mich ganz mit dir. Du läßt von mir nichts, als die Stätte der Erinnerung. Ich weiß, daß du mich mit jener Heftigkeit geliebt hast, die man nicht lange empfinden kann. Die Leidenschaft brennt, ohne sich aufzusparen. Auch ich liebte dich, du mein einziger Freund auf dieser Welt. Wie oft bin ich abends, ganz angekleidet, nach einer langen Träumerei, die nur von dir erfüllt war, eingeschlummert, vergaß die brennende Lampe und erwachte des Morgens durch das Sonnenlicht. Die ersten Tage werden sehr traurig sein. Kummervoll werde ich mich durch das Haus schleppen, in den Park gehen, um einem Phantom nachzujagen, und auf dieser Bank die Augen schließen, um dich zu sehen. O wie qualvoll die ersten Tage sein werden. Du tatest, was du wolltest. Ich mache dir keinen Vorwurf. Wenn es dir eines Tages gefällt, hierher zurückzukehren, wirst du mich so wiederfinden, wie du mich verlassen hast, immer noch deiner Laune ergeben.“
In langen Zügen erquickte er sich an ihren Worten, aber trotz alledem, es waren nicht die, welche er gerne gehört hätte. Sie sprach leise weiter. Er trank den Wohllaut dieser Stimme, die er niemals ohne Bewegung hatte hören können.
— „Ich bin deinem Leben nicht unentbehrlich. Wie viele Jahre reicher Geschehnisse hast du erlebt, ehe du mich trafst. Du wirst ebenso schöne, ebensolcher Fülle erleben, wenn du mich vergessen hast.“
— „Niemals werde ich wieder glücklich sein.“
— „Die Nacht beginnt zu bleichen, und die Frische der Morgendämmerung durcheist mich. Sieh, die Nacht, die den Raum verläßt, ist das Ebenbild selbst des notwendig gewordenen Abschieds. Die Dinge müssen hinsterben oder sich verflüchtigen, damit andere erscheinen können. Der erste Tag, den ich allein zu leben haben werde, steigt bleich und trauervoll auf. Mein Gott, womit werde ich diesen ersten Tag erfüllen?“
„Wie werde auch ich ihn hinbringen? Nichts wird mir dies Glück aufwiegen, das sich durch dich unaufhörlich erneute.“
— „Süß ist es, dein mitleidvolles Bedauern zu hören.“
— „Es ist mein selbstsüchtigstes Bedauern.“
— „Du hattest bisher immer über dich gesiegt!“
— „Ich bin des Sieges über mich, das heißt gegen mich, müde. Ich beginne die süße Niederlage zu ersehnen.“
Er wußte, daß er feige das verlangen würde, was man ihm nicht gegeben hatte, und daß ihn daran nichts hindern konnte.
Trotzdem bemühte er sich, diesen Gedanken zurückzudrängen. Er suchte ihn zu ersticken, ihm zu entfliehen, aber jedes Wort, das er sagte, brachte ihn unwillkürlich näher. Er fühlte den Gedanken schwer und lastend werden in seinem unbeweglichen Körper. Um ihn an diesen Ort zu binden, fiel er unaufhaltsam langsam abwärts, wie der gewichtige Anker ins Meer hinabsinkt.
Er sagte:
— „Ich habe schon an viele Dinge geglaubt und entsinne mich manchen Irrtums. Bin ich dessen wahrhaftig sicher, anderswo den wahren Weg zu finden? Kann man etwas vorausbestimmen, und soll man sich nur von der Vernunft leiten lassen?“
Er zitterte, während er sprach. Niemals war sie ihm so schön, seiner Liebe so würdig erschienen.
— „Ich gehe . . . Wohin aber? . . . Ich weiß es nicht und habe nicht mehr die geringste Sehnsucht darnach.“
Seine Stimme senkte sich nach diesen letzten Worten. Alles war nun gesagt. Eine wollüstige Müdigkeit bemächtigte sich seines Körpers und Geistes.
. . . Zwei Wesen, so lange beflissen sich zu kennen, sich zu verschmelzen, konnten sie daran denken einander zu fliehen, da das Unermeßliche und unbekannte All sie in einem gemeinsamen Bedürfnis, sich gegen die öde Verlassenheit zu verteidigen, zueinander drängte?
„Du bist der Meister unserer beiden Schicksale. Ich bin nur das Echo deiner selbst, ich bin deine Sache. Bestimme denn.“
Sie legte ihren Arm um seinen Hals und lehnte ihr kühles Antlitz gegen das seine.
Er verleugnete alles, was ihn vordem begeistert hatte. Fortgehen sollte er? Das Liebste, was er hatte, verlassen und sich ärmer denn je wiederfinden! Die Welt durchwandern, Erinnerungen häufen, als ob er nicht schon genug mit sich schleppte! Er spottete der großen Arbeiten, der Eroberungen, des Ruhmes. Es gab genug Werke zur Befriedigung der Menschen. Und konnte er nicht überdies neben ihr im glücklichen Frieden ihres Daseins seine Seele besser als irgendwo von dem befreien, was ihn bewegte, Tag für Tag ein unvergleichliches Werk verrichtend? Aber von dem allem abgesehen, wog nichts die höchste menschliche Freude auf, nur in ihr zu verharren. Die ersten Pflichten, waren es nicht die gegen sich selbst und dann gegen die, die ein Teil seines Selbst ausmachte, da ihr Schicksal an das seinige gebunden war. Er würde bleiben.
O keusche Freundin, wie bist du schön in dieser Nacht! Wie konnte ich daran denken, dich zu fliehen. Seite an Seite werden wir bis zum letzten Tag verbleiben, wir werden auf unserem Antlitz diese Erleuchtung tragen, die der Tod nicht auslöschen wird. Ich werde dich an der Hand nehmen und mit dir die Welt durchlaufen. Wir werden dieselben Seltsamkeiten erleben, und dieselben Eindrücke sollen uns bewegen. Unter fremden Rassen werden wir uns noch enger aneinander geschlossen fühlen. Der nächste Winter wird mit dir verbracht sein und das Frühjahr und all die kommenden Jahre.
Die Sterne erloschen allmählich. Die wieder erweckten Dinge trugen die Farbe des Traumes und des Todes. Sie hielten sich umschlungen und sahen den Tag herandämmern. Sie war beglückt, aber in ihm blieb ein leiser Geschmack von Niederlage bestehen. Er hatte diesen großen Schrei, der alle Entschlüsse umwirft, nicht erlebt. Er selbst hatte es nicht verstanden, dieses Wunder heraufzubeschwören.
So hatte er denn seine Ansprüche vermindern und schüchtern um ein Almosen betteln müssen. Alle Kosten des Festes hatte er getragen; er scheuchte diese Gedanken und wiegte sie in zärtliche Worte ein, um sie zu betäuben. In dieser Schwäche, wie sie ihn zuweilen befiel, sprach er, über sie gebeugt, unaufhörlich weiter. Sie lächelte und hob von Zeit zu Zeit ihre Augen zu ihm auf. Seine Stimme wurde leiser. Ein Kamm entfiel ihr, als ihr Kopf sich ein wenig mehr neigte. Da verstand er, daß sie eingeschlafen war. Ein langsamer, regelmäßiger Atem hob ihre Brust.

Er betrachtete sie wie eine Unbekannte.
War es wirklich diese hier, gab es nicht anderswo eine Vollkommenere, eine andere, die ihm diesen unschätzbaren Beweis gegeben hätte.
Die Morgenröte stieg herauf. Ein rosiges Leuchten durchzog die Höhen des Himmels. Ganz nahe blies die Sirene eines Schiffes.
Der Name des Kontinents, den er zu bereisen sich vorgenommen hatte, brannte in seiner Stirn. Eine Stadt, die in der Glut des Juli brodelte, erfüllte sein inneres Auge. Mit allergrößter Vorsicht und Sorgfalt verließ er seine süße Bürde; sie schlief immer noch. Er lehnte sie an den Baum, der hinter der Bank stand, und erhob sich langsam ohne Geräusch. Er setzte einen Fuß vor, dann den andern. Leise streckte er das Bein, machte einen Schritt. Um seine Arme legten sich Stricke. Sein ganzer Körper bebte. Eine Schwere wollte ihn unbeweglich machen, aber eine unbesiegbare Kraft stieß ihn nach vorwärts. Wie ein Blinder streckte er die Hände vor sich aus.
Jede seiner Bewegungen war ein Losreißen, seine Füße hatten starken Widerstand niederzudrücken, als ob er durch Wasser ginge . . . der Atem ging ihm aus. Ein belaubter Ast streifte ihn; er blieb stehen und ging dann wieder, so kam er durch die ganze Allee, dann durch eine nächste und schließlich schon mit festem Schritt durch eine dritte. Er öffnete das Gitter, das schrecklich kreischte, begab sich auf die Straße und begann, die Hände fest an die Ohren gepreßt, damit er nichts höre, zu laufen, um das Schiff nicht zu versäumen, das bald abfahren sollte.
Ein großer Schrei erschreckte das Kind inmitten seiner Träume. Es horcht. Nichts . . . Dämmerung und Stille und der Pulsschlag der Uhr. Wie spät kann es sein? Zwei Uhr? Drei Uhr? Es hört im Nachbarzimmer umhergehen und denkt an seinen kranken Bruder, der seit acht Tagen dort liegt, denkt an das unterbrochene Spielen, an das veränderte Leben im Haus.
„O, mein Gott! Ich flehe zu dir, nicht dies! Nur dies nicht!“ Er erkennt die Stimme seiner Mutter, aber ihr verzweifelter Ausdruck erschreckt ihn. Was ist geschehen? Von Angst durchschauert springt er aus seinem Bett. Er horcht, das Ohr an die Mauer gepreßt. Nichts mehr? Sein Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit, er erkennt die Dinge. Er geht ans Fenster und hebt den Vorhang. Es sind einige Sterne am Himmel, und die wandernden Wolken verbergen sie für Augenblicke. Grau ist die Landschaft. Alle Gärten schlafen. Der weiche, leise Wind wiegt die entblätterten Bäume.
Ihn friert, er kehrt ins Bett zurück, bleibt aber aufrecht sitzen, weil er jenseits der Wand Wimmern und Schluchzen hört. Das Geräusch eines fallenden Stuhls und das Öffnen einer Tür läßt sein Herz sehr rasch schlagen; die Klinke bewegt sich, die Tür seines Zimmers öffnet sich nun auch. Seine Mutter erscheint. Sie nimmt ihn in ihre Arme und drückt ihn fest an sich. „Mein Kleiner! Mein Kleiner!“ Dann hüllt sie ihn in einen Schal und trägt ihn ins andere Zimmer. Das Kind versucht zu sehen. Das Lampenlicht schmerzt ihn in den Augen. Von Schluchzen durch und durch geschüttelt, neigt ihn seine Mutter seinem Bruder zu, dessen Augen blicklos geworden sind. Ein rasches Röcheln kommt aus seinem halbgeöffneten Mund: „Küß ihn, und sag ihm adieu; er geht von uns, du wirst ihn nicht mehr sehen.“ Das Kind bricht in Schluchzen aus und weint so, wie es noch nie geweint hat. Ohne viel zu begreifen, schreit es aus Angst, indem es bald seine im Schmerz gebrochene Mutter, bald den im Bett hingestreckten Körper, dessen aufgequollener Leib die Decke wölbt, anblickt.
*
Bleich färben sich die Fensterscheiben. Nachdem er im Fauteuil geschlafen hat, öffnet er plötzlich die Augen. Wo ist seine Mutter? Hat sie ihn mit dem Toten allein gelassen? Das Kind hat solche Angst, daß es sich keine Bewegung zu machen getraut. Es könnte ihn sehen, wenn es ein wenig den Kopf wendete, aber dieser bloße Gedanke erfüllt es mit Furcht. Eine Kerze, deren unbewegliche Flamme wie der Stahl einer Lanze aufragt, vergoldet das Antlitz des Leichnams. Er schaut auf das Fenster, der Ast eines Kastanienbaumes bewegt sich vor den Scheiben. Alle Menschen schlafen noch, und kein Geräusch kommt aus dem Hause. Er hört auf das Zinkdach Tropfen fallen. Der Regen beginnt von neuem. Seit acht Tagen hat er kaum aufgehört. Gestern hat seine Mutter gesagt: „Wir haben einen verregneten März.“ Sie hat es gestern gesagt, und es ist ihm, als wäre es lange schon her, daß er diese Worte gehört. Diese Nacht, in der er mit offenen Augen denkt, ist nicht wirklich wie andere Nächte. Sie ist einzig in seinem Kinderleben. Jäh ist er erwacht, die Nacht hatte keinen Anfang und kein Ende.
Das Kind horcht in die Stille; es ist ihm, als werde es sowohl vermöge seiner Augen als seiner Ohren durch ein Raunen von Erinnerungen überflutet. Dann läßt es seine Blicke schweifen. Der Schatten, der die Winkel des Plafonds einhüllt und sich unter den Möbeln anhäuft, ist nicht von dieser Art Schatten, die es bisher gekannt hat. Er weiß von allerlei, vergrößert die Stille, lebt sein Leben. Es ist, als ob die Dinge mit Gewalt ruhig gehalten würden, sie scheinen von einer innern Kraft besessen, die sie verzerrt. Der Regen fällt zur Erde, und die Nacht blaut mehr und mehr. Das Kind hört Pfiffe und fernes Rollen. Was werden die andern zu dieser Nachricht sagen? Die in der Schule? Wie man ihn ansehen wird! Auf der Stiege hat man eine Tür geschlossen; mit aller Kraft horcht er hin. Wo ist denn seine Mutter? Wird sie nicht kommen, ihn zu befreien? Oh, wie würde er aufatmen, wenn er plötzlich an die Eingangstür gelangen könnte! Aber da müßte er sich bewegen, Lärm machen, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er müßte das ganze Zimmer durchschreiten, dann noch das unbeleuchtete Speisezimmer, und „er“ würde hinter seinem Rücken sein. Er könnte sich vielleicht an ein Möbel stoßen, weiße Gestalten in der Küche erblicken. Wenn er da blieb, beherrschte er sie, beobachtete sie, ohne sich den Anschein zu geben. Wenn er aufstünde, würde nicht der Bann gebrochen werden und er in seine Macht fallen?
So denkt er eifrig, ohne sich zu regen. Allmählich nimmt ihn wieder der Schlummer gefangen. Sein Bewußtsein geht leise unter zwischen Erinnerungsbildern aus der Geschichtsstunde. Doch, o welche Erleichterung, er hört einen Schlüssel umdrehen. Stimmen, Schritte. Seine Mutter ist es mit Leuten . . .
*
Es ist nicht spät, sieben oder acht Uhr vielleicht. Den ganzen Tag über ist es dunkel gewesen, und nun ist schon völlig Nacht. Zerstreut hüpft das Kind über die Stufen und ist, über das Gitter sich vorbeugend, an das Ende der Treppe gelangt, die von Wasser und Kot beschmutzt ist. An der Loge des Hausmeisters ist es auf den Knien vorbeigerutscht, um nicht gesehen zu werden, dann war es laufend auf die Straße gelangt.
Es hatte aufgehört zu regnen. Die feuchte, duftbeladene Luft führt die Botschaft entfernter Wälder mit sich. Ein mäßiger Wind bewegt zuweilen die Gasflammen und gibt dem Dunkel der Straße Leben. Die Lichter des großen Krämerladens leuchten in allen Wasserlachen. Das Kind gelangt auf den verlassenen Boulevard, der es anzieht und ihm zugleich Furcht einflößt. Bei jedem Windstoß vermengen sich die langen Schatten und beschreiben große Gebärden. Das Kind wagt nicht auf dem Fußsteig zu gehen, wo der Efeu des Gitters allzu geheimnisvoll Park und Garten verbirgt. Es schreitet auf der kotigen Straße und wendet sich unaufhörlich um. Der schwarze und blaue Himmel ist in dunkle Inseln zerrissen und düster gleich einem großen Moorland. Die Luft ist lau wie menschlicher Atem. Ein leiser Brodem steigt von der Erde auf. Jenseits des Schmutzes und der Öde des Jahres ist der Frühling schon in Humus und heißer Fäulnis bereit. Das Fieber der Säfte teilt sich dem weiten Raum mit, irrende Winde, die schon grünende Wiesen durchquert haben, flechten sich um die feuchten Stämme der Bäume. Die Landschaft ist noch wie eine alte Frau in Lumpen, aber unter dem Boden lächeln bereits Gesichter mit geschlossenen Augen; bald werden tausend Stimmen am Saum der Erde hinsummen, ungezählte Augen im Grase sich öffnen. Die Sonne wird die Erde zwingen, ihr Geheimnis preiszugeben, Pflanzen werden wie Geständnisse aufsprießen und gleich großen Worten hervorstrahlen. Das Kind geht nun an dem schönsten Besitz des Boulevards entlang. Es bleibt stehen, um durch den kleinen freien Raum, wo das Gitter sich an die Mauer schließt, in den Park des Kommandanten zu blicken. Es sieht in unerklärliche Verwirrung, in die mit faulem Laub bedeckten Alleen, den Weg zum Haus, wo die Erde gelblich leuchtet, und das Wasserbassin, in dem sich der Mond und die Wolken spiegeln. Sicherlich ist das Gehölz voll toter Vögel, es weiß bestimmt, daß die Kinder mit ihren bebänderten Kinderfrauen niemals mehr auf dem Rasen spielen und umherspringen werden. Es sieht auf die beiden Löwen aus Stein, die die Pfeiler des Eingangstores zieren. Vor kurzem hat er mit seinem Bruder Schneeballen auf sie geworfen. Das wird er nie mehr tun. Wenn man einen Bruder hat, der gestorben ist, darf und kann man nicht mehr dergleichen tun. Plötzlich fällt ihm ein, daß man ihn vielleicht sucht. „O Mütterchen, ich sehe dich in deine Hände weinen.“ Er sagt sich, daß er heimkehren muß. „Ich werde den Weg nehmen, den ich so gerne gehe.“ Da ist das Waisenhaus, seine fahlen Säulen sehen durch das Gitter, Goldlettern leuchten im Dunkeln. Eine Glocke läßt Tropfen klingender Töne fallen, die der Wind der Nacht vermengt. Hier ist das Kloster zur Heimsuchung Mariä. Als er einmal mit seinem Bruder aus der Schule kam, hat hier aus diesem vergitterten Fenster eine sehr schöne Dame in Trauer mit ihnen gesprochen. Sie hatte gefragt, ob sie Zwillinge wären und ob sie ihre Mutter auch recht liebten. Er, der Kühnere, hatte geantwortet, den Blick gesenkt; denn diese Dame war nicht so wie andere. Hier ist das Türschild, auf das sie auch Schneehallen geworfen hatten. Eine andere Glocke tönt. Er erkennt sie; es ist die des Klosters der englischen Fräuleins. Dann begannen andere Glocken, alle Klöster des Neullyer Parks läuten zum Segen.
Das Kind ist am Rand des Baches stehen geblieben, der sein Schmutzwasser dem Kanal entgegenführt, in den es mit dem zauberhaften Klang reiner Quellen abstürzt. Er geht jetzt rasch. Auf den Bänken blicken ihn Erinnerungen an.
Dort am Ende der Straße, durch diese Lichtung, dem Himmelstor, wird er eines Tages wie ein Engel davonfliegen. Er weiß sehr gut, daß sich später etwas ereignen wird.
Er ist bereit und wird nicht zittern, wenn man ihm sagen wird, daß die Stunde geschlagen hat. Die Hände wird er falten und sich in die Wolken erheben. Seine Mutter wird auf der Erde knien und vor Stolz weinen. Er hebt den Kopf und geht festen Schrittes: „Gallien, Carolus Magnus, die alten Reiche Neustra und Australia.“ Wenn plötzlich dort aus dem Dunkel ein Auerochs spränge, würde er auf einen Baum steigen und ins Hifthorn blasen, die Gefährten herbeizurufen, die in den Wäldern umherjagen.
*
Die arme Mutter geht aus einem Zimmer ins andere und hört nicht auf zu weinen. Sie läßt sich in einen Sessel fallen und weint, weint!
„Viel Kummer hatte ich und kannte manche traurige Stunde, aber ich vergaß alle Kümmernis, wenn ich in das lächelnde Antlitz meiner Kinder sah. Dieser Gewohnheit habe ich mich hingegeben. Ich war ganz Vertrauen. Niemals habe ich an die Möglichkeit eines solchen Erwachens gedacht. Wie sorglos war ich und wie schuldig fühle ich mich. Der Arzt, der mein armes Kind behandelt hat, ist ein Dummkopf. Man hätte es retten können. Der Kleine von Benoit hat dieselbe Krankheit gehabt, und man hat ihn geheilt. Ich hätte mich wehren sollen.
Meine Lebenskraft ist erstarrt, und meine Augen haben sich in mein Innerstes gewendet. Ich hatte die Wunder vergessen, und nun bin ich wie einer, der tastend in der Nacht in einem großen fremden Hause umhersucht, in dem niemand ist. Nein, mein Gott, das ist nicht der gewohnte Gang der Dinge; es durfte nicht vor mir dahingehen. Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mir mein Kind genommen? Es scheint, daß sich ein fremdes Leben dem meinen zugesellt hat. Wenn ich an mich denke, so ist es nicht wie früher. Viele Dinge, die ich vergessen hatte, kommen mir fast täglich ins Gedächtnis. Ich sehe die Pension, in der ich die schönen Jahre meiner Jugend verbrachte, mein Zopf fliegt mir auf dem Rücken. Ich hatte seit meiner Verheiratung keine Erinnerungen mehr. Ich habe diesen Mann geheiratet, ohne ihn recht zu kennen. Er ist fort. Er hat mich mit seinen beiden Kindern verlassen. Wird er wenigstens zum Begräbnis kommen? Tot ist mein kleines Kind, tot. Ist es denn möglich?
Einmal, ich war gerade nervös, da hab ich ihm einen Schlag gegeben, und es hat lange geweint. Seine Verzweiflung war darüber so groß, daß ich darob ganz bestürzt war. Ich habe es nicht genug umarmt und an mein Herz gedrückt.
Niemals werde ich mehr glücklich sein. Nur mit Mühe kann ich meine Gedanken sammeln. Wo ist es jetzt? Gibt es etwas nach dem Tode? Ja oder nein? Wie traurig wäre es, wenn es nichts gäbe. Die Welt ist so groß, daß sie mir Furcht einflößt. Hier in der Nähe sind Bäume, die sich bewegen, und gleichzeitig sind, sehr weit in den Tiefen des Meeres, Ungeheuer, die sich geräuschlos durch die gelben Algen schlängeln. Hier ist ein Kind gestorben und drei Häuser weiter eines geboren. Wer kümmert sich um meinen Schmerz, und was bedeutet er in dieser großen Welt? Wie doch alles dunkel und schwierig ist! Ich bemühe mich zu verstehen, in mich aufzunehmen; ich beuge mich in Demut, aber mein Kopf ist zu schwach, daß ich verstehen könnte. Weinen ist leichter, o weinen! Nur weinen kann ich. Unerschöpflicher Kummer! Kummer, der du mit vollen Eimern aus allen Brunnen des Lebens steigst.
Ich kann dem Schlaf, der mich hindern wird, an ihn zu denken, nicht mehr widerstehen. Mehrere Nächte habe ich fast nicht mehr geschlafen. Ich darf mich nicht mehr unterwerfen. Ich habe noch ein zweites Kind aufzuziehen. Was täte es ohne mich? Oh, wie bin ich doch müde!
Wie lange habe ich doch geschlafen? Ich werde mir ein wenig Kaffee, sehr starken Kaffee machen, und dann werde ich die ganze Nacht bei ihm Wache halten können. Frau Benoit wird dann gleich kommen. Es ist nicht gerade warm. Ich glaube, das Feuer geht aus. Nun ist es schon einen Tag her, daß es gestorben ist! Ich kann mich nicht besinnen, wohin ich das Paket Kerzen gelegt habe, das ich gestern gekauft habe. Ich werde noch eines kaufen müssen. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich würde ein wenig lüften, um frische Luft einzulassen, aber mir ist, als könnte es mir die Nacht entführen, und es stürbe noch mehr. Seine Nase wird spitzer. O Entsetzen, mein Kind, mein Kindchen! Was suchen wir hier auf Erden? Was tu ich hier, worauf warte ich? Wie können wir in dieser Wohnung leben, mit dieser Gewißheit über uns? Und doch, es gibt in diesem Augenblick Gegenden, wo die Leute jetzt lustig sind und singen. Es gibt welche, die sich verheiraten, und manche bauen sich eben Häuser. Einige spielen Karten, und andere schreiben ihr Testament.
Ich glaube, das Wasser kocht, ich höre die Pfanne singen. Wohin habe ich denn nur die Kaffeebüchse gestellt? Mein Kopf versagt. Ah, da ist sie!
Bei allem, was ich sehe, höre oder berühre, finde ich seine Gegenwart wieder. Jedes Ding ruft mir wieder eine seiner Gesten wach, eine seiner Mienen. Warum hast du, o Gott, den man den Allgütigen nennt, mir ihn gegeben, um ihn mir so rasch wieder zu nehmen? Diese Treppe, die ich tagtäglich mehrmals herunterging, ohne nur an sie zu denken, die ich mit geschlossenen Augen hätte hinaufsteigen können, ist mir vorhin wie ohne Rampe erschienen, und mein Fuß hat eine Stufe verfehlt.
Nichts ist mehr auf seinem Platz, und jedes Ding hat eine neue Bedeutung für mich. Ich bin ganz von meinem Schmerz umschlossen, ich bin nur Schmerz. Die Welt dehnt sich um mich her, und ich fühle sie wie einen Ozean von Gleichgültigkeit um meine kleine Trauerinsel.
Ich kann mich nicht sattsam genug der Stille anvertrauen.
Ich verliere mich in den Tiefen, und alles erschreckt mich. Jedesmal, wenn ich die Augen hebe, trägt mir die Mauer, die Decke, der Rücken des Fauteuils, gleich dem Schweißtuch der Veronika, sein Antlitz zu. Das Licht meiner Lampe ist nicht das gleiche mehr. Etwas ist in ihre Flamme übergegangen und ist darin geblieben. Auf dem Parkettboden ist ein dunkles Feld, das an eine lichtere Zone stößt und unter dem Bett so schrecklich wird, daß meine Augen, wenn ich daran denke, ihm nicht zu begegnen trauen.
Teurer Kleiner! Ich werde nicht mehr für dich zu sorgen haben. Ich werde nicht mehr die tausend Fragen hören, die er an mich richtete, wenn ich ihn des Morgens anzog. Seine kleinen Hände werden mein Antlitz nicht mehr liebkosen. Er nannte mich „Mutter“. Er schlang die Arme um meinen Hals und sagte mir ins Ohr: Mutter! Du bist mein kleines Mutti, du. Und nun liegt er so da.
Noch ist er da und ist nicht mehr da. Es scheint, daß er seinen Leib für einige Zeit verlassen hat und wiederkommen wird. Er sieht sich nicht mehr ähnlich. Er hat das Lächeln, wie man es auf den Malereien der Museen sieht. Morgen werde ich sagen müssen: Zur Zeit, als mein kleiner Raymond lebte . . . Als ich noch meine beiden Kinder hatte . . . Der, der gestorben ist!
Es ist ein Datum mehr in meinem Leben. Wie er so auf dem Rücken daliegt, scheint es, als würde er wie ein Boot, mit seinen Rudern von der Flut getrieben, hinweggleiten.
Wenn ich auf der Straße stehen blieb, um den Leichenzug eines prächtigen Begräbnisses zu betrachten, dachte ich nicht, daß ich eines Tages den ersten Platz hinter dem traurigen Karren einnehmen würde.
Morgen werde ich hinter ihm in die Kirche eintreten. Die Kerzen werden durch die Schleier der Weihrauchdämpfe erstrahlen, und die große Stimme der Orgel wird seinen Einzug in das Reich Gottes verkünden. O Kleiner, mein Kleiner!
Wie ist doch das Schweigen, das von dir aufsteigt, beredt. Ein Schweigen der ganzen Menschheit, die mit all ihren Königen und all den lauten Begebnissen wie unterirdisch sich hindehnt.
Mein Gott, antworte mir, wo bist du? Ich stehe vor dir demütig in gläubigem Eifer, bereit, dein strengstes Gesetz anzunehmen, aber gib mir nur ein Wort, irgend etwas für meinen Schmerz, der nicht vergeblich sein kann.“
*
Das Kind geht nicht in die Schule, und man zieht ihm tagtäglich das neue Kleid an. Man hat den Tisch verlängert, weil sein Onkel und seine Tante jeden Tag zum Essen da sind. Bei Tisch spricht seine Mutter nicht drei Worte und läßt alles auf ihrem Teller stehen. Manchmal erhebt sie sich so plötzlich und bleibt so lange im Nebenzimmer, daß seine Tante aufsteht, um sie zu holen. Jeden Nachmittag geht er mit seinem Onkel und seiner Tante spazieren. Alle Tage sind Sonntage geworden. Mit großer Sanftmut spricht man zu ihm, und er wird niemals mehr ausgezankt. Zwar ist er viel vernünftiger geworden. Die Stirn an die Scheibe gelehnt, sieht er auf der Straße seine von der Schule heimkehrenden Kameraden. Er fühlt, daß er von nun an ihnen sehr überlegen ist.
Er sagt zu seiner Mutter: „Ich habe seine Spielsachen genommen und mir sein kleines Federmesser ausgeborgt. Wirklich, Mama, es ist nicht dasselbe, selbst wenn ich sein schönes Pferd nehme, das im Wandkasten steht, wird es nicht das gleiche sein. O Mütterchen, ich bitte dich! Nein, nein, nicht seine Schuhe, sie gehören ihm.“
Und er sagt auch: „Wird Papa niemals wiederkommen? Warum ist er fort, warum kommt er jetzt nicht wieder?“
Und seine Mutter antwortet ihm, daß sie einen Brief erhalten habe. Sein Vater sei weit, sehr weit am anderen Ufer des Meeres. Vielleicht wird er eines Tages wiederkommen . . .
Der Vater kam eines Abends, viele Tage nach dem Ereignis. Das Kind schlummerte eben in seinem kleinen Bettchen ein, und seine Mutter saß neben ihm. Beide hörten einen Schritt auf der Stiege und sahen einander an. „Horch, Mütterchen,“ und sie antwortete: „Ja, gewiß, er ist es!“
Der Schritt hielt vor der Tür an. Er war es!
Die Mutter sagte zu ihrem kleinen Jungen, indem sie einen Finger auf den Mund legte: „Rühr dich nicht, ich werde gleich wiederkommen.“ Sie trug die Lampe weg und schloß die Tür seines Zimmers.
*
Der verlassenen Gattin ward das Dunkel, aus dem sie ihre Träume schöpfte, plötzlich wahrnehmbar, und ein Antlitz erschien in ihm. Der Mann trat ein, alle Stille lastete nun auf ihm. Das traumhafte Schweigen der Gegenstände wurde nun augenblicklich unterbrochen. Dann setzte es wieder ein, als fliehe es den Tiefen zu.
Die Lampe, die vor einem Bilde des Gekreuzigten mit seinem geöffneten Herzen flammte, verbreitete den Schein alten Elfenbeins, und er senkte den Kopf und sagte nicht ein Wort, überließ dem Pendel der Uhr die Unterhaltung. Die schweren Fenstervorhänge mit den tiefen Schatten waren wie das weit geöffnete Memorial ihres Lebens. Der Zweig eines Buchsbaumes schien sich über das Bild zu neigen, und es war als regte sich die Ewigkeit in seinen Blättern. Von Zeit zu Zeit wurde die Tür durch den Wind geschüttelt, und das Fenster krachte.
Sie hielten den Kopf geneigt, denn ihre Blicke konnten das Schwere, das aus ihrer Seele kam, nicht emporheben.
Da plötzlich fesselte ein Gegenstand ihre Augen. Ein Leuchter aus Kupfer, der auf dem Tisch stand, nahm eine seltsame Bedeutung an. Sie schienen mit Aufmerksamkeit den Konturen und Verzweigungen zu folgen, und sie gewöhnten so ihren Blick, sich anderswo als in ihren Augen zu begegnen.
Und ihre Blicke stiegen zusammen längs des Leuchters auf, blieben einen Augenblick an seiner Spitze unbeweglich, dann, als ihre Gesichter sich zueinander aufhoben, verschmolz ihr Blick . . .
Im Nebenzimmer zitterte das Kind vor Unruhe. Mit weit geöffneten Augen versuchte es das Mysterium der Dunkelheit zu durchdringen.
Was ging hier nebenan vor? Es hörte nichts. Sein Vater war zurückgekehrt. Bedeutet das Glück? Unglück? Auf den Fußspitzen näherte es sich der Tür und floh, als es Geräusch hörte.
Seine Eltern betraten das Zimmer. Sein Vater hob es von der Erde auf und drückte es so stark gegen seine Brust, daß das Kind sein Herz gegen das seine schlagen fühlte.
Das Wetter war schön und die Luft sehr milde. An einem Sonntag war es. Der Nachmittag rückte vorwärts, und seit Stunden wälzte sich unaufhörlich die Menge über den Hauptboulevard der Stadt. Ein Menschenstrom flutete abwärts, ein anderer wieder zurück. Wie im Meere eilige Strömungen die bewegte Flut durchqueren, ohne sich in ihr zu verlieren. — Junge Leute folgten einander und drängten durch die widerstrebende Masse. Von Zeit zu Zeit blieben Spaziergänger stehen, und ihr Rücken zerteilte wie ein Fels die menschliche Flut. Sie wurden heftig gestoßen und bald wieder vom Wirbel erfaßt. Da und dort öffnete ein Geschäftsladen seine Höhlung und nahm etwas von diesen Wellen in sich auf. Bei jeder Straßenüberquerung, wo der Sturzbach der Wagen sich gewaltsam staute, rückte der Menschenstrom zurück, schwoll an, wurde lebhafter und brandete dann in die freigelegte Hauptstraße. Die Fassaden der Häuser stießen farbige Schreie aus, und gewaltsam prägte sich die Lichtreklame, die von den Dächern in den Himmel hinaufgeschleudert wurde, den aufwärts gerichteten Blicken ein. Die Spaziergänger waren zahlreicher als die Buchstaben einer Zeitungsspalte. Fadenartig umwickelten sie Plakatkioske. Vor den Auslagen bildete sich eine Wand von Menschen. Wie Adler, die sich auf eine Herde stürzen, kreisten Wagen umher, schienen ihre Beute zu suchen, stürzten an die Masse heran und flohen mit ihrem Fang. Immer noch ging der Strom hin. Er floß über und schwoll durch den unablässigen Zuwachs seiner Nebenflüsse, der Straßen und Durchgänge; ohne sich sonderlich auszubreiten, kam er durch die Seen der Plätze, um sich dann an seinem Ziele, in dem Fächer einiger Vororte, zu verströmen.
Über all dies unterhielt sich unter diesen vielen Menschen ein junger Mann. Schon seit dem Morgen begeisterte ihn eine außergewöhnliche Freudigkeit. Sein Herz saß, wie er sich gern ausdrückte, am Ende einer Rakete, bereit loszugehen. Das Ereignis dieses schönen Tages, nach einer langen Reihe trauriger Tage, hatte ihm Vertrauen und Freude am Leben wiedergegeben. Aus dem fröhlichen Windhauch, der die grünen Blätter der Bäume bewegte, und von dem Geruch der eben frisch besprengten Alleen flog ihn ein Zauber an. Alles schien ihm verändert. Die Frauen waren fast alle begehrenswert, und die streitsüchtigen Männchen, die Gottesfriede beschlossen hatten, begegneten einander mit ungewohntem Wohlwollen. Schon am Morgen hatte er in einer kleinen Bar den allgemeinen Optimismus auf dem lachenden Antlitz eines guten, dicken Kerls leuchten sehen. Sogar der Werkelmann, dem er an seiner Straßenecke begegnet war, war ihm nicht so elend erschienen; lächelnd leierte er mit himmelwärts aufgeschlagenen Augen; er dachte nicht mehr daran, die Hände auszustrecken, und spielte sichtlich nur zum Vergnügen. Er sah noch immer den Mann dort neben der Haustüre mit seinem geröteten und dabei sanften Schnapsgesicht und bedauerte es, ihm nichts gegeben zu haben.
Zerstreut ging er dahin, ließ unbesorgt und ziellos seine Blicke umherschweifen und lockerte die Trense seiner Gedanken. Er wurde nicht böse, wenn man ihn anstieß. Alles interessierte ihn und schien ihm zuzurufen: die Farbe eines Kleides, der Klang einer Stimme, die Klarheit eines Antlitzes, die Spur eines Parfüms. Er blieb oft stehen und wandte den Kopf, ohne der Gewalttätigkeiten zu achten, denen er sich dadurch in jedem Augenblicke aussetzte. Er glich dem sorglosen Kinde, das während der Schlacht unter dem Kugelregen der Kämpfenden Blumen pflückt. Wenn ein Ellbogen in seine Rippen drang, ein ungeschickter Fuß auf den seinen trat, sagte er sich: „Geschieht dir schon recht, warum gibst du auch nicht acht, eben wärst du beinahe wieder unter diesen Autobus geraten, als du über den Boulevard gingst, aber schon hast du es wieder vergessen; eine ganz gelungene Quetschung mit krachenden Knochen und verspritzten Eingeweiden steht dir ja auf der Nase geschrieben und ist dir ganz sicher.“ Aber er war seinen Leidenschaften gegenüber wehrlos und setzte seinen Weg fort, indem er, abenteuerlich gelaunt, voll wirrer Ideen die Augen rechts und links umherschweifen ließ.
Es gab hier um ihn her so viele Dinge zu sehen, daß er mit seinen Blicken den Himmel, das Jagdgebiet der Götter, verschonte.
Leute nähern sich ihm. Alle denken sichtbar an etwas Bestimmtes. Aber ihre Gedanken vermengen sich nicht. Jeder Vorübergehende schlägt seinen Weg ein und trägt die kleine geschlossene Welt seiner ihm allein vertrauten Gedanken, sein undurchdringbares Geheimnis in sich verborgen. Jeder ist ein geschlossenes Buch, das eine Geschichte enthält, die niemand lesen kann. So gehen sie auf dem wohlbekannten Boulevard mit der Sicherheit blind Geborener dahin. Was könnte sie in Erstaunen versetzen? Alles befindet sich an seinem Platz, und der gewohnte Anblick verschleiert mitleidig die tiefern Dinge. Wozu auch sich immer um den Anfang und das Ende sorgen, wenn der gegenwärtige Augenblick so freundlich ist. Jeder fühlt sehr stark, daß schönes Wetter und er frei ist. Sonntags läßt es sich gut leben. Die Erde gehört jedem, und keiner vermag ihr etwas zu rauben. Man existiert ohne jede Mühe. Der Hauch der Lungen, die Maschinerie der Beine funktioniert, ohne daß man sich darum bekümmern muß. Man braucht sich nur laufen zu lassen. Jeder Vorübergehende weiß, daß er den ganzen Tag um seiner selbst willen leben wird, daß er Herr eines Körpers ist und ihn zu seinem eigenen Gebrauch, zu seinem eigenen Vergnügen verwenden kann. Bis zum Morgen werden die Minuten sich aneinanderreihen und mit vollen Händen eine der andern Freiheit spenden. Auch ist es nicht nötig, eine neue Art des Fühlens und des Schauens zu erfinden. Die Freude ist allüberall, und man braucht sich nur zu bücken, um sie aufzuheben. Wir haben ein für allemal die Dinge bei ihrem Namen genannt, und das Weltall mag sein Geheimnis, das uns nicht interessiert, für sich behalten; wir werden uns nicht mehr verfolgen lassen. Der Tod? — laßt uns lachen! —: eine Erfindung der Pfaffen. Und wenn es ihn schon wirklich gibt, so ist er ein Verhängnis, das so entfernt und unwahrscheinlich ist, daß man es nicht nötig hat, daran zu denken, und dann . . . bis dahin kann so mancherlei passieren; weiß man es denn?
Großer Gott, diese Menschenmassen! Woher kommen sie denn alle, diese Köpfe, dies wandelnde Gewirr von Globussen.
Er wurde nicht müde, alle diese Unbekannten zu betrachten, die plötzlich vor seinen Augen erschienen und sich in einer gänzlich von Menschen erfundenen Dekoration hin und her drängten. Nichts, rein gar nichts war hier von der primitiven Natur übrig, und doch hatte ohne Zweifel an dieser Stelle früher einmal ein Wald in seinem Dämmerzustand gestanden. Das wilde Tier hatte hier, gewiß oft von Jägern verfolgt, mit seinem Schrei das finstere Echo geweckt, und er dachte an einen alten Stich, der eine Auerochsenjagd darstellt. Eine ängstliche Hirschkuh hatte vielleicht hier mit ihren Jungen geschlafen, während der Mond die Wipfel der Bäume beleuchtete. Täglich sangen tausend Vögel, wenn der Hauch der Morgenröte sich erhob, und nachts war die wundersame Stille nur gestört durch das Brechen von Ästen, das die behaarten Ohren des Wildes und die traumschweren Schwingen der Vögel aufschrecken ließ. Nun aber sind da Steinpflaster und Häuser und der Horizont geradliniger Fassaden. Selbst der zwischen den Dächern sichtbare Himmel hat sein Geheimnis verloren, er ist geordnet, gleichsam gezähmt.
Mit neuem Blick betrachtete er ein glänzendes Automobil, das am Rande des Fußsteigs stehen geblieben war, er betrachtet es so, als wenn es, ganz ausgestattet und geputzt, eben aus den Tiefen der Erde herausgekommen wäre. Seine glänzenden Kupferbestandteile, seine Laternen, die an riesige Juwelen erinnern, seine wie ein geschmeidiges Tier gewundene Sirene, alles, woraus es sich zusammensetzte, hatte lange in der unterirdischen Nacht als ungeformte, aufgehäufte Materie geschlummert, und die Menschen waren vorbei gekommen, ohne ihren Schlaf zu stören. Heute knatterte es am Rande eines Fußsteigs. Die geduldige Arbeit vieler tausend Jahre hatte eines Tages eine Vereinigung von Zusammenhängen geschaffen, aus denen dieses Wunder erstanden war; und doch würde, Stück für Stück zerlegt, diese merkwürdige Maschine unfehlbar in ihren primitiven Zustand zurückkehren. Er gewährte sich den Zauber, sie mit den aufgerissenen Augen eines Steinzeitmenschen zu betrachten, und sah, wie sie losfahrend ihre Kraft unter dem Befehl eines Chauffeurs bändigte. Dann nahm er wieder seinen Weg auf, die Leute musternd, die ihm begegneten. Er traf seine Wahl unter den Gesichtern und interessierte sich hauptsächlich für einige Vorübergehende. Auf deinem Gesicht, mein Lieber, kann ich ohne Brille dein ganzes Register ablesen. Zylinder, Zigarre, Gewohnheitsraucher könnte man sagen, üppige Lippe, volle Wangen, stubenhockerisches Gesicht, ein großer wohlgenährter Körper, der sich nichts versagt. Ich weiß, daß du Sklaven hältst und daß du in der Tasche den Schlüssel zu deinem Geldschrank trägst. Und nun wieder dieser dort? Begrenzter Blick, Gutmütigkeit des gebrannten Kindes, der Gewohnheit des Gehorsams unterworfen; ausgelaugte Hautfarbe, tägliche Haft in irgendeinem obskuren Büro. Dieser da hatte es schwerer, vielleicht ist er ein Dilettant irgendeiner Art, ein Müßiger, der sich die Illusion einer Tätigkeit zu schaffen verstand. Und wohin geht diese Frau? Wird sie irgendwo erwartet? Ruft sie Pflicht oder Vergnügen? Dieser Austräger, eben auf einem Geschäftsweg, der da am Band des Fußsteigs hingeht? Regelmäßiger und ruhiger Schritt, rhythmisch, fast wie ein Tänzer, keinerlei Anzeichen von Sorgen im Gesichte, also festes Gehalt Ende jedes Monats. Ein Kenner des Kartenspiels und des Weines. Ich sehe seine Frau in einer Portierloge. Vollständige Sicherheit, eine gewisse Leichtigkeit, sich zu verändern! Seine Prinzipien: sich um nichts zu sorgen und weit vom Schuß sein, wenn die Bombe platzt.
Eine Modedame in hellen Farben entflattert einem Geschäftsladen und entflieht den Blicken der Männchen, die ihre Nase nach ihr heben.
Er spaziert immer weiter. Seine namenlosen Zeitgenossen umkreisen ihn und streifen ihn wie Erscheinungen. Wohl hört er manchmal Worte durch diese halbgeöffneten Türen, unter denen sich Geheimnisse dieser Lebewesen auftun, aber sogleich verschlingt der Raum um ihn die Menge mit ihren Beschwernissen, die ihm ewig weiter unbekannt bleiben werden.
Dieser ist heute morgen in der Stadt angekommen, und jener wird sich heute abend einschiffen, um niemals wiederzukehren. Dieser Ingenieur trägt hinter seiner Stirn das Bild einer merkwürdigen Maschine, über deren Bau er nachsinnt. Die Frau dort bemüht sich, nicht an die noch unbezahlten Rechnungen der Lieferanten zu denken. Von all diesen Boulevardspaziergängern werden, wenn auch keiner eine unabsehbare Zeit überleben wird, mehrere, dafür kann er einstehen, schon vor Ende des Monats tot sein. Jeder in Bewegung begriffene Körper, und auch der seine, wird endlich nach langem Hin- und Herschwanken das vollkommenste Gleichgewicht erlangen. Viele haben schon ein kleines Zimmer aus Stein, das sie irgendwo geduldig erwartet . . . Und alles spaziert am Ende einer Leine, die eine gewisse Hand nicht losläßt. Aber glücklicherweise schwebt ihnen die Zukunft als ein herrlicher Golf vor, in dem sich der eingeengte Strom ihres gegenwärtigen Lebens schön ausbreiten wird. Einer von ihnen träumt: noch zehn Jahre guter Arbeit, und wenn mir nichts Böses zustößt, werde ich mein Geschäft verkaufen und mich aufs Land zurückziehen können. Ein anderer: ach, wenn ich im Ruhestand sein werde, dann sollen sie erfahren, was ich über sie denke. Wie einen das erleichtert! Und ein dritter: wenn ich eine bessere Stellung ausfindig gemacht haben werde, will ich mich verheiraten und ein Heim gründen, das muß doch endlich so kommen. Und ein vierter noch, der über seine eigenen Gedanken lächelt: sobald meine Geschäfte besser gehen werden . . . usw . . . .

Sie kommen vorbei und verschwinden wieder, damit ist es zu Ende, und er wird sie nicht wiedersehen.
Plötzlich denkt er an diese Frau, die an einem der letzten Abende in einem Zug ihm gegenüber gesessen hatte. Wenn er sich in diesem Gewühle plötzlich wieder ihr gegenüber fände. In dem Maße, als er sich das Abenteuer neuerdings vergegenwärtigte, vergnügte er sich, diesen unmöglichen Zufall herbeizusehnen. Er erinnerte sich, daß sie recht hübsch und ihr Blick keineswegs der einer dummen Person gewesen war. Mit einer neuen Zähigkeit machte er sich wieder Vorwürfe. Ich hätte es doch wagen sollen. Jeder Tag hat so seine Launen; wenn ich ihr heute begegnen würde, spräche ich sie gewiß an. Warum habe ich damals gar nichts versucht? Wer weiß, welch glückliche Möglichkeiten ich mir an jenem Abend entgehen ließ? Es war eine seiner großen Versuchungen und zugleich seiner großen Befürchtungen, die Ereignisse vorwegzunehmen, um ihnen zu ihrer Verwirklichung zu verhelfen. Neue Wesen aus einer unbekannten Welt anzusprechen, hatte immer eine besondere Erregung in ihm hervorgerufen. Vor wieviel Türen hatte er nicht, die Hand an der Klingel, gezögert und war schließlich gegangen, um am nächsten Tag mit einem verspäteten Sieg über sich selbst wiederzukommen. Wer konnte die vielleicht seltsamen Folgen der geringsten Begegnung voraussehen? Dies hieße schließlich sein Leben in zu kleiner Münze verausgaben, wenn man so wenig Herr über sich selbst war, daß man es zur Beute des erstbesten Zufalls machte, der um die Ecke bog. Es gab so viele Menschen, die er nach seinem Willen kennen lernen konnte oder nicht. Eine einzige Begegnung mochte seinem Leben eine neue Richtung geben. Denn jedes Ereignis ist reich an unvorhergesehenen Verknüpfungen. Wie sollte man unter den unzähligen Erwägungen jedes Tages wählen? Durfte er leichthin Freundschaft und dann Haß in Blicken erwecken, die heute zum erstenmal auf sein Antlitz gerichtet waren? Sollte er diese lange Folge von Enttäuschungen herbeilocken, die ihn bei jener Frau erwarteten, die zu rasch ihm sein Lächeln erwidert hatte?
Zögern des Spielers vor der Wahl des Wagnisses!
Begegnungen, neue Beziehungen über ihn verhängt oder von ihm gesucht, o all dieser Aufbau der Zukunft, der zwischen Gebundensein und Freiheit schwankt! Begegnung! Ist sie nicht stets für den immer fortbestehenden Menschen wie eine feierliche Geburt? O schöpferische Begebenheiten! Als ich jenem Unbekannten die Hand drückte, entstand plötzlich in mir der Mensch, der ich erst später einmal sein werde.
Werde ich also kraft einer unbescheidenen Sicherheit mich ohne Furcht und Demut den tausend Abenteuern entgegenwagen, die jeden meiner Schritte belauern? Werde ich nicht zumindest die Erregung des Jägers erleben, der auf den Fußspitzen in den geheimnisvoll belebten Wald dringt, in dem ich gegen mich selbst vorschreite, der ich mir in eigener Person vielfach und doch einzigartig begegne?!
Er ließ sich von anderen Gedanken entführen und wechselte das Spiel.
Er musterte jetzt die Augen der Vorübergehenden. Dies war, wenn er durch die Straßen spazierte, eine seiner alltäglichen Vergnügungen, die Augen der Frauen und Männer zu befragen. Er trug aus der Antwort, die er erhielt, immer irgendein Wunder davon.
Man geht in einer wenig belebten Straße hin. Vor uns ist nichts als der unbekannte und seelenlose Raum, Bewegungen überflüssig wie vergebliche Axtschläge, und dann Häuser mit ihren Fenstern und die leuchtenden Auslagen der Geschäfte. Da plötzlich nähert sich uns jemand auf dem Fußsteig, z. B. eine Frau. Von weitem ist sie vorerst nur ein Körper, der sich bewegt. Im Hintergrund der Straße, viel weiter, regen sich ja noch viele andere Wesen. Aber die Frau nähert sich, ihr Gesicht wird deutlicher. Unter den Bogen der Brauen lugt ein fremdes Leben hervor, die Augen. Selbst kommt man gleichfalls heran. Der äußerste Punkt der Blicke beginnt nun an uns zu rühren. Irgend etwas leuchtet aus diesem nahenden Antlitz. Die Linien des Körpers halten das Wesen nicht mehr versperrt. Das Leben der Augen ist größer als das sie einschließende Antlitz. Die Vorübergehende wird uns erreichen, wir suchen ihren Blick, und plötzlich findet die übliche Verschmelzung statt. Aus den Tiefen des Alls kommt uns durch diese Augen eine flüchtige Botschaft, und wir vereinigen uns in ihnen mit dem ganzen fremden Leben.

Die zwei Vorübergehenden deren Blicke sich begegnen, haben beide das Gefühl einer Besitzergreifung. Aber weder der eine noch der andere könnte sagen, wer besitzt und wer besessen wird. Wie viel zärtliche, ironische und hochmütige Worte habt ihr für den müßigen Spaziergänger, der euch in aller Unschuld sucht, ihr Blicke, die ihr zahlreicher als die Kiesel des Meeres, zahlreicher als die raschen Strahlen der großen, sich drehenden Leuchttürme aus dem Antlitz der Vorübergehenden hervorzielt!
Alle Blicke gewähren sich nicht dem ihnen auflauernden Blick. Es gibt Blicke, die überrascht sich sogleich abwenden. Es gibt auch solche, die uns durchdringen, als ob sie uns nicht zu sehen scheinen, und andere, die sich mit solcher Zähigkeit an uns anlehnen, daß wir Mühe haben sie zu ertragen. Wenn sie vorbei sind, fühlt man sich verarmt, und manchmal hat man nach ihnen zurück schauen müssen.
Die Menschenmenge war ihm jetzt nichts mehr als Tausende von Augen, die er unermüdlich befragte. Er war manchmal so stark betroffen, daß er als erster den Kopf wenden mußte. Die Seele jedes Vorübergehenden erfloß aus dieser Doppelquelle, und er fühlte sich bald mit Höflichkeit empfangen, bald verächtlich in ein unwiderrufliches Nichts verwiesen. Es gab da auch Augen, die auf das Antlitz nur gemalt waren, und es war fast unmöglich, in ihnen die geringste Spur eines Innenlebens zu entdecken.
Das ist ein Antlitz, ein Antlitz . . . das ihm nicht unbekannt ist. Und dieser Gang! Nur den Körper erkennt er nicht, der muß sich verändert haben. Wer mag es doch sein? Der Blick des Vorübergehenden prüft ihn mit Dringlichkeit. Er ist voll Leidenschaft und scheint eine Frage zu enthalten. Worte stehen hinter ihm bereit. Es ist offenbar, daß man ihn nicht wie einen Fremden anblickt. Auch er zögert vielleicht, ihn zu erkennen. Er selbst schaut mit der ganzen Kraft, mit dem inneren Auge seines Gedächtnisses. Wenn er sich nicht sehr eilt, wird es in wenigen Sekunden zu spät sein. Er leidet vor Ungeduld. Aber da er nichts findet, bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als seinen Weg fortzusetzen. Der Fremde ist vorübergegangen und hat nicht einmal seinen Schritt verlangsamt. Er aber, der seinen Blick nicht von dem Manne abwenden kann, bleibt stehen. Ohne Zweifel irre ich mich; wer könnte es denn sein? Nun entfernt er sich, aber der Zusammenprall war so stark gewesen, daß er noch immer sein Gedächtnis durchforscht. Einige Gesichter, auf die er den passenden Namen finden könnte, schaltet er aus. Dieser ist es nicht, jener auch nicht, wer denn also? Wer war dieser Mensch? Solange er seine Persönlichkeit nicht festgestellt hat, wird ihm ein unangenehmer Eindruck den Spaziergang verleiden. Irgendwie fühlt er, daß es für ihn wichtig sein würde, diese Spur aufzufinden. Der Mann ist jetzt in der Menge verschwunden. Vielleicht könnte er ihn noch laufend erreichen, unwillkürlich beugt sich sein Körper vor. Er wird immer ungeduldiger, und sein Gesicht verändert sich. Wer ist es, wer mag es nur sein? Es ist ihm unmöglich, sich zu erinnern. Er forscht in die Vergangenheit, von dem nicht geklärten Wunsche beeinflußt, diesen Mann wiederzusehen. Wie er so seine Nachforschungen pflegt, fühlt er, daß es „brandelt“. Er muß sehr weit in seinem Leben zurücksuchen, und plötzlich ist kein Zweifel mehr, er fühlt in sich einen starken Chok, und er erkennt endlich den, der eben an ihm vorübergestreift ist. Er hat sich allerdings verändert. Aber ein Irrtum ist ausgeschlossen, er war es sicher. Daß er ihn hat vorübergehen lassen! Einen seiner liebsten Menschen, der einmal sein täglicher Vertrauter gewesen war. Er eilt seiner Spur nach, stößt an jedermann an, aber die Menge ist plötzlich feindlich geworden und richtet sich hart vor ihm auf. Hat er denn mehr Eile als die andern? Nun sitzt er ganz fest in einem Knäuel von Leuten. Er will sie abschütteln, heimst aber nur ärgerliche Bemerkungen ein. Da er einen Streit voraussieht, schweigt er. Schließlich entkommt er, und es gelingt ihm, sich durch die Gruppen durchzudrängen. Die Hoffnung, den Mann noch zu entdecken, erscheint ihm plötzlich so märchenhaft, daß er die Suche aufgibt. Wie sollte er ihn in dieser zahllosen Menge wieder auffinden? Eine leichte Trauer befällt ihn, wie Ermattung. Er ist es müde, zwischen den Leuten so hinzugeben, er möchte sich auf eine Bank fallen lassen und lange nachdenken.
So nahe ist er an mir vorübergegangen, daß ich ihn hätte berühren können! Wird er ihn jemals wiedersehen? Schmerzliche Umstände hatten diesen Freund seinerzeit gezwungen, auszuwandern. Er erinnerte sich des Abends, wo er fortgegangen. Viele Menschen waren auf dem Bahnhof gewesen. Während die Abteiltüren zuklappten und die Angestellten hin und her liefen, hatten sie einander umarmt, dann war der Zug abgefahren. Einige Monate hindurch hatten sie einander geschrieben, dann waren sie beide lange ohne Nachricht gewesen, bis eines Tages ein Brief unbeantwortet geblieben, und da der letzte Verbindungsfaden auf diese Art zerriß, war einer für den andern nicht mehr gewesen als eine Erinnerung, die auf einer stummen Insel hinstarb. Jahre waren darüber hinweggegangen.
Und doch, welchen Kummer hatte er zur Zeit jener Trennung empfunden. Die neuen Freundschaften hatten ihn nicht hindern können, oft an den zu denken, der ihm verloren war. Im Geheimen seines Herzens bewahrte er ihm eine von Schwermut genährte Zärtlichkeit. Sie hatten den gleichen Enthusiasmus gefühlt, sie hatten wie Brüder gelebt, während einiger Zeit dieselbe Wohnung geteilt. Und heute hatten sie sich nicht wiedererkannt. Wo würde er ihn wiedersehen können? An welche Tür sollte er pochen? Er kannte weder seine Familie noch irgendeine seiner Beziehungen. Er sah keinerlei Ort, wo er ihm begegnen könnte. Niemand konnte ihm helfen, seine Spur zu verfolgen. Und dabei hatten seine Augen auf ihm geruht. Diesen Mann wiederzufinden, koste es was immer, war ihm die wichtigste und dringendste Sorge geworden. Aber wie, wie nur? Er wird ihn nicht wiedersehen. Das ist ganz sicher. Und dieser Gedanke war ihm unerträglich.
Die Menschen fluteten noch immer vorbei. Aber ganz in seine Gedanken verloren, sah er sie nicht mehr. Ja, die Berührung mit dieser Masse war ihm sogar unangenehm. Er bog um eine Ecke und schlug die Richtung nach seiner Wohnung ein. Mit gesenktem Kopf und unzufrieden mit sich selbst, schritt er hin. Wie konnte er auf den Zufall hoffen, ihm wieder zu begegnen? Sein früheres Leben erschien ihm wieder, kalt und wie dem Geschmack der erloschenen Zigarre vermengt, an der er zerstreut kaute. Sein Herz empörte sich.
Er erblickte den Mann wieder, wie er an ihm vorübergekommen war. Ganz deutlich sah er sein Gesicht, seine Krawatte und die Art, wie er ihn angeblickt hatte. Ein Staunen begann sich in ihm zu regen. Seltsam, er selbst hatte sich kaum im Lauf dieser Jahre verändert. Darüber waren alle Leute einig, und seine Porträts bewiesen es. Hatte sein alter Freund ihn wirklich nicht wiedererkannt? Ein Zweifel, der sich mehr und mehr bestärkte, setzte sich in ihm fest. Aber ja, ganz sicher hatte er mich erkannt. Ich sehe ja noch das Erstaunen in seinem Blick, aber ohne mit mir zu sprechen, ist er vorübergegangen. Er hat mich erkannt, aber mit Gleichgültigkeit, das ist die Wahrheit. Ob er denn auch in meinem Zögern die Absicht vermutet hat, ihn nicht erkennen zu wollen? Immerhin hätte ihn die Freude unserer Begegnung in meine Arme drängen müssen. Er hat Zeit gehabt, zu überlegen, aber er hat die Sachlage ganz kalt beurteilt. Er hat sich vielleicht gesagt: die zehn Jahre haben aus diesem früheren Freund einen Fremden gemacht, den ich nicht mehr anzusprechen wage. Was für ein Mensch mag er geworden sein? Welche Sorgen beschäftigen, was für Ziele locken ihn? Ich selbst habe ja nicht mehr die Wünsche von damals, und ich lächle, wenn ich an die Ideen denke, die ich früher verteidigte. Ich habe mich sehr verändert. Und er? Wenn er derselbe geblieben ist wie vor zehn Jahren, haben wir nichts Gemeinsames mehr. Und wenn er sich so sehr verändert hat, daß er ein ganz neuer Mensch geworden ist, ist er auch nur mehr ein Fremder für mich.
Er ist vorübergegangen, ohne stehen zu bleiben. Ohne Freude hat er mich wiedergesehen. Zweifellos hätte er mich angesprochen, aber meine Haltung entmutigte ihn. Er hat wohl einen Augenblick des peinlichsten Zögerns gehabt, als sich sein Schritt dem meinen näherte. Sollte er mich ansprechen, sollte er sich den Anschein geben, mich nicht zu erkennen? Er hat vielleicht meine Augen gierig belauert. Zwei Ströme haben sich berührt, ohne ihre Wasser zu vermengen. Zwei lebendige Menschen haben sich angeblickt, und jeder von ihnen hatte hinter sich einen toten Mann. Wie zwei Phantome haben sie sich einander genähert, um sich dann wieder in ihrer Nacht zu verlieren.
O Trauer, Trauer! Du alter Freund, der du, mich erkennend, nicht gedrängt warst, deinen Arm um den meinen zu schlingen, nie wirst du die Bitternis ahnen, die dein Vorübergehen in mir zurückgelassen hat. Und dennoch hätten wir vielleicht nicht lange gebraucht, um wieder die alten Gefährten von einst zu werden! Mit einigen guten Gesprächen und gegenseitigen Retouchen hätten unsere Seelen sich wieder gefunden. Du hast es nicht gewollt. Und diese Gewißheit ist mir jetzt so eingeprägt, daß vielleicht ich jetzt derjenige sein werde, der als erster den Blick senken würde, um dich nicht zu sehen, wenn ich dir an einem der nächsten Tage begegnen würde.
Als er die Straße erreichte, in der er wohnte, kehrte er nochmals um, um den Augenblick, wo er sich in seinem Zimmer mit seiner Traurigkeit allein befinden würde, hinauszuschieben. Er schlenderte noch einige Zeit in der Gegend seines Hauses umher, dann kam ihn die Lust an, alte Briefe zu lesen, gewisse Reliquien hervorzunehmen, die er fromm bewahrte.
Er schritt über die Schwelle seiner Wohnung mit der Absicht, demjenigen seinen einsamen Abend zu widmen, der beladen mit einem früheren Leben aus dem Vergessen und dem All herausgetreten war und sich dies eine Mal sogleich wieder, diesmal aber wohl für immer, darin verloren hatte.
Du bleicher Nachtwandler, gefoltertes Phantom, fern deinem Bette, wo dein schlummernder Körper, wie von dir selbst losgelöst, ausgestreckt liegt, irrst du um Mitternacht durch die Räume der schlichten Behausung. Die Mauern, die Decke, die Möbel, sie alle schlafen, aber du? Du hast dein Lager verlassen, um bis zum Morgenrot im Schattenreich des Schlummers und der Toten ein unruhevolles und wirres Leben zu führen. Unter deinen Füßen hat sich der Boden aufgetan, um tief in die Traumwelt zu sinken, und welch alte Dinge, — o wie alt sind sie — rauschen und weben in deinen Ohren. Wie ängstigst du dich doch, das Nebenzimmer zu betreten, wo das Dunkel mächtig ist wie ein Geist. Unter dem Teppich des Tisches ist es so stark und lebendig, daß du ein Unbekanntes nahen fühlst.
Wie spät mag es sein? In welches Jahr deiner Jugend bist du zurückgerückt? In Nebeln blitzt eine Klinge auf, und du denkst an Menschenmord. Aber du liebst deine Furcht und machst einen Schritt vor, um noch besser in sie einzudringen. Hier ist der Schlupfwinkel. Die Türe weitet sich, als könnte sie nicht länger mehr das geheime Schrecknis bewahren. Dort ist das Vorzimmer, das ganz mit Kleidern angefüllt ist. Ist denn die Türe geschlossen? Keineswegs, sie ist gegen die Stiege weit geöffnet, und zögernd steht dort eine gequälte Gestalt. Wie konnte die Tür sich öffnen? Unter welcher Blicke Macht? O wie gerne möchtest du imstande sein, sie zu schließen, es wagen hinzugehen, den Riegel vorzuschieben, um dann, an den Türrahmen gelehnt, tief Atem zu holen. Du weichst gegen die Küche zurück, läßt den Eingang nicht aus dem Auge. Nun schließt du die Türe und schiebst den Riegel vor. Aber die Küche ist von dem anderen Raum nur durch ein schwaches Eisengitter getrennt, und du fühlst dich nicht in Sicherheit. Du spürst, daß man dich nebenan belauert. So öffnest du denn das Fenster und suchst zu deiner Verteidigung im Freien einen Verbündeten.
Da draußen aber liegt nur ein armseliger Hof, und es ist tiefe Nacht. Zwischen zwei Mauern sieht man allerdings die dunklen Gärten und Schatten dort, die du zu erkennen versuchst. Am Fensterrand, den man mit einem Brett verbreitert hat, steckt ein Pinsel in einem mit Wasser angefüllten Gefäß und ein Blumentopf mit kärglichem Gartenkerbel, den der gefühllose Wind hin und her bewegt. Schnüre sind von der Schutzstange eines Fensters zu der eines andern gespannt; an Waschtagen hängt man daran Wäsche auf. Du erinnerst dich des Geruches nasser Leinentücher. An einem solchen Tag, abends, hatte sich die Frau aus dem Fenster gebeugt, um ihre Wäsche dort auszubreiten. Der Wind bewegte hinter ihr eine Kerzenflamme, und im Dunkeln hörte man sprechen. Etwa: „Das Wasser war so kalt, daß mir die Nägel zum Weinen weh taten.“ Oder: „Diese schmutzigen Schornsteine werden mir noch alles verrußen.“ Und dazu klatschte die feuchte Wäsche im Winde.
Da plötzlich streifte nun wie eine Hand ein Hauch deine Wange; eine zerbrochene Fensterscheibe war durch ein Stück Zeitungspapier ersetzt worden und wurde nun zeitweise vom Winde bewegt. Zwischen der Mauer und dem Büfett sitzest du, von irgendeiner Angst festgenagelt. Deine Beine sind nackt und du frierst. Der steinerne Ausguß ist sehr schmutzig, seine Quadern sind so ausgelaugt, daß sie einem alten Schwamm gleichen. Dem Wandkasten, wo Zwiebeln, Kartoffeln und Gewürze in Tüten aufbewahrt sind, entströmen Gerüche. Mit dem Blick biegst du den verbeulten Boden der Kasserolle gerade und besserst die abgeschabte Malerei der Mauer aus. Wenn du das Auge hebst, bemerkst du auch, daß die Blechschachteln auf ihrem Gestell nicht nach der Reihenfolge aufgestellt sind, und leidest an dieser Unordnung. Auch entsinnst du dich, daß eben noch auf der Straße das Gaslicht brannte; so wird denn die Nacht noch lange währen.
Von der sandsteinernen Wasserleitung, mit dem Relief eines Wasserträgers, fällt von Zeit zu Zeit ein Tropfen. Jetzt schüttelt der Wind, nahen Regen kündend, dir Tränen ins Gesicht.
Und du verharrst in deiner kindlichen Hilflosigkeit.
Die Stille hat alles eingefroren, und es ist dir, als wären in ihr die Menschen wie in einem Eisblocke und blickten nun daraus hervor. Du würdest alles, was du besitzt, dafür geben, diese Prüfung, die dein Herz grausigen Mächten in die Hände spielt, überstanden zu haben. Vor Tagesanbruch aber wirst du ihnen nicht entkommen. Vergeblich versuchst du, auf deinem Sessel einzuschlummern. Aber die Stille ist zu groß, als daß du dich dem Schlafe anvertrauen könntest: denn es ist eine Stille, in deren Inneres du wie in eine ausgestorbene Wüste schaust, in der sich keiner der Götter findet, die Furcht und Eitelkeit der Menschen erfunden haben. Du erschrickst über die Wichtigkeit deiner Entdeckung. Dies ist nun die Wahrheit, die so sehr gesuchte. Nichts ist da! Nichts! Was werden die Leute morgen dazu sagen, wenn du ihnen diese Nachricht entgegenschreien wirst? Welche Umwälzungen in der Welt! Es gibt nichts als das Nichts! Der Beweis ist erbracht. Der unwiderlegbare Beweis!
Die Schatten haben sich bewegt. Der bleiche Vorhang ist zurückgeschoben. Wie verbringst du jetzt deine Zeit? Den Schritt vorauszuspüren, der plötzlich die Stiege streifen, die genaue Stelle zu erraten, die das Papier am Fenster, wenn der Wind es in die Höhe hebt, berühren wird? Wie? Mache du vor allem keine Bewegung! Lenke die Aufmerksamkeit nur nicht auf dich! Verringere das Gewicht deiner Anwesenheit durch Unbeweglichkeit. Zieh dich im Raum zusammen! Schrumpfe in dich zurück! An der Wurzel schon schneide deine Blicke ab! Verschwinde in vollkommener Starrheit! Nun bist du nicht mehr und bist dir dessen bewußt. Oh, warum hast du mit diesem kleinen Geräusch deine Lippen genetzt? Der Zauber ist gebrochen; tausendfach läuft Furcht über deine Haut hin. Überall finden deine Blicke Nahrung der Angst. Du bist verloren. Das Ereignis wird eintreffen. Durch einen Windstoß hat sich das Fenster fast gänzlich geschlossen. Nie wirst du den Mut finden, es wieder zu öffnen. Jetzt klammern sich Finger an die Klinke der Tür . . . sie öffnet sich!
Erwachen! Es ist schon hellichter Tag. Reich an Verheißungen ist dieser Frühlingsmorgen. Unzählige Vögel zwitschern in den Bäumen. Flinke Räder geben den Wünschen eine Art Aufschwung. Die Glockentürme ragen auf, die Dome wölben sich, und die ganze Stadt wächst sichtlich unter dem Himmel empor. Was ist denn geschehen? Warum diese übernatürliche Freudigkeit in den Lüften?
Ich denke an den trüben Niederschlag, den die Nacht in mir zurückgelassen hat.
O du meine Seele, die ich nicht kenne und die mir kaum angehört, wohin hast du mich diese Nacht gezerrt? Viele dieser Erinnerungen, die du mir in den Nebeln des Traumes gezeigt, hatten vergessen in meinem Gedächtnis geschlummert; es gab solche, die mir seit vielen Jahren nicht mehr erschienen waren. Andere schließlich waren so verstümmelt, daß ich mich jetzt am Morgen frage, durch welchen bösen Zauber ich sie des Nachts so gut zu erkennen glaubte. Warum hast du den von Bildern bevölkerten Schlamm aufgestört, der sich wie ein tiefes Bett unter meinem Lebensstrom ausbreitet, warum hast du diese Dinge und nicht lieber andere an die Oberfläche aufsteigen lassen? Du, Herrin meines Körpers, nun bin ich voll schwerer Unruhe. Ich vermag fast nichts über dich. Du hast über meine Hellsichtigkeit ein tragisches Übergewicht. So entführst du mich oft in unbekannte Kellerräume, die aber immerhin noch Räume meines Wesens sind. Ja, ja, ich erkenne jetzt sehr gut diese armselige Wohnung mit ihrer Dunkelheit und diesen Hof, ich erkenne auch diese Frau, aber ihre Augen waren nicht so traurig und ihre Kleider verrieten nicht so viel Elend. Ich erinnere mich ihrer Worte, jene aber, die sie sprach, hatte nicht diese schmerzvolle Stimme. Du Unbekannte, die du hinter meiner Stirn eine Welt zu errichten vermagst, die nicht des Raumes bedarf, um zu bestehen, ich fürchte dich, da ich dich größer weiß als mich selbst. Wenn ich mich bezeichnen will, wenn ich, auf mich zeigend, ich sage, krampft sich meine Hand sogleich an meine Brust, und niemals berührt sie eine andere Stelle meines Körpers, niemals greift sie an die Stirne, die dein Sitz ist. Aus dieser Stelle, die meine Hand bezeichnet, aus diesem Mittelpunkt meines greifbarsten Ichs, fühle ich dich so seltsam fremd. Aber werde ich jemals wissen, was ich bin und wie weit mein Wesen reicht, was in mir mit sich selbst identisch bleibt, zwischen all dem täglichen Werden und Vergehen? Hier sind meine Hände, die Dinge greifen können, meine Augen sie zu umfangen, dies ist meine Stimme, die eine Folge von Tönen ist, in denen ich mich erkenne, aber du, wer bist du denn, die ich nicht in eine Form zu kleiden vermag, die sowohl ins Ungewisse mich hinstreuen, als auch in die zwiefache Vision des tiefsten Abgrundes oder des fernsten Sternes mich entsenden kann!?

Es war nichts Sonderliches an ihm, nichts unterschied ihn von anderen Menschen; sein Leben glich in allem dem der anderen. Er hatte eine schlechte Wohnung, deren Fenster auf einen Hof gingen. Auf der Straße war er ein Passant unter vielen, und niemand achtete seiner. Um sein Äußeres war er wenig besorgt, und selbst am Sonntag kleidete er sich ohne irgendwelche Phantasie. Seine Heiterkeitsausbrüche blieben diskret, er lächelte wohl manchmal, lachte aber niemals wirklich so recht herzlich.
Wie so viele Menschen verdingte er sich an einen Dienstgeber. Jeden Morgen stellte er sich ihm zur Verfügung und erhielt dafür ein wenig Geld, das ihm ermöglichte, sich ihm weiterhin zu verdingen. Im Grunde genommen war das zwar eine Art Fopperei, aber das Beispiel der anderen und auch die Gewohnheit ließen ihn darüber gar nicht nachdenken. So lebte er mit seiner Frau seit Jahren. War er glücklich? Er wußte es nicht und fragte sich niemals darüber. Er lebte einfach deshalb, weil er eines Tages geboren war, und beklagte sich nicht.
Aber seit einiger Zeit war er derselbe nicht mehr. Seinerzeit, vor vielen Jahren schon, hatte er sich hinreißen lassen, eine gemeine Tat zu begehen, deren er sich immer schämte, wenn er ihrer gedachte. Noch heute war es ihm unerklärlich, daß er so verächtlich hatte handeln können, war er doch ein anständiger Mensch, dem jeder niedrige Gedanke fremd war. Lange hatte ihm das Kummer bereitet, und eine Art traurige und erquälte Ernsthaftigkeit blieb davon in ihm zurück.
Zwei Personen hatten von der Sache gewußt. Die eine war verstorben, die andere hatte das Land verlassen und man hatte sie nie wieder erblickt. Eine dritte . . . aber wußte die wirklich etwas? Kürzlich hatte diese dritte Person allerlei seltsame Anspielungen gemacht. Zuerst hatte er an einen Irrtum geglaubt. Sie wußte sicher nichts, und hätte sie etwas gewußt, so würde sie es doch bei sich behalten haben. Was für ein Interesse konnte sie daran haben, ihn zu quälen? Diese Geschichte war begraben. Alle, die sie möglicherweise angehen mochte, waren verschwunden. Man konnte sie ihm vorwerfen, doch niemand besaß den geringsten Beweis, er brauchte bloß zu leugnen. Außerdem war er imstande gewesen, den verursachten Schaden teilweise wieder gutzumachen, und sein Opfer hatte ihm selbst vor dem Tode vergeben.
Aber diese Frau war schlecht und ließ es sich angelegen sein, Böses zu tun. Wozu wäre sie nicht imstande, wenn sie das Geheimnis besaß und sich daran berauschte, es mit ihm allein zu besitzen! Eines Tages war er fast sicher, daß sie es wußte. Wie hatte sie die Sache erfahren können? Vielleicht durch denjenigen, der ins Ausland gegangen war, und den sie, wie er glaubte, gekannt hatte.
Sie wußte es, und sie würde es seiner Frau sagen, seiner Frau, die er so sehr liebte und die ihn ohne Zweifel verstoßen würde, wenn sie seine Missetat erkundete. Vor allem würde sie es ihm nicht verzeihen, das Vertrauen verletzt zu haben, ihr nichts gesagt zu haben. Und sie besaß genügend Stolz, sich von ihm zu trennen. Jeden Tag beobachtete er sie sorgsam, ob sie noch nichts ahnte, ob die andere nicht schon Andeutungen gewagt hatte. Oh, er wußte sehr gut, daß die schreckliche Frau nicht auf diese Art sein Geheimnis preisgeben würde. Mit einem Schlage würde sie sich gewiß nicht dessen entäußern, was ihr wochenlanges Vergnügen bereiten konnte. Sie würde eines Tages so leichthin einige ausgesuchte Worte fallen lassen, einen Satz mit alltäglichem Tonfall, aber mit vieldeutigem Nachhall. Nachher würde sie über die Wichtigkeit erstaunt tun, welche die Angeredete ihren Worten beilegte. „Nein, sie hatte wirklich nichts sagen wollen, ach, welcher Einfall!“ Und die von ihr aufgestörte Seele würde sich wieder ganz und gar beruhigen. Dann, an einem anderen Tage, würde sie zwischen zwei süßliche Phrasen neuerdings einige Gifttropfen träufeln. Eines Tages dann würde entweder seine Frau sie zwingen, alles zu sagen, oder sie würde selbst, unfähig länger zu schweigen, die ganze Sache dummerweise viel früher erzählen, als sie es beabsichtigt hatte.
Seine Frau würde es wissen!
Täte er nicht besser daran, es ihr noch heute zu sagen. Seine Vergehung war nicht solcher Art, daß man sie nicht vergeben konnte. Sie würde ihm sicher Absolution erteilen. Doch nein, er hatte zu lange geschwiegen, er hatte zu sehr gezögert. Ja, er hatte es an Ehrlichkeit fehlen lassen, denn der Mann, den sie geheiratet hatte, war ihrer Ansicht nach kein Mensch, der dieses Unrecht hätte begehen können. Hätte sie, wenn sie es gekannt hätte, ebenso gehandelt? Er hätte es ihr gestehen sollen. Er erinnerte sich nicht mehr, daß eine sehr lebhafte Liebe und große Angst ihn davon zurückgehalten. Wie hatte er denn nicht daran denken können? Wie es vermocht, diese andere Unehrlichkeit zu begehen? Er hatte sich statt seiner einen neuen Menschen unterschoben. Niemals würde er den Mut haben, mit ihr zu sprechen. Aber er mochte auch nicht, wenn es eines Tages notwendig wäre, den Mut finden, zu leugnen oder zu lügen.
Die Dinge, die er liebte, verloren ihre Köstlichkeit. In ihm wuchs Leid. Abends bei Tisch, seiner Frau gegenüber, nach langem Tag, an dem er unaufhörlich sich gesagt hatte: Vielleicht heute abend — erlebte er alle Phasen der Beängstigung, der Beichte. Würde sie etwas sagen? Jedesmal wenn ihre Lippen nach einem Augenblick der Stille sich bewegten, griff Angst ihm ans Herz. Der Abend dehnte sich hin. Er sprach mit seiner Frau über die kleinen Ereignisse seines Lebens. Dinge, die ihre Wirtschaft betrafen, und plötzlich sagte sie, daß jene Nachbarin, die er so sehr fürchtete, sie besucht hatte und am nächsten Tag wiederkommen würde.
Manchmal brauchte er tausenderlei Vorwände, damit sie früher schlafen gehe als er. Er sagte, daß er ein wenig lesen, Ordnung in seine Papiere bringen wolle, einen Brief suchen müsse, auf den er zu antworten hätte. Sie hatte Ruhe nötig. Er riet ihr dringend, nicht auf ihn zu warten. Er bestand darauf, er sei nicht schläfrig und würde ziemlich lange aufbleiben. Er blieb dann stundenlang allein in seine Gedanken versunken. Die Lampe brannte auf einer Etagere, von der aus sie das ganze Zimmer beleuchtete. Der Herbst rückte vor. Es war noch nicht sehr kalt, aber in den Häusern war es feucht und abends heizte man ein. „Nur ein kleines Feuerchen“, sagte seine Frau. „Um das Blut ein wenig in Gang zu bringen.“
Er kauerte sich neben dem Ofen in eine Ecke und ließ von der Wärme eingelullt seine Gedanken schweifen. Der Wecker auf der Kommode schien irgendeinem Ziele zuzueilen. Im Hause war keinerlei Geräusch. Es war von Leuten bewohnt, die früh schlafen gingen und früh aufstanden.
Ohne seinen Traum zu unterbrechen, betrachtete er die Dinge, die ihn umgaben. Die unbeweglichen Stühle, den Tisch, die Nähschatulle seiner Frau, einen Fingerhut, die Zwirnspule. Sie hatte ihm heute nach dem Frühstück auf dem Flur gesagt: „Bring mir eine Spule von D. M. C. mit.“ (Dies war die Marke, die sie benützte.) Sie hatte ihm so herzlich zugelächelt, als sie um diese geringfügige Sache bat, daß er inmitten der dunklen Tage, die er jetzt durchlitt, eines der stärksten Glücksgefühle seines Lebens empfand. Er hatte ihr dann auch, als er sie verließ, um seiner Arbeit nachzugehen, den leidenschaftlichsten Kuß gegeben, den sie jemals von ihm empfangen hatte. Diesen Abend war es ihm auch wieder gelungen, allein zu bleiben. Es war spät, und er sann in der Stille des Hauses vor sich hin. Im Ofen erstarb das Feuer.
Seine Blicke fielen auf einen eingerahmten Stich, der an der Mauer hing. Peinlicherweise sah er ihn immer wieder, weil er sich an einem Platz befand, wo er ihn schwerlich vermeiden konnte. Er hatte immer dagehangen. Er sah ihn täglich, und vielleicht war dies der Grund, weshalb er ihn niemals gesehen hatte. Woher kam er eigentlich? Er erinnerte sich dessen nicht mehr. Immer war er ein Bestandteil ihres Hausrates gewesen. Wenn sie umgezogen waren, hatten sie ihn mitgenommen und neuerdings an die Mauer gehängt, ohne ihn eingehender zu betrachten, als eben nötig, um ihn nicht verkehrt anzubringen. Seit einigen Tagen betrachtete er ihn hartnäckig. Auf einem Hügel befand sich da eine Hündin von mehreren Jungen umgeben, zwei andere junge Hunde versuchten ihr zuzuschwimmen, kämpften im dunklen Wasser, das den Hügel umgab. Überschwemmung war der Titel. Er wurde nicht müde, den Stich zu betrachten. Die Verzweiflung der Hündin, die gegen den fahlen Himmel anschlug, wurde ihm für Augenblicke unerträglich.
Seine Frau erwachte, bemerkte durch die halbgeöffnete Tür das Licht und rief ihm aus dem Nachbarzimmer zu:
„Komm doch schlafen, du wirst morgen müde sein.“
„Ja, ich komme schon, ich bin bald fertig.“
Und er blieb sitzen, unfähig, seinen Gedanken zu entfliehen. Nach längerer Zeit erwachte seine Frau von neuem und rief ihm in ärgerlichem Ton zu: „Du bist wirklich unvernünftig.“
Er legte sich schlafen, ohne zu einem Entschluß gekommen zu sein.
Ein Leben umfing ihn, in dem der Traum die Wirklichkeit beherrschte. Die Leute, die mit ihm verkehrten, sahen, wie sein Blick sich mit neuen Dingen füllte.
Eines Tages, in der Dämmerung, kehrte er aus seinem Bureau heim. Er ging einen Boulevard entlang, der von Privatbesitzungen gesäumt war. Ein Straßenräumer fegte den dicken Teppich der Blätter und sammelte sie zu einem rauschenden Haufen. Er blieb stehen, um ihm zuzuschauen, empfand wieder eine aufrichtige Freude, die Erde, die so lange unter den Blättern begraben gewesen war, zu erblicken. Der Boulevard würde bald in seiner ganzen Länge so rein aufgekehrt sein, wie auf diesem Platz. Die wieder aufgedeckte Erde war feucht und wie zernagt von den unzähligen Insekten, die er umherlaufen sah. Er verfolgte den Kampf einer Ameise mit einem ungeheuren Gegenstand. Er blieb so lange unbeweglich, daß der beunruhigte Straßenkehrer sich näherte, um zu sehen, was er mit so viel Aufmerksamkeit betrachtete. Aber schon seit einigen Minuten sah er weder die Tiere noch die Erde mehr. Das Antlitz, das er dem Manne zuwandte, war so leidvoll, daß dieser sprachlos stehen blieb.
Er dachte daran, zu verschwinden, sich zu töten.
Das Antlitz seiner Frau blieb so friedlich, wie er es immer gekannt hatte. Sie widmete sich mit derselben Sorgfalt dem Haushalt und schien nichts von ihrer früheren Fröhlichkeit eingebüßt zu haben. Wenn er abends heimkehrte, sah er sie unter der Lampe nähen. Sie tauschten den Begrüßungskuß. Sie erhob sich, stellte wieder die Lampe auf die Etagere und deckte den Tisch. Während sie das tat, sprach sie mit ihm, blieb zuweilen einen Augenblick still und erwartete mit aufmerksamem und lächelndem Blick seine Antwort. In ihrer Haltung war ganz und gar nichts, woraus man hätte schließen können, daß sie das Geheimnis kannte. Ja, vielleicht bewies sie ihm mehr Zärtlichkeit als früher.
Und dennoch hatte die andere gesprochen, dennoch wußte sie!
Es war anfangs sehr hart für sie gewesen, diese Sache zu tragen. Plötzlich war ihr das Wesen, mit dem sie seit Jahren lebte, wie ein Fremdes erschienen. Als sie ihn so plötzlich für verächtlich und niedrig gehalten, hatte sie sich gesagt: ich werde morgen von ihm gehen. Er hatte kein Vertrauen gehabt! Er hatte ihr nichts gesagt, und doch mit welcher Freude hätte sie ihm verziehen. Warum hatte er geschwiegen? Warum sie getäuscht? Dann hatte sie die Überlegung zu einer richtigeren Auffassung seines Benehmens geführt. Er hatte nichts gesagt, weil er sie so sehr liebte und Furcht gehabt hatte. Daran konnte sie nicht mehr zweifeln. Zweimal war er schwach gewesen, nichts als schwach. Und wenn sie an die liebevolle Feigheit dachte, die er ihr bewies, stieg Freudenröte ihr ins Antlitz. O teurer Freund, sei ohne Angst. Sie, die du erwählt hast, mit ihr ein Leben zu verbringen, sie verdammt dich nicht. Sie zürnt dir kaum, daß du an dem Reichtum ihres Herzens gezweifelt hast. Du kennst sie so wenig, und doch hast du sie erwählt. Ich erinnere mich, mit welch rührender Schüchternheit du in den ersten Tagen unserer Begegnung mit mir gesprochen hast. Und ich habe das Beben nicht vergessen, das dich durch und durch bewegte, als du mich um das batest, was mein Herz dir längst geschenkt hatte.
Wenn sie sich ihm gegenüber befand, dachte sie: Du magst mich ansehen soviel du willst, du wirst nicht die mindeste Spur meiner Mitwisserschaft entdecken. Drücke meine Hände, schließe mich in deine Arme, du wirst nichts in mir finden, was dir fremd geworden ist und dir entfliehen will. Diese dumme Person hat ihre Zeit verloren, als sie versuchte, dich in meinen Augen herabzusetzen. Damit du nicht aufmerksam wirst, werde ich sie nicht hinauswerfen. Einige Zeit werde ich sie noch herkommen lassen, dann werde ich sie nach und nach entfernen, und es wird von all dem nichts mehr übrigbleiben. Freund, treuer Freund, du mein unentbehrlicher Gefährte, erkenne deine Frau besser. Noch ganz andere Dinge hätte sie dir verziehen. Sei denn beruhigt. Du wirst es nicht erfahren, daß dein Geheimnis in mir begraben ist. Niemals wird zwischen uns davon die Rede sein.
Tage vergingen, ohne daß der Friede des Haushaltes durch irgend etwas gestört wurde. Er entfernte sich morgens, um ins Bureau zu gehen, kam zum Mittagessen nach Hause und blieb dann wieder bis zum Abend aus. Sie räumte die Wohnung auf und ging dann einkaufen. Sie nähte, bügelte, las ein wenig. Zu den Mahlzeiten fand er sie sorgsam frisiert, mit bloßen Armen und Hals und in einem immer reinlichen, hübschen Schlafrock.
Die „Andere“ kam von Zeit zu Zeit, um den Gang der Dinge auszuspüren. Sie hoffte immer, daß auf dieses glückliche Paar die Endkatastrophe hereinbräche, die ihr eine Freude bedeuten würde. Aber sie wurde mit demselben Lächeln empfangen wie früher und verstand nicht. In dem Maße, als ihr selbst dieses Unternehmen langweilig wurde, verringerten sich ihre Besuche.
Er verlebte düstere Tage. Der Verurteilte in seiner dumpfen Zelle, nicht endenwollende Stunden damit verbringend, in Gedanken seine eigene Gruft zu bauen, war weniger unglücklich als er. Das konnte so nicht andauern. Alles war einem solchen Leben vorzuziehen.
Jeden Morgen sagte er sich: ich lasse mir noch einen Tag Zeit zu überlegen, um einen Entschluß zu fassen. Wenn ich morgen, nach dem Nachtessen, nichts gesagt haben werde, wenn ich nicht den Mut gehabt habe zu gestehen, werde ich fortgehen und mich ins Wasser stürzen. Der nächste Tag kam. Er dachte von neuem wie am Abend zuvor. Da sie nichts weiß, wird sie vielleicht nie etwas wissen. Ist es also nötig, zu versuchen? Zweifellos nein. Überdies bin ich es nicht mehr imstande. Oh! Elend. Wie aus dieser Situation herauskommen? Wäre denn nicht seine einzige Rettung die Selbstvernichtung? Eine banale Zeitungsphrase, die ihm beim Lesen der vermischten Anzeigen aufgefallen war, kam ihm unaufhörlich in Erinnerung:
„Er hatte ein Unrecht begangen, aber er hat es bezahlt. Breitet den Mantel des Schweigens über ihn.“
Ich werde mich ins Wasser stürzen, und damit wird es ein Ende haben. Der Abend kam. In Augenblicken, wo sie beide still blieben, sagte er zu sich selbst: nun so fang doch an, jetzt ist der Augenblick. (Die Stille dehnte sich hin.) Beginn doch, Feigling. Auf was wartest du? Seine Frau hob den Kopf und sprach irgend etwas. Er antwortete eilig und leichthin, glücklich, einen Vorwand gefunden zu haben, um den Augenblick seines Geständnisses verzögern zu können. Und er sagte zu seinem Gewissen: dieses Mal ist es nicht meine Schuld. Du bist mein Zeuge, daß ich den Mund soeben öffnete, als sie zu mir zu sprechen begann. Ich mußte ihr ja doch antworten. Ein neues Schweigen setzte ein. Er sagte immer noch nichts. Und er blieb so bis zu dem Augenblick, wo er aufstand, von Verzweiflung übermannt. Sie ganz in ihrer Rolle aufgehend, ihn nur ja recht gut zu behandeln, ja innerlich glücklich, daß ihr das so gut gelang, so glücklich, daß sie zuweilen wie ein Kind in die Hände klatschte, sobald er gegangen war. Sie ahnte nichts von dem Drama, das sich in ihm abspielte. Sie sagte sich: wie leicht fällt es mir, dieses Geheimnis zu bewahren. Ach, er wird niemals etwas erfahren! Der arme Schatz!
Und sie sagte ihm Worte der Zärtlichkeit, die sie noch niemals gesagt hatte.
Diesen Abend wird er sprechen oder sich töten. Er wußte, daß ihn diesmal nichts mehr verhindern konnte. In seiner Westentasche befand sich ein Brief, den er nachmittags in seinem Bureau geschrieben hatte. Er setzte darin seiner Frau die Gründe seines Selbstmordes auseinander. Er hatte geweint, als er ihr schrieb. Den ganzen Tag über hatte er sich am Rande des Wassers gesehen. Wie würde er es anstellen? Wird er sich nach vorwärts, seiner ganzen Länge nach, mit großem Lärm ins Wasser werfen, oder wird er sich über die Böschung lehnen, um mit geschlossenen Augen sanft hinunterzurollen? Er könnte auch hinknien . . . Wie schwer mußte es einem werden, sich in dieses Wasser zu werfen. Er empfand das Gefühl der ersten Berührung mit dem Wasser. Würde er bis zum letzten Augenblick an seine Frau denken können? Würde er die letzte Klarheit seines Bewußtseins ihrem Gedächtnis widmen? All dies beunruhigte ihn sehr.

Er hatte sich eine Taktik ausgedacht, um zu erfahren, was sie über eine Verfehlung wie die seine denken mochte. Er würde ihr ungefähr seine eigene Geschichte erzählen, jedoch so, daß er sie einem seiner Bureaukollegen zuschrieb. Er würde ihre Meinung mit einer vorgespiegelten Teilnahmslosigkeit einholen. So würde er erfahren, ob er die Maske fallen lassen könnte, oder ob er sterben müsse.
Sie saßen einander am Tisch gegenüber. Er hatte darauf bestanden, daß die Lampe zwischen ihnen stehen blieb. (In dem Schatten, der über dem Lampenschirm herrschte, würde er mehr Mut haben zu sprechen.) Seine Frau aß langsam ihre Suppe, indem sie gemächlich über jeden Löffel hinblies. Er blieb unbeweglich, den Hals wie zugeschnürt, er streckte sich, und wie man gewaltsam ein Tier am Halse nimmt, überwand er sich und zwang sich den Mund zu öffnen. Irgend etwas stach ihm über das ganze Gesicht.
„Weißt du, dieser Mensch, der da neben mir im Bureau arbeitet und von dem ich dir so oft erzählt habe?“
„— Nun? Nun?“
„Schöne Sachen hat man über ihn gehört. Eine unglaubliche Geschichte!“
„Ach!“ Sie sah ihn an, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt. Er sprach mit gesenktem Haupte.
„Seine Frau wird ihn verlassen. Sie hat recht. Denk dir nur, bevor er sich verheiratete . . . dieser Elende.“ (Er zitterte so sehr, daß er kaum sprechen konnte.) . . . „wie kann man nur so seine Frau hintergehen! . . . hat dieser unanständige Mensch eine Niedrigkeit begangen, von der ich dir jetzt erzählen werde —“
Er hielt inne, um Atem zu schöpfen. Der Schweiß perlte ihm schon aus der Stirne. Die große Stille ließ ihn den Kopf emporheben. Er sah, wie sich seine Frau vom Sessel erhoben hatte und, beide Hände auf den Tisch gestützt, ihn betrachtete. Die Lampe erhellte ihr Gesicht von unten nach oben her. Auf ihren Wangen lagen Schatten und Ränder roten Lichtes um ihre Augen, aus denen seltsame Blicke fielen. Diese Blicke flehten ihn an, inne zu halten.
Er verstand augenblicklich. Sie wußte es und hatte nichts gesprochen. Nun? So hatte sie ihm denn verziehen! Er stand auf, sie trat einen Schritt zu ihm und umarmte ihn mit aller Kraft.
Nach einem langen Schweigen flüsterte sie ihm ins Ohr.
„Wir werden niemals mehr darüber sprechen.“
Er war des Morgens viel früher erwacht als gewöhnlich, hatte in seinem Bette lange gesonnen, sich hin und her gedreht und sich nicht entschließen können, aufzustehen.
„Elende Schindmähre, wie widerlich ist doch dein Leben! Jahr um Jahr rackere ich mich nun zu Tod für andere, ohne nur einen Schritt weiter gekommen zu sein als am ersten Tage. Jeden Morgen setze ich mich gezäunt und aufgetakelt, mit gut geöltem Kopf und Gliedern für mein Tagewerk in Bewegung. Dieses Kalb von einem Hausmeister wirft mir im Vorübergehen (er vergißt es nie) die wenigen Worte zu, die er mir schuldig zu sein glaubt: ‚Der Herr ist heute spät daran‘, oder auch: ‚Der Wind hat sich gedreht, wir werden wieder Regen bekommen‘. Mit welchem Hochgenuß würde ich ihn mit meinem genagelten Absatz zerquetschen, diesen kriechenden Hund! Jeden Tag durchquere ich dieselben Straßen und begegne denselben Dummköpfen. O Schrecken, mehr Schilder, als mir lieb ist, kenne ich auswendig. Ich setze mich auf den Stuhl, der mich an meinem Schreibtisch erwartet, und ärgere mich, wenn man ihn mir ausgetauscht hat. Ich hasse denjenigen, der mich angestellt hat, weil meine Armut ihm Macht über mich gibt, und er seinerseits verachtet mich, weil ich von ihm abhänge. Nur abends lerne ich ein wenig Vergnügen kennen, wenn ich für einige Stunden meine Fron verlasse. Ich schleppe mich durch die Straßen, bleibe vor den Auslagen stehen, dränge mich hinzu, wenn Menschen sich irgendwo ansammeln. Ich gestehe, daß ich zuweilen ein angenehmes Kitzeln empfinde, sobald ich allein in meinem Zimmer bin. In meinen vier Mauern bin ich Buddhist, Herr eines Besitzes, der nur mir gehört. Ich lese. Ich kann nachdenken. Endlich fühle ich, daß ich lebe, für kurze Zeit zwar nur und beinahe wie durch Betrug, aber doch lange genug, um diese Annehmlichkeit zu genießen. Der Kaffee, den ich mir selbst zubereitet habe, hat einen besonderen Geschmack. Er hat das Aroma meiner Freiheit. Aber bald flutet mir wieder die unendliche Traurigkeit meines Lebens zu. Wird es sich denn niemals wandeln? Werde ich immer Sklave sein? Ich verzögere den Augenblick, mich schlafen zu legen, um die Zeit meiner Freiheit vor der Sklaverei des kommenden Tages zu verlängern. Wenn ich in mein Bett gehe, habe ich den Eindruck, daß dieser verhaßte kommende Tag bereits da ist. Wird es mein Los sein, zu krepieren, ohne gelebt zu haben? Ich war für Abenteuer geboren, für kühne Unternehmungen, und ich verkomme allmählich in verelendender Geruhsamkeit. Als ich jung war, erwartete ich dumpf etwas. Nun sind es bald vierzig Jahre her, daß ich mich um tägliches Brot mühe. Wofür? Nichts Gutes ist gekommen und wird jemals kommen. Ich langweile mich. Ich langweile mich bis zum äußersten. Immer allein, allein, allein. Kein Frauenzimmer, keinen Trinkkumpan. Vorzeiten habe ich eine Freundin gehabt; als ich ihr das letztemal begegnete, fühlte ich, daß sie mir ebenso fremd geworden war wie jener Stern, dessen Licht noch nicht bis zu uns gedrungen ist. Diese Tausende von Lebewesen, die sich um mich her bewegen, vermehren nur meine Einsamkeit. Ich bin und bleibe für jeden von ihnen isoliert. Es gab Monate, wo ich auch nicht einen Brief bekommen habe. Nicht einmal irgendeinen kleinen Prospekt hatte man den Einfall, mir zu senden. Es würde mir wohlgetan haben zu wissen, daß mein Name irgendwo bekannt ist. Jedesmal, wenn jemand auf dem Gang geht, halte ich den Atem zurück, denn ich glaube immer, daß man zu mir kommt. Ah, da bin ich aber schön hineingefallen! Hundedasein! Ich habe es satt. Das muß anders werden. Koste es was immer. Und zuvörderst, um damit zu beginnen, bleibe ich im Bett. Ich werde zu spät kommen, und sie werden mir Geschichten machen; meinetwegen, pfeife drauf. Versteht ihr: Ich pfeif auf euch!“ Er machte es sich noch bequemer im Bett. „Schließlich und endlich bin ich ja frei. Wenn sie mich während fünfzehn Jahren gehabt haben, geschah es mit meinem guten Willen. Heute verweigert der Narr den Dienst und wird widerspenstig. Bréhaigne & Lecoultres, Maschinenwerkzeugfabrik? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht, sage ich und pfeife darauf. Ich verantwortlich? In dieser Gott-sei-bei-uns-Fabrik? Ihr irrt euch, meine Freunde. Ich bin freier Mensch; um es euch zu beweisen, werde ich den ganzen Tag spazierengehen. Gestern war erst Sonntag, sagt ihr? Nun, heute wird wieder Sonntag sein. Und wenn einer unter ihnen ist, der sich räuspert, trotz des Respektes, den ich euch schulde, wird man ihn, wohlverstanden, von der Höhe des Eiffelturmes von oben bis unten begießen.“
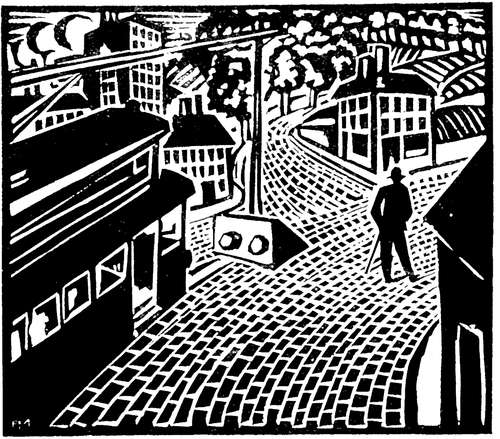
Er hatte vormittags blauen Montag gemacht, sich dann sorgfältig angekleidet, nachdem er zuvor mit den Fingern jedes Stäubchen auf seinem Rock wegschnippte.
Nach einer Tramwayfahrt, die ihm schier endlos erschien, war er an die äußerste Stadtlinie gelangt und hatte an der Straßenkreuzung nach einigem Zögern schließlich jenen Weg gewählt, den bereits andere Personen eingeschlagen hatten.
*
Am Rande des Dorfes, fast schon am Eingang des Waldes, liegt eine kleine Herberge mit braun geziegeltem Dache, wo man zu Fuß oder zu Pferd absteigt. Sie ist fast nur von den Fuhrleuten der Ostgegend besucht. Während der Woche ist selten jemand im großen Saale, denn die Stammgäste essen im Schankzimmer, wo es mehr Leben und Heiterkeit gibt.
Er hatte in diesem Saal gefrühstückt und schien nicht mehr weggehen zu können. Er blieb da vor seiner geleerten Kaffeetasse in seine Gedanken vertieft. Auf dem Wachstuch des Tisches sammelte er sorgfältig Brotkrümchen zu Formen und Buchstaben, zerstreute sie dann mit dem Finger und begann dieses kindliche Spiel von neuem. Er hob den Kopf. Seine Blicke liefen über die Fläche der Mauer, senkten sich aber rasch wieder, denn er kannte schon alles, was dort hing. In einer Ecke des Raumes lagen auf einer Nähmaschine einige Zeitungen. Er stand auf, nahm eine, dann eine andere und legte sie zurück, kaum bemerkte er, daß sie ein altes Datum trugen.
Schließlich verlangte er die Rechnung, zahlte und ging fort.
Bei schönstem Sonnenschein hatte er die Herberge betreten. Nun war der Himmel mit Wolken bedeckt. Alles hatte seine Farben verändert. Ein Unbehagen lastete auf der Landschaft. Er schlug den Weg zum Wald ein. Über kleine Pfade ging er, drang ins Dickicht, wo die Blätter des vergangenen Herbstes faulten, umging kleine Teiche, fand Pfade wieder, als ihm plötzlich der Weg durch einen Fluß gesperrt war. Er sah klares Wasser fließen und ging weiter seinem Lauf entlang.
„Ich werde ihnen sagen, daß ich krank gewesen bin.“
Er war gewiß der einzige Spaziergänger in diesen öden Wäldern und fühlte sich von Einsamkeit und Stille bewegt. Mit vollen Zügen atmete er den Waldesduft und freute sich an dem Geräusch seiner Schritte, die trockene Blätter aufrauschen machten und Zweige zerknackten. Das Wasser wurde bald dunkler, da der Fluß hier schon viel tiefer war.
„Wenn ich es wollte, wäre es bald vorüber.“
Ein Teppich frischen Grases breitete sich vor ihm aus, er setzte sich. Bäume wölbten sich über seinem Haupte, und Äste streiften die Wellen. Ein irdisches Geheimnis schien an diesem Orte zu wohnen. Hier war das Leben nicht eine Folge verschiedener Zustände, die Dinge schienen in Unbeweglichkeit versteinert, die sich bis ins Unendliche dehnte. Allerdings empfand er, seitdem er seine Wohnung verlassen hatte, sein Leben gleichsam zurückgedrängt und von Träumen niedergehalten. Die Luft war milde und ohne jegliche Regung, der Himmel grau. Alle Bewegungen waren von einer gewissen Müde erfaßt. Die Menschen, denen er begegnete, zeigten düstere und resignierte Gesichter; keinerlei Schwung, keinerlei Plötzlichkeit war in ihren Gesten. Das war wirklich so ein Tag, wo alles sinnlos wird und die Zuversicht so tief gesunken ist, daß niemand mehr an seinen Beruf glaubt. Das Leben scheint an seine Grenze gelangt und nur aus Gewohnheit fortzudauern.
Der Montag allerdings ist ein trauriger Tag. Er ist wie die Bahre, auf die man den Leichnam des schönen Sonntags hinbettet. Er ist der erste der sechs Tage, die man Stunde für Stunde hinzubringen hat, der sechs Stahlblocke, die man mit der Feile in Staub verwandeln soll. Endlos sind die Minuten, aus denen er sich zusammensetzt. All jenen, die für andere arbeiten, ist der Montag ein Tag, an dem Freude fast ausgeschlossen. Selbst freie Menschen können sich diesem Eindruck nicht entziehen.
Er lag auf dem Rücken ausgestreckt und sah durch das Blätterwerk die lässigen Wolken vorüberziehen. Um ihn war ein großer Kreis von Stille, dessen Grenzen von Zeit zu Zeit durch entfernten Lärm getrübt wurden. Frische hüllte ihn ein, und der schwere Duft des Humus berauschte ihn.
„Seltsam. Seltsam. Ich bin doch so oft Sonntags spazieren gewesen, ohne diese Wirkung zu verspüren. Ich glaube, ich bin ein anderer Mensch geworden. Bei Gott, ich weiß warum. Der Sonntag ist ein Tag unbestimmter Freiheit und ohne besondere Köstlichkeit. Ein öffentliches Glück. Ich gehe noch weiter: der Sonntag ist nichts weiter als eine dicke Allerweltsdirne. Ein Vergnügen, das jedermann zugänglich ist, hat mich immer abgestoßen. An einem Wochentag spazierenzugehen, während die anderen Sklaven an der Arbeit sind, dies allein ist ein Zeichen der wahren Freiheit, der Freiheit des Luxus, der Freiheit des Reichen, des selbständigen Menschen.“
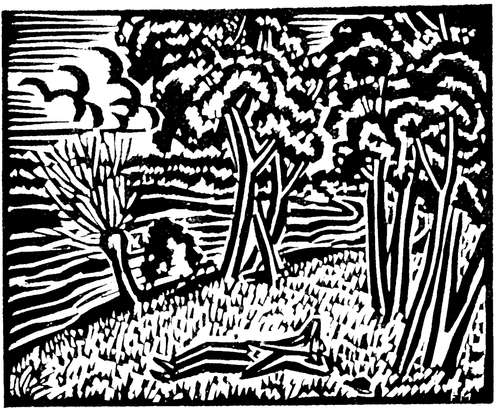
Aber man ist nicht ungestraft während fünfzehn Jahren ein pünktlicher und untergebener Beamter gewesen. Und ohne daß er es wußte, begann ein Vorwurf sich in ihm zu rühren. Er hatte einen Gewaltstreich gemacht, den er ohne Zweifel zu bereuen haben würde. Gerade an diesem Tag erwartete ihn heikle Arbeit in seinem Bureau, eine Arbeit, die niemand so gut verrichten konnte als er.
„Und das Aktenstück Dumas“, rief er aus, und schnellte auf. „Mein Gott! Sie werden sicher vergessen, es abzusenden. Das wird eine schöne Geschichte geben. Ich hätte vielleicht meinen Streich auf morgen verschieben sollen. Dumm, daß ich nicht daran gedacht habe. Dieses leidige Schriftstück wird mir meinen Tag verderben.“
Da ließ sich weiter nichts mehr tun. Diese Dummheit war nicht mehr gutzumachen.
„Na, und wenn schon, ich wette, sie werden einen Ausweg finden. Schade darum. Warum denn schade? Ich scher mich nicht darum. Ich scher mich einen Schmarren darum.“
Er fühlte sein wohl bestelltes Portemonnaie in der Tasche und hatte den Einfall, sich irgendwo, einerlei wo, ein wenig zu amüsieren. Er trat aus dem Walde, überquerte den Fluß und ging an seinem Ufer hin. Eine unglaubliche Anzahl von Anglern sah er dort und eine noch viel größere Zahl müßiger Zuschauer, die längs der Böschungen im Grase lagen und aufmerksamen Auges die von der Strömung mitgeführten Schwimmer an den Angelschnuren verfolgten. All diese Leute arbeiteten gleich ihm nicht und widmeten sich nur ihrem Lieblingsvergnügen. Er hatte niemals gedacht, daß es deren so viele gab.

„Der Montag ist also doch nicht für jedermann ein trauriger Tag, es ist so wie in allem und jedem, es gibt auch hier Ausnahmen. Ich bin bis heute immer ein richtiger Idiot gewesen.“
Die Töne eines Orchesters zogen ihn an.
Er befand sich schließlich vor einer großen Gastwirtschaft, die sich längs des Flusses hinzog. In schönen gelben Lettern auf grünem Grunde las er:
Ball der Artilleristen.
Weinfisch und gebackene Seinefische.
Möblierte Zimmer.
Auf einem Wandbild war ein prächtiger Artillerist in Gala aufgemalt. Seine weiß behandschuhten Hände waren über dem Säbel gekreuzt, den er zwischen den Beinen hielt. Er trat ein und durchquerte einen großen Garten, der durch Lauben geteilt war, unter denen ein glückliches Völkchen lachte, trank und aß.
„Hier gibt es doch noch mehr, als man glauben würde, von solchen, die sich nichts daraus machen!“ Vor ihm war eine lange Bretterbaracke, an den Seiten gegen den Garten geöffnet, auf einer Estrade ein Orchester, Paare, die sich heftig nach dem Rhythmus der Polka der kleinen „Pierrots“, die er wiedererkannte, bewegten, und der Ballsaal. Dirnen minderer Gattung, junge Arbeiter mit Mützen und einige Soldaten bildeten die Gesellschaft. Die müde waren, Polka zu tanzen, tranken an den Tischen längs des mit Wappen und Fahnen geschmückten Saales. Er sah den Tänzern zu, die wie in Spiralen ineinander gewunden waren. Die Beine der Männer keilten sich frech in die Frauen, die, den Kopf nach rückwärts geworfen, die Augenlider hoben und senkten. Die runden Brüste bebten. Die Röcke flogen weit hin, entblößten die Strümpfe, und zuweilen blitzte ein weißes Stück Fleisch unter einem Gewirr von Spitzen hervor. Er stieg wieder in den Garten hinab und suchte sich eine abgelegene Laube. Eben wurde eine frei, die ein Liebespaar auf dem Wege nach dem möblierten Zimmer verließ. Sie stellte eine Champagnerflasche im großen dar. Das Gitter, woran die Schlingpflanzen hinaufkletterten, ahmte recht deutlich ihre Form nach, und die Spitze, die in einem Holzpfropfen auslief, der aus einer Blechmanschette hervorkam, täuschte die Flasche ausreichend vor. Er ließ sich nun eine Flasche Wein und einen Backfisch geben. Nachdem er die Kartoffeln verzehrt hatte, zündete er sich einen Stumpen an und zog die Uhr. Erst drei Uhr! Er war erstaunt, wahrzunehmen, daß die Zeit im ganzen weniger schnell verging als im Bureau.

„Da schau her, da wird nach Schweizer Art getrunken? So gehört sich’s ja gar nicht!“
Ein Soldat, ein Artillerist, steht, noch vom Tanze schwitzend, vor ihm. Recht sympathisch sah er aus, und so freute er sich denn seiner Vertraulichkeit.
„Allein trinken schlägt nicht an, da geht das Beste verloren.“
„Ich kenne niemand hier.“
„Stimmt, ich habe Sie noch niemals gesehen. Wir sind hier im Artilleristen fast alle Stammgäste, man kennt sich untereinander, wissen Sie! Ist es erlaubt?“
Und der Soldat setzte sich zu ihm an den Tisch.
„Ein Glas Wein gefällig?“
„Nein, ich danke, ich setze mich nur hierher, weil ich mir hier in der ‚Flasche‘ Rendezvous gegeben habe; sie wird gleich da sein.“
„Ist wohl Ihre Liebe?“
„Ah, nein, nur so zum Amüsieren, fürs Herz habe ich eine vom Land, die mir jede Woche schreibt. Wenn man Dreijähriger ist, darf man sich nicht unterkriegen lassen. Ich bin Magazinwärter, das ganze Bataillon ist heute auf Felddienst, und weil ich nicht mittun muß, benützte ich gleich die Gelegenheit, davonzusegeln. Ich muß auf der Hut sein, daß ich nicht abgefaßt werde.“
„Einen Schluck können Sie doch mit mir trinken.“
„Wenn Sie darauf bestehen!“
„Was sind Sie im Zivil?“
„Rechnungsführer!“
„Rechnungsführer? Das ist stark, ich auch! Ich bin bei Bréhaigne & Lecoultres.“
„Maschinenwerkzeuge? Das ist mein Fall“
„Sie kennen sie? Feine Sache! Das ist einmal ein Zusammentreffen!“
„Ich habe einen Spezi, der dort sitzt, Charles Courolle, Karlchen, ein kleiner Brünetter mit unruhigen Augen. Wissen Sie, welchen ich meine?“
„Was arbeitet er?“
„Aufsteller!“
„Wie Sie wissen, sind bei Bréhaigne & Lecoultres 600 Arbeiter, da kann ich nicht alle kennen!“
„Das tut mir für Karlchen leid. Ein verbitterter und grindiger Kerl! Wenn er es auf jemand abgesehen hat, steigt’s ihm gleich in den Schädel. Wie ein Halunke sieht er aus, trotzdem aber ist er ein guter Kamerad. Ihn geht man bestimmt nicht vergeblich um einen Freundschaftsdienst an, er läßt einen nicht im Trockenen.“
„Noch ein Glas, aber die Flasche ist ja leer! Kellner!“
„Jetzt bin ich dran!“
„Aber nein, lassen Sie doch.“
„Nicht zu machen, Kellner, eine Flasche Rotwein, Bouteillenwein vom feinsten, an jeden kommt die Reihe, ich bin für Gleichheit. Na, ist es also das erstemal heute, daß Sie in den ‚Artilleristen‘ kommen?“
„Mein Gott, ja.“
„Und Sie ergeben sich da dem stillen Suff. Haben Sie denn kein Mädel? Nein so etwas! Da staune ich. Armer Kerl! Da muß Ihnen geholfen werden. So etwas braucht ja der Mensch, man muß doch auch etwas Tröstliches haben im Leben, man kann nicht immer wie ein Wilder allein in seinem Winkel sitzen. Und dann auch aus Gesundheitsrücksichten! Auf die Ihre! Trinkkumpan, was! Wir sind jetzt Trinkkumpane — da ist schon meine kleine Kröte. Ein gutes Ding und nicht zu derb, sie kommt da mit zwei Kommißknöpfen.“
Das Mädel näherte sich, von zwei Soldaten begleitet. Nach der üblichen Vorstellung ließ man für die neu Hinzugekommenen Gläser bringen, stieß miteinander an und machte ein Höllengelächter. Eine Flasche für vier Personen war bald nicht genug, zwei andere rückten nacheinander auf.
„Backfisch,“ rief das Mädchen dem Kellner zu, „aber recht resch.“
„Auf Ihr Wohl, mein Herr, und auf die Dreijährigen.“
„Die Erde ist kugelrund“, sagte mit Ernst einer der Soldaten, der plötzlich von seltsamen Gedankenfolgerungen heimgesucht wurde.
„So rund ist sie denn doch nicht.“
„So bist es also du, der so rund ist!“
„Wieso, zum Teufel! Der Herr ist nicht sehr liebenswürdig!“
Allgemeine Zufriedenheit. Das Mädel lachte laut und stemmte die Brust, die sich unter der leichten Seidenbluse bauschte. Wohl tauchte der Akt Dumas zuweilen auf, aber man schob ihn gewaltsam in Vergessenheit mit einem daraufgeschütteten großen Schluck Wein.
„Adolf, sag ihnen dein Rätsel!“
„Ah, ja, also raten Sie nun, Sie Gescheiter! Mein Erstes sieht zum Verwechseln meiner Hose gleich, mein Zweites ist ein Getränk für den Abend, und mein Ganzes bin ich, wenn ich mein Erstes angezogen habe, was ist das nun?“
„Na, was denn nur?“
„Keine Ahnung!“
„Nun, ist euch die Zunge angewachsen?“
„Ich habe nichts verstanden!“
„Also, Brüder, das heißt: Culotté, Culotte, das ist Hose, té — Getränk. Wenn ich die Hose anziehe, bin ich Culotté, verstanden?“
„Nein, aber das macht nichts.“
„He, Getränke her, hier gibts Durst. Ich habe Sand im Hals.“
Die Gesichter begannen wie Rosenkohl oder gar wie Pfingstrosen aufzublühen.
„Ich pfeife auf sie, sie haben mich fünfzehn Jahre zum Narren gehabt, jetzt ist an mir die Reihe, sie zum Narren zu halten.“
„Heda Sie, ärgern Sie sich nicht!“
Ein Soldat begann zu summen, und ein anderer begleitete ihn sogleich, man stand auf, das Glas in der Hand.
„Trinken wir auf das Wohl
Der, die schon drei Jahre dienen,
Daß es bald vorbei,
Liest man in ihren Mienen.
Bald sind wie zuvor
Sie im gewohnten Loch,
Drum singen wir im Chor:
Die Freiheit lebe hoch!“
„Sag, Väterchen, bist du nicht etwas angeheitert?“
„Ich, angeheitert? Ihr wißt nicht, was ich vertragen kann. Es hat mich nur diese elende Zigarre etwas müde gemacht. Angetrunken? Glaubt ihr das? Nun, ihr werdet ja sehen, Kellner, noch zwei Flaschen. Das nenne ich Glück, daß wir einander getroffen haben. Ihr seid alle fesche Kerle.“
„So gibt es also noch welche, was?“
Seit einigen Augenblicken tuschelten das Mädchen und ihr Freund miteinander.
„Was denn nicht gar! Du brauchst ihn doch nur selbst darum anzugehen, für mich gehört sich das nicht.“
„Spiel nicht das Täubchen, du weißt sehr gut, daß eine Frau sich besser auszudrücken versteht; er wird es begreifen, weil er ja auch Dreijähriger war, wie er selbst gesagt hat.“
„Du kannst deine Geschäfte selbst ausrichten.“
„Dann frage ich dich vielleicht, ob deine Mutter . . .“
„Na, wie gehts?“
„Auf zur Masurka!“
Das Orchester ließ mit einemmal all sein Blech erschallen. Die Militaristen fühlten den Geist der Musik und des Tanzes in ihre Glieder fahren und begannen sich hin und her zu wiegen.
„Na, wollen wir eins runterwalzen, Bertha bleibt bei dem Herrn zurück, wir finden uns dann alle wieder ein.“
„Gehen wir.“
Die drei Soldaten entfernten sich durch den Garten. Adolf steckte, bevor er ging, dem Mädel ein Portemonnaie zu.
„Er ist drinnen“, flüsterte er ihr zu.
*
Die Wellen fluteten zurück und gaben den Sand frei, diesen traurigen Sand, auf dem in schwarzen Buchstaben geschrieben stand: „Sie werden gewiß nicht daran gedacht haben, den Akt Dumas wegzuschicken“, aber hinter einem häßlichen Felsen kam ein hübsches Segelschiff hervor und tauchte ganz nahe auf.
Das schöne Mädchen saß da und pickte auf dem fettigen Teller nach den Krumen des genossenen Backfisches.
„Sie würden vielleicht noch eine Portion nehmen?“
„Wenn ich aufrichtig sein soll, so sage ich nicht nein.“ Man aß, man trank, man plauderte.
„Ihr Freund sieht ja recht nett aus, Sie haben ihn gewiß gern?“
„O ja, den da schon, der sitzt mir im Blut, aber Sie können halt nicht beurteilen, wie er sonst mit mir umgeht, weil er jetzt eben Sorgen hat.“
„Sorgen, was für Sorgen denn?“
„Er ist ein bißchen beengt, was das Geld betrifft.“
„Das ist leicht begreiflich, ein Soldat! Was wollen sie auch mit einem Sou per Tag anfangen.“
„Sein Vater, der sitzt im Vollen, er hat ein gutes Geschäft, ist geizig wie eine Kirchenratte; wenn er aus einem Rettich drei machen könnte, würde er es sich nicht überlegen. Mein armer Adolf ist es schon müde, er lehnt sich schließlich auf. Er hat doch Bedürfnisse, ist doch kein Kind mehr, er ist ein ausgewachsener Mann und braucht Geld.“
„Er hat allen Grund, sich zu beklagen.“
„Nicht wahr? Sie finden auch! Ich wußte, daß Sie es begreifen würden. Adolf hat es mehr als satt, immer zu seinem Alten betteln zu gehen. Er möchte sich selbst aus der Affäre ziehen. Eben jetzt hat er einen Ausweg gefunden. Er hat einen goldenen Ring in der Tombola gewonnen, einen herrlichen Ring mit einem Diamanten, einen echten, ich wollte, Sie würden ihn sehen! Man hat ihn auf mindestens 400 Franken geschätzt, — da sehen Sie, da ist er, sagen Sie einmal, ob der nicht schön ist. Sie können sich denken, daß er den nicht beim Regiment braucht — er würde damit auffallen. Für ein Butterbrot gibt er ihn weg, für 150 Franken. Wenn man aber darauf bestehen würde, möchte er ihn für 100 Franken lassen, 100 Franken! Der ist schön dumm, was? Das ist eine Sache, auf die man nur so hinspringen müßte, aber er will seinen Ring natürlich nicht dem ersten besten verkaufen, er hat so seine Gedanken darüber und hat recht. Aber ich wette, daß er froh wäre, Sie daraus Nutzen ziehen zu lassen. Das ist also eine gute Gelegenheit, die Sie nicht auslassen sollten. Unter uns gesagt, da sehen Sie nur, wie der glänzt! Ein wahrer Sonnenschein! Sie haben doch Vertrauen zu mir, nicht wahr; ich stelle mich eher auf Ihre Seite, mit Freunden muß man ein offenes Spiel führen, und andererseits bin ich Adolfs so sicher wie meiner selbst. Sollten Sie die 100 Franken nicht bei sich haben, können Sie ihm ja einen Schuldschein ausstellen und ihm das übrige nach und nach bezahlen. Man setzt Ihnen ja nicht dabei das Messer an die Kehle, wenn Sie ihm nur etwas daraufhin borgen könnten, würden Sie ihm sicher eine Freude bereiten.“
*
Gewölk! Finsteres Gewölk, das die Sonne verbirgt und gleichzeitig die ganze Landschaft entfärbt. Du armer Einfaltspinsel, du hast nicht bemerkt, wohin dich die Leute haben wollten. Ein Vierzigjähriger, der allein lebt, der muß wohl Ersparnisse haben. Du siehst übrigens auch recht wohlbestallt aus mit deinem neuen Anzug und deiner goldenen Uhr und verdienst die freundliche Aufmerksamkeit Adolfs; der Lump hat eine gute Nase! Man muß schon sagen, die Hälfte der Menschheit verbringt ihre Zeit, die andere Hälfte zu verschlucken und auszuplündern. Deshalb also schlug er mich so herzlich auf den Rücken. Einen Wein hat er mir sogar bezahlt, der Lump. Schau, daß du so rasch als du kannst nach Hause kommst, du alter Dummkopf — hättest besser getan, gar nicht fortzugehen . . .
„Haben Sie ihn gut angesehen? Wie denken Sie darüber?“
„Ich habe Schmuck nicht gern, Sie sehen, ich trage keinen, das ist einer meiner Grundsätze!“
„Sie könnten jemand ein Geschenk damit machen oder ihn mit großem Nutzen verkaufen.“
Er schüttelt den Kopf. Sehr angeheitert kamen die drei Artilleristen zurück.
„Nun?“
„Ihr seid zu früh zurückgekommen. Aber ich glaube, es wird sich nichts machen lassen.“
„Das ist stier!“
Das Wort wurde gehört und schlug überall ein.
„Hast du nicht einmal zwanzig aus ihm herausgezogen? du Eselin du?“
„Wie wäre es, wenn wir zahlen würden und eine Kahnpartie machten?“
„Sie werden mich entschuldigen, meine Herren, ich muß fort . . .“
„Aber was denn — wir wollten doch zusammen nachtmahlen?“
„Ja, ja, alle zusammen!“
„Bitte entschuldigen Sie mich, ich muß unbedingt fort, ich habe eine wichtige Verabredung“, und sich zu dem Mädchen wendend, sagte er ihr: „Was Ihre Sache betrifft, kann ich wirklich nicht, ich besitze diese Summe nicht, bedaure . . .“
„Bringen Sie auf, was Sie können, man wird sich schon einigen, wir sind hier jeden Abend zwischen fünf und sechs Uhr.“ Der Kellner zählte die Flaschen. Die Soldaten begannen Gebärden zu vollführen, deren Überflüssigkeit sehr deutlich war; einer von ihnen rückte mühevoll seinen Gürtel zurecht, der vollständig an seinem Platze saß, und Adolf, der sein leeres Glas gegen das Licht gehoben hatte, sagte mit hochgezogenen Augenbrauen: „Dieser Wein ist sehr tanninhaltig, er hat einen Satz.“
Die Rechnung war bezahlt, man fühlte sich wieder sehr wohl. Die Blicke senkten sich zur Erde, Adolf tat sehr böse.
„Ja, was haben Sie denn da eben gemacht, Sie haben ja alles bezahlt. Zwei Flaschen kamen mir zu, wieviel macht das nun für mich aus?“
„Lassen Sie das, gehen Sie doch, beunruhigen Sie sich nicht.“
Adolf zog seine Hände, die auf nichts anderes gewartet, aus seiner Tasche und beharrte nicht weiter.
„Sie geben ihm zwei Franken Trinkgeld? Das ist viel zuviel, das ist Verschwendung.“
„Hat keine Bedeutung, lassen Sie, das macht mir Vergnügen. Meine Herren, ich verschwinde, entschuldigen Sie mich, ich muß mich beeilen.“
Er sah, wie das Mädchen Adolf eines der Zwanzigsoustücke, die er auf dem Tische zurückgelassen hatte, zuschob.
„Vergessen Sie nicht unsere Angelegenheit, wir sind jeden Tag nach dem Abendessen hier, wir würden uns gern mit Ihnen darüber einigen.“
„Grüß Gott, alles Schöne zu Hause, auf Wiedersehen!“
Adolf, der nicht nachträgerisch war, preßte herzlich die Hand in der seinen.
„Also auf baldiges . . .“ und er fügte einen kleinen Scherz hinzu, der ihm geläufig war. „Wenn du den kleinen Buckligen triffst, so sage ihm, daß er sich strecken soll.“
*
Die Tramway raste von einer Station zur andern, die Fahrgäste schüttelnd, wie Korn im Sieb. Ein plötzliches Halt, und die Körper stießen aneinander, ein Hut rutschte auf eine Nase herunter. Der durchdringende Schrei einer Pfeife ließ sich hören, und die teuflische Maschine nahm wieder ihren Lauf. Wie sie so blitzeschleudernd, klirrend mit den Scheiben und dem Eisenwerk daherkam, schien sie einer großen Wut anheimgegeben. Sie sprang über die Nieten der Schienen, zeigte sich bei den Biegungen widerspenstig und bewies bei jeder Gelegenheit einen lebhaften Hang zur Unabhängigkeit. Für Augenblicke bemächtigte sich ihrer ein solcher Zorn, daß sie von epileptischen Zuckungen geschüttelt schien. Aber trotz allen ihren Bemühungen ward sie dennoch in den Bahnen der Ordnung festgehalten, ihre Räder gehorchten den Schienen, die ihr nicht das geringste an Extravaganz gestatteten. Ein temperamentvoller Ruck, und die Bremse ließ sie sofort ihren eisernen Willen verspüren.
„Spiel doch nicht den Dummkopf“, sagte der kleine stählerne Hebel, „es nützt dir ja doch nichts.“
Die Tramway war nichts als eine fanatische Begierde, von einer Disziplin niedergehalten, die immer das letzte Wort behielt.
„Da ist nichts zu machen, meine Liebe, da heißt es gerade hinfahren wie jedermann.“
Die Tramway wird ihr Leben aufbrauchen, indem sie so jeden Tag zwischen zwei Endpunkten hin und her läuft. Gelb bemalt, fast in Uniform, genau in eine Liste eingetragen, einem Stundenplan unterworfen, wird sie trotz ihres zornigen Aufbegehrens dennoch ihrem Schicksal nicht entlaufen. Wie alle ihresgleichen, ist sie für einen bestimmten Weg geschaffen, und alle Wege kreuzen sich, ohne sich zu verwirren; so ist es auch mit den menschlichen Wesen.

Leute stiegen aus, andere stiegen ein. Joppen, Taillen, darüber ein Kopf, ein wenig nacktes Fleisch in Form von Händen am Ende der Ärmel, manchmal eine Faust, ein Hals, ein Schimmer von Büsten.
Stoffiguren, Zierpuppen aus Seide mit schönen Augen! Diese einander fremden Wesen, aus allen Winkeln des Alls herbeigelaufen, saßen da, Schulter an Schulter, auf Bänken, einander gegenüber und stellten wie in einem Spiel so eine Art vorübergehender und überflüssiger Symmetrie dar. Jede Haltestelle schied einige Stücke, die rasch wieder von anderen ersetzt wurden, aus dem Spiele aus, so mir nichts dir nichts, nur gerade um die Zeit totzuschlagen. Die lebendige Welt ist immer im Kommen und Gehen begriffen. Unzählige Bewegungen, die sich seit langem zu suchen scheinen, treffen sich endlich, um sich aber sogleich wieder zu zerteilen. Hände schlagen auf das einzige Kartenspiel, verteilen nach einer scheinbaren Ordnung die Figuren und vermengen sie von neuem.
*
Und die Unterhaltung setzt sich so endlos fort. Komisch!
An alles dies dachte der Mann. Der Schaffner verteilte an die Fahrgäste Scheine.
„Schon um 5 Uhr morgens beginnen diese Leute ihr Tagwerk, was für ein Leben! Da habe ich mich nicht zu beklagen. Allein bin ich zwar, das ist ja wahr, aber zum mindesten lebe ich ruhig und habe keine Verpflichtungen. Ich kann tun, was ich will, und bin niemandem Rechenschaft schuldig. Wenn ich meinen Tag verlor und dreißig Franken mit dieser elenden Bande ausgegeben habe, so bin nur ich es, der darum weiß, und niemand anderem als mir ist damit etwas geschehen.“
Als ein Soldat aufstieg, zuckte er ein wenig zusammen.
„Ich hatte schon Angst, ich glaubte, es sei einer von ihnen dort. Diese Flegel!“
Die Sonne ging unter, wie sie es jeden Tag zu tun verpflichtet ist. Sogleich werden die Sterne zu strahlen beginnen, indes sich zur selben Stunde alle Gaslichter der Stadt entzünden. Das war gewiß: Auch von dieser Seite war keine Überraschung zu erwarten.
Ich sage mir oft: „O Freiheit! Hätte ich doch meine Freiheit! Und was dann? Man sagt, es gäbe Rentner, die sich langweilen wie tote Ratten. Die Welt ist wohlgeordnet, und es handelt sich bloß darum, sie bürgerlich zu bewohnen und bemüht zu bleiben, die anderen Mieter nicht allzusehr zu stören. ‚Weder Hund noch Katze‘, wie es in Pachtverträgen heißt. Bei mir stimmt alles, nicht einmal einen Vogel verdränge ich. Da fällt mir ein, daß ich einen Schlauch für den Wasserhahn in meiner Küche kaufen muß.“
Er zog seine Uhr. „Ein Viertel vor sieben. Hoffentlich komme ich zurecht, ich werde an der Straßenecke, bei der kleinen Kneipe, Lemoine abpassen. Der wird mir sagen, ob sie nicht vergessen haben, den Akt Dumas abzusenden.“
| Ein Abend | 5 |
| Warten | 19 |
| Vorahnung | 39 |
| Abschied | 55 |
| Über den Tod eines Kindes | 81 |
| Spaziergang und Begegnung | 99 |
| Träume | 121 |
| Das Geheimnis | 131 |
| Er lehnt sich auf | 149 |
Dieses Buch wurde in einer Auflage von 3400 Exemplaren in der Spamerschen Buchdruckerei zu Leipzig gedruckt; 100 Exemplare wurden auf echtem Büttenpapier abgezogen.
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert wie hier aufgeführt (vorher/nachher):
End of the Project Gutenberg EBook of Das Gemeinsame, by René Arcos
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS GEMEINSAME ***
***** This file should be named 49582-h.htm or 49582-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/9/5/8/49582/
Produced by Jens Sadowski
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.