
The Project Gutenberg EBook of Mitteilungen aus dem Germanischen
Nationalmuseum, by Various
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum
Jahrgang 1900
Author: Various
Release Date: May 30, 2015 [EBook #49084]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MITTEILUNGEN AUS DEM GERMANISCHEN NATIONALMUSEUM ***
Produced by Karl Eichwalder, Martin Ågren, Reiner Ruf, and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
HERAUSGEGEBEN
VOM DIRECTORIUM.
JAHRGANG 1900.
MIT ABBILDUNGEN.
NÜRNBERG
VERLAGSEIGENTUM DES GERMANISCHEN MUSEUMS
1900.
der
Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum.
| Seite | |
| Andreas Herneisen, von Dr. Hans Stegmann | 1 |
| Goldschmiedearbeiten im Germanischen Museum, von Dr. Theodor Hampe. | |
| II. Langobardische Votivkreuze aus dem 6.–8. Jahrhundert | 27, 92 |
| III. Ein langobardischer Schaftbeschlag aus dem 7.–8. Jahrhundert | 97 |
| IV. Ein Vortragskreuz aus dem 10. Jahrhundert | 98 |
| Die Grabdenkmäler der Kaiserin Eleonore in Wiener-Neustadt und des Kaisers Friedrich III. im Stephansdome zu Wien von Dr. Karl Simon | 39 |
| Kachelöfen und Ofenkacheln des 16., 17. und 18. Jahrhunderts im Germanischen Museum, auf der Burg und in der Stadt Nürnberg, von Dr. Max Wingenroth | 57 |
|
Beiträge zur Geschichte des Kaufmanns im 15. Jahrhundert, von Dr. Otto Lauffer Vgl. Jahrgang 1899. S. 105. |
78 |
| Das Lebensende Georg Wechters des Älteren und seines Sohnes Hans Wechter, von Dr. Theodor Hampe. | 109 |
| Zwei Schreiben Maximilians I. von Bayern, von Dr. Rudolf Schmidt | 115 |
| Anhänger im Germanischen Museum, von Dr. Karl Simon | 118 |
| Herd u. Herdgeräte in den Nürnberger Küchen der Vorzeit, von Dr. Otto Lauffer | 129, 165 |
| Ein Orgelgehäuse aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, von Gustav von Bezold | 138 |
| Recept wider die Faulkeyt vnd Klappersucht der Weyber vnd Magd, von Dr. Otto Lauffer | 142 |
| Der Neue Lucas van Leyden im Germanischen Museum, von Dr. Franz Dülberg | 157 |
| Eine Holzstatue des heil. Georg im Germanischen Museum, von Dr. Richard Grundmann | 185 |
| Literarische Besprechungen: | |
| Max Zucker, Albrecht Dürer | 43 |
| Karl Justi Winckelmann und seine Zeitgenossen I. | 144 |
| Litterarische Notizen | 55, 107, 155, 197 |
| Kleine Mitteilungen | 202 |
VON HANS STEGMANN.
Wer heute die obenstehenden auf Andreas Herneisen[2] sich beziehenden Verse des biederen Hans Sachs liest, wird sich, wenn er die Kunstverhältnisse Nürnbergs in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich vergegenwärtigt, kaum eines Lächelns erwehren können, auch wenn ihm der hier an Dürers Seite gestellte Andreas Herneisen zunächst noch gänzlich unbekannt sein sollte. Es gehört ein tiefes Eindringen in die Geschichte Nürnbergs in allen ihren Äußerungen politischer, wirtschaftlicher, geistiger und künstlerischer Natur dazu, um den Tiefstand begreifen zu können, den die Nürnberger Malerei noch nicht fünfzig Jahre nach dem Tode Albrecht Dürers, des Mannes, der ihr den ersten Platz in ganz Deutschland erworben, erreichte. Es können hier die Faktoren nicht aufgezählt werden, die den außergewöhnlich raschen, wenn auch nach außen noch verschleierten Verfall der in jeder Richtung so hoch bedeutenden Reichsstadt herbeiführten. Die bildenden Künste, vor allem die Malerei, zeigt denselben am augenscheinlichsten, nur das Kunsthandwerk blüht, weil eben allein das Bürgertum, d. i. in diesem Falle das Handwerk, sich[S. 2] ernste Tüchtigkeit bewahrt hatte, während die oberen Kreise, politisch, wirtschaftlich und geistig mit dem Vergessen und der Vernachlässigung der Momente, welche Nürnberg groß gemacht hatten, dem unausbleiblichen Bankerott langsam aber sicher zusteuerten.
Die Künstler, die in Nürnberg Dürers Erbe übernahmen, heißen, wenn auch zunächst wegen des kleinen Formats ihrer graphischen Werke die Kleinmeister, klein war aber auch der geistige Horizont und Inhalt ihrer Thätigkeit. Das war, wie bereits angedeutet, nicht allein ihre eigene Schuld, sondern mehr noch die ihrer Umgebung, die ja schon einem Dürer nur ein dürftiges Einkommen gewährt hatte. Die Kirche, die Jahrhunderte lang die nährende Mutter der Künste auch in Nürnberg gewesen, hörte auf, der Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens zu sein, die vornehmen Leute, das Patriziat, waren aus klugen, weitsichtigen, unternehmenden Bürgern äußerlich Edelleute geworden, innerlich aber Spießbürger geblieben, der dritte Stand war in seiner geistigen Entwicklung noch zu weit zurück, um in die Entwicklung der hohen Kunst fördernd einzugreifen. Doch aber war mit dem Anbruch der modernen Zeit die Freude an der Persönlichkeit so weit gestiegen, daß die Darstellung derselben, die Bildniskunst, reiche Nahrung, quantitativ wenigstens, fand. Denn die Zunahme der Porträts aus bürgerlichen Kreisen führte ihre Verbilligung und damit ihre Handwerksmäßigkeit herbei. Georg Pencz war der letzte Vertreter der eigentlichen Nürnberger Bildnismalerschule, und als einen, wenn auch vielleicht nur mittelbaren Nachfolger dürfen wir den bescheidenen Meister, dessen unbescheidenes Lob aus Hans Sachs Munde wir an die Spitze stellten, ansehen, Andreas Herneisen, über dessen Leben und Wirken die an sich vielleicht nicht übermäßig interessanten, aber doch manche kultur- und kunstgeschichtliche Aufschlüsse bietenden, bis jetzt auffindbaren Notizen im Folgenden zusammengestellt werden sollen.
In weiteren Kreisen war eigentlich von ihm nicht viel mehr bekannt, als daß Jost Amman nach einem Bild von ihm 1576 das Porträt des Hans Sachs radierte. Und doch werden wir sehen, daß die launische Klio über ihn mehr der Nachwelt erhalten hat, als über viel bedeutendere Kunstgenossen; dafür ist von dem wichtigsten Teile seiner Thätigkeit, seinen dekorativen Malereien, so gut wie nichts auf unsere Zeit überkommen.
Andreas Herneisen[3] ist am 28. Juli 1538 als der Sohn von Hans und Barbara Herneisen zu Nürnberg geboren. 1562 dürfte er das Meisterrecht errungen haben, da er in diesem Jahre heiratet und ebenso zuerst als Meister erwähnt wird. Über seine Lehr- und Wanderjahre, sowie seine Lehrmeister sind wir nicht im mindesten unterrichtet[4]. Sein erstes Vorkommen ist indes kein rühmliches. Am 27. Juni heißt es »Enndresen Herneysen im loch auff[S. 3] das schmehelich gemeldt vnd wers Im also angeben guetlich zured halten sein sag wiederpringen[5].« Der Maler war also wegen eines dem Rat anstößig erschienenen Gemäldes gefänglich eingezogen worden. Auf die Dauer scheint ihm dies aber die Gunst des Rates nicht entzogen zu haben; in demselben Jahre wird er vom Rat für die Triumphpforte für Maximilian II. im August und September in Gemeinschaft mit den übrigen Nürnberger Meistern dreiundeinhalb Wochen beschäftigt und erhält 7 fl. Lohn[6].
Bald muß er sich auf dem Gebiet großer dekorativer Malereien einen guten Namen gemacht haben, denn das in seinem Anfang oben zitierte Gedicht des Hans Sachs spricht in ausführlichster Weise von seinen Arbeiten in Aldersbach[7] wie folgt:
Das »Valete« des Hans Sachs ist 1567 (s. Götze a. a. O. S. 321) der hier angezogene Spruch am 28. August 1568 gedichtet, also muß die Arbeit in Aldersbach in den vorgenannten beiden Jahren vor sich gegangen sein.
In die sechziger und siebziger Jahre fallen auch eine Anzahl von Bildern des Meisters, die von seiner Kunst fast allein mehr Zeugnis geben und die sich in dem Vorstandszimmer der Hauptschützengesellschaft Nürnberg befinden.

Abb. 1. Die ältesten Porträts der Nürnberger Schützenmeister
im Schießhaus
zu Forsthof in Nürnberg. Erste bis dritte Reihe.

Abb. 2. Die ältesten Porträts der Nürnberger Schützenmeister
im Schießhaus
zu Forsthof in Nürnberg. Vierte bis sechste Reihe.
Dort sind die Schützenmeisterbilder seit den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag aufbewahrt. Unter den sechs ältesten Reihen nun, auf die zum erstenmal in der Festzeitung zum XII. deutschen Bundesschießen in Nürnberg im Jahre 1897 von Dr. Reicke[8] hingewiesen wurde, befinden sich eine größere Anzahl Herneisen’scher Bilder. Die sechs Reihen, die im Laufe der Jahrhunderte und insbesondere wohl bei der Übertragung vom alten Schießhaus in St. Johannis in das jetzige zu Forsthof in Unordnung gekommen sind, vielleicht auch das eine oder andere Stück verloren haben mögen, enthalten vierzehn mit dem Monogramm bezeichnete Porträts von Andreas Herneisen unter einer Gesamtzahl von 42 Stück. Die beiden beigegebenen Abbildungen 1 und 2[9] geben dieselben wieder, ohne freilich eine[S. 6] genauere kritische Würdigung zuzulassen. Die monogrammirten Stücke sind in Abbildung 1: das vierte der ersten Reihe (immer von links nach rechts gerechnet) Endres Deucher, 2) das dritte (Albrecht Welcker), 3) das vierte (Hans Trebing, Bader zu Wöhrd), 4) das fünfte (Martin Pfeiffer Sporer), der zweiten Reihe, 5) das erste (Hans Koch), 6) das dritte (Joerg Lang), 7) das vierte (Peter Frischeisen), 8) das sechste (Hanns Ziegler) der dritten Reihe, in Abbildung 2: 9) das zweite (Steffan Bon), 10) das dritte (Franz Reder); 11) das vierte (Jacob Koch), der ersten, 12) das zweite (Johan Ettwiller), 13) das vierte (Hans Wynderlin), 14) das fünfte (Mertty Hoffmann) der zweiten Reihe. Mit diesen bezeichneten Bildern dürfte aber die Thätigkeit Herneisens für diesen Zweck nicht erschöpft sein; ja es ist nicht einmal der Gedanke ganz von der Hand zu weisen, daß von den 42 Bildern 41 (das letzte von 1615 kann natürlich nicht von ihm sein) von Herneisen gemalt sind, wiewohl es nicht ganz wahrscheinlich ist. Mit Rücksicht auf Manier, Auffassung und Technik möchte ich noch das zweite Bild (Jörg Schwertfeger) der ersten Reihe, die vier übrigen der zweiten Reihe (Hans Schneider, Büchsenfasser, Bernhard Hainla, Sebastian Seufferbelt, Martin Lang), das fünfte und siebente der dritten Reihe (Niclas Mengel und Hans Lutz) in Abbildung 1, das sechste und siebente der ersten Reihe (Istrom Lindelbach und Martin Baumgartner), das sechste der zweiten (Sewald Wissenhauer) und das zweite und dritte der dritten Reihe in Abbildung 2 (Madeis Flaischer und Baltasser Rinder) ihm zuweisen.
Der Umstand, daß er in der urkundlich beglaubigten Zeit seines Würzburger Aufenthalts (1578–87) einige bezeichnete Bilder hierher malte, erlaubt, ihm auch andere nicht bezeichnete aus dieser Zeit zuzuschreiben. In Anbetracht der kleinbürgerlichen Verhältnisse, in welchen wir uns die hier Dargestellten ausschließlich lebend zu denken haben, und welche schwerlich zu besonders hohen Aufwendungen für ein Porträt verleiten und daher auch den Künstler kaum zur Anwendung seines höchsten Könnens anstacheln mochten, können wir uns aus den kleinen Bildern (sie sind gleichmäßig 29 cm. hoch und 26,5 cm. breit und auf Tannen- oder Fichtenholz gemalt), immerhin eine Vorstellung von Herneisens künstlerischen Qualitäten machen. Darin, daß er seine Halbfiguren stets vor eine hell gehaltene, ideale Landschaft setzt, bewährt er sich als konservativen Nachfolger der Sitten der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Seine Malweise ist eine flotte, freie und sichere; kräftige Farbenkontraste, wie sie ja das dargestellte Kostüm mit sich brachte, liebt er; das Ganze ist stets hell gestimmt. Ob die steife und etwas eintönige Haltung der Dargestellten mehr auf Rechnung derselben, oder des Malers kommt, mag dahingestellt sein; immerhin geben sie ein sehr anschauliches Bild des zu höherem Selbstbewußtsein erwachenden Bürger- und Handwerkertums. Die landschaftlichen Hintergründe sind ziemlich schematisch gehalten, und flüchtig gemalt. Überraschend wirkt die Sicherheit, mit der die recht plastisch durchmodellierten Figuren vor die Luftperspektive gesetzt sind. Die Figuren selbst verraten flotte, rasche Ausführung, leichte und sichere Pinselführung. Der Porträtähnlichkeit ist offenbar große Sorgfalt zugewendet, und das[S. 7] Charakteristische in allen Äußerlichkeiten trefflich erfaßt; geistige Vertiefung kann man bei dem Vorwurf ja kaum erwarten. So viel kann man ruhig behaupten, der Mann hatte eine recht achtbare Routine; daß sie gar zu sehr nach Handwerk schmeckt, lag vielleicht mehr an den umgebenden Verhältnissen als an ihm selbst. Eines läßt sich auch beobachten, daß Herneisen mit den Jahren zu immer größerer Sicherheit sich durcharbeitete. Ein Vergleich der früheren und späteren Arbeiten läßt dies erkennen. Von den datierten Arbeiten ist das früheste von 1565, das späteste von 1582.
Von einigen weiteren Arbeiten berichtet Nagler in den Monogrammisten. Daß das mit dem Monogramm 672[10] bezeichnete radierte Blatt, das mir nicht vorliegt und eine weibliche Büste mit groteskem Kopfputze darstellen soll, ein Herneisen’sches Werk ist, muß mindestens als recht zweifelhaft angesehen werden. Auch über die andere Notiz Naglers[11] ein bezeichnetes Bild von 1571 betreffend, kann hier bloß referiert werden. Es soll die Leidensgeschichte Christi behandelt und darin noch ein Nachklang der Dürer’schen Schule ersichtlich, die Färbung aber nicht angenehm, ins Dunkle gehend, sein.
Am bekanntesten sind von Herneisen jedoch die verschiedenen Hans Sachs-Porträts geworden. Das eine derselben, von dem wir vorstehend eine[S. 8] Nachbildung, und zwar zum erstenmale geben, befindet sich in der bekannten Sammlung Weber in Hamburg, deren Besitzer, Herr Konsul Weber, uns in liebenswürdiger Weise eine vortreffliche Photographie zur Verfügung stellte. Es ist ein Brustbild des einundachtzigjährigen Hans Sachs ohne Hände, nach rechts gewandt, auf rotem Grunde[12]. Der greise Dichter mit graublauen Augen, spärlichem, weißem Haupthaar und Vollbart, und weißen Augenbrauen, trägt eine graue, mit schwarzem Pelz besetzte Schaube über rotem Rock mit weißer kurzer Halskrause. Die Bezeichnung oben in der Mitte befindet sich innerhalb der Jahrzahl 1576. Das Bild ist auf Tannenholz gemalt, 49,5 cm. hoch und 38 cm. breit. In die Sammlung Weber gelangte es aus der Auktion Arnstein in Berlin 1890, nachdem es sich um die Mitte des Jahrhunderts im Besitz des Ministers von Nagler befunden hatte. Es ist das Vorbild der meisten uns bekannten Hans Sachsbildnisse gewesen. Ohne die künstlerische Bedeutung des Bildes zu überschätzen, darf man wohl behaupten, daß es mit einfachen Mitteln eine starke, naturalistische Wirkung erreicht. Die Greisenhaftigkeit des Dargestellten ist mit außerordentlicher Wahrheit wiedergegeben. Der Einzeldruck mit dem oben des öfteren angezogenen Gedicht »Ein gesprech, darin der dichter dem gefeierten abt zu allerspach etc.«, enthält die Radierung (Stich) des Jost Aman (?)[13] und an den 1568 gemachten Spruch anschließend, beziehungsweise ihn verwendend, die Danksagung des Herneisen für das geschenkte Valete für den Abt, sowie die genauen Daten über das Bild in den unten stehenden Versen. Daß sie von Hans Sachs selbst kurz vor seinem Tode noch verfaßt, ist wohl nicht anzunehmen, vielleicht hat einer der Freunde aus der Nürnberger Singschule dem Maler ausgeholfen, wenn dieser nicht gar selbst in diesem Fall den etwas flügellahmen Pegasus bestiegen hat. Der Maler schreibt:
Später sagt er:
Es mag bemerkt werden, daß von den anläßlich des Todes nach Herneisens Gemälde angefertigten, gestochenen und geschnittenen Nachbildungen, so weit mir das Material vorliegt, sich gerade diejenige Ammans am wenigsten treu an das Vorbild hält, obwohl dasselbe angeführt wird. Die betreffenden Verse lauten:
Es ist nach genauer Kenntnis des vorbeschriebenen Bildes jetzt auch sicher anzunehmen, daß Herneisens Bild das Vorbild für die anläßlich der Vierhundertjahresfeier bekannt gewordenen Hans Sachsmedaille in München ist.
Herneisen hat den greisen Dichter und sich selbst nur noch in einem Genrebild verewigt, das ebenfalls seit längerer Zeit bekannt, doch erst in den letzten Jahren bei dem Hans Sachsjubiläum die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich zog und bei dieser Gelegenheit auch abgebildet wurde[14]. Die genaue Beschreibung des Bildes mag hier im Wesentlichen nach O. v. Heinemann[15] folgen: Das Bild, schon seit längerer, aber nicht näher zu bestimmender Zeit im Besitz der Wolfenbütteler Bibliothek, ist auf Holz gemalt, 54 cm. breit und 47 cm. hoch. Der Maler hat sich darauf selbst dargestellt, wie er beschäftigt ist, den ihm gegenübersitzenden Dichter möglichst naturgetreu auf die Tafel zu bringen. Hans Sachs sitzt links von dem Beschauer, in grauem, pelzverbrämten Hausrock, mit weißen Ärmeln und weißer Halskrause, an einem Schreibtische, die Feder in der Hand, aber er schreibt nicht, sondern er wendet das nach vorn gehaltene Gesicht mit dem spärlichen weißen Haupthaar, und dem langen, weißen, unten spitz zulaufenden Bart zu zwei Dritteln dem Beschauer zu. Auf dem Tische, der das Schreibpult trägt, steht ein Tintenfaß mit eingetauchter Feder, links davon liegt ein aufgeschlagenes Buch, rechts ein Papierblatt, auf dem geschrieben steht: »Zway monat 81 iar wardt ich Hans Sachs in diser Gestalt Von Endres Herneisen abgemalt.« An dem Pult aber, an dem sich der Dichter anschickt zu schreiben, spaziert mit erhobenem Schwanz ein graues Kätzchen einher. Die Schrifttafel unterhalb des Tisches bezieht sich auf dieses Kätzlein, und dieses hat wohl auch teilweise den Anlaß zur Fertigung gegeben. Die anziehende Erläuterung des Spruches gibt O. von Heinemann in dem erwähnten Aufsatz.
Da mir nur eine nicht genügende Photographie des Bildes vorliegt, ist die künstlerische Qualität desselben schwer zu beurteilen. Mit Ausnahme vielleicht des Kopfes von Herneisen ist sie aber entschieden schwächer als das Webersche Hans Sachsbild und die Bildnisse der Schützenmeister. Bedenken, die wegen des Kostüms des Malers aufgetaucht sind, als ob es mehr der Mode des beginnenden 17. Jahrhunderts angehöre, und hier eine spätere Fälschung vorliege, vermag ich nicht zu teilen. Ein Vergleich mit den Kostümen der Schützenmeister ergibt die Echtheit. Trotzdem wäre es möglich, daß die nicht durch ihre Ausführung, aber ihrem Inhalt nach verschiedenen Seiten hochinteressante Genrescene erst beträchtliche Zeit nach dem Tod des Hans Sachs entstanden wäre, und zwar aus Eitelkeit des Künstlers, der sein nahes Verhältnis zum Dichter seinen Zeitgenossen gewiß recht eindringlich vor Augen führen wollte, oder aus wirklicher Anhänglichkeit an den Verstorbenen. Für die spätere Anfertigung spricht die offenbar aus dem Gedächtnis nur ganz andeutungsweise gegebene Lokalität. Bezüglich der Jahrzahl ist zu bemerken, daß Heinemann wohl sicher irrt, wenn er 1574 liest. Auf der Photographie ist die Zahl nicht zu erkennen.
1578 siedelte Herneisen nach Würzburg über, wie schon oben kurz erwähnt wurde. Über seinen dortigen Aufenthalt berichtet Becker einmal aus dem seit dieser Zeit in den Besitz des Germanischen Museums übergegangenen Würzburger Malerverzeichnis, daß er 1578 in die dortige Lucasgilde aufgenommen worden sei[16], dann, daß ihm im Jahr 1580 vom Domkapitel zu Würzburg die Ausmalung der Decken des dortigen Doms um 700 fl., 5 Malter Korn und drei Eimer Wein verdungen worden sei[17]. Seine Arbeiten haben im vorigen Jahrhundert der jetzigen Dekoration weichen müssen.
Aus den Ratsverlässen geht hervor, daß er ursprünglich nur auf zwei Jahre nach Würzburg gehen wollte, unaufgesagt seines Bürgerrechts. Er scheint aber bald einen günstigen Boden für seine Thätigkeit gefunden zu haben, denn 1579, am 22. Mai, gibt er das Nürnberger Bürgerrecht auf, um erst 1587 nach Nürnberg zurückzukehren.
Ob seine Thätigkeit dort keine Aufgaben mehr fand, oder ob nur der ihm in Aussicht gestellte Auftrag, ihm die Neubemalung und Vergoldung des schönen Brunnens, der damals einer gründlichen Erneuerung unterzogen wurde[18], zu übertragen, seine Rückkehr, die eine definitive sein sollte, bewirkten, wissen wir nicht. Über diesen Auftrag sind wir in der Lage, aus der Literatur, den Ratsverlässen, und vor allem aus einer Anzahl Briefe Herneisens, die diese Angelegenheit betreffen, und bei einem Akt mit Rechnungen etc., über die Instandsetzung des schönen Brunnens, im gedachten Jahr im Nürnberger Stadtarchiv sich erhalten haben, ganz genauen Bericht geben zu können. Mögen die künstlerischen Qualitäten Herneisens auch keine über[S. 11]mäßigen sein, so daß seine Gestalt nur durch die Personen und Denkmale, an die seine Thätigkeit sich knüpft, in erster Linie interessiert, so glauben wir doch, die sechs Schreiben Herneisens hier in extenso und in diplomatischer Treue[19] folgen lassen zu sollen. Einmal, weil sie in das deutsche künstlerisch-handwerkliche Treiben, den Ton und die Bildungsstufe der damaligen Handwerker-Künstler, über das ganze Milieu von Auftraggeber und Künstler, über technische und wirtschaftliche Fragen des Künstlerlebens erwünschten Aufschluß geben, dann, weil sie uns das Denken und Fühlen eines biederen, warmherzigen Menschen von kerndeutscher Art kennen lernen lassen, also als kulturgeschichtliche und menschliche Dokumente Wert und Anziehendes genug haben. Die Briefe sind nicht datiert und bis auf einen von der Hand des Malers selbst. Der erste ist an den Rat von Nürnberg gerichtet und lautet:
Erveste Erbare wolweiße günstige herrn. Dieweil mir von einem erbarn Rath alhie fürkomen, so ich meiner gelegenheitt nach möchte mich wiederumb hieher in nürmberg Begeben, so woltten ir ernvest mir den schonen Brunen zu mallen vnd vergülden verleihen; darin dan der Ernvest Herr Jeronimus Holzschuher vertraulich mitt mir davon gehandeltt vnd an mich begertt meinen vberschlag zu thon, welches ich mich dan ganz vnderthenig Erbern (?) nach meinem geringen verstandt dasselbig E. Ernvest hiermitt vermelde vnd ist gewiss so ich es bei einem gülden konndte erraten oder treffen damitt E. E. vest nit vbernomen vnd ich Bei gebürlicher besoldung bleiben kondte, warlichen thun wolte, die weil aber dises ein gefehrliche arweitt, sonderlich dass golt aufs sich tregt, habe ich Erstlich Bey mir weniger nicht vberschlagen konden[20], dan 1500 fl., die weil aber es gemelter herr Holtzschuher Baumeister mir angezeigt, es werde ein rath nitt gesinett so vill goltes wie zuvor[21] daran zu hengen, welchs dan meiner meinung auch nicht zu wider vnd etwass zirlicher sthen würde, dass ander mit allerley merllen[22] von schönem glantz aussgefasst[23]; damit da der staub sich darauss gesamelt durch den regen mo(c)ht wider abschissen vnd abgewaschen werden. vnd damitt E. Ervest wissen mogen, wass er auf das negst Costen würdt allen vncosten dazu zu legen von goltt vnd oll farben, wills auch mit gott bezeugen der sachen so vil mir muglich recht zu thun, so wird es Bei den dreizehen hundert gulden bleiben muessen ausserhalben des gegitters, so diser zeitt noch nitt gantz fertig, auch nicht davon zu fodern ist. daneben denutig[24] gebetten, da ich E. E. vest solches werck gantz verfertigett, auch gefallen davon hette, ich aber dessen Schadens oder mer dan ich verhofft, darauff lauffen würdt vnd bei verstendigen solches gespürtt, meine heren würden mich[S. 12] desshalben ergotzen[25]. welches ich andrer meinung nitt melde dan darumb, dass solche arweitt nitt wie ander gemeldt[26] zu schetzen ist. wil mich hiemit E. Ervest sampt meinen gantzen von Gott gegebenen wenigen angebotten vnd bevolhen haben.
E. Ernverst williger v. gehorsamer diener
Endres Hernneisen maller.
Zur Sache selbst mag hier das nicht uninteressante Faktum mitgeteilt werden, daß der Rat offenbar für die Bemalung und Vergoldung des schönen Brunnen eine Art engere Submission ausgeschrieben hatte. In dem beregten Aktenfascikel findet sich nämlich auch die (nicht eigenhändige) Eingabe eines sonst nicht bekannten, aber wie es aus seinen eigenen Worten scheint, angesehenen Malers Barthl Brechtl, der ebenfalls vom Rat um Angabe seiner Forderung für diese Arbeit am schönen Brunnen befragt wurde. Es sei hier auszugsweise nur so viel gesagt, daß er für unmöglich erklärt, im Voraus einen Kostenvoranschlag zu machen, vielmehr die schlaue Idee hat, den Rat aufzufordern, ihm erst mitzuteilen, was die farbige Fassung im Jahre 1541 gekostet habe. Er betont dabei, wie wir dies gleich auch bei Herneisen sehen werden, die bedeutende Preissteigerung der Materialien. Er selbst würde die Arbeit leiten, an der Spitze der Gehilfen würde sein Sohn stehen, er würde des Weiteren aber auch noch eine Anzahl Nürnberger Meister beiziehen. Jedenfalls würden die Kosten (ohne Gitter) nicht unter 1800 fl. betragen. Der Rat, der sparen wollte, wird weder auf das erstere Verlangen die früheren Kosten anzugeben, noch auf das um 500 fl. höhere Angebot weiter reagiert haben. Dies geht schon aus dem zweiten Schreiben Herneisens an den Baumeister (patricischen Referenten über das Nürnbergische Bauwesen) Hieronymus Holzschuher hervor:
Ernvester Wolweisser günstiger her Holtzschuer. Nachdem mir von Eur Ernvest vnd auch dem Ernvesten herrn Jullius geuder ist befelch geben, dass ich eine Visierung zu dem schonen Brunen nitt allein auff Bapier, sondern auch an dem Brunnen selbst von ollifarben machen vnd mallen solte; wie ich dan vermeint dasselbig auffs Bestendigste zu verrichten. Welches dan nun geschehen vnd ane Zweiffel ein Erbar rath Besichtigett vnd dieweil mir[27] nun abermals des verdings oder foderung halben handeln sollen, ist darauff meine entliche meinung, nach dem ich die zeitt vber den Brunen Besichtigt, Bei meiner Ersten foderung zu Bleiben vnd wie die selbige lautett, keineswegs davon zu wei(c)hen. ich mochte aber wol leiden, dass ein E. E. weiser Rath den zeug alss oll vnd farben, goldt vnd zu sohen[28] gehorig selbsten schaffen vnd leghen vnd ich allein die gesellen vnd gesindt, so mir dazu duglich[29], herbei brechte, dieselbigen in der cost halten; für solches ales[S. 13] wolte ich 500 fl. nemen vnd denselbigen nach meinem Besten vermügen mallen vnd machen. da aber eur Weisheit wolten der wochen nach Besolden oder arweiten lassen, so kondt man mitt dem gesindt der Cost vnd lohn halben abermals weg finden. Was meine Berson Belangt will ich in allen sachen nach meinem besten vermügen darzu rethlich sein vnd meine Besoldung ist einen tag ein gulden. vnd ferner weiss ich E. E. vnd Weisheitt keinen fürschlag oder andern Bericht zu geben. Bleib also bei dem Ersten Meinen Bericht. dan ich auch die Bedencken hab wie alle ding zum deuersten alss öll, steinöll vnd farben, das man vor wenig zeitten baldt vmb halb geldt gekaufft hett. zu dem so ist mit dem goldtschlager[30] abgehandelt, das er das buch goltt eines gulden dicker vnd steiffer machen soll, welches sich dan auch gewaltig mer in das gelt legt. so ist das gesindt schwer zu halten mit Cost vnd lohn. müsst auch noch wol was verzeeren, Biss ich ettwass von gesindt zusamen Bring, die mir taugen. wil geschweigen, was einem vol öll vnd zeug, goltt vnd andern verschütt oder in ander weg verwüst wirtt. dass vnmuglich ist solte ich dan stetig mit Beschwertem hertzen arweiten vnd etwa, da gott vor sey, mit meiner armutt noch Buessen. vnd kem dise meine Reis von Würtzburg dar zu[31], so würdte es mir zu Wahrhafftigem verderben gereichen. vnd kan E. Ervest für mein Berson keinen andern fürschlag thon, dan den Ersten vnd so ferrn ich E. Ernvest auch Einen E. Erbarn Weissen Rath dazu gefallen mo(c)ht, so wil ichs in gotes Namen wagen vnd frisch mit Ehstem angreiffen in alle weg des Bürgerre(c)hts mit gemeint.
E. Ervest W. diener
Endres Herneisen
maler.
Der treuherzige Ton mit dem der Meister hier den weiteren Versuch, den ohnehin niederen Preis herunterzudrücken, zurückweist wird bei jedem Leser für den Schreiber einnehmen. Die Folge sollte dem Künstler Recht geben, daß er um den Preis von 1300 fl. die Arbeit nicht in gewünschter Weise zu Ende führen konnte. Die am Eingang des Schreibens erwähnte Visierung glaubte Wallraff[32] in einer der beiden im Germanischen Museum[33] aufbewahrten farbigen Zeichnungen des schönen Brunnens wiederkennen zu sollen, nachdem Bergau die eine derselben schon als Arbeit des J. Pencz nach einem modernen Monogramm desselben beschrieben hatte[34]. Indessen sind meiner Ansicht nach die beiden nach einem Vorbild, eben der Pencz’schen Zeichnung von 1541[35], gefertigt, und zwar nach der rohen und sehr ungeschickten Ausführung sicher von Dilettanten und nicht von einem Berufskünstler. Die am Schluß stehende[S. 14] Erwähnung des Bürgerrechts soll soviel heißen, dass er außer der ausbedungenen Summe die unentgeltliche Wiederverleihung des Bürgerrechts erwarte. Diese erfolgte denn auch in dem Ratsverlaß, in dem ihm weitere 200 fl. bewilligt werden[36].
Im nächsten Brief an Holzschuher ist der Meister in voller Arbeit, aber ohne Geld:
Ervester wolweiser günstiger Herr Holzschuher. E. E. seindt meine willige dinst ider zeitt zum Besten. Mein Begern vnd anzeigung ist dieses an eur E. vest. die weil der costen nun mer grosser wurtt und lefft, nemlich auff dem schonen Brunnen vnd sonderlich den goltschlager Betreffendte, der mir dan zu sol(c)her arweitt 60 Buch goltts dass Buch vmb 4 fl. zugestellt vnd geliffert hatt daran er 100 fl. von eur ernvest empfangen auff mein verdinge, so Begertt er gleichwol jetz wiederumb; vnd damitt ich meiner auch nit vergess, kann ich dem herrn nit verhalten solchs geltz halben, welches mir dan teglich vnd alle stundt auffgeth, das mir ein merers muss gereicht werden vndt vnder handen haben, es wil jetz nitt geschertzt sein[37], dan so ich wil fernnis[38] oder Bleiweiss oder anderes haben, muss ich das gelt schir for hinaus zallen, one wass mir auff das gesindt wechentlich geth. do aber das würtzbergische gelt konte den schonen Brunnnen ausstauern vnd verlegen[39], wolt ich es gar gern mitt einander von E. E. zur entschafft[40] empfangen. die weil dan aber lautt meines zusagungs vnd der hilffe gottes das werck schleunig vnd vleissig sol fortt gehen, so wil mir gebüren die mengel, so solches verhinderten, E. E. an zu zeigen, die mügen mich zu solcher sa(c)he nitt verstehen, alss dass ich es Boss meinte vnd ettwa zu vill soltt herauss nemen. das dan mein gebrauch nit gewest vnd noch nitt sein soll, dan allein das ich haben muss. Mein Bfflug (?)[41] ist ietz allein zu nurmberg vnd stetth die müll zu würtzberg, Euer E. E. soliches in vntherthenigkeitt nit verhalten wellen vnd sollen.
Was das goltt anlangt Bin ich nie aus unserem verding vnd abredt geschritten; will auch also demselbigen obliegen, vnd nach meiner zusagung vleissig verrichten, den es ist ausfürlich also von dem golt, wie ich es dan gebrauch, geredt worden vnd gantz vnd gar nitt von anderem oder halb geschlagenem den da es wer fürgelauffen[42], so wolte ich es damals widerrathen haben, den mir dieses golt, so es auff steinöll in die krummen lilgen vnd rosen zu dick vnd Brüchig ist. vnd wie wol ich weiss, dass Ein E. Erbar weiser Rath, meine Herrn mir solchen costen des halb geschlagen golts da[S. 15] es von notten[43], wol würden erstatten, so hatt es doch mir nitt gepüren wollen dar zu zu rathen, dieweil es mir nitt zu brauchen geschmeidig genug ist; ach nit lenger[44], wie den noht[45] ein gantzer Ducaten am wetter bame[46] der farbe halben. Ist also bei meiner warheitt weder nettig noch nütz, ein E. E. weisen Rath in vnnötige vncosten zu führen. was aber mich vnd mein gemeldt antrifft erbiete ich mich noch vnd darff anders nitt wiederholens, wie meine vbergebne schrifften (vnd) das verding lautten, alles wo mengel zu verbessern. Vnd sonsten E. E. vest mit Bestem vermügen zu dienen, vnthertänig gebeten mir mein Begern, welches doch mündlich geschehen könen, in solche vnzierlichen schrifften zu vermelden vnd gegen E. E. auszuschicken nitt verargen. Befielh E. E. dem Ewigen gott. E. E. W. Diner
Endres Hernneissen maller
In dem vorstehenden Brief sehen wir Herneisen tapfer und allem Anscheine nach mit vollem Recht seine Interessen wahren. Die beiden nächsten Schreiben enthalten das Gesuch, ihm weitere 200 fl. zu gewähren. Das vierte an den Rath gerichtete ist nicht von der eigenen Hand des Malers, sondern wohl von einem berufsmäßigen Schreiber für den Rath mundiert und etwas redigiert:
Ernvest fürsichtig erbar vnd weiss gebietende, günstig Lieb herrn. es ist mir Endres Herrneisen Malern als E. E. vnd Hrn. Burgern der Schöne Prunnen verdingt vnd verlihen worden zu Malen Im Namen Eines ganzen Ernvesten fürsichtigen Erbaren und weissen Raths durch die Auch Ernvesten Herrn Julius Geuder vnd Herrn Jheronimus Holzschuher Alss Bauherrn vmb vnd für dreyzehenhundert gülden. solchen prunnen Aber wie der zu Malen vnd zu vergulden sein solle Ist von mir ein vissirung Auff Pappier vnd nachmahls an den Prunnen selbsten zwey Bilder gemacht vnd allerdings verguldet, wie sie alle sollen gemalt werden. Darauf ich dann nach meiner gemachten Vissirung fortgefaren vnd im Namen Gottes angefangen. Dieweil ich aber im werck gewesen, So hab ich doch müssen erfaren vnd von dem herrn Baumaister berichten lassen, das dass golt etwas zu wenig vnd vnscheinlich sein würde, hab also on alle widerredt dem herrn willfarn vnd mich nicht Tauren lassen vnd denselbigen mit goldt dermassen gezieret, das daran nichts vergessen, man wolte in dann gannz verguldet haben, das ich dann vn von Nötten (sic) geachtet. Dieweilen ich aber bei gueter zeit gesehen das Ich mit solcher Summe der fl. 1300, wie ich den gern gewildt[47], nit könte auskommen, So hab ich es vnvermeidlicher Not halben nit vnderlassen können vnd Obbemelten beiden herrn Angezeigt mich bei einem Ernvesten fürsichtigen Ernbaren vnd weisen Rath zu defedirn[48] vnd meine clag anzumelden, wie das es mir schwer fallen würde, da mich Ein E. Rath der Uebergemachten Schulden halben würde stecken oder Unenthebt lassen. Und dieweil dan Nun[S. 16] das verding fast ganz vnd Jetzt der Zeit an dem Gitter Arbeitt, so were mein vnderdenstlich Bitten an E. E. vnd Hr. die wöllen mich auss solcher als veber die dreyzehnhundert gulden fernern Costen entheben, welches sich dann an die Zweihundert gülden hernach erstrecken thuet ohne mein Besoldung auf meinen Leib. Ich hoffe auch E. E. vnd Hr. werden als Hochverstendige weise herrn an meiner Vissirung die E. E. vnd Hr. beihanden haben Wol sehen vnd Spüren, was ich über solches von goldt vnd Vleiss gethan habe. Auch mich gantz vnd gar nicht gesaumbt und were mir vnmüglich gewesen den so baldt zu verfertigen, wo Gott der Herr nit bey mir hilflich sich erzeigt hette, den Ich dann von hertzen darum gebetten vnd darumb Jetzt dancke Im zu Lob vnd meiner Obrigkeit zu grossem Wolgefallen. will mich also in E. E. vnd Hr. gnedigen willen befelhen und mich des vebrigen vncosten halben zu entheben getrösten; will mir E. E. vnd Hr. für meins Leibs besoldung vnd vleiss etwas gewen, so bin Ich zufrieden. Wonitt behab ich mich doch Obligirt das Ich nichts begere wenn ich nur des vncostens enthebt bleibe. Will es alles dem Lieben Gott vnd meiner lieben Obrigkeit befelhen. Was aber das Gitter belangt hab ich auff dass Negst Vleissig überschlagen vnd kan vnder Vierhundert gulden, wie es ist angefangen nicht gemacht werden. Das hab ich E. E. vnd Hr. vmb mehrer Nachrichten willen, In vnderthenigkeit nit sollen verhalten, denen ich mich vnderthenigklich bevelhende
E. E. vnd Hr. E. w. Undertheniger gehorsammer
Burger Endres Herneisen
Maler.
Nicht ganz so unterthänig lautet das andere Schreiben desselben Betreffs, welches Herrneisen gleichzeitig oder kurz vorher an den Anschicker der Peunt, den technischen Leiter des städtischen Bauamts F. Fuerst hatte gelangen lassen. Dasselbe bringt die Thatsache, daß Herneisen sich in seiner Calculation verrechnet, in humoristischer Weise auch durch die links seitlich angebrachte und auch hier wiedergegebene Zeichnung[49] zum Ausdruck, dass er sich als in den Brunnen gefallen darstellt und den Adressaten durch die Beischrift »helfft auff« auffordert, ihn in seinen Nöthen zu unterstützen. Der Brief lautet:
Ernvester, wolweiser gunstiger Herr Bauherr F. Fuerst ist wohlwissentt, welcher gestalt mir der schone Brunnen verlihen vnd angedingt, wie zu sehen in vbergebener vissirung vnd schrifften. auch was ich mich gegen den E. E. w. herrn Jullius Geuder, auch meinem günstigen herrn Beklagt & folgesezen (?)[50] Bei andern herrn Eltern im schonen Brunnen. diweil den nun dise verdingte arweitt zum Endtt laufft, welch ich myt meinem hochsten vleiss vnd vermugen gemachett habe, das ich verhoff ein Ernvester weiser Rath werden in[51] solche arweit neben gethanen vleiss in der zeitt gefallen lassen, vnd wess ich noch dann zu vnterthänigsten gefallen vnd willen thone kondt, mich hiemitt erbotten[S. 17] haben. diweil mir aber die suma zu schwer wirtt vnd ich dieselbige vberschlagen, wil mir zu vill vber dise verdingte dreizehnhundert gulden fallen, alls das ich E. Ernvest will gebetten haben mich Bei einem E. E. weisen Rath oder Bey herrn Jullius geuder anmeldten, wie ich in dem fortfaren verzagt sey vnd oft besorge ich müsse vber dise schuld, so vber mein verding von Bihlein[52] als Zetteln hinvnd wider[53] zusammen flossen[54], mit meiner armutt noch langen[55]; dazu ich mich vil Bessers zu meinem E. E. weissen rath versehe vnd umb wider antwort vndertänig gebeten haben, vnd mich E. E. vest bevollen.
was das gitter belangt, ist alle augenBlick zeitt wie mitt demselben sol abgehandelt werden, damit wir nitt vergebens Zeit verliren
so dann der Casten auch nitt gar vergüllt werden; er würdt sonst von wegen dess steigens zu den gitter wider verwüstet.
Ich wollte auch nach diser sa(c)hen gern gen würtzberg und mergatham reisen; der goldtschlager wil gelt haben 140 fl.
Ich muss auch einen Zettel auf der Beindt[56] haben das öll betreffendt
E. E. vntherteniger Diner
Endres Hernneisen
Maler
Die im vierten Brief erwähnte Forderung von 400 fl. für das Gitter, mit dem sich der Maler für den entgangenen Verdienst am Brunnen vielleicht etwas schadlos halten wollte, scheint dem Rath wieder zu hoch gewesen zu sein; im letzten Briefe, in dem wieder der Adressat nicht genannt ist, als welchen wir aber ziemlich sicher wieder den »Bauherrn« Hieronymus Holzschuher vermuthen dürfen, erwidert Herneisen auf desfallsige Vorstellungen in geschickter und eindringlicher Weise[57]:
Ervester weiser gunstiger Herr. eur gegen mir gethanes Beschweren des gegetters[58] alss der fl. 400 belanget, so hab ich mich vber gesetzt vnd dem[S. 18] selbigen vleissig nach gerechnet, wie es hernach E. Ehrnvest verzeichnet, was die negste Manir ist, allso zu machen wie ich es angefangen hab vnd damit meine Herrn Ein Ervester wolweiser Rath wahrhafftig bericht haben vnd mir darauss khomen. ma(c)ht erstlich das goldt auff eintheil des Gitters deren achte sein der Feldter.
auff ein feldt geth 5½ Buch fein goldt. nun seindt der felter achte; das Buch an fein goldt umb fl. 4 gerechnet, thut zusamen an geltt fl. 176, ehr mehr. so setz ich für mein zeug alls farben vnd steinöll, müh vnd vncosten, wie dan an allen enndten gebreuchlich auch sovil, thuett fl. 352[59] vnnd neher kan man es nicht haben, sonderlich dieweil ich die höchsten farben als lack dan der Niderlander Nicolei ein Maler macht, dan ich den bei Ihme bishero kaufft hab, vnd das Lot kost 1½ fl., wie mir in dan der wandereisen geholt hat. es ist ein klein ding umb 1 Lot vnd das habe ich E. Ernvest nitt sollen verhalten. Befelh mich in E. E. vnd Herlikeit wolmeinung
E. E. W. D. Endres Herrneisen Maler.
Damit schließt der interessante Briefwechsel, der Herrneisen zwar nicht als hochgebildeten, aber immerhin schriftgewandten Mann zeigt.
Die Wiederherstellung des schönen Brunnens im Jahre 1587 wurde in Nürnberg als Ereignis ersten Ranges gefeiert und nicht wenig auch die mit derselben betrauten Meister. In gleichzeitigen Nürnberger Dichtwerken bekommen wir davon schlagende Beweise.
Zunächst ist das in einer Chronik befindliche (Handschrift im German. Museum 4419, f. 353 ff.) Lobgedicht auf den schönen Brunnen, von dem bekannten Spruchsprecher Hans Weber zu erwähnen. Die hauptsächlichsten auf unsern Maler bezüglichen Verse lauten:
Es folgt dann die sehr ausführliche Beschreibung des Brunnens, insbesondere die Beschreibung der Figuren, von der Direktor Frommann im Anzeiger f. K. d. D. V. S. 1854, Sp. 162 f. einen Teil veröffentlicht hat.
Ein anderer Lobspruch auf den schönen Brunnen, ebenfalls 1587 von Friedrich Beer verfaßt und dichterisch auf der gleich niedrigen Stufe stehend, wie der Weber’sche, beschäftigt sich ebenfalls eingehend mit unserem Maler[60]:
Ob die in dem letzten Brief angedeutete Reise nach Mergentheim, die er mit derjenigen nach Würzburg verbinden will, mit einem Auftrag dort zusammenhängt, konnte ich aus der Literatur nicht ermitteln. 1572 war das neue Schloß des deutschen Ordens zu bauen angefangen worden; vielleicht daß er hier wieder in dekorativen Aufgaben Beschäftigung gefunden.
Wichtiger für ihn und für Kunst- und Kulturgeschichte, ist seine Beteiligung an der Ausstattung eines der hervorragendsten Denkmale der deutschen Renaissance, des neuen Lusthauses zu Stuttgart, das Herzog Ludwig von Württemberg vom Jahre 1585 ab erbauen ließ. Die Akten über den Bau desselben sind glücklicher Weise vollständig erhalten, und durch das liebenswürdige Entgegenkommen des kgl. Württembergischen Hauptarchivs zu Stuttgart, war es mir ermöglicht, die die Ausmalung betreffenden Teile hier in Nürnberg benutzen und denselben die nachfolgenden Notizen entnehmen zu können.
Nach den vorliegenden, einer Klagschrift Herneisens über den Stuttgarter Hofmaler, beigelegten Originalbriefen desselben, an den Nürnberger[S. 20] Meister, scheint dieser irgendwie durch seine Württemberger Verwandtschaft von dem Plan, das neue Lusthaus auszumalen, Kunde gehabt zu haben, denn er läßt vor Neujahr durch seinen Vetter Johann Lederlein, Formschneider zu Tübingen, diesem ein Geschenk überreichen. Steiner dankt in seinem ersten Brief vom 7. Januar 1590; erinnert an den ersten Aufenthalt Herneisens in Stuttgart im Jahre 1575, gelegentlich der ersten Hochzeit des Herzogs Ludwig, wo die einheimischen Maler mit der Dekoration für das Turnier nicht fertig werden konnten und daher Herneisen nach Stuttgart durch einen eigenen Boten hergeholt wurde. Es geht aus dem Brief des weiteren hervor, dass Herneisens Gattin Anna (die zweite wohl, da in der Folge des Öfteren von kleinen Kindern die Rede ist), aus Württemberg stammte. Er weist auf die bevorstehende Ausmalung des Lusthaussaales hin, die wohl zwei Sommer in Anspruch nehmen werde. Es werde für Herneisen, wenn er Lust habe, ein gut Stück Geldes zu verdienen sein. Im zweiten Brief vom 31. Januar, nachdem Herneisen erwidert, sich näher nach der Sache erkundigt und im Allgemeinen seine Bereitwilligkeit, nach Stuttgart zu kommen, zu erkennen gegeben hat, gibt er ihm den Inhalt der Malereien (Jagden) an, fragt ihn nach seinen monatlichen Ansprüchen, außer den vom Hof gelieferten Malutensilien, Essen und Trinken, und bietet ihm nebst seiner Frau eine Stube und Kammer in seinem Hause an. Sobald der Zeitpunkt des Verdinges gekommen sein werde, werde er ihn nochmals benachrichtigen, falls er ihm weitere zusagende Antwort zukommen lasse. Der Frau Anna Herneisen schickt er gleichzeitig ein Angedenken. Interessant ist in dem sehr herzlich und fast übermäßig gottselig gehaltenen Brief eine Randbemerkung, die darauf schließen lässt, daß Herneisen nicht blos Maler, sondern auch Bilderhändler gewesen sei: »Lieber meister Endres, so ier was seltzams von gemeldtt her schigen veldt so duedts. So ichs Eich kan verkauffen vnd geld leschen (lösen) wils dan von hertzen gern, mein Gn. ft vnd her hett gern was seltzams; wil Eich gern dienen.«
Der vermutlich dritte Brief ist nicht datiert; möglicher Weise ist er Anfang März 1590 geschrieben. Es geht daraus hervor, daß Herneisen Gemälde (Tücher), also offenbar auf Leinwand, angeboten; Steiner fordert ihn auf, diese nach Stuttgart zu schicken; besonders aber Porträts von Kaisern, Königen, Fürsten und andern Herren; im Fall er solche verkaufen könne, solle er ihm ein Verzeichnis derselben schicken und die Preise angeben. Er sucht »axelbilder das hebbt bis an die brust, den Kopff rechte grossen«. Die letzteren sollten erst von Herneisen gemalt werden, bei den erstgenannten scheint es sich um Handelsobjekte zu handeln. Er fährt dann fort »veldt (wollet) ier mich wissen lassen ob ier zu nürmberg bei den kunstliebhabern kont etwann Condervet endleen (entlehnen) (vnd?) abmalen, mich wissen lassen, dan ich ein buch zu stand bring aller Kaiser, Küng, Cur vnd fürsten, was ich khan bekummen, es sein altt oder new, welsch oder ditsch.« Aus diesen Sätzen, die wie die ganzen greulich unkorrekt und kaum entzifferbar geschriebenen Briefe etwas unklar sind, geht nicht hervor, ob es sich um Vorlagen für ein Buch mit Porträts von Fürstlichkeiten oder einer Sammlung für die herzogliche Kunstkammer handelt. Des weiteren erhält Herneisen wiederholt die[S. 21] befriedigendsten Versicherungen über seine Bezahlung; auch erbietet sich Steiner, ihm Geld für die Reise vorzuschießen. Wenn er etwas früher komme als die Malerei selbst beginne, so schade es nichts, es seien allerlei Vorbereitungen, Naturaufnahmen u. s. w. zu treffen.
Der vierte Brief vom 20. März, aus dem wir entnehmen, daß Herneisen sein Kommen zugesagt und drei Gemälde (Tücher) eingesandt hat, welche der Herzog an einen seiner Diener verschenkt, ist etwas kleinmütiger. Steiner weist darauf hin, daß er einen gefährlichen Konkurrenten bei Hofe habe, vielleicht Wendel Dietterlin: »dan sunst ein maller vor honden der vill sein ein haspell machen, der vil sich mitt gewaltt Eindrängen. Mein G. F. Red (Räte) sind wunderberlich, wie ier dan wissend an den fürsten höffen gets also zu, aber wen ier Kumptt vellendt mier sehen wie der sach zu don ist. ich hab Eich sunst von hertzen gern allein die vil es so wankhelmiettig zugett veiss (weiß) einer veder hinder noch für.« Er klagt weiter, daß die Räte des Herzogs, weil der Bau des Lusthauses so viel gekostet, an der Ausmalung nun möglichst sparen wollten. Er fordert ihn neuerdings auf, Porträts, Brustbilder, in einem gewissen Maßstab zu fertigen, und ersucht ihn um ein Verzeichnis der auf dem Nürnberger Rathhaus befindlichen Bildnisse.
Im fünften Brief vom 1. Mai 1590 fordert Steiner Herneisen dringlich auf, falls er noch Willens sei zu kommen, sich baldigst auf die Reise zu machen. Für das Reisegeld schickt er ihm 10 fl. auf Rechnung der bestellten Porträts. Über die Porträtsammlung des Herzogs gibt er nochmals Aufschluß: »weltt gerne das ier ettliche bechumen khindt, dan mein G. F. vnd her mecht ain büchlein von Elfarben allerley conterevedt aller pottenditatten (sic!) dittscher vnd welscher Natzion so viel zu bechumen sendt. ich schreib allen Talben (allenthalben) wo ich etwas weiss ierer F. G. etwas zu bechumen.«
Der letzte Brief ist unmittelbar vor Herneisens Abreise, am 21. Mai geschrieben. Er warnt den Nürnberger Maler, zu viel Personen und Hausrat mitzubringen, ehe die Verdingung wirklich abgeschlossen. Für die drei oben genannten Gemälde und zwei Visierungen erhält Herneisen ausserdem 17 fl. zugesandt.
Als Herneisen in Stuttgart eintraf, waren die Vorverhandlungen zwischen dem Herzog, seinen Räten, dem Bauintendanten Dr. Georg Badner und dem Hofmaler Hans Steiner zum Abschluß gediehen, nachdem sie schon im Jahre 1587 zuerst aufgenommen worden waren.
Die ursprüngliche Absicht für die Bemalung der Decke war, eine Kosmographie Württembergs zu geben. Des Herzogs als leidenschaftlichen Jägers lebhafter Wunsch, in dieser Kosmographie auch die verschiedenen von ihm in den Wäldern seines Landes gepflegten Jagdarten mit einverwoben zu sehen, hätte natürlich ein künstlerisches Unding ergeben. Man verfiel deshalb nach jahrelangen Versuchen und nachdem auswärtige (französische?) Kräfte zurückgetreten waren, auf den Ausweg, zwölf Landschaften, die zwölf Forste Württembergs mit Jagddarstellungen zu geben. Die 201 Werkschuh lange und in der Gewölbfläche ungefähr 90 Werkschuh breite Decke des großen Saales wurde daher in drei Längsstreifen geteilt, von denen die äußeren je sechs der erwähnten Landschafts- und Jagdbilder enthielten, der innere Streifen[S. 22] aber religiöse Darstellungen aus der Offenbarung Johannis enthielt. Der mittlere Streifen, der offenbar auf Betreiben des geistlichen Ratgebers des frommen Herzogs Ludwig, Dr. Osiander, eingefügt wurde, erhielt Wendel Dietterlin von Straßburg zugetheilt[61]. Für die Bemalung der wahrhaft riesigen Flächen wurden außer Dietterlin und dem Hofmaler Hans Steiner, der den ersten Hauptentwurf und die Einteilung besorgt hatte, folgende Maler herbeigezogen: Andreas Herneisen, Hans Karg von Augsburg, Hans Dorn von Stuttgart, Jacob Zieberle (Zäberl) von Tübingen, Peter Riedlinger von Eßlingen (kurz nach Beginn der Arbeit verstorben), Gabriel Dachs (Stuttgart?), Hans Melchior Offstein von Göppingen und Philipp Grether von Stuttgart. Der Hofmaler, Hans Dorn und Herneisen waren insofern bevorzugt, als sie von Anfang an zwei Stücke (»Förste«) zugeteilt bekamen; die übrigen nur einen; später erhielt Herneisen noch einen Teil am Uracher Forst zu malen. Seine Landschaften waren der Stuttgarter und der Heidenheimer Forst.
Es ist interessant, aus den Akten über das Verfahren der Maler das Nötige zu erfahren. Zuerst mußte eine Farbenskizze (gemalte Tafel) in kleinerem Maßstabe dem Herzog zur Genehmigung vorgelegt werden. Da die Mehrzahl der Maler des Waidwerks unkundig waren, was ihnen, wie wiederum aus den Akten hervorgeht, einigermaßen zum Vorwurf gemacht wurde, mußten sie den vorfallenden herzoglichen Jagden beiwohnen, um dort Studien nach der Natur zu machen. Ebenso mußten sie die Landschaft aufnehmen und die Porträts des Jagd-, Forst- und Hofpersonals anfertigen, um sie dann auf das eigentliche Gemälde zu übertragen.
Von den einzelnen Abteilungen waren vier 40 Werkschuh, acht 30 Werkschuh breit und sämtliche 30 Werkschuh hoch. Da natürlich diese riesigen Flächen in einem Stück auf Leinwand zu malen ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, wurden die Abteilungen in 5 resp. 4 »Tücher« zerlegt und erst beim Aufschlagen an der Decke zusammengefügt. Für jedes derartige Tuch erhielten die Maler außer Lieferung sämtlicher Malutensilien gleichmäßig 100 fl., 2 Schäffel Dinkel und ½ Eimer Wein nebst 8 fl. jährlichen Hauszins; eine, wenn man den mehr dekorativen Charakter der in einer sehr beträchtlichen Höhe (die Gewölbehöhe des Saales betrug 50 Werkschuh) angebrachten Malereien berücksichtigt, wohl recht zulängliche Bezahlung.
Sehr merkwürdig ist auch die Ordnung, auf welche die vereinigten Maler während ihrer Arbeiten am Lusthaus verpflichtet wurden. Mit Rücksicht auf ihre Ausdehnung muß leider auf Mitteilung des kulturgeschichtlich wichtigen Stückes verzichtet werden. Die Inspektion der Arbeit, wie die Verteilung der Materialien lag dem Hofmaler Steiner ob; bei vorfallenden Streitigkeiten hatte eine aus Steiner, Dietterlein und Herneisen bestehende Kommission zu entscheiden.
Die Arbeiten begannen im Juli 1590, nachdem die Skizzen vorgelegt waren und noch mancherlei Verhandlungen über die Höhe der zu verab[S. 23]reichenden Naturalverpflegung und den Mietzins gepflogen worden waren. In solchen Dingen scheint unser guter Herneisen geschickt, aber auch etwas vordringlich gewesen zu sein, wenn man die große Zahl seiner Schreiben an den Fürsten und die Rentkammerräte in Betracht zieht.
Daß Herneisen nicht mit Glücksgütern gesegnet war, beweist eine Eingabe vom 21. Juli 1590, worin er zur Anschaffung von Haushaltungsvorräten den Herzog um einen Vorschuß von 100 fl. auf den verdingten Lohn bittet.
Dr. Badner empfiehlt sein Gesuch, da er der weiten Entfernung halber keinen Hausrat mitgebracht habe und diesen nun neu beschaffen müsse, »auch für einen fertigen Maler gerühmt werde«. Am 1. August wird für Herneisen, abgesehen von Dietterlein, der ungefähr im Lohne gleichsteht, eine Erhöhung seiner Naturalbezüge über die übrigen hinaus beantragt, nämlich 2 Schäffel Dinkel und 2 fl. Hauszins und ½ Eimer Wein pro Tuch mehr und jährlich ein Sommerkleid. Das letztere wurde gestrichen, das übrige zugebilligt. In der zweiten Hälfte Januars bittet der Meister wegen des ersten ihm übergebenen Stückes, des Stuttgarter Forstes mit ihm abzurechnen, da die drei hauptsächlichsten Tücher fertig, die beiden anderen aber innerhalb des Monats vollendet würden, er aber an Lichtmeß an dem von ihm erkauften Haus in Nürnberg 150 fl. abzubezahlen habe.
Nach einer Eingabe am 23. Juni 1591 war er damals auch mit dem Heidenheimer Forst und damit seiner ganzen Arbeit ziemlich fertig. Er bittet darin um Zuteilung auch noch des zu vergebenden Uracher Forstes, erhält aber nur neben drei anderen Malern den vierten Teil desselben.
Nun gab es allerdings noch weitere Arbeiten, die Bemalung des Gesimses, d. h. wohl des Frieses unter Decke, oder über den Fenstern in der Höhe von fünf Schuh. Auch hier war es der Wunsch des Fürsten, sämtliche Maler, die bei der Decke thätig gewesen waren, wieder zu verwenden. Im Frühjahr 1592 wurde darüber verhandelt, um welchen Preis pro Quadratfuß die Maler die Arbeit übernehmen wollten, wenn sie diesmal Farben, Gold, Silber etc. selbst dazu lieferten. Die Maler verlangten für den Geviertschuh einen halben Gulden, aber auf Betreiben des Hofmalers, der unterdessen mit den übrigen in Dissidien gekommen war, beschloß man, ihnen nur einen drittel Gulden zuzubilligen.
Das brachte im April 1592 einen Streit zwischen Herneisen und Wendel Dietterlin einer- und dem Stuttgarter Hofmaler Hans Steiner anderseits zum Ausbruch. Bei diesem beschuldigte Herneisen den Letzteren, neben andern Durchstechereien, die ihn nicht persönlich betrafen, daß der Hofmaler ihm dafür, daß er ihm außer den ursprünglich angedingten Forsten auch den Steinberger Forst zu malen verhelfen werde, von ihm den Lohn für ein »Tuch« d. h. 100 fl. nebst vier Scheffel Dinkel und einen Eimer Wein als »Verehrung« verlangt habe, auch gleich eine dahin lautende Verschreibung nebst Siegel dem Nürnberger habe aufdringen wollen. Die 100 fl. habe Herneisen geben wollen, nicht aber die Viktualien, woraus gegenseitige Feindschaft entstanden sei.
Es würde zu weit führen, auf den Streit, der auf das Künstlerleben jener Zeit eigentümliche Streiflichter wirft und in den Akten in ermüdender Breite wiedergegeben ist, bis auf den fehlenden Abschluß, näher einzugehen.
Der Stuttgarter Hofmaler zeigt sich nach den aktenmäßigen Darlegungen als ein recht trauriger Patron, der mit Heuchelei und Verdrehungen nicht nur seine Kollegen verdächtigt, nachdem er mehr oder minder erfolgreiche Erpressungsversuche gemacht, sondern auch seinen Herrn in schmählicher Weise betrügt. Allein er scheint, obgleich der Referent in der Sache, Dr. Georg Badner, der sich überhaupt stets als ein gütiger und wohl wollender Vertreter der ihm unterstellten Malerkompagnie darstellt, dem Herzog nahe legt, ihn aus den fürstlichen Diensten zu entlassen, in dem allmächtigen Geheimrat des Herzogs, Melchior Jäger von Gertringen, einen starken Rückhalt besessen zu haben; er verlor seine Stelle nicht, wenn er auch nach den Akten in der Angelegenheit des Lusthauses nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Wie gewöhnlich scheint Herneisen mit seiner Arbeit am Fries (Gesims) des Saales rasch fertig geworden zu sein; wenigstens rühmt er sich dessen in mehreren späteren Eingaben. Der Herzog resp. Melchior Jäger behandelten ihn übrigens, jedenfalls unter Einwirkung des Hofmalers, möglichst schlecht. Obgleich im Verding nichts davon stand, wurde nachträglich verlangt, daß im Friese die Bildnisse der Räte und Diener des Fürsten angebracht werden sollten. Herneisen sollte die Vorbilder liefern. Als Herneisen eine Entschädigung verlangt, wird die Sache rückgängig gemacht; den Malern aber die Anfertigung nichts destoweniger zugemutet. Als auch sie insgesamt dafür eine Bezahlung verlangen, wird nach Anhören des Hofmalers u. s. w. die Sache an den bisher nicht am Sims beteiligten Maler Philipp Gretter vergeben und beschlossen, die fremden Maler baldmöglichst ziehen zu lassen. Zu einem sehr ausgiebigen Schriftenwechsel zwischen Herneisen und dem Hof, gab noch eine weitere Arbeit Anlaß. Der Herzog hatte den Maler beauftragt, einen am Neujahrstag 1592 anläßlich eines Feuerwerks stattgehabten Zug, in Öl auf Leinwand auf einer 15 × 22 Fuß haltenden Tafel zu malen. Dafür verlangte Herneisen eine im Verhältnis gleichmäßige Zahlung wie für die Deckengemälde im Lusthaus, nämlich 200 fl. und die dem entsprechende Menge Dinkel und Wein. Da er an sechzig Porträts darauf anbringen mußte, war die Summe vielleicht nicht übermäßig hoch. Es sollte sich an Herneisen aber bitter rächen, daß er keinen Vertrag abgeschlossen, denn der Herzog bewilligte ihm trotz oftmaliger Eingaben nicht mehr als 100 fl., obgleich die Kammerräte und Jörg Badner ihn befürworteten; Melchior Jäger war dagegen. Man scheute sich von württembergischer Seite auch nicht einmal, die Unwahrheit zu behaupten, man hätte so viel »Contrefets« gar nicht gewollt, worauf der Maler die ihm amtlich zugestellte Liste der zu porträtierenden Personen vorlegen konnte. Im August scheint Herneisen, wohl privater Aufträge halber, sich von Stuttgart entfernt zu haben, auf Befehl des Herzogs begibt er sich wiederum dahin, bemerkt aber, daß er mit sämtlichen ihm verdingten Arbeiten fertig sei.
In einer umfangreichen Eingabe ohne Datum, ungefähr im September, bittet er um seine gnädige Entlassung durch eigenes Secret, da er schon längere Zeit in Stuttgart ohne Arbeit liege. Er bittet um die Bezahlung seiner rückständigen Auslagen, dann um eine Entschädigung dafür, daß er in den Jagdstücken zuerst das Gefolge des Herzogs porträtiert und dann die Vorlagen seinen Genossen überlassen habe, weiter ersucht er um eine Erstattung der Reisekosten für ihn, seine Familie und sein Gesinde, eine Verehrung, die er dem Rat seiner Vaterstadt vorweisen und zu Ehren des Herzogs gebrauchen könne, und erinnert an den Abzug seiner Rechnung für den Neujahrsaufzug. Seine durchaus kräftigen Worte, seien teilweise, weil sie seine Lage und Stellung deutlich kennzeichnen, hier mitgeteilt:
»So khann ich mir ainigen gedanckhen nicht schöpffen, Warumben E. Frl. Gn. eben in disem stuckh mit dem Ich Zur Lötz vil grösser gnad Vnd dankh zuverdienen Vnderthenig Verhofft, mich In so mörkhlichen schaden steckhen, Vnnd mir halbe bezalung reichen zulassen gesynnt sein, Oder womit Ich doch hier Innen E. Frstl. Gn. missfälliges (dass ich, da es mir Angezaigt würde, zu änndern Vndthänig (sic) erbiedtig) gethan haben solte, Dieweil aber mir Armen Hanndtwerkhsmann vil zu schädlich Vnnd meinem Weib Vnnd kleinen Khindlin zu nachtheilig Vnnd Übel gehennd sein will, Ein solliche grosse Summam, In lannger saurer, bestölten Arbaitt wol Verdientes gellt, mir Abzichen, da doch hiebeuor E. Frstl. Gn. mich Vnnd Anndere Jedesmahls Verrichter Arbaitt mit gnaden nach Pillich dingen bezahlen lassen, So Pidt E. Frstl. Gn. Ich gantz Vnderthenig, sy wöllen auch dises Puncten halbenn mir die gepür gnedig verordnen.« Er schlägt schließlich die Prüfung seines Bildes durch auswärtige Maler vor. Der Vorschlag der Rentkammer und Badners, ihm 10 fl. Reisegeld und einen Becher im Werte von 26–30 fl., sowie Erstattung seiner Auslagen zu gewähren und nochmals seine Bitte um Nachzahlung für den Aufzug in Erwägung zu ziehen, fand natürlich den Beifall Jägers, der schon früher vorgeschlagen, man solle das mehrerwähnte Gemälde, wenn Herneisen nicht mit 100 fl. zufrieden sei, ihm ohne jede Entschädigung zurückstellen, nicht. Er erhält, nach dem ihm noch die Farben für das Bild ersetzt worden (21 fl.), am 22. Sept. ein Sommerkleid bewilligt, wobei Melchior Jäger in Bewahrung seiner kleinlichen Gesinnung ihm den seidenen Besatz und die Knöpfe streicht. So wird unser Meister wohl mit sehr gemischten Gefühlen die schwäbische Hauptstadt mit Weib und Kindern verlassen und in sein Heim am Geyersberg zu Nürnberg zurückgekehrt sein.
Übrigens hat Herneisen auch von Nürnberg aus versucht, zu seinem Geld zu gelangen. Der Rat hatte ihn schon am 15. April 1591 mit einer Erlaubnisurkunde, die Arbeiten in Stuttgart unaufgesagt seines Bürgerrechts fortzuführen, ausgestattet und ihn weiter, wie auch aus den Akten hervorgeht, dem Herzog empfohlen. Am 16. Dezember 1692 erfolgt ein weiterer Ratserlaß des Inhalts: »Auss Endresen Herneysens Malers supplication und fürschrifft an Herrn Ludtwigen Hertzogen zu Württemberg ec. ist verlassen dem Supplicanten antzuzeigen, das mein herren nit sehen köndten, wie er vil erlangen vnd zu wegen bringen möcht, wenn er inn dieser seiner Suppli[S. 26]cation den Melchior Jeger als einen geheimbsten Carmmerrat, vnd dann den Hofmaler antziehen wollt, wenn er aber ein solchs endern vnd auslassen wurd, so wolten Ime meine Herren ein fürschrifft mitteylen.« Herneisen hatte offenbar Melchior Jäger und Hans Steiner in seiner Eingabe an den Herzog angegriffen, was zum mindesten für die Erreichung seines Zieles sehr unklug war.
Noch einmal kam er mit dem Rat in Konflikt wegen eines Gemäldes, das er 1593 gemalt. Es wird eine »Tafel von allerley Calvinisten« genannt und ihm vorgeworfen, daß er dasselbe zum Ärgernis der Bürgerschaft zum Hause herausgehängt. »Der Rat ließ ihm solches untersagen; Herneisen achtete aber nicht darauf und hing noch einmal eine solche Tafel heraus. Nun wurde er vom Rate zur Rede gesetzt; der Maler entschuldigte sich, er habe die Tafel bereits nach Würzburg, dahin sie gehöre, geschickt; ein ehrbarer Rat möge es dabei bleiben lassen. Das geschah; aber eine sträfliche Rede mit Warnung ließen ihm die Herren dennoch sagen«[62].
In den Jahren 1597 erscheint Herneisen zum letzten Male in den Ratsverlässen. Es handelt sich, wie es scheint, um einen Aus- oder Anbau an seinem Haus am Geyersberg, den er anbringen wollte, wogegen sich aber sein Nachbar Jonathan Schwingsherrlein sträubt und dessen Ausführung auch trotz vielmaliger Eingaben der Rat nicht zugibt.
Nach dem von Direktor Bösch[63] jüngst in diesen Blättern veröffentlichten Verzeichnis der Nürnberger Maler von 1596–1659 war Andreas Herneisen von 1596–1600 Vorgeher des 1596 neugeschaffenen Handwerks der Maler. Daß er als der erste dieses Ehrenamt bekleidete, ist ein Beweis seiner Tüchtigkeit, wie der Achtung, mit der ihm seine Nürnberger Berufsgenossen entgegenkamen. Nach derselben Quelle bildete er nach 1596 noch vier Lehrlinge aus, nämlich Jeremias Putz, Hans Albrecht Stahl aus Bamberg (1594–97), Lienhart Kilga (1603–8) und Wilhelm Vogel (1606–10). Hieraus ergibt sich, daß Herneisen bis zum Tode die Kunst betrieb. Auch erfahren wir, daß ein Sohn von ihm, der erst in den 90er Jahren geboren sein kann, Namens Valtin (Valentin) den Beruf des Vaters ergrift, allerdings erst nach dessen Tode. Derselbe lernte 1610–1614 bei Wolf Eisenmann.
Es ist die letzte verbürgte Nachricht, die sich bisher über unsern Maler auffinden ließ vor seinem Tod.
Denn die in der früheren Litteratur des Öfteren wiederholte Notiz, er habe im Jahre 1613 den Hochaltar von St. Sebald gemalt, kann deshalb nicht wahr sein, weil er zu dieser Zeit längst gestorben war.
Nach dem Eintrag im Totenbuch der Pfarrei St. Sebald[64] ist er am 13. April 1610 verschieden.
Damit sei das Lebensbild des einfachen Nürnberger Meisters geschlossen. Möglich immerhin, daß von seiner offenbar weitverbreiteten Thätigkeit weitere, umfangreichere Werke sich erhalten haben, die mehr als das Genannte dazu beitragen würden, seinen künstlerischen Charakter festzustellen.
VON TH. HAMPE.
Erst vor wenigen Wochen ist die Sammlung frühchristlich-germanischer Altertümer des Museums durch eine Anzahl Kreuze aus dünnem Goldblech bereichert worden, die ich, da sie sich zeitlich unmittelbar an den in unserem ersten Aufsatz behandelten ostgotischen Schmuck[65] anschließen, gleich[S. 28] hier einer kurzen Betrachtung unterziehen will. Ich verbinde damit die Besprechung zweier weiterer Kreuze derselben Art, die sich schon länger im Besitz des Germanischen Museums befinden und von denen das eine auch[S. 29] bereits von Essenwein im ersten Bande dieser Mitteilungen (1886) S. 110 f. gewürdigt worden ist. Ebenso sind die zwölf neu hinzugekommenen Goldkreuze schon verschiedentlich Gegenstand der Untersuchung und Besprechung gewesen und den Fachgelehrten also keineswegs unbekannt. Sie gehörten früher den Kunstsammlungen des 1881 zu Mailand verstorbenen Cavaliere Carlo Morbio an und finden sich zuerst in dem Auktionskatalog dieser Sammlungen S. 57 ff. (Nr. 638–649) von J. Naue ausführlich beschrieben[66]. Diese Beschreibung findet sich um einige ergänzende und kritische Bemerkungen vermehrt auch in dem Aufsatze von Paolo Orsi »Di due crocette auree del museo di Bologna e di altre simili trovate nell’Italia superiore e centrale«[67], der umfangreichsten Arbeit, die bisher der Erscheinung dieser Kreuze — es werden deren im ganzen 81 namhaft gemacht und besprochen — gewidmet worden ist, und erscheint ebenso in dem Auktionskatalog Nr. 1204 von Rudolph Lepke, wo unsere Kreuze unter Nr. 383 aufgeführt werden. Auf eben dieser Auktion (am 14. Dezember 1899 und folg. Tage) wurden die zwölf Kreuze vom Germanischen Museum erworben.
Nach diesem Hinweis auf die hauptsächlichste einschlägige Literatur, die natürlich leicht noch vermehrt werden könnte[68], lasse ich hier zunächst[S. 30] eine kurze Beschreibung der Kollektion unter jedesmaliger Beigabe einer der Größe des Originals entsprechenden Abbildung des betreffenden Kreuzes folgen. Die beiden schon früher im Besitz des Museums befindlichen Stücke sind durch ein Sternchen kenntlich gemacht:
1) Kreuz, aus dünnem Blech von Feingold ausgeschnitten (F. G. 1615. Katalog Morbio Nr. 640, Orsi Nr. 77), der Querbalken wenig kürzer als der Längsbalken, die vier Arme sich gegen die Mitte zu verjüngend und an den Enden zweimal durchlocht. Glatt ohne jede Verzierung. Herkunft unbekannt. 52:47 mm.
2) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1616. Katalog Morbio Nr. 641. Orsi Nr. 46) von der Form des lateinischen Kreuzes. Die Kreuzarme, sich gegen die Mitte zu verjüngend und leise ausgeschweift, sind je mit einem runden Buckel von etwa 5 mm Durchmesser versehen und weisen an den Enden 2 bis 4 Löcher auf. Die Mitte zeigt im Kreis ein Monogramm, das wohl C. Rex zu lesen ist und das man auf den Langobardenkönig Kleph oder Cleve (gest. 576) hat beziehen wollen. Die Richtigkeit dieser Vermutung selbst zugegeben, ist daraus dennoch, wie Orsi mit Recht bemerkt, nicht zu folgern, daß unser Kreuz in irgend einer Beziehung zu König Kleph gestanden habe. Nur als Terminus post könnte die Regierungszeit des Königs für unser Kreuz allenfalls in Betracht kommen. Wer aber leistet Gewähr, daß das C in der That Cleve bedeutet und nicht etwa auf Karl den Großen zu beziehen ist, der nach der Unterwerfung des Desiderius (774), wie auch gemäß einem Vertrage mit dem Langobardenherzog Grimoald III. von Benevent in der Lombardei und im Beneventischen Münzen mit der Aufschrift »DN CARLVS REX«, »DOMS · CAR · R« prägen ließ?[69] Giebt etwa die Numismatik hierüber zuverlässigen Aufschluß? Ich vermag diese Frage zur Zeit weder zu bejahen noch zu verneinen, da mir im Augenblick die Speziallitteratur über[S. 31] langobardische Münzen (Quintino, Spinelli etc.) nicht zur Hand ist. Die Paläographie jedoch, von der man vielleicht gleichfalls Hülfe erwarten könnte, kann leider, wie mir Herr Professor Bresslau die Liebenswürdigkeit hatte mitzuteilen, zur Deutung dieses wie der im folgenden zu erwähnenden weiteren Monogramme »wenig oder nichts beitragen«, zumal langobardische Königsurkunden uns — abgesehen von einem Stück von immerhin zweifelhafter Originalität — nur abschriftlich erhalten sind; »und auch wenn wir Originale hätten, würden wir nicht weiter kommen, da die langobardischen Diplome weder von den Königen unterschrieben noch mit einem Monogramm versehen waren.« — Das Kreuz ist unten eingerissen und auch am rechten und oberen Arme etwas schadhaft. Es stammt aus Monza. 63:51 mm.
3) Kreuz aus etwas stärkerem Feingoldblech geprägt (F. G. 1617. Katalog Morbio Nr. 643. Orsi Nr. 47) von schlanker lateinischer Form, mit leicht erhabenem Rande. Die Arme, sich gegen die Mitte zu verjüngend, sind durch Reihen kleiner Buckel gemustert und an den Enden zweimal durchlocht; die des Querbalkens tragen überdies an kleinen goldenen Ketten die gleichfalls durch Prägung hergestellten christlichen Symbole A und ω, ebenfalls aus Gold. In dem kreisförmigen, doppelt umränderten Mittelstück ein A mit angefügtem Abkürzungsschnörkel und die mutmaßliche Abkürzung für Rex. Herkunft: Monza. 67:41 mm.
4) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1618. Katalog Morbio Nr. 644. Orsi Nr. 48), und auch von gleicher Form, Größe und Ornamentierung, nur daß in der Mitte ein E und R mit Abkürzungszeichen erscheint, sowie von gleicher Herkunft.
5) Kreuz, aus dünnem Blech von Feingold ausgeschnitten (F. G. 1619. Katalog Morbio Nr. 646. Orsi Nr. 78), sich der griechischen Kreuzform nähernd, die Arme, sich gegen die Mitte zu verjüngend und aus[S. 32]geschweift, an den Enden dreimal durchlocht. Durch Punzierung oder Prägung hergestellte Punkte oder kleine Buckel bilden die Einfassung und von den Enden der vier Kreuzarme überdies je ein lateinisches Kreuz, das von kleinen mondsichelförmigen Figuren umgeben ist. In der Mitte ein aus kleinen, durch je neun Punkte gebildeten Rauten zusammengesetzes griechisches Kreuz. Herkunft unbekannt. 118:103 mm.
6) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1620. Katalog Morbio Nr. 639. Orsi Nr. 75), von der Form des lateinischen Kreuzes; die Arme, sich gegen die Mitte zu wenig verjüngend, an den Enden zweimal durchlocht. In der kreisrunden, am Rande noch viermal durchlochten Mitte der Abdruck einer Goldmünze Kaiser Leos III., des Isauriers (716–741), die vier Kreuzesarme je von feinem Perlstab und gerader Linie, gegen die Mitte zu nur von ersterem in schwach erhabener Ausführung eingefaßt. Die linke Endigung des Querbalkens, wie es scheint durch Abschmelzen, etwas beschädigt. Herkunft: Benevent. 61:50 mm.
7) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1621. Katalog Morbio Nr. 638. Orsi Nr. 57), doch von annähernd griechischer Form. Die Kreuzarme verjüngen sich gegen die Mitte zu und sind an ihrem Ende zweimal durchlocht. Durch diese Löcher läuft, die Enden der vier Kreuzarme unter einander verbindend, ein schmales Streifchen Goldlahn, und mit eben solchem Goldlahn sind auch die schmäleren Enden der Kreuzarme noch mehrfach umwunden. Im übrigen besteht der Schmuck dieses Kreuzes lediglich aus dem fünfmaligen Abdruck einer Goldmünze des Kaisers Justinus I., des Thraciers (reg. 518–527), die auf beiden Enden des Querbalkens im Avers mit dem Brustbild des Kaisers und Umschrift, auf beiden Enden des Längsbalkens, sowie in der Kreuzesmitte im Revers mit einer Viktoria und Umschrift erscheint. Das Kreuz wurde in der Umgebung des alten Doms von Novara gefunden. 82:76 mm.
8) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1622. Katalog Morbio Nr. 645. Orsi Nr. 15) und der gleichen Form. Die sich gegen die Mitte zu verjüngenden Kreuzesarme sind an ihren Enden zweimal durchlocht und weisen als Musterung ein dichtes aber regelmäßiges Bandgeschlinge auf, während die[S. 34] Kreuzesmitte im Rund ein sogen. spanisches Kreuz (mit durchkreuzten Enden) mit vier Punkten in den am Kreuzungspunkt von Längs- und Querbalken entstehenden rechten Winkeln zeigt. Herkunft: Cividal del Friuli. 67:66 mm.
*9) Kreuz der gleichen Art (F. G. 192. Orsi Nr. 49) und Form, die gegen die Mitte zu sich verjüngenden Arme an den Enden zweimal durchlocht. Längs- und Querbalken sind je durch den gleichen Stempel mit einer Musterung von Bandverschlingungen versehen, die an Riemenwerk erinnern und mit einem dem Fries am Theoderich-Grabmal zu Ravenna verwandten Ornament endigen. Die Längseinfassung wird je durch den Perlstab gebildet, der jedoch nur an den sich verbreiternden Enden des Kreuzes sichtbar, gegen die Mitte zu mit einem Teil des Riemenornaments jedesmal roh weggeschnitten ist. Mit verschiedenen Waffen[70] in einem Grabe zu Mailand gefunden. 56:56 mm.
10) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1623. Katalog Morbio Nr. 642. Orsi Nr. 16) und annähernd der gleichen Form, nur daß der Querbalken hier kürzer ist als der Längsbalken und daß die Kreuzarme, die an den Enden zweimal durchlocht sind, sich nicht so stark gegen die Mitte zu verjüngen. Auch dieses Kreuz zeigt die mehrfache Anwendung eines und desselben Prägestempels, der indessen wohl nicht ursprünglich zu diesem Zweck be[S. 36]stimmt war, da seine Musterung sich offenbar über die Grenzen des Kreuzes noch fortgesetzt hat. Diese Musterung besteht im wesentlichen aus einem sich in seinen Motiven fortgesetzt wiederholenden Bandornament, wobei die entstehenden Schlingen und Endigungen teilweise als Vogelhälse und -köpfe aufgefaßt und demgemäß, doch in strenger Stilisierung, gestaltet worden sind. Dazwischen, wie es scheint, menschliche Hände in langer Reihe. Perlstab-Einfassungen. An zwei Stellen etwas eingerissen. Aus Cividal del Friuli. 75:61 mm.
11) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1624. Katalog Morbio Nr. 647. Orsi Nr. 51), sich der griechischen Form nähernd, doch ziemlich unregelmäßig ausgeschnitten, die Kreuzarme sich nur wenig gegen die Mitte zu verjüngend. An den vier Endigungen je zweimal, im Mittelstück noch viermal durchlocht. Die Kreuzarme sind mit einem Geschlinge von breiten, gerippten Bändern gemustert, die sich an den Endigungen ergebenden Zwickelflächen karriert. Die Mitte weist im Perlenkranz eine rohe männliche Figur mit gescheiteltem Haupthaar, starkem Schnurrbart, erhobenen Händen und zwei Schnörkeln anstatt der Beine auf. An mehreren Stellen etwas eingerissen. Herkunft: Lodi vecchio. 90:92 mm.
12) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1625. Katalog Morbio Nr. 648. Orsi Nr. 50) und von ähnlicher Form; die an den Enden zweimal durchlochten Kreuzarme sich gegen die Mitte zu etwas stärker verjüngend. Die Musterung derselben ist die gleiche wie bei dem vorhergehenden Kreuz, nur daß wegen der geringeren Abmessungen von den karrierten Zwickelflächen an den Enden hier nur Ansätze zu sehen sind. In der Mitte, von Perlstab und einem Kranz kleiner halbmondförmiger Figuren umrahmt, ein stilisierter Adler mit nach links gewandtem Kopfe. Am linken Kreuzarm eingerissen. Aus Varese. 66:58 mm.
*13) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1131) und von griechischer Form; die sich gegen die Mitte zu etwas verjüngenden vier Kreuzarme sind an den Enden zweimal, die Mitte noch viermal durchlocht. Jene sind mit[S. 38] einem Bandgeschlinge ähnlicher Art wie bei den beiden vorhergehenden Kreuzen gemustert; darunter, gegen die Kreuzmitte zu ein ziemlich roh gezeichnetes Menschenantlitz mit langem Haar und Bart. In der Mitte, wie es scheint, ein sich viermal wiederholendes ähnliches Gesicht; dazwischen Schnörkel, die vielleicht auch Locken bedeuten sollen. Die Gesamtmusterung des Kreuzes wurde also offenbar mit drei verschiedenen Stempeln hergestellt, von denen zwei viermal, der für die Mitte einmal zur Anwendung kam. Einer der Kreuzarme und die eine Hälfte eines anderen Kreuzarms (mit dem Bandornament) hat sich losgelöst. Auch sonst weist das interessante Stück, das hier zum ersten male veröffentlicht wird, mehrere kleine Beschädigungen auf. Fundort: Mailand. 92:92 mm.
14) Kreuz der gleichen Art (F. G. 1626. Katalog Morbio Nr. 649. Orsi Nr. 67) und von ähnlicher Form; die sich gegen die Mitte zu verjüngenden Arme an den Enden mehrfach durchlocht. Ein wie es scheint aus dem späten Akanthus entwickeltes doch teilweise zu tierischen Formen umgestaltetes Rankenornament schließt auf den vier Kreuzarmen und der Kreuzesmitte je ein schwer deutbares Monogramm in einem durch eine Punktreihe ornamentierten Rähmchen ein. An den äußersten Enden der Kreuzarme je ein traubenartiges Ornament, doch mit kleinen Ringen anstatt der Beeren. Aus Toskana. 89:87 mm.
(Fortsetzung folgt.)
VON KARL SIMON.
Hierzu eine Tafel.
Zu den schönsten Erwerbungen, die das germanische Nationalmuseum in den Jahren 1898 und 1899 gemacht hat, gehören unstreitig die Abgüsse der Grabdenkmäler Kaiser Friedrichs III. und seiner Gemahlin Eleonore; die Mittel dazu gewährte der Fonds der Habsburger Stiftung.
Eleonore, eine geborne Prinzessin von Portugal, die 17jährig mit Friedrich III. im Jahre 1452 zu Rom feierlich vermählt wurde, starb schon 1467, und bald darauf wurde ihr Grabmal in Angriff genommen.
Es ist eine stark geaderte Platte aus rotem Marmor, die aufrecht befestigt im Chorschlusse der Stiftskirche zu Wiener-Neustadt steht. Sie ist einfach profiliert; in einer rechteckig vom oberen Plattenrande absetzenden Vertiefung befindet sich die nach innen gerichtete vierseitige Inschrift:
DIVI · FRIDERICI
CAESARIS · AVGVSTI ·
CONTHORALIS · LEONORA
AVGVSTA · REGE · PORTVGALLIAE ·
GENITA · AVGVSTALEM
REGIAM · HAC · VRNA ·
COMMVTAVIT · III · NON ·
SEPTEMBR · 1467
In den Ecken oben sind das Wappen des deutschen Reichs und das von Portugal angebracht, unten der österreichische Bindenschild und der steiermärkische Panther. Das lebensgroße Reliefbild der Kaiserin ist in einer Tiefe von etwa 20 cm aus dem Stein herausgearbeitet, auch die vorspringenden Teile ragen nicht über den Rand der Platte hervor. Die Kaiserin steht unter einem reich mit Fransen besetzten Baldachin, dessen Vorhänge nach rechts und links aufgenommen und auseinandergeschlagen sind und in langen Falten herabfallen. Zwischen ihnen wird die Gestalt der Kaiserin voll sichtbar. Die Krone auf dem Haupte, von dem in langen Wellen das fast bis zur Erde reichende Haar herabfällt, in der Rechten den Reichsapfel, in der[S. 40] Linken das Szepter, steht sie in leicht nach rechts ausgebogener Haltung. Die Figur ist durchaus stehend und lebendig gedacht. Das Kissen, auf dem ihr Haupt ruht, ist nur der Ausfluß einer bis gegen Ende des Mittelalters herrschenden Vermischung der Vorstellung des Stehens und Liegens der Grabfiguren.
Die Gewandung, unter der nur die Spitzen der Schuhe zum Vorschein kommen, besteht zunächst aus einem ungegürteten langen Kleide, über dem ein reichverbrämter Mantel liegt, der auf der Brust durch eine Spange zusammengehalten wird. Vom Haupte fällt unter der Krone hervor ein langer Schleier herab, der gleichfalls bis zu den Füßen reicht. Unter dieser Fülle der Gewandung verschwinden die Körperformen von den Hüften abwärts nahezu vollständig. Die Gewandbehandlung ist ausgezeichnet; der knitterige Wurf des schweren Stoffes gegen die grossen Falten des Baldachins in guten Gegensatz gebracht, die Verbrämung und der mannigfaltige Schmuck sorgfältig wiedergegeben. Auch das Gesicht mit der rund vorgewölbten Stirn, der schmalrückigen, in der Mitte ein wenig gebogenen Nase, den feinen, geraden Lippen mit den grübchenartigen Mundwinkeln ist eingehend und zart, fast jungfräulich charakterisiert. Die ganze Gestalt eine ansprechende und vornehme Erscheinung.
Weit reicher ist das Grabmal des Kaisers, das im Passionschor des Stephandomes in Wien steht. Es ist ein Hochgrab (tumba). Wir mußten uns darauf beschränken, die Grabplatte mit dem Bildnis des Kaisers abformen zu lassen, weil unsere Räumlichkeiten die Aufstellung des ganzen Hochgrabes nicht gestatteten, indessen sei des Aufbaues mit einigen Worten gedacht.
Das Monument ist aus rotbraunem, stark geaderten Salzburger Marmor, ruht auf einem 2 Fuß hohen Unterbau und wird oberhalb dieses von einem reich mit Figuren geschmückten Marmorgeländer umschlossen. Auf einem zierlichen Systeme von Stäben, Leisten und Hohlkehlen, zwischen welchen phantastische Tiere ein buntes Spiel treiben, erhebt sich die eigentliche Tumba bis zu einer Höhe von 5′ bei einer Länge von 12′ 3″ und einer Breite von 6′ 4″.
An den Langseiten sind je drei Reliefbilder, an den Schmalseiten je eins, die fromme Stiftungen des Kaisers vorstellen. Die Pfeiler, welche die Felder abgrenzen, zeigen Statuetten unter Baldachinen, die Köpfe der Pfeiler sind mit sitzenden und knieenden Figuren besetzt, welche um den Verstorbenen klagen und für ihn beten. Der ringsum mit Wappenschildern geschmückte oberste Teil der Tumba verjüngt sich etwas und schließt mit einem Gesims ab; über dem dann die Deckplatte liegt.
Dieser ganze Reichtum des Aufbaues dürfte in der deutschen Grabplastik des XV. Jahrhunderts unerreicht sein. Vorbilder sind vielleicht in Burgund (Dijon und Brou) zu suchen. Auch die Deckplatte selbst ist reich ausgestattet. In der Umrahmung steht die Inschrift. Es folgen weiter an den Langseiten Wappen, die Mitte nimmt die Gestalt des Kaisers selbst ein.
Taf. I.

Grabplatte Kaiser Friedrich III.
im Stephansdome zu Wien.
Gefertigt von Nikolaus Lerch um 1490.
Die nach außen gerichtete Legende läuft an drei Seiten und lautet:
FRIDERICUS ·
TERCIUS · ROMANOR ·
IMPERATOR · SP ·
AUGUSTUS · AUSTRIE ·
STIRIE · KARINTHIE ·
ET · CARNIOLE · DUX · DNS · MARCHIE
SCLAVONICE · AC · PORTUSNAONIS ·
COMES · I · HABSPURG · PHERRET · ET ·
I · KIBURG · MARCHIO · BURGOVIE ·
ET · LANTGRAVI · ALSACIE · OBIT · ANNO ·
MCCCC ·
Die Angabe der Jahreszahl ist unvollständig, die Platte war schon bei Lebzeiten des Kaisers vollendet und die fehlenden Zahlen wurden später nicht ergänzt.
Die Wappen sind zur Rechten des Kaisers von oben nach unten das Deutschordenskreuz, der doppelte Reichsadler, zwischen ihnen das kaiserliche Monogramm, der österreichische Bindenschild, mit dem Reichsschwert von einem Löwen gehalten, rechts das Herzogtum Mailand, der Fünfadlerschild (Österr. unter der Enns), der steierische Panther; zu den Füßen endlich der Habsburger Löwe.
Der Kaiser steht unter einem gotischen Baldachin, dessen Flächen figürliche Reliefs schmücken; auf der Vorderseite der heilige Christophorus mit dem Christuskinde, an den Schrägseiten knieende Engel. Der Kaiser ist in Lebensgrösse in vollem Ornat dargestellt, auf dem Kopfe die Krone, in der Rechten den Reichsapfel, in der Linken das Szepter um das sich ein Spruchband mit den fünf Vokalen schlingt, nach des Kaisers eigener Deutung angeblich: Austriae Est Imperare Orbi Universo. Über das lange Gewand legt sich der reichgeschmückte Mantel. Es ist das Bild eines alternden Mannes. Die Stellung ist gebeugt und etwas geziert wie es das späte XV. Jahrhundert liebte, die Last des Körpers verteilt sich nicht ungezwungen auf Stand- und Spielbein. Auch bei dieser Figur ist trotz der stehenden Stellung das Kissen hinter dem Kopfe beibehalten. Die Gesamtwirkung ist äußerst malerisch.
Das Einzelne ist im höchsten Grad fein und sorgfältig ausgeführt; der schwere Stoff der Gewandung mit der knitterigen Faltenlage, die doch das rechte Knie deutlich hervortreten lässt, die Adern an den Händen, endlich das von wallendem Haar umrahmte Gesicht mit der vorspringenden Nase, dem zurücktretenden Kinn und dem charakteristischen, von Schlaffheit zeugenden Falte um Nase und Mund. Das Porträt ist augenscheinlich treffend und entspricht durchaus dem historisch bekannten Charakter des Kaisers.
Von sonstigen Porträts kommt ausser den Fresken Pinturicchios in Siena und den Siegeln besonders eine Medaille von Giovanni de Candida in Betracht, die von 1469 datiert ist und den Kopf des Kaisers in Profilstellung zeigt. Abgesehen von dem jugendlicheren Alter des Dargestellten, finden wir hier schon die erwähnten Eigentümlichkeiten vorgebildet. Von den übrigen ihn vorstellenden Medaillen ist eine vielleicht nach unserer Grabplatte gemacht; [S. 42]soweit sich das bei der Kleinheit des Stückes (17 mm) behaupten läßt. Das Datum der Medaille (18. Oktober 1513) bezeichnet zugleich den Tag, an dem die Gebeine des Kaisers von Wiener-Neustadt in das eben besprochene Mausoleum übertragen wurden. Erst in diesem Jahre nämlich wurde es vollendet.
Damit berühren wir schon die geschichtliche Frage. Über das Geschichtliche der beiden Grabmäler sind wir ziemlich ausreichend unterrichtet. Schon 1467, noch im Todesjahre der Kaiserin, berief Friedrich III. den Steinmetzen Nikolaus Lerch zur Anfertigung ihres Grabmals. Lerch war schon ein bekannter und geachteter Meister als ihm diese Aufgabe übertragen wurde. So hatte er im Dom zu Konstanz das Chorgestühl und die Bildschnitzerarbeit an den Thüren, sowie eine »Tafel« im Chor angefertigt. Er war Werkmeister des »großen Baus« in Straßburg gewesen und Bürger dieser Stadt. Als seine Heimat wird gewöhnlich Leyden angegeben, ob mit Recht, lassen wir dahingestellt; angesichts der eigenhändigen Inschrift an dem schönen Kruzifixus in Baden-Baden: Nicolaus von Leyen erscheint es mindestens zweifelhaft. Sein Aufenthalt in Wien-Neustadt hat naturgemäß länger gewährt; 1472 wird er als Weingutsbesitzer daselbst erwähnt.
Nach der Vollendung des Grabmals der Kaiserin gab ihm Friedrich sein eigenes in Auftrag. Wahrscheinlich ist aber nur die oben besprochene Deckplatte das Werk des Meisters Nikolaus. Seine (verloren gegangene) Grabschrift sagte nur, dass er Chayser Friedrich Grabstein gehauen hat. An einer anderen Stelle heißt es: hette Maister Niclaus nit unsern Herrn Römisch Kaiser kunnen howen uff Stein, so hette man kum ainen stainmetzel funden, der dasselb werk hett kunnen machen.
An beiden Orten ist offenbar nur von der Deckplatte die Rede. Die letztere Stelle (aus dem Jahre 1490) zeigt uns die hohe Achtung der Zeitgenossen vor Lerch’s Können, die auch wir ihm nicht versagen können. Beide Denkmäler gehören ohne Zweifel zu den bedeutendsten Schöpfungen der derzeitigen Plastik und in ihnen glauben wir noch ein Fortschreiten des Meisters zu monomentalerer Auffassung wahrzunehmen.
Die Vollendung des Grabmals, für das vielleicht ursprünglich der mächtige Aufbau nicht geplant war, wurde dem Steinmetzen Michael Dichter übertragen, der es 1513 fertigstellte.
ALBRECHT DÜRER.[A]
VON GUSTAV VON BEZOLD.
An Lebensbeschreibungen Albrecht Dürers ist nachgerade kein Mangel mehr, wenngleich die klassische Biographie unseres größten Malers auch nach Thausing noch zu erwarten bleibt. Die letzten Dezennien haben uns neben Thausings gründlichem Buch drei nach Anlage und Umfang ähnliche Lebensbeschreibungen Dürers gebracht von L. Kaufmann (1880), von Anton Springer (1892) und von M. Zucker (1899). Kaufmanns Buch ist im Auftrage der Görres-Gesellschaft geschrieben und sucht neben Beibringung des Biographischen und Würdigung der Werke die Frage nach Dürers religiösem Bekenntnis in katholischem Sinn zu lösen. Springers Dürer, seine letzte Arbeit ist nur zu teilweisem Abschluß gekommen. Sie ist auf einen allgemeineren Teil, die Biographie und die Würdigung der Werke, und auf einen speziellen, kunstgeschichtliche Erörterungen einzelner Fragen angelegt. Springer konnte nur den ersten vollenden. Dieser zeigt Springers schriftstellerisches Können in hellem Licht, sichere Beherrschung des Gegenstandes und hohe formale Begabung wirken zusammen, das Buch ist ein Kunstwerk, das das Interesse des Lesers von Anfang bis zu Ende wach erhält.
Dürers Stellung zur Reformation ist kontrovers, Katholiken und Protestanten nehmen ihn für sich in Anspruch. Nachdem die Görresgesellschaft vorangegangen war, wollte der Verein für Reformationsgeschichte nicht zurückbleiben mit einer Biographie Dürers, in der die Zugehörigkeit des Meisters zur protestantischen Kirche nachgewiesen wird. Mit der Bearbeitung wurde Professor Dr. Zucker, Bibliothekar der Universität Erlangen betraut, ein genauer Kenner der Werke Dürers, der schon 1886 eine Arbeit über Dürers Stellung zur Reformation gegeben hat. Gleich im Voraus sei bemerkt, dass sich der konfessionelle Standpunkt des Verfassers nicht vordrängt. Die Untersuchung über das Bekenntnis Dürers ist einem eigenen Kapitel zugewiesen, sachlich und für den Unbefangenen überzeugend geführt und die Polemik — vielleicht von einzelnen Ausdrücken abgesehen, maßvoll.
Die Schriften des Vereines für Reformationsgeschichte sind mehr oder minder alle Volksschriften, auch Zuckers Buch verfolgt die Absicht, die Kenntnis Dürers in weitere Kreise zu tragen, die der Kunstforschung fern stehen. Er will eine Vorstellung geben von dem Entwickelungsgang und dem reichen Schaffen Dürers und den Leser geneigt machen, vorurteilslos auf die Schöpfungen des grossen deutschen Meisters einzugehen.
Die Anordnung gruppiert sich, wie bei Kaufmann und Springer, nach den drei Hauptperioden in Dürers Leben und künstlerischer Entwickelung. Die ersten Kapitel behandeln die Jugend und die Lehrzeit mit Einschluß der ersten Reise nach Venedig. Daran schließt sich die Besprechung der Arbeiten Dürers bis zum Jahre 1504. Auf die[S. 44] Erzählung der zweiten Reise nach Venedig folgt die Erläuterung der von 1506 bis 1520 erschienenen Werke. Dann folgt die Reise nach den Niederlanden und die Besprechung der nach dieser noch entstandenen Gemälde und Stiche, sowie der theoretischen Studien und der Stellung Dürers zur Reformation. Es sind eine schlichte Erzählung des Lebensganges und gewissenhafte und zartsinnige Kommentare zu Dürers Werken. Das Buch ist aus gründlicher Kenntnis des Werkes Dürers und der reichen Dürer-Litteratur heraus geschrieben, aber es vermeidet ein zu tiefes Eingehen auf kritische Untersuchungen, zu welchen Dürer ja noch reichlich Gelegenheit bietet. Es ist im besten Sinne populär.
Die Quellen zur Biographie Dürers und namentlich zur Erkenntnis seines Entwickelungsganges bis etwa zum Jahre 1500 sind ungenügend. Er selbst berichtet, daß ihn sein Vater in seinem Handwerk, der Goldschmiedekunst unterwies, daß er aber mehr Lust zur Malerei hatte. Der Vater gab nach einigem Widerstreben nach und brachte ihn 1486 auf drei Jahre zu Michel Wohlgemuth in die Lehre. »In der Zeit verliehe mir Gott Fleiß, daß ich wohl lernete. Aber ich viel von seinen Knechten leiden mußte. Und da ich ausgedient hatte, schickt mich mein Vater hinweg, und bliebe vier Jahr außen, bis daß mich mein Vater wieder fodert. Und als ich im 1490 Jahr hinwegzog nach Ostern, darnach kam ich wieder, als man zählt 1494 nach Pfingsten.«
Wir wissen, daß Dürer nach Colmar ging, um bei Martin Schongauer zu arbeiten, diesen aber nicht mehr am Leben traf, indes nahmen ihn dessen Brüder freundlich auf. 1492 war er in Basel und arbeitete dort an Vorlagen für den Holzschnitt. Es werden ihm neuerdings zahlreiche Holzschnitte in den Baseler Verlagswerken jener Zeit zugeschrieben und ebenso eine Anzahl Vorzeichnungen auf Holzstöcken im Museum zu Basel, welche nicht geschnitten wurden. Zucker verhält sich zweifelnd gegenüber diesen Zuschreibungen. Gewiß ist es schwierig, das Jugendwerk eines noch unfertigen Künstlers rein nach stilistischen Anhaltspunkten zu konstituieren, die Zuschreibungen dieser Arbeiten an den jungen Dürer hat aber doch einen ziemlichen Grad von Wahrscheinlichkeit. Man hat noch andere Wanderziele für die Jahre 1490 bis 1494 nachzuweisen gesucht, Krakau, Köln, Venedig; für die ersteren liegen indes keine irgend zureichenden Gründe vor und die erste Reise nach Italien wird mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Jahr 1495 gesetzt. Sie ist umstritten, wird aber von Zucker mit Recht als eine feststehende Thatsache betrachtet. Wodurch sie veranlaßt war, wird sich kaum mehr aufklären lassen. Mit dieser Reise darf Dürers Lehrzeit als abgeschlossen betrachtet werden, nun tritt er uns als fertiger Meister entgegen.
Die hohe Begabung Dürers lassen schon die wenigen Zeichnungen, die sich aus seiner Jugend, aus der Zeit vor dem Eintritt in Wohlgemuths Werkstatt erhalten haben, erkennen. Schon die älteste, das Selbstporträt des dreizehnjährigen Knaben vom Jahre 1484 zeigt nicht gewöhnliche technische Fertigkeit in der Führung des Stifts und trotz einiger Fehler in der Zeichnung, eine merkwürdige Sicherheit im Erfassen des Charakteristischen.
In Wohlgemuths Lehre hat er sich dann die Technik der Zeichnung und der Ölmalerei und wohl auch die knorrige Härte der Formgebung angeeignet, die ihm Zeitlebens geblieben ist. In der großen Werkstatt Wohlgemuths gab es reichlich Gelegenheit zu technischer Ausbildung. An welchen Werken Dürer beteiligt war, wissen wir nicht. Das Bildnis seines Vaters von 1490 in den Uffizien zu Florenz läßt erkennen, was er als Maler bei Wohlgemuth gelernt hat. Es ist ein sehr ansprechendes frisch aufgefaßtes und trefflich modelliertes Porträt. Gewisse Einzelheiten, die Dürer auch später liebte, wie die sorgfältige Behandlung der Haare und die Spiegelung des Fensters in der Pupille finden sich schon hier. Auch das starke Zurücknehmen der Nasenwurzel, das wir an späteren Porträts Dürers häufig wahrnehmen, ist, wenn auch nicht in auffälliger Weise, zu bemerken. Wenn es bei aller Sorgfalt der Naturbeobachtung noch nicht die frappierende Charakteristik späterer Bildnisse Dürers hat, so ist es doch ein sehr achtenswertes Werk, das innerhalb der Nürnberger Schule seinen Platz mit Ehren behauptet.
Die grosse Reihe der Holzschnitte für Baseler Verleger — angenommen, sie seien sicher Dürers Werk — ist Gelegenheitsarbeit, an welche der höchste Maßstab nicht gelegt werden darf, unter den Holzschnitten des spätesten XV. Jahrhunderts nehmen sie aber einen hohen Rang ein. Es sind ganz oberdeutsche Arbeiten, an welchen auswärtige Anklänge nicht wahrzunehmen sind. Wichtiger für Dürers Entwickelungsgang sind die Eindrücke, die er in Italien empfangen hat. Dürer hat die Renaissance nicht so vollständig aufgenommen wie Holbein, aber doch weisen die Architekturmotive in der grünen Passion, im Marienleben, so frei sie gestaltet sind, auf die eigene Anschauung von Renaissancebauten hin. Formale Zusammenhänge mit italienischer Kunst in der Behandlung der Körperformen finden sich mehrfach in Dürers Bildern und Zeichnungen aus jener Zeit. Auch das Colorit einiger seiner frühen Bilder, namentlich des Dresdener Altars und des Porträts Friedrich des Weisen ist aus der oberdeutschen Malerei nicht zu erklären. Solche Farbenakkorde waren der deutschen Kunst fremd; man geht kaum fehl, wenn man seine Vorbilder in den Eremitani zu Padua oder, im Archivio notarile zu Mantua sucht. Daß hier italienische Erinnerungen nachklingen, geht auch daraus hervor, dass Dürer die coloritischen Eigenheiten dieser Gemälde nicht festhält, sondern bald wieder das mit Lokalfarben arbeitende oberdeutsche Colorit aufnimmt.
Auf die Frage der Proportionen des menschlichen Körpers ist Dürer erst später gekommen (allerdings schon in dieser Epoche aber wohl nicht in Italien, sondern durch Jacopo de Barbari), ob aber nicht seine Kompositionsweise schon in der Apokalypse italienische Einwirkungen verrät, wäre näher zu untersuchen.
Nach seiner Heimkehr nach Nürnberg und seiner Verheiratung hat Dürer mehr für den Kupferstich und Holzschnitt gearbeitet und gezeichnet als gemalt. Noch scheint die Kunstanstalt Michel Wohlgemuths alle bedeutenden Aufträge festgehalten zu haben. In sechs Kapiteln bespricht Zucker die Apokalypse (Fig. 1), die Passionsdarstellungen mit Einschluß der etwas späteren Kupferstichpassion, das Marienleben, die erste Epoche der Thätigkeit als Kupferstecher, die Gemälde bis 1504 und die Einwirkung von Traditionen aus dem Altertum. Am gelungensten sind die schönen Kapitel über die Holzschnittfolgen.
Dürer steht mit diesen Werken schon hoch über seinen Zeitgenossen, wie in seinem technischen Können und der Fähigkeit klar und übersichtlich zu komponieren, so noch mehr an Reichtum und Kraft der Phantasie und an Tiefe der Empfindung. Er hat viel zu sagen und er bringt alles, was er sagt, treffend zum Ausdruck.
Im Spätherbst 1505 reiste Dürer zum zweiten Male nach Venedig und blieb dort bis in das Jahr 1507. Die Veranlassung zur Reise ist nicht bekannt. In Venedig erhielt er bald nach seiner Ankunft von den dortigen Deutschen den Auftrag, ein Altarbild für die Kapelle San Bartolommeo beim Fondaco dei Tedeschi zu malen, er berichtet dies seinem Freund Wilibald Pirkheimer am 6. Januar 1506. Er hoffte das Bild bis Ostern fertig zu stellen, aber die Vollendung nahm ihn bis zum September in Anspruch. Das Bild erregte selbst in Venedig Aufsehen. Noch in des Malers Werkstatt besichtigten es der Doge und der Patriarch und die Maler bekannten, sie hätten schönere Farben nie gesehen.
Das Bild ist das Rosenkranzfest, das heute im Besitze des Klosters Strahow in Prag ist, leider in traurigem Zustande. Die Komposition ist symmetrisch, die Hauptfiguren, Maria, Papst Julius II. und Kaiser Maximilian bilden eine pyramidale Gruppe, zu den Seiten knieen zahlreiche Teilnehmer an dem Feste. Dürer selbst steht mit einem Begleiter hinter denselben; im Hintergrund ist eine Stadt am Fuß eines steilen Berges sichtbar. Die ursprüngliche Farbenwirkung ist nicht mehr zu beurteilen, das Bild ist fast ganz übermalt.

Fig. 1. Die vier Engel vom Euphrat erschlagen das
dritte Teil der Menschen. Holzschnitt aus der
„Heimlichen Offenbarung Johannis“ von 1498.
Dagegen ist die Madonna mit dem Zeisig in der Berliner Gemäldegallerie (Nr. 557 f.), gleichfalls im Jahre 1506 in Venedig gemalt, wenn auch nicht frei von Erneuerungen, im Ganzen wohl erhalten. Sie steht dem Rosenkranzfest nahe und lässt auch auf dessen coloristische Behandlung Schlüsse zu. Die Lokalfarbe herrschst im ganzen Bilde, aber die einzelnen Farben sind trefflich verteilt und gegeneinander gestellt und tragen nicht wenig zu der anmutigen, fröhlichen Gesamtwirkung des reizenden Bildes bei. Das[S. 46] geschlossene Colorit der Venezianer ist gar nicht angestrebt, die sinnliche Schönheit der einzelnen Farben ist betont und sie ist denn wirklich eine solche, daß sie auch den Venezianern Eindruck machen konnte. Unserer Farbenempfindung allerdings entspricht sie nicht mehr vollständig. Wir stellen ein Bild, wie das herrliche Frauenporträt der Berliner Gallerie (Nr. 557 G.), das nur in Venedig entstanden sein kann, coloristisch höher. Es verrät ein intimes Eingehen auf die venezianische Weise und beweist, wie schon der[S. 47] Dresdener Altar und das Bildnis Friedrich des Weisen, daß Dürer dem Malerischen im engeren Sinne keineswegs unzugänglich war. Auch die kleine Kreuzigung in Dresden kann hiefür herangezogen werden. Zucker setzt sie gleichfalls in die Zeit des Aufenthaltes in Venedig, sie dürfte indes wohl einige Jahre früher entstanden sein (vgl. Max Friedländer im Jahrbuch der kgl. preußischen Kunstsammlungen 1899 S. 266.)
Dürer befand sich wohl in Venedig, es fehlte ihm nicht an anregendem Umgang, nicht an Anerkennung und Ehren, ja der Rat bot ihm einen Jahresgehalt von zweihundert Dukaten, um ihn dauernd in Venedig zu halten. Dürer lehnte ab, wiewohl er klar erkannte, was er damit aufgab.
Wie er der Heimat treu blieb, so hat er auch seine eigene Kunstweise in Venedig unentwegt festgehalten. Innerhalb derselben aber hat ihn der Aufenthalt in Venedig mächtig gefördert. Seine Zeichnung erreicht hier die freie Größe, in der er nicht übertroffen worden ist, die Auffassung der Formen hat sich gehoben und geklärt, er strebt nach Einfachheit und baut seine Kompositionen streng gesetzmäßig auf. Auch theoretischen Studien über die Proportionen des menschlichen Körpers und über die Gesetze der Perspektive widmet er sich mit Eifer und sie nehmen in seinen späteren Jahren einen immer breiteren Raum ein. Man nimmt die Einwirkungen Lionardos hiefür in Anspruch. Ich kann diese Frage nicht beurteilen.
Unter den Gemälden, welche Dürer nach seiner Rückkehr geschaffen hat, sind einige seiner Hauptwerke. Die zwei Tafeln, Adam und Eva im Prado Museum zu Madrid dürften 1507 noch in Venedig entstanden sein. Der Eva und der Madonna mit dem Zeisig liegt das gleiche Kopfmodell zu Grunde. Ich muß bekennen, daß sie in ihrer künstlerischen Wirkung die hochgespannten Erwartungen, mit welchen ich an sie herangetreten bin, nicht ganz erfüllt haben. Es ist in der Haltung der Figuren eine etwas gesuchte Grazie, die Dürer sonst fremd ist. Rein formal betrachtet sind die beiden Gestalten allerdings sehr schön.
In den Jahren 1508 und 1509 entstand der Heller’sche Altar (Fig. 2 und 3) für die Predigerkirche in Frankfurt, als Komposition der Höhepunkt von Dürers Schaffen; 1511 wurde der Altar für die Kapelle des Landauer Bruderhauses mit dem Allerheiligenbild vollendet, das jetzt in den Hofmuseen in Wien bewahrt wird. Die ersten Ideen dieser Komposition gehen in das Jahr 1508 zurück. Die Komposition des figurenreichen Bildes ist streng symmetrisch, etwas überfüllt. Unten öffnet sich der Blick in eine weite Landschaft. Das Bild enthält eine Fülle der herrlichsten Einzelheiten. Der feierlichen Anordnung entspricht das lichte, festliche Kolorit. Es gilt von ihm das Gleiche wie von dem der Madonna mit dem Zeisig, die Freude an der Farbe nicht am Ton herrscht vor, es ist für unser Gefühl zu bunt.
1512 vollendete Dürer die Bilder der Kaiser Karl des Großen und Sigismund. Den Typus des ersteren hat er schon im Allerheiligenbilde aufgestellt und hier nochmals in einer großartigen, wenn auch etwas schematischen Einzelfigur durchgeführt. Dem gewaltigen Herrscher gegenüber erscheint der porträtmäßig behandelte Sigismund ziemlich untergeordnet.
In diese Zeit und zwar schon in das Jahr 1508 fällt das unerfreuliche Bild der Marter der Zehntausend, in der Gallerie zu Wien, dessen Vorzüge nur in der Behandlung liegen.
Als Dürer im Jahre 1508 die Himmelfahrt Mariä vollendet hatte, schrieb er an Jakob Heller. Niemand solle ihm mehr vermögen, eine Tafel mit soviel Arbeit noch zu machen. Er käme dabei zu Schaden. Darum will er jetzt seines Stechens auswarten. Es ist freilich nur ein Ausdruck des Unwillens und kurz darauf ist Dürer an dem Allerheiligenbild thätig, aber er hat doch in den folgenden zehn Jahren nicht viel und namentlich keine figurenreichen Bilder gemalt und seine Maltechnik wird eine andere, weniger sorgfältige. War es wirklich dauernde Unlust am Malen und nicht der Mangel an entsprechenden Aufträgen, der auf die Zeit freudigster Thätigkeit eine nahezu völlige Abwendung von der Malerei folgen ließ?
Dürer hat zunächst seine grossen Holzschnittfolgen abgeschlossen und neu herausgegeben und dann neues für den Holzschnitt und Kupferstich geschaffen, darunter die[S. 48] berühmten tiefsinnigen Blätter, Ritter, Tod und Teufel, die Melancholie, Hieronymus im Gehäuse und den großen Holzschnitt der heiligen Dreifaltigkeit. Sie sind von Zucker eingehend und sachgemäß besprochen. Das XII. Kapitel ist den Arbeiten für Kaiser Maximilian, dem Gebetbuch, dem Triumphzug und der Ehrenpforte gewidmet. Ein[S. 49] großer Künstler wird auch undankbaren Aufgaben etwas abgewinnen, ja die Schwierigkeit wird vielleicht seine Erfindungskraft besonders reizen, so bietet denn das Gebetbuch wirklich eine erstaunliche Fülle der reizendsten Darstellungen in leichter und sicherer Federzeichnung, aber der Triumphzug bleibt eine frostige Allegorie und aus der Ehrenpforte war vollends nichts zu machen. Dürers Sache war die Architektur überhaupt nicht; Hans Holbein hätte wohl einen anderen Triumphbogen entworfen, wenn er damals schon thätig gewesen und zu der Aufgabe herangezogen worden wäre. Aber die Aufgabe selbst mit ihrer Überfülle von genealogischen und historischen Beziehungen schloß eine wirklich einheitliche Lösung im Vornherein aus. Und wenn das Werk im Einzelnen viel Schönes bietet, so bleibt doch die Mühe zu bedauern, die Dürer auf diese undankbare Aufgabe verwendet hat. Wußte der Kaiser dem größten deutschen Maler keine[S. 50] besseren Aufträge zu erteilen, so hätte er ihn besser gar nicht beschäftigt. Auch die Verhältnisse in Nürnberg waren nicht dazu angethan, Dürer viele Anregungen zu bieten und große Aufträge Seitens der Stadt oder reicher Bürger blieben vollends aus. Seine Produktivität geht denn auch in den nächsten Jahren zurück. Da brachte die Reise nach den Niederlanden im Jahre 1520 einen neuen Aufschwung.
Kaiser Maximilian hatte Dürer für die Arbeiten am Gebetbuch, der Ehrenpforte und dem Triumphzug ein Leibgeding von 100 Gulden aus der Nürnberger Stadtsteuer angewiesen und ihm 1518 weiter eine Anweisung auf 200 Gulden gegeben, welche 1519 fällig war, er war aber vor der Auszahlung gestorben. Nun weigerte die Stadt die Auszahlung und verlangte dafür wie für das bisherige Leibgeding eine Bestätigung Karl des V. Da nun Karl V. nach den Niederlanden kam, beschloss Dürer, ihn dort aufzusuchen und seine Angelegenheiten vorzutragen. Das war die äussere Veranlassung zur Reise. Geschäftliche Interessen kamen dazu. Dürer reiste am 12. Juli 1520 von Nürnberg ab, diesmal in Begleitung seiner Frau und einer Magd. Die Reise ging über Bamberg, Frankfurt und Köln nach Antwerpen. Das Tagebuch, das Dürer auf dieser Reise führte, ist abschriftlich erhalten und gibt uns ziemlich genauen Einblick in den Verlauf der Reise. Allerdings notiert Dürer manches, was wir leicht missen könnten und verschweigt anderes, was für uns von Wichtigkeit wäre, aber bei alledem bleibt das Tagebuch eines der wichtigsten Dokumente zu seiner Lebensgeschichte.
Die Bestätigung des Leibgedings erhielt er in Köln, wohin er von Antwerpen gereist war, am 12. November 1520, auf die 200 Gulden mußte er verzichten. In Antwerpen wie in anderen Städten wurde er von allen Seiten, namentlich aber von den Malern aufs Höchste geehrt und an künstlerischen Anregungen fehlte es nicht; er besichtigt überall die Werke der großen Meister des vorigen Jahrhunderts, mehr noch förderte ihn der Umgang mit den Lebenden. Dürers Vortrag wird malerisch. Ein Versuch in dieser Richtung, der noch nicht völlig geglückt ist, ist das Bildnis Bernhards von Orley in Dresden. Ein zweites zeigt die volle Meisterschaft. Es ist das als Hans Imhoff bezeichnete Porträt von 1521 im Museum des Prado zu Madrid (Fig. 4). Das Bild ist in mehr als einer Hinsicht das Höchste, was Dürer im Porträt erreicht hat. Nie wieder hat er einen Kopf so eindringlich aufgefaßt und so lebensvoll wiedergegeben, selbst nicht in den schönen Bildnissen seiner letzten Jahre. Was aber noch mehr in Verwunderung setzt, das ist die bei allem Eingehen auß Einzelne freie und breite, im höchsten Sinne malerische Behandlung. Das konnte 1521 auch kein Niederländer besser machen. Wer Dürer als Maler würdigen will, muß dieses Bild gesehen und studiert haben.
Thausing sucht zu beweisen, daß das Bild in Nürnberg und nicht in den Niederlanden gemalt sei. Es ist das eine Frage, welche nicht mit völliger Sicherheit gelöst werden kann. Aber Thausings Argumente, es sei keine Malerei mit geliehenen Farben und fremder Palette, sind nicht zwingend. Gute Farben und Pinsel gab es auch in den Niederlanden und der Aufenthalt in Antwerpen war lang genug zur Ausführung eines sorgfältig gemalten Porträts. Daß Dürer dort Bildnisse gemalt hat, berichtet er selbst. Für die Ausführung in den Niederlanden spricht der Stil des Bildes mit ziemlicher Bestimmtheit, der nicht Nachklänge, sondern unmittelbare Einwirkungen der niederländischen Malerei zeigt. Auch der Umstand, daß das Bild früh nach Spanien gekommen sein muß (bei uns erhalten sich Ölgemälde nicht so unversehrt), spricht dafür, daß es nicht von Nürnberg, sondern von den Niederlanden nach Spanien kam. Wäre es das Bildnis Hans Imhoffs, so wäre es wohl in dem Inventar der Imhoffschen Kunstkammer erwähnt, das ist aber nicht der Fall.
Doch die Frage, ob dieses Bild in den Niederlanden oder erst in Nürnberg gemalt ist, ist nicht von primärer Bedeutung, wichtiger ist es zu sehen, ob Dürer, ein Fünfzigjähriger, noch dauernden Gewinn für seine Kunst aus den niederländischen Anregungen gewonnen hat. Und dem ist so, Dürers Vortrag bleibt von der niederländischen Reise an freier und einfacher als vorher, die malerische Behandlung schwindet nicht völlig, wenn sie auch nicht auf der ausnahmsweise erreichten Höhe bleibt.
Auch in Antwerpen hatte man gesucht, Dürer festzuhalten. Es war ihm ein Gehalt von dreihundert Philippsgulden nebst einem eigenen Hause geboten und alle Arbeiten sollten noch besonders bezahlt werden, aber die Liebe zur Heimat überwog, im Sommer 1521 kam er nach Nürnberg zurück, um sofort wieder die Kleinheit der dortigen Verhältnisse zu empfinden. Der Rathaussaal sollte neu gemalt werden. Die Entwürfe wurden Dürer übertragen, mit der Ausführung aber wurden untergeordnete Maler betraut, welche nach der Malertaxe arbeiteten. An der nördlichen Wand des Saales sind drei große Gemälde, die Verleumdung, der Triumphzug Maximilians und zwischen beiden der Pfeiferstuhl, eine ganz realistische Scene zwischen zwei Allegorien. Es fehlt diesen Bildern die für monumentale Gemälde unerläßliche Anpassung an den Raum. Wie weit dieser Mangel Dürer zur Last fällt, ist kaum mehr zu entscheiden. Die erste Skizze zur Verleumdung (Federzeichnung von 1522 in der Albertina) ist eine wohl angeordnete friesartige Komposition, in der Ausführung sind die Gruppen weiter auseinander gerückt, um den Raum zu füllen, aber es ist damit nur erreicht, daß er überhaupt nicht gefüllt ist, das Bild erscheint zusammenhanglos. Auch der Triumphzug ist dem Raume nur ungenügend angepaßt. Am lustigsten sind noch die Pfeifer auf ihrem Balkon. Dürer mochte an der ganzen Aufgabe, die er nicht ausführen sollte, wenig Freude haben.
Er hat überhaupt nach der niederländischen Reise nicht mehr viel gemalt. Was er noch gemalt hat, sind zumeist Porträts. Das bedeutendste ist das des Hieronymus Holzschuher von 1226 in der Berliner Gallerie; in der charakteristischen Auffassung steht es dem Bild von 1591 in Madrid nahezu oder vollkommen gleich, in der technischen Ausführung[S. 52] kommt es ihm nahe, aber die Behandlung ist doch mehr plastisch zeichnerisch als spezifisch malerisch. In letzterer Hinsicht steht vielleicht das Porträt des Ratsherrn Jakob Muffel noch etwas höher. Neben den Gemälden stehen einige treffliche Porträts in Kupferstich und Holzschnitt (Fig. 5). Dürer hat nicht die ruhige, fast kühle Objektivität Holbeins, er bleibt in der Wiedergabe der Formen immer etwas eckig, aber er erfaßt die gesamte Persönlichkeit weit tiefer als dieser. Zucker macht hierüber einige feine Bemerkungen.
1526 vollendete Dürer auch die zwei Tafeln mit den Gestalten der vier Apostel, jetzt in der Pinakothek zu München. Zucker tritt hier mit Eifer dafür ein, daß Dürer in diesen vier Gestalten die vier Temperamente dargestellt habe. Ich will diese Frage nicht näher untersuchen, denn ich halte sie für überflüssig. Zugegeben, Dürer habe die vier Temperamente malen wollen, so hat er doch in der That etwas ganz anderes gemalt. Die vier Temperamente sind Abstrakta, deren allgemeiner Begriff sich in körperlichen Formen nur unvollkommen aussprechen läßt, die vier Apostel sind konkrete Persönlichkeiten voll des individuellsten Lebens. Eben darin und nicht darin, daß sie schattenhafte[S. 53] Allgemeinheiten sind, beruht ihre nach Jahrhunderten unwiderstehliche Macht; eben darin bilden sie einen Höhepunkt der deutschen, einen Höhepunkt der neueren Kunst überhaupt.
Im Oktober 1526 stiftete Dürer die beiden Bilder auf das Nürnberger Rathaus. Das Begleitschreiben lautete: Fürsichtig ehrber weis lieb Herren. Dieweil ich vorlengst geneigt wär gewest, Euer Weisheit mit meinem kleinwirdigen Gemäl zu einer Gedächtnus zu verehren, hab ich doch Solchs aus Mangel meiner geringschätzigen Werk unterlassen müssen, dieweil ich gewusst, dass mit denselben vor Euer Weisheit nit ganz wol hätt mügen bestehn. Nachdem ich aber diese vergangen Zeit ein Tafel gemalt und darauf mehr Fleiss dann ander Gemäl gelegt hab, acht ich Niemand wirdiger, die zu einer Gedächtnus zu behalten, denn Euer Weisheit. Derhalb ich auch dieselben hiemit verehr, unterthänigs Fleiss bittend, die wölle dies mein kleine Schenk gefällig und günstlich annehmen und mein gönstig lieb Herrn, wie bisher ich allweg gefunden hab, sein und bleiben. Das will ich mit aller Unterthänigkeit um Euer Weisheit zu verdienen geflissen sein. Euer Weisheit unterthäniger Albrecht Dürer. — Der Rat der Stadt beschloß am 6. Oktober, das Geschenk anzunehmen, es der Stadt zu erhalten hat er nicht gewußt, schon nach hundert Jahren kamen sie an den Kurfürsten von Bayern.
Sieht man von dem Curialstil der Widmung ab, so erkennt man leicht, daß sich Dürer des Wertes der Bilder wohl bewußt war, daß er seiner Vaterstadt sein Bestes gab. Man erkennt auch, daß er sein Ende nahen sah; als ein kranker Mann war er aus den Niederlanden zurückgekommen und hat sich nicht mehr erholt. Am 6. April 1528 endete er seine irdische Laufbahn.
Springer sagt in seinem Dürer, ein längeres Leben hätte den von Dürer hinterlassenen künstlerischen Schatz schwerlich vermehrt. Der Tausch des Malerkittels gegen den Gelehrtenrock war endgiltig vollzogen. Wir dürfen uns daher rühmen, daß wir Dürers Werk vollendet besitzen.
Thatsächlich nehmen theoretische Arbeiten in den letzten Lebensjahren Dürers einen breiten Raum ein. Schon früh hatte er gesucht, sich über die theoretischen Grundlagen seiner Kunst Klarheit zu verschaffen. Um 1512–1513 trug er sich mit dem Plane, ein umfassendes Buch zu schreiben, das wir nach heutigem Sprachgebrauch als Lehrbuch der Malerei bezeichnen würden. Der Plan blieb liegen. Nach der niederländischen Reise aber nahm er die Studien wieder auf und brachte wenigstens einen Teil derselben, die Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheit und die vier Bücher menschlicher Proportion, sowie eine kleinere Schrift über die Befestigung von Städten, Schlössern und Flecken zum Abschluß. Diese Werke, namentlich die Proportionslehre gehen nun allerdings über den rein praktischen Zweck hinaus und zeigen, daß die wissenschaftliche Erkenntnis für Dürer Selbstzweck geworden ist.
Ob aber theoretische Studien die künstlerische Produktivität Dürers dauernd zurückgedrängt haben würde, muß billig bezweifelt werden. Dürers künstlerische Entwickelung bewegt sich bis in seine letzten Lebensjahre in aufsteigender Richtung und von irgend welchen Nachlassen der schöpferischen Kräfte ist nichts wahrzunehmen. So möchte er denn wohl bei längerem Leben noch manches geschaffen haben. Da aber der Tod all seinem Schaffen und Wirken früh ein Ende gesetzt hat, ist diese Frage müßig, wohl aber hat eine andere ihre Berechtigung. Ist Dürer zu allseitiger, voller Entfaltung der ihm verliehenen Kräfte gelangt? Und diese Frage kann nicht in vollem Umfang bejaht werden. Dürer ist von dem intensivsten Studium der Natur ausgegangen und hat sich an demselben sein Leben lang weiter gebildet. So ist er denn einer der größten Porträtmaler geworden. Er gibt in seinen Bildnissen mehr als die äußere Form, er gibt das ganze Wesen der Dargestellten. Dadurch ist er weiter befähigt, ideale Charakterfiguren von voller innerer Konsequenz zu schaffen, an die wir glauben, wie an lebende Persönlichkeiten. Solche sind die Apostelfiguren in Kupferstich und vor allem die vier Apostel in München, die mit Recht den höchsten Leistungen aller Malerei beigezählt werden.
Eine so intensive Ausgestaltung des Persönlichen drängt zur Einzelfigur. Dürer hat darin erreicht, was möglich war, ein Überbieten ist kaum denkbar. Allein sein Können war in der Schaffung einzelner großer Gestalten nicht beschlossen, Begabung[S. 54] und Neigung waren ursprünglich auf die Darstellung bedeutender Vorgänge in strengen Kompositionen gerichtet. Die Himmelfahrt Mariae, das Rosenkranzfest, das Allerheiligenbild sind solche Werke. Aber schon mehrere Blätter der Apokalypse gehören hierher, sie sind trotz des kleinen Maßstabes monumental. Um zu voller Wirkung zu kommen, verlangen solche Kompositionen einen großen Maßstab. Was wir von Kompositionen des großen Stils von Dürer haben, läßt wohl erkennen, daß er zur Monumentalmalerei berufen war, allein die Aufträge blieben aus und deshalb ist auch diese Richtung von Dürers Kunst nicht zu voller Entfaltung gekommen. Wenn Dürer mehr als einmal das Malen verschwört, so sind solche Aussprüche nicht durch die Vorliebe für Holzschnitt und Kupferstich, sondern durch den Mißmut über die kümmerlichen Verhältnisse veranlaßt, in Folge deren er keine Aufträge auf große Bilder erhielt, oder wenn er solche erhielt, so schlecht bezahlt wurde, daß er von langer aufopfernder Arbeit keinen Nutzen hatte.
So bilden denn Kupferstiche und Holzschnitte einen sehr großen Teil von Dürers Werk. Durch sie hat er auf das Volk gewirkt und ist volkstümlich geworden, wie kein zweiter deutscher Maler. Noch heute sind seine Blätter im Original oder in guten Nachbildungen in den Händen Vieler. Mit Recht hat ihnen deshalb Zucker ausführliche Betrachtungen gewidmet.
Aber sein höchstes Können hat Dürer nicht im Kupferstich, sondern in der Zeichnung erreicht. Der Zeichner Dürer kommt bei Zucker wohl etwas zu kurz.
Dürers Zeichnungen sind schon technisch betrachtet von wunderbarer Schönheit (Fig. 3). Er führt die Feder, den Silberstift und die Reißkohle mit gleicher Meisterschaft, sein Strich ist breit und sicher, mit den einfachsten Mitteln werden die beabsichtigten Wirkungen erreicht. Dabei sprechen Dürers Zeichnungen die Gedanken mit packender Unmittelbarkeit aus. Zu ihrem vollen Erfassen ist ein gebildetes Auge erforderlich, wer sich aber den Blick für sie angeeignet hat, dem sind sie ein unversiegbarer Quell des edelsten Genußes. Sie sind neuerlich durch die Ausgabe Lippmanns, die den Originalen so nahe kommt, als es die heutige Reproduktionstechnik gestattet, zwar nicht weiten Kreisen, doch aber allen wohlhabenden Liebhabern zugänglich geworden.
Die Bedeutung eines Künstlers für spätere Jahrhunderte bemißt sich nach dem Verhältnis des allgemein Menschlichen zum zeitlich bedingten, das sich in seinen Werken offenbart. Manches ist uns an Dürer fremd geworden, ist veraltet; aber des Bleibenden ist unendlich mehr und seine Werke werden für alle Zeiten zu den herrlichsten Besitztümern der Menschheit zählen.
Geschichtliches über das Franziskaner-Minoriten-Kloster in Würzburg. Von P. Benvenut Stengele. Würzburg, Andreas Göbels Verlagsbuchhandlung. 22 SS. 8o. 25 Pfg.
Das Schriftchen gibt in knappem Rahmen Auskunft über alle wichtigeren Ereignisse in der Geschichte des Klosters von seiner Gründung im Jahre 1221 bis auf die neueste Zeit. Von allgemeinerem Interesse sind die Mitteilungen über die Schwierigkeiten, welche dem Orden im Anfang seiner Wirksamkeit seitens des Säcularklerus bereitet wurden und die Nachrichten über den Bau und die Umgestaltungen des Klosters und der Kirche. Leider wurde letztere, ein Bau Bischof Julius Echters, vor etwa 20 Jahren in ziemlich unverständiger Weise in gotischem Stil restauriert.
Lorenz Fries, der fränkische Geschichtsschreiber und seine Chronik vom Hochstift Würzburg. Von Dr. Josef Kartels. (Quellennachweis bis Mitte des XIII. Jahrhunderts und Kritik.) Würzburg, Bonitas-Bauer 1899. 8o. (190 S.)
Wer, angezogen von dem überall zu Tage tretenden liebenswürdigen Wesen des trefflichen fränkischen Chronisten M. Lorenz Fries, sich versucht fühlt, dessen Lebensschicksalen nachzugehen und besonders in die Werkstätte dieses Geistes zu schauen, der wird dies gerne aufs neue an der Hand einer mit Fleiß und Hingebung geschriebenen Würdigung des »Vaters der fränkischen Geschichte« thun. Einer Anregung des verstorbenen Geheimrats von Wegele entsprang die uns vorliegende Schrift — ursprünglich Würzburger Dissertation.
Nach der Darlegung der näheren Umstände eines Deutschen Humanistenlebens, erläutert ein erstes Kapitel Veranlassung und Zeit der Abfassung, Umfang und Anlage der Chronik. Weiterhin wird es dann zum erstenmal unternommen, die Quellen des Magisters für seine fränkische Chronik im einzelnen zu würdigen und seine historische Bedeutung ins rechte Licht zu setzen. (Eine kurze Zusammenstellung hatten allerdings schon Heffner-Reuß in der kleinen Schrift »Lorenz Fries, der Geschichtsschreiber Ostfrankens. Würzburg 1853« p. 7 ff. gegeben.) Die lange Folge der hier mit nicht zu verkennender Sorgfalt ausgeführten älteren Geschichtswerke, läßt an Fries wieder die unermüdliche Schaffensfreudigkeit und ausgebreitete Belesenheit bewundern, die uns insbesondere bei den Ergebnissen seiner archivalischen Thätigkeit in Staunen setzen. Die Quellennachweise betreffen namentlich auch eine stattliche Reihe von Urkunden, die dem Hofsekretär in den Kopialbänden der bischöflichen Kanzlei vorlagen.
Bei der strengeren Betrachtung der historischen Befähigung Friesens sieht sich Kartels genötigt, dem zu überschwänglichen Lobe Ludewigs entgegenzutreten und die einmal nicht wegzuleugnenden Mängel vom Standpunkte unserer Auffassung von Kritik abzuwägen. Den Vorwurf von Leichtgläubigkeit, Irrtümern, falschen Schlüssen, Ungenauigkeiten, kann er Fries wiederholt nicht ersparen, wenn dieser auch sonst allzutollen Phantasieen eines Trithemius u. a. aus dem Wege gehen mochte. Wird so der kritische Wert nicht allzuhoch angeschlagen, so wird doch der ihm mit am meisten verargte[S. 56] Fehler, nicht bis zur ersten Quelle zurückzugehen und Originalurkunden hintanzusetzen, zu rechtfertigen gesucht mit dem bemerkenswerten Einwand, daß Fries nur wenige Urkunden auch wirklich im Original vorlagen. Daß Fries als Franke und insbesondere als Diener seines Herrn, des Bischofs, schrieb, dem er ja auch sein Werk widmete, läßt uns die Voreingenommenheit wenigstens begreiflich erscheinen, mit der die Verteidigung des Gedankens der herzoglichen Gewalt Würzburgs in die Hand genommen wird. Des Chronisten sonstiger Freimut wird vom Verfasser mit Recht wiederholt in entsprechendes Licht gesetzt.
Gegenüber solchen Schwächen finden aber die entscheidenden Vorzüge unseres Magisters einen beredten Anwalt. Man freut und erfrischt sich mit dem Verfasser an dem warmen Eintreten des Humanisten für Deutsche Sprache und Deutsches Wesen und bedauert umsomehr den Verlust der Friesischen Schrift »Von der Art, Eigenschaft und dem Gebrauche der hochdeutschen Sprache«. Gewisse Glanzstellen in Stil und Ausarbeitung werden beleuchtet, wie z. B. einzelne seine Charakteristiken, das Zurückgreifen auf verschiedene ältere Lieder und Epigramme, die der Chronist mit Geschick in seine Darstellung verflicht. Gedrängte Übersichten geben uns ein anschauliches Bild, welch eine Fülle des Materials für Wirtschafts-, Verfassungs- und Rechtsgeschichte, für die Kunde der Würzburger alten Stadt- und Landestopographie, für Kunst-, Kultur- und Sittengeschichte sich in dieser Bistumschronik versteckt. Wieviel sich für die scientia amabilis unserer Tage, die Volkskunde, an Nachweisen von alten Volksbräuchen u. dgl. aus diesen Blättern gewinnen läßt, ist wenigstens angedeutet. Friesens Sinn für den inneren Wert der Sagen, seine Erkenntnis der historischen Bedeutsamkeit von Liedern und Inschriften, seine Vorliebe für das kecker zeichnende Sprichwort, hätten vielleicht an anderer Stelle ein klein wenig mehr Platz verdient. Die trefflich durchgeführten Sittengemälde, die oft das Leben und Treiben des geistlichen Standes zum Gegenstand haben, die Aufmerksamkeit, die Fries dem Judentum und dem Sektenwesen in Franken, dem wechselnden Verhältnis von Bischof und Stadt schenkt, findet sich andererseits entsprechend hervorgehoben. Die Abneigung gegen die päpstliche Politik in Deutschland, der Fries sehr unverhohlenen Ausdruck verleiht, setzt Kartels im wesentlichen auf Rechnung von dessen glühender Begeisterung für fränkisch-deutsche Art. Was des Chronisten persönliche religiöse Überzeugung anlangt, so glaubt Verfasser ihn entschieden für den alten Glauben in Anspruch nehmen zu können. Wenn zum Schlusse nochmals Fries das Lob des Fleißes und der Arbeitskraft zuerteilt wird, so ist diesem damit gewiß nur Genüge geschehen.
Wir scheiden von dem Buche mit dem aufrichtigen Wunsche, daß der Verfasser Zeit und Lust finden möchte, die Nachweise der Quellen für die fränkische Chronik über die bisher gesteckte Grenze hinaus auszudehnen, womit er freilich eine Arbeit übernähme, deren Mühe bei dem steten Anwachsen der von Fries für die folgenden Zeiträume benutzten Materialien nicht gering erscheint.
Heerwagen.
VON MAX WINGENROTH.
(Mit 2 Tafeln.)
Den Anstoß zu einer definitiven Umgestaltung des Ofenschema’s sollte die Hafnerei etwa um die 40er Jahre des Säkulums erhalten: der allgemeine Umschwung in der deutschen, insbesondere in der Nürnberger Kunst, der um diese Zeit stattgefunden hatte, konnte auch auf sie nicht ohne Einfluß bleiben. Wir müssen aus diesem Grunde den genannten Umschwung näher ins Auge fassen.
Der neuen Geisterbewegung Italiens, welche wir unter dem Namen Humanismus verstehen, hat zuerst die Stadt Augsburg Thür und Thore geöffnet. Nürnberg, mit dem konservativen Sinn seiner aus Baiern und Franken gemischten Bevölkerung folgte, wie vor kurzem mit Recht dargelegt wurde, nur zögernd und langsam nach. Wie in diesem Falle, verhielt es sich auch mit der Kunst. Die neue, wie man sie nannte, die antikische Bauweise fand den empfänglichsten Boden in der Stadt der Fugger; hier traten auch früh ihre wirksamsten Apostel auf; Nürnberg verhielt sich zunächst eher ablehnend. Doch ihren Siegeslauf wie durch ganz Europa, so auch durch Deutschland konnte nichts aufhalten und es will uns müßig scheinen, das zu bedauern. — Schon Dürer hat bekanntlich zahlreiche Renaissance-Elemente in seine Werke aufgenommen, aber man darf sagen, daß sein Formgefühl durchaus das der Gotik blieb. Immer lebhaftere Kunde indeß von der Herrlichkeit des neuen Stiles drang über die Alpen. Mantegna’s und anderer Stiche, verzierte Bücher, insbesondere die Hypnerotomachia des Polifilo regten zu genauerer Bekanntschaft an. Und in solcher persönlichen Anregung dürfte auch die Bedeutung eines Jakob Walch für die Nürnberger Künstler zu suchen sein. Aber alles das hätte nicht genügt, ein wirkliches Verständniß für die neuen Formen zu erwecken: die persönliche Bekanntschaft mit den Werken der neuen[S. 58] Bau- und Dekorationsweise mußte den Ausschlag geben. Und so zogen voll Wanderlust die deutschen Meister gen Süden: vor allem nach Oberitalien, wenige nur werden weiter nach Süden oder gar nach Rom vorgedrungen sein. So ist denn auch von einem Einfluß des Florentiner Dekorationsstiles nichts zu spüren. Oberitalien: Venedig und die Terra ferma, Mailand, vor allem aber die Certosa von Pavia und der Dom von Como sind die bestimmenden Vorbilder für die deutsche Kunst gewesen. Mußten sie doch in ihrem überquellenden, dekorativen Reichtum, ihrer Häufung lebensvoller Motive den Herzen der deutschen Künstler anders zusagen als die Florentiner Renaissance, für deren Klarheit und feines Maßhalten ihnen jegliches Verständnis fehlte, ja immer gefehlt hat. Unter den frühesten dieser Wanderer befand sich zweifellos ein Sohn Peter Vischers, Peter der Jüngere, wenn wir auch die hiefür angeführten Urkunden kaum auf ihn anwenden dürfen[71]. Er kam noch frühzeitig genug zurück, um dem Vater die Resultate seiner Reise vorzulegen und die beiden großen Künstler begaben sich nun daran, dieselben an dem Sebaldusgrabe, das ursprünglich in gotischem Sinne geplant war, in ausgiebigster Weise zu verwerten. Mag auch die Gotik hie und da durchblicken, der naive Beschauer erhält den Eindruck vollständiger Renaissance und ähnlich mußten die Künstler urteilen, welche damals das Wunderwerk ansahen. Es ist die Renaissance der Certosa, mit der hier die Nürnberger bekannt gemacht werden. 1516 zog ein anderer Sohn des Altmeisters, Hermann, nach Rom und auch er brachte reichliche Ausbeute. Der Eindruck dieses Meisterwerkes nun, das heute wohl als das vollkommenste Kunstwerk bezeichnet werden darf, welches die alte Reichsstadt noch in ihren Mauern birgt, dieser Eindruck muß ein geradezu siegender gewesen sein. Und daß er nicht verloren ging, dafür sorgten die Arbeiten, welche in dem folgenden Jahrzehnt (1519–1529) aus der Werkstatt der Vischer hervorgingen: ich erinnere vor allem an das Grabmal Friedrichs des Weisen, die Epitaphien der Eisen und Tucher und endlich an das wichtigste, das leider verlorene Fuggergitter, welches nach den erhaltenen Zeichnungen geradezu den Triumph der Renaissance in Nürnberg bedeutet. Man war lange geneigt, die Bedeutung der Vischer’schen Gießhütte zu unterschätzen. Jetzt dürfen wir wohl sagen, daß der Altmeister und seine Söhne die treibende Kraft waren, sie haben den Bann gebrochen und den Nürnbergern die Augen geöffnet. Was mußte es nicht bedeuten, wenn der nach Dürer mächtigste Faktor in dem Kunstleben der Stadt — und das war die Vischer’sehe Gießhütte, deren Ruhm in Deutschland kaum geringer war, als der des Malers — mit solcher Entschiedenheit für den neuen Stil eintrat? — In gleicher Zeit waren die sogenannten Kleinmeister bestrebt, den neuen Stil in origineller Weise zu verdeutschen und zu verbreiten. Um 1530 war der Boden vollständig vorbereitet; aber noch war auf vielen Gebieten der Kunst und insbesondere des[S. 59] Kunstgewerbes ein Schwanken und eine Unsicherheit bemerkbar; diese verschwindet erst in dem folgenden Jahrzehnt und ein Styl bricht sich Bahn, den wir vielleicht als fränkische Hochrenaissance — sit venia verbo — bezeichnen dürfen. Charakteristische Momente hierfür sind: die endliche Aufstellung des ursprünglich für die Fugger bestimmten Gitters im Rathaussaale, der Bau und die Innendekoration des Hirsvogelsaales, die Thür im Standesamt, das Tucherhaus und zwar vor allem die Täfelung zweier Räume desselben, zwei Schränke im germanischen Museum[72] (der eine 1541 bezeichnet), vielleicht noch der emaillierte Pokal der Pfinzing’schen Stiftung[73] und einige Oefen, die der Gegenstand dieses Aufsatzes sind.
Neben dem Fuggergitter scheint das Schaffen des Peter Flötner den Ausschlag gegeben zu haben. Dieser Künstler ist in seiner Bedeutung eigentlich erst in dem letzten Jahrzehnt entdeckt worden. Da der Umkreis seines Schaffens noch immer strittig zu sein scheint und somit auch das Urteil über seine eigentliche Bedeutung, er aber mit unserem Thema in nächster Beziehung steht, so müssen wir von unsrer Stellung zu der »Flötnerfrage« kurz Rechenschaft geben. Absolut sicher d. h. zweifellos bezeichnet vom ihm sind etwa dreißig Holzschnitte, fünf bis sechs Zeichnungen, eine Holzstatuette des Adam in Wien, zwei Medaillen und ein Medaillenmodell aus Speckstein, aus gleichem Stein ein Plakettenmodell, endlich durch Neudörfer bezeugt der Kamin im Hirsvogelsaal[74]. Die Daten, die wir auf diesen Werken besitzen, gehen von 1526–1546; vor 1522 ist der Meister in Nürnberg eingewandert, 1546 ist er gestorben. Dazu kommt eine Notiz Sandrarts, der ihn Formschneider nennt, sowie eine solche Doppelmayrs über »die drei schönen mit Wasserfarben gemalten Stuck« aus der Praun’schen Kunstkammer. Das sollte eigentlich, zusammengehalten mit dem Bericht Neudörfers — hier besonders wichtig, weil es sich um einen direkten Zeitgenossen handelt —, den es korrigiert und ergänzt, genügen, um des Meisters kunstgeschichtliche Stellung zu fixieren, wenn man bedenkt, wie es der klassischen Archäologie gelingt, aus viel geringeren Bruchstücken das Bild alter Künstler aufzubauen. Wir gewinnen aus all dem folgende Anschauung des Meisters: er arbeitete in Speckstein und Holz, sowohl Modelle für Medaillen und Plaketten, Vorlagen für Goldschmiede etc., als auch selbständige kleine Skulpturen, letztere manchmal auch in Kirschkern, Korallenzinken u. s. w. Ebenso konnte er in großem Maßstabe und in Sandstein arbeiten. Architektonische Entwürfe im Holzschnitt kamen dazu, Landschafts- und figürliche Darstellungen, sowie Vorlagen für Kunstgewerbe, worunter die ersten der Art in Deutschland für Renaissancemöbel. Er war selbst Formschneider. Er zeichnete und aquarellierte schön. In »Perspektiv und Maßwerk« war er erfahren. Das in den meisten Fällen neben dem P. F. als Signatur angebrachte Handwerkszeug des Holzschnitzers legt uns, mit Vorstehendem in Verbindung gebracht, die Vermutung[S. 60] sehr nahe, daß er selbst kunstgewerbliche Gegenstände in Holz geschnitzt hat. Auch die Qualität seiner Leistungen muß eine hohe gewesen sein. Er beherrscht den menschlichen Körper gut und frei: mit Ausnahme der sicher frühen Adamsstatuette ist von dem Modell — wie noch bei so vielen Zeitgenossen — nichts mehr zu spüren. Seine Landschaften zeichnen sich durch malerische und leichte Behandlung aus. Die Medaillen und die Plakette gehören zu den besten deutschen Produkten auf diesem Gebiete: es verrät sich in ihnen ein Sinn für Schönheit der Form, der nur allzuselten ist. Durch die gleichen Eigenschaften werden seine ornamentalen Entwürfe ausgezeichnet und sie heben ihn über alle Ornamentisten der Zeit hinaus. »In Bezug auf Eleganz und Schliff steht er allein Holbein nicht nach, dem er nur an Kraft und Frisch weichen muß, wie Lichtwark mit Recht sagt. Auch ein Neuschöpfer scheint er gewesen zu sein, denn man wird ihm hauptsächlich die Einführung der Moreske in Deutschland zuschreiben dürfen, die er sofort mit höchster Sicherheit und Geschmack handhabt. Er ist fast der Einzige, der die reinen Formen der oberitalienischen Frührenaissance einigermaßen versteht und darin arbeitet, ohne daß das seiner schöpferischen Leistung in Anbetracht der damaligen Lage Abbruch thut. Oberitalien muß er aufs eifrigste studiert haben. Nicht nur, daß ein Teil seiner Betten Variationen, allerdings freie und selbständige nach Polifilo sind; die Erinnerung an die Certosa und an Como verfolgt ihn stets in seinem Schaffen; seine Kapitelle und sein Rankenwerk, Grottesken und Trophäen, seine architektonischen Entwürfe sind unter dem direkten Einfluß des Comasker Domes entstanden; ebenso die Art, wie er Delphine, Voluten und anderes verwendet. — Seinen deutschen Zeitgenossen steht er durchaus selbständig gegenüber, insbesondere Dürer, wie schon als auffällig bemerkt wurde, aber auch Peter Vischer. Alles in Allem ein Meister von respektabler Vielseitigkeit und Begabung, wie geschaffen, nach dem Tode der Genannten die Führung in Nürnberg zu ergreifen. War er diesen auch weitaus nicht ebenbürtig, so fand er jetzt, soviel wir wissen, seines Gleichen kaum mehr in der Stadt. Auch dasjenige, was wir ihm auf Grund obengenannter Werke mit aller Sicherheit, die überhaupt Stilkritik sowie andere Kombinationen geben können, zuschreiben dürfen, bestätigt das Gesagte. Unter anderem gehören dazu die meisten Holzschnitte zum Vitruv und zur Perspektive des Rivius, die allerdings zum Teil nach Cesariano gearbeitet sind, aber selbst dann, wie schon Lübke bemerkt hat, denselben verbessern, in vielen Fällen auch die einfache Kontur mit reicherem Leben ausfüllen. Über die große Bedeutung der beiden Drucke und ihrer Illustrationen für die Kunst der Zeit ist es überflüßig, ein Wort zu verlieren. — Kurz: Flötner ist zwischen 1530 und 1540 von dominierendem Einfluß auf die fränkische Kunst gewesen, wenn auch nicht der Bahnbrecher der Renaissance κατ’ ἐξοχὴν, wie man ihn genannt hat.
Neben ihm darf nur noch Augustin Hirsvogel genannt werden, dieser unstete, von einer Thätigkeit zur anderen übergehende Meister, man möchte sagen ein auf kleineres Maß reduzierter deutscher Lionardo, von dem wir ob lauter Vielseitigkeit nur wenig besitzen und über den uns trotz Friedrichs[S. 61] verdienstvoller Monographie[75] noch die nötige Klarheit fehlt. Für seine hohe Begabung haben wir erst vor kurzem einen neuen Beweis erhalten durch Sigm. Wellisch[76], der gezeigt hat, daß »Hirsvogel, dem als Urheber einer der ersten Stadtvermessungen der Ruhm gebührt, in der Geschichte der praktischen Geometrie als Bahnbrecher genannt zu werden, bei seiner geometrischen Aufnahme der Stadt Wien im Jahre 1547 eine regelrechte Triangulierung angewendet hat, wonach ihm die Ehre gebührt, künftighin in der Geschichte als der älteste Erfinder der Triangulierung bezeichnet zu werden.« Diese bedeutende Erfindung wurde zuerst einem Franzosen (1692), dann einem Engländer (1671), endlich und bis heute dem Niederländer Snellius (1617) zugeschrieben. Siebzig Jahre vorher scheint sie aber schon Hirsvogel gekannt zu haben. — Um nun seine künstlerische Bedeutung zu würdigen, wollen wir uns wiederum an das Signierte halten: es ist nicht allzuviel. Neudörfer spricht von seiner hervorragenden Leistung in der Glasmalerei, er habe eine sonderliche Tuschierung und im Glasbrennen sonderlichen Vorteil erfunden, auch im »Reißen« sei er gewaltig gewesen, überhaupt seinem Vater und Bruder (der wichtigsten Glasmalerwerkstätte Nürnbergs am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts) in der Kunst überlegen. Friedrich hat ihm daraufhin die Glasfenster der Rochuskapelle zugeschrieben, welche aus seines Vaters Werkstätte hervorgegangen sind; doch sind die Gründe, die H. Stegmann[77] dagegen angeführt hat, so gewichtig, daß wir bis auf weitere Forschungen davon absehen müssen; an der Ausführung war vielleicht Augustin beteiligt, die Entwürfe scheinen von anderer Hand zu stammen. Von seinen Hafnerwerken ist uns nichts Bezeugtes erhalten — längst ist man, und durchaus mit Recht, davon abgekommen, ihm jene zwar kuriosen, aber doch geringwertigen Krüge zuzuschreiben, die im Handel noch unter seinem Namen gehen; — ebensowenig besitzen wir etwas von seinen in Stein geschnittenen Wappen, worin er sehr fleißig und berühmt gewesen sein soll. Dieser Umstand legt, in Anbetracht der damaligen Gewohnheiten, die Vermutung nahe, daß er auch Medaillen- und Plakettenmodelle geschnitten hat. Auch von seinen Arbeiten in Email — wenn damit nicht gewisse Manipulationen der Glasmalerei gemeint waren — wissen wir nichts, wie auch von seinen Malereien. Es wäre sicher eine lohnende Aufgabe, wollte jemand einmal dem gesammten Schaffen und Leben dieses Meisters nachgehen, der auch psychologisch interessant genug scheint; es dünkt mir nicht unmöglich, daß sich noch Kunstwerke seiner Hand und auf ihn bezügliche Urkunden finden lassen. Erhalten sind geometrische und geographische Werke und Abhandlungen, auch ein Concordanz des alten und neuen Testamentes, von ihm selbst zusammengetragen und ursprünglich jedenfalls mit Bildern geschmückt; endlich für unser Thema das Wichtigste[S. 62] — eine Reihe von Radierungen, etwa 150 an der Zahl. Entwürfe für Gefäße, Dolche, Ornamente, insbesondere Grottesken und Mauresken, Jagden, Kostümfiguren, biblische Scenen, Landschaften und Porträts mit ihren ornamental sehr wichtigen Umrahmungen. Hirsvogel ist vermutlich um 1488 in Nürnberg geboren, 1553 in Wien gestorben. Seine Radierungen sind alle datiert von 1543–1550, es scheint also, daß er, früher mit anderen Dingen beschäftigt, erst das letzte Jahrzehnt seines Lebens sich der Ätzkunst gewidmet hat. Auch Hirsvogel ist durchaus Renaissancemeister, steht aber seinen Neigungen nach in schroffem Gegensatze zu Flötner. Strebte dieser nach Eleganz und Schönheit, so überbietet jener, insbesondere in seinen Gefäßentwürfen alle Zeitgenossen durch ausschweifende Phantastik, aber auch frische Originalität. Seine Gefäße sind vielfach Kannen in der Gestalt hockender Böcke mit Visierhelmen, Widder, Menschenkörper mit Löwenbeinen, Füße mit Wade u. s. w., Henkel und Ausguß in tollster Weise aus Löwenschwänzen, Zöpfen, Schlangen, willkürlich gebrochenen Tüchern oder Helmzierden gestaltet. Manchmal gibt er auch die Form eines Pokals und verziert ihn dann mit naturalistischen Früchten, Menschengestalten etc. So barock das alles ist und so stilwidrig es in der Ausführung wirken würde, es geht doch ein kräftiger, großer Zug hindurch, der besonders auffällt, wenn man von den in mancher Beziehung recht schönen Entwürfen des Meisters der Kraterographie (1551) mit ihrer sinnlosen und deshalb kleinlichen Häufung an Gliederungen zu ihm zurückkehrt. Wegen seines Geschmackes an barocken Tierfiguren mußte ihm das Motiv der Groteske besonders zusagen und er hat es denn auch vielfach verwendet, ja, einen eigenen Typus eingeführt: »er zuerst in Deutschland füllt eine Fläche durch übereinandergestellte Figuren und Tiere, die durch hängende Tücher verbunden sind« (Lichtwark). Auch darin aber zeigt sich der Gegensatz zu Flötner: er überfüllt die Fläche und häuft, unbekümmert um Klarheit, willkürlich die Motive übereinander, so vor allem in den Dolchscheiden. Mit souveräner Freiheit verwendet er alle überlieferten Motive und verbindet sie in origineller, vorbildlicher Art, so die Grotteske und das Rollwerk, welch’ letzteres er, seiner großzügigen Manier entsprechend, massiv und einfach behandelt. So ist er in jeder Hinsicht streng zu unterscheiden von den eigentlichen Kleinmeistern. — Was den Einfluß Italiens auf ihn betrifft, so verrät sich wohl in Manchem die Kenntnis Como’s und der Certosa, doch nicht so, daß er mehr wie Bücher, Stiche und Holzschnitte gesehen zu haben braucht: Venedig aber und seine Umgegend hat er gründlich studiert und die Nachwirkung der venetianischen Ornamentik ist nie zu verkennen.
So war also in den Jahren 1530–1540 die Richtung, welche man deutsche Frührenaissance nennen kann, überwunden und es macht sich überall, auch im Kunsthandwerk Nürnbergs das Streben nach reinerer »antikischer« Art geltend; da konnte auch die Hafnerei nicht zurückbleiben. Die nötige Grundlage war geboten durch die technische Errungenschaft, von der wir im letzten Aufsatze sprachen: man hatte bereits angefangen, die Kacheln größer zu bilden als bisher, diese neu gewonnene Fähigkeit wurde nun begierig aufgegriffen und gesteigert: man konnte dadurch und wollte von jener Übereinanderhäufung[S. 63] von Reihen kleiner Kacheln absehen, was erforderlich, wenn man den ganzen Aufbau vereinfachen und ihn zugleich zeitgemäß antikisierend umgestalten wollte. Jede Seite des Aufsatzes erhielt nur mehr eine große Kachel — höchstens noch ein kleiner Fries darunter —, ebenso die Vorderseite des Feuerraumes, dessen Nebenseiten aus zwei Kacheln zusammengesetzt wurden. Die Ecken des Aufsatzes werden durch Pilaster, Säulen oder Hermen betont, welche einen Fries und ein kräftig ausladendes Gesimse tragen; ein ähnliches, von den gleichen Pilastern etc. an den Ecken und manchmal auch zwischen den beiden Seitenkacheln gestützt, erhielt der Feuerraum, der sich nun klar von dem Aufsatz scheidet. Beide haben, den Gesimsen entsprechend, eine kräftige, reich gegliederte Basis, mit Akanthus, Schuppenornament und dergleichen, geziemend geschmückt. Die Pilaster, Friese etc. boten reichlich Raum zur Anbringung beliebter dekorativer Motive; die großen Kacheln zeigen meist eine architektonische Umrahmung, Portikus oder Nische, wie früher, aber in viel flacherem Relief und ohne Häufung von Säulen oder Pfeilern; in dieser Umrahmung in der ersten Zeit mit Vorliebe eine Vase oder eine einzelne Figur, eine Allegorie oder ein Planet und anderes in dem Idealstile der Flötner, Solis und Nachfolger; ohne Beifügung der ehemals so beliebten realistischen Details. Mit geringen Ausnahmen verschmäht man alles Bunte und bevorzugt die grüne Glasur, höchstens belebt durch leichte Vergoldung. Die Modellierung ist meistens vorzüglich und läßt darauf schließen, daß entweder tüchtige Bildhauer die Modelle der Formen herstellten, oder daß einzelne Hafnermeister selber, wie später die Leupold und andere, begabte Plastiker waren. Jedenfalls war der Geschmack der Zeit soweit gestiegen, daß man sich nicht mehr mit rohen und sorglos hergestellten Kacheln begnügte, und dem kam ein weiterer technischer Fortschritt entgegen, die Verbesserung der grünen Glasur, ihre reinere Zusammensetzung, welche einen viel dünneren Auftrag ermöglichte, bei dem die Schärfe der Formen nicht allzusehr verlor; wesentlich trug dazu bei, daß man jetzt die Reliefs zuerst mit einem feinen, weißen Thon überzog, worauf die viel hellere und reinere Glasur in der Hauptsache zurückzuführen ist. Bewundernswert ist bei den meisten der Kacheln die außerordentlich geringe Dicke dieser großen Stücke. Mit dieser Umgestaltung, die das eigentliche Prinzip, die Trennung von Feuerraum und Aufsatz unangetastet ließ, ja eigentlich erst recht zum Ausdruck zu bringen wußte, war für die fränkischen Hafner auf anderthalb Jahrhunderte der Weg gewiesen, und sie hielten treu an diesem Schema, sowie an dem quadratischen Grundriß des Aufsatzes und dem oblongen des Feuerraumes fest.
Zu den ersten Stücken dieser Art gehören zwei heute auf der Burg befindliche Öfen, deren Entstehen vielleicht noch in die dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts fällt: der vielbesprochene Ofen im sogenannten Arbeitszimmer des Königs und ein anderer im Wohnzimmer der Königin.
Taf. II.

Grünglasierter Kachelofen, sogen. Hirsvogelofen,
auf der Burg zu Nürnberg.
Mitte des 16. Jahrhunderts.
Nebenstehende Abbildung (Taf. II) enthebt mich einer genauen Beschreibung des ersteren Ofens, der mit Recht einen großen Ruf genießt. So häufig ich schon die Burg besucht habe, stets bin ich von neuem frappiert von der vornehmen und schön gegliederten Erscheinung dieses Stückes. Und dieser Eindruck[S. 64] nimmt eher zu als ab bei eingehender Betrachtung desselben. Die sehr scharfe Pressung der Formen, die offenbar aus noch kaum gebrauchten, aber auch vorzüglich gearbeiteten Modeln entstanden sind, die — wenige stark beschädigte Stellen ausgenommen — tadellose Erhaltung, die »Glätte und herrlich gleichmäßige Farbe der Glasur, an der das feine Netz der Haarrisse selbst jetzt noch, nach mehr als dreihundertjährigem Gebrauche kaum sichtbar ist«, (Friedrich), Alles trägt zu diesem Eindruck bei. Dazu kommt der schön gegliederte, einfache, zweckentsprechende Aufbau; die reine, reizvolle Ornamentik, welche, obschon keine sklavische Kopie, aus dem gleichen Geiste gedacht ist, wie die Marmorreliefs der Venetianer Bauten, ohne natürlich deren Feinheit und Frische ganz zu erreichen, was hier der Überschätzung Friedrichs gegenüber zur Steuer der Wahrheit nicht verhehlt werden darf. Es ist begreiflich, daß Friedrich, als er die Töpferthätigkeit Hirsvogels zu untersuchen begann, in dem Ofen ein Werk dieses Künstlers zu finden glaubte, eingedenk der Stelle Neudörfers: »Er überkam aber andere Gedanken, ließ solche alle fahren, machte eine Kompagnie mit einem Hafner, der zog gen Venedig, ward hie ehelich und ein Burger, bracht viel Kunst in Hafners Werken mit sich, machte also welsche Öfen, Krüge auf antiquitetische Art, als wären sie von Metall gossen, solches ließ er auch anstehen, übergab seinen Mitgesellen den Handel, ward ein Wappensteinschneider etc.[78]« Die hie und da laut gewordenen Zweifel, ob diese Stelle nicht ganz, oder in ihren ersten Sätzen auf Hirsvogels Kompagnon zu beziehen ist, scheinen mir mit Friedrich dem Sprachgebrauch der Zeit und der Art nach, wie Neudörfer fortfährt, gegenstandslos zu sein. Unterstützt wird dieser Bericht durch einen Ratsbeschluß (28. Nov. 1530): »Augustin Hirsvogel’s halb soll den Hafnern ernstlich gesagt werden, ine an dem, so ime ein rath vergönnt hat, der gesellen und anders halben unverhindert zu lassen«[79]. Die sich von selbst ergebende Deutung ist natürlich die, daß Hirsvogel um diese Zeit schon Töpferwaren produziert hat und daß die eifersüchtigen Meister des Handwerks ihn darob chikanierten. Daß Friedrich aufs eifrigste bestrebt ist, dieser Stelle einen andern gezwungenen Sinn unterzulegen, ist nur dadurch erklärlich, daß er streng an Neudörfers Version festhält, wonach Hirsvogel erst nach aufgegebener Glasfabrikation und nach seinem Aufenthalt in Venedig begonnen habe, Töpfereien zu schaffen, statt also Neudörfer durch den Ratsbeschluß, gewissermaßen letzteren durch Neudörfer korrigierte, während doch derartige Zeit- und Motivangaben bei allen Kunstchronisten der früheren Jahrhunderte von ihrem ganzen Berichte am wenigsten Zutrauen verdienen. Ohne deshalb auf die romanhaften Konstruktionen einzugehen, in denen sich Friedrich leider zum Schaden seines sonst so schätzenswerten Werkes gefällt, müssen wir Neudörfers Stelle folgendermaßen interpretieren: wohl aus dem gleichen Künstlerinteresse, wie seine Zeitgenossen, zog es auch den Hirsvogel nach Italien und zwar gen Venedig. Ob vor oder nach der Kompagnie mit dem Hafner, welche den Urkunden zufolge 1531 geschlossen wurde, zwecks Herstellung von Glaswaren auf venetianische[S. 65] Art, wissen wir nicht, da die Stelle Neudörfers aus obigen Gründen in dieser Hinsicht nicht beweiskräftig erscheint. Aus den Jahren vor 1528 haben wir keine Notizen über den Meister, möglich, daß er die Reise schon um diese Zeit unternommen hat. Was er in Venedig gelernt hat, ist schwer zu sagen. Die Darlegung Friedrich’s, daß es das Zinnemail nicht gewesen sein könne, da solches in Venedig um 1530 noch nicht verwendet wurde, ist nach den neueren Forschungen hinfällig. Sicher um 1520 (vgl. O. v. Falke Majolika. Handbücher der kgl. Museen zu Berlin 1896, p. 184 f.), möglicherweise aber schon vor 1500 war das Zinnemail in Venedig eine bekannte Sache. Unter dem »Schmelzen«, das er von neuem lernen mußte, ist doch wohl eine neue Art des Glasierens, also nach Allem die Zinnglasur zu verstehen. Daß es nur eine reinere Herstellung der Glasur und feinere Zusammensetzung der Thonmasse war, was er als Gewinn nach Hause brachte, möchten wir bezweifeln. Die offenbar sehr rührigen Hafner Nürnbergs, und gar ein findiger Kopf wie Hirsvogel, konnten diese Vervollkommnung, die sehr nahe lag, wohl ohne fremde Hilfe zu Stande bringen. Das Zinnemail dagegen war eine Neuerung, deren Wichtigkeit Hirsvogel sofort einleuchten mußte, wenn er die Venetianer Majoliken betrachtete und nach deren Kenntnis er vor allem streben mußte. Vielleicht war er überhaupt durch den Anblick venetianer Majolikenservice im Besitze Nürnberger Patrizier zu der Reise veranlaßt worden; kann es doch nach den erhaltenen Urkunden mit Recht zweifelhaft erscheinen, ob Nickel thatsächlich im Besitz der richtigen Kenntnis war. Zugleich eignete er sich jene innige Vertrautheit mit der geschmackvollen Ornamentik Venedigs an, welche die Radierungen beweisen und die selbst nach dem Vorgange der Vischer in Nürnberg noch Aufsehen erregen konnte. Daß das Kreuz in seinem Monogramm, wie solches auf den Radierungen vorkommt (keine Kachel ist signiert), darauf deutet, er habe eine Tochter des Maestro Lodovico in S. Paolo geheiratet, dessen Platten das Kreuz als Marke tragen, dünkt mir ohne urkundliche Anhaltspunkte doch eine sehr vage Vermutung: das Kreuz in Verbindung mit dem Monogramm ist durchaus keine seltene Erscheinung. »Als wären sie aus Metall gossen«[80], erklärt Friedrich dahin, daß durch die Schärfe der Formen dieser Eindruck erweckt wurde, wozu dann noch die Gleichmäßigkeit der Glasur betrug, oder vielmehr, wie wir mit Falke’s Worten hinzusetzen: »die einheitlich glatte Oberfläche der neuen Glasur oder die im Vergleich mit den übrigen deutschen Irdenwaren feinere und dünnere ausgedrehte Masse, die an Zinngeschirr oder an dergleichen erinnern mochte.« Schwierigkeiten macht noch die Stelle: »welsche Öfen, Krüg und Bilder«. Unter letzteren können wir uns allerdings kaum etwas anderes als Kacheln mit bildlichen Darstellungen vorstellen. Ob wir aber der Verbindung halber, wie Friedrich will, daraus schließen dürfen, Hirsvogel habe Krüge, d. h. Vasen nur auf Kacheln angebracht, gar keine selbständigen Krüge geschaffen, dafür scheint mir der manchmal etwas konfuse Neudörfer, der sein Manuskript bekanntlich in acht Tagen niederschrieb, doch[S. 66] nicht zuverlässig genug. »Auf antiquitetische Art« will wohl nicht nur Grottesken-Dekoration, sondern auch den antikisierenden Aufbau besagen. — All’ die angeführten Umstände passen nun mit einer Ausnahme auf den Ofen der kgl. Burg. Er ist aus dem gleichen Geiste in der gleichen Zeit entstanden, wie die oben angeführten Beispiele der Nürnberger Renaissance zwischen 1530 und 40 und in dies Jahrzehnt muß auch Hirsvogels Töpferthätigkeit fallen, denn um 1542 muß er ihr in der Hauptsache Valet gesagt haben, wie seine vielfache Beschäftigung auf andern Gebieten und seine Entfernung von Nürnberg vermuten läßt. Es liegt also sehr nahe, in ihm eines der von Neudörfer gerühmten Produkte des Meisters zu erkennen. Auch in seiner Ornamentik, finden wir zahlreiche Motive der späteren Ornamentstiche des Künstlers wieder. Nur hat Friedrich übersehen, daß diese Ornamentstiche sich von der klaren und maßvollen Dekoration des Ofens doch etwas durch die willkürliche Häufung und dabei freiere, großzügigere Behandlung der Motive unterscheiden. Auch fehlt in ihnen, soweit meine Kenntnis reicht, das auf dem Ofen verwendete Motiv der Trophäe. Das kann indes leicht aus der Entwicklung des Künstlers zu erklären sein. Bedenklich aber ist der Umstand, daß gerade die Hauptsache, welche Hirsvogel in Venedig gelernt haben muß, nämlich die Zinnglasur, hier keine Verwendung gefunden hat, während es doch sehr wahrscheinlich ist, daß der Künstler nicht versäumte, von dieser wichtigen Neuerung überall Gebrauch zu machen. Mit der Annahme aber, wir hätten ein vor der Venetianischen Reise entstandenes Produkt seiner Hafnerthätigkeit vor uns, begeben wir uns ganz auf das Gebiet vager Konjunkturen. Wenn wir nun auch die Möglichkeit nicht leugnen wollen, so dürfen wir doch nur sehr bedingungsweise und des bequemen Namens halber, der zugleich die offene Frage bezeichnet, fortfahren, von einem Hirsvogelofen zu reden und müssen den Anteil des Meisters an der Veränderung des Ofenschemas durchaus unentschieden lassen. — Die Kacheln des Ofens scheinen sich großer Beliebtheit erfreut zu haben und oft abgeformt worden zu sein, so hat sich noch eine solche auf Schloß Friedensdorf in Schlesien erhalten[81]. Mit anderen Friesen und einrahmenden Hermen versehen, finden wir eine Imitation des ganzen Ofens, sowie der Vasenkachel — letztere nur durch ein über den Bauch der Vase gelegtes Band bereichert — in dem Ofen[82], der ehemals den Saal des Heubeck’schen Hauses zierte und leider zusammen mit der prächtigen Täfelung[83] im Jahre 1869 nach Frankreich verkauft wurde. Ofen und Täfelung dürften den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts entstammen: eines der Beispiele, denen wir noch oft begegnen werden, daß beliebte Stücke manchmal noch um ein Jahrhundert später mit Hinzufügung einiger neu entstandener Teile neu hergestellt wurden. Friedrich nimmt das Motiv der Anbringung einer Vase auf Kacheln als Neuerung Augustin Hirsvogels in Anspruch, und läßt eine ganze Reihe unten zu erwähnender Stücke unter seinem Einfluß entstehen. Dagegen spricht, daß einige Öfen, die dem Kunstkreis eines andern gleichzeitigen Meisters nahe[S. 67] stehen, das Motiv ebenfalls, wenn auch in charakteristischer Verschiedenheit, aufweisen, wonach ich glauben möchte, daß für beide ein italienisches Vorbild anregend war, das mir zur Zeit noch unbekannt ist. Überhaupt spielt die Vase ja in der gesamten italienischen und deutschen Ornamentik der Zeit eine große Rolle.
Taf. III.

Grünglasierter Ofen mit teilweiser Vergoldung
auf der Burg zu Nürnberg.
Mitte des 16. Jahrhunderts.
In seiner äußeren Erscheinung steht dem Hirsvogelofen nahe der grünglasierte, teilweise vergoldete Ofen mit buntglasierten Einsatzkacheln des Aufsatzes (Taf. III) im Wohnzimmer der Königin, und Friedrich hat nicht versäumt, ihn für seinen Helden zu beanspruchen. Die Gründe, die er dafür geltend macht, sind indeß wenig stichhaltig: so eine oberflächliche Verwandtschaft mit den Glasgemälden der Rochuskapelle, die, wie wir sahen, kaum auf Augustin zurückzuführen sind. Friedrich verfällt, wie noch oft, in den Fehler, der bei jeder Arbeit auf dem Gebiet der deutschen Renaissance nahe liegt, von dem wohl niemand, auch der Schreiber dieser Zeilen, sich ganz frei hält, und der darin besteht, Ornamentmotive, die Gemeingut der deutschen Renaissance oder einer gewissen Richtung derselben sind, als für den gerade behandelten Künstler charakteristisch zu nehmen. Denn der Austausch der Motive, gewissermaßen die Internationalität derselben ist in dieser Zeit eine sehr große. — Von dem sogenannten Hirsvogelofen unterscheidet sich dies Stück durch die ungleichmäßigere Glasur, die buntglasierten Einzelkacheln, die Vergoldung — in ihrer heutigen rohen Erscheinung sicher nicht ursprünglich —, die Kapitelle, die viel eher auf Flötner hinweisen, und Anderes mehr.
Am nächsten verwandt ist der Ofen nicht nur durch den Triglyphenfries mit Widderköpfen in den Metopen, sondern auch in der Ornamentik mit dem obengenannten Schrank von 1541 im germanischen Museum. So finden wir auf ihm die Vase mit dem Ährenbouquet wieder, die uns noch einmal auf einem anderen Ofen begegnen wird. Die sehr beschädigten Kacheln des Aufsatzes, in den üblichen Hafnerfarben glasiert, zeigen die ziemlich plumpen Darstellungen des Jonas, wie ihn der Walfisch verschluckt, der Taufe Christi und Abrahams Opfer, alles in weiter, roh behandelter Landschaft. Weit besser sind die grünglasierten Kacheln des Feuerraums; obwohl die Schärfe der Pressung zu wünschen übrig läßt, jedenfalls aus einem vorzüglichen Model entstanden. Drei Personifikationen der Stärke und anderer Tugenden auf Konsolen in einer Nischenarchitektur, welche noch sehr an die Frührenaissance anklingt. Friedrich konnte damit jene treffliche Kachel mit dem Bilde der Venus in Verbindung bringen[84], welche durch die Schönheit dieses weiblichen Körpers und dessen vorzügliche Modellierung mit Recht zu den besten Stücken der alten Hafnerei gerechnet wird. Jetzt im k. k. österreichischen Museum zu Wien, stammt die Kachel aus der Sammlung Seuter in Augsburg, weshalb sie für dortiges Fabrikat unter dem Einfluß Holbeins gehalten wurde. Sie ist aus demselben, nur leicht veränderten Model — es fehlt ein Stern zu Häupten der Venus und die Konsole ist etwas verschieden gebildet — entstanden, wie die vorgenannten. Das eingesetzte Mittelbild stimmt [S. 68]ebenfalls im Styl überein und gehörte wohl zu einer Parallelserie, der Ursprungsort der Kachel ist also zweifellos Nürnberg; der Schärfe der Pressung nach darf sie gewissermaßen als ein »erster Abdruck« gelten. Auch die Kacheln des Ofens lassen in der Eleganz der Bewegung und der Schönheit des Faltenwurfes auf einen tüchtigen Bildner schließen.
Ähnliche Einsatzbilder, wie die buntglasierten im Aufsatze dieses Ofens zeigt derjenige im Schlafzimmer der Königin[85], ein zum Teil sehr roh zusammengesetztes Stück von unreiner Glasur mit einzelnen Kacheln aus der Zeit der besten Renaissance — so der Fries, der noch in einem ganz gleichen oder ähnlichen Exemplar[86] im Hamburger Museum und im bayr. Nationalmuseum zu München (Nr. 315) erhalten ist — und solchen die etliche Jahrzehnte später aus rohen Modeln geformt wurden. Die Hauptkachel gibt eine Nische, welche von großen plumpen Engeln, die einen schweren Früchtenkranz halten, flankiert ist; diese Engel stehen auf einem Postament, an dem Löwenköpfe mit Ringen angebracht sind. In den von Muscheln abgeschlossenen Nischen finden wir wiederum die Darstellung des Jonas, Opfer Abrahams, Taufe Christi, dazu noch Kain und Abel. Ausnahmsweise sind dieselben nicht bunt glasiert, sondern nur bunt bemalt. —
Wie solche Szenen, hat man auch in dieser Zeit schon Genrebilder verwendet: so befindet sich in unserem Museum eine buntglasierte Kachel, offenbar zu einem Fries bestimmt, mit der Darstellung einer Hirsch- und Hasenjagd (Fig. 24), die von einer gleich rohen Hand wohl nach der Vorlage eines Holzschnittes oder einer Plakette hergestellt worden ist. — Weit höher steht jene, gleichfalls genrehaft aufgefaßte Kachel mit dem Engel und Tobias in einer Landschaft[87] als Einsatzbild, deren Originalform im Besitze des Kunsthändlers Fleischmann in Nürnberg war, und welche Friedrich Hirsvogel zuschreibt, da die Landschaft seinen Radierungen nahe verwandt sei. Letzteres ist aber durchaus nicht so sehr der Fall, und außerdem könnte ein beliebiger Hafner[S. 70] einfach eine Radierung Hirsvogels als Vorlage benutzt haben; daß die Umrahmung 20 oder 30 Jahre später ausgeführt sein muß, ist ja auch Friedrich nicht entgangen, er hilft sich aber mit der Annahme, daß auch für diese ein ursprünglicher Entwurf des Meisters vorgelegen habe. Auf solche Vermutungen einzugehen, ist natürlich unmöglich. Noch weniger brauchen wir uns mit den sehr willkürlichen weiteren Attributionen Friedrichs zu befassen[88]; alle die betreffenden Stücke, größtenteils Produkte einer viel späteren Periode, werden an geeigneter Stelle erwähnt werden. Friedrich war eben dermaßen begeistert für seinen Helden und daher von dem Wunsche geradezu besessen, die ganze Neugestaltung des Ofenschema’s auf ihn zurückzuführen, daß er sogar in notorisch nach Virgil Solis gearbeiteten Stücken seinen Geist wiedererkennt, daß die eine andere Stufe der Entwicklung verratenden Rothenburger Ofenmodel als Imitation Hirsvogels gelten müssen, ja, daß er noch den später zu besprechenden G. Vest und die gesamte Töpferei Kreussens unter seinen Einfluß stellt, kurz, die Arbeit einer ganzen Generation einem Meister zuschreibt.
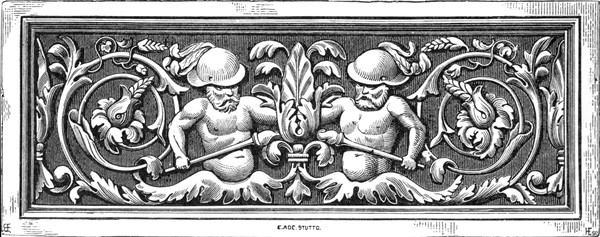
Fig. 26.
Grünglasierte Kachel (Mitte des 16. Jahrh.) im german. Museum (A. 542).
Aus: Lübke, Geschichte der Renaissance in Deutschland. Stuttgart. Ebner
& Seubert. 1882.
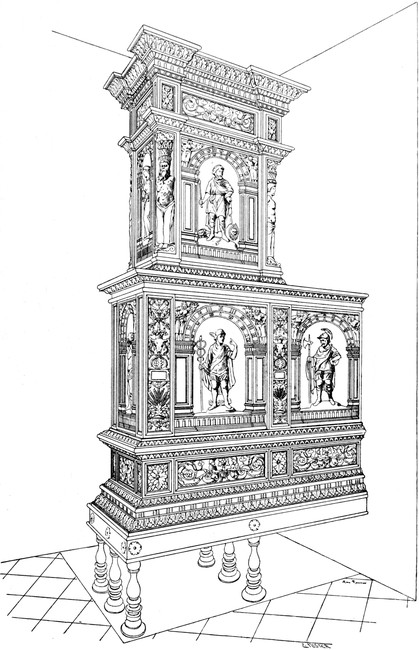
Fig. 27.
Grünglasierter Kachelofen aus der zweiten Hälfte
des 16. Jahrh. im Merkel’schen Hause zu Nürnberg.
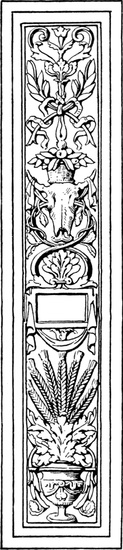
Fig. 28.
Detail des Ofens Fig. 27.
So wenig wir dem Allen zustimmen können, ebensowenig darf auch, was die Nürnberger Öfen betrifft, Hirsvogel, wenn überhaupt, als der alleinige Neuerer gelten. Einmal, weil die Umänderung zum Greifen nahe lag, und derselben überall siegreichen Richtung ihren Ursprung verdankt, wie zahllose andere Erscheinungen im Kunstgewerbe. Dann auch, weil wir einige gleichzeitige Öfen auf die Inspiration eines andern selbstständigen Meisters zurückführen, nämlich Peter Flötner’s, dessen Bedeutung für das Kunstgewerbe, wie wir gesehen [S. 72]haben, mindestens der des Hirsvogel gleichkommt. — An erster Stelle ist da zu nennen der Ofen in der Stadtbibliothek, wohin er aus dem städtischen Leihhaus verbracht wurde (Fig. 25). Die Vorderseite zeigt in einer Nische die Gestalt des Sol, ziemlich genau nach der Flötner’schen Plakette[89] gearbeitet, in vorzüglich scharfer Pressung, die beiden Nebenseiten eine Vase mit Tierfüßen als Henkel, ein vielfach, besonders aber von Flötner angewandtes Motiv. Auch die Architektur der Nische steht, nach der Hungern Chronica und dem Krakauer Altar zu urteilen, dem Meister nicht fern. Der Feuerraum ist aus einfachen Schüsselkacheln zusammengesetzt, nur unten ist ein Fries angebracht, der in oblongen Kacheln an der Vorderansicht einen Triton und eine Nereide einander gegenüber zeigt, an den Seiten zweimal zwei gegen einander gerichtete Männer mit Fackeln, deren Körper in Blätter und dann, wie auch der Fischleib der ersteren in elegant gezeichnetes, zur Spirale gewundenes, echt Flötnerisches Rankenwerk übergeht. Von den letztgenannten Kacheln besitzt unsere Sammlung ein Exemplar (Fig. 26). Auch die an den Ecken angebrachten Engelsköpfe mit gegeneinander geschwungenen Flügeln, erinnern an Flötner. An und für sich wäre es nun leicht denkbar, daß der Meister, wie für Sessel, Betten und Thüren, so auch Entwürfe für Öfen gemacht hat; er könnte sogar, wie später Eisenhoit, die Formen für einzelne Model selbst gearbeitet haben, jedenfalls aber nicht die getreue Nachbildung der Plakette. Sind dagegen nur Plaketten und Holzschnitte Flötners als Vorlage benützt worden, so müssen wir das große Verständnis anerkennen, mit welchem der Bildner die Feinheit seiner Ornamentik wiederzugeben verstand. — Die Frage ist schon deshalb nicht zu beantworten, weil wir Bedenken tragen müssen, die Zusammensetzung des Ofens als ursprünglich anzusehen. Wenigstens will uns die bärtige Herme an der Ecke des Aufsatzes mit der Maske an ihrem Fußgestell etwas später dünken; der Ofen ist wohl in einer Hafnerwerkstatt, welche die Model nach Flötner besaß, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geschickt zusammengesetzt worden.
Aus der gleichen Werkstatt ist noch der prächtige Ofen im Saale des Merkel’schen Hauses (Karlsstraße) hervorgegangen (Fig. 27), dessen Kacheln in den gleichen Nischen die Planetengötter nach der gleichen Flötner’schen Plakettenserie[S. 73] zeigen[90] und zwar wie vorhin Sol, dann Saturn, Luna, Jupiter, Mars, Merkur (Saturn und Jupiter zweimal). Die Pressung ist nicht ganz so scharf wie bei dem vorgenannten Ofen. Gemeinsam mit letzterem ist noch diesem Ofen die achtmal wiederholte Frieskachel mit dem Triton und der Nereide, sowie die unteren Gesimsglieder. Die schöne Füllung der Pilaster am Feuerraum zeigt wiederum die charakteristischen Motive der Flötner’schen Ornamentik (Fig. 28); hier finden wir auch die uns von dem Ofen im Wohnzimmer der Königin und dem Schrank bekannte Vase mit dem Ährenbouquet und Anderes wieder. — Die Karyatiden des Aufsatzes, den Hermen des vorigen Ofens nahe verwandt, vor allem aber die Behandlung der Gesimse[S. 74] und ihre Verkröpfung machen die Annahme wahrscheinlich, daß der Ofen in dieser Form dem Ende des 16. Jahrhunderts seine Entstehung verdankt, also gleichzeitig ist mit der herrlichen Täfelung des Saales, die durch ihre Komposition und Einzelausführung eine der besten in Nürnberg genannt werden muß. Der Saal in seiner vollständigen Ausstattung mit Decke, Wandtäfelung, Gemälden und Ofen trefflich erhalten, wurde offenbar zugleich mit dem gänzlichen Umbau des Hauses eingerichtet, welcher um diese Zeit stattgefunden haben muß, wie die Façade und die interessante Hofarchitektur beweisen. Die Model der beiden Öfen aber (mit den genannten Ausnahmen) müssen wir, der Reinheit ihrer Dekoration halber, in die noch kein fremdes Element eingedrungen ist, noch der ersten Hälfte des Jahrhunderts, etwa um 1540, zuschreiben. Die grüne Glasur dieser hervorragend schönen Stücke ist sehr hell und gleichmäßig; sie sind darin, wie in der Feinheit ihrer Ornamente[S. 75] dem Hirsvogelofen ebenbürtig, während an Eleganz des Aufbaues ihm derjenige im Merkelhause entschieden überlegen ist. Da die Autorschaft Hirsvogel’s an dem Burgofen bis jetzt nur Hypothese, andererseits diese beiden Exemplare sicher, und wie es scheint auch der Ofen im Wohnzimmer der Königin auf Flötner’sche Inspiration zurückgehen, so müssen wir ihm auch auf die Hafner seiner Zeit einen mindestens gleich großen Einfluß zuschreiben wie Hirsvogel.
Diesem Nürnberger Renaissancestyl und besonders dem des Flötner nahe steht der schöne Ofen im Rathause zu Ochsenfurt[91], der in seiner maßvollen Verwendung des Dekorativen und fein profilierter Gesimse, im Allgemeinen[S. 76] nur aus gleichmäßigen Schüsselkacheln bestehend, einen sehr befriedigenden Eindruck macht. Ecksäulchen aus drei gedrehten Bändern, unten ein Fries von oblongen Kacheln, in denen eine Vase von zwei Männern gehalten wird, deren Körper in Blätter und feines Rankenwerk übergeht, ähnlich den vorgenannten Öfen; kämpfende Putten, die den Aufsatz krönen — das ist der ganze Schmuck. — Im gleichen Geiste edelster Renaissance sind noch eine Reihe Schüsselkacheln im German. Mus. (A. 601, 602, 1588, 1589) gehalten, in deren Ecken gut modellierte Tritonen, Nereiden etc. angebracht sind. Von der künstlerischen Höhe und dem Geschmack der damaligen Hafnerei zeugt ferner das schöne Stück der Temperantia im Besitze des Bayrischen Gewerbemuseums (Fig. 29). Die graziöse Bewegung, die eleganten, wenn auch überschlanken Proportionen, die gute Modellierung und der flotte Faltenwurf heben dies Stück über viele andere hinaus. Das Motiv ist der Temperantia (B. 136) des Hans Sebald Beham entlehnt, welche wir später noch einmal als Vorlage zu erwähnen haben. In diesem Falle möchte ich aber fast glauben, daß zwischen der Kachel und dem Stich noch eine nach letzterem gearbeitete Plakette gestanden hat. Zu dieser Annahme veranlaßt mich der veränderte Kopftypus, das Fehlen der Flügel, die aus dem Derben des Beham ins Schlanke übersetzten Proportionen, die viel heftigere Bewegung, die gänzlich[S. 77] verschiedenen, durchaus nicht knittrigen Falten und das ebenfalls verschiedene Beiwerk, wenn wir das Alles nicht auf Rechnung des Modelleurs der Kachelform setzen wollen, der dann künstlerisch recht selbstständig gewesen sein muß.
Die Vase mit Blumen, der wir auf den großen Mittelkacheln des Hirsvogels- und Bibliotheksofens zum ersten Male begegnet sind, ist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vielfach verwendet worden. Auf der Kachel A. 1591 (Fig. 30) finden wir sie wieder, die Form dem Stück der Bibliothek nahestehend, in einer Architektur, welche von charakteristischem, hier recht großzügig behandeltem Rollwerk umschlungen ist. Das Stück zeichnet sich durch seine dunklere, sehr warme und gleichmäßige Glasur aus. Da man bei der ungewohnten Größe der Kachel offenbar noch Besorgnis hegte, wird sie auf der Rückseite durch zwei sich kreuzende Stege verstärkt, das Gleiche ist geschehen bei der Kachel Fig. 31, deren Vase mehr an die des Hirsvogelofens anklingt. Auch hier ist Rollwerk mit der Architektur der Nische verbunden. Die in dem Entwurf schön gedachte Umrahmung ist durch die nachlässige Ausführung sehr vergröbert worden; auch die fleckige Glasur wirkt störend. Verwendet finden wir diese Kachel an dem Aufsatze eines nicht hervorragenden Ofens unserer Sammlung (A. Röper-Bösch 15), bei dem die beträchtliche Vertiefung der einen Schüsselkachel zu praktischen Zwecken interessant ist. — Das Vasenmotiv zeigen endlich noch einige Ofenmodelle der gleichen Zeit, so das nebenstehend abgebildete Stück (Fig. 32). Der Ausdruck Ofenmodelle dürfte wohl ungenau sein: ich möchte kaum glauben, daß diese Stücke von Hafnern als Modelle hergestellt wurden; sie dienten wohl von Anfang an zur Ausstattung von Puppenhäusern, in welchen man in Nürnberg große Pracht entfaltete. Das Germanische Museum besitzt allein fünf solcher, ob ihrer kompletten und die Wohnungen getreu nachahmenden Einrichtung wichtiger Stücke; in einem dieser Häuser entdecken wir auch die Miniaturausgabe eines Ofens, der nur aus übereinander gereihten Vasenkacheln besteht. Ebenfalls der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstammt das bei Ortwein abgebildete Ofenmodell unserer Sammlung[92].
VON DR. OTTO LAUFFER.
In der ersten Sammlung dieser Beiträge (Jahrg. 1899, pg. 105 ff.) haben wir in einer Reihe von Bildern die allgemeinen Handelsverhältnisse des XV. Jahrhunderts näher zu beleuchten versucht. Indem wir uns nunmehr den Einzelerscheinungen im Leben des deutschen Kaufmanns jener Zeit zuwenden, erinnern wir uns, daß die Entwicklung des Kaufwesens im allgemeinen an die Märkte gebunden war, deren Verkehr auf der Grundlage eines besonderen Friedens und Rechtsschutzes[93] sich entfaltete, in gleicher oder ähnlicher Weise wie es Boners Edelstein 100, 1 ff. darstellt:
Von den Märkten kommen allerdings die auf den öffentlichen Plätzen der Stadt abgehaltenen Wochenmärkte für die Entwicklung des Kaufwesens kaum in Frage, weil dort eigentlich nur die vom Lande zu Markt gezogenen Bauern die selbstgewonnenen Lebensmittel umsetzten. Etwas anderes ist es freilich schon, wenn der Verkauf derselben in die Hände der Zwischenhändler oder Höker übergieng, aber auch diese haben kaum jemals den Anspruch auf den Namen Kaufmann erhoben. Ein richtiger Kaufverkehr entfaltete sich erst auf den periodisch wiederkehrenden Jahrmärkten und Messen, die sich im Anfang meist an kirchliche Festlichkeiten angeschlossen hatten, und bei denen sich bald ein so lebhaftes Marktgetriebe entwickelt hatte, daß auch der geweihte Raum der Kirche selbst nicht mehr davor sicher war. »In der kirchen, oder im kirchhoff, sol man nit iar merckt haben,[S. 79] kauffen vnd verkauffen,« in diesen Worten Geilers [Narrensch. fol. 98[94]] zeigt sich, daß das alte Verbot, das die Kirche namentlich im XIII. Jahrhundert immer wieder auf das Entschiedenste hatte aussprechen müssen[95], auch am Ende des XV. noch nicht überflüssig geworden war, ja der sonst so strenge Prediger muß sogar noch hinzufügen: »ob man aber kertzle, oder liechtle zuͦ der meß feil moͤge haben, die leerer seint hie wider einander.« Es war also auch damals noch nicht ganz ausgeschlossen, in dem Raume der Kirche selbst Verkaufsstände anzutreffen. Im allgemeinen aber hatte sich der Markt schon von den geweihten Orten zurückgezogen und auf den öffentlichen Plätzen und Straßen sich festgesetzt, und war so schon rein örtlich betrachtet ein Anlaß der Spekulation für die Einwohner geworden, »die dy hüsser ferleihen.... in der meß[96].«

Fig. 1. Wannenkrämer. Holzschnitt von Hans Frank 1516
aus Geiler, Brösamlin.
(Steinhausen a. a. O. Abb. 24.)[97]
Diese Platzvermieter wenden sich nun natürlich an diejenigen Kaufleute, die ihren festen Stand in der Messe haben, undenkbar ist es, daß sie ihr[S. 80] Geschäft an den sogenannten »Wannenkrämern« machen. Das sind »die kremer, die ihren krom feil tragen in einer wannen. Die selben die schnöcken all winckel auß vnd haben vil narrenwerck vnd thorechte ding feil, vnd haben pfeiflin im krom ligen vnd pfeiffen etwann darzuͦ, vnd machen die lüt lüstig ze kauffen, vnd gond in der meß hin vnd her vff alle stuben an alle ort, vnd wa lüt beieinander ston, so sein die wannenkremer allwegen auch da. Das thuͦt aber ein rechter Kauffmann oder ein hantwercks man nit, der sein war feil hat«[98]. Das Charakteristische dieser Wannenkrämer besteht also darin, daß sie keinen festen Verkaufsstand haben, und ferner darin, daß sie auf eine wenig vornehme Art die Käufer an sich locken, indem sie durch Possen und derbe Spässe die Aufmerksamkeit erregen. »Der kremer ist etwann XL järig, vnd reitet vff eim gemalten stecken daher«[99]. In dieser letzten Art gleichen sie den — meist an eine feste Kramstelle gebundenen — marktschreierischen und oft recht gaunerhaften Verkäufern von Hausmitteln und Quacksalbereien, wie sie sich ja auch bis in unsere Zeit auf den Jahrmärkten erhalten haben[100].

Fig. 2. Zusammenstellung von Waren, die auf der Messe zu
kaufen sind.
Holzschnitt von H. Frank aus Geiler, Brösamlin.
(Steinhausen a. a. O. Abb. 96.)
Nur bedingt charakteristisch für die Wannenkrämer war die — teilweise auch in festen Krambuden anzutreffende — Art ihrer Waren. »Sie haben etwann feil: gemalte rößlin, gemalte buppen, Lengold (= Goldlahn, Lametta), Lepkuͦchen, Rechenpfenning, Rörlin, hüppen (= eine Art Waffeln), oflaten, Kartenspiel«[101]. Jedenfalls trieben sie einen nach dem Urteil der Kirche verwerflichen Handel, sie gehören zu den »vnnützen kremern vnd kauflüten, der war nit not ist: sie haben leichtfertige ding feil, als Schnurren (= Kreisel), Rechen, Bloßbelg, Abbrechen (= Lichtschere), Flöchfallen, Blaw enten[102], die vff holdtschuhen gon, vnd Scheiden vnd der gleichen torechte ding. Die wil ich nennen frauwenkremer... Sie haben frawen werck feil, wann die frawen etwann mit semlichen (= solchen) gackeldingen guckis gackis vmbgond, darumb nenn ich sie frauwenkremer«. Durch solche Dinge werden die Frauen zu Leichtfertigkeiten verführt, »vnd etwann so kummen sie vor den selben kremen zuͦsammen, vnd so muͦß er (= der Liebhaber) ir ein blaßbalck kaufen, so kramet sie im ein abbrechen. Die ding machen sie dann vff[S. 81] den ermel, vnd so verstond sie dann einander, was es bedütet, vnd der eeman lachet sein dann, vnd ist gar ein fein ding, vnd ist als narrenwerck«[103]. (Vergl. Fig. 1.) Die Wannenkrämer dienen also der Sünde, wodurch sie selbst auch sündhaft werden, und solange sie diesen Handel treiben, können sie keine rechte Buße thun. »So eyner in seinem kauffmannschatz vmgat mit wuͦcher, vnd fürkauff vnd die leüt betreügt, ouch die würffel vnd kartenspiel machend, vnd deßgleichen, so lang er dißen vnrechten kauffmanschatz vnd das gewerb treibet, so lang mag er nit wäre buͦß tuͦn für sein sünden«[104]. Geiler gibt einmal (Brösaml. I. fol. 92) eine sehr interessante Zusammenstellung aller der Dinge, mit denen man seiner Überzeugung nach von geistlichen und weltlichen Rechtes wegen keinen Handel treiben darf, und wenn auch die Stelle freilich nur zum Teil hierher gehört und es erst recht zu weit führen würde, in allen Einzelheiten hier näher auf sie einzugehen, so will ich doch nicht versäumen, sie ganz anzuführen. »Ein frummer kaufmann sol feil haben guͦte Kaufmannschatz, nit verlegen ding, erbere ding, die nit verbotten sein. Waz ist verbotten, zuͦ uerkauffen? Geistlich ding (Spiritualia); Gifft (Venena); Prophand (Frumenta publica); Purpurwol (Vellus muricis); Vßgeschnitn kind (Eunuchos); Vnnütze ding (Prophana); Freie menschen (Liberos homines). — Zu dem ersten sein verbotten geistliche ding, als meß lesen, vnd was geistlichen Dingen anhangt (Annexa). Ich hort einist von eim, das im einer fünff pfening wolt geben, er solt im ein meß leßen, da sprach er »ich mag es kum in der werckstat selber darumb haben«. Es was aber schimpff (= Scherz), wie wol man nit darmit schimpfen sol. Es seind darnach die Sacrament, die[S. 82] sol man auch nit verkauffen[105]. — Vnd zu dem andern: gifft sol man nicht verkauffen, dann mit vnderscheid... — Das drit ist prophand, als da man wein vnd korn einem herren zuͦfürt vnd devotis militibus, andechtigen Rittern, wer das vffkauft vnd andern verkauffen wil, ist der kauffman ein grosse person, so sol er leib vnd guͦt verfallen sein, ist er ein gemeine person, so sol man im den kopff abhauwen. — Daz vierd ist vßgeschnitnen kinden, besunder so es römer kind sein, sol man nit verkauffen, aber andere kind mag man wol verkauffen. — Daz fünft ist purpurwol, dem gemeinen man sol man es nicht verkauffen, bei kopff abhauwen. — Zu dem VI. Freie menschen sol nieman verkauffen. Der vatter in hungers not mag er den sun verkauffen, vnd sunst nicht, aber die fraw nit. Er mag die frauw nicht verkauffen, vnd die muͦter mag den sun nicht verkauffen, sie leid hunger oder nicht. — Zu dem sibenden Lusoria instrumenta, Spilwerckzüg vnd ding, die da schedlich seind, üppig, weltlich gezierd, kartenspil, würffel, vnd ding, dy man niendert zuͦ bruchen kann, denn zuͦ narrenwerck, sol man auch nit verkauffen.«
Das zuletzt genannte Verbot richtet sich also ganz deutlich mit gegen die Wannenkrämer, indessen ist es kein Zweifel, daß dieselben sich durch solchen Kirchenspruch nicht gar zu sehr anfechten ließen, und wenn sie selbst darnach strebten, ihren fliegenden Handel mit einem festen, die Wanne mit dem Kramladen zu vertauschen, so wurden sie nicht durch religiöse Bedenken dazu veranlaßt — zumal in vielen Fällen nicht einmal ein plötzlicher Wechsel in der Art ihrer Waren damit verbunden war —, sondern vielmehr durch das natürliche Verlangen, in der sozialen Gliederung ihres Standes eine Stufe höher zu steigen. »Zuͦ dem ersten so treyt er seinen krom in einem wenlyn hin vnd her, Streel vnd spiegel. Wan er etwas überkumpt, so will er darnach ein gedemly haben, vnd würt darnach ein kaufmann vnd haltet huß, er hört nit vff, er sei den in einer geselschaft, noch hört er nit auf, er will ein galeen vff dem mer haben«, mit diesen Worten schildert Geiler (Brösaml. I. fol. 90) die Stufenleiter innerhalb des Kaufmannsstandes. Der Wannenkrämer wird zum Besitzer eines Gadems, eines Kaufladens, darnach wird er Großkaufmann und begründet ein Kaufhaus, dann schließt er sich einer Handelsgesellschaft an und hört nicht eher auf, als biß er an den überseeischen Handelsgeschäften seinen Anteil bekommen hat.
Wenn er es aber soweit bringt, so hat er vorher viel Mühe und Not zu überstehen: »ein kouffman, will der groß rychtum haben, er muͦß luͦgen, daz er vßryt gon Andorff (= Antwerpen), gon Mechel, gon Lyon oder Venedig, io dick (= oft) in schnee, kelt, frost, wind vnd regen, vnd in grosser widerwertigkeit, des er wol überhaben wer vnd doheymen am trucken sässe in einer[S. 83] warmen stuben bey seiner frawen vnd lieben kinden. Aber daz verlot er allesammen allein vmb zeytlichs guͦts willen. Ich will geschwigen dozuͦ, daz er muͦß menge böße ellende herberg haben vnd vil übel zeyt, vnd muͦß offt nacht in den herbergen in winckelen oder lußigen wuͦsten betten ligen, vff schmutzigem deller essen, vnd zeren menge böße ürten vnd wuͤste suppen, vnd dennocht dz thür genuͦg bezalen, vnd muͦß dozuͦ groß sorg, angst vnd not haben, vnd zuͦm dickren mol lib vnd leben zuͦm guͦtt doran wogen«[106]. So hatte der Kaufmann auf jeder Geschäftsreise unzählige Unbequemlichkeiten zu überstehen, bei jedem Aufbruch zur Messe mußte er sich gefaßt machen, von wegelagerndem Raubgesindel überfallen, ausgeplündert und an Leib und Leben gefährdet zu werden[107]. Von schwerer Sorge war er befreit, wenn er das Ziel seiner Reise glücklich erreichte, und es ist wohl zu verstehen, wenn er sich dort für ein paar Tage mit vollem Behagen dem Lebensgenuß hingab, ehe er seine Geschäftsthätigkeit aufnahm. Das ist es, was Geiler, Narrensch. fol. 121 andeuten will mit den Worten: »ein kauffmann, wan er kumpt geen Franckfurt, geen Nierenberg, so gat er dem spil nach, dem fressen vnd suffen, vnd vergißt seiner kauffmannschatz, das sein arm fürnemen was« eine Äußerung, die nichts anderes heißen kann, als daß der Kaufmann von den Anstrengungen der Reise sich erholte in den Gildehäusern oder Kaufleutstuben, wo zumal vor Beginn der Messe ein reich bewegtes Leben und Treiben sich entfaltete, wo alte Bekannte aus weit entfernten Gegenden sich in gleich angeregter Stimmung trafen und mit gleicher Bereitwilligkeit das Geld hinaus gehen ließen.
Nach dem Vergnügen folgte dann die Arbeit schon bald genug, nach der Verschwendung das Feilschen um den Pfennig, und dessen kann man gewiß sein, daß derjenige Kaufmann eine sehr große Seltenheit bildete, bei dem Geilers — wohl mehr der Nutzanwendung zu Liebe gewähltes — Bild (Brösaml. II. fol. 64) zugetroffen hätte: »Ein begiriger kauffman, der etwan findet zuͦ kauffen ein edlen stein, so spricht er nit zuͦ dem der den stein hat, »wie wiltu in geben?« er zelt ym das gelt auch nit, er wigt es ym auch nit, er messet es auch nit, er thuͦt auch den seckel nit vff, er zerreißt vnd zerschneidet den seckel vff, vnd spricht, nym als vil als du wilt.« Wir haben ja schon gehört, wie sehr man sich vor den Warenfälschungen zu hüten hatte[108] und wir werden noch sehen, welchen Übervorteilungen man beim Kauf selbst ausgesetzt war, kein Wunder, wenn der Kaufmann sich beim eigenen Einkauf nicht betrügen ließ. Es ging nun einmal nicht anders, er mußte ein weites Gewissen haben, und wenn wir im XIII. Jahrhundert schon von Caesarius von Heisterbach hören, ein Kaufmann könne kaum ohne Sünde sein, so setzt im Anfang des XV. Jahrh. Joh. Nider (a. a. O. fol. 1a) die alte Klage fort, »cum mercatorum officium tot suspectis contractibus circumvolutum agnoscatur moderno tempore, ut experti animarum medici iustum ab iniusto vix valeant discernere.« So sehen wir sie denn über die Messe[S. 84] ziehen und mit kaltem Blut den »Nachkauf«[109] treiben, »da sie eim die gurgel abstechen, vnd ein armen man zwingen vnd tringen, daz er in zuͦkauffen muͦß geben, als man nach dem end der meß thuͦt, vnd die meß vßgat, da einer verhalten hat, vnd dieselben denn vmbher gon vnd einander vnder den armen füren, vnd dann hinzuͦ gon vnd sich also stellen, als ob sie nit wöllen kauffen, vnd sei nüt des dings, vnd seind doch darumb da. Also würt der genötigt, daz er muͦß sein war neher geben weder sie wert ist vnd er sie selber hat«[110].

Fig. 3. Verladung von Waren in ein Kauffahrteischiff.
Holzschnitt aus: Buch der Zerstörung Trojas. Augsburg, Sorg. 1479.
(Steinhausen a. a. O. Abb. 17.)
Auf die Einzelheiten des Kaufaktes werden wir später zu sprechen kommen, zunächst müssen wir noch mit ein paar Worten auf die Geschäftslaufbahn des Kaufmanns zurückkommen. Als Wannenkrämer fingen natürlich nur die allerwenigsten von denen an, die uns später als Großkaufleute entgegentreten, weitaus die meisten übernahmen als Söhne von Kaufleuten einfach den väterlichen Handel. Zu ihrer Ausbildung erachtete man in wohlhabenden Familien eine auswärtige Lehrzeit, am liebsten im Auslande, für notwendig: »mancher kauffmann sendet seine suͤn in welsche land«[111]. Nach beendeter Lehrzeit tritt der junge Mann in das väterliche Geschäft ein oder er macht sich gleich selbständig, hält selbst Haus und stellt eigene Bedienstete an, die er dadurch möglichst an sein Geschäftsinteresse zu binden sucht, daß er ihnen einen gewissen Anteil am Gewinn gibt, denn »es ist vernunfftig, wenn ein kauffmann lot daz gesind, den gadenknecht auch teil haben am gewerb, wann sie seind desto trüwer, vnd schencken dester minder hinweg, so sie an yeglichem ding ir teil haben des verkauffens«[112]. Derweilen besorgt er selbst die Geschäftsreisen, unterhält die überseeischen Beziehungen — »iedermann weiß, mit was sorg und arbeit die kaufleut daraffter faren biß gon india, sie fliehen armuͦt durch wasser vnd erdtreich«[113] — und endlich führt er die[S. 85] Verbindungen mit den Mitgliedern seiner Handelsgesellschaft[114], »da etwann acht oder zehn kauffmann ir gelt zuͦsammen legen, kauffmannschatz damit zu treiben, ayner ligt zuͦ Rom der ander zu Venedig, der drit zuͦ Nürnberg, der vierd zuͦ Antorff«[115]. Zur näheren Charakterisierung dieser Genossenschaften, die übrigens, wenn irgend möglich aus Angehörigen ein und derselben Familie sich zusammensetzten, wird es genügen, noch die Worte anzuführen, mit denen Geiler (Brösaml. II. fol. 35) sich darüber äußert: »In der grossen gesellschaft, da seind die kauflüt miteinander verpflicht. Da legt einer fünft hundert güldin, einer zwei hundert güldin, vnd haben ir gewerb zuͦ Venedig, zuͦ Lugdun, zuͦ Antorff, vnd vberal ire verweßer. Wenn einer gewint oder verlürt, so gewinnen oder verlieren sie alle zusammen, vnd wenn sie zusammen kummen, so seind ettwann zwei tausent güldin gewunnen, so wissen sie bei der rechnunge, was yeglichem gehört, nachdem vnd er gelert hat.« Die verschieden große Beteiligung der Mitglieder, das gemeinsam getragene Risiko, die Arbeit an den einzelnen Niederlassungsorten, das Wirken der Verweser dortselbst, schließlich die Generalversammlung der Mitglieder und die Verteilung des Gewinnes entsprechend dem Maße ihrer Beteiligung und ihrer Geschäftsgewandtheit, das alles hat Geiler in jenen wenigen Worten sehr hübsch und anschaulich zusammengestellt.
Wir wenden uns der Schilderung des Kaufaktes zu, und indem wir den Käufer beim Eintritt in den Kaufmannsgadem begleiten und die ausgelegte Ware ins Auge fassen, erinnern wir uns dessen, was wir über die häufigen Fälschungen gehört haben, und treten nicht ohne Mißtrauen an die Auslage heran. In der That zeigt sich bald, daß dasselbe berechtigt ist, und wir wundern uns nicht mehr allzusehr, wenn wir im Jahre 1512 Murner in seiner Schelmenzunft (Kap. XXV) schelten hören:
Die betrügerische Kunstfertigkeit der Verkäufer, ihre Waren über Gebühr anzupreisen, hatte schon Johannes Gerson am Anfang des 15. Jahrh. verdammt: »vitetur mendacium (et specialiter ad damnum alterius) in laudando suas merces multo plus quam iudicentur esse laudandae«[116], Nider bestätigt, daß der Kaufmann die Leute verführt, zu teuer zu kaufen, »ementem aliqua arte signorum factorum uel verborum, eciam si vera sint, inducit ad emendum carius quam alias«[117] und Geiler (Brösaml. I. fol. 91) läßt uns gar die Anpreisungen selbst hören: »Einer sprichet, »das ist ein guͦte war«, vnd doch nitt werdt ist, »ich hab das thuͦch daher kaufft, vnd hab es dem vnd dem auch also verkaufft vnd dennocht zweier oder dreier pfenning thürer geben, vnd mag nitt darbei beston, so mir got müß helffen, es ist also.« Vnd du weist wissenlich, das es falsch ist.« Oder an einer andern Stelle[118] sagt er: »Du kumpst gar selten in ein gaden, du findest des affenschmaltzes darin. Kumpst du in ein thuͦch gaden, so hebt man dir ein thuͦch herfür: »Sehen, lieber her, ab dem ist auch noch nie kein elen kummen.« Affenschmaltz ist da! »Vnd het ich ein guͦt thuͦch im hindersten winckel, ich wolts euch geben«. Vnd wann du dich also laßt salben, vnd mit disem affen schmaltz laßt schmieren, wan du hinweg kumpst, so halt er dich für ein narren, vnd gibt dir den muff nach (= er verhöhnt dich).« Selbst wenn ein Verkäufer — was zwar selten genug vorgekommen zu sein scheint — den Grundsatz hatte, keine gefälschte Ware zu verkaufen, so schreckte doch offenbar so gut wie niemand davor zurück, fehlerhafte Stücke als tadellos und zu gleich hohem Preise loszuschlagen. Zwar hatte Gerson (a. a. O. fol. d a b) schon entschieden sich dahin ausgesprochen, daß solche Mängel nicht verheimlicht werden dürften, und daß der Preis herabgesetzt werden müßte: »si in mercibus sive[S. 87] venialibus sunt magni defectus, qui sciri non possunt aut percipi, sive recipiendo sive tangendo non debent celari, nec vendi debeant ac si praedictos defectus non haberent«, aber bei Nider, der doch sonst auch nicht gerade mit seiner Meinung zurückzuhalten pflegt, scheint mir schon aus der ganzen Art der Fragestellung: »numquid venditor tenetur defectum rei vendendae dicere emptori«[119] hervorzugehen, daß die Zeit mehr geneigt war, es für das Risiko des Käufers zu halten, ob er ein gutes oder ein weniger gutes Stück bekommt.

Fig. 4. Der Kaufmann mit der falschen Elle. Aus den acht
Schalkheiten ca. 1470[120].
(Steinhausen a. a. O. Abb. 30.)
In dem letzteren Falle würden also die Kaufleute etwas entlastet werden, dagegen ist es aber kein Zweifel, daß sie von der immer wieder erhobenen Anschuldigung, zu kleines Maß und Gewicht zu gebrauchen, mit vollem Recht betroffen wurden. Wenn im Jahre 1494 Brant’s Narrenschiff 102, 30 ff, die Klage erhebt:
wenn ferner Geiler (Narrensch. fol. 198 b) in Anlehnung an Brants Worte sagt: »Item welcher ist gerecht in quantitate, in der zal, im gewicht vnd in der maß? Acht lot für V! Die metzger wiegen iren dumen! In numero: X für XII biren, öpffel, ein kurtze elen, falsche sester[121], vnrecht maß zuͦ dem oͤl, wein, hunig etc.« — ist es nicht das alte Lied, das auch Nider (a. a. O. fol. 5a) schon gesungen hat: »In quantitate eciam fraus committitur, que per mensuram cognosci potest, ideo si quis scienter utatur deficienti mensura in vendendo per modium, virgam, pondus et similibus deficienter mensurando.«
Verminderung von Maß und Gewicht waren aber nicht die einzigen Mittel, durch die die Verkäufer sorgten, daß sie nicht zu kurz kamen, auch ihre Preise darauf einzurichten, verstanden sie vortrefflich. Offenbar war beim Kauf ein hartnäckiges Handeln und Feilschen sehr stark üblich, das Publikum feilschte, weil es wußte, daß die Verkäufer aufschlugen, und weil die Verkäufer wußten, daß das Publikum handeln werde, so schlugen sie nur noch mehr auf. Gerson (a. a. O. fol. d I. b.) hatte deshalb schon angeregt, die Kaufleute sollten feste Preise einführen, der Verkauf würde dann schneller und vor allem in einer Gott wohlgefälligen Weise von statten gehen: »ad cauendum periurationes et mendacia et alia peccata ego consulo seruari consuetudinem quorundam bonorum et fidelium mercatorum, hoc est non superferre suas merces sed eas vendere ad vnum verbum. Et quando videbitur haec consuetudo, citius et brevius emetur et fiet placitum deo.« Gerson stützte sich bei diesem Vorschlage auf die Erfahrungen, die »einige gute und rechtschaffene Kaufleute« damit gemacht hatten, man sieht schon, daß dieselben eine Ausnahme bildeten. So konstatiert denn auch Nider (a. a. O. fol. 17b) einfach: »institores et mercatores consueverunt, preciosius exhibere quam valeat«, und 70 Jahre später führt Geiler (Brösamlin I. fol. 91b) dasselbe näher aus mit den Worten: »Thürer bieten weder man es geben wil, vff das der kauffmann kum vff das recht mittel, das ist tegliche sünd. Als so einer ein elen thuͦch wil geben vmb sechß schiling, solt er es also bieten, so het der, der es kauffte, kein benügen daran, sunder er wolt es haben vmb sechßthalben schilling. Darumm so thuͦt er eins vnd bütet es vmb sibenthalben schilling, vff das er kum vff das recht mittel, vff den rechten kauff.« Natürlich wenn der Käufer den Wert der Ware nicht abzuschätzen vermochte, oder wenn er durch irgend welche Ursache gezwungen war, gerade ein bestimmtes Stück zu kaufen, oder schließlich wenn er sich nicht auf das Handeln verstand und den ausgesetzten Preis entweder ganz[S. 89] bezahlte oder nicht genug herunterhandelte, dann strich der Verkäufer den Aufschlag ohne Skrupeln ein und lachte sich ins Fäustchen. Potest etiam fraus tribus aliis modis committi in vendendo. Primo si homini inexperto circa rem, seu simplici superuendit rem scienter. Secundo si vidit, emptorem artatum necessitate nel inordinata affectione impulsum, et propter hoc superuendit. Tertio quin venditor scienter verbis rem, quae vix valet vnum denarium, exhibet pro quatuor. Et emptor ex verecundia vel quia credit, non superexhiberi rem plusquam vnum denarium, dat tres pro ea.«[122]
Man kann sich denken, wie empört nachher der Käufer war, wenn er erfuhr, daß ein anderer bei demselben Händler dieselbe Ware bedeutend billiger gekauft hatte, wußte er doch, daß ein Wechsel der Preise in der Regel nur geringfügig ist und auch nur allmälig sich bildet. Daß man freilich den Preis nicht für alle Verhältnisse auf Heller und Pfennig genau fixieren könne, daß also Preisschwankungen möglich wären, das war dem Publikum völlig vertraut und verständlich, wie wir aus vielen Stellen bei Nider erkennen können, z. B. wenn er (a. a. O. fol. 9b) sagt: »Justum precium non est quodcunque punctualiter determinatum sed magis in quadam aestimacione consistit, ita quod modica addicio vel minucio non videtur aequalitatem iusticiae tollere.« Nur verlangte man, daß der Preis in einem vernünftigen Verhältnis zu den Spesen, die auf der Ware lasten, angesetzt würden, und daß man im allgemeinen beim Kauf auf Borg nicht teurer zahlen müsse als bei Baarzahlung: »custodiatur bona fides secundum quod merces constiterint et pro quanto vendi possint saluo sufficienti lucro secundum labores factos et secundum tempus quod currit. Et quod propter simplicitatem alterius aut bonam fidem non fiat ei peius. Item quod non vendatur carius ad credulitatem quam ad argentum, nisi forte haberetur damnum magnum in non habendo argentum[123]«. Das aber mußte, vor allen Dingen bei den Armen, schweren Anstoß erregen, wenn sie sahen, daß einflußreiche Leute, Mitglieder des Rates u. s. w. kein Bedenken trugen, in Rücksicht auf ihre Stellung sich Vorzugspreise gewähren zu lassen, wie wir z. B. einmal bei Geiler (Brösaml. I. fol. 83b) lesen: »Wenn einer im regiment ist, vnd sol fisch kauffen, so bekent in der fischer gar wol vnd gibt sie im allwegen dreier oder vier pfening neher, dann wenn er nit im regiment wär. Wer weiß, wa er des herren würd bedörffen!«
In inniger Beziehung zu den Preisen steht natürlich der Verdienst der Kaufmanns. Ein jeder, der ein ehrenhaftes Gewerbe treibt, hat Anspruch auf Verdienst: »vnumquemque in opere honesto reipublicae servientem oportet de suo labore vivere honeste. Honeste dico propter meretrices histriones et inhoneste viventes«[124]. Nach der Größe und der Gemeinnützigkeit seines Fleißes und seiner Bemühungen, meint Nider[125] solle der Kaufmann seinen Verdienst bestimmen, und ebenso nach der Größe und dem Werte seiner Ware: »mercator debet cum timore luctum recipere racionabiliter secundum[S. 90] noblitatem et gravitatem et utilitatem curae, laborum, industriae et sumptuum, quos et quas contingit habere, nec non secundum magnitudinem, multitudinem aut preciositatem rerum, in quibus servit aut ministrat hominibus.« Ein Hökerweib könne an ihrem Kohl nicht so viel verdienen wollen wie der Krämer an seiner Ware, und dieser wieder müsse hinter dem Großkaufmann zurückstehen, der die Importen auf den Markt bringt: »penestica vendens pisum vel olera, et de vno facili comitati serviens non tantum lucri recipere potest sicut institor vendens nobiles et multum vtiles mercantias. Nec institor in quiete quodammodo residens ceteris paribus potest tantum lucri recipere eciam de aeque magna pecunia sicut adducens res aeque bonas de partibus longinquis«[126]. Im allgemeinen hielt man einen Durchschnittsgewinn von 30 bis 40 % für angemessen, worüber Steinhausen (pag. 77) nähere Angaben macht. Nider (a. a. O. fol. 12a) berechnet den Verdienst mit 50 % wenn er sagt: »esto quod mercator statuat in corde suo, quod pannum, quem habet pro sex, velit dare pro nouem solidis«.
Waren Verkäufer und Käufer nun handelseinig geworden, so hatte der letztere eine Anzahlung zu leisten, dadurch wurde das Geschäft endgiltig besiegelt. Dieses »Aufgeld«, auch »Gottespfennig« genannt, wurde dann bei der abschließenden Bezahlung vom Kaufpreise abgezogen: »das vffgeld, das in latein würt genannt arra: wenn einer etwas kaufft, es sey ein hauß, acker oder matten, wein oder korn, so gibt er dem verkauffer etwas daruff, ein teil geltes, so er im schuldig ist. Damit ist der kouff beschlossen vnd gewiß gemacht, das es also bleiben sol vnd stet gehalten werden — würt ettwen genannt ein gotzpfenning, den man daruff gibt, vnd nit me, vnd ist ein vnderscheid zwüschen eym pfand vnd vffgelt. Wenn so die betzalung geschieht, so gibt man das pfand herauß aber nit das vffgelt, sunder man erfüllet es mit der übrigen betzalung«[127].
Wenn wir zum Schluß uns mancher Einzelheiten erinnern, über die unsere Zusammenstellungen einige Klarheit zu verbreiten gesucht haben, so müssen wir mit Schmerzen gestehen, daß übermäßig viel die Rede sein mußte von Lug und Betrug, von Warenfälschungen und Wucherpreisen, von Geldschneiderei und unredlichen Spekulationen. Wir müßten demnach ein ungemildertes Verdammungsurteil über den Kaufmann des XV. Jahrhunderts aussprechen, und wir dürfen es auch nicht verschweigen, daß die Erhebung gegen den unerträglichen Druck des Großkapitalismus, der sich in den Händen der großen Kaufherren angesammelt hatte, nicht einer der geringsten Beweggründe war für die aufständischen Bewegungen und die revolutionären Stürme, die am Beginn des XVI. Jahrhunderts in so vielen deutschen Städten zu erschreckendem Ausbruche kamen[128]. Um so mehr fühlen wir uns aber verpflichtet,[S. 91] auch dessen zu gedenken, was den Kaufmann zum Teil entschuldbar erscheinen läßt, dessen, was er von anderen Ständen zu erdulden hatte, der vielfach hervortretenden Unsicherheit des Erwerbs, der Beschwerlichkeiten des Verkehrs und der Gefahren der Reise, der drückenden Abgaben und lästigen Hemmnisse, die auf dem Handel lasteten. Zudem finden wir jenen brutalen Egoismus nicht nur im Leben des Kaufmannes wirksam, vielmehr steht das ganze Zeitalter unter seinem Zeichen und mit dem Kaufmanne teilen ihn auch alle übrigen Stände, bei denen er nur andere Erscheinungsformen annimmt. Endlich aber wollen wir vor allem nicht vergessen, was Deutschland gerade im XV. Jahrhundert seiner Kaufmannschaft zu danken hatte. Was auch der einzelne Kaufmann verschuldet haben mag, die Gesamtheit hat es wieder gut gemacht, denn eben sie begründete die hohe Blüte der deutschen Kultur, auf der die großen Errungenschaften der Renaissance und der Reformation in Deutschland beruhen.
VON TH. HAMPE.
Die Fragen, die sich an diese Kreuze knüpfen sind sehr mannigfaltiger Art, indessen teilweise bereits durch die bisherige Forschung gelöst oder doch ihrer Lösung nahe geführt. So kann namentlich durch die Ausführungen Paolo Orsis[129] und die sie in vielen Punkten wesentlich ergänzenden R. Majocchis[130] als erwiesen gelten, daß wir es in dem Gebrauch dieser Kreuze mit einem Spezifikum der Langobarden zu thun haben. Mit verschwindend wenigen Ausnahmen haben sie sich bisher alle in denjenigen Gebieten Italiens gefunden, die von den Langobarden seit der zweiten Hälfte des VI. Jahrhunderts in Besitz genommen worden waren, und teilweise sind die Hauptfundstätten zugleich die ehemaligen Hauptstützpunkte der langobardischen Herrschaft. Ihr Nichtvorkommen im übrigen Italien, wie beispielsweise auch in Ravenna schließt die Möglichkeit einer römischen oder ostgotischen Sitte geradezu aus. In Betracht könnten daher neben den Langobarden höchstens noch die Franken kommen, deren Scharen zu verschiedenen malen Italien heimgesucht haben, wie denn ja auch schließlich das Langobardenreich seine Selbständigkeit an die Franken unter Karl dem Großen verlor. Man hat daher auch hin und wieder für einige dieser Kreuze fränkischen Ursprung in Anspruch nehmen wollen; so für das an letzter Stelle beschriebene und Fig. 14 abgebildete Kreuz unserer Sammlung[131]. Der allerdings von der Verzierungsweise der übrigen wesentlich abweichende Stil dieses Kreuzes, den man als merovingisch ansprechen zu[S. 93] dürfen glaubte, sowie das sich fünfmal wiederholende, freilich schwer zu entziffernde Monogramm, das man auf einen der Frankenkönige mit Namen Chilperich oder Childebert deuten wollte, führte zu dieser Annahme. Auch haben sich sowohl in fränkischen, wie auch in bayerischen Gräbern in der That gelegentlich dergleichen Kreuze gefunden[132]. Indessen sind solche Funde diesseits der Alpen bisher zu vereinzelt geblieben, als daß man daraus einen Schluß etwa auf fränkische Herkunft der betreffenden Kreuze ziehen dürfte. Es ist vielmehr bei den vielfältigen Beziehungen zwischen den Langobarden und den Bayern und Franken und bei der Expansivkraft, die der spezifisch langobardischen Kunst frühzeitig innewohnt[133], sehr wahrscheinlich, daß wir auch in den zu Schwabmünchen, Langenerringen u. s. w. gefundenen Kreuzen Import aus dem Langobardenreich jenseits der Alpen vor uns haben[134]. Für Italien endlich wird die Frage, ob die Erscheinung dieser Kreuze fränkischer oder langobardischer Kultur und Kunst entsprossen, schon durch einen Vergleich der Waffen, die hier in so großer Zahl zusammen mit den Kreuzen gefunden worden sind, mit der in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters bei den Franken üblichen Bewaffnung zu Gunsten der Langobarden entschieden[135].
Mit der Frage nach Ort und Volk erledigt sich — wenigstens im großen — auch zugleich die Frage nach der Zeit der Entstehung unserer Kreuze. Die Zeit der Langobardenherrschaft in Italien, also etwa das VI.-VIII. Jahrhundert, wird man vornehmlich dafür in Anspruch nehmen dürfen. Möglich, daß analog der Entwicklung der langobardischen Plastik[136] auch hier der Beginn eigener Kunstübung kaum vor der Mitte des VII. Jahrhunderts anzusetzen ist, möglich auch, daß manche der Kreuze erst dem IX. Jahrhundert entstammen, da mit der Unterwerfung unter des großen Frankenkönigs Herrschaft Brauch und Kunstübung der Langobarden nicht alsbald in Abnahme gekommen zu sein braucht und ihre nationale Plastik in der That auch später noch manches bedeutendere Werk hervorgebracht hat. Die genauere Zeitbestimmung, die zeitliche Gruppierung und die Datierung der einzelnen Kreuze muß jedoch zukünftiger Forschung vorbehalten bleiben. Ein eingehendes Studium sämtlicher bisher bekannter Stücke dieser Art und ein Vergleich mit anderen uns erhaltenen Denkmälern der langobardischen Kultur, insbesondere auch, wie früher schon angedeutet wurde, der Münzen, würde vermutlich auch für die Zeitbestimmung im einzelnen sichere Anhaltspunkte ergeben.
Was nun die kunstgeschichtliche Seite der Erscheinung unserer Kreuze betrifft, so blickt schon aus obigen Ausführungen zuweilen die Annahme hervor, daß es sich nicht allein um Gegenstände, die — etwa von fremden Künstlern — zum Gebrauch für die Langobarden hergestellt worden sind,[S. 94] sondern zugleich um Erzeugnisse der eigenen, der langobardischen Kunst handelt. Diese Annahme findet nicht nur in der überaus primitiven Technik fast aller dieser Kreuze und in der ebenso primitiven Ornamentik eines großen Teils derselben — vgl. z. B. oben Nr. 1–7 — ihre Stütze; auch die von reiferer Kunst zeugenden, reicher ornamentierten unter ihnen weisen in ihrem Dekor so manche Berührungspunkte mit anderen authentischen Werken der langobardischen Kunst auf, daß an ihrem Ursprung in der Werkstatt eines langobardischen Goldschmieds[137] nicht wohl gezweifelt werden kann. Es begegnen uns hier nicht selten die gleichen Band- oder Riemengeschlinge, die sich so zahlreich an den plastischen Denkmälern der Langobarden finden und für die namentlich die Dreiteilung der einzelnen Riemen durch zwei tiefe Fälze so charakteristisch ist[138] — man vergleiche insbesondere Fig. 8. Ebenso weist die Wiedergabe menschlicher Figuren oder einzelner Körperteile, der »alle Kenntnis von Anatomie und Proportion mangelt«, der Gesichter, die sich als »rohe, starre Larven« darstellen, der Hände, die »ausgestopften Handschuhen« gleichen[139], genau die gleichen Eigentümlichkeiten auf, die uns von den übrigen Werken der langobardischen Kunst bekannt sind.
Eine andere Frage ist freilich die: wieweit darf auch ihrem Ursprunge nach die uns auf diesen Kreuzen begegnende Ornamentik als spezifisch langobardisch betrachtet, wieweit muß sie in diesem Sinne als gemeingermanisch, wieweit als Entlehnung vornehmlich aus der Antike aufgefaßt werden? Und hier sind es im Grunde nicht so sehr jene wenig charakteristischen primitiven Verzierungen durch Punkte in Reihen oder in regelmäßigen Gruppen, durch Striche und Strichelungen aller Art, als eben wiederum jenes Band- oder Riemenwerk, das »Geriemsel«, um das seit einer Reihe von Jahren unter den Forschern ein heftiger Kampf entbrannt ist. Während die eine Partei (Hans Hildebrand, Sven Söderberg u. a.), die den Germanen der Völkerwanderungszeit keinerlei eigene Tierornamentik zugesteht, am liebsten auch die meisten Bandverschlingungen dieser Art, wie wir sie ja nicht nur bei den Langobarden, sondern ähnlich auch bei den Skandinaviern, Angelsachsen, Franken u. s. w. antreffen, auf Barbarisierung antiker Tierornamente zurückführen möchte, sieht die andere Partei (Sophus Müller etc.) in dem teils auf die Flechtarbeit als Vorbild zurückgehenden, teils auf der Metalltechnik beruhenden ornamentalen Bandwerk das Ursprünglichere, aus dem sich ebenfalls ohne Beeinflussung durch die Kunst der alten Völker eine germanische Tierornamentik spontan entwickelt hat. Ein näheres Eingehen auf diese Kontroverse und die Begründung der beiderseitigen Ansichten liegt außerhalb des Rahmens dieses Aufsatzes. Es sollte mit dem Hinweis darauf nur kurz angedeutet werden, wie schwierige Aufgaben auch hinsichtlich der Ornamentik unserer Kreuze noch von der Forschung zu bewältigen bleiben. Denn nicht besser als um die sichere Erklärung von Herkunft und Bedeutung des »Geriemsels« steht es um unser[S. 95] Verständnis der sonstigen ornamental verwandten Darstellungen, die diese Kreuze zeigen, wie beispielsweise der martialisch aussehenden Männerfigur mit dem prächtigen Scheitel und den Schnörkelbeinen auf Kreuz Nr. 11 (s. o. Fig. 11) oder der vier Gesichter auf Kreuz Nr. 13 (Fig. 13), wie sich dergleichen in ähnlicher Zusammenstellung noch auf mehreren anderen Kreuzen finden[140].
Eine Erklärung solcher Einzelheiten, die sich ohne Zweifel wiederum vor allem auf ein eingehendes und vergleichendes Studium des gesamten Materials d. h. aller bisher bekannten Kreuze dieser Art stützen müßte, würde im übrigen wesentlich mit bedingt sein durch die klare Erkenntnis der Bestimmung, des Zweckes, den diese Kreuze gehabt haben. Aber auch dazu — es ist der letzte Punkt, der hier zu erörtern bleibt — ist die Forschung bisher leider noch nicht vorgedrungen.
Wie sich aus den feinen Durchbohrungen, die alle diese Kreuze an ihren Endigungen, manche der größeren auch an ihrem Mittelstück aufweisen, mit hinreichender Sicherheit ergiebt, sind sie ursprünglich — vermutlich auf dem Gewande der Toten, in deren Gräbern sie gefunden wurden — aufgenäht gewesen. Darüber stimmen alle Forscher überein; die Frage ist nur: wozu sie aufgenäht wurden, was sie bedeutet haben mögen. Unter den 81 Kreuzen, die Orsi als in Italien gefunden aufzählt, sind uns für etwas mehr als die Hälfte, nämlich für 42, mehr oder minder eingehende Nachrichten über ihre Auffindung insbesondere über die mit ihnen zusammen bei den Skeletten gefundenen Gegenstände überliefert[141]. Diese 42 Kreuze verteilen sich auf im ganzen 16 Funde. Bei 14 von diesen 16 Funden konnte es infolge der zahlreich mit ausgegrabenen Waffen nicht zweifelhaft sein, daß es sich um langobardische Kriegergräber handle. So war in der That die Vermutung nicht ganz von der Hand zu weisen, daß auch die Kreuze in irgend einer Beziehung zu dem Berufe des Kriegers stehen, etwa als militärische Abzeichen oder Auszeichnungen aufzufassen sein möchten. Dieser Annahme standen aber die beiden anderen Fälle, in denen man es offenbar nicht mit Kriegergräbern zu thun hatte, hindernd entgegen. Der eine derselben betrifft einen Grabfund, der bereits 1750 in Cividale del Friuli gemacht wurde. Bei Restaurierungsarbeiten am Chor der Kirche St. Benedikt stieß man damals auf unterirdische Grabkammern, in denen drei steinerne Sarkophage standen. In dem ersten, der seiner Größe nach die Leiche eines Kindes von etwa 15 Jahren geborgen haben mochte, fanden sich vier oder fünf Goldkreuze, dazu Bruchstücke eines Glasgefäßes. Sechs weitere Kreuze fanden sich in den beiden anderen Sarkophagen zusammen mit verschiedenen anderen Gegenständen aus Gold, Silber und Glas oder Bruchstücken von solchen und untermischt mit Asche und Knochen[142]. In dem andern Falle endlich durfte sogar aus einem mit einem solchen Goldkreuz zusammen gefundenen Paar Ohrringen[S. 96] auf ein Frauengrab geschlossen werden[143]. Im Hinblick überdies auf die zahlreichen Kreuze, die ohne genaueren Fundbericht auf uns gekommen sind — zu ihnen gehören mit nur einer Ausnahme (vgl. oben Nr. 9, Fig. 9) auch alle jetzt im Germanischen Museum befindlichen — konnte jene Vermutung demnach nicht aufrecht erhalten werden und die wichtigste weitere Frage war nur: waren diese Kreuze auch bei den Lebenden in Gebrauch oder haben wir sie lediglich als Grab-Beigaben, als Votivgaben für die Verstorbenen anzusehen? In diesem Punkte sind die beiden Forscher, die zuletzt ausführlicher über unseren Gegenstand gehandelt haben, Orsi und Majocchi, nicht einerlei Meinung. Während Orsi sich mehr der Ansicht zuneigt, daß die »crocette langobarde fossero di uso esclusivamente funerario« und zur Begründung derselben vor allem auf die große Zartheit der aus dünnem Goldblech hergestellten Kreuze hinweist, die die Möglichkeit eines praktischen Gebrauchs geradezu auszuschließen scheine[144], möchte Majocchi darin Schmuckstücke erblicken, die der Stolz und die Freude der Lebenden gewesen seien und daher den Toten mit in das Grab gegeben wurden: »non poteva dunque essere strappata la croce da quei cadaveri, la croce che li aveva aecompagnati constantemente vivi, della quale si erano gloriati ed ornati, cui avevano amato di sì vivo affetto«[145]. Angesichts der zarten Gebilde, die vor mir liegen, glaube ich indessen eher der Anschauung Orsis als derjenigen Majocchis beipflichten zu sollen, zumal mir die letztere durch gleichzeitige Abbildungen und das, was wir bisher über die Tracht der Langobarden wissen, keineswegs genügend unterstützt zu werden scheint. Da die Kreuze bei den Skeletten gewöhnlich in der Brustgegend gefunden wurden, sollte man doch, wenn wir es dabei thatsächlich mit Schmuckstücken für die Lebenden zu thun hätten, wohl annehmen, daß sich die eine oder andere Darstellung erhalten habe, die ein solches Kreuz in »religiös-ornamentaler« Verwendung[146] auf der Brust des Dargestellten zeige. Das ist aber nicht der Fall. Nur Kreuze auf Vorhängen oder an Stelle der Clavi oberhalb der Kniee oder an einem Zipfel des Gewandes etc., von denen noch nicht einmal ausgemacht ist, in welcher Technik man sie sich hergestellt zu denken hat, haben bisher zum Vergleich herangezogen werden können.
Immerhin ist auch diese Frage noch kaum spruchreif und ersieht man aus obigen Ausführungen überhaupt, welch eine Fülle von Problemen aus den verschiedensten Gebieten hier noch der Aufklärung harren. Umsomehr werden es alle Freunde des Germanischen Museum mit Genugthuung begrüßen, daß unsere Anstalt sich dieses hochbedeutsame Studienmaterial nicht hat entgehen lassen, sich vielmehr durch seine Erwerbung in den Besitz der reichsten bisher bekannten Kollektion solcher langobardischer Votivkreuze gesetzt hat.
Im Anschluß an die im vorigen Aufsatze besprochenen langobardischen Goldkreuze bilden wir vorstehend in Originalgröße, und zwar in Aufrollung, einen Schaftbeschlag (F. G. 1614) ab, der nach Mitteilung des Herrn Geheimrat Bode in Berlin zusammen mit Eisensachen und sonstigen Gegenständen in einem langobardischen Grabe gefunden und 1897 durch das Germanische Museum von Herrn Cavaliere Achille Cantoni in Mailand erworben wurde. Der kreisrunde Beschlag, der 30 mm. im Durchmesser und eine Dicke von etwa 1 mm. hat, diente vermutlich zur Verzierung und Festigung eines Lanzenschaftes. Er ist ganz aus Silber gefertigt und mit sorgfältig ausgeführten, sehr kräftigen Gravierungen versehen, die teilweise mit Niello ausgefüllt sind. Die nicht in solcher Weise wieder auf das Niveau der ursprünglichen Oberfläche gebrachten Eingrabungen bilden die Linien der Hauptmusterung, während das Niello zur Zeichnung innerhalb dieser Contouren verwandt worden ist, wie unsere Abbildung zur Genüge zeigt. Am unteren Ende jeder der vier lambrequinartigen Verbreitungen des Beschlages befindet sich ein rundes Loch für die Nägel, mit denen das Stück ehemals an seinem Schaft befestigt war. Nur einer dieser Nägel, ein langer, spitzer, dreikantiger Silberstift, ist noch vorhanden. Im übrigen ist das Stück, abgesehen von einem, wie es scheint durch Abschmelzen herbeigeführten Defekt an einer der breiten Endigungen (auf unserer Abbildung angedeutet), sowie von zwei kleinen, ebenfalls durch Feuer beschädigten Stellen am oberen Rande, und einigen wenigen Stellen, die ihres Niellos verlustig gegangen sind, gut erhalten.
In seiner Ornamentik berührt sich unser Schaftbeschlag vielfach mit anderen Werken der langobardischen Kunst. Man vergleiche für das fortlaufende Ornament der beiden oberen Bänder beispielsweise das oben unter Nr. 10 näher beschriebene und abgebildete Kreuz, für das die beiden Bänder trennende und auch die einzelnen Teile des Beschlags einfassende Zickzackornament unter anderm die aus dem Anfange des VII. Jahrhunderts stammende Evangeliendecke der Königin Theodolinde im Schatz der Johanniskirche zu[S. 98] Monza (abgebildet bei Labarte, Histoire des arts industriels au moyen âge I. Band, Tafel XXVIII). Früher als etwa in den Beginn des VII. Jahrhunderts möchte ich auch schon wegen der reifen Kunst, die das Stück zeigt, die Entstehung unseres Beschlages nicht setzen — obgleich freilich zuvor erst auszumachen wäre, ob man einen langobardischen Goldschmied als Verfertiger annehmen darf oder eher an einen Römer oder Byzantiner gedacht werden muß.
(Hierzu Tafel IV.)
Während bei den in den letzten beiden Artikeln behandelten Gegenständen, den langobardischen Goldkreuzen sowohl, wie dem silbernen Schaftbeschlag, das kulturgeschichtliche Interesse oder ihre Bedeutung für die Geschichte des Ornaments den Wert der Stücke speziell als Goldschmiedearbeiten überwog, haben wir in dem auf der beigegebenen Tafel abgebildeten Kreuz (K. G. 763) ein Werk vor uns, das wiederum in erster Linie für den Stand der Goldschmiedekunst in der Zeit seiner Entstehung bezeichnend ist, vor allem aus diesem Gesichtspunkte betrachtet werden will. Wir knüpfen damit gewissermaßen wieder an jenen von mir an erster Stelle besprochenen ostgotischen Schmuck an, ohne jedoch auch nur den Versuch wagen zu wollen, die einzelnen Phasen aufzuzeigen, die etwa unsere Kunst im Abendlande während der vier Jahrhunderte, die dieses Kreuz von jenem Schmucke trennen mögen, durchlaufen hat. Bleiben doch die in meinem ersten Aufsatze angedeuteten, die Forschung so erschwerenden und die Gewißheit ihrer Resutate nur zu häufig beeinträchtigenden Verhältnisse teilweise auch für diese Folgezeit bestehen, wirken auch weiterhin die Dürftigkeit der Quellen und die weite Zerstreutheit der Denkmäler und ihre mangelhafte, wissenschaftlichen Zwecke nur ausnahmsweise genügende Veröffentlichung hemmend und lähmend auf den Fortgang der Forschung ein. Wenn aber auch aus diesen Gründen der Entwicklungsgang der Goldschmiedekunst vornehmlich in der ersten Hälfte des Mittelalters noch für kein Land mit einiger Deutlichkeit hat erkannt und nachgewiesen werden können, so brauchen wir doch, wie ich glaube, an der Möglichkeit solcher Erkenntnis nicht zu verzweifeln. Insbesondere die deutschen Kirchenschätze, fürstlichen Schatzkammern und Museen weisen noch eine ansehnliche Zahl trefflicher Arbeiten jener Zeit auf, und mit der Gruppierung derselben, der Zuweisung an bestimmte Schulen auf stilvergleichender Grundlage ist bereits ein tüchtiger Anfang gemacht worden. Einem einzelnen, neu auftauchenden Werke gegenüber wird indessen bei dem derzeitigen Stand der Forschung eine möglichst sorgfältige Beschreibung des Stückes und seiner Herstellungsart immer noch das wichtigste sein, und so mag denn auch hier eine solche, die Abbildung erläuternde und ergänzende Beschreibung den Bemerkungen historischer und stilistischer Art, die etwa über unser Kreuz zu machen sind, vorangeschickt werden.
Das Kreuz, das einer alten Stiftung in den Ardennen entstammt und im Frühjahr 1894 aus dem Besitz eines Frankfurter Händlers für die Sammlungen des Germanischen Museums erworben wurde, hat mit der eisernen Spitze und der Kugel, über der es sich erhebt, eine Gesamtlänge von 73 cm, für sich allein eine Länge von 57 cm. Der Querbalken ist 45 cm. lang. Die Breite der Balken schwankt zwischen 43 und 48 mm., sie endigen, wie die Figur zeigt, fischschwanzförmig und erweitern sich dabei auf 62 bis 68 mm. Der Durchmesser des annähernd kreisrunden Mittelstücks beträgt 9 cm.
Die ganze Goldschmiedearbeit ist über einem 2 cm. dicken, auf der Vorderseite flachen, auf der Rückseite leicht gewölbten Holzkern hergestellt, oder richtiger: um einen solchen angebracht. Bezüglich der Holzart bemerkte schon Herr Prälat Dr. Fr. Schneider, der das Museum bei der Anschaffung zu beraten die Freundlichkeit hatte, daß es sich um keines der sonst bei uns üblichen Hölzer, sondern eher um ein ausländisches Holz zu handeln scheine. Auch die mikroskopische Vergleichung eines Splitters von unserem Kreuze mit anderen Holzproben ergab trotz aller darauf gewandter Mühe kein ganz sicheres Resultat. Herr Prof. Reeß in Erlangen, welcher die Güte hatte, diese Untersuchung vorzunehmen, vermochte nur festzustellen, daß es ein Laubholz sei und unter den untersuchten Vergleichsproben am meisten Ähnlichkeit mit dem Holz des Birnbaums (Pirus communis) zu besitzen scheine. Fremdländischer Ursprung also ist auch nach dieser Erklärung nicht ausgeschlossen, wenn sich auch keinerlei sichere Schlüsse darauf aufbauen lassen.
Infolge des leider recht schadhaften Zustandes unseres Kreuzes läßt sich dessen Herstellungsweise auch im einzelnen ziemlich genau verfolgen. Der Holzkern ward in der Weise hergestellt, daß der Längsbalken samt dem hinteren etwas gewölbten Teil des Mittelstücks und ebenso der Querbalken mit dem vorderen Teil des Mittelstücks aus einem Stück geschnitzt und alsdann diese beiden sich in der Mitte also gegenseitig ergänzenden und genau entsprechenden Stücke kreuzweis ineinander gefügt und durch ein paar starke Eisennägel zusammen verbunden wurden. Nur am unteren Kreuzesende ist die fischschwanzähnliche Spaltung am Holzkern nicht vorgebildet, da hier das Kreuz mit dem Kugelfuß verbunden zu werden bestimmt war.
Der Form des Holzkerns entsprechend schnitt oder sägte sodann der Goldschmied die vier Kreuzarme, sowie das Mittelstück mit den Ansätzen der Kreuzarme aus einem nicht ganz ½ mm starken, auf der Oberfläche künstlich geröteten Bleche von 16 karätigem Golde aus und zeichnete sich wohl die Hauptmusterung des Kreuzes auf den so entstandenen fünf Blechstücken vor, um hierauf — aus Sparsamkeitsgründen — dieses Muster, d. h. alle diejenigen Stellen, die durch Steinfassungen oder Buckel verziert werden sollten, sorgfältig auszusägen und ebendort alsbald die vorher fertiggestellten Kastenfassungen mit ihren Steinen sowie die kleineren schildbuckelförmigen Verzierungen von der Rückseite des Bleches her aufzulöten.
Die Fassungen der Steine sind mit alleiniger Ausnahme des großen Ovals der Kreuzesmitte sämtlich von der Art, daß sich der Kasten mit fast senkrecht stehenden Wänden auf der Unterlage erhebt, sich dann aber zur[S. 100] besseren Fassung der Steine etwa in halber Höhe verengert, abschrägt, und je an der Stelle, wo diese Abschrägung beginnt, mit einem rings herumlaufenden Goldfiligrandraht verziert ist. Das Oval der Mitte wird gebildet durch einen mächtigen Bergkristall, der in einen Kranz übergreifender, dicht gestellter, gestanzter Akanthusblätter gefaßt ist und auf einem Kasten aufsitzt, dessen Fuß, wie die Abbildung deutlich zeigt, ein in regelmässigen Abständen durch eine rechteckige Kastenfassung unterbrochener Kranz halbkreisförmiger Goldzellen in der Art der alten Cloisonarbeiten umgiebt. Die Zellen sind mit rotem und dunkelgrünem Glas ausgesetzt, wobei, wie eine ihres Glases beraubte Zelle zeigt, wenigstens bei den roten Stückchen ganz feine Goldblättchen als Folie dienten. Unmittelbar über dem Zellenkranz verziert ein feiner, ebenfalls viermal unterbrochener Filigrandraht, weiter oben ein stärkerer Filigrandraht den Kasten des Bergkristalls, worauf ein starker kordonnierter Golddraht den Übergang zu dem Akanthusblattkranz bildet.
Der Form nach sind rechteckige, fast quadratische, und ovale Fassungen zu unterscheiden. Je zwei rechteckige Kästchen mit grünen Steinen, wohl Chrysoprasen, flankieren an den drei noch in ihrem vollen Goldschmuck erhaltenen Kreuzesenden große ovale Fassungen, und acht ebensolche, nur etwas größere Kästchen mit roten und grünen Steinen — Almandinen, die teilweise durch rotes Glas ersetzt sind, und Chrysoprasen (?) — wechseln rund um das große Oval der Mitte mit acht kleinen ovalen Fassungen ab. In diesen sitzen Almandinen, Granaten und teilweise auch rote Glasstücke. In einem der Kästchen fehlt der Stein. Zwei Reihen von ovalen Kästchen derselben Größe, die mit kleinen goldenen Buckeln wechseln, schließen auf jedem der vollständig erhaltenen drei Kreuzesarme eine Mittelreihe von beträchtlich größeren ovalen Steinfassungen, die jedoch kleiner sind als die schon erwähnten Fassungen an den Kreuzesenden, ein. In den kleinen ovalen Kästchen — es sind abgesehen von dem Mittelstück, das deren wie schon erwähnt noch acht weitere enthält, 46 an Zahl — sitzen 20 tafelförmig geschliffene Almandine, sieben mugelich geschliffene Granaten, ein ebensolcher Saphir, sowie ein Stückchen blauen und fünf Stückchen roten Glases. Aus zwölf dieser Fassungen ist der Stein verschwunden; fünf davon sind ganz leer, sodaß man die Fläche des Holzkernes sieht, in den übrigen sieben findet sich noch die alte Unterlage der Steine, die aus einer spröden, harzigen Masse besteht. Von den 21 noch erhaltenen ovalen Fassungen mittlerer Größe, die dicht aneinander gelötet sind, wobei die Lötstellen ehemals wohl überall durch kleine Spangen aus dickem Golddraht mit sich umrollenden Enden verdeckt waren — erhalten haben sich von diesen Spangen noch zwölf —, enthalten 15 der Länge nach durchbohrte, größtenteils birnförmige, mugelich geschliffene Saphire, eine einen Bergkristall, zwei blaues, und eine rotes Glas. Zwei dieser Fassungen sind völlig leer. Ebenso sind die beiden großen Fassungen am oberen und unteren Ende des Hauptbalkens leer, diejenige an dem erhaltenen Ende des Querbalkens indessen noch mit einem großen, der Länge nach durchbohrten Saphir ausgefüllt.
Die etwa 7 mm hohen Buckel, die mit den kleinen ovalen Kästchen auf den Kreuzesbalken, wie erwähnt, abwechseln, sind am Fuß und auf der Spitze[S. 101] durch rund herum gelegten Goldfiligrandraht von verschiedener Stärke verziert. Der obere, aus feinerem Filigran bestehende Drahtring umgibt die Öffnung eines kleinen Zilinders aus Goldblech, der im Innern des Buckels senkrecht steht. Über diese Öffnung legen sich kreuzweis zwei jener auch sonst verwendeten goldenen Spänglein, deren leicht umgerollte Enden bis auf den unteren stärkeren Filigranring des Buckels heruntergebogen sind. Auf dem Durchschnittspunkt der beiden Spangen sitzt, den Buckel bekrönend, je eine kleine goldene Kugel, die natürlich ebenfalls einigemale samt den Spangen der Unbill der Zeiten zum Opfer gefallen ist, wie denn an fünf Stellen außerdem die Buckel überhaupt fehlen. In dreien dieser Fälle ist wenigstens der Untergrund durch ein Stückchen gelbliches Blech ergänzt worden.
Die also mit ihrem Hauptschmuck versehenen fünf Bleche wurden sodann durch eiserne Nägel, deren platte Köpfe teilweise noch von Vergoldung schimmern auf der flachen Vorderseite des Holzkerns befestigt. Diese Nägel sind überall hart am Rande und je in einer Entfernung von etwa 30 mm. eingeschlagen, die Köpfe mit starkem Filigrandraht umgeben, sodaß sie wie kleine Rosetten wirken. Ganz ähnliche Rosettchen mit kleinen Goldkugeln oder -knöpfen als Mittelpunkt wurden je in der Mitte zwischen zwei Nagelköpfen auf die Unterlage aufgelötet, Kreuzbalken und Mittelstück schließlich noch mit starkem kordonniertem Golddraht umzogen.
Mit gleichem, nur etwas schwächerem Draht sind die verschiedenen schmalen Seitenflächen des Kreuzes eingefaßt, die im übrigen nur eine einfache, aus aufrechtstehenden schmalen Goldbändern gebildete Rankenmusterung auf rotgoldenem Grunde aufweisen. Es ist eine gewöhnliche Wellenranke, von der in regelmäßigen Abständen beiderseits kleine Ranken, an ihrem Ausgangspunkt je durch eine kleine Querstange zusammengehalten, abzweigen. In den durch die Hauptranke, eine der Nebenranken und den abschließenden kordonnierten Golddraht gebildeten Zwickeln ist regelmäßig eine kleine spitzovale Goldschleife, gleichsam eine aus dem Abzweigungspunkt der kleinen Ranken entspringende Knospe oder Keimblättchen, angebracht.
Die so ornamentierten Goldbleche, die den Schmuck der Seitenflächen des Kreuzes ausmachen, sind mit diskret angebrachten, feinen Eisenstiften auf denselben befestigt, doch verraten auch hier gelegentlich roh eingehauene dicke schwarze Eisennägel eine plump ausbessernde spätere Zeit. Auch die Endigungsflächen der Kreuzarme wiesen ehemals die gleiche Goldblechverzierung auf, doch haben sich davon nur verhältnismäßig geringe Reste an der oberen und unteren Endigung erhalten.
Das zur Verwendung gekommene Gold ist, wie mehrere, an den verschiedensten Stellen vorgenommene Untersuchungen mit dem Probierstein ergaben, auf der Vorderseite sowohl wie an den Seitenflächen des Kreuzes überall von der gleichen Qualität (16 karätig) und auch von der gleichen rötlichen Färbung. Nur wo dasselbe durch häufiges Anfassen oder sonstige Beschädigung abgewetzt ist oder aber, wie dies namentlich bei den für Verroterie bestimmten Zellen des Mittelstücks und dem Rankenwerk der Seitenflächen der Fall ist, das senkrecht zur Unterlage gestellte und aufgelötete[S. 102] Goldblech die Schnittfläche zeigt, erscheint es gelb. Das Filigran, das uns in zwei verschiedenen Stärken begegnet ist, hat die Eigentümlichkeit, daß um jedes der kleinen Kügelchen, aus denen sich der Faden zusammensetzt, in der Mitte eine feine Rille läuft, was jedoch gewiß nicht auf eine Absicht des Verfertigers, denn irgend eine besondere Wirkung wird dadurch nicht erzielt, sondern wahrscheinlich auf ein nicht ganz exakt arbeitendes Werkzeug zurückgeführt werden muß[147].
Die Rückseite des Kreuzes endlich war wohl ehemals völlig, ist heute noch an den vier Kreuzesarmen, doch nicht mehr an dem etwa kreisrunden Mittelstück mit vergoldetem Kupferblech verkleidet, in das zuvor hübsch stilisierte Ranken mit palmettenartigen Blättern eingepreßt worden waren, die je an den Enden der Kreuzbalken in zwei kleine Träubchen endigen und leicht erhaben auf ungemustertem Grunde erscheinen. Auch dieses Blech der Rückseite ist mehrfach geflickt.
Mit vergoldetem Kupferblech umkleidet ist auch die Kugel, über der sich das Kreuz erhebt, samt dem Verbindungsglied zwischen Kreuz und Kugel, das überdies mit gleichfalls aus vergoldetem Kupferblech hergestellten perlstabähnlichen Leisten — einer rundherum laufenden horizontalen und drei dazu senkrecht gestellten — verziert ist, während die Kugel ehemals mit einer aus eisernen Spangen und Knöpfen gebildeten Rautenmusterung versehen war, von der jedoch nur noch geringe Reste erhalten sind. Die starke Eisenschiene, die unterhalb der Kugel in eine stumpfe Spitze ausläuft, geht durch Kugel und Zwischenstück hindurch und scheint ziemlich tief in das untere Ende des Kreuzes hineingetrieben zu sein.
Dieselbe zeigt auf das deutlichste, daß wir es mit einem sogenannten Vortrags-, Stations- oder Prozessionskreuz zu thun haben, das bestimmt war, auf einen Schaft gesteckt, bei Prozessionen und sonstigen Umzügen der Schar der Andächtigen vorangetragen zu werden. Nach jedesmaligem Gebrauch ward es vom Schaft genommen und bei den übrigen Kostbarkeiten der Kirche oder des Klosters, in dessen Besitz es sich befand, verwahrt. Der Wert des Kreuzes bestand aber nur zum geringeren Teil in der Goldarbeit und den Steinen, mit denen es geschmückt war. Es ist vielmehr sehr wahrscheinlich, daß sich ursprünglich unter dem großen Bergkristall des Mittelstücks eine Reliquie, vielleicht eine Partikel vom Kreuze Christi befand. Der Umstand, daß gerade hier die, wie es scheint, aus einer Thonmasse bestehende, vielfach zersprungene Unterlage durch den hellen Kristall hindurch deutlich sichtbar ist, während der technisch wohl geschulte Verfertiger unseres Kreuzes derartige unschöne Wirkungen sonst überall zu vermeiden gewußt hat, läßt jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß in späterer Zeit Veränderungen mit der Kreuzesmitte vorgenommen, vermutlich also eine dort aufbewahrte Reliquie entfernt, wohl entwendet worden ist.
Im übrigen sind die verschiedenen erheblichen Beschädigungen unseres Kreuzes, insbesondere des linken Kreuzarms — auch die Glasstücke an Stelle der Saphire u. s. w. sind natürlich nicht ursprünglich, sondern lediglich Ergänzungen der in Verlust geratenen Steine — eher auf eine den späteren Zeiten zur Last fallende Verwahrlosung, als auf Beraubung zurückzuführen. Es ist wenigstens nicht einzusehen, weswegen ein Dieb sich nur des Goldbeschlags des einen Kreuzarmes oder einzelner, nach den erhaltenen zu schließen, nicht eben wertvoller Steine etc. und nicht gleich des gesamten Schmuckes an Gold und Steinen sollte bemächtigt haben.
Wie aber steht es um die Frage nach Zeit und Ort der Entstehung unseres Kreuzes, welchem Stile, welcher Schule mag dasselbe angehören?
Um der Beantwortung dieser Frage näher zu kommen, müssen wir versuchen, die verschiedenen stilistischen und technischen Momente, mit denen uns unsere eingehende Betrachtung bekannt gemacht hat, auf ihren historischen Wert hin zu prüfen. Figürliche Darstellungen, die uns diese Aufgabe ohne Zweifel wesentlich erleichtern würden, mangeln leider gänzlich.
Daß durch die Verwendung der Cloisontechnik in den um das Oval der Mitte angeordneten Zellen das Kreuz stilistisch noch in Beziehung steht zu jener großen Gruppe von Goldschmiedearbeiten der Völkerwanderungszeit, die ich in dem Aufsatze über den ostgotischen Schmuck genauer gekennzeichnet habe, wurde oben bereits angedeutet. Selbst die Unterlegung der roten Glasstücke mit einem ganz dünnen Goldblech als Folie findet sich hier wie bei den Ohrgehängen jenes Schmuckes. Aber technische Kunstgriffe solcher Art haben zumeist ein langes Fortleben, vererben sich, solange Vorbedingungen und Zweck die gleichen bleiben, von Generation zu Generation. Und was die Cloisontechnik selbst angeht, so findet auch sie sich sowohl bei den Abendländern, insbesondere den verschiedenen Germanenstämmen, wie bei ihren Lehrmeistern, den Griechen am Pontus, den Byzantinern und weiterhin den Persern noch lange in freilich spärlicherem Gebrauch. Auch der Deckel zur Lade des Siegeskreuzes der byzantinischen Kaiser Constantinus Porphyrogenitus und Romanus II. aus der Mitte des 10. Jahrhunderts[148] und das noch um einige Jahrzehnte später unter Erzbischof Egbert (977–993) in Trier entstandene Reliquiar (samt Tragaltar) des heiligen Andreas[149] weisen noch Einzelheiten in dieser Technik auf. Über den Schluß des 10. Jahrhunderts hinaus dürfte sie indessen schwerlich mehr nachzuweisen sein, und so wird man das Jahr 1000 etwa als den Terminus ante quem für die Entstehung des Kreuzes ansehen können.
Ein Terminus post quem ergäbe sich jedenfalls am ehesten aus dem Kranz eng gestellter stilisierter Akanthusblätter, der die Fassung des großen Bergkristalls der Mitte bildet. Fassungen dieser Art kommen, soviel ich sehe, vor der Mitte des 10. Jahrhunderts kaum vor, wo sie dann freilich namentlich in der Trierer und der an Trier anknüpfenden Regensburger Goldschmiedschule[S. 104] rasch große Beliebtheit erlangen; und wir würden demnach etwa die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts als die Entstehungszeit unseres Vortragskreuzes anzusprechen haben. Es ist jedoch sehr wohl möglich, daß die Veränderungen, die, wie wir gesehen haben, gerade mit der Kreuzesmitte vor sich gegangen sind, sich auch auf die Fassung des Bergkristalls erstreckten, daß wir also in dem Akanthusblattkranz nicht mehr die ursprüngliche Fassung vor uns haben.
Im übrigen läßt sich als ein weiterer Terminus post mit einiger Sicherheit wohl nur die Entstehungszeit des Gebetbuchs Karl des Kahlen († 877) bezeichnen, mit dessen vorderem Deckel[150] unser Kreuz so mannigfache und augenfällige Berührungspunkte aufweist, daß an einem Zusammenhang zwischen beiden Werken kaum gezweifelt werden kann. Hier wie dort, wenigstens bei allen größeren Steinen, genau die gleichen Fassungen: Kästchen mit senkrecht aufgesetzten Wandungen, die sich oben zum Zweck der Fassung des Steines verengern und an der Stelle, wo die senkrechte Richtung verlassen wird, einen Filigranring tragen. Hier wie dort die gleiche Befestigung des Goldblechs auf seiner Holzunterlage durch Nägel, deren Köpfe durch einen herumgelegten starken Filigrandraht zu kleinen Rosetten ausgestaltet sind, die gleichen kreuzweis gelegten, einen kleinen Buckel bildenden, sich an den Enden ein wenig umrollenden, von einer kleinen Kugel bekrönten goldenen Spänglein, ja sogar — wenn die Abbildung bei Labarte nicht trügt — die gleiche Art der Unterlegung der Steine mit einer rötlich-grauen, harzigen oder vielleicht auch aus Wachs und Ziegelmehl bestehenden Masse; von der gleichen roten Färbung des Goldes und der Umrahmung der Flächen durch kordonnierten Golddraht garnicht zu reden. Andererseits freilich macht unser Kreuz in seiner Gesamterscheinung doch einen erheblich reiferen Eindruck. Die sorgfältige Ausführung der kleinen Buckel, die nicht mehr lediglich aus den beiden Spangen und dem bekrönenden Kügelchen bestehen, die zierenden, die Lötstellen verdeckenden Spangen zwischen den größeren ovalen Fassungen, die aus dünnen schmalen Goldbändern gearbeiteten Rankenverzierungen der Seitenflächen, die im wesentlichen der notwendigen Vorrichtung zur Anwendung von Zellenemail entsprechen und Bekanntschaft mit solchem Email wohl auch hier voraussetzen lassen, endlich die prächtige Rankenführung des Blechbeschlages der Rückseite, die stilistisch wohl dem übrigens reiferen Dekor der unter Erzbischof Egbert gefertigten Goldbekleidung der Kapsel des Petrusstabes, jetzt in Limburg[151], am nächsten steht — alles das verrät entschieden eine weiter fortgeschrittene Kunst.
Ich trage daher auch trotz der nicht zu leugnenden engen Beziehungen, die stilistisch zwischen jenem Deckel am Gebetbuch Karls des Kahlen und unserem Kreuz bestehen, Bedenken, auch zeitlich eine besonders nahe Zusammengehörigkeit anzunehmen, ja das Kreuz überhaupt noch dem neunten Jahrhundert zuzuschreiben. Manches deutet eben doch bereits auf die Kunst [S. 105]des zehnten Jahrhunderts, in dessen erster Hälfte unser Stück entstanden sein mag.
Darf man aber nach dem Gesagten die Möglichkeit byzantinischen Ursprungs noch ernstlich in Erwägung ziehen? Ungeachtet der Fraglichkeit des für den Kern zur Verwendung gekommenen Holzes glaube ich hier doch mit Nein antworten zu dürfen. Allerdings stammen die durchbohrten, also ehemals zu anderen Zwecken verwendeten Saphire sämtlich aus dem fernen Osten, aus China, und kamen dem Abendlande vorzugsweise durch Vermittlung der Byzantiner zu. Ebenso könnte in der Abstufung der im übrigen glatten Gehäuse und der Anbringung eines Filigranrings am oberen Rande der Kästchen, sowie in der Technik der Rankenverzierungen an den schmalen Seitenflächen, wie bereits angedeutet wurde, byzantinischer Einfluß erblickt werden. Aber gerade das Fehlen des Emails nicht nur hier, sondern überhaupt am ganzen Kreuze scheint andrerseits doch eher gegen als für byzantinischen Ursprung zu sprechen, und an der übrigen Goldarbeit vermag ich schlechterdings keine spezifisch byzantinischen Motive oder Techniken zu entdecken, nichts, was nicht ebenso gut in dem Deutschland oder Frankreich des zehnten Jahrhunderts entstanden sein könnte[152].
Schon die mehrfach erwähnte Verroterie um den Bergkristall der Mitte schließt sich enger an die älteren fränkischen als an byzantinische Arbeiten dieser Art an. Ein spezifisch karolingisches Dekorativ sind sodann jene kreuzweis gelegten schmalen goldenen Spangen oder Bänder mit darauf gelöteten goldenen Kügelchen. Wie am Gebetbuche Karls des Kahlen findet es sich, mehr oder weniger modifiziert, auch noch an späteren Werken, z. B. an einem Evangelienbuche im Schatze der Münsterkirche zu Aachen, das zwar Bock noch ins 9. Jahrhundert setzen möchte, Aus’m Weerth jedoch wohl mit größerem Rechte der Ottonenzeit zuteilt[153] ferner an einem der berühmten vier Kreuze in der Schatzkammer der Münsterkirche zu Essen, das wie die beiden »Mathildenkreuze« daselbst wohl gleichfalls als eine Stiftung der Äbtissin Mathilde II. (974–1011), der Enkelin Ottos des Großen, angesehen werden darf[154] und als die reifste dieser Arbeiten vermutlich erst der Wende des 10. und 11. Jahrhunderts angehört und selbst noch an dem Schrein der heiligen Mauritius und Innocentius in Siegburg aus dem Ende des 12. Jahrhunderts[155]. Doch machen die kleinen Goldplatten, auf denen das Dekorativ hier erscheint, soweit sich nach der Abbildung bei Aus’m Weerth urteilen läßt, den Eindruck erheblich früheren Ursprungs, und scheinen an dem Siegburger Reliquienschrein nur aufs Neue zur Verwendung gekommen zu sein.
Ebenso wie von den Spangen und Buckeln war auch bereits von den kleinen Rosetten und den in flachem Relief ausgeführten Ranken der Rückseite die Rede. Auch die nächsten Vorstufen für dieses letztere Ornament sind vermutlich noch auf dem Boden karolingischer Kunst zu suchen — man vergleiche etwa das Rankenwerk an der Basis des sogenannten A Karls des Großen im Schatz zu Conques[156].
Das sonstige Dekor des Kreuzes, das zur Verwendung gekommene Filigran, die kordonnierten Golddrähte, sowie auch die rote Färbung des Goldes, die seit dem 9. und bis ins 12. Jahrhundert sehr beliebt war und deren Herstellung Theophilus im XL. Kapitel seiner Schedula beschreibt — ältere Quellen pflegen, wo sie vorkommt, von »arabischem Golde« zu sprechen — ist doch zu wenig charakteristisch, um zur besseren Beantwortung unserer Frage noch erheblich beitragen zu können. Nur von den kleinen goldenen Spangen zwischen den größeren Gehäusen der mittleren Steinreihe wäre vielleicht, falls sie in dieser Verwendung auch an anderen Werken nachgewiesen werden könnten, was mir bisher nicht gelungen ist, noch einige Aufklärung zu erwarten.
Auch aus der Form des Kreuzes, den immerhin ungewöhnlichen Endigungen der beiden Kreuzbalken, ist nicht eben viel zu schießen. Sie begegnet auf bildlichen Darstellungen sporadisch seit dem VI.-VII. Jahrhundert und ist wohl als eine Übergangsform von den Kreuzen mit einfach ausgeschweiften Balkenenden der Völkerwanderungszeit und fränkischen Epoche zu denjenigen mit lilienförmigen Endigungen, die vom X.-XI. Jahrhundert an beliebt werden, anzusehen.
Die eichene Kugel endlich mit ihrer rohen Umkleidung aus spärlich vergoldetem Kupferblech und ihrem Eisenbeschlag wird dagegen wohl zweifellos als einheimisches Fabrikat gelten dürfen.
Will man nun aber das Gleiche für das Kreuz selbst annehmen, wie dies der Unterzeichnete nach reiflicher Erwägung auf Grund obiger Analyse thut, so müßten mit Rücksicht auf die Provenienz des Stückes wohl in erster Linie die trierisch-lothringischen Gebiete als Ort der Entstehung in Frage kommen, und wir hätten demnach in unserem Kreuz mit seinem noch vielfach altertümlichen, in der Hauptsache spätkarolingischen Dekor vermutlich einen Repräsentanten voregbertischer Goldschmiedekunst zu erblicken. Ein genaueres Eingehen auf diese Gesichtspunkte muß ich mir indessen hier, wo es mir nur um ein vorläufiges Einreihen dieses interessanten und bedeutsamen Werkes in die Kunstgeschichte zu thun sein konnte, leider versagen.
Politische und soziale Bewegungen im deutschen Bürgertum zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf den Speyerer Aufstand im Jahre 1512. Von Kurt Kaser. Stuttgart. W. Kohlhammer. 1899. 8. (VIII. 271 S.)
»Über Ursprung und Ziele der städtischen Bewegung ist in neuester Zeit ein lebhafter Meinungsstreit entbrannt. Lamprecht (Zeitschrift f. Soz. u. W.-G. I, 212–220 und in »Zwei Zeitschriften« S. 71–74) findet ihre Wurzeln in den schroffen sozialen Gegensätzen, welche sich seit Ende des 14. Jahrhunderts infolge der herrschenden »geldwirtschaftlichen Hypertrophie« in den Städten entwickelt hätten. Er sucht den Schwerpunkt der Bewegung in den zahlreichen und vielfach abgestuften, proletarischen Elementen der Stadtbevölkerung, deren längst schon gährender Groll gegen die reiche, vornehme, in üppiger Verschwendung dahinlebende Bürgerklasse schließlich zur sozialen Revolution geführt habe. Er legt daher das Hauptgewicht auf die Darstellung der radikalen Tendenzen, welche aus dem längst bereiteten sozialen Boden herausgewachsen seien. Dagegen sucht Lamprechts Gegner Lenz (H.-Z. N. F. 41 S. 97–99) im bürgerlichen Mittelstand, in den zünftischen oder nichtzünftischen Handwerkern das eigentlich bewegende Element des Aufstandes. Die Handwerker sind nach seiner Behauptung die alleinigen Träger der revolutionären Forderungen. Das Auftreten »taboritischer und sozialistischer« Bestrebungen stellt er gänzlich in Abrede«. Mit diesen Worten charakterisiert der Verfasser kurz und deutlich die wissenschaftliche Kontroverse, in der er durch das vorliegende Buch einen Ausgleich zu finden sich bemüht, und um den Leser selbst zu einem Urteil zu befähigen, führt er uns in langer Reihe mit großer Klarheit und höchst dankenswertem Sammeleifer die Nachrichten über die vielen städtischen Bewegungen und Aufstände vor, über die wir bislang Kenntnis erhalten haben. Eine besonders eingehende Darstellung wird bei dieser Gelegenheit dem Speyerer Aufstande von 1512 zu teil, der unter steter sorgfältiger Benützung des im Speyerer Stadtarchiv liegenden Urkundenmaterials auf 124 Seiten — fast der Hälfte des ganzen Buches — geschildert wird. Der Verfasser ist sich selbst darüber klar, daß dieses genaue Eingehen auf ein bestimmtes Ereignis nicht ganz zum Vorteil der Komposition seiner Arbeit geschehen sei — er darf sich darüber trösten, denn wenn wirklich die Gliederung des Buches dadurch geschädigt ist, was der Leser übrigens bei der anziehenden Art der Darstellung kaum empfindet, so hat die Klarheit und Durchsichtigkeit der Arbeit dabei umso mehr gewonnen, weil eben durch das Eingehen auf die Einzelheiten dieses einen Aufstandes der Leser einen sicheren Maßstab für das Verständnis all der vielen anderen städtischen Revolutionen erhält, über die der Verfasser Bericht erstattet.
Indem uns als die vornehmsten Triebfedern jener Bewegungen der Groll der Bürger über die drückenden Steuern und die starke Verschuldung ihrer Gemeinwesen und das Mißtrauen gegen die Finanzverwaltung des Rates, die Furcht, den regierenden Herren als Objekt der Ausbeutung zu dienen, dargestellt werden, indem wir das Verhältnis der Laienwelt zu der überall nach Erweiterung ihres Machtbereiches und ihres Besitzstandes strebenden Geistlichkeit erkennen, indem wir endlich auch das Proletariat in die Bewegungen eingreifen sehen, erhalten wir ein ungemein fesselndes Bild von dem städtischen Leben jener Tage. Wir sehen in den verschiedenartigen Bewegungen die Sehnsucht des Bürgers nach wirtschaftlicher Befreiung zur That werden, wenn er versucht, alle Lasten[S. 108] und Leistungen, welche geistliche und weltliche Obrigkeit, die Macht des Kapitals oder privatrechtliche Verhältnisse ihm auferlegen, abzuschaffen, zu vermindern oder auf unbelastete Schultern abzuwälzen. Wir sehen, wie der Verfasser sagt, »das große Prinzip der Bauernbewegung angewandt auf die städtischen Verhältnisse.« Auch die Stellung der Städte zum Bauernaufstände, an dem die städtischen Bewegungen ihren materiellen Rückhalt hatten, ebenso wie sie an der Reformation ihre moralische Stütze fanden, wird eingehend untersucht und bei dieser Gelegenheit die, auch in fürstlichen Kreisen geteilte, Ansicht des Humanisten Konrad Mutianus, als hätten die Städte erst die Bauern aufgereizt, entschieden zurückgewiesen.
Indem der Verfasser innerhalb der städtischen Bewegung drei Strömungen unterscheidet: eine antiklerikale, eine gemäßigt-reformatorische und eine radikal-kommunistische, die sich wechselseitig berühren und durchdringen, nimmt er seinen Standpunkt zwischen Lamprecht und Lenz. Das Resultat seiner Untersuchung formuliert er schließlich mit den Worten: »Unsere Beobachtungen zeigen, daß die städtische Bewegung nicht einseitig proletarisch-sozialpolitischer Natur ist, wie Lamprecht annimmt. Aber ebensowenig wird sie ausschließlich vom Handwerkerstande getragen und ist nur dessen Interessen dienstbar, wie Lenz behauptet. In Wahrheit sind beide Schichten des Bürgertums daran beteiligt: der zwar mannigfach bedrückte und mißvergnügte, aber doch in geordneten Verhältnissen lebende oder gar wohlhabende Mittelstand — also im wesentlichen der zunftmäßig organisirte Teil der Stadtbevölkerung, zugleich aber, noch weit anspruchsvoller und leidenschaftlicher als dieser das städtische Proletariat nebst den ihm nahestehenden Elementen.«
Das überzeugend geschriebene Buch vereinigt die Vorzüge eines reichen Inhaltes und höchst anziehender Darstellung und wird sich gewiß viele Freunde erwerben.
Nürnberg.
Otto Lauffer.
Bauernmöbel aus dem Bayerischen Hochland. Von Franz Zell. 30 Tafeln mit Text. 1899. 2. Frankfurt a. M. Heinrich Keller.
Die bäuerliche Kunst hat seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit der Kunst- und Kulturhistoriker auf sich gezogen. Eine derjenigen Gegenden mit besonders ausgeprägter künstlerischer Thätigkeit in und aus dem Volke heraus sind die altbayrischen Lande, besonders die Voralpengegenden. Wie sie vom Ausgang des Mittelalters bis ins späte 17. Jahrhundert herein in farbigen Holzschnitzwerken religiöser Natur sich nicht genug thun konnte, so setzte sich die Lust an farbiger Dekoration vom 17. Jahrhundert fort in der Hausauszierung und im Mobiliar. Gerade in Altbayern hat das Rococo durch eine geradezu enorme Bauthätigkeit, besonders der zahlreichen Stifter und Klöster, eine selbständige Entwicklung und eine bis ins letzte Dörflein gehende Verbreitung gefunden. Da kann es nicht Wunder nehmen, daß es trotz mancher Abschweifung zu Zopf und Empire bis zur Mitte des 19. Jahrhundert der herrschende Bauernstil blieb. In keinem Zweig aber tritt die bäuerliche Kunst des altbayerischen Stammes der beiden letzten Jahrhunderte so reich und anziehend zu Tage, als in den Holzmöbeln, der Kistlerarbeit (Kistler = Schreiner). Die Hauptstätte dieser in Weichholz mit diskreter Verwendung geschnitzter Zierteile in Lindenholz arbeitenden Möbelindustrie war Tölz und die östliche Voralpenlandschaft Oberbayerns. Leider hat der geschmack- und stillose Plunder der modernen gewöhnlichen lackierten Möbel, diese interessante Hausindustrie — die Männer besorgten die Schreinerarbeit, die weiblichen Familienmitglieder in der Regel die Bemalung — in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts absterben lassen. Es ist daher von dem Münchener Architekten Franz Zell sehr verdienstlich, eine Sammlung vortrefflicher Beispiele oberbayrischer Kistlermöbel in farbiger, von J. Oberretter durch Lichtdruck trefflich wiedergegebener Reproduktionen dargestellt zu haben. Die Tafeln werden sowohl den Kulturhistoriker, an den auch der fesselnd geschriebene Text sich in erster Linie wendet, als den Möbelschreiner, der für einfache Gebrauchsmöbel manche gute Anregung aus dieser urkräftigen, naiven Kunst ziehen kann, in gleicher Weise interessieren.
Stegmann.
VON TH. HAMPE.
Mit dem Namen Georg Wechters sind eine Anzahl Malerradierungen bezeichnet, die teils aus den siebziger Jahren des 16., teils aus dem zweiten und dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts stammen[157]. Unter ersteren sind die künstlerisch bedeutsamsten die von 1579 datierten »30 stuck zvm verzachnen for die Goldschmid«, die Wechter außer mit seinem Namen und der Jahreszahl noch mit den Zusätzen »Maller« und »NV̈RMBERG« versehen hat. Auf den dem 17. Jahrhundert angehörigen Blättern ist, wo überhaupt eine Angabe darüber vorkommt, Bamberg als Aufenthaltsort des Künstlers genannt.
Schon Nagler haben diese Thatsachen stutzig gemacht. Er vermutete bereits, daß es sich hier nicht um eine und dieselbe Persönlichkeit, sondern vielmehr um zwei Radierer gleichen Namens handeln werde, von denen der eine im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts in Nürnberg, der andere im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts in Bamberg thätig gewesen sei. Eine 57 Jahre (von 1573 bis 1630) dauernde künstlerische Thätigkeit, meint er, erscheine auch für einen Meister zu lang[158]. Demgegenüber glaubte Andresen[159] doch[S. 110] an der Identität des Autors aller mit dem Namen »Georg Wechter« bezeichneter Radierungen festhalten zu sollen, wenn er auch die Möglichkeit, daß die Blätter vielleicht zwei Meistern, etwa Vater und Sohn, zuzuteilen sein möchten, nicht in Abrede stellen will. »Rechne ich«, sagt er, »die Jahre von 1573–1630 zusammen und noch 30 hinzu, so ergiebt sich ein Alter von 87 Jahren, das zu erreichen nicht zu den Unmöglichkeiten gehört und Wechter vielleicht wirklich erreicht hat, wenn es anders gegründet ist, was der neulich in München verstorbene Bamberg’sche Kunstsammler H. v. Reider mitteilt, daß Wechter sich selbst in seinem Groteskenbuch (von 1619) unter der Figur des sehr alten, sich am Feuer wärmenden Mannes abgebildet habe.«
Wie es sich mit dieser letzteren Angabe nun auch verhalten mag: soviel läßt sich wenigstens mit annähernder Sicherheit nachweisen, daß der Nürnberger Georg Wechter nicht mit dem Bamberger Künstler identifiziert werden darf. Ein »kunstreicher Ätzmaler« Georg Wechter nämlich, aller Wahrscheinlichkeit nach der Meister jener trefflichen Vorlagen für Goldschmiede, starb in Nürnberg bereits am 28. März 1586 und zwar durch Selbstmord und unter so eigentümlichen Umständen, daß sogar ein Nürnberger Chronist, der ungenannte Verfasser der für das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts besonders ausgiebigen Handschrift Nr. 18025 der Bibliothek des Germanischen Museums, davon Akt genommen hat. Er schreibt[160]:
»Anno 1586 den Sechsundtzwainntzigisten Marty hatt sich zu Nürmberg ein wolhabender kunstreicher Ezmahler, Geörg Wächter genant, vff dem Lorennzer Platz wohnent vnnd bej den Sechzig Jahren Altt, auf Sannct Rochius Kirchof vff seines Weibs Grabstain, daruntter sie den Ailftten december Anno 1585 begraben worden, selbsten durch den Halß Jemmerlichen erschossen, war ein Breuttigam vnnd hette sein hochzeit am Sonntag daruor schon angedingt, nemblich am Palm Sonntag mit Seiner Brautt bey S. Lorenzen zu Gottes Tische ganngen. Was nun die vhrsach gewesen, konnte man nicht aigentlich wissen. Ist sonnsten ein frommer vnd Gottsförchtiger Mann gewesen, Ettlich wolten der Neuen Heurath die schuldt geben.
Sein Elttester Sohn Hauns Wechter hatt Sich bey dem Bischoff zu Aystett mit Einem Messer Inn den Halß auch selbst erstochen, wie an seim ortt folgen wird.«
Was in dieser Chroniknotiz über Georg Wechters Tod gesagt ist, wird in allem wesentlichen auch durch die jetzt auf dem Kreisarchiv Nürnberg verwahrten Ratsverlässe der ehemaligen freien Reichsstadt bestätigt. Im XIII. Faszikel des Jahrgangs 1585/86 heißt es daselbst auf Blatt 24a zu Montag den 28. März 1586:
»Auf Valtin Bulmans, besichtigers der gräber, verlesene ansag, was massen sich Jorg Wachter, ein etzer vnd maler, hie heut [!] auf S. Rochius kirchhof mit ainer faustpuchsen, die er bei sich gehabt, selbst in den halß geschossen, das er den negsten [d. h. alsbald] vmbgefallen[S. 111] vnd tod gepliben, soll man bei ime suchen lassen, was er fur brief oder anders bei sich gehabt, alßdann auch [Bl. 24b] sein freundtschafft beschicken und erkhundigung thun, was er für anligen gehabt, oder was ime zu solcher schrecklichen that vrsach gegeben.«
Und weiter:
[1585/86, XIII, Bl. 25b] Dienstag, 29. März 1586:
»Auf den verlesenen bericht Jorgen Wachters, etzers, ime selbst zugefugten ableibung halben soll man seiner freundtschafft ir begern deß begrabens halben under seins verstorbnen weibs grabstain mit guten worten ablainen vnd vmb mehrers abscheuhens willen an den gewonlichen ort [nämlich: für Selbstmörder] begraben lassen. Souil aber ir begern der klaider halben belangt, inen sagen, sich mit den pettelrichtern darumb zuuertragen.
Vnd dieweil die pettelrichter jederman den todten cörper sehen[Bl. 26a] lassen vnd derwegen gelt aus den leuten geschetzt haben, soll man sie derhalben beschicken und zured halten.«
Wie man sieht, stimmen die Angaben der Chronik und der amtlichen Aufzeichnungen nur hinsichtlich des Datums nicht völlig überein. Während der Chronist den 26. März (Samstag) als den Todestag Georg Wechters bezeichnet, geben die Ratsverlässe den 28. März (Montag) als solchen an. Ist nun schon an sich der letzteren Quelle ihrer Natur nach die größere Glaubwürdigkeit beizumessen, so wird in diesem Falle überdies der Schreib- oder Gedächtnisfehler des Chronisten sofort erwiesen durch die Nachricht, die er selbst überliefert, daß nämlich Georg Wechter noch am Sonntag davor, welcher der Palmsonntag gewesen, mit seiner Braut zum Abendmahl in die Lorenzkirche gegangen sei. Der Palmsonntag aber fiel 1586 auf den 27. März.
Interessant ist in dem zuletzt wiedergegebenen Ratsverlaß auch der Schlußpassus, wonach also die Bettelrichter den Körper des Selbstmörders für Geld haben sehen lassen und dafür zur Rede gehalten werden sollen. Offenbar hatte das ungewöhnliche Interesse, das der Fall erregte, seine Hauptursache in der Todesart, die der Verstorbene gewählt: es ist in Nürnberg vielleicht das früheste Vorkommen eines Selbstmordes vermittelst des Faustrohres, des Vorläufers der späteren Pistole. Der tragische Vorfall, von dem wir berichten, ist also auch waffengeschichtlich nicht ganz ohne Interesse.
Auf den Tod Georg Wechters bezieht sich endlich noch ein dritter Ratsverlaß, den ich der Vollständigkeit wegen und als eine Ergänzung zu dem eben berührten Passus gleichfalls hierher setzen will:
[Jahrgang 1586/87, Fasz. I, Blatt 6a] Donnerstag, 6. April 1586:
»Auf Valtin Bulmans, deß gräberbesichtigers bei S. Rochius, verlesene entschuldigung deß gelt nemens halben von den leuten, so deß abgeleibten Jorgen Wechters cörper besichtigt haben, ist verlassen, ime vnd seinem weib deßwegen ein strefliche red zu sagen vnd beiden gräberbesichtigern bei S. Johans vnd S. Rochius ernstlich zu undersagen vnd zu verpieten, da sich in kunfftig zeit wiederumb [6b] ein solcher schrecklicher Fall wie mit dem Wechter zutragen wurde, die cörper in den[S. 112] capellen oder todtenheußlein verschlossen zu halten vnd nicht mehr beschehner massen gelt daraus zu schetzen, bei meiner herren ernstlichen straf.«
Im übrigen habe ich dem, was die alten Schriften über Georg Wechters Tod melden, kaum noch etwas hinzuzufügen, zumal sich auch etwa über die Motive, die er für seine That gehabt, nichts weiter feststellen läßt, als was sich aus dem Thatbestande selbst zu ergeben scheint und bereits von seinen Zeitgenossen gemutmaßt wurde.
Indessen erfordert der Schlußsatz in jener Chroniknotiz noch eine weitere Betrachtung und Erklärung. Nach ihm soll sich auch Georg Wechters ältester Sohn Hans, da er sich im Dienste des Bischofs von Eichstätt befand, durch einen Messerstich in den Hals selbst das Leben genommen haben. Der Chronist fügt hinzu, daß er darüber »an seinem Ort« berichten werde. In unserer Handschrift, die bis zum Schluß des Jahres 1602 reicht, kommt er jedoch nicht wieder auf diesen Fall zu sprechen. Dennoch liegt meines Erachtens kein Grund vor, der Angabe zu mißtrauen. Die Chronik ist, wie sich aus verschiedenen Stellen ergiebt, im wesentlichen auf Grund gleichzeitiger Aufzeichnungen um das Jahr 1614 sehr sorgfältig zusammengeschrieben worden[161]. Es ist also wahrscheinlich, daß der Selbstmord des Hans Wechter erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts, nämlich in der Zeit zwischen 1602, wo die Chronik abbricht, und 1614 erfolgt ist. Vermutlich ist dieser Hans Wechter identisch mit einem Kupferstecher, von dem die Nürnberger Ratsverlässe melden, daß er im Jahre 1584 sein Bürgerrecht aufgesagt habe:
[Jahrgang 1584/85, I, 17b] Mittwoch, 29. April 1584:
»Hans Wechter, kunststecher, hat in sitzendem rath sein burgerrecht aufgesagt, gewonlichen reuers gegeben vnd ist vmb abschied in die losungstuben gewisen worden.«
Da Georg Wechter nach Ausweis unserer Chronik 1586 bereits ein Mann von etwa sechzig Jahren war, kann er um jene Zeit sehr wohl bereits einen selbständigen Sohn gehabt haben, der ja auch ausdrücklich als sein ältester bezeichnet wird.
Der in den Ratsverlässen genannte Hans Wechter ist aber andererseits aller Wahrscheinlichkeit nach identisch mit jenem Zeichner und Kupferätzer dieses Namens, von dem Andresen sagt, daß er »um das Jahr 1610 blühte«[162]. Die datierten unter den mit seinem Namen oder seinem Monogramm bezeichneten Blätter stammen aus den Jahren 1599[163], 1604[164] und 1606[165], und[S. 113] diese Zahlen scheinen ebenfalls dafür zu sprechen, daß wir in dem Radierer Hans Wechter jenen ältesten Sohn Georg Wechters zu erblicken haben, der zwischen 1602 und 1614 zu Eichstätt durch Selbstmord starb. Wir würden also, wenn wir diese Vermutung gelten lassen, sagen können, daß Hans Wechter nach 1606 und vor 1614, aller Wahrscheinlichkeit nach aber bald nach 1606 (oder noch im Jahre 1606) seinem Leben ein Ende gemacht haben müsse.
Merkwürdigerweise walten nun hinsichtlich der Biographie des Hans Wechter ganz ähnliche Schwierigkeiten und Zweifel ob, wie wir sie oben mit Bezug auf seinen Vater Georg Wechter kennen gelernt haben. Und wie diese Zweifel dort durch Feststellung des Todesjahrs Georg Wechters behoben und der Thatbestand klar gelegt werden konnte, so wird sich auch hier, wenn wir durch die angeführten Wahrscheinlichkeitsgründe den Tod Hans Wechters in die Zeit von 1606–1614 zu setzen uns veranlaßt sehen, die Lösung der strittigen Frage leicht ergeben.
Man hat verschiedentlich angenommen, nicht nur daß Hans Wechter von Profession Goldschmied gewesen sei, sondern daß sich auch Goldschmiedearbeiten seiner Hand erhalten hätten in einem zu Kopenhagen befindlichen verzierten Stahlspiegel, der »J[ohann] Wechter 1646« bezeichnet sei, und einer »H. W. 1653« signierten ähnlichen Arbeit mit der Darstellung von Lot und seinen Töchtern in Berlin[166]. Zu der ersteren Annahme mag wohl auch die nahe Verbindung verleitet haben, in der ihn seine Wappenfolge mit Hieronymus Bang zeigt, der hier als Verleger (»Hieron. Banng. Excud:«) erscheint. Hieronymus Bang, der aus Osnabrück stammte und 1587 in Nürnberg das Bürgerrecht erhielt, war von Profession Goldschmied, und zwar, wie es scheint, ein vielbeschäftigter. Das im Germanischen Museum deponierte Freiherrl. von Scheurlsche Familienarchiv z. B. bewahrt manchen Ausweis über seine Thätigkeit als solcher, und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit werden ihm auch die vier von Marc Rosenberg in seinem Buche Der Goldschmiede Merkzeichen unter Nr. 1228 beschriebenen Stücke zuzuschreiben sein[167]. Bekannter aber noch ist er durch die von ihm herrührenden Ornamentstiche.
Eine solche Vielseitigkeit dürfen wir nun für Hans Wechter gewiß nicht annehmen. Die Bezeichnung »Kunststecher« in dem mitgeteilten Ratsverlaß zeigt zur Genüge, daß er nicht Goldschmied von Profession gewesen ist. Und daß die erwähnten Goldschmiedearbeiten von 1646 und 1653 nicht von ihm herrühren können, ergiebt sich aus unserer chronikalischen Notiz über den frühen und jähen Abschluß seines Lebens zu Anfang des 17. Jahrhunderts- Es sind also auch hier zum mindesten zwei verschiedene Persönlichkeiten anzunehmen.
Um nun aus dem vorstehend Mitgeteilten die weiteren kunstgeschichtlichen Konsequenzen zu ziehen, würde wohl zunächst das »Werk« sowohl des Georg Wechter als des Hans Wechter, wie es uns Andresen darbietet, einer erneuten Prüfung und Sichtung zu unterziehen sein. Ich kann darauf hier nicht näher eingehen, sondern muß mich auf einige wenige Bemerkungen darüber beschränken. Am sichersten sind als Arbeiten Georg Wechters des älteren die Vorlagen für Goldschmiede aus dem Jahre 1579 (Andr. 10) bezeugt. Mit ihnen durch gleiche Technik, gleichen Stil und namentlich auch gleiche Ornamentationsmotive — man vergleiche insbesondere die auf den Blättern zur Verwendung gekommenen Cartouchen — auf das engste verwandt und gleichfalls als unzweifelhafte Arbeiten unseres Künstlers auszusprechen sind sodann die Ansichten von Windsheim (1576) und Memmingen (1573), sowie das Wappen des Nicolaus Scheller, die alle mit des Künstlers G W bezeichnet sind (Andr. Nr. 2, 3 und 7). Rätselhaft ist mir dagegen, wie Andresen auch in dem Porträt des Andreas Nagel, Pfarrers zu Windsheim, das unsigniert ist und übrigens erst aus dem Jahre 1605 stammt, die gleiche Art hat erkennen wollen (Andr. 5). Das abscheuliche Blatt hat mit dem Namen Wechter überhaupt nichts zu thun. Als Werke des jüngeren Georg Wechter, der zu Bamberg thätig war, sind endlich Nr. 1, 6, 8, 9 und 11 bei Andresen zu betrachten. Auch die Ansicht des Schlosses Giech (Andr. 4) wird aller Wahrscheinlichkeit nach ihm angehören.
Aus dem Werke Hans Wechters (Andresen IV, S. 334 ff.) möchte vielleicht am ehesten das unbezeichnete Blatt Nr. 6: »Vergleichung der Schlüssel des Pabstes und des Apostels Petrus«, das nach der von Andresen gegebenen Beschreibung eine Spitze gegen die »Pabisten vnd Jesuwider« zu enthalten scheint, auszuscheiden sein. Bei einem Künstler, der zuletzt im Dienste des Bischofs von Eichstätt thätig, also doch wohl ein überzeugter Katholik war, werden wir eine solche Tendenz schwerlich voraussetzen dürfen.
VON R. SCHMIDT.
Von den gleichzeitig im Anzeiger des Museums aufgeführten 24 Originalschreiben des Herzogs und Kurfürsten Maximilian I. von Bayern gelangen hier zwei Stücke, das eine in seiner Eigenschaft als Feldherr der Liga an den Kaiser Ferdinand II., das andere anläßlich des Todes dieses Kaisers an die Witwe desselben gerichtet, zum Abdruck. Das erstere Schreiben gibt ein Bild von der Erschöpfung, der selbst ein so kornreiches Land, wie Bayern, durch die Verheerungen des Krieges anheimfiel. Das zweite gibt gleich den vier hier nicht abgedruckten Schreiben an die Königin Maria von Böhmen und Ungarn Zeugnis von dem nahen Verhältnis Maximilians zu dem österreichischen Kaiserhause und seinen dortigen Verwandten.
Allerdurchleuchtigister grossmechtigister Khayser, Euer Kay. May. sein mein gannz vnndterthenige diennst in aller gehorsamb iederzeit berait zuuor. Allergenedigister lieber Herr vnnd Vetter.
Nachdeme in meinen Lanndten heuriges Jars, wie E. Khay. May. vnlanngst aus meinem, wegen der noch ausstendigen 3000 Muth Khorn abgeganngnen gehorsambisten ersuechschreiben, mit mehrerm ̃gdist verstanndten, die lieben veldtstricht, sonnderbar in Waiz vnnd Khorn, durch die Soldatesca an den maisten orthen vnnd besten Traidspöden dermassen verderbt, auch an vilen orthen gar nit angebauet; oder was noch verbliben, nit in die Scheuren gebracht worden, dass ich vnnd meine Lanndtsvnndterthanen, wie auch E. May. vnnd die Bundtsarmada an nothwendiger vnndterhalt nit geringen Abganng vnnd mangel leiden werden Derowegen ich getrungen würdt, die Notturfft aus E. May. Erzherzogthumb Oesterreich zetrachten, Dieselbe in gehorsamb bittend, weiln dero Lanndt noch mit grossem Vorrath Traidt, wie ich bericht bin, gesegnet vnnd fürsechen, hingegen die meine wegen des gemainen wesens, aufhaltung des Feindes, damit Er in E. May. Lannden nit fürbreche vnnd Prouiantierung der Armada vast aufs aeusserist verderbt vnnd entblösst sein, E. May. gerhuen ̃gdigst zuuerwilligen vnnd Passbrief zu erthaillen, dass ich[S. 116] in dero österreichischen Lannden in[168]: 1000 Muth Waizen (zemahlen ich gennzlich verhoffe, die 3000 Muth Khorn auf E. May. genedigiste verordnung von den Stenndten Lanndtes ob der Enns eruolgen werden) erhanndlen, vnnd Mautt vnnd Zollfrey herauf in meine Landen bringen lassen möge. Eur Khay. May. zue dero hulden vnnd gnaden mich benebens in vnndterthenigkheit empfelchendt
Datum in meiner Statt Braunau den 30. Augusti Ao 1633
E.[169] Khay. Mt.
gehorsamister getreuester
Churfürst und Vetter
Maximilian m. pria.
Dem Allerdurchleuchtigisten Grossmechtigisten Fürsten vnd Herrn, Herrn Ferdinanden dem andern, erwöhlten Romischen Kaiser, zue allen Zeiten mehrern des Reichs, in Germanien zu Hungern vnd Beham Königen, Ertzhertzogen zu Oesterreich, Hertzogen zue Burgundi, in Ober: vnd Nidern Schlesien, Margrauen zue Mährenn, Grauen zu Thürol vnd Görtz, Meinem allergenedigisten lieben Herrn vnd Vettern.
Auf der Rückseite steht außer obiger Adresse und einigen Registraturvermerken noch folgender Entscheid:
Ad Cameram Aulicam. Die würdet aines vnd daß ander Irer Churf. Drchl. in Bayrn begern, Irer Kay. Mt. in negster Audienz mit Guttachten fürzubringen haben.
Per Imperatorem
9. Sept. 1633
T. Hertinger.
Allerdurchleichtigiste Grosmechtigiste Kayserin, Eur May. sein mein gehorsamb willige dienst alzeit mit vleiss zuuor, genedigiste liebe fraw Muemb.
Nachdeme mir der ohnlengst in Gott seeligist verstorbene Kay. May. meines g̃est. geliebten Herrn Vettern vnnd Herrn Vattern[170] erfolgter zeitlicher abgang zu uernemen komen, hab ich denselben nit allein für mich selbst, mit sonderbarer betriebnus verstanden, sonndern auch für ein notturft befunden, sowol an I. May. die verwittibte Kayserin, mein auch fr̃dl. geliebte frauw Muemb vnnd fraw Muetter[170], als die jez Regierende[171] vnnd zuegleich auch E. Kay. M. M. gegenwerttigen den wolgebornen meinen Cämmerer vnnd lieben gethreuen Menrad Graffen von Zollern abzeferttigen vnnd vermitelst desselben Persohn dises vnuerhofften bedriebten zuestandts halb das Jenig zu[S. 117] uerrichten, was die schuldigkeit vnnd nahe Anuerwandtnus von mir erheischt, vnnd Eur May. von Ime Grauen mit mererem vmbstendtlich anheren vnnd vernemben könden. Ersueche derowegen dieselben hiemit gehorsamblich bittendt, Sy wollen nit allein Ime Graffen in dem was Er diss orths von meinetwegen Iro anbringen wirdtet, g̃st audienz, sonndern auch völligen glauben wie mir selbsten ertheilen, allermassen diss orths mein vndtertheniges verthrauen zue derselben steet, vnnd es in begebenden occasionen zuebeschulden bereit, auch damit E. Kay. May. mich gehorsamblich befelchen thue.
München den 23. Febr. Ao 1637.
E.[172] Mtt.
gehorsamer Vetter
Maximilian mpria.
VON DR. KARL SIMON.
Die Schmucksammlung des Germanischen Museums enthält eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl von Stücken, die man im engeren oder weiteren Sinne als Anhänger bezeichnen kann, und deren Besprechung insofern vielleicht einem freundlichen Interesse begegnen dürfte, als wenig von diesen Stücken erhalten und wenn erhalten, wenig bekannt ist.
Die Art, sie zu tragen, wird verschieden gewesen sein; als Hutagraffen, an die Kleider angenäht, an Halsketten, endlich und wohl sehr vielfach seit dem Wiederaufkommen des Rosenkranzes im 15. Jahrhundert an diesem.
Dem ganzen Schmucke des Mittelalters ist eine Richtung auf zentrale Komposition eigen, so vor allem dem Fürspan, dem am meisten vertretenen Stück, der auf der Mitte der Brust befestigt ursprünglich nicht zum Schließen und Zusammenhalten der Kleidung diente, sondern ein reines Zierstück war: so z. B. an einem wohl aus karolingischer Zeit stammenden Stücke im bayer. Nationalmuseum (Obernetter Taf. 235), an einem gegen das Jahr 1000 zu setzenden Adler, der das innere Rund eines flachen Ringes von Filigran ausfüllt (Abb. bei Luthmer, Gold und Silber; Seemann’s Kunstgewerbliche Handbücher Bd. III S. 75, Fig. 28, a); desgleichen bei den Agraffen, die zum Anhängen der Ketten bestimmt waren, an denen Schwert und Dolch befestigt wurden, und wofür die Grabdenkmäler zahlreiche Belege bieten.
Aber auch religiöse Themata finden schon vielfach und früh ihre Darstellung. Besonders haben die in der Seine gefundenen und jetzt zum großen Teil im Musée Cluny aufbewahrten sog. Plombs historiés wichtiges Material geliefert.
Eines der wichtigsten dieser Stücke ist das Zeichen der Notre Dame du Puy, das im Jahre 1183 ein gewisser Durand ausführen ließ, das Haupt der Brüderschaft de la paix oder der chaperons blancs (Abb. bei Gay: Glossaire Archéologique du moyen age et de la Renaissance. Paris 1887. p. 634 s. v. enseigne). Es diente als Zeichen für die Mitglieder der Bruderschaft, die sich die Bekämpfung und Ausrottung der damals das Land verheerenden Räuberbanden zur Aufgabe gemacht hatte. Es ist ein rechteckiges Stück Blei mit dem Relief der Maria mit dem Kinde; den Rand begleitet die Legende. Mehrere Ösen dienten zum Annähen an das Gewand. Anderweitig wurden die Stücke oft mit Nadeln befestigt. Und das ist bezeichnend für die ganze Auffassung des Schmuckes; er hat keine selbständige Existenz, er ist ein Stück des Kostüms.
Der Form der Plombs historiés scheint sich die an priesterlichen Gewändern verwendete Pluvialschließe durchaus anzureihen. In der Mitte eine religiöse Darstellung, in Relief oder durchbrochen, etwa noch in Vierpässe eingefaßt (Gay a. O. Pilgerzeichen des 13. Jahrh.) oder in architektonischer Umrahmung (Gay a. O. S. 635, Luthmer a. O. Fig. 28,7), am Rande die Legende. Aber auch Freiplastik begegnet, so z. B. die Darstellung eines St. Georg mit dem Drachen (Gay a. O. 14. Jahrh.)
Auch nach dem Aufkommen, der Halsketten (Ende des 14. Jahrh.), die erst im 15. Jahrhundert häufiger werden (öfter als Auszeichnung verliehen, Gnadenketten, Schützenketten), hält sich noch lange bei den jetzt an ihnen auftretenden »Anhängern« die alte zentrale Form. Damit stehen wir an der Schwelle der Epoche, der unsere Anhänger angehören und zu deren Beschreibung wir übergehen.
Eines der ältesten Stücke wird T. 972 sein; es ist wie alle folgenden, bei denen nicht ausdrücklich anders bemerkt wird, aus vergoldetem Silber und enthält in einem schmalen Rahmen, von dem 3 Seiten rechteckig zu einander stehen, während die vierte in der Biegung und krabbenähnlichen Ansätzen an die Gotik anklingt, das durch einen Halbmond abgeschlossene Brustbild der Maria mit dem Kinde. 2 Engel schweben von den Seiten heran, 2 andere halten über ihr die Krone. Eine Öse oben dient zum Einhängen, eine untere war für anderen Zierrat bestimmt. (Höhe 44 mm, Breite 32 mm.)
Bei T. 97 sitzt Maria mit dem Kinde allein auf dem Halbmond, in rundem Reifen. (Dm. 33 mm.)
Zu dritt gruppiert erscheint Maria auf T. 85 und auf T. 86. Dort sitzt zwischen ihr und der hl. Anna das Christuskind; die Einrahmung bildet ein dicker runder Blattkranz. (Dm. 37 mm.) Die Vergoldung ist besonders gut. Hier bildet Maria selbst die Mitte; zwischen Gottvater und Christus[S. 120] knieend, empfängt sie von beiden die Krone; über ihr schwebt die Taube. (Fig. 1 rechts unten.) Ein gewundener Reifen schließt die Gruppe ein. (Höhe 35 mm, Breite 32 mm.)
Christus selbst erscheint auf T. 209, die Weltkugel in der Linken, die Rechte benedizierend, unten und oben verbunden mit dem umgebenden Rosenkranze, in den die 4 Evangelistensymbole eingefügt sind. (Höhe und größte Breite 31 mm.)
Ein andermal (T. 87) ist der hl. Georg zu Pferd dargestellt, wie er das Schwert gegen den unter den Füßen des Rosses liegenden Drachen schwingt, der den unteren Abschluß der in rundem gewundenen Reifen eingeschlossenen Gruppe bildet. (Dm. 28 mm.)
So sind die behandelten Gegenstände ausschließlich der christlichen Vorstellungswelt entnommen; die Mariendarstellungen überwiegen.
Sämtliche Anhänger sind gegossen und die Ansicht nur für eine Seite berechnet; die andere ist glatt gelassen. Es sind keine großen Kunstwerke; auf genaue Wiedergabe der Gesichtsformen ist Verzicht geleistet, mit Ausnahme etwa von T. 972; freilich sind die Stücke durch vieles Tragen auch mehrfach abgenutzt.
Gemeinsam ist ihnen allen ein Streben nach zentraler Komposition; der einfassende Rahmen ist meist kreisförmig oder nähert sich doch der Kreisform. Nur T. 972 hat einen wohl architektonisch gemeinten Rahmen.[S. 121] Blätter- und Rosenkränze bringen Bewegung in die Silhouette, die durch die eingefügten Tiere auf T. 209 noch gesteigert wird. Ein Christus an einem Kreuze mit astförmigen Auswüchsen (T. 84) bildet eine leicht begreifliche Ausnahme. Meist setzen die Figuren unmittelbar auf die Einfassung auf; 2 mal bildet ein Halbmond, 1 mal ein Wolkenstreifen die Vermittlung. Die Höhe der hervorragenden Teile der Figuren beträgt kaum mehr als 2 mm.
Fast alle haben unten Ring oder Öse für ein abschließendes Anhängsel, eine Perle u. ä.; nur bei T. 85 ist nichts derart vorhanden, so daß die zentrale Gruppierung voll zum Ausdruck kommt.
Eine Zeitbestimmung der Stücke ist bei dem fast gänzlichen Mangel stilistischer Anhaltspunkte mißlich, und es ist sehr möglich, daß solche offenbar fabrikmäßig hergestellte Ware sich in einzelnen Volkskreisen noch lange erhielt, als im allgemeinen schon eine andere Geschmacksrichtung aufgekommen war. Doch mögen sie wohl in’s 16. Jahrhundert gehören.
War die zentrale Komposition noch ein Nachklang der mittelalterlichen Gewohnheit, so wurde diese im 16. Jahrhundert bei dem eigentlichen vornehmen Schmuck verlassen und die schon bei den besprochenen Stücken verschiedentlich bemerkte Tendenz deutlich, die Bestimmung als »Anhänger« auch in der Form auszudrücken. Jetzt treten jene reizvollen und immer wechselnden Formen mit ihrer Verbindung von edlem Metall und Steinen,[S. 122] etwa auch Emaillierung, auf, die uns noch heute von Bildern jener Zeit entgegenleuchten, und für die ein Hans Holbein nicht verschmähte, Entwürfe zu zeichnen, wie sie uns sein Londoner Skizzenbuch zeigt. Ueberhaupt nehmen solche Entwürfe einen breiten Raum im Kupferstich gegen Ende des Jahrhunderts ein; von einem der bedeutendsten Stecher, der in dieser Art arbeitet, Daniel Mignot, geben wir einige Abbildungen. (Fig. 2, sowie die Abbildungen am Anfang und am Schluß des Artikels.)
Von diesem Reichtum einer schmuckfreudigen Zeit ist verhältnismäßig nur wenig erhalten, und auch unsere Sammlung hat wenig, das zu diesen Schmuckstücken höheren Ranges gehört. So ein goldener zu einer Kette gehöriger Anhänger (s. Fig. 3.). Er ist der Form nach ziemlich kurz, verbreitert sich jedoch nach unten. (Breite 5,4 cm, Höhe 5 cm). Am Rande sitzen 12 Bergkrystalle in hohen, viereckigen Kasten, die durch umgebogenen Golddraht auf der Rückseite befestigt sind. Sie rahmen wiederum ein Mittelstück ein, in dem 6 gleiche Kasten mit Bergkrystallen um einen großen mittleren gruppiert sind. Diese mittlere Gruppe ist aus einem Stück und aufgeschraubt. Die Zwischenräume zwischen den Kasten sind mit schwarzem Email ausgefüllt.
Die dazu gehörige Halskette besteht aus einer Reihe kleiner, nach zwei verschiedenen Zeichnungen abwechselnder Glieder von gleicher Technik und Wirkung wie der Anhänger, der mit dem mittleren größeren durch ein Zwischenglied verbunden ist.
Der gegensätzlichen Wirkung halber wird beim Goldschmuck gern auch buntes Email verwendet. Zwei solche Stücke besitzen wir, die schon in das beginnende 17. Jahrhundert gehören.
T. 519 ist ein Ordenszeichen des von Kurfürst Christian II. gestifteten Ordens »der brüderlichen Liebe und Eintracht in Sachsen«. Ein runder Reif (Dm. 33 mm, s. Fig. 1 oben) mit der Inschrift: »Ecce quam bonum et iucundum habitare fratres inunum« schließt eine frei gearbeitete Gruppe ein: auf grünem Rasen sitzen zwei sich küssende Frauengestalten mit nacktem Oberkörper. Wage und Palme kennzeichnen sie als Gerechtigkeit und Frieden, also eine Illustration der alttestamentlichen Verheißung. Außen am Ringe sind an vier Stellen Ranken mit weißer Emaillierung als Verzierungen angebracht; nur rechts und links sind sie vollständig, oben und unten abgebrochen. In den Ring selbst sind sechs emaillierte Wappen eingelassen; oben das sächsische, dann nach rechts weiter: Markgrafschaft Meißen, Pfalz Sachsen, Henneberg, dann vielleicht Grafschaft Landsberg (2 rote [irrtümlich statt blaue?] Balken in goldenem Felde), Herrschaft Pleißen. Die Räume zwischen den Buchstaben der Inschrift sind mit schwarzem Email ausgefüllt. Die Figuren selbst sind aus Gold, das nach damals beliebter Weise an den Fleischteilen mit weißem Email überzogen ist und an den Gewändern ein eigentümlich körniges Aussehen zeigt. Beide Seiten sind vollkommen gleich und als Schauseiten ausgebildet.
In die gleiche Zeit gehört wohl ein Anhänger mit dem auferstandenen Christus. (T. 760, s. Fig. 4; Höhe 53 mm, Breite 45 mm). Den Grund bildet durchbrochenes Rankenwerk aus Gold, mit reichem opaken Emailschmuck in Blau, Grün und Weiß, auf den zum Teil noch rote Pünktchen[S. 125] aufgesetzt sind. Von diesem flachen Grunde löst sich die frei gearbeitete Figur Christi, mit der Siegesfahne in der Linken, die Rechte erhoben, plastisch los. Die Füße stehen dem Grunde noch am nächsten, während das Haupt mit dem Nimbus sich 9 mm über den Grund erhebt und so der Eindruck des Herausschwebens erweckt wird. Die Gestalt Christi ist wieder aus Gold, das an Lendentuch und Mantel zu dem mit weißem Email überzogenen übrigen Körper einen lebendigen Gegensatz bildet. Die Innenseite des Mantels sollte wohl, nach Farbspuren zu schließen, rot sein. Zu beiden Seiten löst sich je eine Ranke mit blauer Blume vom Grunde los; darüber liegt je ein Almandin in länglichem Kasten; eine mit Almandinen geschmückte Krone schließt das Ganze ab. Auch die Rückseite ist reich mit bunten Emailfarben ausgestattet. Das Ganze ist von einem höchst reichen und festlichen Eindruck und paßt sich einer Darstellung des Triumphes über den Tod aufs glücklichste an.
Eine Ausnahmestellung nehmen zwei an längeren Gehängen angebrachte Stücke ein. Das erste, das unsere Abbildung zeigt (Fig. 5. T. 58, Höhe 18 cm, Breite 7,8 cm), ist eine aus Silber gegossene Sirene mit einer Krone auf dem Haupte, durch die ein Pfeifchen geht. An dem flachen Silbergehänge schwebt ein Glöckchen. Wie das Ganze getragen wurde, ob etwa an einem Gürtel, ist nicht recht klar. Wie sich die Sirenengestalt überhaupt in der Kunst des 16. Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreute und sie Holbein z. B. auf seinem Erasmus im Gehäus verwendete, findet sie sich auch noch[S. 126] öfter, gerade wie bei uns, als Schmuckgegenstand. So z. B. im Rothschildmuseum in Frankfurt a. M.[173] und in der Wiener Schatzkammer[174]. Hier haben Monstreperlen, aus denen der größte Teil des Leibes besteht, den nächsten Anlaß gebildet. Jedesmal bilden 4 kleine Perlen den unteren Abschluß; auch auf unserem Stück deuten 4 Ösen auf ähnlichen Schmuck.
T. 2303 (Fig. 6) stellt einen großen, gekrönten Vogel mit krummem Schnabel und langem, gestreckten Schwanze dar (Länge mit Kette 12 cm, Breite 14 cm). Der Körper ist aus vergoldetem Silber und innen hohl. Die Flügel sind angesetzt und mit Nieten an Brust und Schwanz befestigt; die Federn sind durch Gravierung angegeben. Unter dem Halse hängt in einer Öse eine kleinere goldene Taube, mit den Buchstaben D C am Halse. Es läge nahe, an die Jahreszahl 1600 zu denken, wo das M ausgelassen wäre. Doch könnte der große Vogel noch in frühere Zeit hinaufreichen. Das Stück wird ein Schützenkleinod sein, von denen sich einige ganz ähnliche Beispiele auch in den Sammlungen auf Schloß Heeswijk erhalten haben. (Collections de Heeswijk III. n. 944). Dazugehörige Schützenketten, an denen die Kleinode getragen wurden, scheinen ja häufiger zu sein.
Indessen bestand der einfach ausgestattete Anhänger mit religiösen Darstellungen fort. So erscheint auf T. 102 der hl. Christophorus mit dem Christkinde in ovalem Medaillon, das von krausem Ornament begleitet wird. (Höhe 7 cm, Breite 5,1 cm). So ist also noch der Rahmen beibehalten, der sonst schon vielfach wegfällt[175].
Der Art ist eine 6,5 cm hohe Statuette des hl. Georg (T. 92, s. Fig. 7), die wohl ein Anhänger des St. Georgsritterordens ist. Die frei gearbeitete Gruppe (silbervergoldet) steht auf einer sechseckigen Konsole, unter der sich ein Öhr mit gewundenem Ring befindet. Der gerüstete hl. Georg mit einem Nimbus aus gewundenem Draht steht in weit ausschreitender Stellung auf dem Drachen, mit der Linken den kunstvoll gewundenen Schweif haltend, mit der Rechten das etwas lang geratene Schwert dem Ungetüm in den Rachen bohrend.
Nähert sich so der alte Anhänger durch Wegfall des Rahmens der Freiplastik, so gewinnt das Mittelstück andererseits durch die entschiedene Ausbildung als Relief mit festem Hintergrunde einen mehr malerischen Charakter.
Sehr selten im allgemeinen kommt es vor, daß die Darstellung in einen architektonischen Rahmen gefaßt ist. T. 835 ist ein solches seltenes Beispiel. Zwei Pfeiler auf hohen Sockeln, unter denen sich aufgerollte Voluten befinden, bilden rechts und links, ein ziemlich willkürlich geformter Giebel bildet oben den Abschluß. (Höhe 35 mm, Breite 21 mm, s. Fig. 1 unten links). Die Reliefdarstellung innen enthält die Geburt Christi. In der Mitte ist die[S. 128] knieende Maria mit dem Kinde beschäftigt, das auf der anderen Seite von einem Engel angebetet wird, während Ochs und Esel aus dem Stalle schauen. Von rechts tritt Joseph mit der Laterne hinzu (oder ist es ein anbetender König mit einem Geschenk?), während hinter ihm unter einem Thorbogen ein zweiter männlicher Kopf sichtbar wird. Der Revers enthält in leichter Gravierung in phantastisch-architektonischer Umrahmung mit einem Löwenkopf oben eine weibliche Gestalt, wohl Venus, mit 2 Stäben (?) in den Händen. An den 4 Ecken sind kleine Knöpfchen angebracht, ein gleiches mit Öse unten. Das Ganze macht den Eindruck italienischer Arbeit.
T. 207 ist ein ovales Medaillon (Dm. 38 und 33 mm) mit einem Rahmen in durchbrochenem Rankenwerk. Der Avers enthält in Reliefdarstellung Maria mit dem Kinde auf dem Halbmond zwischen zwei heiligen Bischöfen, der Revers die Verkündigung. Auch dies scheint italienisch zu sein.
Damit mündet der Anhänger in den breiten Strom der religiösen Medaille ein, wie sie im Laufe des 16. Jahrhunderts und weiterhin in Beziehung auf öffentliche und private Vorfälle jeder Art üblich wird, vielfach durch nachträglich zugefügte oft sehr reiche Umrahmung noch als Anhänger charakterisiert, wie z. B. der schöne Pathenpfennig des Martin Vogelgsang vom Jahre 1627 (T. 213; Dm. 55 mm, s. Fig. 8). Aus vergoldetem Silber, enthält die Vorderseite den hl. Martin, der seinen Mantel für den Bettler zerschneidet, die Rückseite die Inschrift.
VON DR. OTTO LAUFFER.
Bei allen Völkern ist die Feuerstätte von jeher ein geheiligter Ort des Hauses gewesen, und so bildet auch für die Deutschen der Herd, die Stelle, die im Anfang unserer Kulturentwicklung die einzige Wärmespenderin im Hause war, die Stelle, an der die tägliche Nahrung bereitet wird, nicht nur den Mittelpunkt des Hauses und des häuslichen Lebens, er ist vielmehr auch der Träger einer Reihe von rechtlichen Vorstellungen geworden, die ihm vor anderem Hausgerät eine hervorragende Bedeutung und eine besondere Weihe verleihen. Die Zündung und Nährung des Herdfeuers war das Zeichen rechtlicher Besitznahme und Inhabung eines Grundstückes, und wem das Feuer des Herdes gelöscht wurde, der war damit für rechtlos erklärt[176]. In manchen Gegenden wurde bis in unsere Zeit der Herd eines Hauses sogar benützt, um danach eine Grenzbestimmung vorzunehmen, ja er bildete selbst die Grenzmarke und durfte also, auch wenn das für die Hauswirtschaft noch so wünschenswert war, nicht verrückt werden[177]. Schließlich weiß jedermann, daß »der eigene Herd« das Symbol des eigenen Hausstandes bis heute geblieben ist.
Diese besondere Weihe des Herdes mag zum Teil schon mit darauf beruhen, daß eine Verschiebung der Herdstelle innerhalb des Hauses zugleich eine eingreifende Veränderung auch des häuslichen Lebens zur Folge gehabt hätte, ebenso aber und wohl noch mehr darauf, daß der alte Herd mit seinem festen Mauerwerk nicht die Bewegbarkeit unserer heutigen »Maschinen«, wie der Westfale den modernen Herd nennt, besaß, und wenn man das umfangreiche Steingefüge des Herdes, zumal da wo derselbe an den Schlot und den weiten Rauchmantel gebunden war, hätte verrücken wollen, so wäre[S. 130] damit eine der umständlichsten baulichen Veränderungen vorgenommen, die man sich im Hause überhaupt denken konnte.
Jedenfalls ist es Thatsache, daß jene geheiligten Vorstellungen, die man mit dem Herde verband, sich mit den letztgenannten praktischen Rücksichten zu gemeinsamer Wirkung vereinigten. Sie waren die Ursache dafür, daß unsere Vorfahren gleich anderen Völkern sich in Bezug auf den Herd und seine Ausstattung ungeheuer konservativ erhalten haben, und so begegnen wir denn unter dem Herdgerät zum Teil uralten und ureinfachen Gegenständen und Formen. Infolge des Alters und der unveränderten Forterbung dieser Geräte hat man dieselben in den letzten Jahren mit Recht als ein schätzbares Material erkannt, aus dessen genauer Erforschung die Wissenschaft der Ethnologie reichen Gewinn zu ziehen erhoffen darf. Solches nach Kräften zu fördern ist der erste Zweck dieses Aufsatzes, in dem wir versuchen wollen, auf Grund des uns bekannt gewordenen litterarischen und sachlichen Materials sowie nach verschiedenen mündlichen Mitteilungen den Herd und das Herdgeräte in den Nürnbergischen Küchen der Vorzeit zu schildern.
Zu dem ethnologischen Interesse wird sich dabei die antiquarische Teilnahme des Altertumsforschers gesellen, den es erfreut, einen nicht unwichtigen Teil deutscher Hausaltertümer näher kennen zu lernen. Mancher unserer Leser wird vielleicht nur diesen letzteren Standpunkt einnehmen. Er möge sich nicht wundern, daß wir mehr, als es sonst angängig ist, die Entstehungszeit der einzelnen Stücke unberücksichtigt lassen, wenn wir es auch nicht versäumen werden, dieselbe in allen Fällen, wo sie für uns überhaupt ersichtlich ist, mitzuteilen. Das oben geschilderte Beharrungsvermögen der einzelnen Formen giebt uns aber ein Recht dazu, den historischen Gesichtspunkt etwas zurücktreten zu lassen. —
Wenn wir nun beginnen, zunächst das uns erhaltene litterarische Material in Augenschein zu nehmen, so sind wir in der glücklichen Lage, für Nürnberg eine Reihe verhältnismäßig alter Auslassungen über den Herd und sein Gerät zu besitzen, die in letzter Zeit zur bequemen Benützung gut herausgegeben sind[178]. Der erste Zeuge ist der Nürnberger Fastnachtspieldichter und Meistersinger Hans Folz, der den zur Gründung eines Hausstandes nötigen Hausrat in zwei verschiedenen Fassungen, das eine mal in einem strophischen Meistergesang und das andere mal in einem Spruchgedichte besungen hat. Für uns kommen aus diesen Gedichten folgende Stellen in Betracht, zunächst Folz, Meistergesang 2, 13–3, 6:
Dieser Stelle entsprechen im Folzens Spruchgedichte fol. A II a/b folgende Verse:
Aus dem Jahre 1544 bietet uns sodann Hans Sachs eine gute Belegstelle in dem Spruchgedicht »Der gantz hawsrat« S. 2/3:
Bedeutendere litterarische Belege aus dem 17. Jahrhundert sind mir nicht bekannt geworden, dagegen erschien im Jahre 1703 in Nürnberg im Verlage Wolfg. Moritz Endters ein Buch mit dem Titel: »Die so kluge als künstliche von Arachne und Penelope getreulich unterwiesene Hausz-Halterin...«, dessen IV. Capitel handelt: »Von denen zur Hauszhaltung gehörigen, und unter der Aufsicht einer klugen Hausz-Mutter stehenden Zimmern, samt deroselben so zierlich- als nutzlichen Aus-staffierung.« Dortselbst wird auch über die wohl-gebaute Küche und ihr Gerät auf Seite 202 manches mitgeteilt, was uns interessiert: »Das Eiserne Kuchengeräthe ebenfalls zu benennen, sind selbiges die Bräter oder Bratenwender, und entweder hier zu Land die Feder-Bräter oder Zug- und Gewicht-Bräter, samt denen dazu gehörigen, wie auch allerley Arten von Hand-Spiszen also genannt, weil man sie mit der Hand umdrehet; theils Orten werden auch die Bräter von Handen umgetrieben: Man hat von Eisenwerck in denen Küchen beedes Brat-Pfannen und gemeine Pfannen, Glut- oder Kohl-Pfannen, Schüssel-Ringe, gemeine und aufgebogene Stirzen zum abbräunen, Rost, tiefe Traif-Löffel, löcherichte Faim-Löffel, flache löcherichte Bach-Löffel, Fisch-Reisten, Hackmesser, Fleischparten, Bratwurst-Zänglein, Fisch-Schäufelin, Schmaltz-stecher, Spick-Nadel, Leuchter und Liecht-schneutzen, Feuerzeug, Feuer-Zangen, Feuer-Hacken, Pfannen-Knechte, Dreyfusz, Ofen-gabeln, Ofen-Schäufelein.«
Schließlich will ich noch ein hierher gehörendes im Jahre 1807 aufgestelltes Inventar der Landauerschen Zwölfbrüder-Stiftung nicht unerwähnt lassen. Dasselbe liegt auf der hiesigen Stadtbibliothek in den »Beilagen zum Extraditions Protokolle der Wohlthätigkeits-Stiftungen in Nürnberg«. Ziffer Nr. 489, und nachdem es die Zinn-, Kupfer- und Möszing-geräte aufgezählt hat, nennt es von Eisen und Blech: »1 Bratpfanne, 3 Stielpfannen, 3 grosze Löffel, 1 Gabel, 1 Hackmesser, 1 Reibeisen, 1 Rost, 1 Dreyfusz, 1 Fleischhacke, 1 Feuerzange, 2 Feuer-Böcke, 2 Ofengabeln.«
Damit sind die wichtigeren für Nürnberg in Betracht kommenden litterarischen Quellen erschöpft, wobei ich noch besonders erwähnen will, daß der im Kupferstichkabinet unseres Museums (H. B. 2243) befindliche Einblattdruck, auf welchem »Anna Köferlin zu Nürnberg« das von ihr erbaute und ausgestattete Kinder-Haus beschreibt, für unsere Zwecke nichts ausgiebt. Die eine oder andere gelegentliche Erwähnung werden wir an schicklicher Stelle citieren. —
Außer diesen litterarischen Nachweisen sind wir aber auch in der glücklichen Lage, eine Reihe älterer Abbildungen zu besitzen, die unsere Erkenntnis in wesentlichen Punkten stützen und fördern werden. Zunächst ist da ein Einblattdruck aus der Zeit von c. 1475–1480 zu nennen, der bislang nur in einem einzigen Exemplare, das sich in dem königlichen Kupferstichkabinet in München befindet, bekannt geworden ist. A. Schultz[S. 133] hat in seinem Buche »Deutsches Leben im XV. und XVI. Jahrhundert« in Figur 151 das Blatt reproduciert, das auf 24 Feldern die Darstellung von allerhand Hausgeräten giebt, die dem davon umrahmten Liebespaare zur Gründung des Haushaltes nötig sind[179]. Für uns kommen die beiden äußeren rechten Felder der oberen Reihe in Betracht. Leider ist es jedoch nicht unbestritten, daß das mit »hanns paur« signierte Blatt wirklich von dem Nürnberger Kartenmaler gleichen Namens herrührt[180], deshalb erachten wir uns auch nicht berechtigt, das Blatt hier nochmals abzubilden. Ebenso ist aus: »Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden... durch den weitberümpten Hans Sachsen gantz fleissig beschrieben vnd in Teutsche Reimen gefasset. Frankfurt a. M. 1568« das Blatt, auf welchem Jost Ammans Illustrationskunst den Koch darstellt, für uns nicht gerade von hervorragender Bedeutung[181].
Dagegen stehen uns aus dem XVIII. Jahrhundert ein paar sehr interessante Abbildungen zu Gebote. »Francisci Philippi Florini Serenissimi ad Rhenum Comitis Palatini... Oeconomus Prudens et legalis. Oder Allgemeiner Klug- und Rechts-verständiger Haus-Vatter... Nürnberg, Frankfurt und Leipzig in Verlegung Christoph Riegels. Gedruckt bei Johann Leonhard Knortzen« erschien im Jahre 1702. Das IX. Buch handelt von der Koch-Kunst und bietet auf Seite 134 und 135 die beiden lehrreichen Darstellungen, die wir[S. 134] in Figur 1 und 2 wiedergeben. Da die Riegel’sche Buchhandlung, die das Buch verlegte, in Nürnberg ihren Hauptsitz hatte, und da auch die Knortz eine Nürnberger Druckerfamilie jener Zeit sind, so können wir nicht daran zweifeln, daß Nürnbergische Küchen es sind, die für die Darstellungen das Vorbild geliefert haben. Schließlich findet sich ein von M. Rößler gefertigter Stich einer Küche als Titelbild in: »Die In ihrer Kunst vortrefflich geuͤbte Koͤchin. Oder Auserlesenes und vollstaͤndig-vermehrtes Nürnbergisches Koch-Buch« Nürnberg. Wolfg. Mor. Endters Erben 1734. Wir geben das Blatt in Fig. 3 wieder.
Das hier mitgeteilte Material ist nun teilweise schon früher verwertet worden. A. Schultz sowohl in seinem oben citierten Buche S. 113 ff. wie H. Bösch in diesen »Mitteilungen«. Jahrg. 1897 S. 62 ff. haben sie zum Teil benützt, als sie anläßlich der Schilderung von Hauseinrichtungen auf die Küche zu sprechen kamen. Wir werden im Verlauf der Darstellung vielleicht Gelegenheit haben, auf diese Arbeiten einzugehen. Außer ihnen haben wir vor allem benützt: M. Heyne, Fünf Bücher Deutscher Hausaltertümer I. Bd. Das deutsche Wohnungswesen. Leipzig 1899. Wer immer sich in Zukunft mit deutschen Hausaltertümern beschäftigen mag, wird auf dieses vortreffliche und grundlegende Buch zurückgreifen müssen. —
Auf das also gesammelte literarische und bildliche Material gestützt, fassen wir nun die uns zu Verfügung stehenden Realien ins Auge.
»Allhier in Nürnberg haben theils Frauen eine große Freude mit besonderen Prang-Kuchen — schreibt die »Haushalterin« S. 202 — darinnen niemal gekochet, sondern das Gerethe nur allein zur Zierde und Gepräng aufgestellet wird, da siehet man nichts von Eisen noch Holz, sondern es muß alles von Zinn und Messing schimmern und gläntzen, auch sogar der Besenstiel und das Kehrig-faß von Zinn gemachet seyn, ob man nun davon nicht füglich sagen moͤchte: Wozu dienet dieser kostbare Unrath? lasse ich andere davon urtheilen.« Nun, wir wollen uns am wenigsten mit einer Köchin über die Daseinsberechtigung dieser Prangküchen streiten, für uns ist die Hauptsache, daß man in Nürnberg ihrem Gebrauch zumeist die Erhaltung einer Reihe für uns interessanter Geräte zu danken hat. Eine vollständige Prangküche ist freilich, so viel uns bekannt ist, nicht mehr erhalten, die letzte ist vor zwei Jahren nach England verkauft worden, jedoch verdanke ich dem Antiquar Wohlbold einige Mitteilungen darüber. An ihrem ursprünglichen Orte erhalten sind eine ziemliche Reihe von Geräten der alten Prangküche des von Fürer’schen Schlosses in Haimendorf bei Lauf. Darunter befinden sich eine Anzahl von Küchengeräten, deren Besichtigung mir gütigst gestattet wurde. In derselben Gegend habe ich auch versucht, in den Bauernhäusern etwas ausfindig zu machen. Diese Mühe war vergebens, dagegen habe ich bei dem Forstaufseher in dem von Fürer’schen Jagdschlößchen Rockenbrunn bei Haimendorf manche Erkundigung eingezogen.
Erst in letzter Linie kann ich an dieser Stelle die Geräte nennen, welche sich in der Küche unseres Museums befinden. Dieselben sind größtenteils zu[S. 135] einer Zeit gesammelt worden, in der ihnen die Ethnologen ihre Aufmerksamkeit noch nicht zugewandt hatten, und in der man ihre Herkunft für ziemlich gleichgültig hielt. Da die Provenienz sich jetzt für manche Stücke nicht mehr feststellen läßt, so dürfen dieselben leider für Nürnbergische Verhältnisse nicht herangezogen werden. Jedoch will ich später nicht versäumen, auch von diesen Stücken Mitteilung zu machen.
So würde unser Material ein immerhin bescheidenes sein, wenn uns nicht reiche Aufschlüsse zuteil würden aus einer Quelle, die gerade für Nürnberg besonders üppig sich erweist, während sie für die meisten anderen Gegenden Deutschlands nur spärlich zu fließen pflegt, ich meine die Puppenhäuser oder »Dockenhäuser«, wie der Nürnberger sagt. Das Germanische Museum ist in der glücklichen Lage von diesen für die Kunde deutscher Hausaltertümer so wichtigen und interessanten Schau- und Prunkstücken der Spielzeugfabrikation eine ansehnliche Reihe zu besitzen. Über die meisten von ihnen hat schon H. Boesch im »Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit«,[S. 136] 1879. S. 230 ff. genaue Mitteilungen gemacht, und so kann ich mich auf die dort gegebenen Nachrichten beziehen. Da es jedoch wünschenswert erscheint, zunächst ein genaues Verzeichnis der in den Dockenhäusern vorhandenen Herdgeräte zu geben, so lassen wir hier eine Zusammenstellung folgen, indem wir zugleich durch die eingeklammerten Zahlen zu erkennen geben, um welche Nummer der von H. Boesch gewählten Reihenfolge es sich handelt.
A.[182] Dockenhaus. Depositum der Familie Bäumler zu Nürnberg. Der Unterbau des zweistöckigen, 2,27 m hohen, 0,676 m tiefen und 1,755 m breiten Hauses enthält in der Mitte Hof und Stiege mit Ausblick auf den Garten, links davon Pferdestall mit darunterliegender Knechtekammer, zur rechten Hand die Hausapotheke. Der erste Stock enthält links von Flur und Treppe die Küche, rechts ein Wohn- und zugleich Speisezimmer. Der zweite Stock enthält links vom Flur ein Wohnzimmer und noch weiter links die sogenannte »Speise«. Rechts vom Flur liegt das Schlafzimmer[183]. Das Haus stammt aus den Jahren c. 1710–1720 und wurde, wie eine Aufschrift an dem mittleren Dacherker mitteilt, im Jahre 1819 renoviert. An Herdgeräten sind vorhanden: 1 Glutpfanne, 1 Blasbalg, 1 Wedel, 1 Kohlenzange, 1 Herdschaufel, 1 Hafengabel, 1 Feuerbock, 1 Pfannknecht, 1 Rost, 4 Bratspieße, 1 Bräter.
B. (4) [H. G. 4481.] Dockenhaus[184] vom Ende des XVII. Jahrhunderts: 2 Gluttöpfe, 1 Feuerhaken, 1 Kohlenzange, 1 Feuerbock, 1 Pfannknecht, 1 Pfanneisen, 1 Fischrost, 6 Bratspieße, 1 Bratspießständer, 1 Bräter.
C. (3.) [H. G. 1953.] Dockenhaus aus der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts: 2 Glutpfannen, 1 Blasbalg, 1 Wedel, 1 Dreifuß, 1 Pfannknecht, 1 Rost, 1 Fischrost, 12 Bratspieße, 1 Bratspießlager, 1 Bräter.
D. (2.) [H. G. 4063.] Dockenhaus vom Jahre 1639: 1 Blasbalg, 1 Wedel, 3 Kohlenschaufeln, 1 Kohlenzange, 1 Feuerbock, 1 Dreifuß, 2 Pfannenknechte, 2 Roste, 6 Bratspieße, 2 Bratspießständer, 1 Bräter mit hölzernem Gehäuse.
E. Dockenküche aus dem Anfang des XIX. Jahrhunderts: 1 Blasebalg, 1 Wedel, 1 Kohlenzange, 1 Hafengabel, 2 Feuerböcke, 1 Pfannknecht, 8 Bratspieße, 1 Bräter.
F. (1.) [H. G. 1952.] Dockenhaus aus der Zeit von etwa 1600: 1 Wedel, 1 Kohlenschaufel, 2 Kohlenzangen, 2 Feuerböcke, 1 großer Dreifuß, 1 Pfannknecht, 2 Roste, 1 Fischrost, 5 Bratspieße, 3 Bratspießständer, 1 Bräter.
G. [Zugangsnummer 18917.] Dockenküche aus dem Anfange des XIX. Jahrhunderts, früher im Besitz der Familie Füchtbauer zu Nürnberg: 1 Glutpfanne, 1 Hafengabel, 1 Feuerbock, 1 Pfannknecht, 1 Bratspieß, 2 Bratspießständer.
H. Schließlich befindet sich noch ein Dockenhaus im Bayerischen Gewerbemuseum [J. Nr. 3602 (217)], welches ich nicht unerwähnt lassen will,[S. 137] weil es gerade in Nürnberg steht. Seine Herkunft ist aber sehr ungewiß, es wurde 1875 von einer Offiziersdame in München gekauft. Es stammt aus dem Anfang des XVII. Jahrhunderts, erfuhr aber im XVIII. Jahrhundert eine fast völlig neue Einrichtung und Umänderung, und ist zum Teil noch im Anfang des XIX. Jahrhunderts aufgefüllt. J. Stockbauer hat in der »Bayerischen Gewerbe-Zeitung« I. 1888. S. 196 ff. Beschreibung und Abbildung davon gegeben. Von Herdgeräten sind darin enthalten: 1 Hafengabel, 1 Feuerbock, 1 Pfannknecht, 1 Rost.
Bei allen diesen Häusern muß man zwar immer bedenken, daß sie vielfach später ergänzt und aufgefüllt sind, wie das ja bei der Vererbung von einer Kindergeneration in die andere natürlich ist, indessen ist auch hier zu bemerken, daß diese zeitlichen Verschiedenheiten für uns kaum von Belang sind. —
Damit haben wir das verfügbare Material zusammengestellt, und wir können uns in einem folgenden Aufsatze der Betrachtung der Einzelheiten zuwenden.
VON GUSTAV VON BEZOLD.
(Hierzu Tafel V.)
Das auf nebenstehender Tafel abgebildete Orgelgehäuse wurde im vorigen Jahre von einem Händler in Augsburg erworben. Nach dessen Aussage stammt es aus einem Schloß im bayerischen Schwaben, nähere Angaben über die Herkunft hat er nicht gemacht, doch ist die Angabe glaubwürdig. Es ist keine Orgel für eine Kirche, sondern für eine Privatkapelle; die Tastatur umfaßt nur 3½ Oktaven, auch die Zahl der Register und Stimmen war gering. Daß die Orgel in einem vornehmen Hause gestanden hat, beweist die reiche und sorgfältige Gestaltung.
Die Orgel hat bis zur Gesimsoberkante eine Höhe von 3,25 m und im unteren Teil eine Breite von 1,51 m. Der Aufbau hat die für Hausorgeln übliche Form.
Die Komposition entfaltet sich von unten nach oben zu größerem Reichtum und feinerer Durchbildung, doch ist schon der untere Teil durch zierliche Behandlung ausgezeichnet. Die Ecken sind mit Lisenen besetzt, auf deren Flächen profilierte Stäbe, an Scepter gemahnend, aufgelegt sind. Das vordere Feld, zum Herausnehmen eingerichtet, hat eine durchbrochene, spätgotische Maßwerksfüllung. Die Seitenflächen des Kastens für die Blasbälge sind geschlossen und mit frei gebildeten Arkaturen geziert. Auf diesem unteren Teil ruht der Aufsatz, der das Werk enthielt und das Manual. Der Aufsatz gliedert sich der Höhe nach in zwei Teile. Der untere enthält seitlich die Register (aus dem 18. Jahrhundert), in der Mitte eine bewegliche Füllung, auf welche ein fünfstimmiges Gloria, von zwei Putten gehalten, aufgemalt ist.
Der Aufbau für die Pfeifen ist dreiteilig. Die seitlichen Teile sind höher geführt als der mittlere und tragen eine dekorativ architektonische Bekrönung mit kleinen Blendarkaden und einem Konsolengesimse. Der mittlere Teil ist breiter als die seitlichen, durch Kandelabersäulen in drei Felder geteilt und im oberen Abschluß konkav gerundet. Vor den Windladen, am oberen Ende der Pfeifen und über der Rundung der mittleren Abteilung ist durchbrochen geschnitztes Renaissanceornament angebracht. Seitlich treten flügelartige Ausbauten von zierlicher architektonisch dekorativer Form vor. Auf ihren Flächen Gemälde, rechts S. Cäcilia, links David.
Die Seiten und die Rückwand haben Maßwerksfüllungen.
Das Gehäuse ist im Ton von grünlich weißem Marmor gefaßt, die Profile und das Ornament sind vergoldet, in letzterem sind einzelne Teile farbig behandelt. Der Prospekt kann mit Flügeln geschlossen werden. Auf der Außenseite der Flügel ist die Verkündigung, auf der Innenseite die Anbetung der Könige gemalt. Die Ansicht mit geöffneten Flügeln zeigt Fig. 1.
Sämtliche Malereien mit Ausnahme der Predella sind in der Frühzeit des 18. Jahrhunderts übermalt worden.
Die Orgel hat in ihrem Aufbau wie in vielen Einzelheiten den Charakter der Frührenaissance, doch weisen einzelne Ornamentmotive (Kartuschen), sowie der Stil der Malereien bestimmt auf die Spätzeit des 16. Jahrhunderts.
Die Malereien waren nie bedeutend, durch die Übermalung sind sie künstlerisch fast wertlos geworden; ihren dekorativen Zweck erfüllen sie indes immer noch. Dagegen ist der Aufbau im Ganzen wie in den Einzelheiten sehr gut und namentlich das Ornament glänzend gezeichnet und ausgeführt.
Es mag auffallen, daß gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine Orgel im Stil der deutschen Frührenaissance gebaut wurde. Die Erscheinung verliert aber ihr Befremdliches, wenn wir sehen, daß unsere Orgel keine Originalkomposition der Spätzeit ist, sondern eine Reduktion und Wiederholung einer Komposition aus der frühesten Zeit der Renaissance in Deutschland, der Orgel in der Fuggerkapelle bei S. Anna in Augsburg[185]. Diese ist 1512 gebaut, das Werk ist von dem kaiserlichen Orgelmacher Jhan von Dôbraw (Dobrau in Schlesien?), das Gehäuse von einem Augsburger Meister. Einen Entwurf bewahrt das Museum in Basel (vgl. Fig. 2 nach G. Hirths Formenschatz I. 143).
Die Augsburger Orgel ist größer als unsere. Sie hat im Prospekt sieben Felder, also auch eine entsprechend größere Zahl von Pfeifen, der obere Teil tritt deshalb weit über den unteren vor und das Manual ist auf einem sogenannten Positiv vor der Orgel angeordnet. Die Ausführung entspricht der rechten Seite des Entwurfes. Die leeren Zwickel über den Pfeifen sind in den äußeren Feldern durch Strahlen, welche aus Wolken hervorbrechen, in den Feldern seitlich der Mitte durch Fugger’sche Wappen gefüllt. Der Aufbau ist dem Raum der Kapelle angepaßt und die konkave Rundung des oberen Abschlusses durch ein großes Rundfenster in der Rückwand bedingt.
Unsere Orgel gleicht nun in den Grundzügen ihres Aufbaues der von S. Anna, doch ist die Zahl der Felder im Prospekt von sieben auf fünf reduziert und die Gruppierung der äußeren gegen die drei mittleren energischer betont.
Nur vermutungsweise möchte ich andeuten, daß der Meister, welcher unser Orgelgehäuse gefertigt hat, nicht nur die Orgel von S. Anna, sondern auch den Baseler Entwurf gekannt hat. Die kräftigere Scheidung der äußeren Felder von den mittleren und die Trennung der letzteren durch Kandelabersäulchen findet sich im Entwurf auf der linken Hälfte und die Delphine über den seitlichen Flügeln sind ähnlich an anderer Stelle in der Zeichnung zu finden.
Auf Grund des Nachweises, daß das Vorbild unserer Orgel in der Fuggerkapelle bei S. Anna steht, darf vielleicht die weitere Vermutung ausgesprochen werden, daß sie aus Kirchberg, wo gegen Ende des 16. Jahrhunderts gebaut wurde, aus Babenhausen oder einem anderen Fugger’schen Schloß stammt. Ich will diese Vermutung nicht weiter verfolgen.
VON DR. OTTO LAUFFER.
Im folgenden drucke ich ein als Einblattdruck verbreitetes Scherz-Recept des beginnenden 16. Jahrhunderts ab, welches in einen Sammelband des Hieronymus Coler (Germ. Mus. Hs. 2908) als fol. 5 eingeklebt ist[186]. Zwar mag die ganze Tonart und der Humor, in dem das Stück gehalten ist, für den Kenner der Zeit nichts Neues bieten, jedoch wird es sich zu Vergleichszwecken hier und da mit Nutzen heranziehen lassen.
Ein Edel vñ köstlich, von vilen ein bewert Recep | wider die Faulkeyt vnd Klappersucht der Weyber vnd Magt. Ausz Esculapio | Podalirio | Galieno | Hipocrate | vnd Mesue | auch vil andern beruͤmbten Doctoribus erlesen. Durch den wirdigen vnd hochgelerten herrn Doctor Nemo | ergruͤndet | vnd zuͦsamen getragen etc.
Die new Salb
So ein Person obgemelt kranckheit anstiesz | oder lang zeyt damit behafft were gwesen.
Recipe: Scheyter Kraut, Gerten Salat, Bengel Suppen, Bruͤgel Bruͤlein, Stecken Pfeffer, Kolben gemuͤsz, Gabel Galrey, Tremmel Proten, Plewel Fladen, Schlegel Kuͦchen, Fuͦsz Milch, Pastetlein gebachen von Besemstiln, Krefftige Fausttaͤflein. Yedes ein halb vierteyl einer stundt. Fiat Vnctio.
Obgemelte ärtzney | eins nach dem andern | lege der krancken person vber den kopff | Lenden | Arm | vnd Schenckel | schmirs auch darmit bisz das jr der roth vn̄ plaw Schweysz kumpt | dan̄ wisch das mit fünff fingerkraut ab.
Man sol auch obgemelte stuͤck | alle so sie vor wol gebeet | mit nach gemeltem Puluer vbersehen | darmit sie dester krefftiger seyen.
Recipe: Leyden, Marter, Wunden, Kranckheyt. Puluer yedes ein halben Landszknecht[187]. Fiat puluis | et condiantur antecedentia.
Pillulen auch | zuͦ purgieren | von nachgemalten stücken seind nicht vnnütz.
Recipe: Fuͤsz pillulen, Feust teyg, Knew latwerg, Electuarium von Ellenpogen stossen. Yedes XII stoͤsz. Fiant Pillul. et dentur ad placitum.
Darneben auch mit Syrop zuͦ purgieren, magst du nach hernante stuck brauchen.
Recipe: Geyselstaͤb, Sesselbeyn, Kunckelzucker, Kerwisch stil. Yedes ein pfundt. Fiat Potio detur in aurora Vesperique.
Du solt vnderweylen der krancken person | fuͤr labung geben | vber die seyten | oder wo dich zuͦm besten bedunckt | wie volgt.
Recipe: Teller pyren. Fiat Electuarium et detur ad refectionem.
Darmit vnnd aber | die krancken zuͦ letzt nit boͤser werden moͤg dann sie zuͦm ersten war | vnd dem krancken nicht wider kum̄.
Recipe: Hungerkraut, Dürrbrot, Brunnensaft, Swelckruͤben. Yedes vier wochen. Fiat Esus et detur summa cum parcitate.
Obgenante stück alle nym nit sambtlich | sunder ye eins nach dem andern | vnnd brauch die zuͦ rechter zeyt | Dann jr krafft gar grosz | vnd sie samptlich genummen wuͤrden | moͤcht der geschmack der krancken person zum todt reychen | vnnd dir des felens halben gefengknusz bringen. Aber recht gebraucht so ist die kunst probiert | vorausz inn der zeyt da die Cappen von Hennen schier gemeystert wuͤrden.
Nun volgt ein Recept fuͤr solche kranckheyt darmit sie für kummen werden mag.
Recipe: Maulschlosz, Demuͦt wasser, Keuschwurtz, Heuszlich bletter. Yeglichs mit tugent.
Welche Fraw oder Magt | dise stuͤck taͤglich neust | vnd sich deren fuͤr vnd fuͤr gebraucht | ist obgenanter sucht | on zweyffel ledig. Ersparet den kosten | den lauff in solcher Keller | Apotek | erlangt die Kron (der sie wert ist) aller ehren etc.
VON GUSTAV VON BEZOLD.
Justi’s Winckelmann ist im vorigen Jahre in neuer Auflage erschienen. Das Buch zählt seit seinem ersten Erscheinen vor mehr denn dreißig Jahren zu den klassischen Hauptwerken unserer biographischen Literatur. Nicht nur den Lebensgang, nicht nur den Inhalt und die Analyse der Werke eines Mannes, der wie kein Zweiter bestimmend auf die ästhetischen Anschauungen seiner und der Folgezeit eingewirkt hat, bietet es uns, es schildert auch stets in behaglicher Ausführlichkeit die Umgebung, in der Winckelmann lebte, und die äußeren Verhältnisse wie die geistigen Strömungen, unter deren Einwirkung sich seine Entwickelung vollzogen hat. Das Buch ist ein gut Teil der Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Diese Eigenschaft mag es rechtfertigen, wenn ich den Lesern dieser Zeitschrift ausführlicher über Inhalt und Bedeutung des schönen Buches berichte.
Winckelmann’s Lebensgang ist seltsam und ungewöhnlich, blindlings folgt er dem inneren Drange, der ihn auf mancherlei wüsten Umwegen dem Ziele zuführt, da sich sein reicher Geist und seine einzige Fähigkeit der Anschauung voll bethätigen kann.
Winckelmann’s Wiege stand zu Stendal in der Altmark. Dort ist er am 9. Dezember 1717 geboren; der Sohn eines armen Schuhmachers. Unter den kärglichsten Verhältnissen ist er aufgewachsen, aber ein ideales Streben und ein mächtiger Drang nach dem Glück war ihm von seiner frühesten Jugend an eigen. Das Handwerk des Vaters mochte er nicht erlernen und ruhte nicht, bis ihn sein Vater in die lateinische Schule gehen ließ. Dieser hoffte, daß sein Sohn Geistlicher werden möge, eine Hoffnung, die auch in unseren Zeiten noch manchen begabten, aber armen Knaben den humanistischen Studien zugeführt hat.
Die damaligen Gymnasien verdienten kaum den Namen humanistischer Bildungsanstalten. Wohl nahm das Latein einen breiten Raum ein, ja es war fast der einzige Unterrichtsgegenstand, neben dem dem Griechischen nur eine untergeordnete Stelle zukam, aber der Unterricht blieb am Äußerlichen der Grammatik und Rhetorik haften. Wenn ein solcher Unterricht unseren Anschauungen von humanistischer Erziehung nicht entspricht, so mochte er doch einem begabten Schüler den Sinn für die Schönheit der Form wecken und bilden. Winckelmanns Anschauungsvermögen bethätigt sich später am selbständigsten und glänzendsten auf dem Gebiete der bildenden Künste. Daß er aber auch mit dem feinsten Gefühl für formale Schönheit in den redenden Künsten begabt war, zeigt neben manchen Äußerungen aus verschiedenen Zeiten die Auswahl der klassischen Autoren, an deren Werken er in der Einsamkeit und Öde der Jahre, in[S. 145] welchen er in kleinen Städten der Mark als Lehrer thätig war, seinen Durst nach Schönheit befriedigte.
Der Gymnasiast, auch wenn er arm ist, hat heute fast ausnahmslos eine würdige Existenz. Das Stundengeben und Beaufsichtigen jüngerer Mitschüler, das ja manchem nicht erspart bleibt, hat nichts demütigendes, stört auch die Studien nicht. Auch Winckelmann hat auf diesem Wege einen Teil der Mittel zu seinen Studien erworben. Außerdem aber bestand zu seiner Zeit noch eine Einrichtung, welche heutzutage glücklicherweise überwunden ist, das Chor- und Currendesingen. Der Chor bestand aus älteren Schülern, welche Sonntags im öffentlichen Gottesdienst, an Wochentagen vor den sogenannten Chorhäusern, außerdem bei allen Begräbnissen, ja an drei Tagen vor allen Häusern der Stadt zu singen hatten. »Die Currende bestand aus den Kindern armer... Bürger, die sich durch Singen vor den Thüren, unter Führung des Currendeküsters, Kleidung, Brot, Schulbücher und freien Unterricht verdienten. In die Reihe dieser Ärmsten..... trat Winckelmann ein.« Ihre Thätigkeit war wenig besser denn Bettel.
Winckelmann war im Unterricht in den alten Sprachen, in Geschichte und Erdbeschreibung ein eifriger Schüler, die theologischen Stunden vermochten seine Aufmerksamkeit nicht zu fesseln. Ein Teil dieser Abneigung mag der Art und Weise zur Last fallen, in welcher der Religionsunterricht betrieben wurde, der tiefere Grund ist wohl der, daß das Metaphysische Winckelmann’s geistiger Veranlagung überhaupt fremd war.
Winckelmann war kein fröhlicher Knabe, an den Spielen seiner Kameraden nahm er selten teil und machte sich davon, sobald er konnte. Dagegen regte sich früh die Neigung, ein Büchermann zu werden. Wenn er jüngere Mitschüler auf ihren Spaziergängen zu beaufsichtigen hatte, nahm er Hefte oder Bücher mit, mit welchen er sich nebenbei beschäftigte. 1733 las er fleißig in dem »Neueröffneten adligen Ritterplatz«, einer Encyklopädie für Kavaliere. Hat das Bild der großen Welt, welche er hier kennen lernte, den ersten Stachel der Unzufriedenheit und des Wegstrebens aus engen Verhältnissen in sein Inneres gesenkt?
Auch der Wunsch, die Reliquien untergegangener Geschlechter zu entdecken, regte sich schon damals, und er durchwühlte die Sandberge vor der Stadt nach alten Urnen.
Siebzehn Jahre alt, verließ Winckelmann Stendal und begab sich nach Berlin. Am 18. März 1735 trat er in das Gymnasium zu Kölln an der Spree ein, in dem er etwa ein Jahr verblieb. Was ihn nach Berlin führte, war das Verlangen nach gründlicher Kenntnis der griechischen Sprache und Literatur, die er sich in Stendal nicht erwerben konnte. Es ist der Ruf seines Genius, der ihn die Schönheit des Hellenenthums ahnen ließ, der ihn hinzog nach der Welt, in der allein er heimisch werden konnte.
Der Schulplan des Köllnischen Gymnasiums (von 1742) läßt es schwer begreifen, wie man des Griechischen wegen nach Berlin übersiedeln mochte. Neben einem sehr spezialisierten Unterricht im Lateinischen wurden allerlei Nebenfächer betrieben, an welchen die Freunde der Gymnasialreform noch heute ihre Freude haben können, aber dem Griechischen war in der oberen Klasse nur eine Stunde für einen griechischen Autor und in Prima, zwei für Homer und Heroidan eingeräumt, und man las nicht die Ilias und Odysee, sondern den Froschmäusekrieg.
Aber Mängel in der Organisation der Schulen können oft aufgewogen werden durch die Persönlichkeit der Lehrer. Und einen Lehrer, der dies einigermaßen vermochte, besaß das Köllnische Gymnasium an dem Konrektor Damm. In den Geist des Hellenentums war freilich auch er nicht eingedrungen, anregend im höheren Sinne war er sicher nicht, und Winckelmann nennt ihn später einen praeceptor ἄμουσος, aber er besaß doch eine redliche Begeisterung für die griechische Sprache und Literatur und hatte sich’s zur Lebensaufgabe gemacht, dem Studium des Griechischen in Deutschland die Wege zu ebnen. In einem Programm spricht er den Satz aus: »Die Griechen müssen noch heute nachgeahmt werden, wenn etwas Beifallswürdiges zum Vorschein kommen soll.« Es ist eine Ahnung von der Herrlichkeit der hellenischen Literatur und Kunst, deren volle Anschauung uns erst sein Schüler Winckelmann erschlossen hat. Seine Auffassung des Homer ist unendlich platt.
Winckelmann aber kam es zunächst darauf an, sich mit der griechischen Sprache vertraut zu machen. Was ihm, nachdem er Damm’s Unterricht genossen hatte, noch fehlte, suchte er bei dem Rektor Johann Georg Scholle in Salzwedel zu erlangen. Scholle war einer der wunderlichsten Schulpedanten, aber ein kenntnisreicher, ein gelehrter Mann, bei dem viel zu lernen war, und Winckelmann bewahrte ihm ein dankbares Gedächtnis.
Auf eigene Kraft angewiesen, im steten Kampfe mit Not und Entbehrung, hatte Winckelmann die Schule durchgemacht. »Ernste Arbeit und heitere Entsagung..., die Bewahrung des inneren Triebes in den entmutigendsten Lagen lernte er so bald, daß seine zeitig gestählten Nerven fortan jeglicher Zumutung im Handeln und im Dulden gewachsen waren.«
In vielen Stücken, in seinen Grundneigungen und Abneigungen, insbesondere in der Vorliebe für die Griechen sehen wir den späteren Winckelmann schon vorgebildet, aber Jahre mußten vergehen und manche Irrwege mußten durchlaufen werden, bis er sein wahres Lebensziel erkennen und erreichen konnte.
Von Salzwedel aus bezog Winckelmann die Universität Halle; am 4. April 1738 wurde er immatrikuliert.
Wie im ersten Kapitel die Zustände der preußischen Mittelschulen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, so beleuchtet Justi in diesem die der preußischen Landesuniversität, und seine Gabe, kurz und treffend zu charakterisieren, zeigt sich in der Besprechung allgemeiner Verhältnisse, sowie einzelner Persönlichkeiten in glänzender Weise. 1694 gegründet, sollte die Universität Halle eine Freistatt sein für die Reform des Unterrichtswesens und für die Lehrfreiheit. Sie sollte der Sitz der durch Spener eingeleiteten religiösen Erhebung des Protestantismus sein, welche mit dem Namen Pietismus bezeichnet wird und deren Bedeutung für die Erweckung und Hebung des religiösen Lebens des 18. Jahrhunderts dadurch nicht aufgehoben wird, daß sie früh entartete. Dann war sie der Sitz einer preußischen Schule des Staatsrechts, »wo den künftigen Beamten solche staatsrechtliche Grundsätze eingepflanzt wurden, die mit der durch die Annahme der Königskrone ganz veränderten Stellung des Staates übereinstimmten.«
»Diese beiden Elemente gingen anfangs einträchtig zusammen; sie gerieten in Spannung, es kam zu einer heftigen Krisis, zuletzt verschwand das eine ganz vom Schauplatz.«
Die berühmtesten Gelehrten lehrten in Halle, aber schon zu Winckelmann’s Zeit hatten sich viele Mittelmäßigkeiten eingedrängt. Die Fachwissenschaften dominierten und die Humaniora wurden zurückgedrängt. Noch waren die Ziele und Methoden der Wissenschaften schwankend, es war die Blütezeit der Polymathie, ein ungeheueres disparates Wissen war in vielen Köpfen gesammelt und ermöglichte gewandten Leuten den Übergang von einer Wissenschaft zur anderen, der Professor der Eloquenz Johann Heinrich Schulze schwankte sein ganzes Leben lang zwischen Medizin und Philologie, Gottfried Sell, Professor der Rechte, hatte jura studiert und lebte in günstigen Verhältnissen in Holland, die Verwüstungen, welche die aus den tropischen Gewässern eingeschleppte Pfahlmuschel an Schiffen und Dämmen anrichtete, veranlaßten ihn, eine Monographie über dieses Thier zu bearbeiten, er legte die Jurisprudenz bei Seite und studierte Naturwissenschaften. Sein Werk sollte nicht nur alle erdenklichen Gesichtspunkte des Gegenstandes erschöpfen — den naturhistorischen und den theologischen, den archäologischen und den praktischen —, es sollte auch die Schönheiten eines literarischen Kunstwerkes haben, wie sie noch niemals beisammen gesehen worden waren. Es war in elegantem Latein geschrieben und geschmückt mit den Blumen einer in alten und neuen lateinischen und italienischen Dichtern und in den Schriftstellern Hollands, Englands und Frankreichs überreichen Belesenheit. 1735 kam er als Professor der Rechte nach Göttingen, zwei Jahre später nach Halle, wo er abwechselnd und gleichzeitig die Institutionen und Pandekten, die Rechtsgeschichte und das Naturrecht, die Kosmographie, die Naturhistorik und die Experimentalphysik las. In letzterer war [S. 147]Winckelmann sein Zuhörer. Er besaß kostbare Sammlungen, welche sein bedeutendes Vermögen verschlangen, zuletzt mußte er vor seinen Gläubigern flüchten und lebte in Paris von deutschem Unterricht und dem Uebersetzen deutscher Werke. 1767 hat er eine französische Ausgabe von Winckelmann’s Kunstgeschichte besorgt, der nicht wußte, daß der Uebersetzer sein früherer Lehrer war.
Auch der Kanzler der Universität, Johann Peter Ludewig, hatte Theologie und Humaniora studiert, in Halle mit der Professur der Poesie und der theoretischen Philosophie begonnen und war später zu den Rechten übergegangen, deren er sich rasch autodidaktisch bemächtigte; er hatte zu Winckelmann’s Zeit den Lehrstuhl des Staatsrechts und der Geschichte inne. Ludewig war ein auf das Praktische gerichteter Kopf und als Publizist der gelehrte und schlagfertige Vertreter der Rechte Preußens. Seine erfolgreiche Thätigkeit auf diesem Gebiet brachte ihm reichliche Titel und Würden, er war zuletzt Kanzler des Herzogtums Magdeburg.
Winckelmann würde, wenn er seinem Wunsche hätte folgen können, Medizin studiert haben, dem Wunsche seiner Eltern entsprechend studierte er Theologie.
Es war ein Opfer der Pietät gegen seine Eltern, denn seine Stellung zur Religion war schon damals eine gleichgiltige, wenn nicht negative. Seine religiösen Anschauungen waren von den englischen Deisten beeinflußt und standen dem Deismus nahe, in späteren Jahren hat er sich doch wieder dem Glauben an einen persönlichen Gott zugewandt. Zunächst aber trieb er seine Fachstudien ohne Liebe und nur die biblische Exegese scheint ihn angezogen zu haben; auch noch in späteren Jahren las er täglich ein Kapitel aus der hebräischen Bibel.
Ebensowenig wie für die Theologie vermochte er sich dauernd für die Philosophie zu erwärmen. Als Winckelmann studierte, stand Wolf auf der Höhe seines Ruhmes, noch war er nicht nach Halle zurückgekehrt, aber seine Schüler hatten fast alle Lehrstühle in Deutschland besetzt. In Halle lehrte Alexander Gottlieb Baumgarten.
Die Wolfische Philosophie kam den Bedürfnissen einer Zeit, der die philosophische Schulung fast vollständig fehlte, aufs trefflichste entgegen, und das Verdienst, dem philosophischen Denken weite Verbreitung in den Kreisen der Gebildeten verschafft zu haben, bleibt ihr unbestritten.
Winckelmann hatte das redliche Bestreben, sich in das System der Wolfischen Philosophie einzuarbeiten. Er hörte Baumgarten’s Vorlesungen über Logik, Geschichte der alten Philosophie, Metaphysik und die philosophische Encyklopädie; diese das einzige Kolleg, in dem er in seinem letzten Semester bis zum Schluß aushielt. — Noch 1743 freut er sich, die gesammelten Werke Wolfs auf seinem Bücherbrett zu sehen, er kauft sich die Logik von Corvinus und wünscht diese Disciplin an der Schule von Kloster Berge zu lehren. Schließlich aber brachte der Versuch, bei Wolf in die Schule zu gehen, die gründlichste Abneigung zu Wege. Sein Verlangen nach erfahrender und anschauender Erkenntnis befand sich in dieser Welt metaphysischer Schemen in einer Luft, wo ihm der Atem ausging und auf einem Boden, wo sein Fuß nicht auftreten konnte.
Baumgarten, Winckelmann’s Lehrer, ist der Begründer der spekulativen Ästhetik. Sein Buch ist zwar erst 1750 erschienen, aber sie war schon acht Jahre vorher in Vorlesungen behandelt worden, und ihre Hauptgedanken kamen jedenfalls schon in der Metaphysik und Encyklopädie vor. Es ist sicher von Interesse, zu erfahren, ob und wie weit der Mann, der den ästhetischen Anschauungen seiner und einer langen Folgezeit ihre Richtung gegeben hat, die Ideen seines Lehrers aufgenommen und verarbeitet hat. Winckelmann erwähnt in seiner Theorie des Schönen den Begriff der Vollkommenheit als Definition der Weltweisen; er weist ihn zurück, ohne den bestimmten Sinn im System zu berücksichtigen. Wenn Winckelmann hier den großen Grundbegriff der Ästhetik so kurz abfertigt und die neue Wissenschaft als leere Betrachtungen bezeichnet oder gar ignoriert: so verrät sich darin nicht blos sein Mangel an philosophischem Sinn: es kündigt sich schon im Keime die Divergenz an, die seitdem fast [S. 148]stets die Angehörigen der Kunstwelt von denen getrennt hat, die sich mit der Kunst vornehmlich zur Beförderung ihrer spekulativen Ideen beschäftigten.
Nach Ablauf seines theologischen Bienniums blieb Winckelmann im Sommer 1740 noch in Halle, um die Bibliothek des Kanzlers Ludewig zu ordnen. Die Verbindung mit Ludewig war in mehr als einer Beziehung das Vorspiel einer zehn Jahre späteren, folgenreichen Verbindung mit einem sächsischen Staatsmann und Geschichtsschreiber, dem Grafen Bünau.
Wir wissen nicht, ob sich Winkelmann’s Thätigkeit nur auf die Ordnung der Bibliothek bezog oder ob er als Amanuensis Ludewigs an dessen Arbeiten beteiligt war. Er empfing nach seiner Aussage aus des Kanzlers eigenem Munde die Elemente des Lehnrechts und studierte zugleich das Staatsrecht, aber er betrachtet später das im Dienste Ludewigs verbrachte halbe Jahr als ein traurig verlorenes. Und doch war diese Thätigkeit das erste Glied einer Kette von Studien, die einen sehr großen Teil der folgenden drei Lustra seines Lebens ausfüllen.
Das Ende der zwei akademischen Jahre war, daß Winckelmann mit großer Not ein kahles Theologenzeugnis bekam. Keiner seiner Lehrer hatte einen bestimmenden Einfluß auf ihn ausgeübt und seinen weiteren Studien die Richtung gegeben. Ohne Lust hatte er seine obligaten Kollegien gehört, wahllos eine Reihe anderer mitgenommen, wenige hatte er ganz ausgehalten. Um so mehr hatte er sich durch Lektüre anzueignen gesucht und sich auf dem großen Schauplatz der Wissenschaften umgesehen, ohne sich einer ganz zuzuwenden. Ein Autodidakt war er durch Not und Neigung geworden und hatte der Polymathie seiner Zeit seinen Tribut entrichtet. Aber er hatte auch gelernt, seine eigenen Wege zu gehen und gesehen, daß er zu dem zünftigen Betrieb der Wissenschaften, wie er damals war, nicht gemacht war.
Im Umgang mit seinen Studiengenossen muß er mehr aus sich herausgegangen sein, als in früheren Jahren. Wenn er von der Bibliothek kam, brachte er den Rest des Nachmittags meist in Gesellschaft seiner Landsleute und Bekannten zu, die ihre Gesellschaft für unvollkommen hielten, wenn er nicht dabei war. »Denn er war immer aufgeräumt, scherzhaft und gesprächig und konnte tausend Schnurren aus alten und neuen Zeiten erzählen. Des Abends war er meistens auf dem Ratskeller und unterredete sich mit alten ehrbaren Bürgern gern von ihren Wanderschaften und Reisen.«
Nachdem Winckelmann zwei Jahre in Halle studiert hatte, übernahm er eine Hauslehrerstelle bei dem preußischen Offizier George Arnold Grolmann in Osterburg. In diesem vornehmen Hause trat Winckelmann zum erstenmale mit der französischen Bildung der höheren Stände in Berührung und mochte fühlen, was ihm bei all’ seinem zusammengehäuften Wissen an formaler Gewandtheit des Umgangs noch fehlte, auch der Mangel der Kenntnis der neueren Sprachen mußte ihm drückend zum Bewußtsein kommen.
In dem Grolmann’schen Hause faßte Winckelmann den Entschluß, nun doch noch seiner früheren Neigung zur Medizin zu folgen und dieses Studium mit dem der höheren Mathematik und der neueren Sprachen zu verbinden. In dieser Absicht bezog er im Mai 1741 die Universität Jena. Für die Verbindung des Studiums von Medizin und Mathematik fand er hier einen ausgezeichneten Lehrer in Georg Erhard Hamberger, der der letzte folgerichtige Vertreter der iatromechanischen Schule war, einer Schule, welche die physiologischen Vorgänge auf rein mathematisch-mechanischem Wege zu erklären suchte. Die große Erweiterung, welche die Mathematik mit der Erfindung der Infinitesimalrechnung erfuhr, die Einführung der Mechanik in die Himmelskunde durch Newton mochten dazu verführen, auch eine Wissenschaft, welche durchaus auf die Erfahrung angewiesen ist, deduktiv zu behandeln.
Daß Winckelmann, dessen ganze geistige Veranlagung auf eine anschauende Erkenntnis gerichtet war, sich dieser bereits überlebten Richtung der Medizin zuwandte, zeigt nur, daß auch er der Macht des Zeitgeistes sich nicht erwehren konnte. Er verweilte indes nur etwa ein halbes Jahr in Jena, schon im Herbst 1741 verließ er die Universität. In den nächsten Jahren beschäftigte er sich noch mit Mathematik, nach und nach aber trat eine ausgesprochene Abneigung an Stelle des Interesses. Dagegen [S. 149] haben die Naturwissenschaften und die Medizin nie aufgehört ihn von Zeit zu Zeit zu beschäftigen und noch in späteren Jahren hatte er die Absicht, nach Vollendung seines archäologischen Lebenswerkes mit der Wissenschaft der Natur sein Leben zu beschließen.
In den Herbst 1741 versetzt Justi den abenteuerlichen Versuch Winckelmanns, seine Studien mit einer akademischen Reise abzuschließen. Eine solche wurde im 17. Jahrhundert allgemein als Erfordernis gelehrter Bildung betrachtet. Die Absichten, welche man dabei verfolgte, waren verschieden, die einen suchten die Höfe und die Mittelpunkte der Diplomatie, die anderen persönliche Bekanntschaft mit den Gelehrten des Auslandes, eigenes Urteil über fremde Völker, Sitten und Verfassungen, die Konversation in fremden Sprachen, Eleganz im Benehmen u. A.
Winckelmann wollte nach Paris, aber schon in Gelnhausen waren seine Mittel zu Ende und blutarm kam er nach Halle zurück. Über die besonderen Absichten, welche er bei diesem Unternehmen hatte, sind wir nicht näher unterrichtet; Äußerungen aus späterer Zeit lassen vermuten, daß ihn die griechischen Handschriften der Bibliothek zu Paris, deren Katalog im Sommer 1741 erschienen war, unwiderstehlich dahin zogen.
Nachdem dieser Plan gescheitert war, übernahm Winckelmann eine Stelle als Erzieher des Sohnes des Oberamtmanns Lamprecht in Hadmersleben. Hier war es, wo er in der Bibliothek eines Herrn von Hansen das historisch-kritische Lexikon von Bayle kennen lernte. Das ungeheuere Material, welches in diesem Werke niedergelegt, anmutig vorgetragen und mit kritischen Anmerkungen versehen war, muß einen überwältigenden Eindruck auf den Büchermann gemacht haben, er hat die vier Foliobände in zwei handschriftlichen Folianten ausgezogen, diese wieder auf einen Quartband von fast siebenhundert Seiten reduziert, ein alphabetisches Register zu den Miscellen der Bayle’schen Noten gefertigt und sich das Dictionnaire zu einem Magazin für neuere Geschichte eingerichtet, und noch 1755 Extracta ex extractis dict. hist. Bael. gefertigt.
Das Interesse an dem Werke, das für das 18. Jahrhundert von großer Bedeutung war (auch Lessing hat es vielfach benützt) und das noch nach 1820 neu herausgegeben wurde, mag zunächst ein stoffliches gewesen sein, sicher aber kam, obgleich es Winckelmann nur in der Übertragung Gottsched benützte, ein formelles hinzu. Die gewandte Dialektik, die kritische Kunst, welche, wie Justi mit Recht bemerkt, das Studium Bayles noch jetzt, blos formell betrachtet, zu einem Schmauß für den Verstand macht, mußte den mit so feinem Formensinn begabten Mann, der bisher nur das schwerfällige Rüstzeug deutscher Gelehrten kannte, anziehen.
Ein einhalb Jahre lang blieb Winckelmann in Hadmersleben; seit dem Anfange des Jahres 1743 suchte er eine feste Anstellung und er fand eine solche als Konrektor der Schule zu Seehausen in der Altmark. Fünf Jahre war er in Seehausen, anfangs mit seiner Stelle vollkommen zufrieden, später mit steigendem Widerwillen, so daß er diese Zeit stets als die dunkelste seines Lebens betrachtete. Vielerlei innere und äußere Bedrängnisse trafen zusammen. Winckelmann war als Konrektor der Nachfolger Boysens, eines Mannes von hoher didaktischer und pädagogischer Begabung, der die Schule merklich gehoben hatte. Winckelmann kam den Pflichten seines Amtes gewissenhaft nach, aber ohne lebendige innere Teilnahme; der Elementarunterricht war einmal nicht seine Sache. Dies machte sich sofort in der Abnahme der Schülerzahl fühlbar und bei den Schülern war er nicht beliebt. Ebensowenig wußte er sich mit seinen Kollegen und Bürgern des Städtchens zu stellen.
Ärgerliche Zerwürfnisse mit der Geistlichkeit kamen hinzu. Die geistige Anregung, die ihm der Tag nicht bot, suchte er in nächtlicher Arbeit. Er studierte bis Mitternacht und des Morgens um vier Uhr begann er wieder zu lesen bis sechs Uhr, wo der Unterricht von neuem begann. Zum Schutz gegen die Kälte hatte er einen Pelzmantel, er schlief nicht im Bett, sondern auf einem Lehnstuhl. Ein geheiztes Zimmer gönnte er sich nicht, auch in seiner Nahrung war er äußerst enthaltsam, nicht aus Geiz, sondern um von seinem kargen Gehalt von 120 Thaler seinen alten Vater unterstützen und seinen Büchervorrat vermehren zu können.
Vereinsamt in seinem Wohnort, machte Winckelmann zahlreiche größere und kleinere Reisen zu auswärtigen Freunden, nach Bibliotheken zur Leipziger Messe u. A. Seine Wanderlust war außerordentlich und er verstand, fast ohne Geld zu reisen.
Winckelmann mochte in der Erinnerung der vielen Widerwärtigkeiten, die er in Seehausen durchzumachen hatte, die dort verbrachten Jahre als verloren betrachten; sie waren es nicht. Er kam dort in seiner Vereinsammung doch zu größerer Sammlung, als irgendwo früher, er wandte sich neuerdings den Griechen zu und in der harten Arbeit schlafloser Nächte hat er den Grund zu seiner künftigen Größe gelegt.
Bevor Justi näher auf Winckelmanns Griechische Studien eingeht, gibt er in einem »Streit der Alten und Modernen« überschriebenen Abschnitt einen kurzen Überblick über das Verhältnis der Menschen des ausgehenden 17. und des beginnenden 18. Jahrhunderts zu den Griechen. In dem Maße, als die ganz der vornehmen Gesellschaft angehörende französische Bildung sich konsolidierte, ist bei den Franzosen, und nur noch sie und die Engländer beschäftigten sich mit griechischer Literatur, eine steigende Abneigung gegen die griechischen Dichter wahrzunehmen. Man richtete sie an dem eigenen Maßstab und rechtfertigte das Urteil, indem man das Gesetz des Fortschrittes, das in den exakten Wissenschaften und in den mechanischen Künsten gilt, auf die schönen Künste anwandte. Die Angriffe richteten sich insbesondere gegen die homerischen Gedichte.
In dem heftigen Streit hierüber suchte Voltaire das Für und Wider objektiv abzuwägen, aber er gibt doch den Römern den Vorzug vor den Griechen. Eine Befreiung von solchen Vorurteilen war von Frankreich aus nicht zu erwarten. Sie wurzelten in der französischen Bildung des »grand siècle«, und diese, so einseitig sie uns heute erscheint, hatte doch eigenartige und große formelle Vorzüge, die sie den Zeitgenossen — nicht nur Franzosen — als vollkommen erscheinen ließen. Gleichwohl war eine Reaktion gegen die Mitte des Jahrhunderts unvermeidlich. Es waren Winckelmann und Lessing, welche der eine auf intuitivem, der andere auf kritischem Wege eine höhere, auf das Wesen gerichtete Auffassung des Hellenentums anbahnten.
Man möchte bei einem Autor, der so weit ausgreift wie Justi, gerade diese für das gesamte Geistesleben der Folgezeit so wichtigen Fragen etwas ausführlicher behandelt sehen.
Die griechischen Lieblingsschriftsteller Winckelmanns waren Homer und Sophokles, Herodot, Xenophon und Plato. Das Kapitel, welches diesen Autoren und Winckelmanns Verhältnis zu ihnen gewidmet ist, ist eines der schönsten in dem reichen Buche, von Winckelmanns Äußerungen ausgehend, gibt Justi viel von Eigenem, das vom Feinsten ästhetischen Urteil getragen ist. Hiebei geht er allerdings von Aussprüchen Winckelmanns aus späterer Zeit aus, und es mag fraglich erscheinen, ob dieser schon in Seehausen ein so reifes Urteil hatte; darauf kommt es indes nicht an, sondern darauf, zu welchem Gebiete sprachlicher und dichterischer Schönheit Winckelmann neigte und wir bemerken, daß es schon damals das gleiche war wie das, welches er später in der bildenden Kunst der Alten am höchsten stellte. Ihm entsprach vor Allem das leidenschaftslose, abgeklärt Schöne, weniger das Erhabene. Aeschylos blieb ihm fremd.
Aber wenn auch die Alten im Mittelpunkt seiner Neigungen standen, wenn ihr Studium sich für seine selbständige, produktive Thätigkeit am fruchtbringendsten erwies, so war es doch für Winckelmann gewissermaßen nur eine Erholung von anderen Arbeiten und er betrieb daneben noch mancherlei andere Studien, am eingehendsten das der neueren Geschichte. Ja er hatte vorübergehend die Absicht in Jena oder Halle die venia legendi für Historie und Staatsrecht zu erwerben. Außerdem aber interessierte er sich für alle möglichen Wissenschaften. Aus allem, was er las, fertigte er Auszüge ohne festen Plan und nicht für bestimmte Untersuchungen, sondern nur zu dauerndem Besitz des Gelesenen.
Vielerlei Widerwärtigkeiten hatten Winckelmann den Aufenthalt in Seehausen verleidet, von 1746 an suchte er fortzukommen um jeden Preis. Endlich im August 1747 fand er eine Anstellung an der Bibliothek des Grafen Bünau in Nöthnitz bei Dresden.
So verließ er die Heimat im einunddreißigsten Lebensjahre; nur auf Besuch kehrte er noch einmal zurück. Ob er auch ahnte, daß nun ein Leben völlig zu Ende gehe; daß nicht nur Land und Volk, Freundeskreise und Berufsgeschäfte ganz der Vergangenheit angehörten, sondern auch bald Religion, Sprache, Sitte, Denkweise? Hätte er sich damals in das Ich seiner Zukunft versetzen können: es würde ihm gewesen sein, als ob das Land mit samt seinem bisherigen Ich hinter ihm versinke.
Die Bibliothek des Grafen Bünau umfaßte die Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften; sie war gesammelt als Hilfsmittel für das große Werk Bünaus, die deutsche Kaiser- und Rechtshistorie und galt als die erste Privatbibliothek Deutschlands. Ein Katalog war in Arbeit und Winckelmann bearbeitete dafür die Abteilung der Kirchengeschichte und das Leben der Heiligen und Märtyrer. Seine Thätigkeit war aber nicht nur eine bibliothekarische, er wurde auch zur Mitarbeit an der Kaiser- und Rechtshistorie herangezogen. Von diesem weitschichtigen Werke waren (1728–1743) vier Quartbände erschienen, welche bis auf Konrad den Salier reichen, aber es war viel weiter gefördert, eine Reihe von Kaisern lag druckfertig vor. Ein Teil dieser Manuskripte ist in die königliche Bibliothek zu Dresden gelangt. Es scheint, daß Winckelmann einige Teile ziemlich selbständig zu bearbeiten hatte. Herausgekommen ist außer den vier ersten Bänden nichts. Von Winckelmanns sechsjährigem Fleiß ist der Wissenschaft nichts zu Gute gekommen; für ihn waren die Arbeiten als Vorübungen im historischen Fach von Bedeutung, er erwarb sich unter der Leitung eines der ersten Historiker eine gewisse Gewandtheit im Gebrauch der Werkzeuge der Forschung, der Kritik und der Darstellung.
1755 hatte Winckelmann die Absicht, in Dresden einen Cyklus von Vorlesungen über neuere Geschichte zu halten. Sie kamen nicht zu Stande, doch hat sich ein Aufsatz über den mündlichen Vortrag der allgemeinen Geschichte erhalten, wonach er die Geschichte nach dem Vorgange Bolingbrokes, Voltaires und namentlich Montesquieus zu behandeln gedachte. Er wollte sie in einem persönlichen oder biographischen und in einem pragmatischen Teil vortragen, der die Schicksale der Reiche und Staaten enthalten sollte, ihre Aufnahme, ihr Wachstum, ihre Blüte und ihren Verfall. Auch die Forderung der »erleuchteten Kürze« welche er an die Darstellung stellt, verrät den Einfluß Montesquieus.
Winckelmanns amtliche Thätigkeit war, wenn auch keine ganz selbständige, doch eine wissenschaftliche und insofern war seine Stellung in Nöthnitz eine bessere als in Seehausen. Sie nahm ihn indes nicht ganz in Anspruch; er sammelte in seinen Musestunden wie bisher unermüdlich in dem weiten Gebiete aller Wissenschaften, wozu ihm die Bibliothek des Grafen reichlich Gelegenheit bot. Es war hier die neuere Literatur der Franzosen und Engländer, welche ihn anzog, vor allen Montesquieu, Montaigne und Shaftesbury. Unter dem Einfluß der Werke dieser Männer, namentlich des Geistes der Gesetze von Montesquieu haben sich seine politischen Anschauungen konsolidiert. Er zieht in seinen Kollektaneen überall die Schriftsteller und Ideen an, welche die Abwendung von dem politischen System des siebzehnten Jahrhunderts am entschlossensten und beredtesten zum Ausdruck bringen und begeistert sich für die Freiheit der alten Republiken wie der Schweizer. Der Druck unter dem er in Preußen gelitten hatte, und den er dem monarchischen Absolutismus zur Last legte sowie die Aufnahme antiker Anschauungen mögen ihr Teil daran haben, aber seine Äußerungen aus der römischen Zeit zeigen ihn als einen politischen Ideologen, der die harten Notwendigkeiten der Politik gar nicht wahrnimmt. — Neben Montesquieu sind es Montaigne, Shaftesbury und Voltaire, welche in Winckelmanns Kollektaneen am reichsten vertreten sind und was er sich aus diesen und anderen Autoren anmerkte, ist allenthalben der Ruf zur Natur, zum Einfachen und Vernünftigen; überall ist herausgegriffen, was dem vordringenden, die Geister entfesselnden Zug der Zeit angehört und die Zukunft in Besitz nehmen will. Hier erscheint Winckelmann einmal nicht blos als der spätgeborene Geistesverwandte der Tage des Phidias und Plato, sondern als der Sohn seiner Zeit. Und doch ist es hauptsächlich das Wiederaufleben antiker Gedanken in der modernen Literatur das ihn fesselt.
Was die Literatur des grand siècle auszeichnet, ist nicht nur ihr Inhalt, sondern auch ihre hohe formale Vollendung, sie wendet sich an eine Gesellschaft vom feinsten[S. 152] und strengsten Geschmack; mehr als Tiefe der Erudition und Strenge der Logik gelten ihr die Tugenden der Konversation: Klarheit, Leichtigkeit und Kürze, Korrektheit und Präzision, Lebhaftigkeit und überraschende Vorstellungsverbindungen. Alle modernen Schriftsteller, für die sich Winckelmann erwärmte, sind Meister des Stils. An diesen Mustern hat sich Winckelmann zu der Kunst des Stils herangebildet, die es ihm möglich machte, ein Buch in gutem Deutsch für Weltleute und Künstler zu schreiben, ein Buch ohne Zitate, in urbanem Ton und in einem aphoristischen Stil.
Es ist eine scharfe Luft die in dieser Literatur weht und die Winckelmann zusagte, das im engeren Sinne poetische geht ihr ab. Justi stellt die Frage nach Winckelmanns Verhältnis zur Dichtkunst. Göthe hat ihm die Neigung zur Poesie abgesprochen, Justi nimmt an, daß dem Freunde des Sophokles und Homer der Sinn für das Dichterische nicht gefehlt hat, er führt als Zeugen Göthe selbst an, der einräumt, daß Winckelmann in seinen späteren Schriften beinahe durchaus selbst Poet gewesen sei, und zwar ein tüchtiger, unverkennbarer, und erwähnt verschiedene Sammlungen dichterischer Blüten von Winckelmanns Hand. Aber damit ist die Frage nicht abgethan. Justi selbst gibt zu, daß Winkelmann vorzüglich der didaktische Vers und das bildliche Element in der Poesie zugänglich war. Diese Vorliebe teilt er mit seinen Zeitgenossen. In der epischen Poesie, vielleicht auch in der dramatischen, schätzt er vor Allem die figürliche Malerei der poetischen Bilder und Vergleiche und die musikalische Malerei der Silben und Rhythmen. Er wünscht, daß alle homerischen Bilder sinnlich und figürlich zu machen wären und er begeistert sich an dem Wohlklang des sanften und musikalischen Dialekts Joniens, der durch den Klang und die Folge der Worte die Gestalt oder das Wesen der Sache selbst ausdrücken kann. Das ist noch die alte ästhetische Schule vor Lessing, deren Theorien das Horazische »ut pictura poesis« zu Grunde lag. Auch darin ist er ein Kind seiner Zeit. Das Wort und der Vers waren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und noch weit darüber hinaus nicht die Elemente, in welchen die innersten, zartesten Empfindungen rein zum Ausdruck kamen. Das Vermögen hiezu hat erst Göthe besessen und Anderen erschlossen. Starke lyrische Empfindungen kamen nur in der Musik voll zum Ausdruck. Den Sinn für das was uns im engsten Sinne poetisch erscheint, dürfen wir also bei Winckelmann nicht suchen. Sein außerordentlicher Formensinn aber fand in vollendeten poetischen Formen ein Vergnügen und sein Verstand freute sich, schöne Gedanken und Bilder in diesen Formen ausgedrückt zu sehen. Und was ist es, das seiner Sprache poetischen Schwung verleiht, es ist die Begeisterung, in die ihn schöne plastische Formen versetzen. Gewiß haben wenige Menschen das homo sum so wörtlich genommen als Winckelmann, aber sein eigenstes Element war doch die antike Plastik, das scheint mir auch sein Verhältnis zur Poesie, soweit wir es beurteilen können, zu zeigen.
Auch über bildende Kunst hat er so viel gelesen und ausgezogen, daß er sagen konnte: »Ich habe alles gelesen, was ans Licht getreten ist, in allen Sprachen über die beiden Künste. — Ich habe Auszüge aus den besten Büchern, die mir nicht um hundert Dukaten feil sind.« Aber die spekulative wie die historische Kunstbetrachtung steckte noch in den Kinderschuhen und als Winckelmann später mit eigenen Augen sehen gelernt hatte, erschien ihm seine frühere Weisheit aus Büchern keinen Schuß Pulver wert.
Dresden bot aber auch, wie keine zweite Stadt Deutschlands, Gelegenheit zu reichster Anschauung in allen Künsten. Hier herrschte unter August II., dem Starken und August III. ein glänzendes Kunstleben, ja es mochte, bis der siebenjährige Krieg alledem ein jähes Ende machte, scheinen, als ob die Beschäftigung mit den Künsten die wichtigste, ja die einzig menschenwürdige sei.
Winckelmann tritt hier zuerst in nähere Beziehung zu den bildenden Künsten. »Es war eine ganz andere Art des Wissens, eine Erkenntnis aus Dingen statt aus Büchern, eine Erkenntnis aus Anschauung und Empfindung, statt aus Worten und Begriffen. Diesen Unterschied brachte sich Winckelmann damals mit Leidenschaft zum Bewußtsein: er wurde von entscheidendem Einfluß auf sein Leben. In dieser neuen Welt findet er endlich sein Element. Dies Neue bringt ihn von polyhistorischer Zerfahrenheit zur Einheit;[S. 153] indem er sich selbst findet, fühlt er zum ersten Male auch den Antrieb, öffentlich zu sprechen.« Damals machte sich der Widerspruch gegen die Kunst des Rococo schon bemerklich. Winckelmanns Stellung in diesem Streit ist durch sein Verhältnis zu den Alten im Voraus bestimmt.
Justi behandelt in einem »Bilder aus dem Dresdener Kunstleben« betitelten Kapitel die Zustände und die Persönlichkeiten. Vortrefflich ist, was er über die Prachtbauten Dresdens und über die dekorative Plastik sagt. Ebenso die Begründung des Widerspruches, der sich schon regte, während diese glänzenden Kunstschöpfungen entstanden. Ich muß darauf kurz eingehen, denn hier liegen die Ursachen der unermeßlichen Wirkungen von Winckelmanns Werken.
»Die Wirkung von Kunstschöpfungen, sagt Justi, auch der Dichtung und Tonkunst, ist eben eine zweifache: das ist in ihrer emotionellen Beschaffenheit begründet. Auch ihre Wärme sinkt durch Ausstrahlung, besonders bei starkem Tempo der Bewegung auf dem Gebiet, und erreicht einen Punkt der Indifferenz. Dann entsteht das Bedürfnis der Neubelebung. Dazu kann wohl eine Zeitlang Steigerung der Reize, Reinigung und Vervollkommnung der Formen genügen; aber die Formen leben sich aus; dann folgt der Bruch und die Hinwendung zum Entgegengesetzten; man sucht die Komplement- und Kontrastwerte. (Die neue Auflage bringt hier einen scharfen Hieb gegen »die Moderne«.) Das ist das Gesetz, das die Wandlungen des Geschmacks beherrscht und es wäre Verkennung des wirklichen Zusammenhanges, wollte man immer nur die Ähnlichkeitsmomente in den aufeinanderfolgenden Erscheinungen sammeln und als die wirkende Kraft betrachten, statt Gleiches und Entgegengesetztes zu wägen und zu messen.
Es ist also kein Zufall, daß die Rede von der rettenden Nachahmung der Griechen um jeden Preis, die Predigt des Classicismus im Schatten des Zwingers und der katholischen Hofkirche sich erhoben hat.«
In diesen Sätzen ist ein Gesetz der kunstgeschichtlichen Entwickelung klar formuliert, in der Anwendung auf konkreten Fall aber bleibt die Frage offen, wie es kommt, daß die Herrlichkeit der französischen Kunst des Louis XV. von so kurzer Dauer war.
Das scheint mir nun zunächst darin begründet zu sein, daß diese Kunst keine eigene Entwicklungsepoche, sondern nur die letzte Phase einer solchen, der Renaissance, ist; allerdings eine sehr glänzende, denn sie hat ihren eigenen, fast selbständigen Formcanon. Dessen Schwäche aber, und das ist das Zweite, ist, daß er rein konventionell ist und keine Entwicklungspotenzen in sich schließt. Das gilt von der Architektur, es gilt in noch höherem Grade von der Plastik und Malerei. Das Konventionelle aber ermüdet bald, besonders wenn es in so verschwenderischer Fülle auftritt wie im Rococo. Dieser zierliche Stil ist um 1725 noch nicht fertig. 1750 ist er schon am Ende seiner Möglichkeiten; die Bahn für einen Reformator des Geschmackes war frei, der Glaube an die absolute Vorbildlichkeit der Antike lebte neu auf, schon war da und dort der Ruf zur Rückkehr zu ihr erschollen. In diesen Kampf trat Winckelmann ein mit seiner Erstlingsschrift, den Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst.
Die Schrift ist in Dresden entstanden in dem Jahre, das er nach seinem Übertritt zur katholischen Kirche und seinen Austritt aus dem Dienste des Grafen Bünau noch dort verbrachte. Die Anregung gieng von Oeser aus, dem auch ein großer Teil der Gedanken angehört, die Form ganz ist Winckelmanns Eigentum.
Er erläutert in begeisterten Worten die Vorzüge der griechischen Kunst in Formgebung, Draperie und Ausdruck. Großes Gewicht legt er auf die Gunst der Umstände, unter welchen sich bei den Griechen eine schöne Körperlichkeit entwickelte und die Sitte, welche den Künstlern erlaubte, diese Fülle der Schönheit aufs freieste auszubeuten. Die häufige Gelegenheit zur Beobachtung der schönen Natur trieb die Künstler, in der Richtung der Schönheit, über die Gegenstände ihrer Einzelerfahrung hinaus: sie führte zum Ideal. Die Griechen wollten nicht blos das in der Natur zerstreute sammeln: sie bildeten sich gewisse allgemeine Begriffe von Schönheit, sowohl einzelner Teile, als ganzer Verhältnisse der Körper, die sich über die Natur erheben sollten.
Dem gegenüber sind die Neueren ganz im Nachteil; durch Beobachtung und Nachahmung der Natur würden sie das Schöne ganz gewiß verfehlen, denn das Schöne der Natur zeigt sich bei uns nicht alle Tage, und selten so, wie es der Künstler wünscht. Ehe er sich daher der Nachahmung der Natur überläßt, sollte er aus den Werken der Griechen die Begriffe des Ganzen, des Vollkommenen lernen, die die Begriffe des Geteilten in unserer Natur bei ihm läutern und sinnlicher machen.
Zu den Verirrungen des Formensinns gesellt sich bei den Neueren die Maßlosigkeit des Ausdrucks, der bei den Griechen »die erhabene Seele gegenüber steht.« »Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterwerke ist eine edle Einfalt und stille Größe, sowohl in der Stellung, als im Ausdruck.«
So weit können wir, soviel anders auch unsere ästhetischen Anschauungen geworden sind, folgen, wenn er aber gegen den Schluß seiner Schrift als Heilmittel gegen die Verbrauchtheit der Stoffe und die Leere der Gemälde die Allegorie empfiehlt, so sehen wir ihn ganz in den Vorurteilen einer Zeit befangen, die glücklicherweise nicht mehr die unsere ist.
Was uns an der Schrift noch heute anspricht, ist die warme Liebe und die ungemischte Bewunderung für die Antike; der antike Sinn für die körperliche Vollkommenheit und die ob zwar veraltete, doch immer noch schöne Sprache. Für ihre Zeit war sie das befreiende Wort das aussprach, was der Kunst Not that. Sie erregte allenthalben Aufsehen, das sich in Ablehnung und Zustimmung kundgab, aber letzteres überwog. Nun kam Winckelmann auf den seltsamen Einfall, seine Schrift selbst anzugreifen und in einer Erwiderung auf diesen Angriff zu rechtfertigen. Dies geschah in dem Sendschreiben über die Gedanken von der Nachahmung (1756) und in der Erläuterung der Gedanken (1756). In dem Sendschreiben stellte er zusammen, was in den Akademien von den Verehrern des Modernen gegen seine These geltend gemacht werden konnte und in der Erläuterung widerlegte er diese Einwände, allein die Kunst der Dialektik und Ironie, die Teilung des Ich in Ankläger und Verteidiger, scheint nicht seine Sache gewesen zu sein. Die Streiche seiner Kritik treffen nicht die »Gedanken«, und die Replik paßt nicht auf die Kritik; beide aber bringen wenig oder nichts zur Bestätigung oder Beleuchtung der Gedanken. Auch erkannte Winckelmann selbst, daß er sich mit den beiden Schriften übereilt habe.
Aber der Beifall der Besten ward seiner Erstlingsschrift zu Teil, mannigfache Anregungen giengen von ihr aus, und wenn die einzige der Anstoß zu Lessings Laokoon geblieben wäre, so wäre ihr schon damit ewiger Dank gewiß.
Winckelmanns Stellung hatte sich mit dem Eintritt in den Dienst des Grafen Bünau angenehmer gestaltet, als im preußischen Schuldienst, doch schon nach zwei Jahren war er ihrer überdrüssig. Was ihm fehlte, spricht er in einem Briefe vom 24. Juni 1752 klar aus: »Beatus ille qui procul negotiis est. Mihi tamen felici non licuit esse, ut mihi soli vivere, Musis solis litare Genioque indulgere possim.« Es ist der unwiderstehliche Drang nach Unabhängigkeit, ein Glück gab es für ihn nur, wenn er sich selbst und seinen Studien leben konnte. So arbeitete er wieder die Nächte durch, und bald fühlte er, daß seine Gesundheit wankte; seine Stimmung verdüsterte sich neuerdings und wieder strebte er nach einer Veränderung. In der Kunst war ihm ein neuer Lebenswert aufgegangen, sein Sehnen richtete sich nach dem Lande der Kunst, nach Italien.
In solchen Stimmungen kam er mit dem päpstlichen Nuntius, dem Kardinal Archinto in Beziehung, es eröffnet sich ihm die Aussicht auf ein sorgenfreies Leben in Rom, aber dieses ist nur zu erlangen um den Preis des Übertritts zur römischen Kirche. Dieser erfolgte nach langem Zögern und öfters unterbrochenen Verhandlungen am 11. Juli 1754. Es ist darüber genug geschrieben. Eine Konversion wie die Winckelmanns, der nach wie vor ein lauer Christ blieb, kann niemanden Freude machen. Es kann Fälle geben, in welchen der Übertritt zu einer anderen Konfession Gewissenspflicht ist, es kann äußerer Zwang eintreten, der keinen anderen Ausweg läßt, wo das nicht der Fall ist, muß er unterbleiben.
Wer aber selbst Jahre lang in einem falschen Berufe gelebt und viele vergebliche Versuche sich zu befreien, durchgemacht hat, wird auch über Winckelmanns Schritt milde urteilen.
Und was Winckelmann gefehlt, indem er ohne Überzeugung übertrat, was er erduldet, ist doch der ganzen Menschheit zu Gute gekommen. Er hat die Pforten des Heiligtums aufgethan in dem annoch jeder, der auf höhere Bildung, auf höheres Glück ein Anrecht hat, seine Heimat findet.
Ein zweiter Artikel folgt.
Inventar der Bronzealterfunde aus Schleswig-Holstein. Von Dr. W. Splieth. Kiel und Leipzig. Verlag von Lipsius u. Fischer. 1900. 89 SS. und 13 Tafeln.
Im Anschluß an die grundlegenden Arbeiten von O. Montelius und S. Müller sucht der Verfasser für Schleswig-Holstein ein möglichst vollständiges Inventar der Bronzealterfunde aufzustellen und diesen Bestand in Perioden zu gliedern. Der Untersuchung sind die in Schleswig-Holstein besonders zahlreich registrierten Gesamtfunde zu Grunde gelegt und Einzelfunde nur soweit herangezogen, als sie zur Vervollständigung des Inventars notwendig waren.
Das Fundmaterial ist in der Form von Tabellen vorgeführt. In der Periodisierung folgt der Verfasser seinen Vorgängern darin, daß er eine ältere und eine jüngere Bronzezeit annimmt; die erstere teilt er in drei, die jüngere in zwei Perioden. Es werden die Typen, welche den Formenkreis einer Periode ausmachen, charakterisiert und danach die Tabelle der Funde der Periode gegeben. Den Tabellen folgen kurze Ausführungen über die Bestattungsweise der Perioden. In 230 Abbildungen werden die wichtigsten Typen der Funde vorgeführt.
Die sachlichen Ausführungen sind prägnant und zuverlässig und die Tabellen bieten eine sehr vollkommene Übersicht über die in den verschiedenen Sammlungen der Provinz aufbewahrten Bronzealterfunde. Das Schriftchen bietet eine bequeme Grundlage für die relative Altersbestimmung prähistorischer Bronzefunde und wird namentlich dem gute Dienste leisten, welchem die größeren Arbeiten über nordische Altertumskunde nicht zugänglich sind.
B.
Die deutsche Cicerone. Von G. Ebe. Architektur I u. II. Malerei. Leipzig, Otto Spencer 1897, 1898. 8. 409, 376 u. 475 S.
Der Gedanke, der in den hier uns vorliegenden Bänden zunächst für Architektur und Malerei zur Ausführung gebracht werden soll, eine der modernen Kenntnis entsprechende Kunsttopographie Deutschlands in gedrängter Form herauszugeben, wird in allen beteiligten Kreisen lebhaftes Interesse erregen. Seitdem vor fast einem halben Säkulum Jacob Burckhardts klassischer Cicerone, dessen Titel auch für das vorliegende Werk wohl mit Rücksicht auf den berühmten Vorgänger gewählt wurde, die italienischen Kunstschätze Deutschland und, man darf behaupten, der ganzen gebildeten Welt erst eigentlich nahe gebracht hat, mußte der Wunsch nach einem solchen Werke rege werden und bleiben. Die Unentbehrlichkeit des Lotze’schen Werkes, das trotz seiner relativen Vortrefflichkeit dem Bedürfnis nur teilweise entsprach, bis heute ist der Beweis hiefür. Die in den letzten Dezennien erschienenen zahlreichen speziellen Denkmälerinventare[S. 156] der verschiedenen deutschen Gaue, die immer umfangreicher werdende spezielle und allgemeine Literatur über deutsche Kunst, haben dem Verfasser G. Ebe den Zeitpunkt als gekommen erscheinen lassen, wo ein umfassendes kunsttopographisches Werk in gedrängter Form mit Nutzen herauszugeben sei. Es wäre gewiß unbillig, dem geradezu staunenswerten Fleiße der zur Aufstapelung und Sichtung einer derartigen ungeheuern Zahl von Einzelnotizen gehört, die Anerkennung zu versagen oder die Schwierigkeit der formalen Ausgestaltung eines solchen Sammelwerks und der richtigen Auswahl des Materials zu verkennen. G. Ebe hat nun die gesamte Kunstliteratur in der ausgiebigsten Weise in Kontribution gesetzt; ein gewisses Bestreben, ja Alles, was die Deutschen an Kunst von frühchristlicher Zeit bis zum Jahre 1890 geschaffen, aufzunehmen, läßt sich unschwer erkennen. Autopsie war bei dieser Art der Auffassung natürlich von Vornhinein in der Mehrzahl der Fälle ausgeschlossen. So aber wirkt die Wiedergabe des ungleichartigen literarischen Materials vielfach unerfreulich; es ist nicht zur Bildung eines selbständigen Urteils, einer originellen Auffassung gekommen. Für den Fachmann gibt das Werk zu wenig, dieser wird doch auf die speziellen Inventare und die spezielle Literatur zurückkommen müssen; für den Laien gibt es viel zu viel Material, zu wenig Aufklärung über die wichtigsten Phasen der Entwicklung. Unter dem Aufstapeln möglichst vieler Denkmalsnotizen hat naturgemäß auch die formale Ausgestaltung gelitten; das Buch liest sich trocken und hart. Als Nachschlagebuch wird das Werk immerhin recht gute Dienste leisten, wenn auch zur Abfassung einer wirklich guten, zusammenfassenden deutschen Kunsttopographie nur eine Kraft ersten Ranges, die den schwierigen Stoff zu sichten und zu meistern versteht, berufen sein kann.
H. St.
Kleinigkeiten. Von Alban Scholz. Erste Sammlung. Von Anfang bis 1872. 3. Aufl. 1900. Freiburg i. B., Herder’sche Verlagshandlung. 764 S. (geh. M. 6.—, geb. M. 7.40).
Der vorliegende Band der Kleinigkeiten ist ein beredtes Zeugnis für die Vielgewandtheit und die allezeit gerüstete Feder des bekannten katholischen Volksschriftstellers. Neben Vorworten zu Büchern, Predigten, Aufsätzen religiöser Art, Blättern aus seinem Wanderbuche, Erörterung allgemeinerer sittlicher Fragen, wobei scharfe Beobachtungsgabe und gesundes Urteil vielfach zu Tage treten, sind es besonders polemisch gefärbte Artikel, die einen breiten Raum einnehmen. So gegen die Freimaurer (Mörtel für die Freimaurer (1862) S. 377, Akazienzweig für die Freimaurer, S. 426), gegen Johannes Ronge und seine Anhänger (der neue Kometstern mit seinem Schweif oder Johannes Ronge und seine Briefträger S. 43 f.), gegen die Behandlung der Katholiken in Baden (Badische Kirchengeschichte aus der letzten Zeit (1854) S. 265). Und die Bewegungen in der katholischen wie in der evangelischen Kirche seines engeren Heimatlandes erfahren mehrfach scharfe Beleuchtungen. Fesselnd ist die flotte und frische, durch schlagende Bilder und Vergleiche reich belebte, zuweilen humoristische aber auch barocke Schreibweise, die das Interesse auch da wachhält, wo man etwa sachlich nicht übereinstimmt.
K. S.
Taf. VI.

Moses lässt in der Wüste Wasser aus einem Felsen entspringen.
Gemälde von Lucas van Leyden im Germanischen Museum.
VON FRANZ DÜLBERG.
(Hierzu Tafel VI.)
Die Gemäldegalerie des Germanischen Museums in Nürnberg ist seit einigen Monaten im Besitz eines Gemäldes von Lucas van Leyden, das an Umfang (h. 1,95, br. 2,40 m) nur seinem Leydener Jüngsten Gericht, an künstlerischer Bedeutung nur diesem seinem Hauptwerk, sowie der berühmten Heilung des Bartimeus in der Petersburger Ermitage und vielleicht den reizenden Kartenspielern bei Lord Pembroke in Wiltonhouse nachsteht. Die Erwerbung ist erfreulich einerseits, weil das Bild während des letzten Jahrzehnts den Blicken der Kunstfreunde völlig entzogen war, andererseits weil es den Meister in der Stadt Albrecht Dürers vertritt. Hat doch Dürers Werk dem Holländer die Motive für manche seiner kleineren Stichkompositionen, ja für das Bildnis Maximilians sogar die Vorlage gegeben, war doch der Nürnberger Meister in Antwerpen bei Meister Lucas zu Gast geladen, den er dann »mit dem Stift konterfeite« und hat er doch »den ganzen Druck« des[S. 158] Genossen teuer um »8 Gulden seiner Kunst« ertauscht! Nur schade, daß von Dürer selbst so wenig in Nürnberg verblieben ist!
Das Bild stellt den IV. Mose 20, 1–13 erzählten Vorgang dar, wie in der Felswüste Zin Moses, von den verschmachtenden Israeliten gedrängt, auf Gottes Geheiß durch den Schlag seines Stabes den Steinen Wasser entlockt. Der Augenblick nach dem Wunder ist gewählt »et bibit synagoga et pecora eorum;« doch hat Lucas, dem die Wiedergabe von Tieren nur einmal, in dem Stiche »Die Melkerin«, trefflich gelang, die Beteiligung des Viehes auf eine im Hintergrund heranziehende Karawane eingeschränkt.
Die Geschichte Mosis wurde von der alten Leydener Schule oft behandelt: die Aufrichtung der ehernen Schlange gab Cornelis Engebrechtsz auf dem rechten Flügel der Leydener Kreuzigung den Stoff zu seiner bedeutendsten Kompositionsleistung, Lucas selber schuf jenen Tanz um das goldene Kalb, ein Bild derber Ausgelassenheit, das Sandrart beim Buchhalter Jan Lossert in Amsterdam sah und das 1709 in unmittelbarer Nachbarschaft der Darmstädter Holbeinmadonna versteigert wurde[188]; der letzte Ausläufer der Gruppe endlich, Aertgen van Leyden, malte für den Leydener Quirinck Claesz. den Untergang Pharaos im roten Meere.
Unser Bild hing bis zum Jahre 1891 in Rom in der Villa Borghese, dort aber der in der borghesischen Sammlung so reich vertretenen Schule von Ferrara zugezählt. Ein nicht ganz unbegreiflicher Irrtum: sind doch unter allen italienischen Schulen die Ferraresen am meisten holländischer Art verwandt — wie ja Dosso Dossis herrliche Dido in der Doria-Galerie fast den Eindruck eines Rembrandt macht. Die richtige Bestimmung auf Lucas van Leyden findet sich zuerst in der von Bode herausgegebenen 4. Auflage von Bruckhardts »Cicerone« (1879); Woltmann-Wörmanns Geschichte der Malerei und Hymans’ van Mander-Ausgabe folgten. Bei der Errichtung des Fideikommisses über die Galerie Borghese wurde das Bild ausgeschieden; es gelangte an die Fürsten von Piombino[189] und nach nochmaligem Besitzwechsel 1900 an den Hofkunsthändler Julius Böhler in München[190] von dem es das Germanische Museum erwarb.
Das Gemälde zeigt auf einem Steinblock links unweit der Mitte die Jahreszahl 1527 und darunter das L, beides unzweifelhaft echt, in den von den Stichen her bekannten Zügen des Meisters. So stammt es also aus dem Jahre jener prunkenden Reise nach Seeland, Flandern und Brabant, die Lucas in Gemeinschaft Mabuses unternahm und von der er die Todeskrankheit mitbringen sollte! Übrigens tragen nur noch zwei seiner bisher bekannten Bilder Zeichen und Jahreszahl von der Hand des Meisters: das Votivdiptychon in der Münchener Pinakothek aus dem Besitz des Frans Hooghstraet und[S. 159] Kaiser Rudolphs, von 1522, und die Mönchspredigt des Ryksmuseums, die rechts über der Thür nicht ganz deutlich die Zahl 1530 hat.
Die Schicksale des Werkes lassen sich nicht weit zurückverfolgen. Zwar erwähnt — worauf Piancastelli hinwies — schon Scannelli[191] ein Gemälde von Lucas van Leyden im Besitz der Borghese, doch gibt er den Gegenstand nicht an. Weder Gerard Hoets Catalogus noch die von Bredius gesammelten Archivalien geben uns hier Aufschluß. Vielleicht ist uns hier aber eine Stelle van Manders von Bedeutung, die von einem anderen Bilde handelt. In Leyden — ob es bei Dirk van Sonneveldt oder bei dem Dilettanten Job. Ariaensz. Knotter war, erinnert er sich nicht mehr genau — hatte er ein Bild in Tempera auf Leinwand von unseren Künstler gesehen, das Elieser und Rebekka am Brunnen darstellte: in schöner, tiefer Landschaft sah man besonders anmutige Frauen in den abwechslungsreichen Stellungen, zu denen das Wasserholen Anlaß gibt. Nun ist auch unser Gemälde in Tempera auf Leinwand ausgeführt, es ist gleichfalls alttestamentlichen Stoffes und vor allem: es wandelt ebenso das Motiv des Wasserholens in reichster Weise ab. Wäre da die Vermutung zu kühn, daß unser Bild einst mit jenem Verschollenen über die Wand desselben Zimmers gespannt war?[192]
Wenn schon 70 Jahre nach Lucas Tode van Mander die Verwüstungen beklagt, die die Feuchtigkeit der Wände in dessen, damals bei einem Brauer in Delft befindlichen Temperabildern aus der Geschichte Josephs angerichtet hatte, so werden wir uns heute nicht wundern dürfen, daß unser in gleicher Technik ausgeführtes Gemälde nicht unversehrt auf uns gekommen ist. Zwei der glänzenden Seiten des Meisters, die feine Abstufung der landschaftlichen Gründe und die geschmackvolle Farbenwahl, erscheinen hier durch die Unbill der Jahre verkümmert; die Landschaft ist zumal zu den Seiten verschwommen und ohne Tiefe. Das Kolorit hat an Geschlossenheit sehr verloren, so daß die ursprüngliche Farbenwirkung nicht mehr vollkommen augenscheinlich ist. Störend wirkt jetzt namentlich der mehrmals wiederholte Gegensatz eines stumpfen Grün und kräftigen Rot. Immerhin bleibt noch ein bedeutender malerischer Eindruck, der zumal den delikaten Gewandfarben in der — am besten erhaltenen — Hauptgruppe im Moses zu verdanken ist; manches werden wir uns — da wir von Lucas ein zweites Temperabild bisher nicht haben — etwa nach der dem gleichen Schulkreise angehörigen »Sibylle von Tibur« in der Wiener Akademie rekonstruieren müssen.
Die Ausführung ist von größter Sorgfalt. Wie an Dürers Apostelköpfen in den Ufizi, ist fast jedes Haar einzeln gemalt. Die Zierrate, zumal an den Gewändern der vornehmsten Personen, fein mit spärlichem Blattgold gegeben.
Der Aufbau des Bildes benutzt mit einem seit Geertgens Felsenkoulissen in der holländischen Malerei eingeführten Kompositionsmittel das steinige Terrain der Felswüste zur wirkungsvollen Scheidung der Gruppen; ähnlich wie zumal auf frühen Stichen des Meisters[193] beherrscht den Mittelpunkt der Landschaft ein zerklüfteter Felshügel mit schlanken Bäumen, deren Kronen der Rahmen abschneidet. Die Mitte ist von Figuren leer. Die Führer stehen rechts im zweiten Plan in hellbeleuchteter, ruhiger Gruppe. Die gelagerte und bewegte Volksmenge umzieht sie in doppelter, nach links hin schwererer Ellipse; im vorderen Bogen die Tränkenden und Trinkenden, im hinteren Bogen die Wasserholenden.
Gesenkten Hauptes steht Moses, träumerisch mehr denn befehlend hält er den wunderwirkenden Stab in der Rechten. Das feine langbärtige Gesicht läßt wohl den Kummer über den wundersüchtigen Wankelmut des Volkes, das Leid der Strafe, die Gott dem Erzwinger des Wunders verkündet hat, erkennen: »Könnt’ ich Magie von meinem Pfad entfernen!« Ein rationalistischer Zug des Künstlers ist es, daß die traditionellen Hörner einfach als aufgerichtete Haarlocken gegeben sind[194]. Die Kleidung zeigt geschmackvollen Prunk; der Mantelkragen grau mit Goldborten, die Oberärmel grün und fleischrot, die Unterärmel blau, das in Röhrenfalten fallende Gewand hellgrau, die Stiefel violettrötlich. Vertrauender blickt Mosis linker Nachbar Aaron ihn an. Das kräftige, viereckige Gesicht mit dem kurzen, breiten Backenbart, das sich ähnlich an einer zweiten Figur des Bildes wiederholt, und noch mehr die stolze, senkrechte Linie der Gestalt erinnern an die Typen jenes halbverschollenen, begabten Schülers unseres Meisters, des Jan Swart van Groningen; der prachtvolle Fluß des leuchtenden Mantels gibt Dürers glänzendsten Gewandstudien nichts nach. Aarons Turban ist rot, graugrün umwunden, der reichbrokatierte Talar von hellstem Violett, der Mantel hellorange, die Schuhe rot. Wie links der Priester, so steht rechts der Krieger Moses zur Seite. Mit scharfem Blick wendet er ihm das gedrungene Gesicht zu; bestimmt spricht die halberhobene Rechte; die hängende Linke hält sicher das breite Schwert, dessen Griff der Maler entsprechend seiner Art, alles Ornamentale zu verlebendigen, in einen Tierkopf auslaufen ließ. Seine Tracht ist prunkend: graugrüner, schwerer Turban, olivengrüner Schnürrock, merkwürdig gepolsterter, orangeroter Ärmel. Unter dem halben Dutzend Nebenfiguren der Gruppe sehen wir einen Phlegmatiker mit Doppelkinn in Vorderansicht, das Profil eines Greises mit hängender Judennase, hängender Lippe und gedrehten Bartlocken, der zusammen mit einigen anderen Gestalten unseres Bildes, auf das auch in der 4 Jahre später gemalten Heilung des Blinden[195] zu Tage tretende Rassenstudium unseres Künstlers hinweist,[S. 161] und einen zigeunerhaft schönen, jungen Mann mit halbentblößtem, hängenden Arm rechts am Abschluß des Kreises.
Eine kleine Novelle erzählen uns die drei als Eckgruppe rechts vorgelagerten Personen: mit vollem dankbarem Blick empfängt das hübsche junge Mädchen das Wasser, das der bärtige Mann mit beiden Händen aus der schweren Kanne in ihre Schale gießt; ehrenfest zu Moses und Aaron aufsehend, sitzt der bartlose Alte dabei. Die feinen Züge und die geringelten Locken des Mädchens lassen an manche Köpfe vom linken Flügel des »Jüngsten Gerichts« denken, die wulstige Kopfbedeckung trägt auch eine Frau rechts auf der »Heilung des Blinden«. Der Einschenkende gibt eine zumal mit dem ausgestreckten linken Bein gut raumfüllende Rückenfigur, zugleich einen Haubenstock für die etwas allzugern ausgebrachten Kostümstudien des Künstlers: weißer, breitrandiger, runder Topfhut, geschlitztes, ausgebauschtes und gezacktes rotes Wamms, olivengrüner Unterrock, grüne Ärmel und gelbe Stiefel. — Der Alte erscheint in gelb und orange, das Mädchen in rosa und graugrün. Das etwas entfernter der eigentlichen Mitte des Bildes nächste Paar zeigt uns Jugend und Alter. Die bequem gelagerte junge Frau führt ruhig mit der Rechten die Schale zum Munde und gießt zugleich mit der Linken aus bauchigem Thonkrug dem knieend zu ihr aufblickenden Alten in den Napf, den er mühsam am Boden hält. Ihr Gesicht ist üppig und etwas schwermütig, die Hand an der Schale und der entblößt fortgestreckte Fuß sind, wie auf Stichen des Meisters, etwa Mars und Venus, ein wenig knochig und krampfig geraten. Das verschmitzte, breite Antlitz des Mannes mit der pfropfig aufgestülpten Nase und dem Doppelkinn ist das einzige bewußt häßliche auf dem Gemälde, noch den Pöbeltypen des Engebrechtsz, verwandt. Links im Vordergrunde sehen wir zwei Kinder in guter Kameradschaft: der etwas ältere Knabe kriecht heran und schiebt den anderen, der mit beiden Händen und vollen Backen gierig zugreift, die Kürbisflasche an den Mund; jener ist in grünem Röckchen und trefflich behandeltem weißen Hemd, dieser in Rotorange. Ganz ähnliche Kinderfiguren tummeln sich ja auch auf dem 2 Jahre früher entstandenen Prachtstich »Vergil im Korbe« links im Vordergrund herum. Die mütterliche Pflege vertritt als linke Abschlußgruppe die junge Frau mit hübschen, etwas abgehärmtem Profil, die aus blauem Glase dem stämmigen Kinde zu trinken gibt und ihm zärtlich dabei die Hand von hinten her auf die Schulter legt. Ihr Kragen ist rot, der Ärmel grün; sehr gut ist die Linie des im Knie aufruhenden rechten Beins unter dem weißen Gewand ausgedrückt.
Als Vorderste der Wasserholenden erscheinen im Mittelgrunde, der Mosesgruppe gerade gegenüber, zwei Paare; als Erster an der Quelle und zugleich als zweite, äußerst geschickt gestellte Rückenfigur des Bildes, ein Mann, der den Körper nach rechts hin lehnend, den rechten Arm auf dem bedeutungsvollen, das Zeichen des Künstlers tragenden Steinblock ruhen läßt, mit beiden Händen eine große Flasche an den Felsen hält, den Kopf aber ausspähend nach der links aus der Ferne nahenden Karawane zu wenden scheint. Sein geteilter, am Ärmel geschlitzter Rock ist feuerrot, der langbetroddelte[S. 162] Kragen dunkelgrün, das Hemd weiß. Ziemlich gelangweilt blickt die bei ihm stehende, gewöhnlich aussehende, stumpfnasige Frau in bauschiger Mütze uns an; der Finger ihrer Linken scheint auf die ihr Kind tränkende Mutter hinzuweisen, an der Rechten hält sie wie einen Handkoffer, ein breites, faßartiges Gefäß. Links von Beiden hört ein derbfrisches, reichgeschmücktes junges Mädchen, eine Henkelkanne an der kräftigen Hand, einem mit aufgerissenem Auge und spitzer Handbewegung auf sie einredenden, schwarzhaarigen und bärtigen Orientalen zu, der sich eine mächtige Tonne auf den Rücken geschnallt hat: sie in gelb und grau gestreiftem Kragen, roten Ärmeln und Brusttuch und schwarzen Kleid; er in grünem Rock und roten Ärmeln.
Entfernter naht, durch eine Böschung getrennt, eine zweite Vierergruppe. Der Vorderste, gerade vor der Spitze des Mittelfelsens stehend, kommt mit schwerem, breitem Schritt, eine Tonne unter dem entblößten Arme. Etwas bedenklich richtet er das edel geschnittene, in der Form dem des Aaron verwandte Gesicht auf die Menge der schon Trinkenden und bedeutet mit der freien linken Hand den Nachbar, der ihn mit stechenden Augen unruhig ansieht. Die virtuos gezeichnete Gestalt läßt in der mächtigen, hochgezogenen Schulter und der starken Muskulatur des Armes schon etwas den in den Stichen seit 1528 auftretenden, durch Mabuse vermittelten Einfluß italischen Aktprunkes erkennen. Das Hemd des Mannes ist gelbrot. Der andere hält eine Kanne an der linken Hand und erscheint mit Knebelbart, Schmachtlocken, asiatischer spitziger Pelzmütze und graugrüner Kleidung. Tiefer im Wege folgt eine Frau, die ihr Kind im Gewande am Busen birgt, und, fast von ihr verdeckt, ein lederfarbener Alter mit lebensvollstem Blick, ein Kopf, der unmittelbar an Rembrandts Rabbinerbilder gemahnt.
In einer Felsenspalte zwischen dieser Gruppe und denen um Moses sehen wir noch die wohl auch zu den Wasserholenden gehörende Figur eines Mannes mit in einander gelegten Händen, die sich in ihrer braunen Gewandung kaum von den Felsen abhebt.
Ebenso wie diese Gestalt, hat auch die im Hintergrunde links in kleinem Maßstabe gemalte, mit ihren Kamelen heranziehende Karawane durch die verwischende Feuchtigkeit gelitten. Nur wenig erkennen wir von einem Reichtum geistvoller Züge, den Lucas hier ähnlich wie unter die Patriarchen in der Ferne des Himmels auf seinem ein Jahr früher entstandenen Leydener Jüngsten Gericht[196], ausgestreut hat.
Links wie rechts im Mittelgrunde erblicken wir die befriedigt mit dem geholten Wasser Abziehenden. Die linke, weitaus stärkere Gruppe wird beherrscht durch die Profilgestalt eines Mannes, der tapfer ausschreitend mit der rechten Hand eine umreifte hölzerne Kanne auf der linken Schulter festhält und mit dem nervigen linken Arm das Gewand aufschürzt. Die Haltung, die edlen römischen Züge, der graue, fließende Bart, die quellenden Locken, durch die sich ein Stirnband windet, der große Wurf der Gewandung, die[S. 163] Farbenwahl — graues Hemd, hellbrauner rot geränderter Rock, schwarze Strümpfe — das alles ist mit dem Schwung und der Vornehmheit eines Moretto angelegt. Neben ihm geht ein Junge, der mit andächtiger Freude die eifrig festgehaltene Wasserflasche betrachtet; beiden folgt eine Frau in scharfer Seitenansicht, auf dem Kopf eine edel geformte und ornamentierte Vase tragend, und ein fast verdeckter kleiner häßlicher Mann in verlorenem Profil. — Auf der rechten Seite erkennt man einen abgewendeten Mann mit der Tonne auf dem Rücken und eine stumpf zurückschauende junge Frau mit dem Kindchen an der Brust.
In dem ganzen Bilde, welch eine Fülle der Gesichte! Stundenlang kann man in dem Gemälde spazieren gehen. Zumal manchen Stichen gegenüber fällt das geringe Vorkommen stehender Typen, der Reichtum an persönlich durchgebildeten Köpfen auf. Lucas’ altgerühmte Kunst der Gewandbehandlung zeigt sich auf dieser Leinwand vielleicht am glanzvollsten. Seine unversiegliche Erfindungskraft beweist er schon in den unendlich mannigfaltigen Formen der Trink- und Schöpfgefäße. Einzelne Wiederholungen, wie der zweimal im gleichen Plan nach rechts ausgestreckte nackte Frauenfuß, die Nachbarschaft dreier Vierergruppen, die Aufeinanderfolge von je 5 Männern und Frauen in der Diagonale von links oben nach rechts unten, treten kaum ins Bewußtsein. Nicht nur an die volkreichen Bibelszenen des großen Lucassammlers Rembrandt, auch an den in guten Einfällen unerschöpflichen Leydener Jan Steen, der ja den nicht häufigen Stoff ebenfalls in einem Gemälde des Frankfurter Städel’schen Instituts behandelte, denkt man gerade vor diesem Bilde.
Im künstlerischen Entwicklungsgang des Lucas van Leyden gehört das Gemälde in jene lange Reihe figurenreichster Kompositionen, die sich etwa von den drei großen panoramenartigen Stichen — Bekehrung Pauli von 1509, Eccehomo von 1510, Calvarienberg von 1517 — bis zu der vielleicht spätesten Malerei des Meisters, der Petersburger Heilung des Blinden, hinzieht. Das schon bei Geertgen im Wiener Bilde von den Schicksalen der Gebeine Johannis des Täufers auftretende Bestreben, die Gestalten ohne einen willkürlich angenommenen Mittelpunkt, der Zufälligkeit des Lebens entsprechend, anzuordnen, hatte bei Lucas im Eccehomo und noch mehr im Calvarienberg schließlich dahin geführt, daß neben der Menge der prächtig gestellten Zuschauergruppen die eigentlichen Hauptpersonen fast verschwanden, oder, wenn sie im Mittel- oder Vordergrund verblieben, mit wenig Liebe behandelt wurden. So lassen uns im Stiche, »Der Tanz der Magdalena« von 1519, dem unser Gemälde in der Anordnung der gelagerten Vordergrundgestalten recht verwandt ist, Magdalena selbst und ihr Partner ziemlich gleichgültig. Noch im Vergil im Korbe von 1525 muß man den Helden der ganzen Anekdote fast mit der Laterne suchen, und im Leydener Jüngsten Gericht, jenem merkwürdigen Versuche, das Wunderbarste aller Ereignisse mit naturalistischen Mitteln darzustellen, ist der Weltenrichter eine der am wenigsten interessierenden Gestalten. Hier dagegen wird, bei freiester Gruppenverteilung, bei einer recht eigentlich zentrifugalen Komposition, die Aufmerksamkeit[S. 164] sofort auf die Führer des Volkes gelenkt und Moses und Aaron sind die fesselndsten Erscheinungen des Bildes. In der Heilung des Blinden endlich macht Lucas Christus und Bartimeus auch räumlich zum Mittelpunkte des Ganzen und setzt zu Beiden die zahlreichen Nebenpersonen mit größter Kunst in die lebhafteste Beziehung.
VON DR. OTTO LAUFFER.
Der Nürnberger Herd (lat. focus, foculare, focarium[197]) tritt
uns in allen bekannt gewordenen Fällen in einer Form entgegen, die
überhaupt einen Abschluß in seiner Entwicklung bezeichnet. Er ist
von Grund auf aus Backsteinen erbaut, wie wir denn auch schon in
Anton Tuchers Haushaltbuch (Bibliothek des Litterarischen Vereins in
Stuttgart CXXXIV. 1877. S. 101) zum Jahre 1513 die Bemerkung finden:
»Item adi 2 settember .. für kalg und 8 hertstain mein kuchenhert czu
pessern 2
 20 ₰.« Der Kern des Herdes
ist hohl, so daß man diesen Innenraum, zu dem der Zugang durch gewölbte
Öffnungen in den Herdwänden vermittelt wurde, dazu benützte, um
dortselbst einen Vorrat Brennholz aufzubewahren und zu trocknen (vergl.
Fig. 1, 2, 4
u. 5, ferner Boesch, Ein süddeutsches bürgerliches
Wohnhaus vom Beginne des 18. Jahrhunderts. Mitteilungen 1897. S. 62
Taf. IX.). Die erwähnte Öffnung ist an dem Herde des Puppenhauses B.
mit einer großen Holzthür verschlossen, E. hat eine zweiflüglige Thür
und bei D. verschließen gar vier große schwarz gestrichene Holzthüren
den inneren Herdraum.
20 ₰.« Der Kern des Herdes
ist hohl, so daß man diesen Innenraum, zu dem der Zugang durch gewölbte
Öffnungen in den Herdwänden vermittelt wurde, dazu benützte, um
dortselbst einen Vorrat Brennholz aufzubewahren und zu trocknen (vergl.
Fig. 1, 2, 4
u. 5, ferner Boesch, Ein süddeutsches bürgerliches
Wohnhaus vom Beginne des 18. Jahrhunderts. Mitteilungen 1897. S. 62
Taf. IX.). Die erwähnte Öffnung ist an dem Herde des Puppenhauses B.
mit einer großen Holzthür verschlossen, E. hat eine zweiflüglige Thür
und bei D. verschließen gar vier große schwarz gestrichene Holzthüren
den inneren Herdraum.
Nur ein Herd ist mir bekannt geworden, der die angegebenen Eigenschaften nicht aufweist. Derjenige nämlich im Frhr. von Fürer’schen Schlosse zu Haimendorf, der eine Breite von 1,40 m., eine Länge von 2,90 m. und eine Höhe von 0,58 m. besitzt, hat eine Herdplatte die aus einem einzigen großen Sandsteine besteht, der hinten auf einer Mauerleiste, vorn aber auf drei Sandsteinfüßen ruht (vergl. Fig. 6), wodurch der Herd eine tischförmige[S. 166] Gestalt bekommt, ähnlich wie der siebenbürgisch-sächsische Herd eines Bauernhauses in Grossau, den J. R. Bünker in den »Mitteilungen der Anthropologisehen Gesellschaft in Wien« XXIX. S. 219 beschrieben und Fig. 83 abgebildet hat.
In allen übrigen Fällen fand sich eine gemauerte Herdplatte, deren äußerer Rand, abgesehen von der Wandseite, mit einer Holzleiste von etwa 20 cm. Breite eingefaßt ist. Diese Holzumrahmung ist bei A. (vgl. Fig. 4) C. und D. blendend weiß angestrichen, und man kann sich denken, daß die Hausfrau ihren Stolz darein setzte, die Kante stets blitzsauber zu erhalten[198].
Nun aber zeigen schon Fig. 4 u. 5, daß jene Kante zum Teil eine Unterbrechung erleidet durch ein aus Backstein aufgeführtes Herdmäuerchen, welches um eine Backsteinhöhe, also ca. 8 cm., den Herdrand überragt. Bei B. legt es sich über die halbe Breitseite des Herdes, ähnlich wie es auch bei Bösch a. a. O. Taf. IX. an der linken Herdseite vorhanden zu sein scheint, bei D. läuft es über die ganze rechte Seite, bei A. (Fig. 4) liegt es an der Rückwand und springt noch um etwa ein Drittel der rechten Seitenwand vor. Auf diesem Vorsprunge ist es zu der Höhe von vier Backsteinlagen also ca. 32 cm. ausgewachsen und strebt, treppenförmig abgesetzt, mit vier Stufen zur Küchenwand empor. Ähnlich ist bei F. rechts und links ein dreistufiger Aufbau. Selbst bei H. (vgl. Fig. 5) wo schon ein neuer Abschnitt in der Entwicklung des Herdes sich darstellt, zeigen sich die Ausläufer des Herdmäuerchens, das nur bei E. fehlt.
J. R. Büncker hat dieses Herdmäuerchen auch im siebenbürgisch-sächsischen Bauernhause vorgefunden, wo es noch heute den alten Namen »willestein« führt. Jedenfalls ist es eine sehr alte Vorrichtung, und zufälliger Weise trifft eine der wenigen bekannt gewordenen Erwähnungen derselben für bayrisches Gebiet zu, wenn im 12. Jahrhundert »wihelstain« glossiert wird durch: »taedifer, lapis vel ferrum super quo ponunter taedae« (Schmeller-Frommann, Bayerisches Wörterbuch2 II, 882)[199]. Leider ist es mir nicht gelungen, neues [S. 167] Material zur Geschichte des »wihelstaines« ausfindig zu machen, und so muß ich mich begnügen, einiges von dem hier abzudrucken, was in Joh. Wolff’s »Vorarbeiten zum siebenbürgisch-deutschen Wörterbuche« (aus dem Nachlaß abgedruckt im »Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde« N. F. XXVII, 3. Heft 1897) sich darüber findet. Dortselbst heißt es auf Seite 648: »willestein (wiləštein, -štin) m. Herdstein, halbspannenhoher Block aus Lehm und Ziegelstücken an der Feuerstatt, auf welchen das vordere Ende der Brände gelegt wird; das hintere Ende liegt auf dem brantert[200]. Obwohl vielerorts verdrängt durch andere Ausdrücke, namentlich durch wiləštīsken und einfaches štīskən (Stösschen, An-, Aufsatz), die man zur Bezeichnung des Mäuerchens, an dem nichts von Stein ist, passender gefunden hat, und obwohl mit dem alten Ofen auch der Wilstein mehr und mehr verschwindet, so hat sich das Wort dennoch in vielen Gemeinden des alten Stuhlslandes bis heute behauptet;... In Deutschland ist das Wort, wie es scheint, erloschen; im 15. Jahrhundert muß es auch dort, gewiß in Mittelfranken, noch bestanden haben. Ein Weistum von Bacharach (zwischen Bingen und St. Goar am linken Rheinufer)[S. 168] bestimmt 1407: Wär es, daß einer einen anderen erschlüge, so soll der Schultheiss und ein Vogt sein Haus schliessen, und waz von farender habe da innen funden wurde vom wilstein an bis zur fursten usz, daz sij der herren (Grimm, Weist. 2, 217 f.)... In anderer beachtenswerter Form kennen wir den Ausdruck seit kurzem auch aus der Schweiz. Der Herd ist im sogen. burgundischen Hause meist von ungefähr zwei Fuß hohen Steinplatten eingefaßt. An dieser Einfassung ist in einigen Dörfern des Kantons Bern die Benennung bilstein haften geblieben... Darnach stammt der Ausdruck aus einer Zeit, wo auch im deutschen Hause wie hierlands in der Hirten- und Zigeunerhütte heute noch die blanke Erde (der iərən) die Feuerstätte war und ein Steinkreis den Feuerraum umschloß.«
Diese Auslassungen sind für ein Wörterbuch geschrieben und gehen aus von dem Interesse für das Wort. Zu der Geschichte des Wilsteines als Gegenstand bleibt uns jedoch noch manches zu bemerken. Zunächst betone ich im Gegensatze zu Wolff nochmals, daß in den Puppenhäusern der Wilstein offenbar als aus Backsteinen aufgeführt durch die Bemalung charakterisiert wird, wie es denn überhaupt von vornherein nicht glaublich erscheint, daß eine mit -stein zusammengesetzte Bezeichnung an einem Gegenstande sich hätte halten sollen, »an dem nichts von Stein ist«. Wir werden im Gegenteil nachher sehen, wie sich alsbald eine neue Bezeichnung durchringt, nachdem durch eine Änderung im Material auch der alte Name unzutreffend geworden war. Ferner kann ich die Frage nach dem Zwecke des Wilsteines durch Wolffs Bemerkungen noch nicht für endgiltig erledigt halten. Es ist leider nicht ersichtlich, ob Wolff die von ihm beschriebene Benützung selbst gesehen hat, nach der das eine Ende der Brände auf dem Wilstein, das andere auf dem Feuerbock liegt. Eine Bemerkung darüber wäre sehr wünschenswert gewesen, mir wenigstens scheint diese Feuerungsart kaum glaublich zu sein, weil sie wegen allzustarken Zuges entschieden höchst unvorteilhaft gewesen wäre. Die einfachsten Sparsamkeitsrücksichten weisen darauf hin, daß man das eine Ende der Holzscheite auf den Wilstein legt, das andere aber unmittelbar auf den Feuerungsboden, das ist in unserem Falle die Herdplatte. Diese Art, die einzelnen Brände einseitig hoch zu legen, ist meines Wissens in der That überall gebräuchlich, wo man am offenen Feuer kocht. Natürlich ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß man in der ganzen Reihe der Brände abwechselnd das rechte und dann das linke Ende der einzelnen Scheite hochlegt, indem man dem Wilstein parallel noch einen Feuerbock oder einen einfachen Stein aufstellt[201].
So viel scheint mir dagegen mit Sicherheit aus Wolff’s Zusammenstellungen hervorzugehen, daß wir in dem Wilstein den Vorläufer des Feuerbockes zu erkennen haben, der dadurch charakterisiert ist, daß er[S. 169] als Teil des Herdes mit dem Mauerwerk desselben organisch verbunden war. Wenn nun zu dem Wilstein noch ein zweiter durch irgendwelche praktische Bedürfnisse erforderter, in der oben geschilderten Weise parallel zu ihm aufgestellter Stein als Scheitunterlage hinzu kam, so ging auch auf diesen, der jetzt frei beweglich war, die Bezeichnung »Wilstein« über, ja sie wurde sogar — sprachlich betrachtet mit Unrecht — auch angewandt auf das »ferum, super quo ponuntur taedae«, wie die oben angeführte Glosse beweist. Wie lange es dauerte, bis sich für dieses Eisen die Bezeichnung »Feuerbock« in Nürnberg festsetzte, weiß ich nicht. Ich werde später darauf zurückkommen. Unter dem Namen des »Feuerbockes« versah das neue Eisen die Funktionen des »Wilsteines«, der seinen alten Namen bewahrte, im übrigen aber, zumal wo zwei Feuerböcke auf dem Herde standen, nutzlos wurde. Nutzlos, so scheint es mir, wurde der alte Wilstein Jahrhunderte lang fortgeerbt, und er konnte sich nur deshalb so lange erhalten, weil der Herd sich des in der Einleitung geschilderten konservativen Verhaltens unserer Vorfahren zu erfreuen hatte, die mit ihm gewisse rechtliche Begriffe verbanden, wie die aus dem Bacharacher Weistume von Wolff zitierte »zweifellos formelhafte Wendung«: vom wilstein an bis zur fursten usz zur Genüge beweist.
Diese rechtlichen Rücksichten wurden — was übrigens auch durchaus nicht überraschend ist — noch durch religiöse Beziehungen unterstützt. Eine bei Schmeller a. a. O. angeführte, aus dem 14. Jahrhundert stammende Glosse »lar: wihelstain«, scheint mir dafür beweiskräftig zu sein. Zwar ließe sich einwenden, daß lar in diesem Falle nur schlechthin »Herd« bedeute, dagegen ist jedoch zu bemerken, daß dann »wihelstain« geradezu die Bedeutung des »Herdes« angenommen haben müßte, was anderweitig nicht bezeugt ist, vor allem aber spricht der Umstand dagegen, daß an der betreffenden Stelle auch »focus: fiurstat« besonders aufgeführt ist. Man müßte hier also bei lar die mythologischen Beziehungen empfinden, — vergl. lares und penates ahd. hûsgota oder herdgota. Graff 4, 151 — und daraus, daß man es mit wihelstain glossierte, erhellt, daß auch der Wilstein der Träger solcher mythologischen Beziehungen war (s. o. S. 166 Anm. 12.)
Man sieht, die wenigen Erwähnungen des Wilsteines gruppieren sich doch so glücklich zu einander, daß wir über Zweck und Bedeutung desselben eine Reihe von Vermutungen aufstellen können, die den Vorzug großer Wahrscheinlichkeit besitzen. Alles jedoch klärt sich nicht, denn die Frage muß unbeantwortet bleiben, welchen Zweck der oben geschilderte treppenförmige Ausbau des Wilsteines (vgl. Fig. 4) gehabt habe. Die Möglichkeit, daß er als Untersatz für die erste Form des Bratspießlagers gedient hätte, der wir später begegnen werden, und dessen höhere oder niedere Aufstellung er reguliert hätte, daß er dann später nutzlos geworden, aber gleich dem eigentlichen Wilstein gewohnheitsmäßig beibehalten wäre, diese Möglichkeit will ich als eine sonst nicht zu begründende Vermutung hier nur andeuten. —
Die einfache Herdplatte genügte nun den Ansprüchen der Kochkunst nicht auf die Dauer, schon am Ausgange des Mittelalters muß eine Ergänzung des einfachen Herdes vorgenommen sein, die in größeren Küchen wenigstens seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts des öfteren angetroffen wird: zu der Herdplatte kam, entweder unmittelbar auf dieselbe aufgesetzt, oder doch dicht an den Herd herangebaut, ein Backofen. Zwar ist das Backen von allerlei Speisen im Ofen gewiß so lange bekannt, als es überhaupt Bäckeröfen gab, aber diese großen Backöfen waren früher auch wohl die einzige Gelegenheit, mit der man gebackene Speisen bereiten konnte. In manchen Gegenden Deutschlands werden ja heute noch die seltenen Festbraten beim Bäcker gebacken[202], und bis auf diesen Tag schickt jeder Nürnberger sein Spanferkel zum Bäcker, weil die eigene Bratröhre entweder gar nicht oder nur mit übermäßig starkem Feuerungsverbrauch zu der nötigen intensiven Wärme erhitzt werden kann. Diese Abhängigkeit vom Bäcker war aber auf die Dauer für größere Küchenansprüche unerträglich, und so entstanden die kleineren Bratöfen in der Küche. Schon in dem, aus einer Würzburger Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts entnommenen »Buche von guter Speise« (hrsg. Bibliothek d. Lit. Ver. Stuttgart. IX. 1844) findet sich so oft die Bemerkung: »schiuzzez in einen ofen und laz in backen«[203], daß man versucht ist, schon für jene Zeit die Möglichkeit eigener Küchenbacköfen anzunehmen, wie denn ein Jahrhundert später, im Jahre 1450, nach der von Meringer und Bancalari angezogenen Stelle aus Aeneas Silvius die Unterscheidung von Back- und Stubenöfen in Österreich bezeugt ist[204].
Wenn allerdings Anton Tucher an der schon oben zitierten Stelle zum 2.
Sept. 1513 (a. a. O. S. 101/2) notiert: »fur kalg und 8 herdstain mein
kuchenhert czu pessern 2
 20 ₰«, für ein taglun
dem Kuncz stainmecz, auch mein ofenschlott czu pessern, thut alles 7
20 ₰«, für ein taglun
dem Kuncz stainmecz, auch mein ofenschlott czu pessern, thut alles 7
 ,
»mee darein 2 grosze eiszne ofenplech 4
,
»mee darein 2 grosze eiszne ofenplech 4
 5 ₰«[205] so scheint mir doch wegen der Art, wie Tucher sich
ausdrückt, fraglich zu sein, ob die ofenplech zu dem kuchenhert
gehörten. A. Schulz, a. a. O. S. 114 und ebenso Grimm W. B. VII, 1162
halten freilich die Zusammengehörigkeit für so selbstverständlich, daß
sie die nicht cursiv gedruckte Stelle ruhig streichen, ohne auch nur
die Lücke irgendwie anzudeuten. Für das folgende Jahr 1514, welches
als Druckjahr des Straßburger Hausratgedichtes angenommen wird,
haben wir dann aber einen sicheren Beleg, wenn es dortselbst fol. c. Ia
(Hampe a. a. O.) heißt:
5 ₰«[205] so scheint mir doch wegen der Art, wie Tucher sich
ausdrückt, fraglich zu sein, ob die ofenplech zu dem kuchenhert
gehörten. A. Schulz, a. a. O. S. 114 und ebenso Grimm W. B. VII, 1162
halten freilich die Zusammengehörigkeit für so selbstverständlich, daß
sie die nicht cursiv gedruckte Stelle ruhig streichen, ohne auch nur
die Lücke irgendwie anzudeuten. Für das folgende Jahr 1514, welches
als Druckjahr des Straßburger Hausratgedichtes angenommen wird,
haben wir dann aber einen sicheren Beleg, wenn es dortselbst fol. c. Ia
(Hampe a. a. O.) heißt:
Der Herd in Haimendorf (Fig. 6) sowohl wie auch derjenige auf dem von Boesch a. a. O. Tafel IX. reproduzierten Blatte zeigen diese Erweiterung, der erstere außerdem noch einen eingemauerten Waschkessel, der letztere noch einen Aufsatz, den ich für eine Aschengrube halten möchte. Auch »Die Nürnbergische wohl unterwiesene Köchin. Nürnberg. G. N. Raspe 1779« setzt den Backofen offenbar als weit verbreitet voraus, sie behandelt das[S. 172] Braten am Spieß oder im »Oefelein« als gleichwertig, wenn sie z. B. S. 480 bei der Vorschrift, »Einen Pohlnischen Braten zu machen« sagt: »stecke ihn an einen Spiesz oder brate ihn im Oefelein«. Noch heute heißt das mit dem Sparherde verbundene Bratrohr bei Nürnberg das »Ufla«[206].
Nach alle dem würde ich immerhin zweifelhaft sein, ob ich mich der von J. R. Bünker, a. a. O. S. 207 — bei der Beschreibung des dortselbst unter Fig. 62 abgebildeten Herdes — ausgesprochenen Ansicht anschließen sollte, wo es heißt: »Der im Hintergrunde des Herdes links stehende Branntweinbrennkessel und die rechts stehende Aschengrube sind neue Zuthaten«. Oder wenn die Erhaltung der betr. Objekte ihr kurzes Alter klar erwiese, so würde sich wenigstens die Frage erheben, ob sie nicht auch in früherer Zeit schon möglich gewesen wäre, was mir nach den obigen Ausführungen durchaus nicht unwahrscheinlich ist. —
Den interessanten Herd des Puppenhauses H bilde ich in Fig. 5 ab. Ungefähr ein Drittel der Herdfläche ist mit einer Eisenplatte (a) überdeckt, die von einer größeren Kupferplatte (b) umschlossen ist, welche den ganzen übrigen Teil der Herdfläche bedeckt. Der Wilstein (c) umfaßt in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise die Wandseite des Herdes. An dieser Seite ist auch — und das scheint mir das Wichtigste an diesem Herde zu sein — der Bratofen in das Innere des früher völlig hohlen Herdraumes verlegt: d. ist die Öffnung der Bratröhre, e. das Feuerloch und f. der Aschenkasten. In der hinteren Ecke der Kupferplatte b. bildet g. das Loch für den Rauchabzug. Deutlich sieht man hier die Ansätze zu der neuen Entwicklung, die das Erscheinen des modernen Sparherdes vorbereitete. — An der inneren Seite von c (oberhalb der Bratröhre d) befindet sich ein Krampen, dessen Bestimmung mir nicht klar ist. Aus Rücksicht auf ihn ist an der entsprechenden Stelle der Eisenplatte a ein viereckiger Einschnitt ausgespart, damit sie beim Abheben ungehindert über den Krampen hinweg gleiten kann. —
Von den übrigen Teilen der Herdausrüstung bleibt mir nur noch wenig zu sagen. Über den Herd, der bei A. E. G. und in Haimendorf in der Mitte der Wand, bei B. C. D. und F. in einer Ecke der Küche steht (vgl. auch Fig. 1 u. 2), spannt sich die Kutten (vgl. Schmeller I, 1312), der weite Rauchmantel[207] (infumibulum[208]), der in Haimendorf an seinen beiden vorderen Ecken noch durch eine von der Decke herabsteigende Eisenstange getragen wird. Um den Rauchmantel ziehen sich mehrere Holzrahmen zum Aufstellen von Kochgeschirren, ebenso finden sich bei D. und E. an der unteren inneren Kante des Rauchmantels eine Reihe nach innen vorstehender Holzpflöcke zum Anhängen von Gerätschaften. — Erwähnen will ich wenigstens eine Stelle aus Grimm, W. B. II, 296, wo es heißt: »brände heißen auch die zwei hölzer im rauchfang, woran man das fleisch hängt«. Ich habe den Namen hier freilich nicht konstatieren können.
Vom Rauchmantel aus steigt der Rauch in den Schlot[209]. Derselbe ist in den Steinhäusern von Stein, wie denn Anton Tucher (a. a. O. S. 101) im Jahre 1513 seinen Schlot vom Steinmetzen ausbessern läßt, in Holzhäusern aber hat sich der hölzerne Schlot sehr lange erhalten. Heyne hat schon auf die von Schmeiler II, 537 zitierte Würzburgische Feuer-Ordnung verwiesen, die im Jahre 1721 erlassen und noch 1790 erneuert wurde, nach der die hölzernen Schlõte zusammen mit den Strohdächern verboten wurden.
Hölzern wie vielfach der Schlot ist nun auch das Ofenrohr, das in den drei angezogenen Nürnbergischen Dichterstellen (s. o. pg. 130–132) sich findet, und das von der »Haushalterin« pg. 202 ausdrücklich unter den Geräten »von Holtz-werck« genannt wird. So fügt es sich denn auch ganz gut in die Reihe der übrigen Holzgeräte ein, wo es A. Schultz (a. a. O. S. 118) nicht in den Zusammenhang zu passen schien[210]. Gerade das »Oefelein«, der Bratofen, hatte diesen bis zum Ansatz des Schlotes oder auch nur ein Stück an der Wand sich heraufziehenden Rauchabzug (vgl. Boesch a. a. O. Taf. IX) sehr nötig, da es sonst wohl an dem wünschenswerten Durchzuge gefehlt hätte. Einen eigenen Schornstein brauchte das Ofenrohr natürlich nicht, sondern es ließ seinen Rauch mit durch den Herdschlot aufsteigen, eine Einrichtung, die völlig dem üblichen Gebrauche entsprach, der sogar den Rauch von den Feuerstellen dreier verschiedener Stuben in einen Schlot leiten konnte, wie es z. B. für Freising schon im Jahre 1335 bezeugt ist (vgl. Heyne, a. a. O. S. 240 Anm. 109).
Neben Herd und Öfelein steht nun — nicht nur zu Heiz- sondern auch zu Kochzwecken verwandt — die unter dem Eisenwerk aufgeführte »Glut- oder Kohlpfanne« (lat. arula, batilla, foculus, ignitabulum), die ein sehr häufig genanntes Gerät ist[211]. Außer den eisernen muß es aber auch schon seit alters solche aus Thon gegeben haben, der Name Glut- oder Feuerhafen, der des öfteren bezeugt ist (Grimm W. B. III, 1593), beweist das, denn »unter hafen ohne näheren adjectivischen zusatz versteht man in der regel nur den irdenen topf, wie man auch bei topf zunächst an einen irdenen denkt«[212]. Ebenso kann man die Bezeichnung »glut-scherb«, die für Nieder-Altaich bezeugt ist (Dieffenbach 52b unter arula) zum Beweise anführen, allein es bedarf dessen kaum, denn Dürers bekannter Stich vom Jahre 1514 »Melencolia« zeigt am linken Rande deutlich einen mit einem Handgriffe versehenen irdenen[S. 174] Feuertopf, über dessen Glut ein Schmelztiegel aufgestellt ist, und bis heute haben sich die irdenen Gluthäfen im Gebrauche der Nürnbergischen Marktfrauen erhalten. Denjenigen in der Küche von Haimendorf bilde ich Fig. 7 ab.
Die eisernen Glutpfannen treten uns in zwei verschiedenen Formen entgegen. Die erste finden wir z. B. bei A. (vgl. Fig. 8.) Der eigentliche Kohlenkasten, an den Seiten mit Luftlöchern versehen, hat innen einen Rost, auf dem die Kohlen liegen, und ist oben mit einem Gitterwerk zum Aufsetzen der Häfen ausgestattet. Um zu verhüten, daß die durch die Luftlöcher fallende Asche das Zimmer beschmutzt, steht der mit einem hölzernen Handgriffe versehene Boden des Kohlenkastens an den Seiten über — ähnlich wie bei unseren Vogelbauern —. Der Kasten ruht auf vier Beinen, die unten umgebogen sind, und an den oberen Enden, blattförmig ausgezogen, der Pfanne eine Art Bekrönung verleihen. Dieser Blattschmuck — künstlerisch mehr oder weniger vollendet — scheint ein durchgehendes Charakteristikum dieser Glutpfannen zu sein, er findet sich noch bei B. und G., sowie in der Küche des Museums, ferner in etwas veränderter Form bei der auch sonst abweichenden Glutpfanne von C. (vgl. Fig. 9.)
Die zweite vornehmere Form der Glutpfannen, die gewiß weniger der Küche als dem Wohnzimmer angehört, wird repräsentiert durch ein im Nürnberger Saal des Museums (Zimmer 43) befindliches Exemplar (Fig. 10). Dasselbe besteht in einem Kohlenbecken mit blumenförmig angeordneten Luftlöchern — an anderen Exemplaren sind sie weniger dekorativ eingeschnitten — und mit zwei am oberen Rande angebrachten Tragringen von Messing. Dieses Becken wird eingesetzt in eine, auf einem dreibeinigen Ständer ruhende Krone, die ihrerseits zwei Tragringe und außerdem drei nach außen herabhängende blattförmige Stifte besitzt. Die letzteren können über das eingesetzte Kohlenbecken herübergeklappt und als Unterlage für einen Kochtopf benützt werden. — Eine zweite ähnliche Pfanne befindet sich in demselben Zimmer, schließlich eine sehr schlicht gehaltene bei B. —
Nicht zum Kochen, sondern nur zum Wärmen bezw. zum Warmhalten der aufgetragenen Speise dienen die Wärmebecken (franz. réchaud)[213]. Ein sehr einfaches, in Messing ausgeführtes Beispiel derselben befindet sich in der Küche des Albrecht-Dürer-Hauses in Nürnberg. Ich bilde es unter Fig. 11 ab.
Bei den einfachsten Herdgeräten, nämlich bei denjenigen, die zur Bereitung und Unterhaltung des Herdfeuers und zur Bedienung des Herdes benützt werden, ist ein formales Interesse meist kaum vorhanden, so daß es genügt, ihre Namen zusammenzustellen: Von dieser Zusammenstellung selbst glauben wir aber deshalb hier nicht abstehen zu sollen, weil gerade unter den Herdgeräten so viel Namen und Formen sich zeigen, daß es ohne eingehende Forschung oft schwer sein wird, die Zusammengehörigkeit von Gerät und Benennung festzustellen.
Neben dem fächerförmigen Wedel (foculare) und dem Blasbalg (lat. follis, folliculus, sufflabulum, sufflatorium, foculare, flabellum, flabrum, venticapium)[214], den schon eine Miniatur des 14. Jahrhunderts in der noch heute üblichen Form darstellt[215] erscheint zunächst die Kolhenschaufel (lat. pala, thuribulum, infurnibulum, batillus)[216], für die Grimm W. B. V, 1589 schon in einem rheinischen Vocabularium des 15. Jahrhunderts einen Beleg findet. (Vgl. Fig. 2: an die verspringende Herdecke gelehnt.) Die Feuerzange (lat. forceps, tenacula, tanalia)[217] dient zum Anfassen der glühenden Kohlen, ihre Gestalt entspricht in allen mir bekannt gewordenen Fällen völlig derjenigen auf Fig. 3 und — besonders deutlich — auf Fig. 2, wo sie über den Herdrand gelegt ist, sowie derjenigen, die Meringer in den »Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien« XXI, S. 125 in Figur 143 abgebildet hat. In der Form ihr durchaus gleich, nur kleiner, ist die Bratwurstzange, die man infolge dessen leicht mit ihr verwechselt, zumal wenn es sich um die Miniaturformen der Puppenhäuser handelt.
Der Feuerhaken[218] tritt uns in B. in der Form entgegen, die Fig. 12 wiedergibt. Er ist dort ganz aus Eisen, sein Griff läuft in eine Tülle aus, die am Handende mit einer Öse einen Ring zum Aufhängen trägt. Die Ofenkrücke (tractula, rutabulum, fornaculum, fornalium) ist nach Folz (s. o. S. 131) ein Gerät, »da mit mons feir zw samen ruck.« Sie ist schon lange in Gebrauch und wird bereits ahd. erwähnt[219]. Sie besteht aus einer Stange, die am einen Ende durch ein Brett von der Form eines Kreissegmentes hindurchgetrieben ist, und noch heute wird sie — zumal vom Bäcker — zum Räumen des Ofens benutzt[220], oder auch um die Glut zum aufbewahren zusammenzuschieben, wie Bancalari aus Berchtesgaden berichtet[221]. Nicht so[S. 176] alt wie die Ofenkrücke scheint die Ofengabel zu sein. Ich habe im mittelalterlichen Latein keine eigene Bezeichnung dafür finden können. Sie wird vielmehr gleich der Ofenkrücke mit rotabulum übersetzt, obwohl aus der Zusammensetzung mit -gabel, die die Form ja deutlich beschreibt, hervorgeht, daß es sich um ein ganz anderes Gerät handelt[222]. An einer anderen Stelle wird sie gleich dem Feuerbock mit audena bezeichnet[223].
Von der Ofengabel wohl zu trennen ist die Hafengabel, die Grimm, W. B. nicht kennt, und von der A. Schultz a. a. O. S. 117 mit Unrecht sagt, sie diene dazu, das Fleisch aus den Töpfen herauszunehmen. Es handelt sich dabei um das Gerät, das J. R. Büncker auch in der deutschen Heanzerei in Westungarn unter dem Namen »Fua’gåp’l« gefunden und in den »Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien«. XXV, S. 122 durch Fig. 173/4 abgebildet hat, und es dient dazu, mit seinen beiden Zinken die Kochhäfen an ihrem Henkel zu fassen und über das Herdfeuer oder in den Ofen zu schieben. Die Hafengabel in Haimendorf besteht aus einer eisernen Gabel — mit zwei 20 cm. langen Zinken und einer 12 cm. langen Tülle — und aus einem Holzstiel von 1,25 m. Länge, die von G. dagegen ist ganz von Eisen, ihr Stab ist vierkantig, an einer Stelle jedoch 1¼ mal um sich gedreht, eine Vorrichtung, die wohl verhüten sollte, daß die Stange sich beim Aufheben eines schweren Hafens von selbst verdrehen möchte. Am Griffende ist der Stab zu einem Öhr umgebogen. Den zu der Hafengabel sich gesellenden »Ofenwagen«, den Büncker a. a. O. beschreibt, habe ich nicht gefunden. Er wird dazu benützt, um den mit der Hafengabel gehaltenen Hafen von der Herdplatte aus durch das Mauerloch in die Röhre des in der Stube befindlichen Ofens hineinrollen zu lassen. —
Ein Gerät, über welches etwas mehr zu sagen ist, stellt sich in dem Kesselringe dar, welcher Name des öfteren belegt ist, ohne daß es doch bislang völlig klar geworden wäre, um welchen Gegenstand es sich dabei handle. Der Grund liegt darin, daß der Name Kesselring offenbar für zwei verschiedene Geräte zugleich benützt worden ist. Inbetreff des einen derselben ist es kein Zweifel, daß es sich dabei um einen aus Stroh geflochtenen Ring handelt, welcher dem vom Feuer abgesetzten fußlosen Kessel als Unterlage zu dienen und ihm einen festen Halt zu geben hatte, wie es eine von Grimm W. B. V, 627 angeführte Stelle beschreibt: »und da es kaum gar, satzte man den kessel auf einen ströhernen kesselring, vater, mutter und kinder drum herum, und aßen das ganze kalb auf einmal auf.« Nur mit der Vorstellung dieses strohernen Ringes läßt es sich meines Erachtens auch vereinigen, daß Fischarts Gargantua 74a von den spanischen Halskrausen, sagen kann: »(die frau) nehet ihm reine (leinene) krägen mit toppelkrösigen kesselringen«, oder daß Grimmelshausen den Kesselring wie einen Panzerkragen verwenden lassen kann: Simplicissimus I, 241, »der kesselring gerieth mir in die händ, den hieng ich an den hals.«
Dagegen würden jene beiden Stellen geradezu unsinnig sein, wenn man annehmen wollte, daß der Kesselring eine Art von Kesselhaken sei, weil ein von Grimm a. a. O. zitiertes Vocabular schreibt: »cacabus hale vel rink«. Man vergleiche nur einmal bei Dieffenbach a. a. O. 86b, wie cacabus als Bezeichnung für alle möglichen Geräte benützt wird. Wenn man sieht, wie es dort wechselnd mit kachel, hafen, deckel, kessel, kesselhaken, kelter glossiert ist, so wird man nicht mehr im Zweifel sein, daß die eben dort sich findende Glosse: hale vel rinck nur besagen soll, daß cacabus die beiden verschiedenen Geräte, sowohl die hale wie den rinck bezeichnen könne. Nicht aber wird man mit Grimm a. a. O. herauslesen wollen, daß hale und rinck zwei verschiedene Namen desselben Gerätes seien. Die Schwierigkeit ist nun aber noch dadurch vermehrt worden, daß Stieler in seinem großen Wörterbuche: »Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs .. gesammelt von dem Spaten. Nürnberg. Joh. Hofmann 1691« Sp. 1649 ebenfalls für den[S. 178] Kesselring einen lateinischen Ausdruck setzt, den er sonst für den Kesselhaken verwendet. Dort schreibt er: »keszelring, climacter, de quo suspendunter lebetes,« während er Sp. 760 sagt: »haͤngel siue haͤnkel quoque est climacter, instrumentum in gradus scansile, de quo ahena et lebetes suspendimus. dicitur etiam alibi Kajutte«, woraus mit Sicherheit hervorgeht, daß climacter, ein Ausdruck, für den ich weder bei Du Cange noch bei Dieffenbach Belege finde, die Bedeutung des Kesselhakens hat.
Jedenfalls ersieht man aus diesen beiden Stellen, daß thatsächlich dieselben lat. Namen für Kesselhaken und Kesselring gebraucht wurden, und doch ist auch das Zweite mit »Kesselring« bezeichnete Gerät etwas durchaus anderes als ein Kesselhaken, es ist nämlich der Henkel, mit dem der Kessel an den Kesselhaken angehängt wird. Dieses zu konstatieren, sind wir durch die gütige Hilfsbereitschaft des Herrn Oberstleutnant Kindler von Knobloch-Berlin befähigt worden, der uns die mit Fig. 13 und 14 wiedergegebenen Skizzen der Wappen des Colmarer Geschlechtes Kesselring und des Überlinger Geschlechtes Kessenring freundlichst mitgeteilt und folgende Notizen hinzugefügt hat. Ad. Fig. 13: »Ludwig Kesselring von Nidernhardt (wohl richtiger K. zum Niederhoff, wie die Familie sonst genannt wird) wurde von Kaiser Rudolf II. d. d. Prag 1604. 2. 8. unter Besserung seines Wappens (durch gekrönten offenen Helm) in den Adelstand erhoben. (Akten im k. k. Adelsarchiv in Wien; Wappen im dortigen Wappenbuche II fol. 89a). Denselben Schild zeigt schon das Siegel des Ludwig Kesselring, Obersten Meisters in Colmar 1488«. Ad. Fig. 14: »Jacob Kessenring erhielt vom Kaiser Karl V. d. d. Burgos in Castilien 1528. 3. 2. ein Wappen mit dem Lehen Artikel. In Schwarz ein mit den Vorderpranken einen roten Kesselring haltender goldener Löwe mit roter Krone und Zunge. Stechhelm: der Löwe wachsend. Helmdecken rotgolden. (Akten des k. k. Adelsarchivs in Wien. Das Original des Wappenbriefes befindet sich im Stadtarchiv Überlingen).«
Durch die beiden Wappen ist die Gestalt des Kesselringes sicher bezeugt, wir glauben auch aus ihnen entnehmen zu dürfen, daß er unabhängig vom Kessel als selbständiges Gerät betrachtet wurde. Um seine Verbreitung zu bestimmen, dürfte es von Nutzen sein, wenn wir hier wiedergeben, was uns Herr Schulrat Keszelring-Bayreuth in gütiger Bereitwilligkeit mitgeteilt hat, daß neben seiner aus Schlesien stammenden Familie ihm noch eine andere in Sachsen ansäßige Familie Kesselring bekannt sei, wie denn auch der Name in Thüringen verschiedentlich zu finden ist.
Dieses zweite als »Kesselring« bezeichnete Gerät dürften wir wohl, weil zum Kessel gehörig, in die Reihe der Kochgeräte zu rechnen haben, wir hatten uns hier jedoch damit zu beschäftigen, da das erstere, der Strohkranz, als Herdgerät anzusprechen ist. —
Als einfachere Herdgeräte sind hier noch ein paar solche zu nennen, die zur Versorgung und Instandhaltung des Herdes dienen. Der Stülp (repofocillum)[224], der Feuerdeckel, der des Nachts zum Schutze gegen[S. 179] die Feuersgefahr über die glühenden mit Asche bedeckten Kohlen gestürzt wird, ist wie schon sein Name anzeigt niederdeutscher Herkunft[225]. Das Museum besitzt einen solchen von friesischer Herkunft und einen zweiten — unbekannter Provenienz — von Messing in der »Küche.« Ob und wie weit dieses gewiß sehr praktische und nützliche Gerät in das oberdeutsche Gebiet eingedrungen ist, vermag ich nicht anzugeben. In unserem Puppenhause F. befindet sich jedoch ein solches Gerät, welches aus einem einviertelkreisförmig gebogenen Stück Messingblech mit zwei Füßen besteht, während jene beiden anderen Exemplare völlig der mit Handgriff versehenen Hälfte eines Messingkessels gleichen.
Der Besen (virgae, verriculum)[226] dient zum Abkehren der Herdplatte. Unsere Fig. 1 zeigt ihn deshalb neben dem Herde an die Wand gelehnt, wie ihn auch Marperger a. a. O. S. 686 bei den Herdgeräten unter dem Namen scopae aufführt[227]. Außer ihm wird der Flederwisch (scopulae plumeae)[228], der Gansflügel, zum Abkehren gebraucht, wie auch schließlich jeder beliebige Lumpenwisch (penicellum)[229] dazu benutzt wurde. »Ein pessen, strowisch vnd flederwisch« haben wir schon (S. 132) von Hans Sachs genannt gefunden. — Auf den ebendort wie auch von Folz erwähnten Panzerfleck gehe ich hier nur deshalb ein, weil A. Schultz a. a. O. S. 118 sagt, er sei in diesem Zusammenhange nicht zu erklären. Aus Hans Sachsens Worten geht deutlich hervor, daß er zu dem »spülstant« gehört, und so sagt denn Grimm W. B. VII, 1430 sehr richtig, er sei »ein stück von einem drahtpanzer, zum reinigen der Kochgeschirre gebraucht... baslerisch wird ein zum reinigen der pfannen gebrauchtes kleines drahtgeflecht noch harnischblätz genannt«. Auch Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel der heidnischen Vorzeit II, S. 112 nennt im alemannischen Hause »ein Stück Drahtpanzer, Harnischplatz genannt, womit man Pfannen und Kessel fegt.«
Der Leser verweile hier eine kurze Zeit zu flüchtiger Erinnerung, damit nicht vor der Fülle der Geräte, die uns vor Augen geführt werden, vor der Menge der Namen, denen wir begegnen, der Überblick verloren gehe. Wir hatten zunächst die verschiedenen Feuerstellen kennen gelernt, den Herd mit seinen Nebenerscheinungen und die Glutpfanne. Darauf sind uns die einfacheren Herdausrüstungsgegenstände bekannt geworden, ich möchte sagen »das kleine Herdgerät,« nämlich Wedel, Blasbalg, Kohlenschaufel, Feuerzange, Feuerhaken, Ofenkrücke, Ofengabel, Hafengabel, Kesselring, Stülp, Besen und[S. 180] Flederwisch. Wir wenden uns nunmehr dem »großen Herdgerät« zu, wenn ich diese Trennung beibehalten darf, das sind der Feuerbock, ferner die Gegenstände, die als Diener und Träger der Kochgeräte dienen, und schließlich diejenigen, die als Bratgeräte schon eine selbständige Haushaltsfunktion zu verrichten haben und an Bedeutung fast den Kochgeräten gleichstehen, mit denen sie nur deshalb nicht zusammengestellt werden können, weil die Kochgeräte ursprünglich alle zugleich auch zum Auftragen der Speisen benützt werden konnten, während die Bratgeräte — mit seltener Ausnahme — sich nicht vom Herde zu trennen pflegten und zum Auftragen besondere Serviergeräte nicht entbehren mochten.
Indem wir dem Feuerbocke unsere Aufmerksamkeit zuwenden, wollen wir es wagen, über denjenigen Gegenstand uns zu äußern, der in mehrfacher Beziehung wohl der wichtigste von allen Herdgeräten ist, der zum mindesten bislang am meisten das Interesse der Ethnologen in Anspruch genommen hat, der aber gerade deshalb noch vielfache Schwierigkeiten bereitet, weil seine Geschichte für uns durchaus noch nicht mit der wünschenswerten Klarheit zu erkennen ist. Was wir also hier bieten, erhebt nicht etwa den Anspruch, als abschließend zu gelten, wie denn überhaupt diese Ausführungen nur als Beiträge erscheinen wollen.
R. Meringer hat sein Urteil über das Alter des Feuerbockes in folgenden Worten ausgesprochen: »Eines, scheint mir, bleibt bei manchem noch Zweifelhaften: daß der Feuerbock eine Erfindung sehr alter Zeiten ist. Das ist mir die Hauptsache, und diese wird man gerne gelten lassen[230].« Diese Behauptung stützt sich mit Recht auf eine Anzahl von erhaltenen prähistorischen Feuerböcken, die Meringer zum Teil selbst abbildet[231], und die zum anderen Teile von M. Hoernes, Zur prähistorischen Formenlehre, besprochen und abgebildet sind[232]. Schon vorher hatte Meringer sein Forschungsergebnis formuliert mit den Worten: »Der Feuerbock ist in prähistorischer Zeit erfunden worden und ist nur von einem Teile der Germanen angenommen worden[233].« Für uns erhebt sich demnach die Frage: wann ist der Feuerbock nach Deutschland gekommen?
Im germanischen Norden hat es nie Feuerböcke gegeben[234]. Ein gemeingermanisches Gerät ist es also nicht, und auch die uns durch die angegebenen Nachweisungen bekannt gewordenen prähistorischen Feuerböcke stammen sämtlich aus Italien oder wenigstens aus Gegenden, die unter dem Einflüsse römischer Kultur standen. Das nördlichste Exemplar wurde im Flußbette der Sihl gefunden. Es scheint also völlig an Belegen dafür zu fehlen, daß der Feuerbock schon in prä- oder frühhistorischer Zeit in[S. 181] Deutschland vorhanden gewesen sei. Die erste Erwähnung finde ich in Karls d. Gr. Capitulare de villis vom Jahre 816, wo in Cap. 42 verlangt werden: »in supellectili villarum: vasa aerea, plumbea, ferrea, lignea, Andedi, andenae, cramaculi«[235]. Ein unanfechtbarer Beleg! aber leider vermag er uns fast nichts zu sagen, denn mit Recht wird sich alsbald die Frage erheben, ob hier wirklich eiserne Feuerblöcke gemeint seien. Schon die Nennung, von zwei Namen, die sonst beide als lateinische Bezeichnungen für den Feuerbock verwandt werden, macht uns stutzig. Es müssen doch zwei verschiedene Geräte gemeint sein! Ferner, wenn es auch klar ist, daß es sich um Geräte handelt, die im Gebrauche die Funktionen des »andena« genannten römischen Feuerbockes erfüllten, wer sagt uns, daß wirklich eiserne Feuerböcke gemeint seien? Jeder, der sich einmal mit Glossensammlungen beschäftigt hat, wird uns recht geben, wenn wir behaupten, daß mit andena ebenso gut wie der Feuerbock auch der Wilstein übersetzt werden konnte.
Die Erwähnung in dem Capitulare bleibt also immerhin ein höchst unsicherer Beleg. Ebenso ist auch die aus dem Jahre 1053 stammende Stelle bei Papias Lombardus: »andena, instrumentum ferreum foci« für Deutschland deshalb nicht zu verwerten, weil sie italienische Verhältnisse im Auge hat[236]. Die erste uns bekannt gewordene deutliche und sicher deutsche Erwähnung des Feuerbockes ist darum erst die aus dem 12. Jahrhundert stammende, oben auf Seite 166 mehrfach besprochene Glosse: »wihelstain, taedifer, lapis vel ferrum super quo ponuntur taedae«.
Wir haben früher auf Seite 168/9 die Ansicht ausgesprochen, daß in dem Wilstein der Vorläufer des Feuerbockes zu erkennen sei, und wir sehen mit Vergnügen, daß auch Meringer zu derselben Meinung gelangt ist, die er in die Worte faßt: »Bei dieser Art der Feuerung wird zuerst ein Holzscheit quer gelegt und die anderen werden rittlings über ihn gelegt. Das quer liegende Holzscheit kann durch einen Stein, eine gemauerte Leiste des Herdes, einen beweglichen Thonuntersatz vertreten werden. Das letzte Stadium dieser Entwicklung ist der Feuerbock, den auch der Kamin übernommen hat«[237]. Eben in die Zeit, wo in Deutschland dieses »letzte Stadium« erst kürzlich eingetreten war, muß unseres Erachtens die Wilsteinglosse fallen. Damit ist also unsere Ansicht ausgesprochen, daß in Deutschland erst um die Zeit des 11.-12. Jahrh. der Feuerbock den Wilstein aus dem Gebrauch zu verdrängen begonnen hat. Völlig verdrängt hat er ihn bis heute noch nicht, nur sehen wir die merkwürdige Erscheinung, daß er dem in manchen Gegenden nicht zu bezwingenden Alten hier und da seinen neuen Namen aufgezwungen hat. Meringer berichtet: »Mehrfach habe ich im Gebirge gemauerte Herdleisten gesehen, welche ebenfalls Feuerrösser genannt wurden. (Dazu Anm.: Levissohn hat auch bei Aussee in einer kaiserl. Holzknechthütte solche Stollen gesehen, die Feuerrösser genannt wurden.) Sonst thut ein Ziegelstein zur Not denselben Dienst«[238]. Nicht nur der am[S. 182] Herde festsitzende Wilstein, sondern auch das Bindeglied zwischen ihm und dem Feuerbock, der freibewegliche Feuerstein, wenn ich in diesem Zusammenhange so sagen darf, hat sich also erhalten, wie auch Bancalari — freilich nicht für Deutschland — bezeugt: »In der slavisch bewohnten Valle Resia, südlich Pontebba, benützt man steinerne roh behauene Feuerhunde«[239].
Das verkennen wir zwar durchaus nicht, daß ein glücklicher Fund vielleicht noch ältere Feuerböcke, deren deutscher Ursprung sicher bezeugt ist, zu Tage fördern und klar beweisen mag, daß schon Karls Capitulare nur den Feuerbock und nicht etwa den Wilstein meine oder nur westfränkische, höchstens rheinische Verhältnisse im Auge habe, aber soviel scheint uns sicher zu sein: wenn an der Stelle Baierns, wo die Wilsteinglosse geschrieben wurde, noch im 12. Jahrhundert der Feuerbock den Namen seines Vorgängers tragen konnte, so kann er unmöglich lange vorher dorthin gekommen sein.
Später finden wir den Feuerbock dann in ganz Deutschland verbreitet, wo er unter den verschiedensten Namen erscheint: als Feuerbock, Feuerroß, Feuerhengst, Feuerhund, Brantert, Brandeisen, Brandreide, Brandbock, Brandruthe etc.[240]. Auch in der mittelalterlich-lateinischen Litteratur ist er sehr oft genannt, wohl am meisten von allen Herdgeräten, und es ist uns gelungen — ohne drei zweifelhafte Ausdrücke und abgesehen von vielen Nebenformen — allein 23 verschiedene lateinische Benennungen des Feuerbockes ausfindig zu machen: andela, anderius, andedus, andasium, brandanale, branderium, caminale, canis, canteriolus, chenetus, chiminale, focarius, ignitabulum, incipiendium, epigergium, ipogirgium, lignigerium, lander, tressetus, tedale, tedarium, tedifera, tubolofola[241]. Außerdem nennt Grimm, W. B. III, 1589 den Feuerbock mit dem allgemeinen Ausdruck fulcrum, und nach Dieffenbach 493a wird auch repofocillum, sonst den Stülp bezeichnend, einmal mit brandysen vel -reyde glossiert. Igniferrum kann ich trotz Dieffenbach 285a: igniferrum, ignitabulum furysen nicht für den Feuerbock in Anspruch nehmen, weil sich[S. 183] ebendort die Glosse findet: Ignimen, igniferrum, ferrum cum quo perforatur aliquid.
Alle diese Erwähnungen dürften reichlich genügen, um den Gebrauch
des Feuerbockes in Deutschland während der letzten Jahrhunderte des
Mittelalters zu erweisen. Dennoch ist es sehr auffallend, daß Hans
Folz weder in dem Meistergesange noch in dem Spruchgedichte (s. o.
S. 130/131) den Feuerbock erwähnt[242]. Daß er ihn für selbstverständlich
gehalten hätte, kann man nicht als Grund anführen, denn er nennt
auch viele andere selbstverständliche Sachen, die noch dazu unter
den Herdgeräten bedeutend unwichtiger sind. Andererseits, daß er ihn
nicht gekannt hätte, scheint auch kaum glaublich zu sein, zumal wir
für das Jahr 1516 einen deutlichen Nürnbergischen Beleg haben. Damals
schrieb nämlich Tucher in sein Haushaltungsbuch[243]: »fur grosz eisen
in ofen, so man einhaiczt, die scheit vorn darauf zu legen, wigt 11
 dafür par bezalt 65 ₰«. Immerhin giebt auch diese
Stelle zu denken. Weshalb drückt sich Tucher — noch dazu in einem
Haushaltungsbuche, das doch nur seinem allerpersönlichsten Gebrauche
dienen sollte — so umständlich aus? Kannte er den für Nürnberg später
bezeugten Ausdruck »Feuerbock« noch nicht?
dafür par bezalt 65 ₰«. Immerhin giebt auch diese
Stelle zu denken. Weshalb drückt sich Tucher — noch dazu in einem
Haushaltungsbuche, das doch nur seinem allerpersönlichsten Gebrauche
dienen sollte — so umständlich aus? Kannte er den für Nürnberg später
bezeugten Ausdruck »Feuerbock« noch nicht?
Nach England scheint der Feuerbock erst in der Zeit des 14.–15. Jahrhunderts gekommen zu sein, wie wir im Anschluß an Wright glauben möchten. Derselbe vergleicht a. a. O. S. 162 die Vocabularien der Mitte des 13. Jahrhunderts mit denjenigen des 15. Jahrhunderts, und es zeigt sich dabei, daß erst in den letzteren sich findet: a »gobard«, explained in the MS. by ipegurgium.
Die Feuerböcke treten, besonders wenn sie in vornehmeren Häusern bezeugt sind, meist paarweise auf. Das gilt schon von dem auch noch in anderer Beziehung interessanten Bericht über die Küchen Pavias, den ungefähr im Jahre 1320 der Anonymus Ticinensis in seiner Schrift »De laudibus Papiae« lieferte: »Habent etiam ab utroque latere ignis instrumenta ferrea, pluribus necessitatibus apta, quae quia sub igne ponuntur, graece ypopiria, vulgariter autem ibi Brandanalia vocantur«[244]. Ebenso zitiert Du Cange I, 250 (Artikel anderius) eine Stelle vom Jahre 1376 aus einem Inventar S. Capellae Parisiensis: »Duo cheneti siue Anderii ferri«. Fünfzehn Jahre später, i. J. 1391, finden wir in dem Hausrat des Bischofs von Speier »in dem hofe zu Franckford«: In studorio domini: item 2 par brantreiden[245]. Noch das Inventar des Landauerklosters führt zwei Feuerböcke auf.
Kleinere Haushaltungen haben sich dagegen gewiß immer mit einem Feuerbock begnügt, und infolgedessen ist es ganz zutreffend, wenn Hans Sachs, der doch nur den nötigen Hausrat zusammenstellt, auch nur über »das fewer pöcklein« spricht.
Die Form der einfachen Feuerböcke ist leicht beschrieben. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei verschiedene Arten: den vierbeinigen und den dreibeinigen Feuerbock. Der erstere ist unzweifelhaft der ältere, alle die oben erwähnten prähistorischen (altitalischen und römischen) Exemplare sind vierbeinig. In historischer Zeit hat der vierbeinige Feuerbock an beiden Seiten je einen Bügel (vergl. Fig. 15), der dreibeinige dagegen hat den Bügel nur an der Seite, die mit zwei Beinen versehen ist. Der ersten Art, die sich auch auf Fig. 2 u. 3 darstellte, gehören fast alle uns bekannt gewordenen Nürnbergischen Feuerböcke an, nämlich die Exemplare von A. B. D. E. (zwei Exempl.), eins in der Küche des Museums (H. G. 5737) und schließlich dasjenige in Haimendorf. Mittelalterliche Abbildungen dieser Art habe ich ebensowenig wie Meringer (Mitt. d. Anthropol. Ges. Wien. XXI, 138a) ausfindig machen können, und auch die mittelalterlichen Schriftquellen sagen über die Form nichts aus.
Nur als eine — gewiß nicht häufige — Nebenart des vierbeinigen Feuerbockes zu betrachten, ist der große fünfbeinige, den Wright auf der Feuerstätte der großen Halle zu Penshurt (Kent) gefunden und a. a. O. S. 450, Nr. 290 publiziert hat. Nach jener Abbildung ist unsere Fig. 16 gezeichnet.
Die dreibeinige Form des Feuerbockes haben wir in Nürnberg überhaupt nicht unter den Herdgeräten gefunden. Zwei völlig gleiche als Kamingeräte verwendete Exemplare des 16.–17. Jahrhunderts, welche unser Museum besitzt, hat schon Meringer, a. a. O. XXI, S. 139, Fig. 167, abgebildet. Wir geben in Fig. 17 eine Darstellung davon. Diese Art, die bequemer als die vierbeinige an die Wand anzulehnen war, scheint mit Vorliebe für Kaminheizzwecke benützt worden zu sein. Havard, Dictionnaire hat in den Artikeln »andier« (I, 76 mit zwei Abb.) »chenet, chien de feu« (I, 818 ff. mit zehn Abb.) und »landier« (III, 239 mit vier Abb.) eine Reihe in Frankreich befindlicher, künstlerisch ausgeführter Exemplare des 14.-18. Jahrhunderts abgebildet, die sich aus deutschen Sammlungen wohl noch werden vermehren lassen[246]. Havards Anschauungen werden aus den Worten klar, die er unter Art. »landier« schreibt: »Au mot andier, on a pu voir que l’ustensile dont nous parlons remonte au moins au XIIIe siècle. Il est probable qu’il est encore plus ancien et qu’il vit le jour au moment où la cheminée quitta le centre de la cuisine pour venir s’ adosser à la muraille.« Damit ist zugleich ausgesprochen, daß Havard für Frankreich ein sehr hohes Alter der Feuerböcke annimmt. —
Wie dem Feuerbocke dann neben der Erfüllung seines eigentlichen Zweckes, die Scheite zu stützen, noch weitere Haushaltsfunktionen übertragen wurden, und wie er infolgedessen mannigfache formale Veränderungen und Erweiterungen erfuhr, darauf werden wir später zurückkommen. —
VON
DR. RICHARD GRUNDMANN.
(Hierzu Tafel VII.)
Zu den Gebieten kunstgeschichtlicher Forschung, die bisher noch wenig bearbeitet sind, gehört auch die frühmittelalterliche Holzplastik. Ist schon über die Geschichte der Steinskulptur für einzelne Zeiträume, besonders für das 14. Jahrhundert, noch nicht volle Klarheit gewonnen, während hier wenigstens für das 13. Jahrhundert in neuerer Zeit eifrige und gründliche Untersuchungen angestellt wurden[247], so liegen die Anfänge und die Entwicklung der Holzbildnerei fast ganz im Dunkel und erst vom 15. Jahrhundert ab beginnt die Geschichtschreibung sich ernstlich mit ihr zu befassen, was bei der hervorragenden Stellung dieser Kunst gegen den Ausgang des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts notwendig geworden war. Mag nun die geringe Beachtung, mit der die Kunstgeschichte bis jetzt an den Erscheinungen der frühmittelalterlichen Holzskulptur vorübergegangen ist, in der Handwerksmäßigkeit und Derbheit und in der geringen Anzahl der erhaltenen Denkmäler immerhin ihren Grund haben, zu bedauern ist doch, daß der Holzschnitzer der frühen Zeit dem Steinmetzen gegenüber vergessen wurde, denn der genaue Einblick in die Entwicklung dieses so reichen Kunstzweiges der Holzbildnerei fehlt dadurch. Selbst eine Geschichte der Holzskulptur in ihrer Blütezeit ist noch heute ein kunstgeschichtliches Desideratum und die wenigen einschlägigen Publikationen unserer Tage[248] sind immer noch Vorarbeiten dazu, während eine umfassende Darstellung derselben eine Aufgabe der Zukunft bleibt. Welch wichtige Resultate aber eine gründliche Einzelforschung auch für die Holzplastik noch zu Tage fördern kann, hat sich erst vor zwei Jahren gezeigt, als nachgewiesen werden konnte, daß Hans Multscher’s Altarwerk in Sterzing (1456–58) nicht, wie man früher glaubte, als Werk eines tiroler Meisters aus Innsbruck, sondern als das eines schwäbischen Künstlers aus Ulm stammt, wodurch gleichzeitig die überraschend hohe Entwicklung der Ulmer Kunst vor Schühlein, eine Zeit, für welche bis dahin sichere[S. 186] Anhaltspunkte gefehlt hatten, dargelegt wurde[249]. Dieses Schnitzwerk des Hans Multscher, das noch den Steinstil zeigt »und die knitterige Eigenart des Holzstils noch nicht erreicht hat«[250] ist dennoch eine sehr bedeutende Leistung und beweist vor allem die künstlerische Höhe, auf welcher die Holzplastik bereits vor Ausbildung eines eigenen Holzstils angelangt ist, wonach die Forderung noch mehr berechtigt erscheint, diesem Zweige der plastischen Kunstübung und namentlich den Anfängen desselben mehr Beachtung als bisher zu schenken.
Wenn es demnach schon wegen des Mangels an eingehenden stilkritischen Untersuchungen schwierig ist, einem Denkmal der Holzskulptur, das vor der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden ist, seine genaue Stellung innerhalb der Geschichte dieser Kunst im allgemeinen und innerhalb der einzelnen Schulen im besonderen anzuweisen, so wird diese Schwierigkeit noch größer angesichts eines Werkes, über welches uns urkundliche Berichte fehlen und das uns noch dazu als eine in verhältnismäßig früher Zeit so ausgereifte Schöpfung entgegentritt und dadurch geradezu frappierend wirkt, wie die jüngst vom Germ. Museum erworbene Freifigur des hl. Georg.
Der hl. Georg steht hier als eine kräftige, jugendlich schöne Mannesgestalt auf dem Rücken des unter ihm zusammengekauerten Drachen, dem er, mit dem Ausdrucke der ruhigen Überlegenheit des Siegers auf ihn herabblickend, die Lanze in den emporgewendeten Rachen so wuchtig gestoßen hat, daß sie unterhalb des Kopfes am Halse hindurchdringt. Da der Heilige die Lanze mit der Rechten am untersten Teil des Schaftes gefaßt hält, während seine Linke, dem Stoß die Richtung gebend, den Schaft ungefähr an dessen Mitte kräftig umspannt, so ist sein erhobener rechter Arm im Gelenk fast spitzwinklig, der linke Arm dagegen nur wenig, etwa in einem Winkel von 135°, gebeugt. Sein Haupt, das vorwärtsgeneigt und leicht nach rechts gewendet ist, bedeckt eine Rundkappe mit Knopf, unter der das reiche lockige Haar zu beiden Seiten an den Schläfen herabfällt, die Ohren bedeckend, während ein gekräuselter Schnurr- und ein in zwei Spitzen auslaufender Kinnbart die untere Hälfte des länglichen Gesichts einrahmen. Die Augenbrauen sind schön geschwungen, die Nase fein gebildet, die Wangen sinken unterhalb der Backenknochen leicht ein. Das rechte untere Bein des Heiligen (Standbein) umklammert der krokodilartige Schweif des Tieres in einmaliger Umwindung, das linke Bein (Spielbein) ist etwas vorgestellt und setzt zwischen Hals und Rumpf des Drachen auf. Die Ausbiegung der rechten Hüfte ist dazu so gar nicht outriert, daß die Haltung, trotz der etwas ins Knie gebogenen Beine, von durchaus vornehmer Wirkung ist. — Der Heilige ist zunächst bekleidet mit dem Panzerhemd, über welchem dann als Schutz für die Achseln halbkugelförmig getriebene Eisenplatten und ebenso ähnliche für die Ellbogen und die Knie (Ellbogen- und Kniekacheln), alle mit Geschübe, aufliegen. An den Achselschutz schließen sich Ober- und Unterarmschienen. Dabei[S. 187] umgeben die Oberarmschienen den Arm als Halbröhren, während die Unterarmschienen schon vollständige Röhren bilden. Ellbogenbergen und Kniekacheln sind durch Riemen befestigt. Unterhalb der schöngeformten Kniekacheln setzt sich die Bewaffnung durch Beinröhren fort die, hinten die Fersen freilassend, nach vorn über den Fuß in schnabelförmig spitzauslaufenden, geschobenen Eisenschuhen ihre Fortsetzung finden. Über der Brust liegt eine Brustplatte, die sich, dem bekannten Brauch gemäß in der Mitte zuspitzt, so daß sie hier nur eben durch diesen hervortretenden Rand sichtbar wird, denn über sie ist als Bekleidung des ganzen Oberkörpers ein Waffenrock angelegt, der den Körper gänzlich faltenlos und in den Hüften wie angegossen umschließt, während er unterhalb des Ringgürtels in leichten Falten bis dicht über die Kniekacheln herabreicht, die Oberschenkel gänzlich deckend. Durch die beiden seitlichen Schlitze des Lendners wird die ausgezackte Form des darunterliegenden Eisenhemds sichtbar. Ein mit gotischen Metallbeschlägen reichverzierter, wulstiger Gürtel legt sich über dem Lendner unterhalb der Hüften um den Leib. Über den Rand des nicht hohen Halskragens fällt der gebogte Saum des Hemdes. Regelmäßig halbkreisförmige Ausschnitte in kleinem Maßstabe zeigt der Rand der aufgenagelten, bronzenen Einfassung des an der rechten Brustseite angebrachten Reliquienovals, das ehemals wohl mit einem Bergkristall geschlossen war und an welchem jetzt nur noch einer von den ursprünglichen vier Dornen erhalten ist.
Der zweibeinige, geflügelte Drache von krokodilähnlicher Bildung wendet sich, wie zum Sprunge bereit, mit fast gerade emporgestrecktem Halse und aufgesperrtem Rachen gegen seinen auf ihm stehenden Besieger, dessen linkes Bein sein länglicher Kopf beinahe berührt. Die beiden kurzen, breiten und deshalb wie gestutzt erscheinenden Flügel zu beiden Seiten des Körpers, an denen die einzelnen Fluren deutlich unterschieden sind, wollen sich wie zum Auffliegen ausspannen. Von der Mitte des Kopfes, zwischen den Augen beginnend, bis auf die Spitze des Schwanzes, dessen in Wut und Schmerz zuckende Windung um das Standbein der Hauptfigur sehr charakteristisch wiedergegeben ist, ziehen sich über den ganzen Leib des Tieres eng aneinander gereihte, doch nach der Mitte des Körpers an Größe zunehmende und gegen das Ende desselben sich allmählich wieder verkleinernde, gleichmäßiggeformte Knochenschilder hin. Die Füße sind mit fünf scharfen Krallen bewaffnet. Aus den tiefen Nüstern glaubt man ein ingrimmiges Fauchen zu verspüren. Die langen spitzen Ohren, von denen das rechte nicht mehr erhalten ist, stehen, die innere Erregung bezeichnend, vom Kopfe ab. Die aus ihren Höhlen heraustretenden Augen sind starr auf den Angreifer gerichtet. Das raubtierartige Gebiß zeigt im Ober- und Unterkiefer je zwei furchtbare Fangzähne.
Das 1,46 m. hohe Standbild ist aus Lindenholz, dem bevorzugten Material der mittelalterlichen Holzplastik, vollrund geschnitzt. In Übereinstimmung mit der Gewohnheit alter Zeit, wertvollere Holzskulpturen vor der Bemalung erst mit grober Leinwand zu beziehen, weist auch unsere Statue an fast allen ihren Teilen diese Art der Technik auf. So sind mit Leinwand überzogen:[S. 188] die Kappe und der Oberkörper des Heiligen einschließlich der Hände und des Schmuckgürtels und die Gestalt des Drachen gleichfalls zum größten Teil. Dagegen fehlt dieser Überzug am Kopf des Georg und an einzelnen Partien der untern Hälfte des Standbilds: an dem sich unterhalb des Gürtels fortsetzenden Lendner, an den Beinen der Hauptfigur und am Halse und untern Teil des Drachenkopfes. Auf alle Partien der Statue, die mit Leinwand bekleideten sowohl wie die unbekleideten, ist alsdann ein Kreidegrund aufgetragen, der danach die reiche Bemalung erhielt.
Bevor ich zu dieser übergehe, erübrigt es noch, von einer Eigentümlichkeit unsers Bildwerks zu sprechen, die dem Betrachter unmittelbar auffällt. Es sind dies die zahlreichen kleinen Nägel, die an den Armlöcherrändern des Oberrocks und an den seitlichen Schlitzen desselben sichtbar werden. Sie dienten zur Befestigung von Metallbeschlägen, mit denen diese Ränder oder Säume des Kleides, gleichwie der Gürtel, verziert waren und von denen sich ein Teilchen noch an dem rechtsseitigen Ausschnitte des Gewandes erhalten hat. Mit ebensolchen Nägeln sind auch die bleiernen Beschläge des Gürtels aufgenagelt und aneinandergereiht dienen sie dazu, die Riemen, mit denen die Ellbogenbergen angeschnallt sind, zu verzieren, wenn sie nicht auch hier gleichzeitig ein Metallornament, das sich nicht mehr erhalten hat, zu befestigen die Aufgabe hatten. Diese Metallbeschläge sind als Zierrat mittelalterlicher Holzskulpturen eine Seltenheit.
Die Bemalung ist eine vollständige. Ihre Beurteilung ist bei dem jetzigen Zustande der Statue, der den Kreidegrund teilweise abgebröckelt, die Leinwand an manchen Partien, besonders der Rückenseite, abgerissen zeigt, eine im einzelnen schwierige. So gleich bei der die Mitte des Hauptes deckenden niedrigen Kappe; sie scheint ursprünglich braun gewesen zu sein. Die Karnation ist rosig, aber eine bräunliche Kruste, die sich über das Antlitz zieht, sowie das defekte Aussehen anderer Teile läßt darauf schließen, daß unser Bildwerk lange ungeschützt aufgestellt und vernachlässigt war. Die schwarzen Pupillen heben sich von den weißen Augäpfeln sehr prägnant ab. Das Haupthaar ist dunkel gehalten; Schnurr- und geteilter Kinnbart spielen vom Hellbraun ins Rötliche; einen noch helleren Ton zeigen die Augenbrauen. Die Lippen sind kirschrot gefärbt. Die Bemalung des reichverzierten Lendners ist in zwei Grundfarben gehalten: ein 9 cm. breiter, dunkelroter kreuzförmiger Einsatz teilt der ganzen Länge und Breite des Gewandes nach den grauen, in den Hüften und über der Brust enganliegenden Rock in zwei obere und zwei untere sich völlig entsprechende Partien[251]. Die Wahl gerade dieses roten kreuzförmigen Einsatzes auf hellem Grunde mag von dem Künstler vielleicht mit Absicht in Anlehnung an das Georgsabzeichen (das rote Kreuz auf weißem Felde) getroffen sein. Ein gotisches Pflanzenornament, das in den Kreidegrund geritzt, vergoldet und dann gepunzt ist, trägt in seiner prächtigen Weise noch dazu bei, den Eindruck der Statue zu erhöhen. Besonders[S. 189] fein ist die Abtönung der beiden Grundfarben, des Grau und Rot, denen sich noch ein sattes Grün zugesellt, das für die Kolorierung des Schmuckgürtels verwendet wurde. Die Farbe des Eisenhemdes ist schwarz, ebenso die der anderen Harnischteile, soweit dieselben nicht vergoldet sind.
Die Vergoldung erstreckt sich in erster Reihe auf die Ellbogen- und Kniekacheln, sodann auf die gotischen Ornamente des Gewandes und auf die Metallverzierungen des Gürtels, des Lendners und des Reliquienovals. Im Vergleich zu diesen Teilen erscheint es unzweifelhaft, daß die Armschienen nicht vergoldet waren. Die Untermalung ist rot gewesen und tritt als solche an der Ellbogenkachel des linken Arms und besonders auch an den oberen Teilen des Lendners deutlich zu Tage.
Die Bemalung des Drachen ist nicht minder sorgfältig. Die Grundfarbe ist ein grünliches Schwarz, das von dem für das Eisenkleid des h. Ritters verwendeten nicht sehr absticht. Doch ist Eintönigkeit vermieden, denn zahlreiche rote, blaue und gelbe Punkte übersäen den ganzen Leib und fischartig silbern und stahlblau schillert der Schwanz des Ungetüms. Auch die Schildknochen sind farbig unterschieden. Dort wo die Lanzenspitze aus dem Drachenhalse herausdringt, ergießt sich ein Blutstrom über den dunklen Hals des Tieres. Mit naturalistischer Treue ist der Rachen behandelt, dessen Gaumen in natürlichem Rot wiedergegeben ist. Aus den roten Augäpfeln treten die schwarzen Pupillen heraus. An den Füßen und Krallen lassen sich die Spuren der einstigen glänzenden Bemalung mehr ahnen als deutlich wahrnehmen, denn die Farben haben dem Einfluß der Zeit nicht Stand gehalten. Aber schon diese spärlichen Reste der alten Bemalung genügen vollkommen, uns einen Begriff zu geben von der wundervollen polychromen Wirkung der Statue in dem ursprünglichen Zustande ihrer Fassung.
Für Werke der bildenden Kunst, in denen der bekleidete Mensch dargestellt wird, haben wir zur Bestimmung ihrer Entstehungszeit, sobald uns archivalische Zeugnisse fehlen und solange das Denkmälermaterial noch nicht hinreichend gesammelt und gesichtet uns wenigstens in guten Nachbildungen vorliegt und so eine vergleichende Stilkritik ermöglicht, zunächst kein besseres Kennzeichen als die Tracht. Wir halten dabei an dem Axiom fest, daß ein Archaismus der Darstellung, besonders in der Bekleidung, dem Mittelalter fremd war, und daß die vereinzelten Spuren desselben nur zufällige sind.
Die Ausbildung der Kostümformen, welche wir an unserer Statue vorfinden, fällt in das 14. Jahrhundert und vornehmlich in die zweite Hälfte desselben. Um die Mitte und besonders in der zweiten Hälfte des genannten Jahrhunderts treten die Arm- und Kniekacheln, die Armröhren, die spitzen Eisenschuhe und der Lendner auf, der namentlich in seiner enganliegenden, scharf in die Weichen geschnittenen Form und über der Rüstung getragen, wie in Frankreich und England, auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts hinweist und wobei es für Deutschland charakteristisch ist, daß man ihn hier mit zwei seitlichen Schlitzen ausstattete. Auch die selbständige Brustplatte[S. 190] und die reiche Verzierung des ritterlichen Gürtels, die schließlich soweit ging, daß man in Aufwandgesetzen dagegen einzuschreiten gezwungen war, weisen auf die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts und auf Deutschland wieder die nicht zu tiefe Lage des Gürtels hin. Ob dieser letztere dabei durch verdeckte Haken, wie Hottenroth[252] meint, befestigt war oder ob hier des böhmischen Chronisten Hagecius[253] Bemerkung zum Jahre 1367: — »Die Rittermessigen liesen ihnen auff gemelte Röcklein über die Lenden vō Tuch anderer Farben Sträme gleich als Ritter Gürte auff nehen« — zutrifft, läßt sich an unserer Statue nicht erkennen. Jedenfalls bezeugt desselben Chronisten weitere Auslassung zum Jahre 1367: »Darnach pflegten sie auch dieselbigen Käpplein zu tragen, oben aufm Kopff über sich mit Trollern« (wohl Troddeln), daß auch aus dieser kleinen Kappe, ebenso wie aus dem Schmuckgürtel, bereits auf die spätere Zeit des 14. Jahrhunderts zu schließen ist.
Auch die Grabdenkmäler jener Zeit, von denen das Germanische Museum eine Anzahl Gipsabgüsse besitzt, zeigen eine relative Übereinstimmung der Tracht. So der Grabstein des Otto von Pienzenau († 1371) gleichen Knieschutz mit Geschübe, Beinschienen, Schnabelschuhe und den verzierten Rittergürtel unterhalb der Hüften. Verwandt in Einzelheiten sind die Grabmäler des Johann von Falkenstein († 1365) und des Berengar von Berlichingen († 1377), welch letzterer den Knieschutz auch reich vergoldet, durch Riemen geschlossen, den Gürtel unter den Hüften liegend und eine verhältnismäßig freie Haltung zeigt, wie man sie auf Grabdenkmälern nicht oft antreffen kann. Auch das Grabmal des Ritters Burkhard von Steinberg († 1379) zeigt gleiche geschobene Kniekacheln, mit Riemen angeschnallt, ähnliche Ellbogenbergen und Schnabeleisenschuhe. Für die Barttracht wäre dann hier das Grabmal des Johann von Holtzhausen[254] († 1393) im Dom zu Frankfurt a. M. und das obige des Johann von Falkenstein zu nennen, da sie beide in geteiltem Kinnbart dargestellt sind und vornehmlich diese Form des Bartes zeigt auch der uns in der Wiener Handschrift Nr. 8330 erhaltene, 1356 vollendete Bildercyklus des Luxemburger Stammbaums aus Karlstein in Böhmen[255], — in dem sich übrigens auch die Rundkappe mit Knöpfen auf dem Scheitel als Kopfbedeckung der Männer findet, — und die mit Miniaturen geschmückte Handschrift des Wilhelm von Oranse von 1387 in der Ambraser Sammlung. Da zudem das Pflanzenornament auf dem Lendner unsers Georg in den Goldornamenten der Miniaturen dieser letzteren Wiener Handschrift und noch dazu auf einem gleichfalls der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörigen[S. 191] und aus Ulm stammenden, jetzt im bayr. Nationalmuseum befindlichen Temperagemälde[256], das einen Ritter in ähnlichem Lendner mit seitlichen Schlitzen und dickem cingulum militare darstellt, eine Analogie findet, so könnte man leicht geneigt sein, unsere Statue an das Ende des 14. Jahrhunderts zu setzen. Nun ist jedoch damit nur ein terminus a quo, nicht aber der zwingende Beweis erbracht, daß die Statue gerade im 14. Jahrhundert entstanden sein muß, denn, da das 15. Jahrhundert keine neuen Kostümformen erfand[257], haben sich viele Bestandteile der hier vorliegenden Tracht noch lange erhalten, so der ritterliche Gürtel (Dusing) mit Metallbeschlägen, der Schnabelschuh (bis ca. 1490), die mit Riemen aufgebundenen Armkacheln (noch um 1480), die Rundkappe u. a. Ebenso die Barttracht, denn das Grabmal des 1407 verstorbenen Johann Grafen von Wertheim mit seinen Frauen[258] zeigt denselben noch im geteilten Bart. Zudem ist nach den von Alwin Schultz[259] erwähnten Bilderhandschriften von Enenkels Weltchronik, des Wilhelm von Orlens in der kgl. Privatbibliothek zu Stuttgart (v. 1419) und des Kalendariums der Landesbibliothek zu Kassel (1445) nicht zu zweifeln, daß die längere Form des Rockes erst im 15. Jahrhundert allgemein wird. Und daß sich einzelne ältere Gewandarten noch bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts erhielten, das beweisen die Federzeichnungen der 1451 in Schlesien geschriebenen Hedwigslegende, von denen die bei Schultz in Fig. 320 und 322[260] mitgeteilten Proben eine Länge und Form des Oberrockes und namentlich eine Lage und Gestalt des Gürtels zeigen, die sich von der bei unserm Heiligen wahrnehmbaren nicht wesentlich unterscheidet. Den längeren, bis auf die Knie herabreichenden Waffenrock zeigen außerdem die bei Hefner-Alteneck[261] abgebildeten Grabdenkmäler des Ludwig von Hutten († 1414), des Martin Seinsheim († 1434), des Oswald von Wolkenstein († 1408) und die um 1410 entstandene Kaiserstatue aus dem plastischen Schmuck des Braunschweiger Altstadt-Rathauses[262], ebenso der hl. Georg am Westportal der Frauenkirche zu Eßlingen[263], so daß es nach dem Zeugnis dieser Denkmäler und der Kostümkunde also nicht ungerechtfertigt erscheint, wenn ich unser hier in Rede stehendes Bildwerk für eine treffliche Arbeit aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts erkläre.
Die Ähnlichkeit, welche die früher der »hl. Georg von Nürnberg« genannte, jetzt aber unter der Bezeichnung »Karl IV.« im Berliner Museum befindliche Statue aus Sandstein mit unserm Bildwerk im Gesichtstypus, in Haar- und Barttracht und in der Form des Baretts hat, kann nicht als ein hinreichender Grund gelten, auch unsere Statue an das Ende des 14. Jahrhunderts[S. 192] zu setzen. Denn abgesehen davon, daß der Modebart und die Kopfbedeckung (Kappe) den Gesichtern ohnehin stets etwas Gleichförmiges giebt, wovon sich jeder überzeugen kann, der z. B. die im German. Museum befindliche Holzfigur des »Herzogs in hohem Hut und Mantel«[264] zum Vergleich heranzieht, so deutet doch schon die freiere Haltung, die keineswegs steife Stellung der Beine bei unserer Statue und namentlich die längere Form des Lendners auf eine jüngere Entstehungszeit. Daß übrigens gerade Karl IV. in der Berliner Statue dargestellt sein soll, erscheint, selbst wenn man die Kunst des Porträtierens in der Skulptur des 14. Jahrhunderts für noch unentwickelt hielte, schon deshalb sehr zweifelhaft, weil die zahlreichen zeitgenössischen Bildnisse dieses Kaisers von Nikolaus Wurmser von Straßburg und Theodorich in der Burg Karlstein in Böhmen und selbst die Porträtbüste Karls IV. im Triforium des Prager Domes demselben wenigstens immer die an der Nasenwurzel etwas eingezogene, ein wenig aufgestülpte und an der Spitze fast klobigdicke Nase als Charakteristikum geben, von der aber hier nichts bemerkbar ist. Dazu kommt, daß die steinerne Statue an einem Strebepfeiler des Chors der Pfarrkirche zu Sulzbach in der Oberpfalz[265], schon nach der Rüstung des Dargestellten zu urteilen ein vorzügliches plastisches Werk der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in der Bildung und im Ausdruck des Gesichts, in der Behandlung des Haares und Bartes, in der an der Wurzel eingedrückten Nase, dem hängenden Schnurrbart und dem zweifach geschnörkelten Kinnbart mit der Prager Triforiumbüste viel Ähnlichkeit hat und den authentischen Karlsbildnissen, wie ich sie bei Neuwirth a. a. O. reproduziert finde, namentlich im Profil gesehen, so verwandt ist, daß man hier, der Überlieferung zustimmend, nicht daran zweifeln kann, ein wirkliches Bildnis Karls IV. von einem zeitgenössischen Meister vor sich zu haben. Die Berliner Statue[266] stimmt vielmehr mit dem Gottfried von Bouillon des Schönen Brunnens in der Kopfbildung[267] so vollkommen überein, daß,[S. 193] zudem auch sie aus Nürnberg stammt, für beide Figuren wohl auf einen gemeinsamen, in Nürnberg thätigen Meister geschlossen werden darf.
Wie die Berliner Statue so lehnt sich auch die Darstellung unsers hl. Georg augenscheinlich, wie die porträthaften Züge beweisen, an eine ganz bestimmte Persönlichkeit als Vorbild an, ein Fall, der in der Kunstgeschichte nicht selten ist. So zeigt, nach der Meinung Riehls[268], eine Silberstatuette im bayr. Nationalmuseum den Herzog Ernst als hl. Georg[269] und der hl. Georg auf einem niederländischen Gemälde von 1520 im German. Museum ist nach der Ansicht der Herausgeber des Katalogs anscheinend gleichfalls ein Bildnis. Auch die Statuen der hh. Wolfgang und Benedikt am Pacherschen Wolfgangaltar hält Stiassny[270] für Porträts von Kirchenfürsten und in gleicher Weise mochte den Bestellern von Bildwerken wohl öfters noch ein Denkmal gesetzt werden. Für die porträtmäßige Auffassung spricht sodann auch die bärtige Darstellung des hl. Georg, die immerhin eine Ausnahme von der Regel[271] ist, wenn diese Ausnahme auch, wie Dürers Stich (Bartsch 53), wie das schöne Temperagemälde im erzbischöflichen Museum zu Köln[272], wie das schwäbische Gemälde (Nr. 201) im Germ. Museum und einige Holzfiguren (Nr. 482 und 525)[273] im bayr. Nationalmuseum u. a. beweisen, gar nicht vereinzelt dasteht.
Von den ungemein zahlreichen künstlerischen Verherrlichungen des himmlischen Ritters im Mittelalter, dessen höfisches Ideal sich in St. Georg wohl am besten verkörpert fand, gehören die großen cyclischen Darstellungen seiner Legende fast ausnahmslos den Werken der Malerei an[274]. Die Plastik zeigt den Heiligen fast immer nur als Drachentöter, bisweilen zu Pferde, wie auf dem ehernen Reiterstandbild auf dem Hradschin zu Prag (1373)[275], wie am Westportal der Frauenkirche zu Eßlingen und auf einem Relief des Choraltarschreins in Milbertshofen[276], häufiger aber, wie im vorliegenden Fall, als auf dem Rücken des Drachen stehende Einzelfigur. Von derartigen Standbildern mögen einige, gleichfalls der Holzplastik angehörige und bereits datierte Beispiele hier noch in Betracht gezogen werden, um auch durch einen Vergleich mit ihnen bestimmen zu können, in welche Zeit unser Bildwerk gesetzt werden muß.
Eine ehemals bemalte Holzstatue des hl. Georg, von deren Fassung jetzt nur noch spärliche Reste erhalten sind, bewahrt das bayr. Nationalmuseum; sie ist daselbst im Saal 8 aufgestellt[277]. Auch dort steht der hl. Ritter auf dem Rücken des Drachen, dem er die Lanze in den aufgesperrten Rachen, aus welchem die lange rote Zunge hervorragt, hineinstößt. Die gezaddelten langen Hängeärmel, der über dem Lendner liegende Brustharnisch und namentlich die ganz hölzerne, breitbeinige Haltung unterscheiden ihn wesentlich von dem unsrigen, wohingegen in der Lage des ziemlich breiten cingulum militare, in dem geteilten, in zwei Spitzen auslaufenden Kinnbart und in der Länge des Waffenrockes, der bis an die mit Geschübe versehenen Knieschirme herabreicht, Ähnlichkeit vorhanden ist. Auch die Wendung des Drachen gegen den Heiligen ist eine ähnliche, erscheint aber ungemein steif und hölzern dabei. Dazu deutet auch der Umstand, daß die schwächere Linke den Stoß ausführt, während die stärkere Rechte die Lanze nur in ihrer Richtung hält, auf keine scharfe Beobachtung und kein richtiges Erfassen der Natur hin. Während dieses Standbild um 1400 angesetzt wird, zeigt die prächtige, im gleichen Saal 8 unter Nr. 10 aufgestellte polychrom gefaßte Freifigur des hl. Georg[278], der dort auch in (schwarzem) hängendem Schnurr- und zweispitzigem Kinnbart dargestellt ist, im einzelnen und zwar im Kostüm Züge der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, so in dem kurzen Lendner, unter dem das Panzerhemd noch sichtbar ist, dem tiefgestellten cingulum militare, der Brustplatte ohne Rückenteil, bedeutet aber in ihrer viel freieren Haltung trotz ihrer stark ausgeschwungenen Formen einen solchen Fortschritt gegen die vorige, daß der Herausgeber des Katalogs[279] sie mit Recht in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts gesetzt und zudem für eine treffliche Arbeit erklärt hat. Freilich fällt auch bei diesem Werk die ungeschickte, wenig zweckentsprechende Art, wie der Heilige die Lanze gefaßt hält, wieder auf, doch ist die Bewaffnung des Unterkörpers (die Kniekacheln, die Beinschienen, die hinten die Ferse frei lassen, die völlig gleichen geschobenen Schnabeleisenschuhe) und die Wendung des Drachenkopfes gegen Georg der unsrigen ganz ähnlich und auch die Windung des Drachenschweifes um das eine Bein des Ritters kehrt bei unserm hl. Georg nicht viel verändert wieder. Dagegen charakterisieren sich schon durch die vollständige Plattenrüstung die Georgsstatuen Nr. 752 und 756 im bayr. Nationalmuseum, ebenso wie der hl. Georg von Multscher in der Spitalkirche zu Sterzing[280], als der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bereits zugehörig, während zwei weitere Darstellungen des hl. Georg (Nr. 561 in Saal 14 und Nr. 812 in Saal 13 des bayr. Nationalmuseums)[281] nicht blos durch die vollständige Eisenkleidung, sondern auch durch die gezierte, häufig fast unmögliche Stellung des Ritters, durch dessen Bewaffnung mit dem[S. 195] Schwert anstatt der Lanze, die letztere Holzfigur noch besonders durch die schöne um den Arm gewundene Schärpe und den ganzen spätgotischen Stilcharakter als Arbeiten einer jüngeren Zeit sich unzweideutig kennzeichnen und in ihrer ungezwungenen, freibewegten Haltung noch über die schönen Georgsgestalten an den Flanken der Altäre zu St. Wolfgang[282] und zu Käfermarkt in Oberösterreich[283] hinausgehen. Eine dem Bildschnitzer des Wolfganger Altars zugeschriebene Schnitzfigur in der Kapelle des Schlosses Matzen bei Brixlegg im Unterinnthal, die den hl. Georg darstellt, aber nach der Meinung von Stiassny[284] ursprünglich ein hl. Michael gewesen sein soll, weist in ihrer jetzigen Gestalt, in der Stellung des Heiligen auf dem Drachenrücken, in seiner Neigung des Hauptes nach vorn, in der leichten Ausbiegung der rechten Hüfte, in der Bildung des Drachenkopfes, in der Art wie sich derselbe emporwendet, namentlich aber in der Armhaltung des Georg, der die ganz ebenso erfaßte Lanze in den ähnlich gestalteten Rachen des Tieres stößt, so mannigfache Berührungspunkte mit unserer Darstellung auf, daß man sich fast zu der Annahme versucht fühlt, es habe bei jener Umgestaltung der Matzener Statue unser hl. Georg als Vorbild gedient. Schließlich begegnen wir noch einer verwandten Darstellung des Drachentöters in einer Statue aus Eichenholz, die sich zu Berg am Laim bei München befindet[285]. Auch dort sehen wir den Drachen sich mit steil aufgerichtetem Kopf und weit geöffnetem Rachen gegen seinen Besieger wenden, der die Lanze mit beiden Händen erhebt und sich eben zum Stoß anschicken will. Den rechten Fuß hat er dabei auf den Rücken des Tieres gesetzt. Indessen steht dieses Bildwerk dem unsrigen nicht entfernt so nahe, wie die oben besprochene Holzstatue (Nr. 522) im bayr. Nationalmuseum und, soweit sich nach der Abbildung schließen läßt, jene restaurierte Schnitzfigur im Schlosse Matzen, wodurch einerseits für unsere Datierung eine weitere Stütze, anderseits vielleicht auch ein Hinweis auf die mutmaßliche Heimat des Künstlers gegeben ist, nach dessen Namen wir vergeblich fragen. Er ist unbekannt[286], ein Schicksal, das[S. 196] er mit allen Meistern aus der früheren Zeit der Holzbildnerei teilt, die heute nur noch durch ihre Werke zu uns reden. Erst als im 15. Jahrhundert die Holzskulptur das eigentliche Arbeitsgebiet der plastischen Kunstübung wurde und der Holzstil in gewissem Sinne selbst auf die dekorativen Formen der Architektur nicht ohne Einfluß blieb[287], erst dann tauchen aus dem Dunkel der geschichtlichen Überlieferung die Namen eines Hans Multscher und Jörg Syrlin auf.
Die Wiege unsers Meisters wird in Österreich zu suchen sein. Werke, wie das in Rede stehende, die in einer relativ frühen Zeit eine solche Vollendung bekunden, müssen auf einem Boden entstanden sein, der an Übung und Erfahrung in diesem Kunstzweige besonders reich war und schon frühzeitig alle Vorbedingungen zu blühender Kunstentfaltung enthielt. Hier aber gehen alle Wege den Alpen zu[288] in deren stillen Thälern diese alte Volkskunst wie vor Jahrhunderten noch heute eine Heimstätte hat, hier führt uns die geschichtliche Forschung in diesem Falle vielleicht zunächst ins Salzburgische. Diese Vermutung, die in erster Reihe durch einen Vergleich mit der dortigen Schnitzkunst, den ich hier anzustellen leider nicht in der Lage bin, möglicherweise an Wahrscheinlichkeit gewinnen würde, ist übrigens mit der Angabe des Verkäufers[289], der die Statue aus Steiermark erworben haben will, nicht absolut unvereinbar, da Salzburg während des ganzen Mittelalters in Malerei und Plastik einen weitreichenden, maßgebenden Einfluß ausgeübt hat[290]. Wenn diese Frage danach auch heute noch offen bleiben muß, so dürfte es einer späteren Untersuchung doch vorbehalten sein, den Meister des hl. Georg, wenn einmal erst auf Grund stilkritischer und archivalischer Forschungen über die Geschichte der Holzplastik im allgemeinen ein helleres Licht als jetzt verbreitet ist, mit aller Sicherheit zu bestimmen, wie es ja auch vor noch nicht langer Zeit erst gelungen ist, in Peter Vischer dem Jüngeren den so lange unbekannt gewesenen, vielumstrittenen Meister der berühmten Nürnberger Madonna aufzufinden[291] und damit für die Entstehungszeit des Werkes und seine kunstgeschichtliche Stellung feste Anhaltspunkte zu gewinnen[292].
Sechszehn Holzschnitte nach Arnold Böcklin. (Meisterwerke der Holzschneidekunst. Neue Folge. Heft 5.) Mit einer Einleitung von Aemil Fiedler. Leipzig. J. J. Weber. Imp. Fol.
Die Worpsweder. Zweiundzwanzig Kunstholzschnitte nach Gemälden, Radierungen und Zeichnungen. Text von Aemil Fiedler, (Meisterwerke der Holzschneidekunst. Neue Folge. Heft VI.) Verlag von J. J. Weber, Leipzig. Fol.
Zeichnungen von Sascha Schneider. III. Aufl. Gesamtausgabe. Text von Aemil Fiedler. Leipzig J. J. Weber. Gr. 4.
Die vorstehenden drei Werke, aus dem bekannten Verlage der Illustrierten Zeitung, J. J. Weber in Leipzig, geben, wie die gesamten seit langen Jahren erscheinenden Folgen, aus der genannten Wochenschrift zusammengestellte Reihen von in Tonschnitt reproduzierten Kunstwerken wieder. Mit Erfolg ist die Webersche xylographische Anstalt bestrebt, den Wettkampf mit den neuen auf die Photographie basierenden Reproduktionsverfahren einerseits, der modernen Griffelkunst, wie sie der Künstler seiner Platte aus manigfachem Material unmittelbar anvertraut andrerseits, aufzunehmen. Es kann hier nicht an die Aufgabe gegangen werden, den künstlerischen Inhalt der drei vorzüglich ausgestatteten Mappen zu analysieren, oder auf die Stellung einzugehen, welche die dargestellten Werke und ihre Meister in der Entwicklung der modernen Kunst einnehmen. Das ist in anregender und für den augenblicklichen Zweck erschöpfender Weise in den bei allen dreien von Aemil Fiedler geschriebenen Textbeilagen geschehen. Die Verlagsfirma nimmt in der noch nicht gar zu langen Geschichte des Tonholzschnittes unbestritten die erste Stelle ein, unbestritten dürfte auch bleiben, daß die letzten beiden Dezennien die allgemeine Verwendung des Tonholzschnittes stark einschränkten, wegen der durch die neuen photographischen Reproduktionsverfahren ermöglichten größeren Treue und vor Allem der größeren Billigkeit. J. J. Weber hat an seinen Traditionen festgehalten und mit Erfolg danach gestrebt, durch technische und künstlerische Verfeinerung den Tonholzschnitt auf der Höhe zu erhalten. Insbesondere die ausgezeichnet klaren, die farbige Wirkung trefflich wiederspiegelnden Blätter nach Böcklin geben von den Fortschritten in der jetzt etwas über die Achsel angesehenen Technik eine deutliche Vorstellung.
Das radierte Werk des Adriaen van Ostade in Nachbildungen. Mit biographisch-kritischer Einleitung, herausgegeben von Professor Dr. Jaro Springer. Verlag von Fischer und Franke, Berlin. 4.
Die außerordentlichen Fortschritte der Reproduktionskunst sind insbesondere den Erzeugnissen der Schwarz-Weißkunst früherer Jahrhunderte zu Gute gekommen. Was früher nur dem bemittelten Sammler und da selten in größerer Vollständigkeit zugänglich war, das wird Dank der Zinkätzung jetzt in weite Kreise zu ganz billigem Preise getragen. Der rührige Verlag des »Kupferstichkabinets« Fischer und Franke zu Berlin, hat mit der Herausgabe der Radierungen Ostade’s, des nach Rembrandt bedeutendsten Meisters der Radiernadel einen glücklichen Griff gethan. Die künstlerisch vertiefte und dabei von[S. 198] feinem Humor durchtränkte Darstellung des holländischen Bauernlebens durch Ostade ist als Schlüssel zur holländischen Genrekunst vortrefflich geeignet. Die Wiedergabe mittelst Strichätzung vergröbert freilich und verwischt die intimen Feinheiten der Nadel. Immerhin ist das vorliegende Werk, von einer kurzen Beschreibung des Lebens und Wirkens von Jaro Springer begleitet, ein Beweis wie weit auch in diesem Verfahren sorgfältige Technik es gebracht hat.
Unser Egerland. Blätter für Egerländer Volkskunde. Im Auftrage des Vereines für Egerländer Volkskunde. Herausgegeben von Alois John. Verlag des Vereines. Jahrg. I-IV. 1897–1900. 8.
Zwischen Fichtel- und Erzgebirge, Böhmer- und Kaiserwald liegt, jenseits der Grenzen des neuen Reichs, aber der deutschesten Gauen einer, das Egerland. Ob nun die stattlichen farbenfreudigen Bauernhäuser ihn begrüßen, ob die ehrwürdigen Bauten der alten Pfalz ihn an die Kaiserherrlichkeit der Hohenstaufen gemahnen oder beim Besuche des städtischen Museums in Eger manch schönes Stück Egerländer Hausrats ihn anheimeln mag, überall schaut dem Wanderer, der das Land durchstreift, echt deutsche Art entgegen. Da beginnt man zu ahnen, wieviel Volksgut auch noch in Sitte und Sprache des dem Bayerischen Stamm engverwandten Egerländers sich birgt. Diese ansehnlichen Reste des deutschen Lebens und Denkens ihrem Wert gemäß dem Volke wieder lebendig zu gestalten und damit die beste Waffe gegen das andringende Slaventum zu schmieden, das ist, was diese von warmer Heimatsliebe beseelte Zeitschrift vor bald vier Jahren versprochen und bis heute redlich gehalten hat. Sammlungen und Arbeiten auf allen Gebieten der Volkskunde lösen in diesen Blättern in bunter Folge einander ab, vieles wird überdies im Bilde dem Leser veranschaulicht. Dabei ist im Laufe der Zeit auch der äußerliche Umfang des Gebotenen gewachsen. Hervorgehoben zu werden verdient, wie namentlich auch dem Volksliede, das in ähnlichen Unternehmungen zuweilen etwas stiefmütterlich behandelt wird, ein breiter Raum gewährt ist. Einem so kerndeutschen Blatte, wie dem vorliegenden, möchten wir gerne die Aufmerksamkeit und Teilnahme aller Freunde deutschen Volkstums gesichert wünschen.
H. H.
Aus der Geschichte der Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen. Von Professor Dr. Eduard Heydenreich. 60 SS. Halle. Otto Hendel. 1900. 8.
Unsere alten Reichsstädte haben nicht nur in allbewunderten Werken der Kunst Zeugen ihrer großen Vergangenheit in eine andere Zeit hinübergerettet, noch liegt in den von jeher treu gehüteten Archiven manch ungehobener Schatz verborgen. Diese Urkunden und sonstigen schriftlichen Denkmäler der nach Art der Entwicklung unter sich so verschiedenen, immer aber mit den Schicksalen des Kaisertums eng verbundenen Reichsstädte gehen weit über rein örtliche Bedeutung hinaus, ihre Überlieferung leiht vielmehr der Geschichte des alten Reichs die frischesten Farben. Nicht in letzter Reihe solcher Archive steht das der Stadt Mühlhausen in Thüringen, dessen Reichtum aber gleichwohl bisher noch nicht in einer der strengeren Kritik entsprechenden Geschichte die rechte Verwertung gefunden hat. Diese Lücke will Prof. Heydenreichs Buch ausfüllen, den Ortsansässigen das täglich Geschaute im Lichte der Geschichte verklären und dem fremden Geschichtsfreunde Anregung zu eigener Umschau und Vergleichung geben. Bei aller strengen Wissenschaftlichkeit, die bei bloßen Durchblättern schon aus den fleißigen Literaturnachweisen dem Leser in die Augen fällt, ist überall ein Ton getroffen, der die kleine Schrift zu einem Hausbuche nach des Verfassers Wunsch machen dürfte, indem die flüssige Darstellung oft nur dem Kenner verrät, wie viel eigene Forschungsmühe darin steckt. Ausgehend von den ersten Anfängen der Stadt, die wir noch aus vorgeschichtlichen Altertümern und den Ortsnamen zu erkennen vermögen, folgt stets mit Heranziehung der allgemeinen Fragen der städtischen Verfassungsgeschichte die Darlegung der Entwicklung der Reichsstadt auf Grund der urkundlichen Quellen, von den Zeiten des noch königlichen Beamten unterstehenden Gemeinwesens bis zum selbständigen und unabhängigen Reichsstand. Dies Ziel wird erreicht allerdings erst nach [S. 199] Überwindung wiederholter Bemühungen, die gemacht werden, um sie zur einfachen thüringischen Landstadt herabzudrücken. Die Zünfte werden hier ohne wesentlichen Kampf in den Rat eingegliedert, so erfuhr das alte städtische Regiment eigentlich erst in der Reformationszeit einen entscheidenden Stoß. Wir erfahren mancherlei Einzelheiten über das häusliche Leben der Bürger, über Fürstenbesuche in der Stadt, Statistisches und Wirtschaftliches im Vergleich zu heute, über das Münzwesen, u. A. Hingewiesen wird auf die kulturgeschichtliche Bedeutung der Mühlhausener Kopialbücher (1382 ff.) und Kämmereirechnungen (1407 ff.), die noch manche Ernte versprächen. Erwähnung finden ferner die Umgehungen des Zinsverbotes, die kulturelle Bedeutung der Klöster, die Kämpfe der Stadt mit der toten Hand. Sehr interessante Ausführungen beschäftigen sich mit Baudenkmälern des Kreises Mühlhausen, von denen wir hier nur die kleine vorgotische Stadtkirche zu Trefurt, die Burg Normannstein, die Reste der Stadtbefestigung, endlich die sog. Untermarktskirche (St. Blasius) als die zweitälteste gotische Hallenkirche des Deutschordens hervorheben. Zum Schlusse führt uns eine malerische Wanderung durch das Mühlhausen von heute, welches die Anstrengungen und finanziellen Opfer seiner Bürgerschaft der neuen Zeit angepaßt haben, immerhin so schonend, daß dem Kunst- und Altertumsfreund das Bild einer mittelalterlichen Reichsstadt nicht getrübt ist. Das Buch ziert eine stattliche Reihe hübscher Abbildungen.
H. H.
Breitkopf und Härtels Sammlung musikal.-wissenschaftlicher Arbeiten von deutschen Hochschulen. Leipzig 1898 ff.
Während die Geschichte der Litteratur schon seit langer Zeit, die der bildenden Künste seit einigen Dezennien zahlreiche Vertreter und feste Methoden der Forschung besitzt und weite Kreise der Gebildeten an ihren Ergebnissen Anteil nehmen, ist die Ästhetik und die Geschichte der Musik bisher wenig gepflegt worden, ihre Behandlung hat vielfach eine gründliche Wissenschaftlichkeit vermissen lassen und um die Ergebnisse der Forschungen haben sich nur wenige Fachleute und noch weniger Laien bekümmert.
Daß dem so ist, beruht hauptsächlich darauf, daß eine erfolgreiche Pflege geschichtlicher Forschung in der Musik ohne gründliche theoretische Kenntnisse noch weit weniger möglich ist, als in Litteratur oder bildender Kunst. Es ist aber an der Zeit, daß auch die methodische Behandlung der Musikgeschichte in größerem Umfang in Angriff genommen werde, als bisher. Neuerdings haben sich zahlreichere jüngere Forscher der Musikgeschichte zugewendet. Um für ihre Arbeiten ein Organ zu schaffen, hat sich die um die wissenschaftliche Musikpflege hochverdiente Verlagsbuchhandlung entschlossen, eine Sammlung musikwissenschaftlicher Arbeiten von deutschen Hochschulen zu publizieren analog den Sammlungen kunstgeschichtlicher Arbeiten von E. A. Seemann und von Heitz und Mündel. Es sind bis jetzt vier Bände erschienen.
Gleich der erste Band, die Choralnotenschrift bei Hymnen und Sequenzen von Eduard Bernoulli, führt uns auf ein Gebiet, auf dem noch vielfach Zweifel und Unsicherheit herrschen. Alle musikgeschichtliche Betrachtung wird dadurch erschwert, daß wir uns, sobald wir in ältere Zeiten aufsteigen, erst von dem auf diatonische Scala aufgebauten System der modernen harmonischen Musik frei machen müssen, und daß Melodieführung, Rhythmus und Notierung andere sind, als die uns geläufigen. Nun ist zwar im liturgischen Gottesdienste der katholischen Kirche die Tradition der ältesten Zeiten niemals ganz erloschen, aber sie ist vielfach getrübt. So ist auch das Verständnis der ältesten Tonzeichen unsicher geworden.
Bernoulli setzt sich zunächst mit den modernen Autoren über die Auflösung der Neumen und der Choralnoten (der Notierung einstimmiger Gesänge im Mittelalter) auseinander. Im zweiten Teil untersucht es die Aussagen der mittelalterlichen Theoretiker, im dritten das in den Handschriften enthaltene Material an Choralnoten. Es handelt sich dabei hauptsächlich um deren rhythmische Werte. Die Untersuchungen sind gründlich und methodisch geführt und die Arbeit muß wohl von jedem der auf diesem Gebiete arbeiten will, beachtet werden.
Der zweite Band enthält: Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik von Dr. Hermann Abert. Auch diese Arbeit behandelt ein Gebiet, das unserem musikalischen Gefühl äußerst fernliegt, die Auffassung des griechischen Volkes von seiner Musik. Wir stellen an die Musik, wie an jede Kunst ästhetische Anforderungen, der Grieche schreibt ihr etliche Wirkungen zu. Die elementare Wirkung der Musik auf jugendliche Völker ist bekannt, auch der Grieche ist ihr noch unterworfen, aber er gab sich ihr nicht willenlos hin, sondern suchte sie ethischen Zwecken dienstbar zu machen. Es bildete sich eine Lehre vom Ethos in der Musik aus, deren Hauptsatz sagt, die hörbare Bewegung der Musik vermag die Bewegung der Seele nicht nur darzustellen und wiederzuspiegeln, sondern auch zu erzeugen. So kann sie den Willen stärkend oder hemmend beeinflussen, ja das normale Willensvermögen zeitweise aufheben (Extase). Abert gibt in ansprechender Weise eine Darstellung der Quellen der griechischen Musikästhetik und entwickelt sodann an der Hand der Quellen und der »Überreste« antiker Musik die Theorie vom Ethos. Die Untersuchungen über die antike Musik sind darum so schwierig, weil uns nur ganz wenige Denkmäler erhalten sind, und so wichtige Aufschlüsse sie geben, aus ihnen doch weder die Theorie unmittelbar aufgefunden noch selbst die Aussagen der Autoren allseitig sicher kommentiert werden können. Es kann hier auf die interessanten Ausführungen Aberts über das Ethos der Tonarten, des Klanggeschlechts und des Rhythmus nicht näher eingegangen werden.
Es handelt sich um Erscheinungen, welche uns trotz unseres scheinbaren Vertrautseins mit dem griechischen Altertum völlig fremdartig anmuten. Unsere Stellung zur Musik ist eine ganz andere, eine überwiegend, wo nicht ganz ästhetische. Und doch wären die Fragen: Sind wir überhaupt noch fähig, ethische Einwirkungen von der Musik zu empfangen? Und: Ist unsere ganz anders geartete Musik im Stande, solche auszuüben? nicht zu verneinen.
Im dritten Band handelt Heinrich Rietsch über die Tonkunst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Er bezeichnet seine Arbeit als einen Beitrag zur Geschichte der musikalischen Technik. Beethoven hat die Epoche der harmonischen Musik zur Vollendung und zum Abschluß gebracht. Wenn von den Epigonen auf diesem Gebiete noch in der alten Weise weiter gearbeitet und viel schönes geschaffen worden ist, wenn sich noch manche kräftige künstlerische Individualitäten unter ihnen befanden, so ändert das nichts an der Thatsache, daß die entwickelungsgeschichtlichen Faktoren der Gattung durch die Klassiker erschöpft waren.
Beethoven selbst hat die Grenzen der Musik nach der Seite der begriffsbestimmten Ausdrucksfähigkeit hin wesentlich erweitert und die ganze moderne Schule ist auf den von ihm eröffneten Bahnen weiter geschritten. Der neue Stil der Musik ist um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts fertig, er tritt nicht unvorbereitet ein, gleichwohl kann Richard Wagner als sein Schöpfer bezeichnet werden, denn er hat die zerstreut liegenden Mittel der neuen Kunst zur Einheit zusammengefaßt. Es ist deshalb gerechtfertigt, die Tonkunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einer eigenen Betrachtung zu unterziehen.
Man kann den Charakter der harmonischen Musik in ihrer klassischen Epoche als plastisch bezeichnen. Die Melodie ist nach den Gesetzen der linearen Schönheit gebildet, die Harmonisierung ist klar und wohlklingend, und auf das feste Fortschreiten des Rhythmus wird großes Gewicht gelegt. Wurden Dissonanzen und rhythmische Freiheiten als Kunstmittel angewandt, so erregten sie Verwunderung und Anstoß. Welche Erörterungen knüpften sich an die bekannte Einleitung zu Mozarts C-dur Quartett. Würde sie heute komponiert, so würde sich niemand mehr an ihr stoßen. Auf eine Periode vorwiegend plastisch linearer Kunstübung mußte, nach dem alle Kunstentwickelung beherrschenden Gesetze des Gegensatzes eine koloristische folgen. Rietsch führt nun in seiner Abhandlung die technischen Kunstmittel vor, deren sich der neue Stil bedient. Wie weit er dem Fachmann Neues sagt, vermag ich nicht zu beurteilen; der Laie, der der Entwickelung der modernen Musik ein über das oberflächlichste Anhören hinausgehendes Interesse entgegenbringt, wird seine Ausführungen mit Dank aufnehmen. Die Arbeit ist sehr gut [S. 201] geschrieben und wird durch sorgfältig gewählte Beispiele aus neueren Musikwerken erläutert.
Die Musik befand sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in voller, produktiver Entwickelung und geriet nicht wie die bildenden Künste völlig in den Bann der historischen Formbehandlung. Gleichwohl ist auch sie von dem historischen Zuge, der unser ganzes Zeitalter beherrscht, stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und während die moderne Schule eine Entwickelung nach neuen Zielen nahm, wurde von anderer Seite auf ältere Kunstformen zurückgegriffen. In dem vierten Bändchen der Sammlung untersucht Richard Hohenemser die Frage: Welche Einflüsse hatte die Wiederbelebung der älteren Musik im 19. Jahrhundert auf die deutschen Komponisten. Hohenemser gibt eine Geschichte der Wiederbelebung der älteren Musik und ein Kapitel über den Einfluß der älteren Tonkunst auf die Vokalmusik des 19. Jahrhunderts. Die Einwirkungen der älteren Tonkunst auf die Instrumentalmusik bleibt späterer Bearbeitung vorbehalten. Es ist begreiflich, daß ein junger Autor seine erste Arbeit rasch gedruckt haben will. Er mag sie dann als Dissertation drucken lassen; will er sie in eine Sammlung ernster Arbeiten einreihen, welche sich nicht nur an akademische Kreise wenden, so begeht er damit, daß er nur ein Fragment bietet, eine Unhöflichkeit. Zudem hätte es ja dem dünnen Bändchen nicht geschadet, wenn es um ein Kapitel dicker geworden wäre.
An sich ist diese Arbeit dankenswert und gibt eine für die allgemeine Orientierung ausreichende Übersicht über die Entwickelung des Verständnisses für alte Musik und über die Verwendung der alten Tonformen in der Vokalmusik des 19. Jahrhunderts.
Eine Frage ist programmgemäß in dem Buch gar nicht berührt, nämlich die nach der Stellung des modernen Hörers zu alter Musik. Auch sie wäre der Untersuchung wert. Das Ergebnis würde wohl sein, daß sie uns noch ferner steht als die alte Kunst, daß die Vokalmusik, namentlich der Acapella Gesang in seiner reinen Klangschönheit auf ein leidlich gebildetes Ohr seine Wirkung nicht verfehlt, daß aber die Instrumentalmusik in ihrer einfachen, farblosen Besetzung einen Verzicht auf so vieles voraussetzt, daß sie nur schwer in weiteren Kreisen volles Verständnis finden wird. Vorläufig ist sie für den Spieler interessanter als für den Zuhörer.
Man darf der Fortsetzung der Sammlung mit guten Erwartungen entgegensehen.
Die Chorstühle in der ehemaligen Cisterzienserabtei im Wettingen. Von Hans Lehmann. Zürich, Hofer & Co. 24 Lichtdrucktafeln mit IV und 48 S. Text; fol. 1900.
Der um die Erforschung der Kunstgewerbegeschichte seiner schweizerischen Heimat wohlverdiente Verfasser giebt mit dieser neuen Publikation aus dem reichen Schatz der Schreiner-Bildnerarbeiten der Schweiz ein hervorragendes in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts entstandenes Werk in mustergiltigen Lichtdrucktafeln heraus. Von dem fast überreich im Geschmack der schweizerischen Renaissance des 16. Jahrhunderts geschmückten Chorwerk sind in den Lichtdrucken Gesamt- und Teilansichten, sowie die bedeutsamsten Details wiedergegeben, während die ebenfalls reich bemessenen Textillustrationen in Autotypie weitere Details, sowie manche andere auf das Wettinger Kloster, das bekanntlich auch in der Geschichte der Schweizerscheiben eine hervorragende Rolle spielt, bezügliche Denkmale und Vergleichsmaterial zur stilistischen Beurteilung des Chorgestühls bringen. Ein außerordentlich gründlicher Begleittext, der in fast allzu breiten Schilderungen über die Geschichte des Klosters, den Stifter des Werkes Abt Peter II. Schmid und die historischen Bedingungen der Herstellung sich ergeht, dient zur Erläuterung.
XIX. Plenarsitzung der Badischen Historischen Kommission. Am 19. und 20. Oktober d. J. fand in Karlsruhe die XIX. Plenarsitzung der Badischen Historischen Kommission statt. Derselben wohnten 13 ordentliche und 4 außerordentliche Mitglieder bei. Als Vertreter der Großh. Regierung waren zugegen Se. Exz. der Staatsminister Dr. Nokk, sowie die Ministerialräte Dr. Böhm und Seubert. Den Vorsitz führte der Vorstand Geh. Hofrat Professor Dr. Erdmannsdörffer.
Seit der letzten Plenarsitzung sind nachstehende Veröffentlichungen der Kommission erschienen: Beyerle, Konstanz im dreißigjährigen Krieg (Bad. Neujahrsblätter, Neue Folge. 3. 1900); Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch, II. Band, 2. Lieferung (Lieferung 3 befindet sich unter der Presse); Köhne, Oberrheinische Stadtrechte, I. Abteilung, Heft 5 (Heidelberg, Mosbach, Neckargemünd, Adelsheim); Fester-Witte, Regesten der Marggrafen von Baden und Hachberg, Schluß des I. Bandes (Lieferung 9 und 10); Lieferung 1 des II. Bandes befindet sich unter der Presse; Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluß von Venedig. 2 Bände.
An den Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz hat Privatdozent Dr. Cartellieri unter Mitwirkung des Hilfsarbeiters Dr. Eggers weitergearbeitet. Letzterer hat durch einen Besuch der Archive in Bern, Innsbruck und München (Allgem. Reichsarchiv) das Material für die beiden nächsten Lieferungen (bis 1383) vollends ergänzt, so daß mit deren Drucklegung demnächst begonnen werden kann. Kurt Schmidt war wiederum im Vatikanischen Archiv zu Rom für die Regesten thätig; er wird seine Nachforschungen noch eine Zeit lang fortsetzen. — Für die Regesten der Markgrafen von Baden hat Prof. Dr. Witte den Anfang des zweiten Bandes druckfertig ausgearbeitet und aus mehreren Archiven Deutschlands und der Schweiz wiederum reiche Ausbeute für die Publikation gewonnen. Bei den Nachforschungen im Karlsruher Generallandesarchiv hat ihn der am 4. Mai ausgeschiedene Hilfsarbeiter für die allgemeinen Zwecke der Kommission Dr. Hölscher unterstützt, an dessen Stelle am 1. September Fritz Frankhauser aus Straßburg getreten ist. — Bezüglich der Fortführung der Regesten der Pfalzgrafen bei Rhein wurde beschlossen, daß der ursprüngliche Plan einer Bearbeitung derselben bis 1508 aufgegeben und der Abschluß des Werkes auf das Jahr 1436 festgesetzt werde, wobei für die Zeit König Ruprechts auch die auf das Reich bezüglichen Urkunden volle Berücksichtigung finden sollen. Die Bearbeitung wird Dr. Sillib, Kustos an der Universitätsbibliothek in Heidelberg, unter Professor Dr. Wille’s Leitung übernehmen. — Von den Oberrheinischen Stadtrechten hat Dr. Köhne unter Leitung des Geh. Rats Professor Dr. Schröder die fränkische Abteilung erheblich gefördert. Von der schwäbischen Abteilung bearbeitet Dr. Hoppeler das Stadtrecht von Überlingen, Privatdozent Dr. Beyerle das von Konstanz. Für die Herausgabe der gleichfalls einen Bestandteil dieser Sammlung bildenden elsässischen Stadtrechte hat der Landesausschuß für Elsaß-Lothringen die Mittel bewilligt. Das von Dr. Gény bearbeitete Stadtrecht von Schlettstadt befindet sich bereits unter der Presse.
Von der Politischen Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden ist der von Archivrat Dr. Obser bearbeitete fünfte Band im Druck. — Die Sammlung und Herausgabe der Korrespondenz des Fürstabts Martin Gerbert von St. Blasien konnte infolge mehrfacher Abhaltung der Bearbeiter Geh. Rat Dr. v. Weech und Archivassessor Dr. Brunner nur wenig gefördert werden. Doch steht ihr Abschluß im nächsten Jahre zu erwarten. — Dem zweiten Band der [S. 203]Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften wird Professor Dr. Gothein, der Geschichte der badischen Verwaltung Privatdozent Dr. Ludwig sich auch fernerhin widmen. Von dem Oberbadischen Geschlechterbuch hat Oberstleutenant a. D. und Kammerherr Kindler von Knobloch einen beträchtlichen Teil des Manuskripts für weitere Lieferungen ausgearbeitet.
Mit der Sammlung und Zeichnung der Siegel und Wappen der badischen Gemeinden war wie bisher der Zeichner Fritz Held beschäftigt. Er hat im Berichtsjahr für 14 Städte und 155 Landgemeinden neue Siegel beziehungsweise Wappen entworfen und aus den Urkundenbeständen des Generallandesarchivs 1374 Siegel von Stadt- und Landgemeinden aufgezeichnet. Damit ist bereits eine erhebliche Vorarbeit geleistet für das zweite Heft der Siegel der badischen Städte, das die Kreise Baden, Offenburg, Freiburg und Lörrach umfassen und im nächsten Jahr ausgegeben werden soll. — Die Pfleger der Kommission waren unter Leitung der Oberpfleger Prof. Dr. Roder, Archivrat Dr. Krieger, Professor Maurer, Professor Dr. Wille und Stadtarchivar Dr. Albert für die Ordnung und Verzeichnung der Archive von Gemeinden, Pfarreien, Grundherrschaften etc. thätig. Es steht jetzt nur noch eine geringe Zahl von Archiven aus.
Von der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (Neue Folge) ist der XV. Band unter der Redaktion von Archivrat Dr. Obser für den badischen und von Archivdirektor Professor Dr. Wiegand für den elsässischen Teil erschienen, in Verbindung damit die unter Leitung des Sekretärs stehenden Mitteilungen der Badischen Historischen Kommission (No. 22).
Das Neujahrsblatt für 1901, von Stadtarchivar Dr. Albert bearbeitet, wird eine Schilderung von »Baden zwischen Neckar und Main in den Jahren 1803 bis 1806« bringen.
Für die Herstellung von Grundkarten für die badischen Gebiete nach den Vorschlägen des Professors Dr. von Thudichum hat, einem Beschluß der vorjährigen Plenarversammlung gemäß, das Großh. Statistische Landesamt umfassende Arbeiten gemacht, die bereits ihrem Abschluß nahe sind.
Von dem im Jahr 1898 vollendeten Topographischen Wörterbuch des Großherzogtums Baden von Krieger erweist sich infolge starken Absatzes und fortdauernder Nachfrage eine zweite Auflage als notwendig. Die Kommission beschließt die Veranstaltung einer solchen in zwei Bänden und beauftragt den Bearbeiter mit den Vorarbeiten dazu. — Ferner wird die Herausgabe des fünften Bandes der Badischen Biographien, deren Fortführung die Kommission in ihrer 16. Plenarsitzung in ihr Programm aufgenommen hat, beschlossen und die Redaktion desselben dem bisherigen Herausgeber des Werkes, Geh. Rat Dr. v. Weech, und Archivrat Dr. Krieger übertragen. — Zu den Bänden 1 bis 39 der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins soll ein alphabetisches Wort- und Sachregister ausgearbeitet werden. Zum Zweck sorgfältiger Beratung über die Anlage und Durchführung dieser Arbeit wird eine Subkommission eingesetzt, die ihre Vorschläge der nächsten Plenarsitzung unterbreiten wird.
Die von der Kommission erfolgten Wahlen unterliegen noch höherer Bestätigung.
[1] Stuttgarter Lit. Ver., Hans Sachs XXIII. Bd., herausgeg. von E. Götze S. 318. »Ein gesprech in dem der dichter dem gefuersten abt in Allerspach sein valete und leczen spruch dediciret«.
[2] Im Einblattdruck des Gedichts, von dem noch weiter unten die Rede sein wird, steht für die obenstehende sechste Verszeile zu lesen: Endres Herneisen sein namen hat.
[3] Von den verrschiedenen Schreibweisen des Namen dürfte die hier gewählte die richtige sein; er selbst unterschreibt so, des Öfteren mit willkürlicher Verdoppelung des »n«. Herneise = Hornisse im Nürnbergisch-fränkischen Dialekt.
[4] Für die Beihülfe zum Nachweis einer Reihe von Daten über das Leben und Wirken des Künstlers ist der Verfasser Herrn Kreisarchivar Dr. Bauch in Nürnberg zu lebhaftem Danke verpflichtet.
[5] Ratsverl. vom J. 1562 Heft 4 fo. 6 vo. Kgl. Kreisarchiv Nürnberg.
[6] Die Originalabrechnungen S. 1. S. 134 im K. Kreisarchiv zu Nürnberg.
[7] Allerspach = Aldersbach, wornach die unrichtige Notiz bei Goetze a. a. O. zu berichtigen ist. In Niederbayern, im Bez.-Amt Vilshofen belegenes, ehemaliges Cisterzienserstift mit spätromanischer Kirche. Die Malereien Herneisens sind nicht mehr vorhanden. Sie wurden jedenfalls bei der im 18. Jahrh. erfolgten Neuausstattung der Kirche durch die Brüder Asam beseitigt.
[8] Die ältesten Porträts der Hauptschützengesellschaft Nürnberg. Festzeitung für das XII. deutsche Bundesschießen in Nürnberg 1897. S. 155 f.
[9] Die Clichés wurden dem Museum von der Hauptschützengesellschaft Nürnberg in dankenswerter Weise zum Abdruck überlassen.
[10] Nagler, Monogrammisten I S. 352.
[11] a. a. O. S. 321.
[12] S. K. Woermann, Wissenschaftliches Verzeichnis der Galerie Weber in Hamburg, S. 44 f.
[13] S. Becker, Jost Amman, S. 204 ff.
[14] S. Dr. Alfr. Bauch, Barbara Harscherin, vor dem Titel.
[15] S. O. von Heinemann in den Grenzboten 1895. S. 168 ff.
[16] A. f. K. d. V. 1855 Sp. 148.
[17] Deutsches Kunstblatt 1851, S. 405.
[18] S. R. Bergau, Der schöne Brunnen zu Nürnberg, Berlin 1871, S. 19 und Wallraff, Bericht über den Entwurf zur Wiederherstellung des schönen Brunnens, Nürnberg 1899 S. 11.
[19] Die Schreibweise wurde beibehalten, nur die im Original fast stets fehlende Interpunktion zum leichteren Verständnis beigefügt.
[20] = können.
[21] offenbar ist die weit kostspieligere Restauration des Jahres 1541 gemeint.
[22] wohl Schreibfehler für: mallen = malen.
[23] fassen = malen, Bildhauerei mit Gold und Farben bekleiden.
[24] = demütig.
[25] ergötzen = entschädigen.
[26] = malerei.
[27] = wir.
[28] = solchen.
[29] = tauglich.
[30] am Rand steht von Herneisens Hand dessen Name J. Adoling.
[31] gemeint sind, wie aus dem Brief Nr. 3 hervorgeht, das Geld, das er sich in Würzburg verdient hat.
[32] a. a. O. S. 11.
[33] Historische Blätter Nr. 5250 u. H. B. Wasserbaukunst 14.
[34] Bergau a. a. O. S. 5.
[35] Unterdessen hat die wirkliche, jetzt im Besitz des Herrn Architekt Wallraff befindliche Originalzeichnung von Pencz sich vorgefunden. S. Wallraff a. a. O. S. 9.
[36] Mitgeteilt von Baader, A.f.K.d.d. Vorzeit 1870 Sp. 91f.
[37] Man beachte die naive Ausdrucksweise für: es ist mir bitter Ernst mit meiner Klage
[38] = Firnis.
[39] = während der Arbeit am schönen Brunnen ausreichen würde.
[40] = am Schluß der Arbeit.
[41] Unverständlich; vielleicht soll es Pflug heissen = Arbeit, im Gegensatz zu der folgenden Metapher: die Mühle zu Würtzburg steht still = in Würtzburg habe ich keine Arbeit oder kein Geld zu erwarten.
[42] = zur Sprache gebracht werden, nämlich das halb geschlagene, doppelt so dick wie das gewöhnliche Blattgold.
[43] Nöten.
[44] zu ergänzen = währt oder reicht.
[45] = nötig ist.
[46] Wetterfahne.
[47] = gewollt.
[48] = defendiren, verantworten.
[49] Aus der angezogenen Denkschrift von Walraff und vom Magistrat der Stadt zum Abdruck gütig überlassen.
[50] vielleicht auf das Sitzen im Brunnentrog auf der Zeichnung bezüglich.
[51] = ihnen.
[52] nicht verständlich, vielleicht = Büchlein etc. Goldes.
[53] = hin und wieder.
[54] = geflossen.
[55] = dafür mit einer geringen übrigen Habe aufkommen.
[56] Beindt = Peunt, Name des städtischen Bauhofes.
[57] Der Brief liegt im Original von Herneisens Hand und in einer Reinschrift mit kleinen orthographischen, grammatikalischen und stylistischen Verbesserungen vor.
[58] = Gitter.
[59] Herneisen hat also beim Gitter auch wieder 48 fl. vom ursprünglich geforderten Preis nachgelassen.
[60] Der Lobspruch ist des Öfteren abgedruckt. Die hier gegebene Stelle, nach: Waldau, Beiträge zur Geschichte der Stadt Nürnberg III. 235.
[61] Der Verfasser hofft in der Folge auf die interessante Thätigkeit Dietterlins am Lusthausbau in einem besonderen Aufsatz zurückkommen zu können.
[62] Nach Bader, A.f.K.d.d.V. 1870 Sp. 91 f.
[63] Mitt. d. germ. Mus. 1899, S. 134 f.
[64] Kgl. Kreisarchiv Nürnberg, Nürnberger Totenbücher Nr. 4752. 1607–12. Pfarrei St. Sebald. 1610. »13. April. Der Kunstreich Andreas Herneisen Flachmaler am Geyersberg.«
[65] Unter den Erörterungen, welche die Arbeit veranlaßt hat, sind von besonderem Interesse die Ausführungen von A. de Waal: »Fibulae in Adlerform aus der Zeit der Völkerwanderung« in der Römischen Quartalschrift XIII (1899) S. 324 ff. De Waal weist darin auf eine der letzten Arbeiten de Rossis hin, die dieser im Bulletino della commissione archeologica communale di Roma, 1894, S. 158–163 unter dem Titel »Fibula d’oro aquiliforme« hat erscheinen lassen. Die beigegebene Tafel XI gibt neben der im Besitz des Germanischen Museums befindlichen nach der genannten Publikation de Rossis noch vier weitere Adlerfibeln größeren Umfangs wieder. Die eine derselben (Nr. 4) ist eine der bekannten beiden aus vergoldeter Bronze gefertigten Fibeln des Cluny-Museums, die sich in Originalgröße schon bei Charles de Linas, Orfèvrerie mérovingienne: Les oeuvres de Saint Éloi et la verroterie cloisonnée (Paris 1864) auf der letzten Tafel unter A abgebildet findet. Sie wurde samt ihrem Gegenstück zu Castel bei Valence d’Agen in Aquitanien gefunden. Zwei andere erheblich kleinere, gleichfalls zusammengehörige und sich entsprechende Adlerfibeln (Nr. 3a und 3b bei de Waal) wurden 1888 in einem Grabe an der Via Flaminia beim Coemeterium Sancti Valentini, doch außerhalb seines Bezirks gefunden. Als Nr. 1 endlich, ist auf der Tafel bei de Waal eine Adlerfibel abgebildet, welche genau der Nürnberger Fibel entspricht, nur daß der Kopf des Adlers statt nach rechts nach links gerichtet ist, wodurch in der That sehr wahrscheinlich wird, daß wir in dieser Fibel das gesuchte Gegenstück zu den unsrigen vor uns haben. „De Rossi“, so führt de Waal aus, „erhielt die Photographie »dal fortunato possessore sig. cav. Vito Serafini, che l’ha rinvenuta la fibia in un suo podere di vocabolo Lagucci, parrochia di Domagnano nel territorio di S. Marino«“. „Daß die fibula des Herrn Serafini“, fährt de Waal fort, „identisch sei mit der dem Museum zu Budapest angebotenen, ist sehr wahrscheinlich. Cesena und S. Marino liegen so nahe bei einander, daß die verschiedene Ortsangabe nicht ins Gewicht fällt. Auch die Ausfindungszeit, um 1893, stimmt bei beiden überein; de Rossi bezeichnet 1894 den Fund der Mariner als »scoperta testè avvenuta«. Wird von der Fibel, die in Budapest angeboten wurde, gesagt, daß das Auge durch einen weißen Stein, mit einem Granat in der Mitte gebildet sei, so zeigt ein gleiches die Abbildung auf unserer Tafel“. Zwar sind Kopf und Hals des Adlers hier ziemlich verdrückt, was von der in Budapest angebotenen Fibel nicht ausdrücklich erwähnt wird, doch fällt dieser Umstand nicht schwer ins Gewicht und werden wir das von de Rossi veröffentlichte Stück daher vorderhand wohl als zu unserem Schmuck gehörig betrachten dürfen. Leider bleibt auch nach de Waals schätzenswertem Hinweis der gegenwärtige Aufbewahrungsort jener anderen Fibel zunächst noch dunkel.
Daß die Kreuze auf den mittleren Rundschildchen der Fibeln nicht durchaus das christliche Symbol zu bedeuten brauchen, sondern an sich ebensowohl als bedeutungslose Zierformen genommen werden könnten, wie dies de Waal zu thun geneigt ist, versteht sich von selbst. Angesichts der beiden Fische jedoch, die auf einer der zu dem gleichen Schmuck gehörigen beiden schildförmigen Platten im Budapester Nationalmuseum dargestellt sind, scheint mir die erstere Annahme, daß wir es in der That auch in jenen Kreuzen mit dem christlichen Symbol zu thun haben, doch nicht so gewagt und möchte ich mich nach wie vor zu dieser Auffassung bekennen.
Ebensowenig kann ich mich mit de Rossis und de Waals Ansicht befreunden, derzufolge Fibelpaare dieser Art als „militärischer Gürtelschmuck“, „militärische Dekorationen der Germanen zur Zeit der Völkerwanderung“ zu betrachten wären. Ein Schluß von den beiden kleinen Fibeln von der Via Flaminia, die in der Gegend der Hüften des daselbst Bestatteten gefunden wurden, auf Fibeln von der Art und Größe der unsrigen oder ihres Gegenstücks, erscheint mir von vornherein wenig zulässig; und wie sollte man sich, falls jene Ansicht das Richtige träfe, die Auffindung dieses Fibelpaares zusammen mit anderem offenbar zu dem gleichen Schmuck gehörigen weiblichen Geschmeide, wie Haarnadel, Ohrringe, überhaupt erklären? Im übrigen fehlt es mir an dieser Stelle leider an Raum, ausführlicher auf diese Frage einzugehen, und ich begnüge mich deswegen damit, hier nur noch einen Abschnitt aus einem Briefe Julius Naues, der meine Ansicht über die Bestimmung der Fibeln teilt, wiederzugeben. Herr Dr. Naue schrieb mir am 13. März unter anderm:
„Rossis und de Waals Ansicht, daß diese großen Fibeln als Gürtelschmuck gedient haben sollen, kann ich nicht teilen. Wir wissen bestimmt, daß in den fränkischen Frauengräbern, welche Abbé Cochet beschreibt, die Fibeln von den Frauen meistens paarweise getragen wurden, und zwar lagen sie bei den Skeletten auf der Brust, links und rechts (Cochet, La Normandie souterraine etc. Paris 1856. S. 265); ebenso verhält es sich in den angelsächsischen Gräbern von Fairford und Marnham-Hill (Akerman, Remain of pagan Saxondom S. 37 und 38), und in Selzen fand Lindenschmit (Das germanische Totenlager bei Selzen, Tafel 10 und 11) bei zwei Frauenskeletten je ein Paar Fibeln, eine auf der Schulter, die andere auf der Brust“.
„Auch Fausset, Inventorium Sepulcrale, edited Ch. R. Smith bestätigt, daß die Fibeln bei den Skeletten auf der Brust lagen. — Von Nordendorf geben die Fundberichte leider die Lage der Fibeln nicht an, doch ist es nach meinem Dafürhalten zweifellos, daß sie ebenfalls auf der Brust getragen wurden, bzw. hier die Gewänder oder den Mantel zusammenhielten“.
„Auf dem großen Mosaik in S. Vitale in Ravenna mit der Darstellung der Kaiserin Theodora und ihren Hofdamen trägt die Kaiserin auf der rechten und linken Brustseite je eine große, runde, mit Perlen besetzte Fibel, während die beiden neben ihr stehenden Kämmerer auf der rechten Achsel die Spangenfibel haben, wie die Mehrzahl der Männer auf dem gegenüber befindlichen Mosaik des Kaisers Justinian“.
„Da unter Theoderich dem Großen und sicher auch unter seinen Nachfolgern Vieles von den Byzantinern und Römern angenommen worden ist, so wohl auch die Art und Weise, die Schmucksachen (also ebenfalls die Fibeln) zu tragen“.
„In vorhistorischen Gräbern — der Hallstattzeit — habe ich die Fibeln bei den Skeletten stets in der Nähe der Achseln oder auf der Brust (links und rechts) gefunden, so die großen halbmondförmigen Bügelfibeln mit den zwei Vögeln oben und mit den in Kettchen angehängten Klapperblechen“.
„All dieses spricht dafür, daß die Fibeln nicht als Gürtelschmuck verwendet worden sind“....
Allerdings schreibt dies N. noch ohne genauere Kenntnis des Aufsatzes von de Waal; doch ergibt sich aus seinen Ausführungen zur Genüge, daß es auch in unserm Falle näher liegt, an Frauenschmuck als an militärischen Gürtelschmuck zu denken.
[66] Katalog der Kunst-Sammlungen des ... Cavaliere Carlo Morbio. München 1883. In Kommission bei Theodor Ackermann.
[67] In den Atti e memoire della r. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, III. serie, vol. V. Bologna 1887 S. 333–414.
[68] Vgl. z. B. noch Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission IV, (1859) S. 326 Fig. 6. u. S. 327. L. Lindenschmit, Handbuch der deutschen Altertumskunde I (1880–1889) S. 474 und Taf. XXII Nr. 7, Taf. XXX u. a. m.
[69] Vergl. Dannenberg, Grundzüge der Münzkunde 2. Aufl. (1899) S. 257.
[70] Abgebildet in den Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum I S. 105 Fig. 1–5.
[71] G. Seeger, Peter Vischer der Jüngere. Leipzig A. Seemann 1897 und die Besprechung desselben durch A. Bauch in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 13. Heft 1899 Seite 290.
[72] Mitteilungen Bd. I, Jahrgang 1886, sowie Ortwein, Nürnberg Taf. 14. Ferner P. J. Rée, Nürnberg. Seemann 1900. Fig. 134.
[73] Ebenda Bd. II, Jahrg. 1887, Seite 34, Taf. XVI.
[74] Ausführlicheres über P. Flötner in dem Exkurs zu diesem Aufsatz.
[75] C. Friedrich. Augustin Hirsvogel als Töpfer. Selbstverlag. Nürnberg 1885.
[76] S. Wellisch in »Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereines zu Wien« Band XXXIV. S. 71, sowie Ebenderselbe in der Zeitschrift des Österr. Ingenieur- und Architektenvereines, Jahrg. 1899. S. 335.
[77] H. Stegmann, Die Rochuskapelle zu Nürnberg. Fr. Bruckmann, München 1885. Seite 25 ff.
[78] Quellenschriften zur Kunstgeschichte X. S. 151.
[79] Ratsbuch 15. Fol. 138. 139, cf. Friedrich a. a. O. p. 12.
[80] Unsere Handschrift 4355, von Fuhse und Lange als vertrauenswürdiger betrachtet, hat statt dessen: »in Model gegossen«.
[81] Ortwein LIII. Blatt 44.
[82] Ortwein Nürnberg, Blatt 26 und 27.
[83] Ortwein Nürnberg, Bd. 1 und 2.
[84] Friedrich a. a. O. 58. Abgebildet im »Kunsthandwerk«. Herausgeg. v. Bucher und Gnauth. Spemann 1875. S. 22.
[85] Röper-Bösch Taf. 9.
[86] Ich kenne das Stück nur aus der Abbildung bei J. Brinckmann. Das Hamburgische Museum für Kunst und Gewerbe. S. 296. Wir werden ihm später nochmals begegnen.
[87] Friedrich a. a. O. 58 f. — Taf. XXXVII.
[88] Es liegt mir die Absicht ferne, mit diesen Bemerkungen das Verdienst Friedrichs schmälern zu wollen. Ihm bleibt immer das nicht zu unterschätzende Verdienst, die sogenannten Hirsvogelkrüge endgültig abgethan und mit Energie auf die erneute Untersuchung dieses sicher sehr wichtigen Meisters hingewiesen zu haben. Auch ist eine Arbeit über ein Gebiet der deutschen Renaissance, besonders in Verbindung mit dem Kunstgewerbe stets verdienstvoll, da dies Gebiet mit Ausnahme der Malerei seiner Schwierigkeit halber von den Kunsthistorikern ängstlich gemieden wird.
[89] Lange, P. Flötner Nr. 14, Taf. VII.
[90] Lange, Nr. 11, 12, 13, 14, 16, 17, Taf. VII. Noch im 17. Jahrhundert oft als Vorlage von Hafner benutzt, wofür die Beispiele bei Lange, der diese beiden Öfen, da nicht publiziert und geradezu unbekannt, nicht anführen konnte.
[91] Abbildung bei Ortwein Abteil. 54. Franken Blatt 10.
[92] Ortwein, Nürnberg Taf. 79, danach die Abbildung in den Mitteil. des German. Museums, Bd. I. Jahrg. 1886, S. 257.
[93] Über die Entstehung desselben vergl. K. Lamprecht, Der Ursprung des Bürgertums und des städtischen Lebens in Deutschland. Hist. Zeitschr. Bd. 67, pg. 385 ff.
[94] Nähere Mitteilungen über die Ausgaben, die ich benützt habe, finden sich in den Anmerkungen der ersten Sammlung.
[95] Vergl. Steinhausen, a. a. O. pg. 16.
[96] Geiler, Brösaml. I. fol. 94b. Auf dem Markte war ein Standgeld und außerdem während der Messe Gebühren an das Kaufhaus zu zahlen. Vergl. Kurt Kaser, Politische und soziale Bewegungen im deutschen Bürgertum zu Beginn des 16. Jahrhdt. Stuttgart. 1899. pg. 119.
[97] Die Abbildungen sind uns, wie die des ersten Aufsatzes in dankenswerter Weise von der Verlagsbuchhandlung Eug. Diederichs, Leipzig, zur Verfügung gestellt.
[98] Geiler, Brösaml. I. fol. 104b.
[99] Ibid. —
[100] Vergl. z. B. die Beschreibung, die Grimmelshausen im Simplicissimus (Halle’sche Neudrucke) pg. 470 davon macht: »Ein Marckschreyer oder Quacksalber (welche sich selbs vornehme Aertzte, Oculisten, Bruͤch- und Steinschneider nennen, auch ihre gute pergamentine Briefe und Siegel darüber haben) ... wann er am offnen Marckt mit seinem Hanß Wurst oder Hanß Supp auftritt, und auf den ersten Schrey und phantastischen krummen Sprung seines Narrn mehr Zulauffs und Anhoͤrer bekompt, als der eyfrigste Seelen-Hirt, der mit allen Glocken dreymahl zusammen laͤuten lassen....«
[101] Geiler, Brösaml. I. fol. 104b.
[102] Grimm W.-B. III. pg. 509 führt zwar die Beziehungen zu den Ausdrücken »blauer Dunst« und »Zeitungsente« an, gibt aber keine eigentliche Erklärung. Die oben zitierte Stelle scheint unter einer blauen Ente deutlich ein Kinderspielzeug zu verstehen, gibt also den Ausgangspunkt für die Redensart: »von blauen Enten reden«, die zuerst nur bedeutete, von Nichtigkeiten reden, und dann in eingeengter Bedeutung geradezu den Begriff »lügen« annahm.
[103] Geiler, Brösaml. I. fol. 95 b.
[104] Geiler, Der seelen Paradiß. (Straßburg, Matth. Schürer 1510.) fol. 218.
[105] Es ist nicht ganz klar, ob Geiler an dieser Stelle meint, ein Priester solle nicht mit Geld sich einen Vertreter zur Darreichung der Sakramente verschaffen, oder ob er auf die Stolgebühren anspielen will, die so schweres Ärgernis erregten und dem Publikum nicht anders als ein Sakramentenhandel erschienen, wie denn auch der Reformationsprediger Joh. Eberlein von Günzburg sich darüber äußert: »Wir verkaufen alles, Taufen, Absolution, Begräbnis, Heirat, Ein- und Aussegnen von Kindbetterinnen .... und so geben wir entweder Ärgernis oder wir werden Bettler.«
[106] Geiler, Postill III fol. 64 b.
[107] Vgl. Steinhausen a. a. O. pg. 50.
[108] S. o. Jahrg. 1899, pg. 115.
[109] Ibid. pag. 111.
[110] Geiler, Brösaml. I. fol. 91. Vgl. auch Ibid. fol. 93b/94.
[111] Ibid. II. fol. 58b. Vergl. Steinhausen a. a. O. pag. 36 u. 39 ff. J. Kamann, Aus dem Briefwechsel eines jungen Nürnberger Kaufmanns im 16. Jahrh. Mitteilungen a.d. german. Nationalmuseum. 1894, pg. 9 ff.
[112] Geiler, Brösaml. I. fol. 90b.
[113] Geiler, Narrensch. fol. 134.
[114] Vergl. Steinhausen a. a. O. pg. 51 ff.
[115] Geiler, Predigen teütsch. (Augsburg. H. Otmar 1510.) Fol. 112 b.
[116] Opusculum de cognicione peccatorum venialium et mortalium. (Augsburg. Joh. Froschauer 1503.) fol. d Ia.
[117] Nider, a. a. O. fol. 17a.
[118] Geiler, Von den dry marien, wie sie vnsern heren iesum cristum wolten salben... (Straßburg. Joh. Grüninger 1520.) Fol. 15b.
[119] Nider, a. a. O. fol. 5b/6a.
[120] Vgl. W. L. Schreiber, Manuel de l’amateur de la gravure sur bois et sur métal. Nr. 1986, 2.
[121] sester = ein Maß für Getränke und Frucht.
[122] Nider a. a. O. fol. 5a/b.
[123] Gerson a. a. O. fol. d I. b.
[124] Nider a. a. O. fol. 16a.
[125] Ibid. fol. 8 a.
[126] Ibid. fol. 8a/b.
[127] Geiler, Paradiß fol. 120.
[128] Eine sehr gute Zusammenstellung hierüber gibt das oben genannte Buch von Kurt Kaser.
[129] Vgl. a. a. O. S. 379–387.
[130] R. Majocchi, Le crocette auree langobardiche del civico museo di storia patria in Pavia (Bolletino Storico Pavese, Anno II, Fasc. III. 1894). — S. 8 f. des Separatabdrucks dieser Arbeit, den Herr Professor Majocchi in Pavia so liebenswürdig war, mir zur Verfügung zu stellen, werden in den Anmerkungen noch 14 weitere Kreuze dieser Art erwähnt, sodaß sich die Zahl der in Italien bisher gefundenen und bekannt gewordenen Kreuze dadurch auf 95 erhöht.
[131] J. Naue im Katalog der Sammlung Morbio S. 61.
[132] Vergl. Orsi a. a. O. S. 413 f.
[133] Vergl. E. A. Stückelberg, Langobardische Plastik. Zürich 1896. S. 88 ff.
[134] Orsi S. 414. Majocchi S. 14 f. etc.
[135] Vergl. Orsi S. 383 ff.
[136] Vergl. Stückelberg a. a. O. S. 81 f.
[137] Über Goldschmiede und den Betrieb der Goldschmiedekunst bei den Langobarden siehe u. a. Orsi a. a. O. S. 395 ff.
[138] Vgl. Stückelberg a. a. O. S. 19 f.
[139] Die drei Zitate nach Stückelberg, a. a. O. S. 71 f.
[140] Vgl. Orsi a. a. O. Tavola IV Nr. 5 u. 7; letzteres Kreuz, in getreuerer Abbildung auch bei Majocchi als Nr. 2 auf der dem Aufsatze beigegebenen Tafel.
[141] Vgl. Orsi Nr. 1, 2–11, 12, 20–21, 22, 23, 25, 26, 32–45, 49, 53, 54, 56, 58–61, 69, 70.
[142] Vgl. Orsi Nr. 2 11 (S. 340 f.).
[143] Vgl. Orsi Nr. 53 (S. 363), Majocchi S. 19.
[144] Orsi S. 409 f.
[145] Majocchi S. 26.
[146] Majocchi S. 21.
[147] Anderer Meinung scheint Wolfg. M. Schmid, Eine Goldschmiedeschule in Regensburg um das Jahr 1000 (München 1893) S. 16. Er sagt von dem Filigran am Deckel des Codex aureus: »Der Faden ist von feinster Ausführung; denn auch die kleinste Perle desselben zeigt um ihren Aequator einen Schnitt, der oft nur mit dem Vergrößerungsglas sichtbar wird«.
[148] Abbildung bei E. aus’m Weerth, Das Siegeskreuz etc. (Bonn 1866) Taf. I.
[149] Abbildung bei E. aus’m Weerth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters in den Rheinlanden Taf. LV.
[150] Abgebildet bei Labarte, Histoire des arts industriels, I. Bd. Tafel XXX. Das Gebetbuch befindet sich jetzt im Louvre-Museum.
[151] Abbildung bei Aus’m Weerth, Siegeskreuz S. 16.
[152] Nicht unerwähnt will ich lassen, daß Herr Prälat Schneider in Mainz, dieser vorzügliche Kenner kirchlicher Altertümer, das Kreuz für eine griechische, d. h. byzantinische Goldschmiedearbeit hält.
[153] Vgl. Bock, Karls des Großen Pfalzkapelle und ihre Kunstschätze 1, 54 ff. Aus’m Weerth, Kunstdenkmäler S. 94 und Taf. XXXIV.
[154] Aus’m Weerth, Kunstdenkmäler Tafel XXIV, XXV Nr. 4. Clemen, Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz II, 3. S. 45, Nr. 4.
[155] Abbildung bei Aus’m Weerth, Kunstdenkmäler Tafel XLVI Nr. 2b.
[156] Abbildung bei Didron, Annales archéologiques XX, 264.
[157] Vgl. Andresen, Der deutsche Peintre-Graveur etc. V. Bd. S. 4 ff.
[158] Nagler, Künstlerlexikon Bd. XXI S. 192 f. Monogrammisten III. Bd. S. 146 (Nr. 470).
[159] a. a. O. S. 1 ff.
[160] Blatt 136b der genannten Handschrift.
[161] Bl. 98b wird von Hasdrubal Rosenthaler, der wegen zahlreicher Betrügereien gegen seine Herren, die Fürleger, von 1583 an mehr denn 20 Jahre auf dem Fröschturm gefangen saß, gesagt: »yetziger zeitt aber, 1614, wohnet Er vff dem Diellinghoff inn seins Vatern Behaussung« ... etc.
[162] Andresen, Peintre-Graveur Bd. IV S. 331 ff. Vgl. auch Nagler, Künstlerlexikon XXI, S. 193 ff.
[163] Andr. Nr. 2: Nürnberg von Osten, nach Lorenz Strauch.
[164] Andr. Nr. 3: Die vortreffliche Wappenfolge.
[165] Andr. Nr. 4: Die große aus neun Blättern bestehende Ansicht von Prag; Andr. Nr. 5: Die streitende Kirche Christi und Andr. Nr. 7: Das Religionsgespräch zu Regensburg 1601.
[166] Vgl. Nagler a. a. O. S. 193 f., Andresen a. a. O. S. 331 f.
[167] In Betracht kommen könnten auch die Nummern 1325 und 1347, bei denen sich das Merkzeichen ebenfalls aus H und B zusammensetzt. Zeitlich scheinen sie indessen weniger zu entsprechen. Hieronymus Bang mag um 1590 Meister geworden sein. 1587 wird er in den Ratsverlässen noch »Goldschmiedsgeselle« genannt.
[168] in = an, ungefähr.
[169] Von hier an bis m. p̅r̅i̅a̅ eigenhändige Unterschrift des Kurfürsten.
[170] Vattern = Schwiegervater; Muetter = Schwiegermutter. Maximilian war in zweiter Ehe vermählt mit Maria Anna, Tochter Ferdinands II. und der Kaiserin Maria Anna, geborenen Prinzessin von Bayern.
[171] Erste Gemahlin Ferdinands III., Maria Anna, Schwester Philipps IV. von Spanien.
[172] Von hier an eigenhändige Unterschrift.
[173] Vgl. F. Luthmer: Der Schatz des Freiherrn Karl v. Rothschild. Meisterwerke alter Goldschmiedekunst, Bd. II Taf. 50.
[174] Vgl. Quirin v. Leitner: Die hervorragendsten Kunstwerke der Schatzkammer des österreichischen Kaiserhauses. Wien 1870–73. Taf. 12 u. bes. 13.
[175] Vgl. die Anhänger bei Marc Rosenberg: Die Kunstkammer im Großherzogl. Residenzschlosse zu Karlsruhe. 1892. Taf. 6.
[176] Vergl. J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 4 I, S. 268/9, wo die weiteren Angaben nachzulesen sind.
[177] E. L. Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel der heidnischen Vorzeit. Berlin 1867 II, S. 113.
[178] Drucke und Holzschnitte des 15. und 16. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. II. Gedichte vom Hausrat aus dem 15. und 16. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben. Mit einer Einleitung von Dr. Th. Hampe. Straßburg. Heitz. 1899. Ich citiere nach dieser Ausgabe.
[179] In kleinerem Maßstabe abgebildet bei Hampe, a. a. O. S. 16.
[180] Das Nähere darüber siehe Hampe, a. a. O. S. 9.
[181] Abgebildet in G. Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch III Nr. 1195.
[182] Mit diesen Buchstaben werde ich künftig die einzelnen Dockenhäuser zitieren.
[183] Wie ich höre, wird demnächst in Velhagen & Klasings Monatsheften eine Abbildung des Hauses erscheinen.
[184] Über die Einrichtung vgl. Boesch, a. a. O.
[185] Aufnahmen der Kapelle mit sorgfältigen Detailzeichnungen hat der akademische Architektenverein des Karlsruher Polytechnikums unter Leitung von Professor Weinbrenner gemacht und 1884 herausgegeben. Vgl. auch die schöne Abhandlung von Robert Vischer in seinen Studien zur Kunstgeschichte S. 583 ff.
[186] Vgl. meinen Aufsatz: Zur Narrenliteratur des 16. Jahrhunderts. »Mitteilungen«. 1898. S. 133 ff.
[187] Vgl. Grimm, W. B. VI, 139: »landsknecht, ein Kartenspiel, das in landsknechtkreisen aufgekommen«. Nach obiger Stelle scheint die Dauer jenes Spieles in der Volkssprache scherzhaft als Zeitmaß gebraucht zu sein, eine Wortverwendung, die Grimm a. a. O. nicht kennt.
[188] G. Hoet, Catalogus. Haag 1752. D. I. S. 131 ff.
[189] cav. Piancastelli in L’Arte 1898, Maggio-Giugno, domande e risposte.
[190] Herrn Böhler bin ich für verschiedene bereitwilligst gemachte Angaben zu Dank verpflichtet.
[191] Il microcosmo della pittura. Cesena 1657. S. 142 »una grande historia in quadro assai capace, e molto ben conservata«. — Piancastelli a. a. O.
[192] In desen tyt had men de maniere te makē groote doecken met groote belden in, die men gebruyckte om Camers mede te behangen als met Tapytserye, en waren van Ey — verwe oft Lym — verwe ghedaen. — Van Mander, Schilderboeck 1604. fol. 203, het leven van Rogier van Brugghe.
[193] B. 18 und 24, 25; für das Abschneiden der Baumkronen B. 39 und 78.
[194] Man vergleiche diesen fast sentimentalen Moseskopf mit dem gewaltig festen von Claux Sluters Mosesbrunnen in Dijon, dem 100 Jahre früher geschaffenen Werk eines Künstlers holländischer Herkunft!
[195] Van Mander sah in dem — jetzt zugrunde gegangenen — obersten Teil der Außenseiten der Flügel dieses Bildes das Datum 1531.
[196] Über die Datierung dieses Werkes schrieb ich in meinem Aufsatz »Das jüngste Gericht des Lucas van Leyden« im Repertorium für Kunstwissenschaft. XXII, 1.
[197] Vgl. Grimm. W. B. IV, 1074; Dieffenbach, Glossarium latino-germanicum S. 241 a; Du Cange III, 332b, foculare: idem quod focus, locus ubi ignis asservatur, vel domus ipsa. Über den indogermanischen Herd vgl. O. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Straßburg. K. J. Trübner 1901. I. Halbbd. S. 367 ff.
[198] Zum Teil mag dieser saubere Anstrich auch auf das Muster der Prangküchen zurückzuführen sein. Dieselben waren übrigens nicht etwa nur in Nürnberg üblich, wie in P. J. Marperger, »Vollständiges Küch- und Keller-Dictionarium ...« Hamburg. Benj. Schillers Wwe. 1716 folgende Stelle auf S. 671 beweist: »Eine Prunck- oder Prang-Küche nennet man die, in welcher alles Zinn- Meszing- und Eiserne Küchen-Geräth in schönster Ordnung, blanck gescheuret, gefeget und poliret stehet, die Feuer-Heerde sauber angestrichen, und welche fast niemahls oder wenig gebrauchet, oder doch so einmahl darin gekochet worden, solche gleich wieder gesaubert und aufgewaschen wird. Dergleichen Küchen findet man in Holland und Teutschland sehr viel, da sich manche Haus-Frau sehr piquiret, eine solche propre und mit allerhand zu einer vollkommenen Küchen erforderten Küchen-Geräth (auch selbst das Porcelain nicht ausgeschlossen) wohl versehene Küche zu haben, und solche denen, die sie besuchen, aufzuweisen; Dabey sie dann eine andere kleine und zum täglichen Gebrauch gewidmete Neben-Küche haben, damit die Prang-Küche nur immer in ihrem Esse bleiben möge.«
[199] »Wickilstein« ist auch als Ortsname bezeugt: Graff, Ahd. Sprachschatz I, 708. Zur Erklärung dieses Namens will Förstemann, Ad. Namenbuch 2 II, 1585 an eine Kom-Position mit wig bellum denken. Sollte nicht vielmehr eine solche mit ahd. wîh, goth. veihs sacer anzunehmen sein?
[200] brantert = Bezeichnung für Feuerbock.
[201] Wenn Meringer, Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien. XXIII, S. 177 sagt: »man erzählt mir, daß man in Krain einen Feuerbock für kleines Holz auf den Herd setzt, längere Scheiter aber über zwei Böcke legt. Das letztere sieht man bei Schultz (Fig. 115) nach einem altniederländischen Gemälde des Leipziger Museums«, so trifft diese letztere Bemerkung nicht zu. Auf dem betreffenden Bilde »Liebeszauber« ist nur ein Feuerbock zu sehen.
[202] Den Ausdruck »Eigenbrätler«, den ich z. B. bei Hottenroth, Deutsche Volkstrachten I, S. 88 finde, in diesem Zusammenhange zu verwerten, trage ich deshalb Bedenken, weil bei Grimm, W. B. III, 97 steht: »Eigenbrötler, m. qui rem familiarem ipse curat.« Diese letztere Form würde sich als eine Komposition mit -brot darstellen.
[203] Vgl. Nrn. 56, 86, 87, 94, 95.
[204] Vergl. Mitteilungen der Anthropolog. Gesellschaft in Wien. XXX. (1900.) S. 6b.
[205] Mit Ofenblech nicht zu verwechseln sind die »Ofeneisen« (vgl. Tucher, a. a. O. 86. »dem stathafner . . . für ofeneiszen zu vernewen«) Grimm, W. B. VII, 1159 erklärt sie gleich »Ofenanker« als »eiserne Schiene, die die steine oder kacheln des ofens zusammenhält«.
[206] Vgl. Bancalari a. a. O. S. 6b/7a.
[207] Vgl. Heyne, a. a. O. S. 167.
[208] L. Diefenbach a. a. O. S. 298a. Ibid. 93a caminus rauch lach, 251c fumigale rauchfankch Grimm. W. B. VIII, 248 fagunale.
[209] Heyne a. a. O. S. 120/1.
[210] Grimm, W. B. VII, 1162 gibt meines Erachtens jenen Dichterstellen eine falsche Auslegung. Dort bedeutet das »Ofenrohr« weder »rohr in einem Ofen (zum braten oder warm halten)« wie in einer von Grimm angeführten Stelle aus Hebel’s Werken, noch »rohr zum anblasen des feuers im ofen«, sondern nur »rauchrohr eines ofens«.
[211] Vgl. Heyne, a. a. O. S. 121. Marperger, a. a. O. S. 686. Du Cange III, 760 Ignitabulum, Ignis receptaculum. Dieffenbach 65a Bacilla kolpfanne. Vergl. H. A. Müller u. O. Mothes, Illustriertes Archäologisches Wörterbuch der Kunst des germanischen Altertums, des Mittelalters und der Renaissance. Die Artikel »Kohlenbecken« (mit Abbildung) und »Handwärmer«.
[212] Grimm, W. B. IV, 121 unter »Hafen«.
[213] Vgl. H. Havard, Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. Artikel: »réchaud« (mit Abbildungen).
[214] Marperger a. a. O. S. 685; Du Cange III, 332; Dieffenbach, 565a; 241a. focular efoͤcher vel plaspalck. S. o. S. 165. Müller & Mothes, a. a. O. S. 561. Art. »Kamingerät«. Dieffenbach 237b. Du Cange III, 313c. Hans Paur a. a. O., Abt. 7.
[215] Abgebildet bei Müller & Mothes, Illustriertes Archäologisches Wörterbuch der Kunst des germanischen Altertums, des Mittelalters und der Renaissance I, S. 124. Fig. 98. Vgl. auch Thom. Wright, The homes of other days. London 1871. Fig. 107. (14. Jahrh. British Museum. M. S. Reg. 10. E. IV.) Dazu S. 163: »the cook makes use of a pair of bellows, which bears a remarkably close resemblance to the similar articles made in modern times.« Bei Hans Paur a. a. O. Abt. 24. ein Wedel mit Öse zum Anhängen.
[216] Marperger S. 685. Du Cange I, 623. batillum (vel batilus): thuribulum, pala, ferrum quo colliguntur carbones. I, 625. batulus: sunt autem batilli ferrea instrumenta, palae similitudine, quibus prunae in fornacibus colliguntur. V, 15. pala instrumentum coquinarium, batillum. Dieffenbach 65a. bacilla (est pala ferrea) ein ysen-schuffel. 298a. infurnibulum. 405c pala.
[217] Marperger S. 685. Dieffenbach 242b. Müller & Mothes a. a. O. S. 561. Art. »Kamingeräth«. Du Cange VI. 503a, 532c. Hans Paur a. a. O., Abt. 7.
[218] Grimm, W. B. III, 1594. hamus igni alendo suscitando fiurhâke.
[219] Heyne a. a. O. S. 171. Anm. 73. Grimm. W. B. VII, 1161. Dieffenbach. 591a. tractula, instrumentum cum quo trahitur ignis de fornace. Idem fornaculum vel fornalium. ofenkrucken. 504c. rutabulum ofenkruck, womit Dieff. 369a morungum rurscheyt in Zusammenhang bringt.
[220] Mitteilungen der Anthrop. Ges. Wien XXX, 10a.
[221] Ibid. 3a.
[222] Dieffenbach 500c. rotabulum eyn vorck, cum qua ignis mouetur in fornace. Hans Paur a. a. O., Abt. 7.
[223] Ibid. 34a audena feurhundt vel ofengabel.
[224] Dieffenbach 493a. repofocillum, retropophinum, vurstulppe, fuerstolpp, feur-hall vel -loch, id quod ponitur super ignem de nocle, vuyrdecksel des nachtes. Fraglich ob die Bezeichnungen für Feuerschirm: anticipa, antipirium, umbella auch für den Stülp gebraucht sind. Dieff. 38 a. anticipa, antipirium furschirm, schirmbret vor dem feur. Du Cange I, 305 b. antipirgium. Gall. Ecran, umbella, qua ante ignem utuntur. Marperger a. a. O. 685.
[225] Vgl. Bancalari a. a. O. S. 3 a.
[226] Grimm W. B. I, 1614. Dieffenbach 613 c. Hans Paur a. a. O. Abt. 8.
[227] Vgl. Dieffenbach 519 c. scopetum eyn beszemplatz.
[228] Grimm W. B. III, 1747.
[229] Marperger a. a. O. S. 686. Dieffenbach 422 c. penicellum, genus spungiae ad tergendos humores et scutellas, wadel, keerwisch.
[230] Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien. XXII, 106.
[231] Vgl. Ibid. XXI, 144, 146. Abb. 181. (römischer Feuerbock) XXIII, 177.
[232] Mitteilungen der prähistorischen Kommission d. Ak. d. Wiss. Wien I, Nr. 3 (1893).
[233] Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien. XXI, 148.
[234] Ibid. S. 137 b.
[235] Du Cange I, 250. Art. »andena«.
[236] Ibid.
[237] Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien. XXI, 152.
[238] Ibid. S. 135.
[239] Ibid. XXX, S. 3b.
[240] Dieffenbach 34 a andena, brantraite, -ruthe, brandeisen. 204 a epigergium prantreyt, eyn windeysern, herdram. Marperger S. 685. Brandruthen canteriolus, focarius. Grimm W. B. II, 297 sagt etwas unklar: »Brandbock, craticula, eiserner Rost, auf dem die brände liegen, was ahd. prantreita, mlat. andena hiesz.« Unter »Bock« findet sich dann allerdings eine zutreffende Beschreibung. Schmeller giebt leider nichts, weder unter »Bock« noch unter »Roß«. — Ähnliche Bezeichnungen finden sich in England. Vgl. Wright a. a. O. S. 450: »the iron dogs, or andirons, that supported the fuel. It may be observed that these latter, in the North of England and in some other parts, were called cobirons.«
[241] Dieffenbach 34 a, 204 a incipiendium, fulcrum focarium, andena, ferrum quod sustinet ignem. 575 a ledale, tedarium, tedifera, ferrum, super quo ponuntur ligna in foco. Du Cange. I, 761. II, 55. Caminale, fulcrum focarium. Gall. chenet, cujus usus est in caminis. Inventar. M. S. bonorum Joan. de Madathano ann. 1450. Item plus duo caminalia ferri ponderis quadraginta librarum. II, 324 b. II, 328. III, 792 b. III, 900 a. ipopigerium. IV, 927 a. ypopyrgium. IV, 115 a/b. IV, 23 c. VI, 655 c. Inventar, ann. 1476 ex Tabul. Flamar. »Item plus in camino ignis ejusdem aulae duos canes sive Tresseti ferri ponderis viginti librarum ferri ad communem extimationem.« Müller & Mothes, a. a. O. 561. Art. »Kamingeräth«. Heyne, a. a. O. S. 243. Anm. 114.
[242] Auch das Hausratblatt des Hanns Paur (Schultz a. a. O.) hat keinen Feuerbock!
[243] a. a. O. S. 138 (Heyne S. 243. Anm. 114, zitiert versehentlich: 133.)
[244] Muratori, Script. Ital. XI, Sp. 26.
[245] Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrh. III, 255. — Vgl. auch Wright, a. a. O. S. 450 ff.
[246] Vgl. Wright a. a. O. Fig. Nrr. 249, 268, 296.
[247] Von August Schmarsow über die Bildwerke des Naumburger Domes, von Arthur Weese über die Bamberger Domskulpturen.
[248] A. Sach: Hans Brüggemann und seine Werke (1896) und: Eduard Tönnies: Leben und Werke des Würzburger Bildschnitzers Tilmann Riemenschneider 1468–1531. (1900.)
[249] Franz v. Reber: Hans Multscher von Ulm. — Sitzungsberichte der kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1898, Bd. 2, S. 1–68.
[250] F. v. Reber, a. a. O. S. 68.
[251] Herr Direktor v. Bezold teilt mir mit, daß sich eine Holzstatue aus dem 15. Jahrhundert im Louvre durch einen ähnlichen kreuzförmigen Einsatz auf dem Lendner auszeichnet.
[252] Friedrich Hottenroth: Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgerätschaften der Völker alter und neuer Zeit. Stuttgart 1891. II. Band. S. 77.
[253] Ich zitiere nach der deutschen Übersetzung der »böhmischen Chronika Wenceslai Hagecii« von Johann Sandel aus dem Jahre 1596.
[254] und der Gudela v. Holtzhausen († 1371). — Abgebildet bei Hefner-Alteneck: Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften vom frühen Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1883. Taf. 201.
[255] Joseph Neuwirth: Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens. II. Der Bildercyklus des Luxemburger Stammbaumes aus Karlstein. Prag 1897 und I. Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in Böhmen. Prag 1896.
[256] Abgebildet bei Hefner-Alteneck a. a. O., Band III, auf Taf. 215.
[257] Hottenroth a. a. O. S. 85.
[258] Abgebildet bei Hefner-Alteneck a. a. O., Bd. IV, auf Taf. 229.
[259] »Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert.« Familienausgabe. Zweiter Halbband. Wien. 1892. S. 249 ff.
[260] a. a. O.
[261] a. a. O. Band IV, auf den Tafeln 240, 249 und 237.
[262] Abgebildet in A. von Heyden’s Blättern f. Kostümkunde. Neue Folge, zweiter Band. 93 Blatt.
[263] Abgebildet bei W. Lübke: »Geschichte der Plastik«. 3. Aufl. Leipzig 1880. S. 509.
[264] Aus dem 15. Jahrhundert.
[265] Ich wurde durch eine gütige Mitteilung des Herrn Direktors Bösch auf sie aufmerksam gemacht. — Eine Notiz im »Chronicum Nordgaviense« des Johann Braun (Germ. Museum. Handschrift 7172, S. 113) besagt, daß der Rat der Stadt Sulzbach die Statue im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts »renovieren« ließ. Man wird sie damals neu bemalt und vergoldet haben.
[266] Vgl. Bode: Geschichte der deutschen Plastik. Berlin, 1887. S. 94 fg. Daselbst Abbildung. — Ein Gipsabguß des Bildwerks im Germ. Museum. — Dazu vgl. »Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epoche«. Berlin 1888. S. 86.
[267] Der Kopf des Gottfried von Bouillon ist — trotz Bergau — zweifellos alt; neu (von 1824) ist nur der untere Teil der Statue, vom Knie abwärts. — Wie viel besser passen übrigens die drei Nägel an dem Barett der Berliner Statue zu einem Herzog und Beschützer des hl. Grabes als zu einem deutschen Kaiser, an dessen Krone sich niemals drei Nägel in der Art befanden. Die unter den verschollenen Reichsreliquien aufgeführte und oft abgebildete hl. Lanze umschließt nur einen Nagel und der schmale eiserne Reif der lombardischen Krone, angeblich aus einem Nagel vom Kreuz Christi hergestellt, kommt nach außen gar nicht zum Vorschein, so daß Bode’s Deutung auf ein Kaiserbildnis auch hiernach unhaltbar ist.
[268] Berthold Riehl: Sanct Michael und Sanct Georg in der bildenden Kunst. München 1883. S. 49.
[269] Nach Gg. Hager, in der Zeitschrift »Das Bayerland« 1895, S. 437 ist sie nur eine Stiftung des Herzogs Christoph.
[270] »Ein mittelalterlicher Alpenkünstler« in der »Deutschen Rundschau,« Bd. 92. (1897.) S. 426.
[271] Vgl. ἑρμηνεία τη̄ς Ζωγραφικῆ (ed. Didron-Schäfer, 1855, S. 374) und die Georgsdarstellung bei Donatello und den meisten Künstlern.
[272] Abgebildet bei Hefner-Alteneck a. a. O., Band III, auf Taf. 126.
[273] Mit diesen Nummern sind sie im VI. Band der Kataloge des bayr. Nationalmuseums aufgeführt und daselbst auch abgebildet.
[274] Die Wandgemälde in der Burg zu Neuhaus behandelte J. E. Wocel, (Wien 1859), die Fresken in Padua am eingehendsten P. Schubring. (Altichiero und seine Schule. Leipzig, 1898. S. 48 ff. u. bes. S. 75, 76.)
[275] Vgl. Bode: Geschichte der deutschen Plastik. S. 89, 90.
[276] G. v. Bezold und Dr. B. Riehl: Die Kunstdenkmale des Regierungsbezirkes Oberbayern. Tafel 112.
[277] Nr. 482 im VI. Band der Kataloge des Museums. Abbildung ebenda auf Taf. VIII.
[278] Nr. 522 im VI. Band der Kataloge; gleichfalls abgebildet auf Taf. VIII.
[279] Direktor Dr. H. Graf.
[280] »Kunsthistorische Gesellschaft für photographische Publikationen« unter Leitung von A. Schmarsow und A. Bayersdorfer. IV. Jahrg. 1898. Taf. 18.
[281] Abgebildet auf Tafel XVIII und Tafel XIV des Katalogs. (VI. Band.)
[282] Vgl. Bode: Geschichte der deutschen Plastik. S. 197 und Dr. P. Albert Kuhn: Allgemeine Kunstgeschichte. 16. Lief. 1898.
[283] Vgl. »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Oberösterreich und Salzburg.« Wien 1889. S. 233.
[284] »Zeitschrift für bildende Kunst«. Neue Folge. 6. Jahrg. 1895. S. 26. — Da die inzwischen von Stiassny wiederholt angekündigte Lichtdruck-Publikation des Hochaltars von St. Wolfgang, in deren Text er auch über dieses Schnitzwerk eingehender handeln wollte, immer noch nicht erschienen ist, kann sich mein Urteil über dasselbe leider nur auf die a. o. O. gegebene Abbildung desselben (Autotypie) gründen.
[285] Die Kunstdenkmale des Königreiches Bayern. Erster Band; bearbeitet von G. v. Bezold u. Dr. Berth. Riehl a. a. O. und »Zeitschrift des bayrischen Kunst-Gewerbe-Vereins in München.« Jahrgang 1890. S. 62.
[286] Es kann dies nicht befremden, wenn man bedenkt, daß im Verhältnis zu der großen Anzahl von Denkmälern nur für äußerst wenige Werke der Meister bisher bestimmt werden konnte. So haben wir selbst in Michael Pacher, nach Stiassny, den Bildschnitzer des Wolfganger Altars nicht zu sehen. Friedrich Herlin ist, der Ansicht von Haack in seiner Erlanger Habilitationsschrift — S. 21 u. 32 — zufolge, wohl auch nicht Holzschnitzer; bei Lukas Moser und Joh. Schühlein ist die Frage gleichfalls noch offen und selbst Meister so bedeutender Werke, wie des Blaubeurener und Heilbronner Altars oder der Statuen in Blutenburg bei München vermögen wir nicht mit Namen zu nennen. Und wie viel besser steht es mit der Autorenfrage bei den Werken der Steinplastik?
[287] Dr. Albert Kuhn a. a. O. S. 434.
[288] Das andere Hauptgebiet der Holzbildnerei (die baltischen Küstenländer) kommt hier zweifellos nicht in Betracht.
[289] Julius Böhler, München.
[290] Robert Stiassny in der »Deutschen Rundschau« a. a. O. S. 415.
[291] Vgl. Georg Seeger: Peter Vischer der Jüngere. J. D. Leipzig 1897, woselbst die vorangegangenen Untersuchungen von Rettberg, Dr. H. Stegmann und die den Ausschlag gebende von Direktor v. Bezold zusammengefaßt sind. (S. 132–140.)
[292] Nach dem Abschluß dieser Arbeit stellte Herr Direktor v. Bezold mir gütigst einen Brief des Herrn Prof. Dr. Neuwirth zur Verfügung, aus welchem ich ersehe, daß dieser gründlichste Kenner böhmischer Kunst annimmt, der Meister unsers hl. Georg habe böhmische Werke gekannt und sich vielleicht teilweise nach und an ihnen gebildet, daß die Statue aber nicht für »böhmisch« d. h. in Böhmen entstanden, sondern für oberösterreichisch oder salzburgisch zu halten sei.
[A] Albrecht Dürer von M. Zucker. Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. XVII. Jahrgang. Vereinsjahr 1899–1900. Halle a. S. Max Niemeyer. 184 SS. 6 Mark. Die Illustrationen sind uns vom Herrn Verleger freundlichst zur Verfügung gestellt worden.
[B] Winckelmann und seine Zeitgenossen von Carl Justi. Zweite durchgesehene Auflage. 3 Bände. Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel. 1898.
Anmerkungen zur Transkription:
Der vorliegende Text wurde anhand des Jahrganges 1900 der ‚Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum‘ so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Einzelne Satzzeichen wurden bei offensichtlichen Druckfehlern stillschweigend korrigiert, ausgenommen in Zitaten, welche stets unverändert übernommen wurden. Inkonsistente Schreibweisen wurden so belassen, wie im Text angegeben. Die im Original teilweise falsche Nummerierung der Bildtafeln wurde sinngemäß korrigiert.
Das Inhaltsverzeichnis wurde der Übersichtlichkeit halber vor den Text gesetzt.
Die folgenden Stellen wurden korrigiert:
Gesperrter Text wird in serifenloser Schrift wiedergegeben.
Links zu größeren Bildansichten sind möglicherweise nicht aktiv.
End of the Project Gutenberg EBook of Mitteilungen aus dem Germanischen
Nationalmuseum, by Various
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MITTEILUNGEN AUS DEM GERMANISCHEN NATIONALMUSEUM ***
***** This file should be named 49084-h.htm or 49084-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/9/0/8/49084/
Produced by Karl Eichwalder, Martin Ågren, Reiner Ruf, and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.