![[klicken für größere Darstellung]](images/p183i_small.jpg)
The Project Gutenberg EBook of Reise über Indien und China nach Japan., by
Richard von und zu Eisenstein
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Reise über Indien und China nach Japan.
Tagebuch mit Erfahrungen, um zu überseeischen Reisen und
Unternehmungen anzuregen.
Author: Richard von und zu Eisenstein
Release Date: November 1, 2014 [EBook #47260]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REISE ÜBER INDIEN UND CHINA ***
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by The Internet Archive/Canadian
Libraries)
Tagebuch
mit Erörterungen, um zu überseeischen Reisen und Unternehmungen anzuregen.
Von
Richard Freiherr von und zu Eisenstein
k. u. k. F.-M.-L.
Mit vier Figuren im Texte und einer Reisekarte.
Wien 1899.
Druck und Commissionsverlag von Carl Gerold's Sohn
I., Barbaragasse 2.
Seiner
kaiserlichen und königlichen Hoheit
dem
durchlauchtigsten Herrn General der Cavallerie
Erzherzog Franz Ferdinand
von Oesterreich-Este
zur Disposition des Allerhöchsten Oberbefehles,
Ritter des Ordens vom Goldenen Vliese, Grosskreuz des St. Stephan-Ordens,
Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, Ehren-Grosskreuz des souveränen Johanniter-Ordens,
Ehrenmitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
etc. etc. etc.
in tiefster Ehrfurcht und Ergebenheit allergehorsamst gewidmet
vom
Verfasser.
| Seite | |
| Einleitung | 1 |
| Vorbereitung für die Reise | 3 |
| Antritt der Reise. Fahrt von Triest nach Port Said | 9 |
| Aufenthalt in Port Said | 15 |
| Fahrt von Port Said nach Aden | 16 |
| Aufenthalt in Steamer Port bei Aden | 21 |
| Fahrt von Aden nach Bombay | 22 |
| Aufenthalt in Bombay | 24 |
| Fahrt von Bombay nach Penang | 45 |
| Aufenthalt in Penang | 52 |
| Fahrt von Penang nach Singapore | 55 |
| Aufenthalt in Singapore | 58 |
| Fahrt von Singapore nach Hongkong | 60 |
| Aufenthalt in Hongkong | 62 |
| Fahrt von Hongkong nach Shanghai | 66 |
| Aufenthalt in Shanghai | 68 |
| Fahrt von Shanghai nach Kobe | 72 |
| Aufenthalt in Japan. | |
| A. Aufenthalt in Kobe und Ausflug nach Osaka | 74 |
| B. Aufenthalt in Kioto | 82 |
| C. Die Eisenbahnfahrt von Kioto nach Yokohama | 92 |
| D. Aufenthalt in Yokohama | 95 |
| E. Aufenthalt in Tokio | 101 |
| F. Fahrt von Tokio nach Kobe | 113 |
| G. Zweiter Aufenthalt in Kobe und Ausflug nach Himeji | 114 |
| H. Fahrt von Kobe nach Shimonoseki und Schlusswort über meinen Aufenthalt in Japan | 119 |
| Rückreise von Japan nach Oesterreich-Ungarn. Fahrt von Shimonoseki nach Hongkong | 126 |
| Aufenthalt in Hongkong | 128 |
| Fahrt von Hongkong nach Singapore | 132 |
| Aufenthalt in Singapore | 134 |
| Fahrt von Singapore nach Colombo | 138 |
| Aufenthalt auf der Insel Ceylon. | |
| A. In Colombo | 144 |
| B. Eisenbahnfahrt von Colombo nach und Aufenthalt in Kandy | 148 |
| C. Eisenbahnfahrt von Kandy nach Nuna oya und Aufenthalt in Nuwera Eliya | 151 |
| D. Eisenbahnfahrt von Nuna oya nach und Aufenthalt in Colombo | 159 |
| Fahrt von Colombo nach Port Said | 163 |
| Ankunft in Port Said und Weiterfahrt nach Marseille | 168 |
| Ankunft in Marseille und Weiterfahrt nach Wien | 170 |
| Reiseauslagen und Reisepläne | 172 |
| Kritik über die Vorbereitungen zur Reise | 175 |
| Schlusswort | 177 |
zu v. Eisenstein, Reise nach Japan.

Trotzdem, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Elektricität und Dampf auch die weitesten Entfernungen um ein Bedeutendes verringern und ungeachtet der stetig fortschreitenden Civilisation, welche die meisten der früher bestandenen Beschwerlichkeiten von den Reisenden ferne hält und dieselben mit allem nur denkbaren Comfort umgibt, so klingt dennoch, besonders in unserem schönen Oesterreich-Ungarn, das Project, eine Weltreise zu machen, fast noch wie ein waghalsiges Unternehmen, welches nur in der Vollkraft der Jahre und mit dem Aufwande von schier unerschwinglich grossen Geldmitteln der Verwirklichung zugeführt werden kann.
Als in mir selbst, angeregt durch das eingehende Studium der höchst interessanten und sehr lehrreichen Reisebeschreibung Sr. k. u. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand, der Wunsch immer lebhafter wurde, mir auch einmal die grosse weite Welt etwas anzusehen, so entschloss ich mich endlich nach reiflicher Erwägung, ungeachtet meines vorgerückten Alters, dennoch diesen meinen Herzenswunsch thatsächlich durchzuführen.
Und wie sehr belohnten mich die Fülle von schönen, unvergesslichen Eindrücken, sowie die Menge von werthvollen Erfahrungen, die ich auf meiner Reise gesammelt habe, für einen Entschluss, den ich späterhin auch keinen Augenblick zu bereuen Ursache hatte!
Da ich während meiner Reise immer mehr zur Einsicht gelangte, dass dem intelligenten und bemittelten Theil der Bevölkerung unserer Monarchie durch die Scheu vor weitgehenden Reisen und Unternehmungen namhafte Vortheile entgehen, so entschloss ich mich nach meiner Rückkehr in die Heimat, die täglichen Aufzeichnungen und Erörterungen zusammenzustellen und meinen Landsleuten zu dem Zwecke zu übergeben, um in ihnen die Lust zu Weltreisen zu wecken, um darzuthun, dass die Scheu vor einer Gefahr, auf Dampfschiffen zu fahren, in der Jetztzeit ebenso unberechtigt ist, als dieselbe vor einem halben Säculum nicht motivirt war gegen die Fahrt auf den Eisenbahnen, um nachzuweisen, dass die Auslagen für die Reise, speciell bei der Benützung der Dampfschiffe des Oesterreichischen Lloyd, nicht so gross sind, als allgemein angenommen wird, und endlich um die Aufklärung zu geben, dass Jenen, welche eine solche Reise machen, bedeutende Vortheile in physischer und psychischer Richtung erwachsen, und dass ihnen gegebenen Falles auch materielle Gewinne zufallen werden.
Was auch der gegenwärtigen Veröffentlichung zur Erreichung des vorgesteckten Zieles fehlen mag, den einen Vortheil wird sie dem Leser unbedingt bieten können, dass die Schilderungen der Erlebnisse und Eindrücke wahrheitsgetreu sind, und dass das Streben vorherrschte, die praktischen Reise-Erfahrungen bestens zu verwerthen.
Vorerst verschaffte ich mir von der commerziellen Direction der Dampfschiffahrts-Gesellschaft des Oesterreichischen Lloyd in Triest, sowie von der Lloydagentie in Wien, I., Freisingergasse, den Fahrplan, die Informationen für Reisen und ein wohl veraltetes, aber noch brauchbares illustrirtes Handbuch für die Fahrten mit unserem Lloyd.
Laut des Fahrplanes fahren am 23. jeden Monates die gewöhnlichen, nach Japan verkehrenden Dampfschiffe von Triest ab, verweilen in Port Said, Suez, Aden und Karachi je circa einen Tag, in Bombay sieben Tage, dann in Colombo, Penang und Singapore je ungefähr einen Tag, ferner in Hongkong und Shanghai je zwei bis drei Tage und landen endlich nach beiläufig zwei Monaten in Kobe in Japan.
Auf diesen gewöhnlichen Dampfschiffen fallen die erste und zweite Classe zusammen, wobei den Passagieren dieser vereinten Classen der Anspruch auf eine Cabine mit zwei Betten für zwei Personen zusteht, sowie dies bei den fremdländischen Dampfschiffen auch für Passagiere erster Classe der Fall ist. Ferner haben die Reisenden der vereinten ersten und zweiten Classe auf den Lloydschiffen die Berechtigung, die Salons, das ganze Schiffsdeck und die Badecabinen zu benützen, und werden ihnen tagsüber fünf Mahlzeiten servirt, und zwar: von 6-8 Uhr Früh Kaffee oder Thee mit Brot, um 9 Uhr Thee, Eier, eine warme Speise und Obst, um 1 Uhr eine kalte und eine warme Speise und Käse, um 6½ Uhr Suppe, zwei warme Gerichte, Salat, Cürrie mit Reis, Mehlspeise, Käse, Obst und Kaffee und endlich um 9 Uhr Abends Thee, Brot und Butter.
An Bagage ist ein Metercentner frei, für jeden weiteren Metercentner ist für die Strecke von Triest bis Kobe 9 Goldgulden oder 10 fl. 80 kr. ö. W. zu zahlen. Von der Bagage kommen die kleinen Gepäcksstücke in die Cabine, die grossen dagegen gelangen in den Laderaum.
Der gewöhnliche Fahrpreis für die erste und zweite Classe von Triest nach Kobe beträgt 425 Goldgulden oder 510 fl. ö. W. Hierbei hat der Passagier auf der 63 Tage währenden Fahrt in der Zeit des siebentägigen Aufenthaltes in Bombay das Schiff zu verlassen und hat seine Unterkunft und Verpflegung auf dem Lande aus Eigenem zu bestreiten; somit hat der Reisende 56 Tage Verpflegung und Unterkunft auf dem Schiffe. Da nur für die Beköstigung per Tag 3 Goldgulden oder 3 fl. 60 kr. ö. W. gerechnet werden, so entfällt von dem obbezeichneten Fahrpreise von 510 fl. der Betrag von 201 fl. 60 kr. ö. W. für die Verpflegung und der Rest von 308 fl. 40 kr. ö. W. für die Fahrt und Unterkunft.
Officiere haben nur die Hälfte des Fahrpreises zu zahlen. Dieselben haben demnach für die Fahrt nur 154 fl. 20 kr. ö. W. und für die Verpflegung den obgenannten Betrag von 201 fl. 60 kr. ö. W., im Ganzen also 355 fl. 80 kr. ö. W. für die Fahrkarte erster und zweiter Classe von Triest nach Kobe zu entrichten.
Es fahren ausserdem von Triest am 3. jeden Monates Schnelldampfer nach Bombay, welche dort die am 23. des verflossenen Monates abgegangenen gewöhnlichen Dampfer antreffen. Es können also nach Japan Reisende am 3. des Monates von Triest mit dem Schnelldampfer nach Bombay fahren und von dieser Stadt die Weiterreise nach Japan mit dem gewöhnlichen Dampfer fortsetzen, sie haben aber dann in Bombay nur zwei bis drei Tage Aufenthalt und es erhöht sich der Preis für die erste Classe um 150 Goldgulden oder um 180 fl. ö. W.
Ich entschied mich für die Fahrt mit dem gewöhnlichen Dampfer und gewann dabei den Vortheil, mich längere Zeit in Bombay aufhalten und diese so interessante Stadt eingehend besichtigen zu können.
Was die Wahl für die Ausdehnung und für die Jahreszeit der Reise anbelangt, so waren für mich folgende Erwägungen bestimmend. Die Dauer der Reise bis Japan sammt den verschiedenen Aufenthalten beträgt, wie erwähnt, ungefähr zwei Monate. Wollte ich von Japan mit dem nächsten von dort abgehenden Lloyddampfer zurückkehren, so hätte ich in Japan nur vier bis fünf Tage Aufenthalt gehabt. Auf der Rückreise hätte ich dann von Colombo aus mit einem anderen Lloyddampfer über Madras nach Calcutta hin und wieder zurück nach Colombo fahren können, und zwar mit einem Aufenthalte von eilf Tagen in Calcutta und einem Zeitverbrauche von einem Monate für diese Reise, natürlich vorausgesetzt, dass Abgang und Ankunft der Zweiglinien mit der Hauptlinie normalmässig correspondiren. Die Dauer meiner ganzen Reise hätte in diesem Falle annähernd fünf Monate betragen. Die Erwägung aber, dass der Aufenthalt in Japan nur vier Tage betragen würde, die dortige Bevölkerung indess in ihrem gegenwärtigen raschen Aufschwunge jedenfalls ein sehr grosses Interesse in Anspruch nimmt, hat mich bewogen, für meinen Séjour in Japan die Zeit von einem Monate festzusetzen. Bei dem Umstande jedoch, dass eine Reise in den Tropengegenden über den 1. Juli hinaus der Regenperiode halber mit mannigfachen Beschwerlichkeiten verbunden ist, entschloss ich mich, die Reise Colombo-Calcutta aufzugeben. Besser wäre es wohl gewesen, und ist dies auch sehr anzuempfehlen, eine solche Reise überhaupt bereits am 23. September oder am 23. October anzutreten, um hierauf im Frühjahre wieder zurückzukehren, ich that es aber nicht, weil ich am 2. December 1898 der Feier des Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers und Königs beiwohnen wollte.
Ich möchte hier noch besonders hervorheben, dass wenigstens eine theilweise Kenntniss der englischen Sprache für eine derartige Reiseunternehmung unumgänglich nothwendig erscheint, da man sonst ausserhalb des Schiffes von dem Verkehre mit der Aussenwelt geradezu ausgeschlossen ist.
Zur besseren Orientirung für meine bevorstehende Reise und für die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten habe ich die beiden Bände des Werkes Sr. k. u. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand: »Tagebuch meiner Reise um die Erde 1892/93« noch einmal zur Hand genommen und hierin vorzüglich jene Stellen aufmerksam durchgelesen, welche Länder und Städte schildern, die ich berühren werde.
Zur Aufklärung darüber, was auf eine solche Reise mitzunehmen ist, habe ich an competenter Stelle Erkundigungen eingezogen und erhoben, dass man sich nur mit Herbst- und Sommerkleidern zu versehen habe, und die Tropenkleider später in Port Said oder in Suez, wo die betreffenden Kaufleute auf das Schiff kommen, anzuschaffen seien. Ferner wurde ich darauf aufmerksam gemacht, eine grössere Menge von Leibwäsche mit mir zu nehmen, da auf dem Dampfschiffe nur gewaschen, aber nicht geglättet wird, auch sei es für Raucher vortheilhaft, sich in genügender Menge mit Cigarren zu versehen. Dieselben unterliegen in keinem der anzulaufenden Orte der Verzollung. Nach diesen Angaben und nach weiteren Informationen und Rathschlägen entschied ich mich, nachstehende Gegenstände mitzuführen. Ich will dies als Anhaltspunkt für andere Reisende detaillirt angeben, und werde zum Schlusse die sich aus der Reise ergebende Kritik hierüber anfügen. So nahm ich mit:
An Tenniskleidern, auch als Tropenkleider zu benützen: Ein weisses Flanellcostume, zwei weisse Piquetcostume, zwei leichte Flanellhemden, einen Sweater, ein Paar braune Zeuglederschuhe, eine sehr leichte Mütze, und einen Gürtel. Auch ein Raquet führte ich mit mir.
An Jagdkleidern: Ein sehr leichtes grünes Costume, ein Paar leichte Woll- und ein Paar leichte Seidenstrümpfe, ein Paar Jagdstiefletten, und einen Jagdhut.
An Kleidern im Allgemeinen: Einen wasserdichten, ganz lichten und leichten Mantel, einen lichten Ueberzieher, einen Frackanzug mit schwarzem und weissem Gilet und schwarzem Beinkleid, einen langen Salonrock mit schwarzem Gilet und Beinkleid, einen Jaquetanzug mit lichtem und dunklem Gilet sammt gestreiftem Beinkleid, ein Smokingcostume, einen Saccoanzug, einen etwas wärmeren Jaquetanzug für den Fall, als es im nördlichen Theile von Japan im April noch kältere Tage geben sollte, acht verschiedenfärbige, hauptsächlich dunkle oder schwarze und weisse Cravatten, sechs Paar lichtere und zwei Paar schwarze Glacé-Handschuhe, einen Cylinderhut und einen Klappcylinder, einen runden dunklen Hut, einen grossen, aber ganz leichten weissen Filzhut und eine Reisekappe.
An Beschuhung: Zwei Paar Kalbleder-, zwei Paar Lackleder- und ein Paar Naturleder-Stiefletten, ein Paar Kalbleder- und ein Paar Lackleder-Morgenschuhe.
Ausserdem führte ich noch einen Regenschirm und zwei Stöcke mit.
An Wäsche: 20 Taghemden, darunter sechs Stück aus sehr dünnem Stoffe mit schwarzen, goldenen und Perlen-Knopfgarnituren, vier Nachthemden, sechs Unterbeinkleider, 24 Paar Socken, darunter 12 Paar sehr feine und seidenartige, 20 Taschentücher, 24 Halskrägen verschiedener Façon, sammt den dazu gehörigen Knöpfen und Cravattenhälter, drei Tricotleibchen verschiedener Dicke, zwei Leibbinden für den Fall des Bedarfes und vier Handtücher.
An Toiletteartikeln: Die nöthigen Wasch- und Kammrequisiten, Rasirmesser und Scheeren, mehrere Stücke Wasch- und Rasirseife, mehrere Düten Kalodont, ein Fläschchen Glycerin, Closetpapier.
An Medicamenten im Bedarfsfalle: Kalicrême, englisches Pflaster, Soda, Fiakerpulver, Doverische Pulver, Opium, Salicyl und Chinin; sämmtliche Medicamente waren in Glas- oder Blechbüchsen versorgt. Hierzu kamen noch eine Flanell- und eine Leinenbinde, sowie Kautschukpapier.
Die in Murray's Beschreibung von Indien für den dortigen Aufenthalt empfohlenen Medicamente: eine Flasche Chlorinds und zwei Schachteln Sorkelspils, sind bei uns nicht erhältlich und werden in Indien anzuschaffen sein.
An Gewehren: Einen schön ausgestatteten und sehr guten Mannlicher-Stutzen und ein gutes 12 mm-Jagdschrotgewehr.
An Patronen: 80 Stück Mannlicher-Patronen mit Expansivkugeln, 10 Stück Patronen mit Schrot Nr. 0 und 20 Stück mit Nr. 2, 30 Stück mit Nr. 4, 30 Stück mit Nr. 6, 30 Stück mit Nr. 8, und 40 Stück mit Nr. 12.
Für den Fall, als ich für eine länger währende Jagd einen Proviant benöthigen sollte, versorgte ich mich mit einigen Büchsen Fleischconserven und mit einer Flasche Cognac, und für den Fall, dass ich in Gelegenheit kommen sollte, einem mir zur Begleitung beorderten Jäger ein Geschenk zu machen, nahm ich Cravattennadeln mit Jagdemblemen mit.
An Bettrequisiten: Für die Eventualität einer weiteren Fahrt in das Innere des Landes und einer sich hierbei ergebenden Nachtunterkunft in kleinen Orten führte ich nach dem Rathe aus Murray's Handbuch an Bettzeug mit: eine gesteppte und zwei Wolldecken, einen Kopfpolster, Bettwäsche und natürlich auch eine Flasche Zacherlin.
Diese Bettsorten liess ich in eine wasserdichte, zeltartig zusammengenähte Plache wickeln, welche einerseits das Bettzeug vor Nässe bewahrt, und anderseits bei einem Lager unter freiem Himmel als Bettzelt verwendet werden kann.
An Rauchrequisiten: 1000 Stück Cigarren, 100 Stück Papierspitzen mit Rohrmundstück, einige Stück Lunte für das Feuerzeug, und 50 Schachteln schwedische Zündhölzer.
An Büchern: Die beiden Bände »Tagebuch meiner Reise um die Erde« von Sr. k. u. k. Hoheit dem Herrn Erzherzog Franz Ferdinand, beide Bände »Autour du monde« von Baron Hübner, beide Bände »Japan« von Baron Siebold, Murray's Handbücher »Indien« und »Japan«, das Illustrirte Handbuch des Oesterreichischen Lloyd, den Atlas von Andrée, ein englisches Dictionär und endlich eine grössere Anzahl belletristischer Werke.
An Schreibmaterial: Eine Schreibmappe, eine grössere Quantität von Schreib- und Briefpapier, nebst Couverts, Löschpapier, Federn, Siegellack, Syntheticon und endlich eine Blechbüchse, in der sich ziemlich viele Bögen durchsichtigen Papieres befanden, welche auf der einen Seite gummirt, und auf der anderen Seite mit den Adressen jener Personen beschrieben waren, denen ich von den verschiedenen Stationen meiner Reise aus Ansichtskarten zu senden beabsichtigte. Ich werde auf diese Weise in meinen Aufenthaltsorten nur die Adressen abzuschneiden, mit dem mitgenommenen Befeuchtungsapparate zu behandeln und dieselben auf die Adressseite der Ansichtskarten aufzukleben haben, wodurch ich der langwierigen Arbeit des Adressschreibens enthoben werde.
Ferner versah ich mich mit einem Fernglase, einer zusammenlegbaren Traglaterne (Excelsior lux) sammt Kerzen, einem Aneroid, Putzmitteln und Werkzeug, das ist Hammer, Zange, Stemmeisen und Schraubenzieher, sowie mit Visitkarten und last not least einem Reisepasse.
Um nicht zu viel Baargeld mit mir nehmen zu müssen, liess ich mir von der Creditanstalt für Handel und Gewerbe in Wien, I., Am Hof, einen Creditbrief ausstellen, laut welchem ich in der Chartered Banks of India, Australia and China in Bombay, Colombo, Hongkong und Yokohama bis zum 29. Juli 1899 succesive 500 Pfund Sterling beheben konnte.
Als Packgefässe habe ich drei schwarzgelb angestrichene Holzkoffer, einen grossen und einen kleinen Lederkoffer, einen Waterproof-Mantelsack, eine grosse Cylinderhut- und eine kleine Kappenschachtel, eine lange schwarzgelbe Kiste für Jagdgewehre und Patronen und einen wasserdichten Stoff zum Einwickeln des Bettzeuges mitgenommen, und ich versah jedes Stück mit meinem vollen Namen.
Der Vollständigkeit halber muss ich hier noch erwähnen, dass ich auch meine verschiedenen Uniformirungsgegenstände mit mir führte.
Ungeachtet der so vielen hier angeführten und von mir auf die Reise mitgenommenen Gegenstände überstieg die ganze Bagage keineswegs das auf dem Schiffe jedem Passagiere zustehende Freigewicht.
An Baargeld versorgte ich mich in Wien mit 600 fl. ö. W. und 30 Pfund Sterling. Das englische Geld zerfällt und stellt sich zu unserem Gelde in nachstehender Weise:
| 1 £ (Pfund Sterling oder sovereign) = 20 shilling = 12 fl. ö. W.; | |
| 1 sh (shilling) = 12 penny = 60 kr. ö. W.; | |
| 1 d (pence) = 5 kr. ö. W.; | |
| Silbermünzen: 1 fl. (florin) = 2 shilling = 1 fl. 20 kr. ö. W.; | |
| Kupfermünzen: | 6 penny (1 sixpence) = 30 kr. ö. W.; |
| 3 penny (1 threepence) = 15 kr. ö. W.; | |
| 1 pence = 5 kr. ö. W.; | |
| ½ pence (halfpence) = 2½ kr. ö. W. | |
Am 15. Jänner erhielt ich die Nachricht von der commerziellen Direction des Lloyd, dass der Dampfer Marie Valerie für die Fahrt nach Japan bestimmt sei, dass derselbe aber ausnahmsweise statt am 23. Jänner erst am 25. Jänner seine Fahrt von Triest antreten werde. Am 20. Jänner gelangte an mich die weitere Mittheilung von der Direction, dass die Abfahrt des Dampfers Marie Valerie bis auf den 30. Jänner verschoben werde, und am 21. Jänner erhielt ich das Telegramm, dass der Dampfer Maria Theresia am 25. d. M. bis nach Bombay abgehen werde, ohne dass die Fahrpreise hierdurch eine Aenderung erleiden.
Nun begab ich mich nach Triest, wo ich in Erfahrung brachte, der Dampfer Marie Valerie noch später als am 30. Jänner, der Dampfer Maria Theresia hingegen am 27. Jänner, um 4 Uhr Nachmittags, von Triest nach Bombay abgehen werde. Die Weiterreise von Bombay nach Japan würde dann auf dem Dampfschiffe Marie Valerie nach dessen Eintreffen in dem genannten indischen Hafen erfolgen.
In Erwägung des Umstandes, dass ich bei der Fahrt mit dem Maria Theresia-Dampfer einen längeren Aufenthalt in Bombay nehmen könne, entschied ich mich dafür, dieses Dampfschiff zu meiner Reise nach Indien zu benützen.
Es muss hier als eine beklagenswerthe Thatsache hingestellt werden, dass unsere gewiss so verdienstvolle Lloyddirection keinen grösseren Werth darauf legt, die einmal festgestellte Abfahrtszeit ihrer Schiffe auch genau einzuhalten. Es entstehen daraus, wie mir während der Reise vielfach von berufenen Persönlichkeiten mitgetheilt wurde, ganz erhebliche Nachtheile für den Verkehr an Personen und an Fracht und somit auch für die Gesellschaft selbst.
An dieser Stelle möchte ich noch dem commerziellen Director unseres Lloyd in Triest, Herrn Janni, meinen Dank aussprechen für die mir freundlich zu dem Zwecke übergebenen zwei Vorschreiben an die Lloydcapitäne und an die Lloydagenten, um diese aufzufordern, mir sowohl auf der Reise, als auch in den Aufenthaltsorten möglichst hilfreich beizustehen.
Und somit waren alle Vorbereitungen für meine grosse Reise, wozu ich auch nicht ermangelte, mir verschiedene anderweitige Empfehlungsschreiben zu erwerben und selbe mitzunehmen, zu Ende geführt, und so stand der Antritt der Reise selbst vor mir.
Es ist doch ein ganz eigenthümliches Gefühl, welches die Seele erfasst, wenn der Moment herannaht, das Land, die Heimat, zu verlassen, und von allen seinen Lieben auf geraume Zeit zu scheiden.
Die seit der Kindheit geliebten Bilder bleiben zurück, und neue Eindrücke machen sich geltend. Auf diese richtet sich der Forschungsgeist, dem sich jetzt neue Bilder von ungekannten, aus Beschreibungen und Erzählungen fast nur traumhaft geahnten Ländern erschliessen sollen. Diese Aussicht ergreift die Seele so mächtig, dass die trüben und wehmüthigen Gefühle über die bevorstehende Trennung zurückgedrängt werden, und es nicht vermögen, die Reiselust zu mindern.
Bei meiner Ankunft in Triest fand ich einen heftigen Borasturm vor, welcher bereits seit zwei Tagen tobte, ein Umstand, der ebenso den Wunsch rege machte, die Hafenstadt möglichst bald zu verlassen, als er zur Annahme berechtigte, dass der Beginn der Fahrt ein ruhiger sein werde.
Der Dampfer Maria Theresia ist ein grosses Schiff, circa 130 m lang und besitzt einen Fassungsraum für 3400 t; er umfasst viele Schlafcabinen mit 70 Betten, einen grossen Salon, ein kleineres, sehr elegantes Sitzzimmer, alle Räume mit elektrischen Flammen ausgestattet, einen grossen freien Raum auf dem Deck, Badecabinen etc. Das Schiff steht unter dem Commando des Lloyd-Schiffscapitäns Giuseppe Morovich. Für die Verpflegung der Passagiere und der Schiffsbemannung ist reichlich vorgesorgt und hat hierfür der zweite Capitän des Schiffes aufzukommen. Entsprechend grosse Vorräthe an lebenden Ochsen, Geflügel, an Victualien, Conserven und Südfrüchten sind vorhanden, und theils in den Magazinen, theils in der Eiskammer untergebracht.
Zur Schiffsbemannung gehören ausser den Matrosen noch Köche, Fleischer, Bäcker, Wäscher, Kellner, Kammerjungfern, Kleider- und Stiefelputzer, ja selbst Schlosser und Holzarbeiter. In den Schiffsräumen sind Küche und Backstube untergebracht und sehr zweckmässig eingerichtet.
Gegenwärtig sind an Fracht 2400 t verladen, zu deren Verfrachtung auf dem Lande zehn Lastzüge nöthig wären. Passagiere gab es nur sehr wenige auf unserem Schiffe, weil die Mehrzahl der in Triest weilenden Reisenden es vorzog, die Abfahrt des später abgehenden Dampfers Marie Valerie abzuwarten. In der vereinigten ersten und zweiten Classe befand sich ausser mir nur noch ein junger Holländer, dessen Reiseziel Rangun in Hinterindien war.
Den 27. Jänner, um 4 Uhr Nachmittags, ertönte das Signal zur Abfahrt unseres Schiffes. Langsam löst sich der Coloss vom Ufer los und manövrirt mit Hilfe eines vorgespannten Dampfers sehr behutsam, um sich auf dem verhältnissmässig kleinen Raume zu wenden. Dann geht es frisch darauf los in das unabsehbare weite Meer. Frei wird der Anblick auf Triest, immer weiter gestaltet sich das Bild des daran liegenden Geländes, und immer kleiner erscheinen die Gebäude, bis sich später die ganze Stadt nur mehr als ein weisser Flecken kenntlich macht, und auch dieser entschwindet nach und nach den Augen. Lebt wohl, meine Lieben, lebe wohl, mein geliebtes Oesterreich-Ungarn!
Zuerst verfügte ich mich in die mir angewiesene Cabine. Dieselbe lag nahe an dem grossen Salon und in der Mitte des Schiffes, weil sich da die Schiffsbewegungen weniger fühlbar machen, und befand sich der grösseren Helligkeit halber an der Bordseite. Eine solche Cabine ist 2·5 m lang, 2 m breit und 2·2 m hoch, und ihre Ausstattung besteht aus einem ziemlich schmalen Bette, einem gleichfalls schmalen Sofa und einem Waschkasten. Die Beleuchtung der Kabine erfolgt durch elektrisches Licht, und es befindet sich ausserdem noch für den Fall, dass die elektrische Beleuchtung nicht functioniren sollte, an der einen Wandseite ein labil befestigter Leuchter. Die elektrische Lampe, sowie dieser Leuchter sind oberhalb des Waschkastens angebracht. Des Lesens im Bette halber wäre es aber weit angezeigter, wenn wenigstens der eine dieser beiden Beleuchtungskörper über der Lagerstätte befestigt wäre. An den Eckständern, zwischen welchen sich das Bett befindet, sind Vorkehrungen getroffen, um oberhalb desselben noch ein zweites Bett im Bedarfsfalle aufschlagen zu können.
Ich packte nun die zum täglichen Gebrauche nöthigen Gegenstände aus und legte dieselben auf das Sofa, um sie jederzeit bei der Hand zu haben. Da mir der Capitän im Hinblicke auf die geringe Anzahl von Passagieren noch eine zweite Cabine zur Verfügung stellte, so liess ich in dieselbe meine drei Koffer, welche einstweilen im Laderaum untergebracht waren, schaffen, und hatte derart alle mehr oder weniger erforderlichen Effecten zu meiner unmittelbaren Disposition. Die Kiste mit den Gewehren und Patronen, sowie den Pack mit dem Bettzeuge beliess ich im unteren Schiffsraume.
Um 6 Uhr Abends ging es zum Diner, während dessen ich mich mit dem sehr zuvorkommenden Capitän recht gut unterhielt. Nach Tisch spielte der zweite Mitreisende lustige Weisen auf dem im Salon befindlichen Piano, ich las noch im Reisetagebuch des Erzherzogs Franz Ferdinand und legte mich um 10 Uhr Abends zu Bette.
Während der Nacht schlug der Wind in Scirocco (Südwind) über, was sich durch das Schaukeln des Schiffes bemerkbar machte, eine Bewegung, welche ich, im Bette liegend, recht einschläfernd fand.
Am Samstag, den 28. Jänner, blies fortwährend der Scirocco und brachte, wie dies häufig der Fall ist, mehrere Regenschauer mit sich.
Am 29. Jänner war es ziemlich windstill, theilweise bewölkt und theilweise sonnig. Das Schiff glitt so ruhig dahin, dass man, im Salon sitzend, gar nicht zur Empfindung gelangte, sich auf der See zu befinden. Bis zur Mittagszeit fuhren wir im Adriatischen Meere, einerseits zwischen unseren Ländern Istrien, Kroatien und Dalmatien, und anderseits Italien, in südlicher Richtung vor, und hielten uns dabei, der Meeresströmung gemäss, näher an die italienische Küste. Dann gelangten wir in das Jonische Meer. Im Osten erschienen nun die albanischen Gebirge am Horizonte, während im Westen die italienischen Berge immer mehr und mehr sich unseren Blicken entfernten. Am Abend erblickten wir Corfu.
Am 30. Jänner fuhren wir Morgens und Vormittags nahe den westlichen, steinigen und meist sterilen Küsten der Inseln Kephalonia und Zante vorbei und sahen weder nach Westen noch nach Süden nirgends mehr Land. Nachmittags kam das Schiff in das Mittelländische Meer und wir erblickten im Osten die Gebirge der griechischen Halbinsel Morea und hierauf die Südwestspitze von Griechenland, den südlichsten Punkt von Europa. Der heutige Tag hat sich mehr aufgeklärt, es ist trotz einiger Wolken sonnig, und statt des Sciroccos bläst ein kräftiger Westwind, welcher den Dampfer im fortgesetzten mässigen Schaukeln erhält, wodurch des Holländers Gesundheit etwas in's Wanken kommt.
Die Fahrtgeschwindigkeit des Dampfschiffes beträgt 19 km in der Stunde, somit ungefähr 450 km in 24 Stunden, und demgemäss werden wir heute Abend, in der Nähe der Südostspitze Europas, von Triest aus gegen 1400 km zurückgelegt haben. Die Fahrtgeschwindigkeit ist wegen des stetig uns entgegenblasenden Windes und wegen der grossen Befrachtung des Dampfers eine geringere als die normale.
Im gleichen Masse des Vorwärtsschreitens gegen Süden nimmt auch die Temperatur zu, und zwar stieg das Thermometer in 24 Stunden oder nach zurückgelegten 450 km um 2½° R. In Triest zeigte das Thermometer am 27. Jänner 6° R. Wärme und heute, also nach drei Tagen, steht es zur Mittagszeit zwischen 13 und 14° R. Wärme.
Am 31. Jänner Früh gelangten wir an das Südwestende der Insel Kreta oder Candia und fuhren bis zum Abend längs der südlichen Küste dieser langgestreckten Insel, um uns dann direct gegen Port Said zu wenden. Die Insel Candia ist, insoweit sie sich unserem Auge eröffnete, ein bergiges Land, von tiefen Thälern durchzogen und nur mit recht schütterem Grase und einzelnen Büschen bewachsen. Sie trägt im Allgemeinen den Charakter unserer Karstländer und besitzt ausschliesslich an ihrer Nordküste einen culturfähigen und auch cultivirten Boden. Daher kommt es, dass sich die Städte Kanea, Rethymnon, Megalokastron u. s. w. an der Nordseite der Insel befinden, während sich im Süden nur wenige kleine Fischerdörfer zeigen. Der in der Mitte der Insel in der Richtung West-Ost sich hinziehende höchste Gebirgskamm ist auf seinen bis 2500 m hohen Spitzen zur Zeit mit Schnee bedeckt.
Der Himmel ist trotz Sonnenscheines leicht bewölkt und die Meeresoberfläche ist mässig bewegt und hat eine dunkelblaue Färbung. Der Wind schlug wieder in Scirocco um, der während der Nacht so heftig wurde, dass das Schiff in stärkere Schwankungen gerieth.
Bezüglich der Schiffsbeköstigung will ich dem schon Gesagten einige Worte beifügen. In der Zeit von 8-9 Uhr Morgens erhalten wir Milchkaffee mit Brot. Gegen 10 Uhr werden hors d'oeuvres, ein Ragout, Roastbeef oder dergleichen mit Zuthat und Dessert servirt. Um 1 Uhr folgt ein ähnliches Menü. Um 6 Uhr Abends gibt es potage, hors d'oeuvres, boeuf bouilli garni, Braten mit Salat, gedünsteten Reis mit currie (Gemisch indischer Gewürze), Mehlspeise, Dessert und Kaffee und um 9 Uhr Thee mit Gebäck. Die Auswahl und Zubereitung der Speisen ist vortrefflich. An Getränken findet man Pilsner Bier und einen sehr guten dalmatinischen Wein; die ½ Liter Flasche Bier, sowie die ¼ Liter Flasche Wein kostet 30 kr. Gold oder 36 kr. ö. W. Doch sind auch sehr gute österreichische und französische Weine in Flaschen, sowie Champagner, Säuerlinge und Liqueure in grosser Menge vorhanden.
Der besseren Orientirung halber lasse ich nachstehend einen Vergleich der verschiedenen Längenmasse folgen:
Am 1. Februar war das Land nach allen Richtungen hin entschwunden; man sah nur mehr nach oben den leicht bewölkten Himmel, nach unten das wogende Meer und rundum am Horizonte die Kante des sich nach abwärts neigenden Meeres, in dessen weiterer Fortsetzung der Himmel seine Basis einzutauchen scheint.
Der Südwind (Scirocco) von der libyschen Wüste, also von Tripolis und vom Nordwesten Aegyptens kommend, blies heute so heftig, dass die Wogen oben mit weissem Gischt gekrönt waren, und das Schiff ziemlich starke Schaukelbewegungen machte. Das Gehen an Bord ist für einen mit solchen Schwankungen nicht vertrauten Menschen recht schwierig, doch der Aufenthalt auf dem Decke gewährt einen eigenthümlichen Reiz, welcher hervorgerufen wird, durch den Rundblick über das weite, tiefblaue, so bewegte und mit weissen Punkten übersäete Meer, durch das Vernehmen der Töne, welche wie ein Sausen und ein Rauschen von den sich überstürzenden Wellen herauf-, und wie ein Brausen und ein Schwirren aus der Takelage niederklingen, und endlich durch den Anblick der, dem Schiffe stets folgenden, weitbeschwingten weissen Möven.
Die Temperatur ist seit dem 30. Jänner mit Rücksicht darauf, dass wir uns nun immer mehr gegen Südost, ja gegen Ostsüdost wendeten, nicht mehr in derselben Weise wie früher gestiegen, so dass das Thermometer nicht über 16° R. zeigt.
Durch unsere fortgesetzte Bewegung gegen Osten hat sich indess die Tageszeit mit unserer Uhrzeit erheblich verändert, und zwar ist bis jetzt der Sonnenauf- und Niedergang, sowie die Mittagszeit schon um 45 Minuten früher eingetreten als in Triest, wonach auch unsere Uhren gerichtet werden mussten.
Um 8½ Uhr Abends des 1. Februar befanden wir uns in der Mitte zwischen der Südostspitze von Candia und dem Hafen von Port Said, das ist von beiden Punkten je 400 km entfernt, ferner 500 km südlich von der Küste von Kleinasien und 200 km nördlich von den afrikanischen Gestaden.
Täglich werden von einem Schiffsofficiere die Punkte genau eruirt, an welchen sich das Schiff zu den verschiedenen Zeitmonaten befindet. Am verlässlichsten erfolgt dies durch die Fixirung der Lage des Schiffes zu den Himmelskörpern und der hieraus sich ergebenden Berechnung des betreffenden Punktes, wozu dem Schiffsofficiere geeignete Instrumente und Berechnungstafeln zu Gebote stehen. Sind dann solche Punkte genau bestimmt, so können weitere leicht gefunden werden durch die Erwägung der Richtung und der Fahrtgeschwindigkeit des Schiffes. Die Richtung wird durch die Boussole angezeigt und die Fahrtschnelligkeit ergibt sich entweder durch die Beobachtung und Berechnung der Umdrehung der Dampfschraube oder durch die Beobachtung der Zeigerstellung auf dem Shiplog, das ist ein kleines Uhrwerk, an welchem mit einer langen starken Schnur eine im Meere schwimmende Schraube befestigt ist, die durch die Zahl ihrer Umdrehungen im Wasser die hinterlegte Strecke auf dem Zifferblatte ersichtlich macht. Wind, Wellenschlag etc. beeinflussen aber diese Bestimmungen in solcher Weise, dass sie nur auf verhältnissmässig kurzen Strecken genügende Verlässlichkeit bieten. Die genaue Fixirung der Punkte kann indess nur, wie oben gesagt, auf astronomischem Wege gemacht werden.
Der 2. Februar (Donnerstag, Marien-Feiertag) brachte uns den ersten wolkenfreien, sonnenhellen und beinahe windstillen Tag. Wie auf Sammt gebettet, glitt unser Schiff ruhig dahin, die Meeresoberfläche war nur leicht gekräuselt und schimmerte silbern im Sonnenglanze und azurblau im Schatten. Um 11 Uhr Vormittags zeigten sich die Conturen der südafrikanischen Küste, und der Capitän theilte mir mit, dass das Schiff um 3 Uhr Nachmittags bei Port Said anlegen werde. Am südlichen Horizonte wurden Vormittags zuerst Alexandrien, dann Damiette sichtbar, und schliesslich landete der Dampfer im Hafen von Port Said.
Die Stadt Port Said ist auf dem Sande und Erdreiche erbaut, welche von der Aushebung des Suez-Canales herrühren, und welche zur Anlegung eines grossen Hafenplatzes verwendet wurden. Sie theilt sich in den europäischen und in den arabischen Theil. Der erstgenannte Stadttheil besteht aus Steinhäusern mit niedrigen Dächern und mit in jedem Stockwerke rundum angefügten Balkonen, der arabische Theil zeigt elende, oft zwei Stock hohe Bretterbuden. Nach dem Landen des Schiffes wurde dasselbe überlaufen von kupferbraunen Arabern, in langen Kleidern, blossfüssig, mit rothem oder weissem Fez auf dem Kopfe, welche in allen Sprachen zur Ueberfahrt auf's Land drängten, und von europäischen Händlern, welche ihre Tücher, Pfeifen, Cigarretten und Ansichts-Correspondenzkarten zum Kaufe anpriesen.
Ich sah mir dieses wüste Treiben eine Weile an und liess mich dann nach der Stadt hinrudern und von einem Händler in eine Verkaufshalle führen, in welcher Tropenkleider feil geboten wurden. Aus dem Durchlesen des erzherzoglichen Tagebuches wusste ich bereits, dass auf der ganzen Strecke alle Händler die Preise ihrer Waaren sehr hoch angeben und dass dieselben erst nach langwierigem lästigen Feilschen auf den annähernd wirklichen Werth reducirt werden können. So begehrte der eine der Verkäufer für eine mit Briefstempel versehene Ansichtskarte anfänglich 16 kr. ö. W. (drei Stück für 1 Franc) und gab sie schliesslich um 12 kr. (fünf Stück für 1 sh) her. Ich nahm 60 Stück solcher Karten, um sie an alle jene Personen auszufertigen, welchen ich schreiben wollte, oder welchen ich derartige Karten versprochen hatte. In gleicher Weise war es der Fall bei den Tropenkleidern, von welchen ich mir einen weissen Piquetanzug, einen mit arabischer Zeichnung versehenen langen Mousselinrock als Schlafkleid, einen weissen Korkhelm, ein Paar weisse Zeugschuhe mit Kautschuksohlen und drei weisse Cravatten um 26 sh = 1 Pfund und 6 sh oder 15 fl. 60 kr. ö. W. erstand, nachdem ich diese Gegenstände von dem ursprünglich gebotenen Preise von 40 sh = 24 fl. ö. W. auf die obgenannte Summe herabgemindert hatte.
Eine Jagd auf dem nahe gelegenen Menzala-See, wo tausende Pelikane, Flamingos, viele Arten von Wildenten, Tauchern u. s. w. vorkommen, konnte unser liebenswürdiger Consul nicht arrangiren, weil vorher die Bewilligung hierzu seitens der ägyptischen Regierung hätte gegeben werden müssen.
Am 3. Februar Vormittags besichtigte ich noch einmal die Stadt Port Said. Bei dieser Gelegenheit sah ich ägyptische Soldaten, sämmtlich Neger, in blauen Uniformen mit gelben Knöpfen adjustirt, die sich recht gut präsentirten; sie haben ausserdem noch lichtgelbe Mäntel, die sie beim Aufziehen der Wache auf dem Arme tragend mit sich nehmen, weil diese Kleidungsstücke am Abend, wo es recht kühl wird, angezogen werden müssen.
Dass die Stadt, wie erwähnt, erst seit Eröffnung des Suez-Canales, das ist seit dem Jahre 1869 besteht, zeigt sich an den durchgehend geraden und sich senkrecht durchschneidenden Strassen und an der guten Erhaltung der Häuser im europäischen Theile. Die daran sich anschliessende arabische Holzstadt verräth dagegen Elend und entsetzlichen Schmutz in einer noch viel ärgeren Weise, als man dies in den galizisch-bukowinaischen Judenorten, z. B. Sadagora u. s. w., begegnet. An hervorragenden Gebäuden fällt die Moschee mit ihrem Minaret und das aus Eisen erbaute, vier Stock hohe englische Hôtel, Eastern Exchange, sowie der prachtvolle Palast der Suez-Compagnie auf.
Die Fiaker haben recht hübsche Wagen, an welche aber abgetriebene arabische Pferde vorgespannt sind. Schmutzige Tramwaywagen durchziehen die Stadt, und auch an Radfahrern und Radfahrerinnen fehlt es nicht.
3. Februar. Nach abgestattetem Besuche beim Consul und dem Lloydagenten und nach eingenommenem Gabelfrühstück setzte sich unser Dampfer um 3 Uhr Nachmittags wieder in Bewegung und fuhr in den Suez-Canal ein. Dieser Canal wurde von Lesseps in der Zeit von 1859 bis 1869 erbaut. Er hat eine Länge von 162 km, die für jedes Schiff genügende Tiefe von 19 m und eine für ein grosses Schiff nöthige Breite; sowie nach je 10 km eine Ausweichstelle mit den dazu gehörigen Signalstationen. Die Kosten des Canalbaues beliefen sich auf 240 Millionen Gulden.
Unter dem Vorwande der Zinsendeckung für das aufgewandte Capital und der Bestreitung der immerhin sehr grossen Auslagen für die Schiffbarerhaltung des Canales werden von jedem passirenden Schiffe unverhältnissmässig hohe Gebühren eingehoben. Die Suez-Compagnie fordert nämlich von jedem Schiffe eine Durchfuhrsgebühr von 9½ Franken per Tonne Schiffsfracht und von 10 Franken per Person. Der Dampfer Maria Theresia mit 2400 t Fracht und etlichen Passagieren zahlte für die Durchfahrt die Summe von beinahe 24.000 Franken. Im Jahre 1898 passirten 3098 Dampfschiffe mit 7¼ Millionen Tonnen und mit ½ Million Personen den Canal. Man berechne nun die Höhe der jährlichen Gesammteinnahmen und wird es erklärlich finden, dass die Suez-Canal-Actien nun sehr hoch stehen.
Unser Consul in Port Said erzählte mir, dass die spanische Flotte für das zweifache Passiren des Canales während des letzten Krieges eine Million Franken zahlen musste.
Wenn der Suez-Canal nicht bestünde, und die Schiffe somit um die Südspitze von Afrika fahren müssten, so würde dies einen um mehr als 20.000 km längeren Weg und bei der Fahrtgeschwindigkeit des Dampfers Maria Theresia einen Mehrbetrag an Zeit von etwa 50 Tagen und ein Mehrerforderniss an Geld nur für Kohle ungefähr von 30.000 Franken beanspruchen. Der Dampfer benöthigt nämlich für die Fahrtschnelligkeit von 19 km oder 10 Seemeilen per Stunde mehr als eine Tonne Kohle zum Preise von über 23 Franken, das ist per Tag etwa 600 Franken.
Der Canal durchschneidet die arabische Wüste und wird in den ersten 20 km von dem sehr ausgedehnten Menzala-See flankirt. Während der Fahrt sieht man an den Ufern des Sees unzählige Wasservögel dicht aneinander stehen, die rosenrothen Flamingos, die schwerfälligen Pelikane und die verschiedenartigsten Enten und Taucher. Das Schiessen auf diese Vögel vom Schiffe aus ist untersagt. Nach dem Vorbeifahren an dem See erblickt man beiderseits, soweit das Auge reicht, die Wüste mit ihrem wellenförmig gelagerten gelben Sande.
4. Februar. Zeitlich Morgens fuhr das Schiff an den am Canale gelegenen Bitter-Seen vorbei, welche vielfach für jenen Theil des Rothen Meeres gehalten werden, durch welchen einst die Israeliten zogen.
Um 8 Uhr Früh fuhren wir bei Suez aus dem Canale in den gleichnamigen Golf, hielten etwa eine Stunde seitwärts von Suez an und setzten sonach die Fahrt fort.
Obgleich noch der Südwind blies und es sonnig war, zeigte das Thermometer, welches in Port Said die Höhe von 20° R. erreichte, eine Abnahme von zwei Graden. Oestlich des Golfes dehnt sich die Halbinsel Sinaï aus, westlich desselben befindet sich der südliche Theil von Unter-Aegypten. Beiderseits sieht man kahle, nur hie und da mit sehr wenig Gestrüpp bewachsene Berge, und weiter hinein erscheinen rechts und links viele, viele Meilen weit trostlose Wüsteneien.
In Port Said sind zwei Passagiere zugewachsen; ein protestantischer Missionär und seine grosse, sehr corpulente Frau, welche von Amerika nach Vorder-Indien reisen, um dort die christliche Religion zu verbreiten.
Während der Fahrt im Suez-Canal sah ich eine kleine Karawane, welche aus zwei Arabern auf zwei Kameelen und zwei zu Fuss daherschreitenden Arabern bestand, längs der Küste nach Port Said ziehen. Die Kameele mit dem langen, tief vorgestreckten Halse gehen gravitätisch im langsamen, aber sehr raumgreifenden Schritte, im sogenannten Pass, das heisst, stets die Füsse derselben Seite gleichzeitig vorsetzend, und verursachen dem Reiter dadurch eine schiebend schaukelnde Bewegung, welche demselben zu Beginn des Reitens von Kameelen im hohen Grade lästig werden soll.
Im Golfe von Suez wurden während der Fahrt in der Kohlenkammer zwei Leute angetroffen, welche sich in Port Said gelegentlich der Kohlenaufnahme dort eingeschlichen hatten, um auf diese Art kostenfrei weiterreisen zu können. Der eine der beiden Männer stand im 18. Lebensjahre, war von mittelgrosser, schwächlicher Statur und stammte aus der Gegend von München, der andere, ungefähr 26 Jahre alt, ziemlich gross und kräftig aussehend, gab die Umgebung von Köln am Rhein als seine Heimat an. Beide Burschen waren vernachlässigt und zerlumpt und hatten sich schon lange Zeit in der Welt herumgetrieben. Der Schiffscapitän beabsichtigt, diese Leute in Aden dem deutschen Consulate behufs ihrer Repatriirung zu übergeben.
Nachmittags trat der Scirocco heftig auf, doch ging das Schiff ziemlich ruhig vorwärts. Im Osten sah man den Berg Sinaï im Sonnenscheine erglänzen — jenen Berg, von welchem, der Ueberlieferung nach, Moses die Tafeln mit den zehn Geboten Gottes brachte. Im Westen war die ganze Küste durch eine riesige Sandwolke vollkommen verdüstert, ein sicheres Anzeichen dafür, dass der Sturm den Sand der dortigen arabischen Wüste aufwirbelt und durch die Lüfte trägt.
Während der Nacht schlug der Wind in südwestliche Richtung um und trug den Wüstensand, einer dichten, trockenen Wolke gleichend, weit über das Schiff hinaus, wodurch die Leitung des Schiffes wegen behemmter Aussicht bedeutend erschwert wurde.
Sonntag, den 5. Februar, befanden wir uns im Rothen Meere, nachdem wir in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar an der Südspitze der Halbinsel Sinaï und bei Ras Mahumed vorbeigefahren waren.
Noch immer müssen wir die mit Wüstensand vermengte Luft einathmen; dieser Sand ist so fein, dass er in unmittelbarer Nähe mit freiem Auge nicht wahrgenommen werden kann, sondern erst in der Ferne als eine gelbe, nebelhafte Wolke sichtbar wird und sich erst mit der Zeit durch seine Ablagerungen unangenehm bemerkbar macht. Das ganze Schiff, Mobiliar, Kleider u. s. w., werden mit diesem feinen Sande bedeckt, derselbe dringt in alle Falten und in die Taschen der Kleider, ja selbst in das Innere der Uhren ein.
Bei 18° R. haben wir einen ziemlich starken Südostwind, der ein unausgesetztes Schaukeln des Schiffes verursacht. Die Strecke von Triest nach Port Said beträgt circa 2500 km, zu deren Zurücklegung wir sechs Tage benöthigten. Die Entfernung von Port Said nach Aden wird auf ungefähr 2700 km, und jene von Aden nach Bombay auf etwa 2900 km berechnet. Unser Schiff dürfte daher, wenn es seine Fahrt nicht etwas beschleunigt, mit Einschluss des eintägigen Aufenthaltes in Aden, bis zu seiner Ankunft in Bombay noch 15 Tage brauchen, und somit erst am 22. Februar dort anlangen.
Am 6. Februar passirten wir Vormittags den Wendekreis des Krebses, und mithin befinden wir uns in der tropischen Zone. Die Wärmegrade deuten dies aber noch nicht an, denn das Thermometer zeigt nicht mehr als 18° R., eine für das Rothe Meer verhältnissmässig geringe Temperatur, welche durch das Umschlagen des Windes in Nordost herbeigeführt wurde.
Da der Wendekreis des Krebses in den 23½ Grad nördlicher Breite, und Triest in den 45½ Grad nördlicher Breite fällt, so sind wir am 6. Februar Vormittags um 22 Grad, oder 330 österreichische Meilen, oder um 2500 km südlicher als Triest, eine Entfernung, welche der von Stockholm nach Messina gleicht. Da Wien um 280 km nördlicher als Triest liegt, so befinden wir uns 2780 km südlicher als unsere Kaiserstadt. Was den Unterschied an Breitegraden betrifft, so liegt Triest im 14. Grad östlicher Länge, während wir heute an Ort und Stelle den 37. Grad östlicher Länge zählen und somit um 23 Grad östlicher als Triest sind — eine Distanz, welche der von Strassburg bis nach Kiew gleichkommt. Bei dem Umstande, als die einmalige Drehung eines Breitekreises der Erde 24 Stunden währt, das sind 360 Grade in 24 Stunden, so ist der um 15 Grad östlicher gelegene Meridian um eine Stunde in der Tageszeit voraus. Es entspricht also ein Grad Breite gerade vier Minuten unserer Zeitrechnung, woraus es sich ergibt, dass wir am 6. Februar 23 × 4, das ist um 92 Minuten der Tageszeit von Triest voraus sind. Im Vergleiche zu Wien, welches ungefähr im 16. Grad östlicher Länge liegt, beträgt der Zeitunterschied nur 84 Minuten.
Auch am heutigen Tage verdeckt die ringsum gelagerte Wüstenstaubwolke die beiderseitigen Ufer. Die Schnelligkeit des Schiffes mag jetzt 10 Seemeilen oder 18 km in der Stunde betragen.
Am 7. Februar währt der Nordostwind noch fort, und zwar im erhöhten Masse, wodurch einerseits das Schaukeln des Schiffes zunimmt, anderseits aber durch Aufziehen der Segel die Fahrt beschleunigt wird. Das Wetter ist heiterer als in den beiden letzten Tagen, gestattet aber noch immer keine Aussicht auf die beiderseitigen Ufer, denn am Horizont lagern stets nebelhafte Gebilde. Die Temperatur ist auf 20° R. gestiegen, macht sich aber des heftigen Windes halber nicht stark fühlbar, dabei empfindet man es indess als grosse Wohlthat, auf dem Schiffe Bäder nehmen zu können. Die Temperatur des Meerwassers beträgt jetzt 19° R., sonst hat sie gewöhnlich den gleichen Wärmegrad wie die Luft, ja mitunter ist das Meerwasser sogar wärmer als die Temperatur der Luft.
Im Verlaufe der Fahrt vom 6. zum 7. Februar befanden sich ostwärts der arabischen Küste die den Muhamedanern heiligen Städte Medina, und etwas über 300 km südlich davon Mekka, die beiden Hauptpilgerorte aller Korangläubigen. Westlich vom Dampfer liegt das zu Aegypten gehörige Nubien, durchquert vom Nil, jenem Flusse, welcher in der Nähe des Aequators aus dem Victoria-See tritt und sich nach einem mehr als 4000 km langen Laufe in das Mittelländische Meer ergiesst, wobei er späterhin bei seinen jährlichen Ueberschwemmungen die mitgenommenen Erdbestandtheile absetzt und hierdurch die grosse Fruchtbarkeit von Unter-Aegypten herbeiführt. Der Nil ist der längste von allen Flüssen der Erde. An der Grenze von Nubien gegen Sudan hat die englisch-ägyptische Armee im verflossenen Jahre nach bewunderungswerther, umsichtiger Einleitung und Durchführung von militärischen Massregeln die schier unüberwindlich scheinenden Derwischtruppen vollständig geschlagen, und hierdurch ein, für diesen Theil von Afrika heilsames Werk vollbracht. Am Abende des 7. Februar trat die Nordspitze des grossen Reiches Abessinien hervor, jenes Reiches, welches die Italiener nach dem unglücklichen Feldzuge unter der Oberleitung des Generals Barattieri aufgegeben haben.
Am 8. Februar erblickten wir im Südwesten der Halbinsel Arabien das Land Jemen, von welchem Heinrich Heine in seinem Gedichte »Asra« behauptet, dass die Menschen dort sterben, wenn sie lieben. Die Temperatur stieg einstweilen auf 22° R., und bei etwas umdüstertem Himmel nahm der Wind allmälig ab.
Das Leben auf dem Schiffe richtete ich mir ganz angenehm ein. Nach meinem ersten Frühstück, also nach 8 Uhr Morgens, gehe ich auf das Deck und halte Umschau, wobei ich auf der Karte die Stelle aufsuche, wo sich das Schiff eben befindet, dann beurtheile ich die allgemeine Lage, und spaziere hierauf auf dem Deck herum oder nehme ein Bad. Um 10 Uhr Früh wird das zweite Frühstück eingenommen, während welchem ich hauptsächlich mit dem Schiffscapitän conversire. Von 11 bis 1 Uhr Mittag schreibe ich an diesen Blättern und mache mir sonstige Vormerkungen. Um 1 Uhr Mittags, zur Zeit des zweiten Gabelfrühstücks, promenire ich abermals auf dem Deck, welches mittlerweile mit Plachen überdeckt wurde. Hierauf beschäftige ich mich von 2 bis ½6 Uhr mit Lectüre, besonders mit der von Murray in englischer Sprache geschriebenen Zusammenstellung der Sehenswürdigkeiten von Indien und Japan, und gehe dann um 6 Uhr zum Diner. Nach dem Essen spielt der holländische Passagier lustige Weisen auf dem Clavier, später lese ich noch aus Baron Hübner's Werke »Autour du monde« jenen Theil, der von China handelt, nehme eine Schale Thee und gehe um 10 Uhr Abends zu Bette. Die Cabine glich in der Nacht vom 8. zum 9. Februar, trotz des nur mit Jalousien verschlossenen Fensters, einem Dampfbade.
Am 9. Februar war es leicht umwölkt, ziemlich windstill und die Luft hatte 23° R. Um 10 Uhr Vormittags fuhren wir bei der an Arabiens Küste gelegenen Stadt Mocca vorbei, nach welcher die rühmlich bekannte Kaffeesorte benannt ist, und um 6 Uhr Abends passirte das Dampfschiff die Meerenge von Bab el Mandeb, das Thor der Thränen, kam dabei an der, in der Mitte derselben gelegenen, den Engländern gehörigen Insel Perine vorbei und gelangte nun aus dem Rothen Meere in den Golf von Aden, respective in den Indischen Ocean. Hierauf wendete sich das Schiff von Afrika nach Osten ab, um nach Aden zu fahren. Der Name »Rothes Meer« soll daher rühren, dass in den Monaten Juli und August der von dem Winde hergebrachte Wüstenstaub durch die Sonnenstrahlen einen rothen Schimmer erhält. Zur Zeit meiner Durchfahrt hatte das Meer die gleich tiefblaue Färbung wie anderwärts.
Am 10. Februar, um 9 Uhr Vormittags, landete das Schiff in Steamer Port, etwa 2 km westlich von Aden, welches seit dem Jahre 1839 den Engländern gehört, die sich indess den ungehinderten Besitz hiervon bis zum Jahre 1867 in blutigen Gefechten gegen die Araber erkämpfen mussten. Jetzt befindet sich hier eine grössere englische Besatzung.
Die Temperatur war auf 25° R. hinaufgegangen.
Zerklüftetes und kahles Felsengebirge fällt gegen das Meer ab, und dort auf einem schmalen, ebenen Streifen liegt der kleine Ort Steamer Port. Die Häuser in ihrer blendenden Weisse, versehen mit Säulen, Terrassen und Plattformen statt der Dächer, machen einen sehr gefälligen Eindruck. Braune und schwarze Gestalten kletterten wie die Katzen von ihren Kähnen auf das Deck des Schiffes. Die braunen Leute, meist in lange, weisse Linnen gehüllt, die Köpfe mit weissen oder bunten Schärpen umwunden, sind einheimische Araber, während die Schwarzen, fast ganz entblösst, nur ein kurzes Leinenstück um die Lenden gebunden, von dem jenseitigen afrikanischen Lande »Somali« herstammen. Sowohl die Einen, wie die Anderen sind meist schlanke, hohe Gestalten von auffallender Magerkeit; die Neger haben durchaus sehr kleine Köpfe mit meist kurzem, schwarzem, ganz gekraustem und nur hie und da mit braunem, längerem und in unzählig viele kleine Locken getheiltem Haare, und besitzen dabei eine blauschwarze Haut und perlenweisse Zähne. Ausser ihrer Muttersprache sprechen dieselben nur wenige englische Worte.
Die Kaufleute und Händler sind Engländer minderer Sorte. Die Hôtels sind von aussen recht hübsch, innen aber sehr schmutzig und vernachlässigt. Die interessantesten Handelswaaren sind weisse und graue Straussenfedern, welche nach langem Feilschen zu guten Preisen zu kaufen sind. Die Temperatur im Orte selbst beträgt über 30° R. Einspännige, mit weisser Leinwand gedeckte Miethfuhrwerke und Kameele, theils geritten, theils mit Bagage bepackt, durchziehen die Strassen. Die schwarzen Menschen sitzen oder liegen überall herum, ja man sieht dieselben mit blosser Haut sogar auf scharfkantigen Schotterhaufen schlafen. Unbegreiflich ist es, dass diese schwarzen Leute die heissen Sonnenstrahlen auf ihrer entblössten Haut und ihrem unbedeckten Haupte ertragen können, und dies umsomehr, als viele von ihnen die Haare ganz kurz geschoren tragen. Sehr ergötzlich ist es auch zuzusehen, wie die kleinen Somaliknaben behende bis auf den Grund des Meeres hinuntertauchen, um von dort die hineingeworfenen Münzen herauszuholen.
In Aden wird nach Rupien gerechnet und hat eine Rupie den Werth von ungefähr 80 kr. ö. W.; die Rupie hat wieder 16 Annas, und diese 12 Pice. Eine Annas beträgt somit ca. 5 kr. und ein Pice etwas mehr als ⅓ kr. Die Rupie ist eine Silbermünze, beiläufig in der Grösse eines österreichischen Guldens und zeigt das Bild der Königin Victoria. Auch die Halben-, Drittel- und Viertel-Rupien werden aus Silber geprägt.
Während meines Aufenthaltes in Steamer Port begegnete ich den beiden in der Kohlenkammer des Schiffes aufgefundenen Leuten, wie sie unter der Escorte eines ägyptischen Polizeimannes in den Arrest abgeführt wurden. Der dunkelblau gekleidete Polizeimann fiel mir dadurch auf, dass er unter dem Arme einen kurzen, braunen, mit breiten Messingringen versehenen Stock trug, an dessen Ende ein längerer, breiterer Lederriemen angebracht war. Die praktische Verwendung dieses Stockes konnte ich wahrnehmen, als ich später mit einem Kahne zum Dampfer zurückfahren wollte und sich die schwarzen Kerle an mich behufs der Ueberfuhr herandrängten. Da schwang ein ägyptischer Wachmann dieses Scepter seiner Macht, hieb mit dem Riemen den heranstürmenden Leuten auf die Beine, und schaffte auf diese Art rasch Ruhe. Ich konnte mich des Lachens über diese einfache und dabei etwas derbe Ausübung der Justiz nicht erwehren.
Am 10. Februar, um 4 Uhr Nachmittags, dampfte unser Schiff in der Richtung nach Bombay ab.
Am 11. Februar befand sich der Dampfer zwar noch im Golfe von Aden, doch waren die beiderseitigen Küsten nicht sichtbar; die Temperatur war auf 22½° R. zurückgegangen. Wenn das Schiff die gleiche Fahrtgeschwindigkeit wie bisher einhält, so werden wir am Samstag, den 18. Februar, zur Mittagszeit in Bombay eintreffen.
Am 12. Februar betrug die Temperatur nur mehr 21° R. Es war ein windstiller, herrlich schöner Sonntag, dessen Feier über meine Initiative dadurch begangen wurde, dass der amerikanische Missionär im würdig dazu hergerichteten Schiffssalon andachtsvoll den Gottesdienst verrichtete.
Am 13. Februar hatten wir abermals eine entzückende Fahrt. Es schien die Sonne, eine leichte Brise machte die Temperatur von 21° R. ganz angenehm, und ruhig glitt das Schiff über den unabsehbar grossen Indischen Ocean dahin. Gegen Abend erhob sich plötzlich ein ziemlich heftiger Ostwind, der unser Schiff so stark rüttelte und schüttelte, dass der amerikanische Missionär und seine Gattin von der Seekrankheit befallen wurden.
Am 14. Februar drehte sich der Wind mehr nach Norden, und er blies tagsüber mit ziemlicher Heftigkeit aus Nordost, also aus der Richtung, in welcher Persien und Balutschistan liegen. Die Temperatur betrug nur 20° R. Der arme Missionär sammt Gattin litten fortgesetzt an der Seekrankheit.
Der 15. Februar brachte wieder Ruhe in Wind und Wellen, und es stellte sich eine angenehme Behaglichkeit in dem Dahingleiten unseres Schiffes ein, was dem guten Missionärpaare wohl sehr zu statten kam. Das Thermometer zeigte zu Mittag 19° R., später 18° R. Ein solcher Abend bei ruhiger See, im Mondenscheine auf Deck zugebracht, ist wahrlich ein hoher Genuss. Die weite, weite dunkle Fläche des Meeres wird in breiten und immer breiter werdenden Streifen vom Monde erleuchtet und schimmert hier wie von einem beweglichen Auerlichte erhellt; oben auf dem blassblauen Himmel erglänzen in voller Pracht die tausende und tausende Sterne, unter welchen im fernen Süden das Kreuz sich wie ein Wahrzeichen abhebt, und aus dem Meere ertönt ein dumpfes Wellen und Schwellen, ein Sausen und Brausen, ein Rauschen und Plauschen wie aus einer wunderbaren Märchenwelt, so dass auch den bejahrten Mann ein traumhaftes Schauen und Lauschen ergreift.
Am 16. Februar erfreuten wir uns wieder des hellsten Sonnenscheines, einer vollkommenen Meeresruhe und einer linden Luft von 18-19° R. In einem bis anderthalb Tagen werden wir in Bombay eingelangt sein; von da sind wir 8000 km oder beinahe um zwei Dritttheile des Erddurchmessers von Triest entfernt und fast um vier Stunden in der Tageszeit voraus.
Der 17. Februar brachte die gleichen Witterungs- und Fahrtverhältnisse, wie selbe Tags vorher waren, und somit ist die Ankunft in Bombay für morgen Vormittag gesichert. Drei volle Wochen befinde ich mich dann an Bord des Dampfers Maria Theresia, während welcher Zeit es mir vorzüglich gut ergangen ist. In geistiger Hinsicht habe ich mich an den wechselvollen Eindrücken der Reise ergötzt und diese zu Papier gebracht, beschäftigte mich mit der Lectüre der Reisebeschreibungen von Indien und China von Sr. k. u. k. Hoheit dem Herrn Erzherzog Franz Ferdinand und von Baron Hübner, und füllte die übrige Zeit mit Lesen von anderen deutschen und englischen Büchern aus, und in physischer Beziehung konnte ich mich an der herrlichen Seeluft und an den ausgezeichnet guten Mahlzeiten erfreuen, sowie an einem famosen Schlafe erquicken. Mit voller Anerkennung muss ich es hier noch hervorheben, dass der Schiffscapitän während der ganzen Zeit gegen die Reisenden sehr zuvorkommend war. Bei Tische wurde stets eine animirte Conversation geführt und fehlte es somit auch nicht an erwünschter Unterhaltung.
Samstag, den 18. Februar, langten wir in dem Hafen von Bombay um 8 Uhr Morgens an, woselbst das Schiff verankert wurde, um Nachmittags in die Docks zu fahren. Bombay präsentirt sich als eine sehr grosse Stadt, da sich dieselbe längs des Meeresufers auf ein Länge von 8 km ausdehnt. Die Stadt befindet sich aber nicht auf dem Festlande, sondern auf einer, dem Festlande vorgelagerten Insel. Sie ist von mehr als 800.000 Menschen bewohnt, von welcher Zahl nur etwa 3000 Seelen auf Europäer, hauptsächlich Engländer, entfallen, während das Hauptcontingent aus Hindus, Parsen und Muhamedanern besteht. Eine grosse Menge von Fabriksschloten ist sichtbar, welche meist zu Wollspinnereien und Webereien gehören, da in Bombay vier Millionen Spindeln und 15.000 Webstühle im Betriebe stehen und hierbei gegen 70.000 Menschen verwendet werden. Auf der Seeseite, sowie landeinwärts auf den Spitzen von Hügeln sieht man je drei Forts, welche sämmtlich zum Schutze des Hafens und der Stadt errichtet wurden. Die Besatzung von Bombay besteht aus einem englischen Infanterieregimente, drei englischen Artilleriecompagnien, zwei einheimischen Infanterie- und zwei einheimischen Cavallerieregimentern, Marinemineurs, Eisenbahncompagnien u. s. w.
Unser Consul hatte die Freundlichkeit, an Bord des Lloydschiffes einen Mann zu entsenden, welcher mir mittheilte, dass im Hôtel auf der Esplanade für mich eine Wohnung bestellt wurde. Ich liess mich nun gleich einschiffen, begab mich in das Consulatsgebäude, und lernte dortselbst den Generalconsul, den Viceconsul und das Consulatspersonale kennen. Der Generalconsul ertheilte mir den Rath, mir für die eventuell nach dem Norden von Indien zu unternehmende Reise von Cook & Son die nöthigen Aufklärungen geben und ein Reiseprogramm entwerfen zu lassen. Die genannte Gesellschaft schlug mir vor, Jaipur, Delhi, Agra und Benares zu besuchen, wozu mindestens zehn Tage erforderlich wären. Der Fahrpreis I. Classe würde nur 160 Rupien, das sind 120 fl. ö. W., betragen, da die Eisenbahnfahrten in Indien fabelhaft billig sind. Hierzu muss ich noch bemerken, dass der Reisende I. Classe für die Nacht im Waggon ein Bett erhält und dass zu entsprechenden Zeiten in den Stationen europäisch eingerichtete Restaurants mit fixen Preisen angetroffen werden.
Aus den mir gemachten Mittheilungen ergab es sich aber, dass mir kaum die erforderliche Zeit zu dieser Reisetour erübrigt wird, da ich mich doch etliche Tage in Bombay aufhalten wollte, um diese grösste Stadt Indiens wenigstens theilweise kennen zu lernen. Ich fuhr hierauf zu dem Generalagenten des Oesterreichischen Lloyd, um auch mit diesem meine Reiseprojecte zu besprechen, und hierbei vor Allem in Erfahrung zu bringen, an welchem Tage der Dampfer Marie Valerie, auf welchem ich meine Reise fortzusetzen habe, voraussichtlich von hier abdampfen werde. Der Termin für diese Abfahrt wurde für den 1. März, spätestens den 2. März angegeben, so dass bei einem nur zweitägigen Aufenthalte in Bombay nicht mehr als eine Woche für die beabsichtigte Reise in das Innere des Landes übrig bliebe. Es entfiel demnach die Idee für eine solche Tour. Der Generalagent erbot sich dann, mich am nächsten Tage, Sonntag, Vormittag in Bombay herumzuführen, und lud mich ein, hierauf bei ihm um 2 Uhr das Tiffin (zweites Frühstück) zu nehmen. Bevor ich mich nun nochmals auf den Dampfer Maria Theresia zurückbegab, kaufte ich für 5 Rupien, das sind 4 fl., 80 Stück Ansichts-Correspondenzkarten, um dieselben auf dem Schiffe mit den nöthigen Adressen zu versehen. Um 4 Uhr Nachmittags kam ich in den Docks an und übergab dort das mitgenommene Schreiben des englischen Botschafters in Wien an die indische Zollbehörde, dem höchsten Zollbeamten. Wir kamen dann überein, dass ich die Kiste mit den Gewehren und Patronen vor der Hand noch auf dem Dampfer so lange belasse, bis ich dieselben auf dem Lande benöthigen werde, und dass ich bei der Einhändigung der Waffen einen bestimmten Betrag zu erlegen habe, der mir seinerzeit, sobald die Gewehre wieder an Bord des Schiffes gelangen, restituirt werden wird. Im Uebrigen liessen die Zollbeamten meine Bagage ganz unbehindert passiren.
Als ich in meinem Hôtel ankam, wurde mir ein hübsches Zimmer mit einem kleinen Balkon und der Aussicht auf das Meer angewiesen. Dasselbe enthielt ein grosses, quadratförmig construirtes Bett, welches ringsum mit einem Mosquitonetze umgeben war, zwei Kästen, einen Waschtisch, Stühle und Tische, sowie elektrische Beleuchtung, und hat einen Nebenraum, in welchem sich eine Badewanne mit Pipen für kaltes und warmes Wasser und sonstiges Geräthe befanden. Die Hôtelzimmer sind sehr hoch (gegen 6 m), die sehr breiten Fenster reichen bis zum Boden und sind nach aussen hin mit Jalousien versehen. Bei dem Bau des Hauses wurden viele eiserne Säulen und Eisentraversen, dann Balken und Bretter, und nur wenig und sehr schmales Mauerwerk in Verwendung gebracht. Das ganze Hôtel ist somit recht luftig, dafür aber auch sehr geräuschvoll, ein Umstand, welcher speciell zur Schlafenszeit sehr lästig wird.
Der Eindruck, welchen ich bei dem Eintritte in die Stadt erhielt, war in erster Linie der des Erstaunens über die grosse Anzahl herrlicher Gebäude mit ihren Bogengängen, Kuppeln, Thürmen und Zieraten, die durch die Verschiedenartigkeit ihrer Farben sehr zur Geltung gelangen, und dann, im geraden Gegensatze hiervon, über die überaus einfache Kleidung der braunen und schwarzen Menschen, denen man auf der Strasse begegnet. Häufig besteht diese Kleidung bei den Männern nur aus einem Stückchen von weissem Linnen, welches um die Lenden geschlungen ist, und bei den Frauen aus färbigem Linnen, welches aber auch den Oberkörper bedeckt. Dabei sind diese Menschen jämmerlich mager und haben ein anscheinend sehr stupides Aussehen. Wenn man die Ueppigkeit und die Pracht der hiesigen Pflanzen- und Thierwelt in Betracht zieht, so erscheint es um so auffallender, dass die Menschen hier so schlecht entwickelt sind.
Um 8 Uhr Abends dinirte ich in dem sehr schönen und grossen Speisesalon des Yachtclubs als Gast unseres Generalconsuls, in der weiteren Gesellschaft des dortigen Viceconsuls und des k. u. k. Gesandten in Japan. Das Diner war sehr gut und verlief in einer recht animirten Stimmung. Sowohl in dem genannten Club, wie auch in den Hôtels sind in den Salons und den Wohnzimmern 1·5-2 m lange und 0·5 m breite, in Rahmen gespannte Zeugstreifen in entsprechender Anzahl vom Plafond aus aufgehängt, welche durch Anziehen und Nachlassen von Schnüren durch Schwarze in schwingende Bewegung gebracht werden, um dadurch die Abkühlung der Luft zu erzielen, eine Einrichtung, welche bei der hier herrschenden grossen Hitze (jetzt 24° R.) sehr zweckmässig ist. Während des Mittagessens verabredeten wir für den morgigen Tag eine Partie nach der Insel Elephanta.
Am 19. Februar fuhren wir um 9 Uhr Morgens mit einem Dampfboote zur genannten Insel, wo sich ein in den Felsen ausgehauener Riesentempel der Brahmanen aus dem 8. oder 9. Jahrhundert n. Chr. befindet. Die ganze Tempelhöhle zeigt in ihrer weit ausgedehnten Grösse, in der ausnehmenden Schönheit der vielen lebensgrossen Steinfiguren an den Wänden und den prachtvollen Decorationen an den Säulen, ein grossartiges Werk der Architektur in ältester Zeit und liefert ein höchst interessantes historisches Material. Wären diese Steinmonumente nicht durch die Decke der Höhle gegen die Einflüsse der Witterung geschützt gewesen, so wären sie wohl schon längst verschwunden, so aber besitzen sie heute noch beinahe die gleiche Frische und Schönheit, wie zur Zeit ihrer Herstellung. Der Tempel wird noch heutigen Tages von den Hindus aus der Banya-Kaste zu ihren Festlichkeiten benützt. Die Insel hat ihren Namen von den Portugiesen nach einem dort befindlichen Heidenaltar erhalten, auf welchem ein Elephant in Frauengestalt ausgehauen war.
Die Wohnungsverhältnisse in Bombay sind recht ungünstige, da die Zahl der Wohnungen für die Europäer nicht ausreicht, und somit viele derselben in Zelten untergebracht sind. So müssen z. B. auch unser Viceconsul und der Generalagent des Lloyd mit Zelten vorlieb nehmen. Sie haben sich hierzu gemeinschaftlich eine halbe Stunde vom Centrum der Stadt entfernt, im Hofe von Baulichkeiten, welche einem vom Lloyd abhängigen Parsen gehören, mehrere Zelte aufschlagen lassen. Das Hauptzelt besteht aus fünf Zimmern, ist recht hübsch und gut eingerichtet, und dient den beiden Herren als Wohnung. Das Zelt ist doppelt mit Segeltuch und mit färbigem Linnen überdeckt, um dadurch die heisse Wirkung der Sonnenstrahlen möglichst abzuschwächen. Die vier sich anschliessenden kleineren Zelte sind für die Dienerschaft und die Küche bestimmt, während die den Herren gehörigen Pferde in einer offenen Schupfe stehen. Bei dem Umstande, als das Wetter hier Monate lang bis zum Eintritte der Regenzeit, das ist bis ungefähr 10. oder 15. Juni, ununterbrochen schön bleibt, so ist eine solche Zeltwohnung für die trockene und heisse Zeit ganz gut und passend. Nun aber müssen die beiden Herren schon dafür Vorsorge treffen, in einem Steinhause Unterkunft zu finden, denn in der Monsumzeit regnet und stürmt es unablässig in einer Weise fort, dass das Bewohnen der Zelte ganz unmöglich wird, und sich selbst in den solidest aus Stein gebauten Häusern überall Schimmel ansetzt. Die Wohnungen in solchen Häusern stehen in Bombay sehr hoch im Preise, sie kosten 300-400 Rupien monatlich, oder pro Jahr etwa 3000 fl. ö. W.; die Hausbesitzer sind meist reiche Natives (Einheimische), und zwar vorzüglich Parsen. Die Steinhäuser befinden sich zum kleineren Theile im Centrum der Stadt zwischen dem Bakk-Bay einerseits und dem Hafen und den Docks anderseits mit dem Abschlusse im Norden durch den Stadttheil der Einheimischen, zum grösseren Theile liegt indess das von Europäern bewohnte Viertel jenseits der Nativesstadt auf dem Malabar Hill, wo sich die Bungalos (Villen) mit kleinen Gärten kilometerweit aneinanderreihen.
Die Hütten der Einheimischen bestehen aus wenigen Latten und darüber und herum aus dünnen, oft durchlöcherten Matten, welche bei trockener Witterung wohl noch bewohnbar sind, für die Regenzeit aber ganz ungenügend erscheinen.
Ich nahm das Tiffin bei den beiden obgenannten Herren in ihrem Zelte ein; das Essen war von ihrem Koche, einem sogenannten »Portugiesen«, sehr gut zubereitet und wurde von den beiden schwarzen Dienern flink servirt. Nach Tisch besichtigte ich die Pferde der Herren, und zwar zwei australische Reitpferde, sowie ein australisches und ein ungarisches Wagenpferd. Die australischen Pferde sind zwar kräftig gebaut, aber blutlos, und werden deshalb durch Kreuzung mit englischen Pferden auf einen besseren Stand gebracht. Die Pferde werden hier zu Lande täglich zweimal mit Wasser ganz überschüttet, gewaschen, abgewischt und schliesslich am ganzen Körper massirt. Sie sind im Haar schön glänzend, befinden sich indess, der sie stark angreifenden Hitze halber, zumeist nicht in einem sehr wohlgenährten Zustande.
Gegen Abend machte ich mit den Herren eine Ausfahrt auf der Wagenpromenadestrasse längs des Strandes gegen Malabar Hill und konnte da eine grosse Anzahl von ein- und zweispännigen Equipagen sehen, deren Besitzer zum grossen Theile Einheimische, vorzüglich Parsen waren. Wagen, Pferde und Geschirre sind nach europäischem Zuschnitt, und Kutscher und Bediente, ganz schwarze Leute, sind eigens gekleidet. Dieselben tragen auf dem Kopfe einen hübsch ausgestatteten Fez, und im Uebrigen schöne, mit Goldknöpfen versehene Livréen nach europäischer Art; nur bleiben die Beine und Füsse nackt, so dass es von der Ferne den Anschein hat, als ob die Leute schwarze Lackstiefeln angezogen hätten. Burlesk sehen solche in rothen, goldbetressten Röcken und Bridges angezogene schwarze Kerle mit den blossen, schwarzglänzenden Beinen allerdings aus. Die Bedienten haben noch einen ½ m langen Stab mit daran hängenden Pferdeschweifhaaren in der Hand, laufen beim Anfahren des Wagens eine Strecke neben den Pferden mit, schwingen sich sonach auf den Bock, verschlingen die Arme und halten den besprochenen Wedel senkrecht in die Höhe. Bei den vornehmen zweispännigen Equipagen stehen rückwärts auf dem Trittbrette zwei livrirte baarfüssige Bediente und halten in strammer Stellung jeder einen Wedel in der äusseren Hand senkrecht nach aufwärts. Diese Wedel haben die Bestimmung, von den Pferden die Fliegen und Mücken wegzutreiben.
Am 20. Februar war die Hitze noch mehr gestiegen und betrug 25° R. im Schatten.
Ich gab nun endgiltig die Idee einer Reise nach Delhi und Agra auf, und entschloss mich, die Zeit bis zur Weiterfahrt dazu zu benützen, Bombay und Umgebung eingehend zu besichtigen und dann noch auf einige Tage nach dem fünf Stunden entfernten Orte Poona, der fashionablen Sommerstation von Bombay, zu fahren.
Zu jeder Excursion nach dem Inneren von Indien muss man unbedingt einen eigenen Diener mitnehmen. Hierzu gibt es speciell dafür bestimmte Leute, welche ausser ihrer Muttersprache auch der englischen Sprache mächtig sind, und welchen man für etwa zehn Tage 12 bis 15 Rupien, das sind 10-12 fl. Lohn und ausserdem pro Tag 8 Anas, das sind 40 kr., für ihre Verpflegung zu geben hat. Wohl erheben diese Leute hie und da noch den Anspruch, ihnen einen besonderen Anzug zu geben, doch braucht man nicht auf diese Forderung einzugehen. Die Reisen in Indien sind gewiss nicht theuer. So z. B. hätte, wie bereits gesagt, die Eisenbahnfahrt von Bombay nach Agra und Delhi und zurück, das ist eine Strecke von 3000 km, für mich auf der ersten Classe nur 120 Rupien und für den Diener 20 Rupien gekostet. Hierzu wären noch für mich Hôtel- und Kostcoupons von Cook, das sind 4 Rupien pro Tag oder 40 Rupien für zehn Tage, hinzu zu rechnen gewesen. Mithin wäre die ganze Reise von acht Tagen für mich und den Diener sammt Verpflegung und Unterkunft auf 200 Rupien oder 160 fl. gekommen. Das ist doch ausserordentlich billig!
Nachmittags besichtigte ich eine Pferdeausstellung, bei welcher die Pferde theils im Hürdenspringen, theils im Kunstfahren producirt wurden. Die Hürden waren wohl 1 m hoch, aber bis zur halben Höhe so weich, dass sie gestreift werden konnten. Zum Kunstfahren waren wie beim Croquetspiele in verschiedenen Richtungen Durchfahrten markirt, die im gleichmässigen Trabtempo durchfahren werden mussten.
Bei dem Springen wurden australische und arabische Pferde vorgeführt, welche von Gentlemen, hauptsächlich von englischen Officieren in Civil, recht schneidig geritten wurden. Die Pferde waren mit Pritsche gesattelt und mit Wischzaum, hie und da auch mit Pelham gezäumt. Bei dem Fahren sah man hauptsächlich nur arabische Pferde, welche theils von Gentlemen, theils von Damen, mitunter auch von vermögenden Einheimischen, in zweirädrigen leichten Wagen kutschirt wurden.
Der Platz war recht hübsch hergerichtet, mit Fahnen reich geschmückt, und auf demselben hatten die verschiedenen Clubs Zelte aufgeschlagen, in welchen Erfrischungen genommen werden konnten. Eine Militärmusik von Einheimischen concertirte recht gut Piècen aus Operetten, Walzern u. s. w. Grosse, magere englische Damen in eleganten Toiletten stolzirten mit englischen Herren in steifer Haltung herum, und reiche Einheimische, speciell Parsen, sassen vorne an der Leine, ein buntes Gemisch tropischer Trachten.
Am 21. Februar machte ich einen Spaziergang durch die Stadt, um das Volksleben zu studiren. Die hiesigen Eingeborenen gehören hauptsächlich drei Stämmen, und zwar den Hindus, den Parsen und Mohamedanern an. Die Hindus zerfallen wieder in sehr viele verschiedene Kategorien, welche durch Zeichen mit Oelfarbe auf der Stirne sich den Religionssecten gemäss von einander unterscheiden. Diese Farbenzeichnung erinnert an jene, wie sie in einem Bienenhause auf den verschiedenen Körben gemacht werden, damit die Biene ihre Familie leichter erkenne. Auch in der Körperfarbe selbst gibt es Verschiedenheiten, und stehen Leute mit brauner Hautfarbe in höherem Ansehen als jene mit schwarzer. Da nun die Hindus, sowie die Heiden überhaupt, uns Europäer als Christen und Fleischesser sehr verachten, und da eine Bedienung von uns, speciell das Serviren von Fleischspeisen, von den etwas besseren, braunen Hindus ihrer Religion gemäss verschmäht wird, so sind es nur die Leute von der geringer angesehenen schwarzen Hindurace, welche bei den Europäern und in den europäischen Hôtels und Clubs als Diener fungiren.
Die Bekleidung der männlichen Hindus besteht aus einem Stück Linnen, welches um die Hüften geschlungen ist, und hie und da aus einem kurzen, weissen Leibchen auf dem Oberleib, sowie aus einem langen, breiten, weissen Leinenstreifen, welcher in ebenfalls breiter Form um den Kopf getragen wird. Die Köpfe sind vielfältig glatt rasirt.
Die schwarzen Diener bei Privaten, in den Hôtels und Clubs tragen im Allgemeinen weisse Kleider nach europäischem Schnitte, tragen das Haupt im Hause unbedeckt und das tiefschwarze Haar nach unserer Weise geordnet. Beim Ausfahren haben die Kutscher und Diener buntfärbige und verschiedenartig, turbanähnlich geformte Kopfbedeckungen.
Viele von den braunen Hindus tragen ziemlich grosse Ringe aus Golddraht mit eingelegten Perlen durch die oberen Theile der Ohrmuschel durchgezogen.
Die Hinduweiber sind auf den Strassen nicht viel zu sehen, da sie selten von ihrer Hütte und dem dieselbe umgebenden Vorraume fortkommen. Diese Weiber tragen ein farbiges Linnen um die Hüften und um den oberen Theil der Beine, ferner ein dunkles, enge anliegendes Leibchen, und dann und wann noch einen farbigen Leinenstreifen über den Oberleib, dazu kommen noch beinahe ausnahmslos fingerdicke Silberreifen an den unteren Enden der Arme und Beine, sowie grössere oder kleinere Ringe aus Golddraht mit eingelegten Perlen durch die Nasenflügel derart gezogen, dass sie einseitig über den Mund herabhängen. Selbst die bei dem Bau von Häusern oder zum Gassenkehren verwendeten Taglöhnerinnen haben Silberreifen um Hand- und Fussknöcheln, sowie auch Goldringe in den Nasenflügeln.
Die Ehe der Hindus wird von den beiderseitigen Eltern für ihre Kinder schon im Alter von drei bis sechs Jahren gegenseitig festgesetzt, und diese Verabredung gilt bereits als Ehe. Die beiderseitigen Gatten kommen indess erst zusammen, wenn der Mann 16-18 Jahre, die Frau 12-14 Jahre alt geworden ist, wobei dann eine Feier stattfindet, zu welcher die Brauteltern verpflichtet sind, möglichst viele Verwandte und Bekannte einzuladen. Dabei gibt es dann auch eine Musik von Trommeln, Trompeten, Schlägern u. s. w., mit welchen ein wahrer Heidenspectakel erzeugt wird. Die von den beiderseitigen Eltern für ihre Kinder in deren frühester Jugend verabredete Ehe ist für die beiden künftigen Eheleute absolut bindend, so dass das Mädchen, wenn der ihr zugesprochene Junge vor der wirklichen Heirat stirbt, in früheren Zeiten als Witwe verbrannt wurde, jetzt aber sich nicht mehr vermählen darf. Die Schwiegereltern aber schlagen und verfolgen ein solches Mädchen, weil sie nach ihrer Göttervorstellung annehmen, dass dasselbe am Tode ihres Sohnes schuld sei.
Die Mütter tragen ihre unbekleideten Kinder bis zum fünften oder sechsten Lebensjahre auf einer ihrer Hüften reitend in der Weise, dass die Vorderseite des Kindes gegen die Mutter zugewendet ist, und diese den betreffenden Arm um den Rücken des Kindes geschlagen hat. Im Allgemeinen ist dem Hinduweibe Eitelkeit und eine gewisse Geziertheit eigen. Die Männer, wenn sie eben nicht arbeiten, liegen oder hocken auf der Strasse herum, und zwar das letztere in der Art, dass die Waden die Oberschenkel, und diese wieder die Brust berühren. Sämmtliche Hindus unterstehen unbedingt den Regeln des Kastengeistes, und so folgen die männlichen Kinder stets der Thätigkeit ihres Vaters nach. Den Satzungen ihrer Religion gemäss glauben die Hindus an das Uebergehen der Seele der verstorbenen Menschen in Thierkörper. Sie halten deshalb alle Thiere sehr gut, tödten sie nicht und nähren sich nur von Pflanzenkost, besonders von Reis. Selbst die vornehmsten und vermögendsten Hindus führen die Speisen mit den Fingern in den Mund.
Der allerangesehenste Stamm der Hindus ist der der Brahmanen, welche die Selbstpeinigung als das höchste Ziel des Lebens ansehen. Da gibt es Brahmanen, welche z. B. eine Hand seit ihrer Jugend stets zur Faust geschlossen gehalten haben, so dass die Nägel durch den Handrücken gewachsen sind, oder die einen Arm immer senkrecht in die Höhe tragen, bis er ganz abgestorben und steif emporragt. Es zeigt dies wahrlich eine grosse Verkommenheit des menschlichen Geistes und beweist, auf welch' niederer Stufe diese Heiden stehen, wenn sie Menschen, die sich selbst künstlich verkrüppelt haben, als die Ersten ihres Volkes betrachten und verehren.
Die verstorbenen Hindus werden auf Holzstössen verbrannt. Zu diesem Zwecke werden längs der Mauern der sehr ausgedehnten Verbrennungsstätten grosse Scheiterhaufen errichtet, darauf die entkleideten Leichen gelegt, und dann die Holzstösse angezündet. Während der Verbrennung sehen die nächsten Verwandten dieser abscheulichen Procedur gleichgiltig zu. Dies ist doch menschenunwürdig und weit unter dem Verhalten der Thiere stehend. In Bombay befindet sich diese vor undenklicher Zeit errichtete Verbrennungsstätte schon beinahe in der Mitte der Stadt, und da sich eine ihrer Mauerseiten längs einer Hauptverkehrsstrasse hinzieht, so sieht man am Abend beim Vorbeifahren oder Gehen die rothscheinenden Rauchwolken aufsteigen, und gelangt in den Bereich dieses entsetzlichen Rauches. Es ist dies nicht nur grauenvoll, sondern auch hygienisch sehr nachtheilig, und dennoch ist die englische Regierung wegen des Fanatismus der Heiden nicht im Stande, die Verlegung der Verbrennungsstätte durchzusetzen.
Ein weiterer zwar nicht der Zahl aber dem Vermögen nach hervorragender Stamm der Eingeborenen in Bombay sind die Parsen, das sind die Nachkommen jener Perser, welche im 8. Jahrhundert nach Christi Geburt in Indien eingewandert sind, sich dort die Hindusprache zu eigen machten, aber dabei ihren heimatlichen heidnischen Glauben beibehalten haben. Ihr Glaube wurzelt in der Vorstellung, die Sonne sei das Sinnbild der Allmacht ihres Gottes, in Folge dessen sei das Feuer hoch zu verehren und heilig zu halten. Die Verstorbenen dürfen somit nicht verbrannt werden, weil das Feuer durch die Leichen, welche sie als etwas Unreines ansehen, entweiht werden würde; sie lassen also ihre Todten von Geiern und Raben auffressen! Hierzu sind in Bombay auf einer der höchsten Spitzen des nahe gelegenen Malabar-Hügels fünf grosse »Thürme des Schweigens« errichtet, auf deren Rost im Innern die Leichen, Männer, Frauen und Kinder, jeden Morgen reihenweise aufgelegt, und sodann von den schon darauf wartenden Vögeln verzehrt werden. Als vor drei Jahren in Bombay die Pest auftrat, und somit weit mehr Parserleichen als gewöhnlich zum Frasse aufgelegt werden mussten, stellte es sich heraus, dass die vorhandene Zahl von Geiern und Raben nicht ausreiche, und die englische Regierung musste aus hygienischen Gründen im Innern des Landes Geier einfangen und nach Bombay bringen lassen. Jetzt sollen in der Stadt gegen 400 solcher Vögel sein. Die am Abend die Stadt umkreisenden Geier, sowie die grosse Anzahl von Raben, welche den ganzen Tag, besonders aber zeitlich Morgens die Luft mit ihrem Gekrächze erfüllen, sind eine widerliche Eigenthümlichkeit von Bombay.
Die Parsen beschäftigen sich nur mit Handel und haben sich grosse Reichthümer erworben, welche sie durch die Schönheit ihrer Villen (Bungalos), durch die Eleganz ihrer Equipagen und, bei festlichen Gelegenheiten, auch durch die Pracht ihrer Toiletten zum Ausdrucke bringen, während die Hindus, wenn sie auch hie und da zu einer grossen Wohlhabenheit gelangen, immer in gleich ärmlicher Weise wie früher fortleben.
Es geben aber auch grossartige, dem Gemeinwohle in Bombay gewidmete Bauten Zeugniss von der vielen Parsen eigenen Grossmuth.
Die gewöhnliche Strassenkleidung der Parsen besteht aus einem langen, weissen Musselinoberrock und darunter einer weissen, mit Aermeln versehenen Weste, aus langen weissen Beinkleidern, Schuhen und einer schwarzlackirten, turbanartigen Kopfbedeckung. Die Parserin ist im Allgemeinen hübsch, die jüngeren sind auch graziös; ihre Kleidung besteht aus einem einfärbigen (meist lichtgelb, lichtgrün oder rosa) leichten Stoffe, welcher den Körper zierlich umhüllt und dessen Enden über den Hinterkopf gelegt sind und auf den Oberkörper herabfallen. Dieselben besitzen eine gewisse Aehnlichkeit mit den Rumänierinnen, nur ist ihre Hautfarbe etwas dunkler.
Von Muhamedanern ist ganz Indien seit der Invasion der Mongolen im 14. Jahrhunderte sehr stark bevölkert und darunter bereiten jene, welche im Norden des Landes der Religionssecte der Araber angehören, am festesten an ihrem Glauben hängen und sehr fanatisch sind, den Engländern die grössten Schwierigkeiten. Der Muhamedamismus ist aber nicht nur in Indien, sondern auch auf den malayischen Inseln (Sunda-Inseln, Molukken) sehr verbreitet und gewinnt stark an Anhängern, während die christliche Religion, sowohl in Indien wie im übrigen Asien, nur sehr geringe Fortschritte macht.
Nachmittags besuchte ich eine eben stattfindende Hundeausstellung, bei welcher vom grossen Bernhardiner bis zum kleinen Schosshündchen eine namhafte Zahl von schönen Hunden aller möglichen, vornehmlich aber englischen Racen vorgeführt wurden. Recht zu bedauern waren bei der grossen Hitze die mit starken, wolligen Haaren bedeckten Hunde, darunter ein auffallend mächtiger weisser Pudel. Bei dieser Gelegenheit wurden wieder, wie Tags vorher, Reit- und Fahrkünste producirt, und haben dabei besonders englische Damen ihre Geschicklichkeit dargethan.
Am 22. Februar machte ich Vormittags abermals einen Spaziergang durch Bombay und erstand hierbei ein Buch, in welchem die hervorragendsten Gebäude und die schönsten Gegenden von Indien ausserordentlich gut dargestellt und mit erläuterndem Texte in englischer Sprache versehen sind. Dieses sehr gediegene, mit 500 prachtvollen Bildern ausgestattete Werk »Glimpses of India« kostet 17 Rupien, das sind 12 fl. 60 kr. ö. W. — ein wirklich fabelhaft billiger Preis für die selten schöne und gute Ausstattung. Während des Spazierganges machte ich aber auch die Entdeckung, dass in Indien nicht Alles billig ist. Ich wollte mich nämlich bei einem der ersten Photographen Kuja Deen-Dajaland sons in meiner Tropenkleidung in Cabinetsformat photographiren lassen, verzichtete jedoch hierauf, als ich aus dem Preisverzeichnisse wahrnahm, dass die erste Aufnahme 12 Rupien und ein Dutzend Photographien 30 Rupien kosten, und als ich erkannte, dass die Bilder gar nicht besonders gelungen sind.
Das bunt bewegte Leben auf den Strassen mit ihren grossartigen Gebäuden verfehlte auch dieses Mal nicht, mein Interesse im hohen Grade zu wecken.
Nach dem Tiffin begab ich mich mit der Eisenbahn nach dem von Bombay vier Stationen entfernten Ort Abahamatsi, wo an diesem Nachmittag ein grosses Rennen stattfand. Die Billigkeit der Eisenbahnfahrt zeigte sich auch hier durch den Preis von kaum einer Rupie für ein Billet erster Classe hin und zurück. Der Eintritt zu den Tribünen, sowie zum Sattelraum kostete 5 Rupien.
Der Rennplatz, mit Fahnen geschmückt, machte einen hübschen und eleganten Eindruck, und es fehlten hierbei weder Totalisateur noch Bookmaker, wovon sowohl Engländer, als auch Einheimische einen massenhaften und beträchtlichen Gebrauch machten. Auch hier hatten die Engländer neben den Tribünen einen für sich abgeschlossenen Raum hergerichtet, in welchem auf einem nach englischer Art sehr gut hergestellten Rasenplatze sich eine englische Militärmusik in ihrer kleidsamen rothen Uniform vernehmen liess, in welchem die Clubs ihre Zelte mit Erfrischungen aufgeschlagen hatten und in welchem sich in den Zwischenpausen die europäischen Herren und Damen aufhielten.
Die Rennbahn ist für Flachrennen bestimmt und die Pferde werden von Jockeys geritten. Die Pferde, Hengste und Stuten, waren der Race nach theils arabischen, theils australischen Ursprunges, doch schon durch englisches Blut verbessert; auch erschienen einige von England direct importirte Pferde. Sämmtliche Thiere befanden sich in gut trainirtem Zustande. Die Jockeys waren zum grossen Theile Einheimische und ritten mit sehr viel Schneidigkeit und auch mit viel Geschick, so z. B. hatte beim vorletzten Rennen ein Jockey sein Pferd beim Auslauf nur durch seine bewunderungswürdige Geschicklichkeit um Kopflänge zum Siege gebracht. Die Preise waren sehr schön und werthvoll.
Der Zuschauerraum bot ein höchst interessantes Bild. Da waren alle Glaubensbekenntnisse und alle Nationen des Orients und der Tropenländer in vielfärbigen, eigenartigen und auch mitunter reichen Costumen vertreten, und weiter erblickte man in überwiegend grosser Zahl englische Herren oder Damen. Das ganze Sportfest gestaltete sich für mich zu einem höchst fesselnden und unterhaltenden Schauspiele.
Am 23. Februar erhielt ich einen Brief des deutschen Generalconsuls, den ich bei der Pferdeausstellung kennen gelernt hatte, worin er mich, um mir als Durchreisenden einige Abwechslung zu bieten, zu sich in seinem Bungalo auf Malabar Hill für Sonntag, den 25. Februar, um 8 Uhr Abends, zum Diner einlud — eine Einladung, welche ich mit grossem Danke annahm.
Nun will ich einige nähere Aufklärungen über das Lohnfuhrwerk in Bombay geben. Für den gewöhnlichen Stadtverkehr gibt es einspännige, halbgedeckte Kutschen und die Pferdetramway, für besondere Fahrten findet man in den Hôtels zweispännige Landauer und die Einheimischen benützen häufig zweispännige Ochsenwagen. Die Wagen der Einspänner haben die gleiche Form wie jene in Europa, doch sind die Halbdächer aus Naturleder erzeugt und so eingerichtet, dass man an der Rückwand des Daches einen Theil desselben erheben kann, damit die Luft besser durch den Wagen streicht. Die Kutscher sind Einheimische der schwarzen Race, mit einfachen, weissen oder weiss sein sollenden Leinenkleidern angethan; sie verstehen sehr wenig englisch und kennen sich in der Stadt gar nicht aus. Der Fuhrlohn ist sehr mässig, auf geringe Entfernungen beträgt derselbe 4 Anas = 20 kr., auf weitere Distanzen, wie z. B. zu den Docks, 8 Anas = 40 kr., und endlich auf die wirklich grossen Fahrten, wie zum Malabar Hill oder zu dem Victoria garden eine Rupie = 80 kr. Für die Rückfahrt ist der gleiche Betrag und für die Wartezeit per halbe Stunde 4 Anas zu zahlen. Die dortigen Kutscher haben aber auch gleich vielen europäischen Rosselenkern die Eigenheit, sich nie mit ihrer Gebühr zufrieden zu stellen. Die Tramway ist schmutzig und wird meist nur von Einheimischen benützt. Die zweispännigen Hôtelwagen sind gut, mit buntlivrirten Kutschern und Dienern ausgestattet, und demgemäss auch kostspielig. Eine besondere Eigenart Bombays sind die zweispännigen Ochsenwagen. Die vorgespannten Ochsen gehören der einheimischen kleinen Race mit sehr stark entwickeltem fleischigen Widerriste an und bewegen sich meist in kurzem Trab, die Wagen selbst sind buntbemalte zweirädrige Karren. Diese Gespanne werden, wie gesagt, in Bombay nur von den Hindus benützt. Die Parsen fahren nur in von Pferden gezogenen eigenen oder Miethwagen. Auch die Frachten werden von den obbeschriebenen Ochsen befördert. Zu diesem Zwecke sind je zwei Ochsen in grosse Lastkarren gespannt und ziehen dann ungeheuere Lasten fort. Geführt werden diese Ochsen von Kutschern, welche dicht an deren Schwänzen sitzen und sie von da aus grausam vortreiben. Die Thiere werden mit Stricken dirigirt, welche durch das Mittelstück ihrer Nase gezogen sind. Die Karren sind oft mit langen Hölzern so beladen, dass die armen Zugochsen nur zur Hälfte unter diesen Hölzern herausstehen. Ein weiteres, sehr stark benütztes Beförderungsmittel ist das Bicycle, dessen sich hauptsächlich die englischen Damen, im geringen Masse die Einheimischen und niemals die indischen Frauen bedienen.
Nachmittags fuhr ich mit unserem Viceconsul zum Malabar Hill, wo sich der eleganteste europäische oder, besser gesagt, englische Spielplatz »Ladies Gymkhana« befindet, und auf welchem fünf bis sechs Lawn Tennis-Partien von englischen Herren und Damen vorzüglich und sehr lebhaft gespielt wurden.
Bei einbrechender Dunkelheit promenirten wir in dem weiteren Theile des Spielplatzes, wo um einen Pavillon ein hübscher Garten angelegt ist. Eben als wir dahin kamen, erschlug ein Gartenarbeiter eine langsam nach vorwärts schleichende Cobra. Es ist dies eine jener anderthalb Meter langen Schlangen, welche in Bombay nicht selten vorkommen und deren Biss absolut tödlich ist. Von diesem Garten gingen wir hierauf in ein dicht anliegendes, weit ausgedehntes und hohes Zelt, in welchem bei elektrischer Beleuchtung auf drei Plätzen Balminster gespielt wurde. Diese Plätze sind ähnlich hergerichtet wie zum Tennis, nur mit dem Unterschiede, dass das Netz auf zwei Meter Höhe gespannt wird, und dass die anliegenden Rechtecke weit kleiner sind. Das Spiel erinnert an das Federballspiel. Auf jeder Seite des Netzes befinden sich je zwei oder drei Mitspieler und es muss der Federball (shuttlecock) jedesmal über das Netz fliegen und darf nicht aus dem Rechtecke kommen. Sobald der Federball den Boden berührt oder in das Netz oder über das Rechteck geht, hat die andere Partei eine Einheit gewonnen. Auch dieses Spiel wurde von den englischen Herren und Damen mit grosser Virtuosität gespielt.
Am 24. Februar fuhr ich zur bereits beschriebenen Zeltwohnung des Viceconsuls und des Generalagenten, um dort verabredeter Weise ihre Reitpferde zu versuchen. Das eine Pferd war ein australischer Braun, etwa 162 cm hoch, kräftig gebaut und nach englischer Art gesattelt und gezäumt, befriedigte mich aber nicht besonders als Reitpferd; das zweite Pferd, ein etwas kleinerer Braun, hatte bessere Gänge und entsprach mehr seinem Zwecke als das andere.
Von dort begab ich mich mit dem Generalagenten in seiner reizenden Equipage zum Victoria-Dock, wo eben drei österreichische Lloydschiffe, und zwar: Maria Theresia, Marie Valerie und Imperatrix vor Anker lagen. Zuerst besuchte ich das Dampfschiff Maria Theresia respective dessen Commandanten, überzeugte mich davon, dass meine dort zurückgelassene Bagage auf den Dampfer Marie Valerie gebracht worden war und kam dann an Bord des letztgenannten Schiffes, um den Capitän zu ersuchen, mein Gepäck bis zu meiner Einschiffung sorgsam aufbewahren zu lassen. Endlich besichtigte ich noch das Dampfschiff Imperatrix, welches am 1. März seine Fahrt von Bombay nach Triest antreten wird. Die Besichtigung dieser drei mächtigen und wunderbar schön gehaltenen Dampfer bewies mir in erfreulicher Weise, dass wir durch unseren Lloyd in Indien gut vertreten sind.
Nachmittags wohnte ich im Yachtclub dem Concerte einer englischen Militärcapelle bei. Von der hochgelegenen Terrasse des Clubgebäudes aus geniesst man eine herrliche Aussicht auf das unmittelbar anliegende, von unzählig vielen Schiffen bedeckte Meer und auf die dem Hafen vorgelagerten Inseln. Inmitten der Terrasse dehnt sich ein grosser Rasenplatz aus, welcher, mit englischem Gras bewachsen, trotz des tropischen Klimas einem grünen Teppiche gleicht. Längs der zum Abschlusse gegen das Meer errichteten niederen Mauer war eine grosse Anzahl von Tischen aufgestellt, an welchen viele Clubmitglieder mit ihren Familien Platz genommen hatten.
Am 25. Februar stellte ich mir Vormittags Notizen über die jüngst vergangenen Tage in Bombay als Anhaltspunkte für dieses Tagebuch zusammen. Die mir von unserem Consulate in zuvorkommender Weise verschafften Eintrittskarten zur Besichtigung der Hindu-Verbrennungs- und Begräbnissstätte, sowie der Parsen-Todtesstätte »Thürme des Schweigens« benützte ich deshalb nicht, weil ich gegen die eine, wie die andere Vernichtungsart der Verstorbenen einen unüberwindlichen Widerwillen empfinde, und weil ich es unvorsichtig fand, zu einer Zeit zu diesen Begräbnissorten zu gehen, zu der so viele an der Pest gestorbene Leute dahin gebracht werden.
Auch das allgemeine grosse Thierspital »Pinjra Pol« besuchte ich nicht, weil dort fast ausschliesslich nur ekelerregende Thiere zu sehen sind. Dieses Spital ist inmitten des Eingeborenenviertels errichtet, und werden dorthin alle hinfälligen und arbeitsunfähigen Thiere gebracht und bis zu ihrem Eingehen gut gehalten, weil, wie bereits erwähnt, bei den Hindus der Glaube herrscht, dass in jedem Thiere die Seele eines der Ihren weile.
Bei dieser Gelegenheit will ich hier noch anführen, dass ich die Absicht, auf die Jagd zu gehen, definitiv aufgegeben habe. In der Nähe von Bombay ist mehr oder weniger Alles abgeschossen und könnte man im besten Falle nur auf einige Rebhühner zum Schusse kommen, und die Jagd auf aussereuropäische Thiere kann nur mit der Bewilligung eines weiter entfernten Madharadschas und mit der Zustimmung des dort angestellten englischen Commissärs veranstaltet werden — ein Unternehmen somit, das weit mehr Zeit erfordert hätte, als mir zur Verfügung stand.
Nach dem Tiffin, welches ich in Gesellschaft des Consularsecretärs und Attaché's in meinem Hôtel eingenommen hatte, fuhr ich durch den von den Einheimischen bewohnten Theil der Stadt zu dem Victoria garden. Die Strassen in diesem Nativesviertel sind ziemlich rein gehalten, aber die Häuser und die gegen die Strassenseite offenen Werkstätten und Verkaufsbuden aller Art sind schmutzig und von Menschen überfüllt. Auf den Strassen selbst eilen tausende braune und schwarze Leute in bunter, jedoch meist sehr mangelhafter Bekleidung hin und her. Längs des sehr langen Weges bis zum Victoria garden sind indess auch viele schöne Gebäude für gemeinnützige Zwecke eingestreut. So z. B. stehen dort mehrere Hindutempel, das Gefängnisshaus, das grosse medicinische Collegium mit seinem Laboratorium zur Ausbildung von Einheimischen, das Spital für arme Indier, das Gebärhaus, sowie das Weiber- und Kinderspital für Einheimische, die jüdische Synagoge, das Polizeihaus, die von katholischen Geistlichen geleitete grosse Schule, um in derselben die Kinder zum Christenthume zu erziehen, ein Pensionat für europäische Kinder, das St. Elisabethhaus für europäische Witwen und Frauen, welche sonst kein Unterkommen finden, und die schottische Erziehungsschule.
Der Victoria garden ist ein sehr grosser, der Bevölkerung stets offen stehender Garten, welcher sehr gut gehalten ist, und der alle Bäume, Pflanzen und Blumen des Landes in sehr schönen Exemplaren, sowie in zerstreut stehenden, vielen grossen eisernen Käfigen alle in Indien vorkommenden wilden Thiere enthält. Anschliessend an diesen Garten steht das Victoria- und Albert-Museum, in welchem die Rohproducte, Mineralien, Manufacturen und die naturhistorischen Muster von Indien ausgestellt sind.
Nach meiner Rückkehr in das Hôtel entsprach ich der liebenswürdigen Einladung des deutschen Generalconsuls und fuhr in Gesellschaft des österreichisch-ungarischen Vertreters in die elegante Villa unseres Gastherrn auf dem Malabar Hill, wo uns ein ausgezeichnetes Diner erwartete. Wir sassen dort vor, wie nach der Tafel in einem des Luftzuges halber nach allen Seiten hin weit geöffneten Salon. Die in den Tropengegenden allgemein eingeführte Sitte, sich in den Häusern der Zugluft auszusetzen, hatte in diesem besonderen Falle für mich ein recht verdriessliches Nachspiel. Kaum zu Hause angelangt, wurde ich von choleraartigen Krämpfen befallen, und ich verdanke es nur meiner mitgebrachten Hausapotheke und der eigenen kräftigen Massage, dass ich des nächsten Morgens ohne ärztliche Beihilfe wieder auf den Beinen war.
Als am 26. Februar, um 9 Uhr Früh, der deutsche Generalconsul bei meinem Hôtel vorfuhr, um mich Tags vorher verabredeter Weise abzuholen, befand ich mich wieder so weit wohl, dass ich denselben begleiten konnte. Wir begaben uns zusammen zu einem Thierarzte, bei welchem das eine seiner Wagenpferde, welches er vor kurzer Zeit um 700 Rupien gekauft hatte, nun seit sechs Wochen in Behandlung stand. Ich war in Rücksicht auf das geringe Vertrauen, welches ich den Einheimischen bei Behandlung von Pferden entgegengebracht hatte, sehr erstaunt über ihre Erfahrung und Geschicklichkeit. Der englische Einfluss war dabei nicht zu verkennen.
Während unserer Rückfahrt sahen wir eben einen Mann, welcher auf der Strasse von der Pest befallen worden und zusammengestürzt war. Diese böse Krankheit hat jetzt in Bombay schon einen hohen Grad erreicht und ist noch stets im Zunehmen begriffen. Täglich werden beinahe 300 Menschen von dieser Epidemie befallen, und davon sterben die Meisten binnen längstens 24 Stunden. Langsam breitet sich die Krankheit über das ganze Land aus, und auch die beiden nächstgrossen indischen Städte Calcutta und Madras wurden hiervon bereits ergriffen.
Die englische Regierung ist in Folge des fanatischen Aberglaubens im Volke, dass die bösen Götter die Krankheit gesendet haben, und dass man diesen nicht entgegenarbeiten dürfe, ausser Stand gesetzt, energische Massregeln gegen das stetige Umsichgreifen der Pest einzuführen. Ja, vor drei Jahren, als die Pest zuerst auftrat und die englischen Behörden mit aller Strenge dagegen einschreiten wollten, kam es zu einem bösen Aufstande der einheimischen Bevölkerung, wobei der Pöbel jeden ihm entgegenkommenden Europäer tödtete. Erst durch Waffengewalt konnte die Ruhe wieder hergestellt und durch das Zurücknehmen aller angeordneten hygienischen Massnahmen weiter erhalten werden.
Bewunderungswürdig ist es, dass die in Bombay weilenden Europäer von der furchtbaren Epidemie keine Notiz nehmen, ruhig und ganz furchtlos auf ihren Posten verbleiben und hierdurch auch den Einheimischen, welche sonst haufenweise fliehen würden, den Muth einflössen, auszuharren.
Bombay und vielleicht so ziemlich ganz Indien haben kein gesundes Klima. Dies beweist ebenso das immerwährende Fortbestehen der Cholera neben der Pest, als auch, dass alle Krankheiten einen raschen und bösen Verlauf nehmen und so viele Menschen an heftigen Husten leiden, wie ich dies in meinem Hôtel Tag und Nacht bei den nebenwohnenden Passagieren wahrnehmen konnte.
Nach der Heimfahrt fühlte ich mich zwar nicht mehr leidend, aber doch nicht so wohl wie gewöhnlich, und so entschloss ich mich, die geplante Reise nach Poona ganz aufzugeben.
Nachmittags unternahm ich noch eine schöne Spazierfahrt längs den Ufern des Back Bays. Links ging mein Weg an den Spielplätzen (Gymkhana) für die Parsen, die Muhamedaner und die Hindus, rechts an der Verbrennungsstätte der Hindus, an dem muhamedanischen Begräbnissorte und an dem christlichen Friedhofe vorbei, dann gelangte ich zu dem »Albless Bagh«, dem Hauptorte für die feierlichen Vermählungen unter den Parsen, dann zu einer grossen Kunstschule und schliesslich hinauf auf den Malabar Hill mit seinen schönen Bungallows der Europäer. Dort sah ich auch den Complex der Bungallows des englischen Gouverneurs und auf der obersten Kuppe des Hügels das riesige Wasserreservoir für ganz Bombay mit den darauf angelegten sogenannten »hängenden Gärten«. Dort angekommen, verliess ich den Wagen und betrachtete mir lange die entzückende Aussicht auf die am Fusse des Hügels zwischen Cocosnussbäumen gelegene Vorstadt von Bombay, auf die Stadt selbst mit ihren schönen Palästen und Baulichkeiten, worunter besonders der Victoria-Bahnhof und das neue Gebäude einer anderen Eisenbahngesellschaft hervorragen, und endlich weiter hinaus auf das im Abendsonnenscheine erglänzende unabsehbare, weite Meer.
Von hier aus fuhr ich weiter, vorbei am Fusse des Hügels, auf welchem die »Thürme des Schweigens« erbaut sind, und sah ringsum auf allen Bäumen die Geier sitzen oder sich im schwerfälligen Fluge vorwärts schwingen, darauf wartend, dass ihnen in empörender Weise die gewohnte Nahrung geboten werde. Sonach passirte ich die sogenannte Mahatumi-Batterie, wo die schweren Küstengeschütze die Mündungen wohl nach auswärts gerichtet haben, aber bei einem etwaigen Aufstande in Bombay auch sehr vortheilhaft gegen die Stadt wirken können, und kam an den europäischen Seebädern vorbei, um von dort auf der von Palmen eingesäumten Wagenpromenadestrasse in mein Hôtel zurückzukehren.
Am Montag, den 27. Februar, war mein Unwohlsein vollkommen behoben, aber dennoch kaufte ich mir auf dringendes Anrathen unseres Generalconsuls zwei Cholerabinden als Präservativmittel gegen ähnliche Erkältungen. Sodann liess ich mir in einem sehr eleganten Confectionsgeschäfte, dessen Inhaber ein Wiener ist, zwei Tropenanzüge zum Preise von 22 Rupien anfertigen.
Zum Tiffin waren der Viceconsul und ich von dem Generalagenten in das Hôtel »Bombay« eingeladen worden. Als ich aber bei der Zusammenkunft erfuhr, dass der Koch dieses Hôtels Morgens an der Pest gestorben sei, fand ich es doch angezeigter, dass die Herren meine Gäste im Esplanade-Hôtel werden, wo der Koch sich noch vollster Gesundheit erfreut.
Am Nachmittag machte ich einen kleinen Spaziergang, schrieb an meinem Tagebuche und liess die Vorbereitungen zur Abreise treffen.
Am 28. Februar machte ich meine Abschiedsbesuche. Alle die vorerwähnten Herren hatten sich während der elftägigen Dauer meines Aufenthaltes in Bombay meiner in der liebenswürdigsten Weise angenommen und wesentlich dazu beigetragen, mir diese Zeit angenehm und unterhaltend zu gestalten.
Gegen Abend unternahm ich noch eine kurze Spazierfahrt durch die Stadt, um noch einmal die vielen neuen und interessanten Eindrücke, die ich hier empfangen hatte, vor meinen Augen vorüberziehen zu lassen.
Die Auslagen in Bombay haben aus folgenden Gründen für mich einen höheren, als den normal anzunehmenden Betrag erreicht. Für's Erste musste ich in meinem Hôtel, obwohl ich sehr häufig anderwärts ass und stets vorher rechtzeitig absagen liess, dennoch die volle Pension entrichten, dann hatte ich die Aufnahme in den Yacht-Club und das dortselbst von mir gegebene Diner zu bezahlen, hatte mehrmals Gäste in meinem Hôtel und schliesslich machte ich verschiedene Einkäufe von Büchern, Spielen und Kleidern.
Die Abrechnung stellt sich folgendermassen zusammen:
| Pension für Wohnung sammt vier Mahlzeiten täglich für 11 Tage | 110 R. | oder | 88·— | fl. |
| (Mit Cook's Hôtelkarten wäre die Pension pro Tag nur auf 4 fl. zu stehen gekommen, also für 11 Tage auf 44 fl.) | ||||
| Für Getränke, Wäschewaschen und Trinkgelder im Hôtel | 20 R. | " | 16·— | fl. |
| Für Fahrten, Pferdeausstellungen, Rennen und Ausflug nach der Elephanten-Insel | 30 R. | " | 24·— | fl. |
| Für Diner und Tiffin mit Gästen, Aufnahme in den Yacht-Club und Diner dort | 96 R. | " | 75·40 | fl. |
| Für Bücher und 80 Ansichtskarten sammt Marken | 42 R. | " | 33·60 | fl. |
| Für Toiletteauslagen | 35 R. | " | 28·— | fl. |
| Zusammen | 333 R. | oder | 264·— | fl. |
Am 1. März. Nachdem ich, sowie alle anderen Einzuschiffenden, wegen der Pestinficirung der Stadt von einem behördlich angestellten Arzte untersucht und als gesund anerkannt wurden, und ich mich von den Herren des Generalconsulats und vom Lloydagenten, die zum Abschied auf den Dampfer gekommen waren, empfohlen hatte, setzte ich um 11 Uhr Vormittags auf dem Dampfschiffe Marie Valerie meine Reise nach Japan fort.
Bevor ich das Capitel über Bombay beschliesse, halte ich es nicht für überflüssig, noch einige von mir gemachte Erhebungen, sowie die während meines dortigen Aufenthaltes gewonnenen Anschauungen und Wahrnehmungen, welche die allgemeinen Verhältnisse in Bombay oder in Indien überhaupt betreffen, zum Ausdrucke zu bringen, und ich will zu diesem Zwecke gleich mit der Armee beginnen.
Im Jahre 1642 landete das erste englische Bataillon in Indien, und seit dieser Zeit wurde nach und nach dieses Land mit seinen 300 Millionen Einwohnern, welches grösser ist als ganz Europa, der englischen Herrschaft theils direct, theils indirect unterworfen. Dieses immense Reich, welches mit unschätzbaren Reichthümern ausgestattet ist und einst von einheimischen prachtliebenden Fürsten in prunkvollen Palästen regiert wurde, musste sich die Fremdherrschaft gefallen lassen und sich dem Willen Grossbritanniens unterwerfen, und dies Alles wurde mit dem Aufgebote von verhältnissmässig sehr kleinen militärischen Machtmitteln erreicht.
Die englische Armee, deren Stand in Indien zu keiner Zeit grösser war als eben jetzt, besteht nur aus 70.000 Mann, von welchen nach übereinstimmenden autoritativen Aussagen zur Zeit etwa 30.000 an ansteckenden Krankheiten in den Spitälern untergebracht sein sollen. Die einheimische Armee, welche sich in Indien selbst rekrutirt, ist wenigstens vierfach so stark, untersteht aber, wenigstens vom Hauptmann oder Rittmeister aufwärts, den Befehlen englischer Officiere. Was speciell die Artillerie anbelangt, so wird dieselbe beinahe ausschliesslich nur von englischen Truppen beigestellt, und ist auch in Friedenszeiten hauptsächlich nur in die eigene englische Armee eingereiht.
Sowohl die englische wie die einheimische Armee zerfällt in drei Hauptgruppen, und zwar in jene von Bengalen, Madras und Bombay.
Die englische Armee in Indien besteht aus:
| Infanterie- Bataillone |
Cavallerie- Regimenter |
Batterien | Artillerie- Compagnien |
|
| in Bengalen | 34 | 6 | 39 | 13 |
| in Madras | 10 | 2 | 13 | 3 |
| in Bombay | 8 | 1 | 14 | 7 |
| Also in Summe: | 52 | 9 | 66 | 23 |
Die Stärke eines Bataillons oder eines Cavallerie-Regimentes beträgt circa 600 Mann, und die einer Batterie 150-160 Mann mit 150 bis 200 Pferden.
Der Wechsel der englischen Truppen in Indien mit jenen in Grossbritannien ist auf einem 13jährigen Turnus für die Infanterie festgestellt, und kehren somit jedes Jahr vier Bataillone aus Indien nach England zurück. Bei der Cavallerie wechselt jährlich ein Regiment.
Die einheimische Armee besteht aus:
| Infanterie- Regimenter |
Cavallerie- Regimenter |
Batterien | Sappeur- und Mineur-Corps |
|
| in Bengalen | 49 | 24 | 7 | 1 |
| in Madras | 33 | 4 | — | 1 |
| in Bombay | 26 | 7 | — | 1 |
| In Summe: | 108 | 35 | 7 | 3 |
Bei den Batterien befinden sich auch schwere Batterien, welche von Elephanten gezogen werden. Sämmtliche Batterien werden nur von englischen Officieren befehligt. Auch eine Abtheilung von Kameelreitern ist in dem Armeestande ausgewiesen.
Ein einheimisches Infanterie-Bataillon hat 8 Compagnien mit 8 englischen und 16 eingeborenen Officieren, 40 Sergeants, 40 Corporalen, 16 Tambours und 800 Mann. Die Einheimischen werden nach ihren Racen und heidnischen Religionssecten in die Compagnien eingereiht.
Ein einheimisches Cavallerie-Regiment hat 4 Escadronen mit 9 englischen und 17 eingeborenen Officieren, 64 Unterofficieren, 8 Trompetern und circa 550 Reitern. Hierzu kommen noch viele freiwillige Officiere, welche von der englischen Regierung aus den besten Ständen der Einheimischen ernannt und von diesen hoch angesehen werden, wenngleich sie auch unter keiner Bedingung höhere Chargen erreichen können. Die Adjustirung besteht aus einem leichten, braunen Wollstoffe, Tropenhelme für Officiere und Turbanen für die Mannschaft. Die Ausrüstung für die Cavallerie schliesst in sich Korbsäbeln und Revolver für die Officiere und Gewehre für die Mannschaft.
Die Bezahlung der einheimischen Infanterie-Officiere beträgt nebst der vollen Verpflegung 50-150 Rupien, und für die Mannschaft 7 bis 23 Rupien pro Monat. Die einheimischen Cavallerie-Officiere erhalten ausser der Verpflegung 60-300 Rupien und die Reiter 27-51 Rupien pro Monat, doch muss hiervon auch die Erhaltung des Pferdes gedeckt werden. Die einheimischen Truppen haben seit jeher sowohl zur Eroberung des Landes, als auch zur Unterdrückung von Aufständen wesentlich beigetragen.
Abgesehen von diesen Truppen, sind indess auch die von England abhängigen Fürsten verpflichtet, im Bedarfsfalle entsprechende Contingente beizustellen. Diese Truppen sollen aber, wie man mir versichert, ganz unfähig und unbrauchbar sein.
Die Bezahlung der englischen Officiere ist sehr gut, denn sie besteht aus jener in ihrem Heimatlande und einer weiteren Zulage. Jedenfalls erwächst durch den grossen Bedarf an höheren Officieren in der indischen Armee dem verhältnissmässig kleinen Mutterlande eine namhafte Anzahl von sehr guten und angesehenen Stellen für seine Söhne.
Aber nicht nur die Armee, sondern auch die Civilverwaltung Indiens verschafft den englischen Unterthanen eine Reihe von einträglichen Posten. Ich nenne hier nur den Vicekönig, die Gouverneure der Provinzen, die Beamten der politischen, juridischen, finanziellen und mercantilen Behörden, die Schulleitungen, die Beiräthe bei den Gemeinden u. s. w. — alle diese Stellen werden von Engländern besetzt und sind reich dotirt. Hierzu kommen noch die königlichen Commissäre, welche allen noch bestehenden Fürsten (Maharadschas) beigegeben und vorzüglich gut gestellt sind, es hierbei aber auch verstehen, derartig aufzutreten, dass diese Fürsten gar nichts unternehmen können, was den Engländern nicht genehm wäre.
Die eben aufgezählten Vortheile sind aber wohl noch verschwindend gegen jene, welche England aus dem Handel und der Industrie Indiens erwachsen sind und noch erwachsen. Es wäre sehr interessant, wenn ein Statistiker erforschen und bekannt geben könnte, welch' riesenmässige pecuniäre Vortheile den Engländern jährlich von ihren aussereuropäischen Besitzungen zufliessen.
Die Arbeitskraft ist in Indien erstaunlich billig, denn sie beträgt per Mann und Tag nur 4 Anas = 20 kr. Mit dieser Arbeitskraft können sowohl der sehr fruchtbare Boden bestellt als auch alle Bau- und Industrieunternehmungen betrieben werden. So bestehen, wie ich schon erwähnte, in Bombay allein Baumwollspinnereien mit mehreren Millionen Spindeln und 15.000 Webestühle, wozu über 70.000 Arbeiter in Verwendung stehen.
Zur billigen Arbeitskraft gesellen sich noch die Ausdehnung der Schienenstränge und die Billigkeit des Frachtenverkehres, um dem Handel den nöthigen Impuls und die gewünschte Erleichterung zu bieten. Das Eisenbahnnetz in Indien umfasst 20.000 km und die Verfrachtung der Waaren ist die denkbar billigste, sowohl zu Land als am Meere. In Folge dessen hat auch seit dem Durchstiche des Suez-Canales der Verkehr mit dem Mutterlande eine erstaunliche Höhe erreicht.
Wenn man bedenkt, dass von allen grossen mitteleuropäischen Häfen Triest wohl Indien am nächsten gelegen ist und auf dem directesten Wege in das Herz von Europa fährt, und dass unser Lloyd den Handel zwischen unserem Welttheil und dem fernen Osten so ausgezeichnet vermittelt, so sollte man unbedingt meinen, dass der diesbezügliche Verkehr im steten Aufschwunge begriffen sei, und dass speciell für Oesterreich-Ungarn hieraus ein grosser Gewinn erstehen müsse. Dem ist indess leider durchaus nicht so. Unser Handel nach Indien ist ein recht mässiger und erstreckt sich in der Hauptsache nur auf Ausfuhr von Zucker und allenfalls von Papierwaaren und auf die Einfuhr von Wolle. Die Ursachen für diese beklagenswerthe Thatsache sind mannigfache; sie liegen zum grossen Theile in dem Mangel an Unternehmungsgeist und an werkthätigem Eingreifen unserer industriellen und mercantilen Kreise. Dazu kommt noch, dass in unserem gesetzgebenden Körper wegen unfruchtbarer Streitigkeiten weder Zeit noch Musse dafür gefunden wird, die grossen handelspolitischen Ziele unserer Monarchie fest in's Auge zu fassen und die Gelegenheit nicht wahrgenommen wird, uns an dem grossen Gewinne des Welthandels Theil nehmen zu lassen. Diese inneren Kämpfe kosten unserem Reiche Millionen und in der Zwischenzeit überflügelt uns das Ausland.
Bezüglich Bombay's muss ich noch erwähnen, dass, nach der Ansicht von best orientirten Leuten, es zu vermuthen steht, Bombay werde nach und nach seine hoch hervorragende Stellung als erster indischer Handelsplatz einbüssen und dieselbe an Karachi im Mündungsgebiete des Indus, an der Grenze zwischen Indien und Balutschistan, abgeben müssen.
Schliesslich will ich noch anfügen, dass ich mir durch die gütige und vortreffliche Vermittlung des Viceconsuls in Bombay nachstehende Producte aus Indien erwerben konnte, und zwar 64 Sorten von Samen indischer Bäume, um selbe im Heimatlande an verschiedene Anstalten und Personen zu senden, damit Versuche gemacht und die bei uns gut gedeihenden Bäume eingeführt werden können, dann 35 Stück kunstvoll erzeugte Modelle von indischen Früchten, um selbe einer Anstalt in der Heimat zu senden, und endlich 6 Stück Vorhänge mit originellen Seidenstickereien.
1. März. Zuerst ging der Lloyddampfer Marie Valerie sehr vorsichtig aus den engen, mit vielen Dampfern besetzten Docks glücklich heraus, und fuhr dann durch den äusseren Hafen zwischen vielen Segelschiffen in das freie, weite Meer hinaus. Windstill und sonnenhell, deshalb aber auch brennend heiss war es, so dass ich mich selbst auf dem durch Plachen gegen die Sonnenstrahlen geschützten Decke wie in einem Dampfbade fühlte.
Unser Schiff ist kleiner als der Dampfer Maria Theresia und dabei anders eingetheilt, und zwar so, dass die Passagier-Unterkünfte sich mehr in der Mitte desselben befinden und sich dort daher die Schwankungen weniger fühlbar machen. Der Speisesalon unter, sowie der Sitz- und Rauchsalon ober dem Decke sind kleiner, dagegen die Schiffscabinen grösser als auf der Maria Theresia. Im Uebrigen ist dieser Dampfer ebenfalls vortrefflich gehalten, und sein Capitän äusserst zuvorkommend.
Ausser mir war in Bombay nur noch ein Passagier eingestiegen. Es ist dies ein Doctor, aus Nordböhmen gebürtig, welcher nach Singapore fährt, um dort vor der Hand für einen zeitweilig nach Europa fahrenden Arzt die Praxis zu versehen und sich auch eventuell, wenn es ihm gefällt, in der genannten Stadt ganz zu etabliren. Er ist ein sehr gebildeter junger Mann, der englischen Sprache vollkommen mächtig, und ein angenehmer Reisegefährte, der gute Anschauungen hat und mit dem es sich gut plaudern lässt.
Der liebenswürdige Capitän hat mir zwei sehr gute Cabinen zugetheilt, von welchen ich die eine bewohne, und in der anderen meine ganze Bagage untergebracht habe.
Nachdem ich mich häuslich eingerichtet und das Tiffin eingenommen hatte, liess ich mir auf Deck einen Tisch stellen und begann sofort, trotz der formidablen Hitze, fleissig an meinem Tagebuche zu schreiben. Während meines Aufenthaltes in Bombay hatte ich mir nur Vormerkungen gemacht, und ich musste nun trachten, alle noch frischen Eindrücke in der nächsten Zeit zu Papier zu bringen.
Wir waren einstweilen so weit in das offene Meer gelangt, dass man von der indischen Küste nichts mehr sehen konnte und wir uns also wieder zwischen Himmel und Wasser befanden. Kein Lüftchen rührte sich, in unabsehbarer Ferne, vollkommen ruhig, dehnte sich die Wassermasse in krystallheller tiefer Bläue vor uns aus, und still und stolz glitt unser Dampfer darüber hinweg, in jeder Stunde 16 km hinterlegend. Ueber uns breitete sich der Himmel in reinem Lichtblau aus und schien sich an den Grenzen des Horizontes in die Ebene des Meeres zu versenken. Die Nacht war zwar fürchterlich heiss, dennoch schlief ich vortrefflich gut.
Am 2. März hatten wir die gleichen Witterungsverhältnisse wie Tags vorher, und wieder war die Hitze (24-25° R. im Schatten) erdrückend. Dessenungeachtet setzte ich die Beschreibung meiner Erlebnisse und Eindrücke in Bombay mit Eifer fort und erlangte dadurch den grossen Vortheil, auf die Hitze zu vergessen.
Wir kamen an diesem Tage zu Mittag in die Höhe der an der Westküste von Vorder-Indien gelegenen Stadt Goa, welche mit einem kleinen anliegenden Gebiete den Holländern gehört. Dieses kleine Gebiet, sowie die drei Städte an der Ostküste von Vorder-Indien, und zwar Yanaon, Pondicherry und Karikal, welche den Franzosen gehören, sind die einzigen Fleckchen Erde in Vorder-Indien, die nicht England direct oder indirect unterstehen. Die Portugiesen, welche vom 14-17. Jahrhunderte ausgedehnte Besitzungen in Vorder-Indien hatten, haben dieselben schon seit Anfang dieses Jahrhunderts aufgegeben, und nur die Nachkommen, aus der Mischung von ihnen und Einheimischen hervorgegangen, führen noch den Namen »Portugiesen«. Diese sogenannten »Portugiesen«, welche sich in Indien in sehr untergeordneten Stellungen, meistens als Köche, befinden, sind ein trauriges Wahrzeichen von Portugals einstiger Macht und Grösse in Indien.
Am 3. März setzte das Schiff seine Fahrt zwischen der Malabarküste von Vorder-Indien und der Laccadiv-Inseln mit der Geschwindigkeit von 11 englischen Meilen = 20⅓ km per Stunde, also von 488 km per Tag, weiter fort, Die Temperatur beträgt 24° R. im Schatten, die Luft ist noch immer ruhig, der Himmel wolkenlos und daher die Hitze recht unerträglich. Eine solche Reihe von schönen Tagen ist wahrlich nicht leicht zu ertragen. Die Qual der Hitze wurde durch das tägliche Baden in den mit Meerwasser gefüllten Wannen etwas herabgemindert, wenn auch das Meerwasser selbst ebenfalls 24° R. hatte. Das Schreiben an meinem Tagebuche half mir über diese schweisstriefende Zeit glücklich hinüber. In der Nacht entlud sich plötzlich ein fürchterliches Gewitter mit Blitz und Donner und mit fluthenartigem Regen, ein in dieser Zeit unendlich seltenes Ereigniss, und dieses Naturschauspiel brachte den ersehnten Umschwung der Temperatur.
Am 4. März zeigte das Thermometer nur mehr 23° R., eine kleine Brise strich über das Schiff und trug dazu bei, die Luft noch mehr abzukühlen. Wir seufzten wahrlich wie neubelebt auf! Unser Dampfer umfuhr das Cap Comorin und gelangte in der Nacht in die Nähe von Colombo auf der Insel Ceylon. Das Schiff durfte aber nicht an die Küste anlaufen, weil dasselbe, von Bombay kommend, pestverdächtig war. Ungeachtet dessen, dass ich also als pestverdächtig erklärt wurde, ging es mir sehr gut.
Am 5. März sah ich vom Deck aus die herrliche Insel Ceylon mit ihren bis über 2000 m hohen Bergen, mit ihren ausgedehnten Palmenhainen und der malerischen, am Meeresufer gelegenen Hauptstadt Colombo — und dennoch konnte und durfte ich nicht dahin gelangen, so sehr ich mich auch lange darauf gefreut hatte. Ich fasste daher den Entschluss, bei meiner Rückfahrt ein wenig länger in Colombo und auf der Insel Ceylon zu verweilen. Ich änderte nämlich mein Reiseprogramm für die Rückfahrt von Japan und dazu bewogen mich die nachstehenden Motive. Nach Bombay wollte ich nicht mehr kommen, um dort abermals fünf bis sechs Tage zu bleiben, weil die Stadt mir nichts Neues mehr bot und ich der schrecklichen Regenzeit halber, die dort Anfangs Juni eintritt, wenig Bekannte mehr vorgefunden hätte; auch schien es mir ganz überflüssig zu sein, noch einmal in einer von der Pest inficirten Stadt zu wohnen. Ausserdem wollte ich überhaupt der zwischen 10. und 15. Juni beginnenden Regenzeit (Monsum) so viel als möglich entgehen, weil um diese Zeit, nach den Aussagen der Seeofficiere, auf dem Indischen Ocean gewaltige Stürme und fortgesetzt ungeheuere Regenstürze herrschen, und die letzteren die Luft derartig mit Wasseratomen erfüllen, dass Wäsche und Kleider selbst in verschlossenen Räumen nass werden. Demgemäss reifte in mir der Plan, mit dem Lloyddampfer nach einem einmonatlichen Aufenthalte in Japan am 30. April abzureisen und mit demselben nach Colombo zu fahren, wo die Ankunft am 25. Mai erfolgen soll. Auf der Insel Ceylon beabsichtige ich, bis 1. oder 2. Juni zu bleiben, dann mit dem Deutschen Lloyd oder der französischen Messagerie bis nach Aden zu reisen, was die Zeit bis 8. oder 9. Juni in Anspruch nimmt, und von dort mit dem am 9. desselben Monates abgehenden Eildampfer unseres Lloyd die Heimreise nach Triest anzutreten. Sollte diese Combination aus irgend einem Grunde nicht möglich sein, so würde ich von Colombo mit dem Dampfer einer anderen Gesellschaft bis Port Said und von da mit der Bahn nach Alexandrien fahren, von wo aus jeden Samstag ein Eilschiff des Oesterreichischen Lloyd nach Triest abgeht. Diesen Plan gab ich der Verkehrsdirection unseres Lloyd in Triest in einem Schreiben mit dem Ersuchen bekannt, mir eine derartig combinirte Karte nach Kobe in Japan zu senden.
In Colombo kamen neue Passagiere an Bord, und zwar ein Engländer, ein Geschäftsreisender aus Wien, zwei Frauen mit einem Wickelkinde und einer schwarzen Magd, und dann für die III. Classe vier hübsche Frauen und vier Männer aus Russland.
Noch am selben Tage gegen Mittag setzte unser Schiff seine Reise fort. Dieses Mal blieben wir aber näher dem Ufer, und so konnte ich die Besichtigung der Insel Ceylon besser fortsetzen. Längs der ganzen Küste befinden sich weit in das Land hinein, soweit das Auge reicht, dichte Cocosnusspalmenwaldungen, die mitunter eine solche Dichtigkeit haben, dass ein Durchgehen oder Durchschliefen geradezu unmöglich erscheint. Am Südrande der Insel sah ich die Stadt Port de Galles, welche mit ihren vielen schönen Gebäuden landeinwärts auf dem Hange eines Berges liegt und einen reizenden Anblick gewährt. Da die ganze Insel keinen natürlichen Hafenplatz besitzt, so haben die Engländer, welche Eigenthümer der Insel sind, sowohl bei Colombo als auch bei Port de Galles Riesenbauten aufführen lassen, um dort künstliche Häfen zu schaffen. In Colombo war ich in der Tageszeit um netto 4 Stunden vor Wien voraus und um 4700 km südlicher als unsere Kaiserstadt.
In der Zeit vom 6. bis 9. März durchquerte die Marie Valerie den Indischen Ocean südlich vom Bengalischen Meerbusen und steuerte fortwährend im 6. Grade nördlicher Breite von der Südspitze der Insel Ceylon bis zur Nordspitze der Insel Sumatra. Dabei hatte der Dampfer sowohl die entgegenkommende Meeresströmung als auch den von Tag zu Tag sich stärker entwickelnden Nordostwind zu überwinden, wodurch die Fahrtgeschwindigkeit auch etwas vermindert wurde. Am 6. März legten wir in 24 Stunden 500 km, am 7. März 433 km, am 8. März 400 km und am 9. März wieder 440 km zurück.
Am 8. März war der Wind schon so stark, dass die Schaumperlen der Wellen hie und da bis auf das Deck geschleudert wurden, und dennoch machte sich die schaukelnde Bewegung dieses famos gebauten Schiffes kaum fühlbar. Dasselbe soll keinen Kiel an seinem Boden haben, sondern ganz flach sein, ein Umstand, der auch den grossen Vortheil mit sich bringt, dass die unteren Räume eine sehr grosse Ladung aufnehmen können. Der stärker blasende Wind verschaffte uns indess den Gewinn, dass die Temperatur, obgleich wir nur 6 Grade vom Aequator entfernt waren, sich ganz annehmbar anliess. Allerdings hatten wir noch 24° R., aber durch die heftige Bewegung der Luft wurde die Wirkung dieses Wärmegrades sehr abgeschwächt. Ausser der jetzt regelmässigen Führung meines Tagebuches beschäftigte ich mich in diesen Tagen viel mit der Lectüre des höchst interessanten und wissenschaftlich sehr gediegenen Werkes »Nippon« (zwei starke Bände), welches die Freiherren Alexander und Heinrich von Siebold aus dem Nachlasse ihres Vaters, des niederländisch-indischen Generalstabsobersten Philipp Freiherrn von Siebold, herausgegeben haben, und das mir einer der Söhne, welcher k. u. k. Legationsrath ist, zum Geschenke machte. Des Abends las ich kleine englische Romane, um mich in der Kenntniss der englischen Sprache zu verbessern.
Ganz nett war ein Bewegungsspiel, welches Nachmittags in der Zeit von 4 bis 6 Uhr auf dem Deck des Schiffes arrangirt wurde. Zum Zwecke dieses Spieles ist auf dem Fussboden des Deckes ein Rechteck mit 1·2 m und 1·4 m Seitenlängen in 12 Abtheilungen mit den nebenstehenden Ziffern in Kreide gezeichnet, ausserdem sind mehrere 1·8 m lange, dünne, runde Holzstöcke mit flachen, unten 10 cm breiten Ansätzen, sowie 12 hölzerne, mit Bleiplatten eingelassene Quadrate, 10 cm Seitenlänge und 1·8 cm Dicke, vorhanden. Sechs der Quadrate sind mit weisser, und sechs mit rother Farbe bestrichen. In einer Entfernung von 7·5 m vom gezeichneten Rechtecke ist der Anfangspunkt des Spieles bezeichnet, von welchem aus die kleinen Brettchen gegen die Figur geschoben werden. Es spielen zwei Personen, welche abwechselnd je mit einem Stosse ihre Brettchen so gut als möglich zu postiren, oder die gut placirten Brettchen des Gegners wegzuschieben, oder ihm oder auch sich selbst eine Barrière zu machen bestrebt sind. Sind beiderseits je die sechs Brettchen hinausgeschoben worden, so werden die Resultate jeder Person notirt, die Hölzchen zurückgenommen, und es beginnt die zweite Tour, wobei die Spieler abwechselnd anfangen. Steht ein Brettchen auf 0, so ist das Resultat für diese Tour für den betreffenden Spieler ebenfalls 0. Sieger ist Derjenige, welcher nach Schluss der Touren 51 Einheiten erreicht hat. Auf Deck ist dieses Spiel um so interessanter, als bei jedem Stosse die wechselnde Neigung des Schiffes in Erwägung gezogen werden muss.
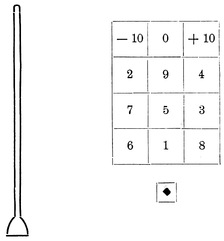
An diesem Tage, um 10 Uhr Vormittags, als wir eben im 6. Grad nördlicher Breite und 90·5 Grad östlicher Länge waren, sahen wir ein grosses Segelschiff, einen Dreimaster, in der Richtung gegen Südafrika segeln. Als der Segler unseren Dampfer wahrgenommen hatte, gab er ein Flaggenzeichen und näherte sich unserem Schiffe. Der Brückenofficier erstattete hiervon sofort dem Schiffscapitän die Meldung, der auf der Brücke erschien, worauf mit dem Schiffsglase die Signalsprache entziffert wurde. Der Segler gab das Signal, dass er Däne sei und Enedika heisse, was der Capitän der Marie Valerie zum Zeichen, dass er verstanden wurde, durch das Hissen der österreichisch-ungarischen Flagge beantwortete. Hiernach gab das dänische Segelschiff noch das Signal, dass auf seinem Schiffe Alles wohl sei, was wir mit dem Aufziehen der Salutflagge erwiderten. Der Däne gab diesen Salut zurück, wendete die Richtung wieder nach Südafrika und setzte die Fahrt fort. Unser Schiff hatte in der Zwischenzeit natürlich seinen Lauf nicht unterbrochen. Der Capitän theilte mir späterhin mit, dass das Segelschiff die Signale gegeben habe, damit von ihm, dem Capitän, aus im nächsten Hafen der Ort und die Stunde des Antreffens dieses Seglers angegeben werde. Dies wird dann von dort aus in die Heimat telegraphirt, und auf diese Weise bleibt das Schiff in Evidenz. Der Segler mag etwa 2000 t Reis aufgeladen haben, um diese vermuthlich nach England, Schweden oder Dänemark zu bringen. Hierzu dürfte er aber, trotzdem er in Hinblick auf Meeresströmung und Windrichtung die richtige Zeit für die Fahrt gewählt hat, immerhin noch fünf Monate nöthig haben!
Am 9. März zur Mittagszeit nahmen wir zu beiden Seiten des Schiffes Land wahr, und zwar war es im Süden die den Holländern gehörige Insel Sumatra und im Norden eine Insel, die zur Nicobaren-Gruppe zählt und unter englischer Herrschaft steht. Später fuhren wir knapp am Nordrande von Sumatra vorbei und erblickten dichtbewaldete und tief zerklüftete Gebirgsketten ohne alle Spuren menschlicher Niederlassungen. Diese Gegenden sollen von Menschen bewohnt sein, die sich bisher noch jeder Civilisation entzogen haben, sich wie die Thiere im dichtesten Walde verbergen, und sogar noch zur Classe der Menschenfresser gehören.
Am 10. März durchquerte die Marie Valerie den nördlichen Eingang zur Meeresenge (Strasse) von Malakka und steuerte direct auf den Ort Penang oder Pinang an der langgestreckten Halbinsel von Malakka zu. Von dieser Halbinsel gehört der nördlichste Theil, anschliessend an Burma (Hinter-Indien), den Engländern, der mittlere Theil zum Königreiche Siam, und der südlichste Theil (Peninsula) wieder den Engländern. Die Stadt Penang oder Pinang liegt auf einer, England unterstehenden Insel, welche sich an der Grenzlinie zwischen dem englischen und siamesischen Besitze befindet.
Der König von Siam, Chulalonkorn, in seiner Hauptstadt Bangkok, ist wohl noch selbständig, sein Königreich ist aber einerseits von den Engländern, und andererseits von den Franzosen mit ihren im Osten liegenden Besitzungen Tonking, Annam und Cambadja (Küste Chochinchina) ganz umfasst, und so hat es den Anschein, dass die Unabhängigkeit des Königs Chulalonkorn nicht mehr von langer Dauer sein dürfte.
Der König machte vor mehreren Jahren eine Reise durch Europa und hat sich aus dieser Zeit eine besondere Vorliebe für Oesterreich bewahrt, die er mit Freuden manifestirt, wenn ihn Oesterreicher in Bangkok besuchen. Es wurde mir auch von verschiedenen Seiten dringend anempfohlen, von Singapore aus auf einige Zeit dorthin zu reisen, um dort wieder neue und höchst interessante Verhältnisse kennen zu lernen. Leider wird es mir aber nicht möglich sein, diese kleine Reise zu unternehmen, da das Dampfschiff in Singapore nur zwei Tage anhält, und das Benützen anderer Schiffe meine ganze Reiseroute zerstören würde.
Die Temperatur in dem 6. Grad nördlicher Breite hat während der ganzen Zeit meiner Reise vom 6. bis 10. März nicht mehr als 24° R. betragen und machte sich aus dem Grunde weniger fühlbar, weil fortwährend ein nordwestlicher Wind mit grösserer oder geringerer Triebkraft über die Meeresfläche hinstrich. Am 10. März (Freitag) ging wohl nur eine kleinere Brise über Deck, der Himmel war aber leicht umwölkt, das Thermometer zeigte nicht viel mehr als 23° R., und es war somit der Aufenthalt auf dem Deck recht angenehm.
Am 11. März, als ich des Morgens auf das Deck kam, sah ich Penang vor mir liegen. Ein sehr anmuthiger Anblick. Grosse, schöne Baulichkeiten am Hafen, daran anschliessend Palmenhaine, aus deren Mitte hübsche Villen hervorguckten, im Hintergrunde eine mit dichten Waldungen bedeckte Berglehne. Wieder zeigten sich mir neue Arten, neues Wesen und neues Leben, und kaum konnte ich all' die mannigfaltigen Bilder voll aufnehmen, die im Laufe des Tages auf mich einstürmten. Vorerst waren es die Leute und Kähne, welche unseren Dampfer umschwärmten, die die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Da waren andere Gestalten und Gesichter zu sehen als in Indien, theils waren sie braun, wie mit Patina überzogen, aber leider nicht so geruchlos als Patina, theils dunkel-, theils lichtgelb; die Einen hatten die Köpfe ganz, die Anderen halb rasirt, und den Dritten hing rückwärts ein langer Zopf herab. Die braunen Singhalesen (Ureinwohner von Ceylon) und die Malayen (Bewohner vom malayischen Archipel) waren in weisse Leibchen und in weisse, um die Lenden geschlungene, bis unter die Kniee reichende Linnen gehüllt; die gelben Leute waren entweder Siamesen oder Chinesen und trugen dunkle Gewänder, speciell die Chinesen mit Vorliebe schwarzglänzende, von der Hüfte abfallende Röcke. Sehr viele Bursche hatten den Oberleib ganz bloss und auf dem Kopfe ein weisses Tuch wie einen Kranz herumgewunden. Die Chinesen trugen Hüte, meistentheils aus grauem Filz. Der Hauptunterschied zwischen den Stämmen, die ich in Bombay, und jenen, die ich hier sah, besteht darin, dass alle hiesigen Leute in einem viel besseren Nähr- und Kraftzustande sind als dort. Die Kähne waren vorne kantig, rückwärts breit and nach diesen beiden Seiten hin stark nach aufwärts gebogen. Sie schaukelten daher lustig auf den Wellen herum.
Ich überschiffte mich mit den beiden Doctoren, von welchen der eine nach Singapore reiste und der andere Schiffsarzt war, an's Land, und nahm mir dort einen Wagen, um mit den beiden Herren nach dem ¾ Stunden entfernten, als schön gerühmten Park zu fahren. Nun bot sich uns ein ganz sonderbarer Anblick dar; 20-30 Personen drängten sich heran, um sich als Kutscher und Pferd in einer Gestalt anzutragen. Es ist unglaublich und menschenunwürdig und dennoch ist es wahr, dass die Menschen hier Pferdedienste leisten, und dies zu einem so geringen Preise, dass man bei uns nicht den schlechtesten Wagen dafür miethen könnte. Die Leute erhalten für einen halben Tag 50 kr. und für einen ganzen Tag 70 kr. und sind froh, wenn sie dies verdienen können.
Dieses Fuhrwerk (Jinriksha) besteht aus einer zweiräderigen Dachkalesche mit einer Gabelstange, die vorne geschlossen ist, und der Zieher derselben (Riksha genannt) läuft innerhalb dieser Stange und bringt sein Gefährt, fortwährend laufend, stundenlang weiter. Derselbe trägt nur einen kurzen Linnenrock von der Hüfte herab und hat ein Leinentuch um den Hals hängen, mit dem er sich nach Bedürfniss abwischt. Es gibt aber auch Pferdewagen, bei welchen der Wagen für vier Personen sehr luftig eingerichtet ist, und der von einem 10 bis 12 Faust hohen Pony, aus Sumatra stammend, gezogen wird. Diese kleinen Pferdchen sehen nicht hübsch aus, sind aber kräftig und sehr ausdauernd.
Ich wählte einen solchen Pferdewagen zur Fahrt nach dem Parke, die uns viele und interessante Momente verschaffte. Vorerst sahen wir in der sich sehr weit landeinwärts erstreckenden Stadt die Auslagen der Verkaufs- und Arbeitsläden an der Front der Häuser mit den für den gewöhnlichen Haushalt jener Leute nöthigen Artikeln, alle in sehr einfacher Form. Die Strasse ist sehr rein gehalten, auch die Läden sehen ziemlich rein aus, aber die ausgebotenen Artikel sind nicht zum Kaufe einladend.
Auf unserem weiteren Wege gelangten wir an einen Platz, auf welchem sich ein heidnischer Tempel erhebt, und wo sehr viele oben beschriebene Wagen und eine grosse Menge von Menschen sich zu einer Leichenfeier vereinigt hatten. Viele der von Menschen gezogenen Wagen hatten die Form von Frachtkarren, auf welchen Schüsseln theils mit abgestochenen, unzubereiteten, oder mit schön gebratenen kleinen Schweinen, theils mit Gänse- und Entenbraten oder mit schön aufgeputztem Zuckerwerke aufgestellt waren. Diese Esswaaren wurden dem Todten gewidmet, damit er nach seinem Tode nicht an Hunger leide. Die Frachtwagen waren zum Theil sehr hoch und schön hergerichtet, und über denselben wurden schmale Baldachine getragen. Der Todtenwagen selbst hatte die Form eines kleinen, kunstvoll auf Rädern gebauten Hauses, welcher von zwei kleinen, reich beschirrten Pferden gezogen wurde. Die Leidtragenden waren ganz in Weiss gekleidet, in diesem Lande die Farbe der Trauer, verriethen indess in ihrem Wesen, ebenso wie in Bombay, gar keine Trauer über den Verlust des Verstorbenen.
Nach dem Austritte aus der Stadt führt die sehr gut gehaltene Strasse mehrere Kilometer weiter durch mehr oder weniger dichte Anpflanzungen von Cocosnusspalmen und Bananensträuchern. Der Blick auf diese herrlich grünen Haine ist überraschend schön. Hoch hinauf ragen die Palmen, deren Stämme horizontale Wachsthumsringe zeigen, und welche erst an der obersten Spitze mit dichten, grossen Palmenblättern bedeckt sind. Im Schatten dieser Blätter setzen sich nächst dem Stamme gruppenweise die Cocosnüsse an. Zwischen den grossen Palmenbäumen stehen kleine, in die Höhe strebende Palmenbäumchen oder mit riesengrossen Blättern ausgestattete Bananenpflanzen. Saftiges grünes Gras bedeckt den Boden, und buntfärbige Blütensträuche umgeben den Strassenrand. Elegante Villen und die auf meterhohen Piloten stehenden Holzhäuser der Eingeborenen sind in diese Haine eingestreut und befinden sich, des Staubes halber, weiter von der Strasse entfernt. Näher gegen den Park zu bemerkte ich ein Haus, in welchem allerlei ausgestopfte Thiere, als Schildkröten, fliegende Hunde, Ottern, Füchse und sehr viele grössere und kleinere buntgefiederte Vögel zum Verkaufe ausgestellt waren.
Nach ¾ Stunden langten wir bei dem Parke an, dessen sorgsame Pflege sofort ersichtlich ist. Der Park steigt sanft an der Lehne eines Berges hinan und besitzt in seinem oberen Theile einen recht hübschen Wasserfall. Inmitten des Gartens befindet sich ein sehr grosses Bassin, welches die Stadt Penang mit Trinkwasser versorgt. Die Bäume und Pflanzen, sowie die in einem offenen Gartenhause gehaltenen Blumen sind von grosser Vielfältigkeit und Schönheit, und geben Zeugniss von der riesigen Ueppigkeit des Bodens in den Tropengegenden. Wahrlich reizend gestaltete sich der Spaziergang in diesem Parke. Vögel, deren Gefieder eine seltene Farbenpracht zeigten, zwitscherten und durchflogen die vom Blumendufte aromatisch gewürzte Luft, mächtig grosse Schmetterlinge flatterten von Strauch zu Strauch, und kleine Aeffchen sprangen an den Aesten der Bäume herum. Ungestraft ergeht es sich aber nicht unter den Palmen! Dies mussten auch wir erfahren, denn die Hitze war erdrückend, und nur im Schweisse unseres Angesichtes konnten wir dieses prachtvolle Bild geniessen. Auf der Rückfahrt kehrten wir denn auch, um die ausgetrockneten Kehlen wieder anzufeuchten, in das Hôtel »Oriental«, das beste von Penang, ein, und liessen uns das in den Tropen übliche Getränk: Whisky mit Sodawasser, reichen.
In diesem Hôtel sah ich auch den Engländer wieder, welcher von Colombo bis Penang mit uns gefahren war, und der, obgleich ich während der Fahrt sehr wenig mit ihm gesprochen hatte, schliesslich die Anfangs zur Schau getragene Steifheit derart abstreifte, dass er — der überaus wortkarge Engländer — mir beim Abschied seine Visitkarte mit der Bitte übergab, ihn während meines bevorstehenden Aufenthaltes in Ceylon jedenfalls auf seinem Landgute zu besuchen und auch den Tag meiner Ankunft in Colombo seinerzeit von Penang aus telegraphisch bekanntzugeben, weil er mir nach Colombo entgegenkommen wolle.
Als ich wieder behufs Weiterfahrt auf den Dampfer Marie Valerie zurückkam, erwartete mich auf dem Schiffe ein eigenartig interessanter Anblick. Es waren nämlich in der Zwischenzeit 240 Kulis (Arbeiter), meist chinesischen, dann aber auch malayischen und siamesischen Stammes, zur Ueberfahrt nach Hongkong auf das Schiff gekommen und dort auf dem Hinterdecke untergebracht worden. Jeder der Leute hatte sein ganzes Hab und Gut bei sich, darunter auch eine fein gearbeitete Strohmatte, welche ihm zur Ruhestätte diente. Alle diese Völkerschaften auf einem kleinen Raume vereint, und ihr ganzes fremdartiges Leben und Treiben boten ein höchst anregendes Bild. Nachdem sich dieser ganze Menschenknäuel in kleineren Gruppen zu drei bis vier Personen aufgelöst, die Bagage theils aufgehängt, theils nebeneinander geschichtet, und sich auf die Matten niedergelassen hatte, errichtete der chinesische Koch, den der Lloydcapitän zur Verpflegung dieser Leute aufnehmen liess, mit seinen Gehilfen auf dem Deck seine primitive Küche. Hierauf trat eine verhältnissmässig volle Ruhe ein, die auch späterhin, während der ganzen weiteren Fahrt nicht mehr gestört wurde. Die Leute plauderten zum grossen Theile fortgesetzt und lebhaft, aber nur mit halblauter Stimme unter einander, Andere lasen für sich oder lasen ihrem Nachbarn in gedämpftem Tone vor, wieder Andere spielten Karten, und zwar die Chinesen mit ihren eigenartigen, schmalen, verschiedenfärbig beschriebenen Karten, und manche sah man rauchen oder essen. Der Koch bereitete indessen in grossen Kesseln die Hauptnahrung, den Reis, dann gab es in verschiedenen kleineren Casserollen allerlei Gemüse, Bohnen, Salat, Wurzeln und dergleichen, ebenso die mitgebrachten Mehlnudeln und die hier so allgemein beliebte Currysauce; auch hatte er stets heisses Wasser vorräthig, mit welchem sich die Leute selbst in ihren mitgenommenen buntbemalten Kannen Thee bereiteten. Die einzelnen Gruppen erhielten hierauf in ihre nett geflochtenen Körbe, in welche sie ihre Porzellanteller und Schüsseln, sowie die kleinen Theekannen eingepackt hatten, eine grosse Portion Reis, und in die anderen Schüsseln Gemüse sammt dem dazu gehörigen Gemüsewasser, Mehlnudeln und Currysauce. Dann stellten die Leute die Speisen in guter Ordnung vor sich auf die Strohmatten hin, und das Mahl begann. Hierbei hielt der Essende seinen Teller in der linken Hand und schob mit zwei kleinen runden Stäbchen, welche er in die rechte Hand genommen hatte, den Reis in kleinen Partien in den Mund, dazwischen griff er auch mit den Stäbchen, wie mit einer Zange, nach dem Gemüse und den vorher in die Sauce eingetauchten Mehlnudeln, und verzehrte dieselben auf die gleiche Weise. Das Essen ging ruhig und langsam vor sich. Nach dem Mahle bereiteten sich die Leute in ihren hübschen Theekannen den Thee und tranken denselben aus ihren eigenen, kleinen, bemalten und henkellosen Schalen. Diese Mahlzeiten wiederholen sich täglich dreimal, und wird stets reichlich aufgetragen; die Speisen sehen gut aus und sollen schmackhaft zubereitet sein. Der chinesische Koch erhält dafür per Person und per Tag ungefähr 7-8 kr. und findet dabei sein gutes Auskommen.
Wie gesagt, sehen die Leute im Allgemeinen sehr gut genährt aus, und nur Jene, welche dem abscheulichen Laster des Opiumrauchens verfallen sind, haben eine fahle Gesichtsfarbe und sind so abgemagert, dass sie wirklich nur aus Haut und Knochen bestehen. Die Opiumraucher führen ihren ganzen Opiumrauchapparat stets mit sich, welcher ganz gleichartig in einem langen, braunlackirten Kistchen mit Messingschloss verwahrt ist. Ich besah den Inhalt eines solchen Kistchens. Derselbe besteht aus einer lackirten Holzdose, einem breiten Pfeifenrohre, einem Lämpchen mit dazu gehörigem Windglase und Dochte, einem Drahtstifte, und endlich aus einer Dose mit dem harzartigen Opium. Späterhin beobachtete ich einen Opiumraucher bei seiner diesbezüglichen Beschäftigung. Er nahm zuerst auf den Drahtstift ein erbsengrosses Stück Opium, liess dasselbe an dem, vom Windglase geschützten Lämpchen weich werden und schmierte dann diese Masse in den am Pfeifenrohre befindlichen kleinen Napf hinein, worauf er das Rohr so hielt, dass eben nur der mit Opium gefüllte Napf über die Flamme zu stehen kam. War dies Alles geschehen, so führte er das andere Rohrende zum Munde und zog beim Verbrennen des Opiums den Rauch ein, wobei er nur zwei Rauchzüge machen konnte. Dieselbe Procedur wiederholte sich sechs- bis siebenmal, bis der Raucher in einen todtähnlichen, ekelerregenden Zustand verfiel. Es ist wahrhaft grauenvoll, dass die anderen Leute, ja selbst die dem Opiumraucher im Leben oft nächststehenden Personen, ruhig und theilnahmslos zusehen, wie ein Mitmensch, mitunter ein naher Verwandter, wissentlich und freventlich an Geist und Körper sich schädigt und sich selbst mordet.
Ausser den besprochenen 240 Arbeitern sind aber in Penang auch sechs Passagiere erster Classe eingeschifft worden, und zwar sämmtliche mit dem Bestimmungsorte nach Singapore. Darunter befindet sich ein sehr behäbiger eingeborener Engländer mit seiner sehr stattlichen Frau, einer geborenen Französin, welcher Besitzer einer Tabakanpflanzung bei Deli in Sumatra ist. Derselbe erzählte mir später, dass er circa 200 Chinesen ständig in Arbeit habe, und dass er jedem derselben ein Stück Land und den betreffenden Samen übergebe und jeden nach der Fechsung die Tabakblätter je nach deren Güte bezahle. Alle dortigen Pflanzer sollen, seiner Mittheilung zufolge, dieselbe Gepflogenheit der Arbeitszahlung haben, weil auf diese Art die Tabakpflanzen, welche sehr viel Arbeit, speciell durch die Reinhaltung von Käfern und Raupen erfordern, unbedingt am besten gedeihen. Er sendet dann seine Tabakblätter, welche sich, wie er anführte, hauptsächlich als Deckblatt sehr gut eignen, zum Verkaufe nach Holland. Auf mein Befragen bestätigte mir dieser eingeborene Engländer auch, dass in Sumatra in den dichtbewaldeten und unwegsamen nordöstlichen Theilen von Atjin, speciell in den Schluchten des 3400 Meter hohen Abong-Abong-Gebirges, noch heutzutage Kannibalen hausen, welche wohl von den Holländern fortwährend mit grossem Aufwande von Soldaten und Geld bekriegt werden, aber weder gefangen und civilisirt, noch vernichtet werden können.
Die Nacht vom 11. zum 12. März war fürchterlich heiss. Ich wachte nach Mitternacht auf und fand, dass meine Finger so verrunzelt waren, als ob ich dieselben stundenlang in warmem Wasser gebadet hätte. Ich liess mich aber deshalb in meiner Ruhe nicht stören, kehrte den Kopfpolster um und schlief ungestört weiter. Den andern Tag erzählte man mir, dass später in der Nacht ein heftiges Gewitter losgebrochen sei.
Am Sonntag, den 12. März, war es Morgens ein wenig kühler, aber gegen Mittag stieg die Hitze wieder auf 25° R. im Schatten. Wir fuhren durch den Settlementstreet nach Süden gegen Singapore, begegneten mehreren Dampfern und überholten ein Viermast-Segelschiff, welches in der Signalsprache bekannt gab, dass es deutscher Provenienz und seit 112 Tagen auf der Fahrt sei, dass es von Cardiff im Bristol-Canal, im Westen Englands, komme und nun nach Singapore segle. Es ist doch eine schöne Sache, auch auf dem Meere mit einfachen Mitteln auf so grosse Entfernung mit einander sprechen zu können.
Um 2 Uhr Nachmittag thürmten sich am westlichen Horizonte schwere Wolken auf, ein Sturm erhob sich und kühlte die Luft ab, und wieder kam ein wenig Leben in die durch die Hitze niedergedrückten Reisenden.
Am 13. März, um 6½ Uhr Früh, steuerten wir gegen Singapore zu. Da mir der Capitän schon Tags zuvor gesagt hatte, dass die Einfahrt zu dieser Stadt selten schön sei, so weilte ich um diese Zeit bereits auf dem Decke. Wir fuhren mit dem Dampfer wie durch einen weit ausgedehnten Park. Zu beiden Seiten liegen die Ufer ziemlich nahe unserem Schiffe und sind mit Bäumen, Gesträuchern und Gräsern bis an den Wasserspiegel dicht bewachsen. Dieses üppige, bis zum Wasser reichende Grün, durch welches der Dampfer sich durchschlängelt, bietet in der That eine wunderschöne Scenerie. Plötzlich öffnet sich dieser grünumfasste Wasserweg und Singapore wird sichtbar.
In Singapore habe ich den südlichsten Theil meiner Reise erreicht; die Stadt liegt etwas mehr als 1 Grad nördlich des Aequators und befindet sich 47 Grad oder 5200 km südlicher als die Stadt Wien, der wir in der Zeit um sechs Stunden voraus sind. Die Strecke, welche das Dampfschiff von Triest nach Singapore zurücklegte, beträgt 12.800 km, und jene, die uns noch von Kobe in Japan trennt, beläuft sich auf 5800 km.
Nach bewerkstelligter Landung des Schiffes nahm ich mir einen dort üblichen einspännigen Wagen, für den halben Tag nach der Taxe von 2 Dollars = 2 fl. 40 kr., und fuhr vorerst in den ausser der Stadt befindlichen botanischen Garten. Auch hier gab es, wie in Penang, grosse, den grünen Teppichen gleichende Grasflächen, hohe Bäume mit mächtigen schönen Blüten in Orange, Lila, Zinnober u. s. w., buntfarbige Pflanzen und Blumen und in den Gezweigen das lustige Zwitschern der exotischen Vogelwelt; dann besichtigte ich den anschliessenden zoologischen Garten, in dem einzelne Exemplare der im Lande hausenden wilden Thiere untergebracht sind.
Bei meiner Rückkehr in die Stadt suchte ich unseren Honorarconsul, den Grossindustriellen Herrn Brandt auf, der sich hier eines grossen Ansehens erfreut. Derselbe machte mir in gefälliger Weise den Antrag, an der am heutigen Tage stattfindenden Feier der Uebergabe des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone an den Besitzer des dortigen Hôtels »Adelphi«, Herrn Hasner, theilzunehmen. Herr Hasner stammt aus Oesterreich-Ungarn und hat sich viele Verdienste, darunter auch jenes der Bereicherung der Schönbrunner Menagerie, erworben. Ich sagte mit Vergnügen zu, denn es freute mich, im fernen Lande einem Feste beiwohnen zu können, in welchem ein Landsmann von Sr. Majestät unserem Allerhöchsten kaiserlichen und königlichen Herrn decorirt wird.
Ich kaufte sodann noch 80 Stück Ansichtskarten sammt Marken, wofür ich 12 Dollars = 14 fl. 40 kr., also beinahe das Doppelte wie bei uns, bezahlen musste.
Um 8 Uhr Abends fand im Hôtel »Adelphi« zur Feier der eben besprochenen Ordensübergabe ein Diner mit zehn Gängen und vorzüglichen Weinen statt. Bei dem Braten erhob sich Herr Brandt, hob die Verdienste des Hôteliers hervor und brachte auf ihn ein Hoch aus; sodann sprach ich einen kurzen, begeisterten Toast auf Se. Majestät unseren allergnädigsten Kaiser und König, welcher eine zündende Wirkung erzielte, und schliesslich stand der Gefeierte auf, konnte aber, vor Rührung übermannt, kaum ein Wort sprechen, und las endlich seine Dankesrede an Herrn Brandt mit bewegter Stimme vor.
Beim Diner waren 12 Personen, Oesterreicher, Ungarn und Reichsdeutsche anwesend, darunter befand sich auch der Magnat Graf F., welcher mit seiner Frau, einer Amerikanerin, seit sechs Jahren auf seinem eigenen Segelschiffe in der Welt herumfährt. Graf F. lud später Herrn Brandt und mich ein, den nächsten Tag sein Schiff zu besehen und daselbst das Tiffin zu nehmen.
Da mir die Seeofficiere dringend abriethen, während meines Aufenthaltes in Singapore in meiner Schiffscabine zu übernachten, weil in den Docks die Cabinen sehr heiss sind und von Mosquitos überfluthet werden, so nahm ich die Einladung unseres Consuls dankbar an, die Zeit über in seiner Villa (Bungalow) zu wohnen. Diese Villa ist inmitten eines grossen Gartens gelegen, sehr luftig gebaut und besitzt viele grosse Zimmer und Säle, welche reizend, theils mit Rohr-, theils mit kunstvoll geschnitzten Möbeln eingerichtet sind. Mir wurde ein Schlafzimmer mit einem Mosquitonetzbette, ein Toilettecabinet und eine Badekammer zugewiesen. Bei dem Umstande aber, als die vor den Zimmern befindlichen Altane ganz offen und die Zimmer selbst nur mit Thüren versehen sind, welche bis zur halben Höhe reichen, war mein Gemach sehr luftig, ja auch zugig.
Am 14. März begab ich mich mit Herrn Brandt zum ersten Pferdehändler in Singapore, weil der Erstere sich zu seinem einzelnen sehr hübschen Schwarzbraun ein zweites, dazu passendes Pferd kaufen wollte. Diese Pferdekaufangelegenheit interessirte mich aus dem Grunde, um einen Vergleich mit den ähnlichen Verhältnissen in der Heimat ziehen zu können. Ich fand bei dem Pferdehändler so ziemlich Alles wie bei den unseren, List und Schlauheit mitinbegriffen; die Preise der Pferde, meist Australier, standen aber höher als in unseren Landen.
Nach der Pferdeschau fuhren wir in den Club, wo ich als Mitglied eingetragen worden war, und wo uns Graf F. bereits erwartete, um uns hierauf gemeinsam in einem sehr hübsch hergerichteten Kahn auf sein Schiff zu bringen. Die ganze Einrichtung des elegant ausgestatteten Seglers fand unseren vollsten Beifall, wie nicht minder das vorzügliche Tiffin, bei dem der Hausherr und die Hausfrau in liebenswürdigster Weise die Honneurs machten.
Nachmittags ging ich nochmals in den Club und von da auf meinen Dampfer, um des Abends nach der Villa Brandt zurückzukehren. Dabei zeigte es sich recht deutlich wieder, dass die dortigen Kutscher gar keine Kenntniss von Strassen und Gebäuden haben. So führte mich mein Kutscher statt in die Villa zu einer englischen Kaserne, und ich verdankte es nur der freundlichen Vermittlung eines englischen Officiers, dass ich bald darauf mein Ziel erreichte.
Am 15. März sah ich mir zeitlich Morgens noch einmal die sehr reiche und schöne Stadt an, in welcher ein auffallend reges Leben herrscht. Singapore ging erst im Jahre 1824 in den englischen Besitz über, und hat seit dieser Zeit einen raschen Aufschwung genommen, so dass es jetzt zu einem der bedeutendsten Handelsplätze Südasiens zählt. Seine Einwohnerzahl mag sich auf 150.000 Seelen belaufen. Die einzelnen Stadttheile sind nach den verschiedenen Nationalitäten von einander getrennt, und in dem europäischen Viertel, in dem ich längere Spaziergänge machte, vereinigt sich der grosse Handelsverkehr. Eine besondere Sehenswürdigkeit der Stadt bildet das Palais des englischen Gouverneurs, welches von einem prächtigen Garten umgeben ist, und bemerkenswerth ist die Gleichmässigkeit des Klimas, welches die Aerzte bewog, diese Stadt das »Paradies der Kinder« zu nennen.
Auf mein Dampfschiff zurückgekehrt, empfing ich daselbst um 1 Uhr Mittag Graf und Gräfin F., sowie unseren Consul, welche ich zu einem Abschieds-Tiffin geladen hatte, und wobei einige Flaschen Chateau Palugyay den ungetheilten Beifall meiner Gäste fanden. Das kleine Fest gestaltete sich bis knapp zur Abfahrtszeit des Dampfers sehr animirt. Um 4½ Uhr Nachmittags lichtete die Marie Valerie die Anker und setzte ihre Fahrt nach Hongkong fort.
Am 16. März hatte unsere Marie Valerie von Singapore den Cours nach Norden genommen, musste gegen Sturm und Wellen ankämpfen, glitt aber dennoch so ruhig dahin, dass von einer Bewegung kaum etwas zu verspüren war. Zu unserer Rechten lag in grosser Entfernung und dem Auge nicht sichtbar die an Kaffee, Thee, Tabak, wie auch an wilden Bestien überaus reiche Insel Borneo, deren grösster Theil den Holländern gehört.
An Passagieren waren in Singapore zugewachsen ein englisches Ehepaar mit einem leider recht viel raunzenden Kinde, ein Reichsdeutscher, vermuthlich aus dem Handelsstande, und ein Mischling von einem Engländer und einer Eingeborenen. Ausserdem verblieb noch das Ehepaar, Besitzer von Tabakpflanzungen, gesundheitshalber auf dem Schiffe.
Am 17. März haben sich Sturm und Wogen noch vermehrt, aber unser braves Schiff überwindet sie mit voller Ruhe und Sicherheit. Die Temperatur ist in Folge unserer Fahrt nach Norden und des anhaltenden Sturmes halber etwas gesunken.
Am 18. März erfreute ich mich an den vortrefflichen Obstgattungen, welche servirt wurden, und zwar frische Ananasscheiben, dann Mangustin, eine apfelgrosse Frucht, deren aussen schwarze und innen rothe Schale einen grossen, weissen, sehr süssen Kern umschliesst, und Cziku, eine der Kartoffel ganz ähnliche Frucht, welche im Innern ein orangefarbiges, sehr saftiges und sehr süsses Fleisch enthält. Die beiden letztgenannten Früchte sind in Europa nicht erhältlich, weil dieselben, ungeachtet verschiedenartiger Versuche, nicht in gutem Zustande dahin gebracht werden können.
Das Wetter hat sich noch immer nicht gebessert, so dass einzelne der Passagiere dadurch viel zu leiden haben; ich selbst werde hiervon gar nicht berührt, und habe meine Freude an dem Schaukeln des Schiffes.
Am Sonntag, den 19. März. Die Gewalt des Sturmes ist heute ein wenig zurückgetreten, doch ist der Seegang ein noch recht hoher; die Temperatur verminderte sich auf 22° R.
Ich habe noch zu berichten, dass in Singapore gegen 400 Chinesen zum Transporte nach Hongkong auf unserem Dampfer aufgenommen wurden, so dass wir jetzt im Ganzen 600 Chinesen an Bord haben. Die Dampfschiffe übernehmen ganz gerne diese Transporte, weil dieselben recht einträglich sind, dagegen ist es eine nicht ganz ungefährliche Sache, eine so grosse Anzahl von halbwilden Menschen auf dem Schiffe zu haben. Schon sind Kämpfe zwischen den Chinesen selbst vorgekommen, doch wurden dieselben bald beigelegt. Jetzt hat der Capitän zwei Mann mit geladenen Gewehren und aufgepflanzten Bajonnetten bei den Eingängen zu den Passagierabtheilungen aufgestellt, und ausserdem liess er die Mündung der Dampfspritze gegen die Chinesen richten und die Vorkehrung treffen, dass sich sofort Wasserströme gegen dieselben ergiessen können. Das Verhalten der Chinesen ist indess in mancher Richtung besser, als dasselbe bei einer gleichen Zahl von europäischen Arbeitern sein dürfte; nur ist es widerlich, unter ihnen immerfort Opiumraucher mit ihren verfallenen Gestalten, den verglasten Augen und dem stupiden Gesichtsausdrucke zu sehen.
Heute Nachmittag starb auf dem Schiffe ein solcher Opiumraucher, welcher, nach der Aussage des Doctors, absolut kein Fleisch mehr an sich hatte, an den Folgen dieses abscheulichen Lasters, und es wurde seine Leiche in die Tiefe des Meeres versenkt.
20. März. Der Sturm fährt fort, das Meer aufzuwühlen, doch unser Schiff durchschneidet ruhig die hochgehenden Wellen. Bis heute Mittag legten wir von Singapore aus 1940 km zurück, und sind somit von Hongkong noch ungefähr 760 km entfernt. Wir dürften also vermuthlich den 22. Früh in den Hafen von Hongkong einlaufen.
Am 21. März blieb Alles genau so wie gestern. Dieselbe Heftigkeit des Sturmes, derselbe hohe Wellengang und dieselbe ruhige Bewegung des Schiffes, welches fortgesetzt dem Norden zusteuert.
Hongkong liegt noch innerhalb der tropischen Zone, nämlich im 22. Grad nördlicher Breite, also im gleichen Breitengrade wie Oberägypten. Die Temperatur ist auf 20° R. zurückgegangen.
Am 22. März Früh liefen wir in den riesengrossen Hafen von Hongkong ein, in welchem nebst sehr vielen mächtigen Handelsdampfschiffen auch kolossale Kriegsschiffe von England, Deutschland und Italien verankert sind, und in welchem sich ebenfalls unser Kriegsschiff Kaiserin Elisabeth befindet. Dazwischen liegen und segeln unzählig viele grosse und kleine Segelschiffe, und so geniessen wir hier den Anblick eines der bewegtesten Hafenbilder der Welt.
Die Marie Valerie landete nicht vor Hongkong selbst, sondern an dem gegenüber liegenden Strand von Kaulung, von wo aus alle zehn Minuten kleine Dampfer die Verbindung mit Hongkong vermitteln.
Ringsum ragen auf den neben einander liegenden Inseln grosse Berge empor, auf deren höchsten Spitzen die Engländer ein ganzes System von starken und sehr gut armirten Forts errichtet haben. Hongkong liegt auf dem Nordrande einer Insel und wurde von den Engländern »Victoria« benannt, doch wurde diese Benennung niemals landläufig.
Vor dem Breakfast machte ich einen Spaziergang durch Kaulung. Dort sind weiter landeinwärts, auf der Spitze der Hügeln, eine grosse Zahl von sehr schönen Kasernen und von dazu gehörigen, wirklich luxuriösen Gebäuden, die mit Gärten umgeben sind, erbaut, in welchen mehrere Regimenter, darunter auch solche aus Indien, untergebracht sind. Die Truppen, theils in rothen, theils in kaffeebraunen Uniformen, exercirten eben auf den nahe gelegenen Exercierplätzen. Die Strammheit ist jener, wie wir dieselben bei unserem und dem deutschen Militär zu sehen gewohnt sind, nicht gleich, doch betreiben die englischen Soldaten, meist Leute von hohem, kräftigem Wuchse, die Uebungen mit vollem Ernste. Im hohen Grade interessirte es mich, die indischen Regimenter mit ihren schönen, kräftigen, braunen Soldatengestalten bei der Ausbildung zu sehen. Die Engländer verlegten nämlich nach Hongkong mehrere Regimenter, welche sich im nordwestlichen Indien recrutiren, wo das beste indische Soldatenmaterial vorkommt. Aus Chinesen bilden die Engländer keine Regimenter, denn der Chinese ist ein schlechter Soldat. Wohl hat er Gehorsam und Abrichtungsfähigkeit, allein es fehlt ihm jedwede Initiative und es mangelt ihm der Muth.
Wie ausgezeichnet die Engländer für ihre Soldaten sorgen, das zeigt sich in den guten und gesunden Unterkünften, die sie ihnen schaffen, in dem reichlichen Lebensunterhalte, den sie ihnen gewähren; das beweisen die schönen Wohnungen der verheirateten Unterofficiere und die hübschen Villen, welche sie ihren Officieren zur Verfügung stellen, dafür sprechen endlich auch die Schulen für die Soldatenkinder, die Spitäler für die Mannschaft und deren Frauen und Kinder, und die Erbauung von sehr reich decorirten Heidentempeln für die Hindu-Regimenter.
Nach dem Frühstück begab ich mich mit dem Schiffscapitän auf das Kriegsschiff Kaiserin Elisabeth zum Besuch des Commandanten, Linienschiffscapitän B.. Sr. M.-Schiff Kaiserin Elisabeth erhebt nicht den Anspruch, gross zu sein, ja es sieht sogar recht mignon aus neben den nahe liegenden Riesenkriegsschiffen, besonders den zweien der Engländer, aber es ist wunderschön gehalten und gibt doch wenigstens hier, unter den anderen Vertretern der europäischen Länder, ein Zeichen davon, dass auch Oesterreich-Ungarn als Grossmacht existirt und seine Stellung im Völkerconcerte zu wahren weiss. Unser Kriegsschiff soll ein ganzes Jahr hindurch in den asiatischen Gewässern bleiben und wird unter der hervorragenden und zielbewussten Führung seines Commandanten die Vertretung unserer Monarchie gewiss vorzüglich gut besorgen. Bald nach meiner Rückkunft auf der Marie Valerie machte der Linienschiffscapitän B. seinen Gegenbesuch und lud mich für 7 Uhr Abends zum Diner auf das Kriegsschiff ein.
Nun fuhr ich hinüber nach Hongkong und suchte unseren dortigen Consul, Linienschiffslieutenant K., auf. Nach eingenommenem Tiffin in den herrlichen Sälen des Hongkong-Hôtels kaufte ich 50 Stück Ansichtskarten sammt Marken um 7 Dollars, behob in der Chartered Bank for India, China and Japan den Betrag von 400 Dollars und liess mich hierauf in der hier üblichen Weise von Menschen bis zur Drahtseilbahn auf den Peak von Hongkong führen. Bezüglich dieser Fahrt mit Menschen muss ich noch beifügen, dass in Hongkong Leute von Distinction nebst dem ziehenden Kuli noch zwei, den Wagen beiderseits anschiebende und in Dress gekleidete Kulis einherlaufen lassen. Da unser Consul so freundlich war, mir seine Leute zur Disposition zu stellen, so fuhr ich auf diese Weise ebenfalls mit drei Kulis, von denen jeder ein breites schwarzgelbes Bandoulière trug.
Die Drahtseilbahn ist ein bewunderungswerther Bau auf den 1800 Fuss hohen Peak von Hongkong, und ideal schön ist die Aussicht während der Fahrt auf den von Schiffen wimmelnden Hafen und auf die weit ausgedehnte Stadt mit ihren grossen Regierungsgebäuden, Palästen und Villen, die sich an der Lehne des Berges erheben. Vom Endpunkte der Bahn aus führt eine prächtig cementirte Strasse in sanft aufsteigenden Serpentinen noch weiter bis zur Spitze. Auf Anrathen des Consuls liess ich mich diese Strecke von Kulis in Tragsesseln hinauftragen. Von oben aus bietet sich ein seltener Rundblick auf die ganze englische Niederlassung dar, und man hat hier wieder Gelegenheit, die grossartigen und erfolgreichen Leistungen der Engländer zu bewundern. Wie auf allen Höhen, so befinden sich auch hier auf dem Peak Befestigungen und in deren Nähe Unterkunftsräume für englische Regimenter. Ja, die englische Regierung hat in der Vorsorge für ihre Truppen hier oben ein weitausgedehntes Hôtel vor Kurzem angekauft und dasselbe zur Umwandlung in eine Kaserne bestimmt.
Die ganze grosse Stadt mit ihren hervorragenden öffentlichen Baulichkeiten, Banken, Hôtels und Verkaufsläden hat vor 50 Jahren noch nicht bestanden. Erst seitdem die Engländer den magnifiquen Freihafen errichteten, erwuchs nach und nach dieser Welthandelsplatz, welcher heute seiner Bedeutung nach der drittgrösste auf unserem Erdballe ist und einen fabelhaften Reichthum repräsentirt.
Je länger ich mich hier in Asien aufhalte und je mehr ich Einblick in das ganze innere Getriebe nehme, um eine desto grössere Anerkennung muss ich einer so fruchtbringenden und zielbewussten Regierung zollen, desto mehr auch würdige ich die englische Verwaltung aller ihrer enormen Gebiete und der verschiedenartigen Völkerschaften, welche sich unter Englands Führung im Allgemeinen zufrieden fühlen. Die Engländer treten gleich mit grossen Werken auf und verwenden hierzu häufig sehr grosse Summen, wohl wissend, dass diese sich in späterer Zeit vielfältig verzinsen werden; sie sorgen in umfassender Weise für die Sanirung der Städte und ganzer Landstriche durch die Anlagen von Wasserleitungen, Canalisirungen, Aufforstungen u. s. w., sie heben auf jede Art den Aufschwung von Industrie und Handel, hauptsächlich durch Anlage von Eisenbahnen und Strassen, sie errichten Gotteshäuser, Schulen und Hospitäler, sie greifen nie in die persönliche Freiheit ihrer Unterthanen ein, insoweit dies nicht das öffentliche Wohl stricte erfordert, sie organisiren die Polizei aus Einheimischen und treffen stets überall die richtigen Vorkehrungen, wie die localen Verhältnisse dieselben nöthig machen. So kam es in früherer Zeit nicht selten vor, dass chinesische Schiffer einzelne Fremde, welche in der Nacht zu ihren Schiffen zurückfahren wollten, umbrachten, ausraubten und in's Wasser warfen, ohne dass man über den Verbleib dieser Leute eine Ahnung hatte. Da ordnete die englische Regierung an, dass die Polizei von jedem Reisenden, welcher in der Nacht auf einem Kahne nach seinem Schiffe zurückfahren will, den Namen und die Nummer des Kahnes in Vormerkung nehmen müsse. Seit dieser Zeit sind dergleichen Ermordungen nicht mehr vorgekommen.
Wenn nun auch die Engländer im Allgemeinen volle Freiheit des Handels und Wandels zulassen, so haben sie doch gewisse Angelegenheiten, welche eine weitgehende Bedeutung haben, ganz in ihre eigene Hand genommen. So ist in Hongkong nur die englische Regierung die ausschliessliche Besitzerin von Kohle, welche sie in ungeheuerer Menge aufspeichert. Auf diese Weise ist die englische Regierung hier Herrin der gesammten Schiffsbewegung und kann im Falle einer kriegerischen Verwicklung sofort die Ausgabe der Kohle ganz oder theilweise einstellen und somit die Function der Dampfschiffe vollkommen beherrschen.
Nach einem kurzen Spaziergange in der Stadt machte ich Toilette und begab mich an Bord unseres Kriegsschiffes Kaiserin Elisabeth, um der an mich ergangenen Einladung nachzukommen. Das Diner war brillant und während desselben spielte die Schiffsmusik heimatliche Weisen. Es machte auf mich eine grosse Impression, mich eben auf jenem Kriegsschiffe zu befinden, auf welchem Se. k. u. k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Franz Ferdinand vor sieben Jahren seine weltberühmte Reise um die Erde gemacht hat, und in denselben Räumen zu weilen, welche Se. k. u. k. Hoheit bewohnte und wo er sein epochales Tagebuch niederschrieb.
Bei dieser Gelegenheit wurde dem Bedauern darüber Ausdruck gegeben, dass die Oesterreicher und Ungarn im Allgemeinen gar so unbeweglich sind, und dass weder das Vergnügen am Reisen, noch die Lust zur Erforschung fremder Länder, noch das Trachten zur Erweiterung des Handels oder zur Erreichung einer einträglichen Position in anderen Welttheilen ihnen den Antrieb geben, aussereuropäische Reisen zu unternehmen. Eben bei uns, wo das Wissen und Können einen hohen Grad erreicht hat und wo das Heimatland oft gar nicht dazu kommen kann, die Intelligenz Angesichts ihrer Ueberproduction fruchtbringend zur Geltung zu bringen, wäre es überaus vortheilhaft, sich in jene Länder zu begeben und sich dort einen Wirkungskreis zu schaffen, wo intellectuelle Kraft sich gut bezahlt macht. Auch abgesehen davon, wäre es sehr nützlich, wenn gar manche unserer Landsleute durch weite Reisen einen weiteren Ausblick gewinnen würden, damit sie in die Lage kommen, die heimatlichen Verhältnisse von einem grösseren und richtigeren Standpunkte aus zu beurtheilen.
Am 23. März besichtigte ich nochmals das bunte Treiben in den Strassen und am Hafen dieses grossen Handels-Emporiums, und kehrte dann auf unseren Dampfer zurück, welcher um 3 Uhr Nachmittags die Anker lichtete, um seine Fahrt nach Shanghai fortzusetzen.
Schliesslich möchte ich hier noch davon Erwähnung thun, dass ich bei meiner Ankunft in Hongkong, auf dem Festlande stehend, das Gefühl hatte, als ob der Boden unter mir schaukeln würde, und dass ich unbewusst meinen Körper hin- und herbewegte.
Die Fahrt von Hongkong durch die vielen, dem Festlande vorgelagerten Inseln bis hinaus in's offene Meer war sehr interessant. Ueberall auf den Lehnen und auf den Höhen der ringsum sich erhebenden Berge, sowie in den Thälern zeigten sich Befestigungen und Kasernen, dann Fabriken und Häusergruppen, schöne Paläste und Villen. Der Charakter der Berge ähnelt jenem des Karstes — sehr wenig Vegetation, dagegen viel Gestein und Felsen.
Als neue Passagiere kamen vier Amerikaner, anscheinend der Mittelclasse angehörig, an Bord, dagegen hat das englische Ehepaar mit dem unartigen Kinde das Schiff in Hongkong verlassen. Einer von den vier Amerikanern ist ein Freiwilliger von der Armee der Vereinigten Staaten auf den Philippinen, welcher von dort seinen Abschied genommen hat und nach Amerika zurückkehrt. Viele Einwohner der Philippinen bedauern jetzt schon, wie mir von vielen Seiten mitgetheilt wurde, im hohen Grade, sich gegen ihr Mutterland Spanien aufgelehnt zu haben. Die vielen, vielen aus ihrer Heimat, den Philippinen, geflohenen Familien, welche jetzt in Penang, in Singapore und in Hongkong leben müssen, geben ein beredtes Zeugniss ab, über das »völkerbeglückende« Eingreifen der Amerikaner.
Die Temperatur ist sehr stark herabgegangen, sie beträgt nur 17° R. und wirkt des fortgesetzt heftigen Windes halber so empfindlich, dass man wärmere Kleider anziehen muss. Es ist erstaunlich, dass die Südgrenze von China, welche doch noch in der tropischen Zone und im gleichen Breitegrade mit der Wüste Sahara liegt, ein so gemässigtes Klima hat.
Am 24. und 25. März fuhr unsere Marie Valerie längs der chinesischen Küste in dem chinesischen Meere, einem Theile des Grossen oder Stillen Oceans Anfangs nordöstlich, dann aber mehr nördlich vorwärts, passirte die Meeresstrasse von Formosa und hatte durch beständiges Ausweichen von Inseln und Sandbänken einen wirklich schwierigen Weg zu hinterlegen.
Die Sonne schien, und obwohl der Wind sehr heftig blies, war das Schaukeln unseres famosen Dampfers ein recht mässiges. Das Thermometer wies nur mehr 14° R. auf, und bei dem herrschenden Sturme fing es an, unangenehm kühl zu werden. Nach Ansicht des Schiffscapitäns muss es in Ost-Sibirien einen abnorm kalten Winter gegeben haben, und dem sei es zuzuschreiben, dass es auch in China so ausnahmsweise kalt ist. Es regnete so ziemlich den ganzen Tag — der erste Regentag auf meiner nun zweimonatlichen Reise — und es blieb nichts Anderes übrig, als warme Winterkleider zu nehmen.
Am 26. März (Sonntag). Die Temperatur sinkt immer weiter, heute hat es selbst im geschlossenen Raume nur mehr 10° R. und dabei sind wir im 30. Grade nördlicher Breite, das ist in der Höhe der nordafrikanischen Küste. Ein dichter weisser Nebel umgibt uns, und bei dem Umstande, dass wir uns in der Hang-tschan-Bai befinden, vor welcher der Tschou-hang-Archipel mit seinen sehr vielen Inseln vorgelagert ist, wird dadurch die Fahrt des Dampfers sehr gefährdet, deshalb die Fahrtgeschwindigkeit sehr vermindert und mitunter die Maschine ganz gestoppt. Es wird fortwährend sondirt und erst nach genauer Prüfung der Stellen streckenweise weitergefahren. Vorsicht erfordert wohl Zeit, doch dieser Zeitverlust ist verschwindend klein gegen jenen, welchen ein Accident in Anspruch nehmen würde.
Gegen Abend langten wir zur Einfahrt von Shanghai an. Dort wurde das Schiff verankert, um erst den anderen Tag nach Eintritt der Fluth um 8½ Uhr Morgens mit dem Lotsen auf dem Wusungflusse bis nach Shanghai zu fahren, welches 20 km von der Küste entfernt ist und an dem Wusungflusse liegt. Dieser Fluss hat für die Marie Valerie die nöthige Tiefe, während unser Kriegsschiff Kaiserin Elisabeth, welches in der nächsten Woche hier eintreffen soll, wegen seines Tiefganges nicht bis nach Shanghai kommen kann, sondern im Flusse, auf dem halben Wege dorthin, bei dem Orte Wusung anhalten muss.
Am 27. März ging der Wind nur mehr ganz schwach, und somit war die Temperatur, die zwar noch immer nicht mehr als 10° R. erreichte, immerhin erträglicher als gestern.
In Shanghai wollten die vier Amerikaner das Schiff verlassen, doch spielte sich vorher noch eine kleine Episode ab. Als wir uns schon dem Hafen näherten, bei welchem wir anlegen sollten, kamen mit einem kleinen Localdampfer drei Engländer an uns heran und bestiegen unser Schiff. Nach dem Anlegen im Hafen entpuppten sich die Engländer als ein Polizeicommissär und zwei Detectivs, welche einen der Amerikaner verhafteten, weil von Hongkong die telegraphische Anzeige an die Polizei-Direction in Shanghai eingetroffen war, dass derselbe dort vor seiner Abreise einen Diebstahl begangen hatte. Eine nette Gesellschaft — diese Amerikaner. Ein Anderer von ihnen, ein grosser, ungeschlachter Kerl, soll der Besitzer eines Circus in Hongkong sein, den er nun nach Shanghai bringen will; dieser Mann brachte während der Ueberfahrt die Figur des formlosen und selbstsüchtigen Amerikaners in einer sehr unterhaltenden Weise zur Darstellung.
Ich stieg nun an das Land, nahm einen von Chinesen gezogenen kleinen zweiräderigen Wagen (Jinriksha), machte unserem Generalconsul meinen Besuch und fuhr dann durch die Stadt und in die Umgebung derselben.
Die sanitären Verhältnisse in Shanghai sind nicht gut. Die Erhebung der Stadt über das Wasserniveau ist eine sehr geringe, und viele Meilen weit gibt es keine Berge; das Wasser hat demnach nur einen sehr schwachen Abfluss und steht beinahe unbeweglich in allen Gräben, wo dann alle dort befindlichen organischen Stoffe verwesen. Hierzu kommt noch die entsetzliche Unreinlichkeit der Chinesen und ihre sanitätswidrigen Gepflogenheiten. So werden z. B. die Gemüse auf den Feldern, des besseren Wachsthumes halber, überall mit flüssiger Jauche übergossen, welche in der heissen Jahreszeit die Luft verpestet; die Verstorbenen der armen Leute werden nur in eine Holzkiste gelegt und mit Kalklösung übergossen; hierauf werden diese Kisten mit Strohmatten umwunden und in diesem Zustande, ohne sie zu vergraben, auf das freie Feld hinausgestellt! Wo die Engländer die alleinigen Besitzer einer Stadt sind, werden von denselben umfassende Vorkehrungen für sanitäre Anlagen gemacht. In Shanghai aber gibt es drei nebeneinander liegende Niederlassungen (Settlements), die der Engländer, der Amerikaner und der Franzosen, und daran stosst die alte Stadt der Chinesen. Die verschiedenen Nationen unternehmen gemeinschaftlich sehr wenig zur Hebung der sanitären Lage, und die autonome chinesische Gemeinde thut gar nichts.
Die alte Stadt der Chinesen ist mit einer Mauer umgeben, welche sieben Eingangsthore besitzt, die von Abend bis Morgen geschlossen sind, weil kein Europäer dort übernachten darf. Auf den Wällen ihrer Stadt haben die Chinesen eiserne Kanonen stehen, welche sich aber, wie ich es selbst gesehen habe, in einem ganz verwahrlosten und gebrauchsunfähigen Zustande befinden. Die Gassen im Innern der Stadt sind kaum meterbreit, und neben der Hauptstrasse liegt ein mit faulendem Wasser und Sumpf gefüllter Graben, welcher alle organischen Abwurfsstoffe aufnimmt und beinahe gar keinen Abfluss hat. Im Centrum der Stadt ist ein kleiner See gelegen, welcher die gleichen Verhältnisse zeigt wie der eben beschriebene Graben, und inmitten des Sees steht ein aus Holz erbautes, sehr grosses Theehaus, zu welchem man auf Holzstegen hingelangt. Die überall herrschende Unreinlichkeit und der pestilenzartige Gestank sind geradezu entsetzlich, und es ist auch die natürliche Folge davon, dass typhöse Krankheiten, Cholera, Blattern, Dysenterie u. s. w. fortwährend sehr viele Opfer fordern. Die Reconvalescenten nach solchen Krankheiten sollten, da es bei Shanghai auch landeinwärts keine besseren sanitären Verhältnisse gibt, baldmöglichst ein anderes Land aufsuchen, am besten nach Europa reisen.
Nachdem ich mit unserem Generalconsul und seiner liebenswürdigen Frau in einem zweispännigen Wagen eine Spazierfahrt in dem europäischen Theile von Shanghai und in dessen Umgebung gemacht hatte, kehrte ich zum Dampfschiffe zurück und unternahm dann wieder gegen Abend in Gesellschaft des Schiffscapitäns und des Schiffsdoctors eine von unserem Consulatssecretär geleitete Excursion in die Stadt. Wir fuhren mit Rikschas zuerst in die Hauptstrasse des englischen Settlements, wo Tausende von Chinesen in der elektrisch beleuchteten Strasse hin- und herwogten, oder von Rikschas in Wagen gezogen oder in Sänften getragen wurden. Die Auslagen waren hier dicht aneinander gereiht und aussen über denselben hingen lange schwarze, gelbe, blaue oder rothe Tafeln herunter, welche mit chinesischen Buchstaben in entsprechender Farbe beschrieben waren. Viele Theehäuser und mehrere chinesische Theater luden zum Besuche ein. Es herrschte hier ein ganz fremdartiges Leben, und dabei war das Verhalten der Chinesen, auch jenes der untersten Volksschichte, ruhig, ohne Lärm und Getöse. Als wir uns das Strassenleben zur Genüge besehen hatten, beschlossen wir, in ein Theehaus zu gehen.
Im Theehause war der grosse Saal elektrisch beleuchtet, bunt hergerichtet, von an langen Tischen nebeneinander sitzenden Chinesen erfüllt. In der Mitte des Saales befand sich ein Podium, wo gleichfalls an Tischen die sich im Gesange producirenden Mädchen, und hinter denselben die sie begleitenden Musikantinnen sassen. Kaum waren wir eingetreten, so wurde uns Thee in Schalen servirt und ein Teller mit einer gedörrten Getreideart zum Verzehren der einzelnen Körner vorgesetzt. Auch wurde eine Art Metallkrug (narguilé) zur Disposition gestellt, aus welchem man den Tabak raucht, indem man den Rauch vorher durch das Wasser ziehen lässt. Die Musikantinnen bestehen vornehmlich aus Holz- und Lautenschlägerinnen, welche ohne Unterlass einen sehr unmusikalischen Lärm hervorbringen. Die Sängerinnen sind dick aufgeschminkt und gelten bei den Chinesen als Schönheiten. Sie sind meistens in sehr reich mit Stickereien versehene Seidengewänder gekleidet, tragen mitunter kostbaren Schmuck und werden häufig in luxuriösen Sänften in das Theehaus getragen. Ihr Gesang ist ohrzerreissend — sie singen nur mit Fistelstimmen in langgezogenen Tönen ohne alle Harmonie. Eine echte Katzenmusik! Nach ungefähr einer halben Stunde entfernten wir uns, und hatte ein Jeder für den Genuss von Thee und Gesang 40 Sens (50 kr.) zu zahlen.
Vom Theehause aus begaben wir uns in ein chinesisches Theater. In demselben ist die Bühne wie bei uns erbaut, nur gibt es keinen Wechsel der Coulissen und kein Fallen des Vorhanges, dagegen befindet sich auf der Bühne eine Musikcapelle, welche aus Holzcinellen- und Lautenschlägern, sowie aus Trompetenbläsern zusammengesetzt ist. Das Theaterspiel besteht hauptsächlich aus Aufzügen, welche einer dem anderen unmittelbar folgen, oder welche auch gleichzeitig erscheinen, um sich auf der Bühne zu bekämpfen. Die Hauptrolle des chinesischen Theaters spielt der Bühnengeneral, welcher durch seine goldgestickten bunten Kleider, durch vier, auf dem Rücken befestigte, wehende Fahnen und durch einen sehr lang herabhängenden Bart erkenntlich ist. Dieser General, meist mit einer martialischen Maske vor dem Gesichte, erscheint mit seinem bunten Gefolge — etwa sechs bis acht Personen — auf der Bühne, schreitet sehr gravitätisch einher, streicht sich den langen Bart, fuchtelt mit seiner Hellebarde herum, schreit dann mit Fistelstimme einige Worte heraus und verschwindet hinter der Bühne. Kaum ist er verschwunden, so kommt ein anderer General mit womöglich noch grässlicherer Maske sammt seinem Gefolge heraus und hält einen Wedel aus Pferdeschweifhaaren in der Hand, zum Zeichen, dass er auf dem Pferde sitze. Auch dieses Ungethüm schreit einige Sätze mit Fistelstimme heraus. Es scheint eben, dass sich die Fistelstimme bei den Chinesen eine weitgehende Vorliebe erworben hat. An diese Aufzüge reihen sich andere an, wieder von Theatergeneralen geführt, und so geht es fort, bis zuerst einzelne, dann mehrere Generale mit Gefolge gleichzeitig auf der Bühne erscheinen und den Kampf durch das raschere Herumgehen darstellen, wozu dann die Musik im schnellsten Tempo einen unerhörten Lärm macht. Das Kommen und Gehen der Aufzüge wird immer lebhafter, und nun produciren sich, zwischen durch, geschickte Luftgymnastiker mit ihren famosen Salti mortali. Ist nun dieses Charivari auf dem Gipfelpunkte angelangt, so verschwindet mit einem Schlage das ganze Gewühl von der Bühne und es kommt dafür von der anderen Seite ein als Frau verkleideter Chinese heraus, welcher eine Liebesscene spielt und von einer Nebenbuhlerin verfolgt wird etc. Frauen und Mädchen dürfen auf den chinesischen Bühnen nicht auftreten.
Während der Vorstellung wurde uns Thee servirt und erhielten wir, wie dies auch im Theehause geschah, kleine, in heisses Wasser getauchte Linnentücher. Mit diesen Tüchern wischen sich die Chinesen Gesicht und Hände ab, weil dies eine kühlende Wirkung haben soll. Durch Vermittlung des Consulatssecretärs wurden wir von einem Polizeimann hinter die Bühne geleitet, wo wir die Schauspieler beim Umkleiden, Rauchen oder Theetrinken fanden. Ich beschenkte jeden der Chinesen, der einen Bühnengeneral dargestellt hatte, mit einem 20 Cents-Stücke (24 kr.), worüber dieselben bei ihrer grossen Anspruchslosigkeit hoch erfreut schienen.
Der Eintritt in das Theater, in welchem man sich nach Belieben in das Parterre oder auf die Galerie an Tischen setzt, kostet per Person einen halben Dollar = 60 kr.
Auf der Heimwanderung zum Schiffe sahen wir noch viele geschminkte Schöne, welche da und dort an den Hausthoren standen, und den Chinesen, aber nie den Europäern, freundliche Gesichter machten.
Am 28. März fuhr ich in die chinesische Hauptverkaufshalle für Seidenwaaren, Laou-Kai-Fook & Comp., Corner of Kiukiang and Hohen Road Nr. 8 and 9, um einige Seidenstoffe auszuwählen. Ich kaufte dort ein sehr schönes, schweres Seidenstoffstück in lichter Orangefarbe, 10 Yards, d. i. circa 9 m lang, um 20 Dollars = 24 fl., dann ein leichtes, blaues Seidenzeug mit Muster in langen Blättern, 15 Yards lang, um 15 Dollars = 18 fl., und endlich 3 Yards eines wunderschönen, lichtblauen Seidenstoffes mit reichen Goldstickereien um 18 Dollars = circa 22 fl. In einer anderen Verkaufshalle erstand ich noch zwei gestickte Seidentheile für Rücken und Brust um anderthalb Dollars und ein Paar von den kleinen, gestickten chinesischen Schuhen um einen halben Dollar.
Nach einem sehr guten Tiffin beim Generalconsul kehrte ich auf meinen Dampfer zurück, und beschäftigte mich mit der Ausfertigung der gekauften 80 Ansichtskarten von Shanghai.
Bezüglich des Geldverkehres sei hier noch erwähnt, dass Hongkong und Shanghai je eine Bank besitzen, welche eigenes Geld ausgibt, und dass, wenn dasselbe auch den gleichen Werth in Dollars zu 100 Cents hat, man doch bei der Umwechslung des Geldes bis zu 5% Abzug erleidet.
Am 29. März fuhr ich Vormittags zu der in Shanghai bestehenden deutschen Post, wo ich mir für meine Ansichtskarten deutsche Briefmarken, welche mit dem Worte »China« überdruckt sind, einkaufte, weil die Expedirung mit der deutschen Post weit sicherer als mit der chinesischen von statten geht.
Nach einem abermaligen Tiffin beim Generalconsul machte ich unter der Führung des Consulatssecretärs und in Begleitung des Schiffscapitäns und mehrerer Lloydbeamten eine Fahrt in die autonome alte Chinesenstadt, deren wenig erbaulichen Zustand ich schon beschrieben habe. Die dortigen Verkaufsbuden bieten nur ganz schlechtes und elendes Zeug, so dass ich nur drei gemalte Porzellan-Theeschalen und ein kleines Holzkästchen mit einer Magnetnadel zu je 10 Cents kaufen konnte.
Zu einem noch in Aussicht genommenen Ausfluge nach einem französischen Kinder-Erziehungshause, welches in der Nähe von Shanghai von Jesuiten geleitet wird, ist es aus Mangel an Zeit nicht gekommen. Die Kinder werden dort in verschiedenen Handarbeiten ausgebildet, und sollen sehr schöne Resultate erzielt werden.
Am Abend kaufte ich noch von einem auf das Schiff gekommenen Schneider ein 15 Yards langes Stück von leichter Rohseide um 6 Dollars, und von einem anderen Händler sechs geschnitzte Holzdosen um 1 Dollar.
Allgemein und sehr tief wird hier noch der Verlust des vor zwei Jahren beim Baden um's Leben gekommenen Consuls Haas bedauert. Derselbe hatte in der richtigen Auffassung seiner Stellung Alles aufgeboten, um österreichische Kaufleute nach Shanghai zu ziehen, und um den Handel mit Oesterreich-Ungarn zu heben und zu fördern. Jeder unserer Landsleute, der nach Shanghai kam, konnte gewiss sein, in seinen Unternehmungen auf das Kräftigste von Consul Haas unterstützt zu werden. Leider haben aber auch seine Bemühungen unsere Geschäftswelt nicht zu ausgedehnterem Handel mit China bewogen.
In Shanghai waren wieder neue Passagiere zugewachsen, und zwar ein spanisches Ehepaar, ein Handelsmann aus Wien mit seiner Frau und zwei Engländer; trotzdem konnte ich meine beiden Cabinen bis zu dem ohnehin in drei Tagen bevorstehenden Ende meiner Reise beibehalten.
Das Wetter war während meines Aufenthaltes in Shanghai vortrefflich; die Sonne schien die ganze Zeit und es war recht warm. Allein am Tage der Abfahrt am 30. März gab es wieder einen tüchtigen Wetterumschlag, es stürmte und regnete, und das Thermometer fiel im geschlossenen Raume bis auf 6° R. herab.
Meiner Abhandlung über Shanghai will ich nun noch Einiges über die dortigen militärischen Verhältnisse beifügen. Im geraden Gegensatze zu Hongkong, wo man auf Schritt und Tritt Soldaten und militärische Einrichtungen sieht, sind in Shanghai gar keine militärischen Vorkehrungen getroffen und existirt überhaupt hier kein actives Militär. Bei dem Umstande indess, dass diese völlige Entblössung von jedweder militärischen Macht den europäischen Einwohnern denn doch etwas unheimlich und gefährlich schien, bildete sich eine militärische Freiwilligen-Abtheilung, welche aus Commis oder sonst dort in Kondition stehenden Europäern gebildet ist. Diese Leute sind mit Gewehren ausgerüstet und scheinen auch eine Art von Uniform zu besitzen. Ich habe diese Abtheilung an zwei Abenden auf einem freien Platz inmitten des englischen Settlements exercieren gesehen. Der Wille scheint gut zu sein, die Ausführung ist aber recht mangelhaft. Hoffentlich genügt diese Freiwilligenschaar, um Ruhe und Ordnung im Innern der Stadt aufrecht zu erhalten und das europäische Shanghai auch vor einem etwaigen chinesischen Ueberfalle zu sichern, eine Annahme, welche im Hinblick auf die elenden militärischen Verhältnisse bei den Chinesen doch einige Berechtigung in sich schliesst.
Am 31. März (Charfreitag) fuhren wir direct auf die Meerenge zwischen Nippon und der Insel Kiuschin zu, welche in einen Binnensee führt, an dessen Ufer Kobe liegt. Auf unserer Fahrt befinden wir uns etwa 500 km südlich von Kiautschau, welches von den Deutschen besetzt ist. Kiautschau befindet sich am südlichen Ufer der Provinz und Halbinsel Schantung, zwischen der Mündung des alten und des neuen Laufes des aus dem Centrum von China kommenden Flusses Hwangho und etwa 300 km östlich von dem 1300 km langen Kaisercanale, welcher von Peking nach Süden bis zur Hangtschau-Bai geführt ist.
Die Lage von Kiautschau ist demnach für den Handel sehr günstig, nur erscheint es geboten zu sein, behufs einer Verbindung mit den genannten Wasserstrassen noch gute Communicationen zu erbauen. Aber auch in politischer und militärischer Hinsicht kann die Wahl von Kiautschau als deutscher Ansiedlungsort als eine sehr glückliche bezeichnet werden, weil dieses Gebiet nur etwa 400 km südlich der Wasserstrasse von Tsill liegt, die ungefähr in einer Breite von 40 km den Wasserweg zum Golfe von Tsill, das ist zur Zufahrt nach Peking, eröffnet. Ausserdem dürfte der bergige Charakter der Gegend vortheilhafte Verhältnisse zur Verteidigung bieten und den sanitären Bedingungen zu Gute kommen.
Am 1. April, bei der Annäherung an Japan, wurde das Wetter endlich wieder besser. Gestern hatte ich den kältesten Tag der ganzen Reise erlebt, das Thermometer hatte sich nicht über 5° R. erhoben und die Witterung war die denkbar schlechteste. Der Wechsel der Temperatur, den ich auf der Reise durchgemacht habe, ist in der That sehr empfindlich gewesen. Auf der Fahrt zwischen Candia und Cypern gegen Port Said und bis 18. Februar in Bombay, dann weiter bis nach Hongkong war es fortwährend sehr heiss oder mindestens recht warm gewesen, aber vom 24. März an wurde es empfindlich kalt, so dass selbst die wärmsten Kleider nicht vor dem Frieren schützen konnten.
Zu Mittag passirten wir die Meerenge zum erwähnten Binnensee, und sahen die sehr starken Vertheidigungsmassregeln, welche Japan gegen eine feindliche Flotte, welche hier einfahren wollte, getroffen hat. Diese Vorkehrungen sind speciell gegen China gerichtet. An den Ufern und auf den Höhen von Shimonoseki und Moji sind viele Schanzen aufgeworfen und reichlich mit sehr guten Geschützen ausgerüstet. Der Name der Stadt Shimonoseki ist in der Welt durch den Friedensschluss bekannt geworden, welcher den letzten Krieg zwischen China und Japan beendete. Eine unzählige Menge von Fischerbooten werden nun sichtbar, und die vielen Dampf- und Segelschiffe, welche im Hafen von Moji vor Anker liegen, geben Zeugniss von dem lebhaften Handel, der hier betrieben wird. Dabei liefern aber zwei, nur mit den Schloten über den Wasserspiegel vorragende japanische Dampfschiffe gleichzeitig den Nachweis, dass in Japan nicht überall volle Solidität herrscht.
Die Fahrt in den Binnensee gewährt manche schöne Ausblicke auf die angrenzenden Ufer von Japan, ist aber nicht ganz ungefährlich, und das Dampfschiff muss daher von einem Lotsen geleitet werden. Der zur Marie Valerie herangekommene Lotse ist ein Norddeutscher, welcher schon seit 25 Jahren diesen Dienst versieht, und der sich hierbei ein hübsches Vermögen erspart hat, wie ich mich des anderen Tages durch Besichtigung seiner ihm gehörigen Villa überzeugen konnte.
Am 2. April (Ostersonntag) kamen wir in den Hafen von Kobe an, und somit war das Ziel meiner Dampfschiffahrt nach mehr als zweimonatlicher Reise erreicht.
Im Hafen von Kobe, einem bedeutenden Handelspunkte von Japan, erblickten wir mehr denn 20 Dampfschiffe und viele grosse Segelschiffe, sowie das mittelgrosse, deutsche Kriegsschiff Kaiser, welches am nächsten Tage nach Kiautschau abdampfte.
Die Stadt Kobe liegt weit ausgebreitet, theils am Ufer des Binnensees, theils an der Lehne eines steil aufsteigenden Höhenrückens, und macht durch die matt gehaltene Farbe der Häuser, sowie durch die stellenweise kahlen Abhänge der Berge keinen lebhaften Eindruck.
Die Japaner sind von kleiner Statur, haben grosse Köpfe and magere Beine, und tragen keinen Zopf; ihre beinahe ausnahmslos ganz schwarzen Haare sind, man könnte sagen borstenartig zugeschoren. Ausser dem langen, kaftanartigen Ueberrocke tragen sie einen kurzen Leibrock und knapp anliegende, dunkle Pantalons. Die Füsse sind mit Strohsohlen bekleidet, welche durch Strohschnüre zwischen der ersten und zweiten Zehe festgehalten werden; an Stelle der Stroh- werden auch Holzsandalen getragen. Der Kopf bleibt unbedeckt. Die japanischen Frauen und Mädchen sind durchaus in lange, dunkle Kleider in der Art von Schlafröcken gehüllt, und haben in der Mitte des Rückens ein Kissenstück, man könnte wirklich sagen ein Kopfkissen, welches mit lichtem, buntem Seidenzeuge aufgeputzt ist. Die rabenschwarzen Haare sind künstlich hoch gewellt und meist mit Korallen geschmückt. An den Füssen tragen die Frauen gleichfalls mit Strohmatten belegte Holzsandalen, die sie so befestigen, wie es oben gesagt wurde. An der Unterseite der Holzsandalen sind häufig zwei Querhölzer angebracht. Das Gehen mit solchen Holzsandalen macht einen klappernden Lärm, und muss, nach der ungeschickten Weise der Fortbewegung zu urtheilen, gar nicht leicht sein. Auch die Frauen tragen keine Kopfbedeckung. Die Mütter tragen ihre Kinder auf dem Rücken, und schmücken dieselben mit lichten, bunten Stoffen. Sonn- und Regenschirme werden aus Rohr und ölgetränktem Papier erzeugt.

Gleich beim Betreten des Landes macht sich Ordnungs- und Reinlichkeitssinn bemerkbar. So sind die Jinrikshas gleichartig und zweckmässig adjustirt, die Strassen, Häuser, Höfe und Kaufläden sind durchwegs rein gehalten, und selbst die kleinen, auf der Strasse spielenden Kinder machen einen netten und sauberen Eindruck.
Die Häuser sind zum grössten Theile aus Holz erbaut, statt Glasscheiben haben die Fenster gewöhnlich ölgetränkte Papiere, und überall sind Fenster und Thüren für das Oeffnen und Schliessen zum Schieben eingerichtet. Im Innern der Wohnungen vertreten Matten die Stelle der Thüren; auch die Fussböden sind nur Matten bedeckt. Diese Matten sind zierlich geflochten, und werden äusserst reinlich gehalten. Dieselben dienen den Hausbewohnern zum Sitzen, wobei ein Kissen unterlegt wird, und zum Liegen. Zur Erhaltung ihrer mühsam fertig zu stellenden Frisur, deren tägliche Erneuerung möglichst vermieden werden soll, schieben sich die japanischen Frauen beim Liegen und Schlafen einen kleinen, etwa 10 cm hohen und mit mehrfach gerollten Linnen bedeckten Holzblock unter den Nacken oder den Hals, eine Liegeart, welche für uns Europäer wohl ganz unbegreiflich ist.
Die wenigen, aus Ziegeln erbauten Häuser, so z. B. die ersten Hôtels, sind sehr leicht aufgeführt, haben nur ziegelbreit dicke Mauern und einfache Fenster mit Jalousien, eine Bauart, welche zur kalten Jahreszeit, wo die Temperatur monatelang nahe an dem Gefrierpunkte steht, wohl wenig schützend ist. Hierzu kommt noch, dass selbst in den vornehmsten Häusern keine Oefen, sondern nur hie und da offene Kamine angebracht sind. Um sich die Hände zu wärmen und auch zum Anzünden der kleinen Tabakpfeifen, aus welchen Herren und Damen dort gerne rauchen, werden Töpfe mit glühenden Holzkohlen auf den Boden gestellt.
Die Hôtels sind mit europäischen Möbeln und sehr breiten Betten versehen.
Jedenfalls ist bei einer solchen Bauart die Feuersgefahr eine sehr grosse, und so ist z. B. vor wenigen Tagen das zweitgrösste Hôtel in Kioto (Hôtel Yarmi) ganz niedergebrannt.
Nachmittags suchte ich mit dem Schiffscapitän den Lotsen auf, von dem ich früher gesprochen habe. Derselbe hat sich an der Lehne des gegen Kobe abfallenden Berges eine reizende Villa erbaut, welche seine Frau, eine Ungarin aus dem Banat, in musterhafter Ordnung erhält. Seine fünf Kinder, die sehr gut erzogen sind, sprechen Deutsch, Englisch und etwas Japanisch, und haben sehr nette musikalische Anlagen. Von dort fuhren wir mit Rikschas zu einem sehenswerthen Wasserfall und besahen uns dann einige Einkaufsbuden.
Am 3. April zahlte ich vorerst auf dem Dampfschiffe Marie Valerie für die Zeit von Bombay, den 1. März, bis Kobe, den 2. April, also für 32½ Tage, an Getränken 24 Goldgulden, für das Tiffin in Singapore 10 Goldgulden und an Trinkgeld, sowie für Wäsche 17 Goldgulden, zusammen 51 Goldgulden oder 61 fl. ö. W.; sodann fuhr ich etwas in der Stadt herum.
Am Abend begab ich mich nochmals mit einem Mitreisenden, dem Dr. F., in die Stadt, um Unterhaltungsorte zu besuchen. Als wir zum Theater kamen, begehrte der Cassier, der uns natürlich gleich als Fremde erkannte, das Fünffache des gewöhnlichen Eintrittspreises, worauf wir auf dieses Vergnügen verzichteten; dann wollten wir in ein Haus gehen, wo sich japanische Tänzerinnen producirten; hier verlangte die amtirende Frau von uns als Entrée 16 Dollars, was gleichfalls unsere Verzichtleistung auf die Vorstellung zur Folge hatte. Nach diesen Misserfolgen verfügten wir uns in ein Theehaus, wo die Unterhaltung eine recht mässige war.
Was die Forderungen der Japaner an Fremde betrifft, so sind dieselben im Allgemeinen ganz unverschämt hoch, und liegt stets die Tendenz vor, den Ausländer über's Ohr zu hauen. Diese Wahrnehmung machte ich nicht nur bei Einkäufen, sondern auch zu verschiedenen Malen in meinem Hôtel in Kobe. So hatte ein Kellner, welcher mir Briefmarken brachte, gleich versucht, mir bei der Geldumwechslung um 50 kr. weniger zurückzugeben. Selbst der Hôtelier übervortheilte mich. Ich nahm ein Zimmer mit Pension, welches laut Uebereinkommen 6 Yen = 7 fl. 20 kr. kostete, als es aber zur Zahlung kam, liess er vorher in meinem Zimmer einen Zettel ankleben, auf welchem der Preis mit 7 Yen bezeichnet war, und nach diesem Ansatze musste ich auch die Pension bezahlen.
Die Rikschas sind dem Tarife nach sehr billig, sie haben per Stunde nur den Anspruch auf 15 Sens = 18 kr.; wenn man ihnen aber auch mehr gibt, so sind sie doch nicht damit zufrieden.
In Japan ist die Geldeinheit der Yen im Werthe von circa 1 fl. 20 kr. ö. W. und der hundertste Theil heisst Sens. Dieses Geld hat aber einen höheren Werth als der Dollar in China, weil in Japan kürzlich die Goldwährung eingeführt wurde.
Bei dem Umwechseln, sowie beim Beheben des Geldes verliert der Reisende in diesen Ländern immer. In Hongkong hatte ich 400 Dollars zum Preise von 1 fl. 20 kr. bei der Chartered Bank, an welche ich von unserer Creditanstalt angewiesen war, behoben. Schon in Shanghai, welches seine eigene Bank besitzt, verlor ich beim nöthigen Geldwechseln 5 Procent und hier in Japan wieder ebensoviel — ein Verlust, welcher bei meinem Geldbetrag von 320 Dollars beiläufig 16 Dollars oder 19 fl. ausmachte.
Am 4. April war Regenwetter eingetreten und die Temperatur schwankte zwischen 6 und 9° R. Ich besorgte Vormittags die Ausfertigung von Ansichtskarten und arbeitete an der Fortsetzung meines Tagebuches, was übrigens recht peinlich war, da es in meinem Zimmer, das nicht geheizt werden konnte, nur 8° R. hatte.
Es trat nun an mich die Frage heran, ob ich mir, wie Murray's Reisehandbuch es dringend anrathet, einen Diener, der täglich 2 Yen oder 2 fl. 40 kr. kostet, oder auch einen Führer, welcher per Tag 2½ Yen = 3 fl. verlangt, nehmen soll oder nicht. Da ich aber wahrgenommen hatte, dass Murray's Ortsbeschreibungen zur Orientirung vollauf genügen, und dass die Rikschas ein wenig Englisch sprechen und auch bei den Einkäufen als Dolmetsche dienen können, so nahm ich von der Aufnahme eines Dieners oder Führers völlig Abstand. Ich möchte dies allen nach Japan Reisenden empfehlen, die der englischen Sprache etwas mächtig sind. Mir kam es allerdings auch sehr zu statten, dass ich von Zeit zu Zeit mit dem Lloydcapitän oder mit Schiffsbekanntschaften gemeinsame Ausgänge machen konnte.
Vor dem Tiffin liess ich mich durch einen ein wenig Englisch sprechenden Rikscha in den Bazar von Kobe, ein im Viereck erbautes Gebäude mit grossem Hof, Garten und Theehaus an der Peripherie der Stadt, führen. In diesem Gebäude befinden sich ringsum in vier Reihen die verschiedenen Verkaufsartikel der japanischen Kaufleute nebeneinander aufgestellt. Diese Artikel sind sehr mannigfaltig, haben feste und billige Preise und gestatten einen guten Ueberblick über die Betriebsamkeit und Kunstfertigkeit der Japaner.
Nachmittags fuhr ich ungeachtet des Regens in die Stadt in Begleitung unseres Capitäns, der japanische Pflanzen einkaufen wollte. Der erste Gärtner, zu dem wir kamen, machte enorme Preise, während ein zweiter, den wir dann aufsuchten, Namens Tomigama, sehr schöne und billige Tropenpflanzen besass. Dann besichtigten wir die Porzellanhandlung Nishida in der Molomachistrasse und fanden dort sehr schöne, grosse und preiswürdige Vasen, in einer anderen Porzellanhandlung gab es kunstvoll ausgeführte Kaffee- und Theeservice (bei Fujii), im Kaufladen von Ohashi wurden grosse, aber nicht besonders gute Teppiche, sowie Waffen und Ofenschirme feilgeboten, und endlich in einer Verkaufshalle von Lackwaaren (Shidzuoka Shikki) war eine grössere Quantität von Holztassen, Ständern, Schachteln und dergleichen mehr ausgestellt. Alle diese Gegenstände waren recht hübsch verfertigt und zu verhältnissmässig billigen Preisen zu haben. Ich machte mir hierüber nur Vormerkungen und verschob die Einkäufe auf die Zeit meiner Rückkehr nach Kobe.
Da mir unser Schiffscapitän mittheilte, dass er beabsichtige, den nächsten Tag nach der sehr bedeutenden Industriestadt Osaka zu fahren, so entschloss ich mich sofort, ihn dahin zu begleiten, um bei dieser Gelegenheit den dortigen Truppen-Divisions-Commandanten aufzusuchen, an welchen mir der japanische Militär-Attaché in Wien ein Empfehlungsschreiben mitgegeben hatte, damit ich die dortigen militärischen Einrichtungen zu sehen bekomme.
Nach dem Tiffin liess ich mich bei dem Photographen Schida in der Motomachistrasse im Tropencostume aufnehmen und übergab ihm auch eine Wiener Photographie zum Malen. Für ein Dutzend Cabinet-Photographien beanspruchte derselbe den Preis von 5 Yen = 6 fl., also unverhältnissmässig weniger, als ich dafür in Bombay hätte bezahlen müssen.
Am 5. April unternahm ich mit dem Capitän den besprochenen Ausflug nach der von Kobe eine Stunde entfernten Stadt Osaka. Die Begleitung des Capitäns war mir in mehrfacher Hinsicht sehr erwünscht, da eine solche Reise in einem sprachfremden Lande für eine einzelne Person doch etwas beschwerlich ist, da der Capitän die englische Sprache geläufiger sprach als ich, und da es mir angezeigt erschien, den Besuch bei einem hochstehenden japanischen Officiere nicht allein zu machen.
Schon bei der Einfahrt von Osaka ist es an den vielen hundert rauchenden Essen ersichtlich, dass diese Stadt ein Hauptstapelplatz für die japanische Industrie ist; noch mehr tritt dies zu Tage in dem grossen Getriebe, welches in den engen Gassen herrscht, sowie an den allenthalben vorhandenen Telegraphen- und Telephonleitungen, wozu in manchen Strassen an mächtigen Stangen wohl 80 Drähte angebracht sind. Der Umstand, dass in den dortigen Verkaufshallen nur mittelmässige oder geringe Waaren ausgeboten werden, und dass von diesem Orte nach fünf Richtungen Bahnstränge ausgehen, weist darauf hin, dass von Osaka aus hauptsächlich die Ausfuhr betrieben wird.
Ich fuhr mit dem Capitän in je einem Rikschawagen, dessen Führer etwas Englisch sprachen, vom Bahnhofe direct in das dortige berühmte alte Castell, in welchem der Generallieutenant O. wohnt. Am Hauptthore des höher als die Stadt gelegenen, mit breiten Wassergräben und mächtigen Steinmauern umgebenen Castells stand ein japanischer Wachposten. Ich entsandte nun meinen Rikscha zu diesem Posten, um in Erfahrung zu bringen, in welchem Theile des Castells die Wohnung des Generallieutenants gelegen sei. Der Rikscha machte vorerst dem Posten eine bis gegen die Erde reichende Verbeugung und bat denselben dann um die betreffende Auskunft. Hierauf entspann sich zwischen dem Rikscha und dem Posten ein langwieriges Zwiegespräch, dessen Ende darin bestand, dass der Soldat den Rikscha an den Postencommandanten verwies. Vor diesem, in einer kleinen, offenen Hütte zwischen vier Soldaten stehenden Unterofficiere machte der Rikscha zwei ebenfalls bis zum Boden reichende Complimente und brachte dann seine Bitte vor. Wieder entstand eine längere Unterhandlung, bis der Unterofficier mein Empfehlungsschreiben zu sehen wünschte, dessen Adresse in lateinischen und japanischen Buchstaben abgefasst war. Der Unterofficier betrachtete lange die Adresse, kam aber zu keinem Entschlusse. Da verfügte ich, ganz einfach in das Castell einzutreten, was die Wache auch ruhig geschehen liess. Nach einigen Schritten kamen wir zu einem überaus mächtigen, aus riesengrossen Steinen erbauten zweiten Festungsthore, dessen Flügel mit kolossalen Eisenplatten versehen waren. Hier war abermals eine Wache aufgestellt, es erfolgten dieselben erfolglosen Debatten zwischen meinem Rikscha, dem Posten und dem Wachcommandanten, und wieder setzten wir schliesslich unseren Weg in das innere Castell unbehindert fort. Nun gelangten wir zu einem ausgedehnten Gebäude, traten in dasselbe ein und gingen in dem Corridor so lange vorwärts, bis wir zu einer offenen Thür kamen, hinter welcher ein Soldat stand. Diesem übergab ich meinen Brief, mit welchem er auch abging. Eine Weile darauf kam ein anderer Soldat, der den Capitän und mich in ein Zimmer nahe dem Hauseingange geleitete und uns durch pantomimische Zeichen bedeutete, hier das Weitere abzuwarten.
Es verging nun eine geraume Weile, und ich stand eben im Begriffe, unverrichteter Dinge fortzugehen, als ein in Civil gekleideter Diener sich uns näherte und durch Zeichensprache zu verstehen gab, ihm zu folgen. Wir durchschritten nun einen langen, düsteren Gang, an dessen Ende ich einen japanischen Officier auf mich zukommen sah. Als wir uns begegneten, sprach er mich zuerst japanisch an, und stellte sich hierauf in englischer Sprache als Generalstabsmajor N. vor. Ich antwortete deutsch, nannte meinen Namen und meine Charge, und sprach den Wunsch aus, dem Generallieutenant meinen Besuch abzustatten. Da der Officier der deutschen Sprache nicht mächtig war, wurde die Conversation englisch weitergeführt. Auf seine Einladung hin, verfügten wir uns in ein anstossendes Gemach, wo wir uns, nachdem ich ihm den Capitän vorgestellt hatte, niederliessen. Im Laufe eines sich langsam hinziehenden Gespräches wurde uns eine Schale Thee, eine in Stanniol eingewickelte Cigarre und zuletzt eine grössere Schale mit einer unbestimmbaren süsslichen Flüssigkeit angeboten. Da aber der japanische Major nur mich reden liess und selbst beinahe kein Wort sprach, hielt ich es für angezeigt, mich zu verabschieden. Nun trug mir endlich der Major an, mich in der Festung herumzuführen, ein Antrag, den ich gerne annahm. Das seit 400 Jahren bestehende Castell ist mit guten, neuartigen Geschützen ausgerüstet und besitzt eine sehr ergiebige und ingeniös angelegte Wasserleitung. In dem Castell stehen mehrere Wohnhäuser für höhere Officiere, und es wird dort soeben ein grosses Gebäude für einen der drei japanischen Truppeninspectoren aufgeführt. Das Castell überragt die ganze umliegende weite Ebene, sowie die Stadt und gewährt einen sehr hübschen Rundblick. Im Uebrigen hat dasselbe eine geringe Ausdehnung und eine sehr untergeordnete militärische Bedeutung. Erst beim Abschiede theilte mir der Generalstabsofficier mit, dass der Generallieutenant nicht anwesend sei, worauf ich ihm meine Visitkarte mit dem Ersuchen übergab, dieselbe seinem Chef einzuhändigen. So endete diese ganze, durch das etwas unbeholfene Benehmen der japanischen Soldaten wirklich drollige Unternehmung.
Nach dem Tiffin, welches wir in dem dortigen, im europäischen Stile eingerichteten Hôtel »Jiyutai« einnahmen (das Couvert ohne Getränke zu 1 Yen = 1 fl. 20 kr.), spazierten wir noch in der Stadt herum, sahen mehrere Verkaufsstellen an und kehrten dann nach Kobe zurück.
Dort machte mir der bereits erwähnte Dr. F. den Vorschlag, in Gesellschaft eines seit 20 Jahren in Kobe ansässigen Deutschen ein japanisches Tanzhaus anzusehen. Ich ging gerne hierauf ein, und auch der Capitän und einige Lloydschiffs-Officiere schlossen sich uns an. Im Tanzhause producirten sich fünf Mädchen im Spiele auf japanischen Guitarren und im Gesange, und vier Mädchen im Tanzen. Die Spielerinnen, im Alter von 18 bis 24 Jahren, waren recht nett in dunklen Stoffen gekleidet, während die Tänzerinnen, im Alter von 14 bis 16 Jahren, in sehr reichen und lichten buntfärbigen Seidenkleidern und mit schönem Haarschmucke erschienen. Die Musik der fünf Mädchen — Guitarre und Gesang — ist getragen, eintönig, aber doch viel melodiöser als jene in China; der Tanz ist ruhig und mimisch, und besteht mehr aus graziösen Körperbewegungen und Wendungen, als aus einem Tanze nach europäischen Begriffen. Schon der Eintritt dieser Mädchen in den Tanzsaal, wo wir uns ohne Schuhe auf Polstern sitzend befanden, war höchst originell. Jedes Mädchen kniete an der Eintrittsthür nieder und verbeugte sich dann den Zuschauern gegenüber mit dem Kopfe bis zum Boden, dann erst begannen sie zu tanzen. Es wurde sonach Thee, Saki (ein aus Reis erzeugtes alkoholisches Getränk) und rohes, in kleine Stücke geschnittenes Fischfleisch servirt. Diese Fischstückchen müssen nach der Landessitte mit zwei in einer Hand zu haltenden Stäbchen aufgenommen, in eine dazu hergerichtete scharfe Sauce getaucht und so in den Mund geführt werden. Nach längerem Zaudern ass ich ein solches Stückchen vom rohen Fischfleisch und trank auch Saki, und kann nur constatiren, dass dieser Genuss mir kein sonderliches Vergnügen machte, aber auch keine üblen Folgen nach sich zog. Der Saki schmeckt ähnlich wie ein leichter Kornbranntwein. Das Benehmen der Mädchen, welche schliesslich in bunter Reihe neben uns auf dem Boden sassen, war ungezwungen und voll Heiterkeit, und dabei ein vollauf anständiges. Ich hatte mich wohl, weil der Abend sehr kühl war, mit Ueberzieher und Regenmantel versehen, doch war mir dieses Sitzen in Socken in einem kalten Zimmer, auf einem schmalen Polster auf dem Boden, nach und nach recht peinlich geworden, und ich war daher recht froh, dass wir endlich aufbrachen und heimfuhren.
Der 6. April brach wieder so kalt und trübe an wie die vorhergegangenen Tage. Ich hatte diesen Tag zu meiner Abreise nach Kioto bestimmt und im dortigen »Kioto-Hôtel« meine Unterkunft bereits signalisirt. Gleichzeitig bestellte ich mein Quartier in Yokohama im »Grand Hôtel« für den 11. und im »Hotel Impérial« in Tokio für den 16. des laufenden Monates.
Da in Japan auf den Bahnhöfen nur japanisch gesprochen wird und ich keinen Diener als Dolmetsch mit mir nahm, so liess ich einen Hôteldiener mit mir zum Bahnhof in Kobe kommen, von ihm die Fahrkarte lösen und meine Bagage aufgeben, wobei ich denselben strenge überwachte, weil mein Vertrauen in die Ehrlichkeit der Japaner wankend geworden war. Das Handgepäck nahm ich zu mir in den Waggon. Vor meiner Abreise kam noch der Lloydcapitän F. auf den Bahnhof, um von mir Abschied zu nehmen und mir glückliche Reise zu wünschen.
Dieser Capitän ist ein hervorragender Schiffscommandant von persönlich grosser Liebenswürdigkeit. Er vertrat die Interessen der Lloydgesellschaft mit grosser Selbstaufopferung und that sein Möglichstes, um die Fahrzeiten richtig einzuhalten. Wenn es stark regnete und stürmte, kam er trotz Kälte und Ungemach nicht, wie gewöhnlich, zu den Mahlzeiten in den Speisesaal, sondern übernahm die Ueberwachung und zur Nachtzeit die Führung des Dampfers auf der Commandobrücke.
| Meine Hôtelrechnung betrug für 2½ Tage — Zimmer, Verpflegung und Getränke | 16 | Yen | = | 19·— | fl. |
| Die Ueberführung der Fracht vom Schiff in's Hôtel und von da zum Bahnhof sammt allen Trinkgeldern | 7 | " | = | 8·40 | " |
| Zwei Einladungen an verschiedene Herren | 10 | " | = | 12·— | " |
| Die Eisenbahnfahrt nach Kioto sammt Fracht | 3½ | " | = | 4·20 | " |
| Im Ganzen | 36½ | Yen | = | 43·60 | fl. |
In Indien, China und Japan ist der englische Gebrauch eingeführt, dass man bei den Mahlzeiten die genommenen Getränke auf eigene Zettel zu schreiben hat, dieselben werden dann, mit den Preisen versehen, der Hôtelrechnung beigelegt und in diese eingerechnet, eine Gepflogenheit, welche für den Reisenden die Annehmlichkeit hat, nicht nach den Mahlzeiten zahlen zu müssen.
Am 6. April kam ich Nachmittags in Kioto an und liess mir sofort mein Gepäck in das »Kioto-Hôtel« bringen, wo mir zu meiner Ueberraschung mitgetheilt wurde, dass kurz vor meiner Ankunft bereits der Secretär des Gouverneurs im Hôtel vorgesprochen hatte, um mir seinen Besuch zu machen.
Als am 7. April, um 9 Uhr Morgens, der Secretär abermals bei mir erschien, sprach ich ihm hierfür meinen verbindlichsten Dank mit dem Beifügen aus, dass ich demnächst den freundlichen Besuch erwidern werde. Derselbe wehrte indess meinen Besuch verlegen ab und trug sich unter Einem an, mir die Sehenswürdigkeiten von Kioto zu zeigen. Sein Anzug bestand aus einem japanischen seidenen Ober- und Unterrocke, Holzsandalen und einem europäischen braunen Hute. An den beiden Vormittagen des 7. und 8. April machten wir zusammen, jeder mit einem Rikscha fahrend, Rundfahrten in der Stadt und besichtigten dabei neun verschiedene Tempel und Klöster, sowie etliche Verkaufshallen.
Da die Tempel und Klöster sich mehr oder weniger ähnlich sind, so will ich vorerst eine allgemeine Charakteristik derselben geben und daran die besonderen Eigenthümlichkeiten des einen oder des anderen Tempels oder Klosters anschliessen.
Alle Tempel nehmen grosse Räume ein, welche von Planken eingeschlossen sind. Ein oder mehrere grosse Prachtthore aus Holz, mit kunstvoll japanisch geformten Dächern, eröffnen den Eingang in den den Tempel umgebenden Raum. Im Innern dieses abgeschlossenen Raumes erhebt sich der in sehr grossen Dimensionen und mit Pracht erbaute Tempel oder das Kloster, daneben befinden sich noch mehrere Wohnhäuser und Gartenanlagen mit viele hundert Jahre alten Bäumen. Alle Gebäude, sowie der Tempel selbst sind aus Holz aufgeführt. Stufengänge in der Breite der Tempelfront, oder auch den Tempel ganz umgebend, führen hinauf in einen sehr grossen und sehr reich ausgestatteten Saal, welcher in der Mitte durch ein geschnitztes Geländer oder ein schönes Gitter abgetheilt ist. Hinter dieser Abtheilung steht der Hauptaltar und meist auch Seitenaltäre, besonders der erstere im prachtvollen Schmucke. Vor dem Hauptaltare brennt ein ewiges Licht, und in der Mitte desselben befindet sich in einem versperrt gehaltenen, prächtig ausgestatteten Schreine die Figur eines der vielen Heidengötter. Ein solcher Schrein wird nur zu bestimmten Zeiten oder nach gewissen, oft jahrelangen Fristen geöffnet.
Mauerwerk und Steine kommen bei den Tempeln und bei allen Gebäuden, welche zu demselben gehören, nicht vor. Selbst die grossen, mächtigen Säulen am Eingange oder im Innern des Tempels bestehen aus Holz.
Die Klöster, welche öfters den Tempeln angeschlossen sind, weisen viele Säle auf, deren Böden mit schön gearbeiteten Rohr- oder Binsenmatten belegt sind. Die Wände dieser Säle sind mit guten, hie und da interessanten Malereien, welche dem Leben der Natur entnommen sind, vollkommen bedeckt und zeigen manchmal im oberen Theile schöne Holzschnitzereien, die Plafonds sind mit kunstvoller Holzarbeit oder auch mit Malereien geschmückt; sonst stehen die Säle gänzlich leer. Die, die Wände rings umgebenden Fenster und Thüren sind, wie in allen japanischen Räumen, verschiebbar.
Beim Eintritte in die Tempel und Klöster müssen an der untersten Stufe die Schuhe zurückgelassen werden, eine Bestimmung, welche den Japanern, die nur Holzsandalen tragen, keine Unannehmlichkeit verursacht, welche aber für den schuhetragenden Europäer recht zuwider ist. Mitunter kann diese Vorschrift dadurch umgangen werden, dass man sich über die Schuhe grosse Leinensocken binden lässt.
Das 300 Jahre alte Kloster Chion-in steht in der Mitte von zur Zeit blühenden Kirschenbäumen und hat an den Wänden besonders künstlerisch ausgeführte Bilder; ausserdem besitzt es einen freistehenden Glockenthurm. Die in demselben hängende Glocke hat 3 m Höhe, gegen 3 m Durchmesser und 30 cm Dicke. Um die Glocke zum Erdröhnen zu bringen, wird ein 25 cm dicker Baumstamm, welcher an Stricken befestigt ist, in Schwingung gebracht und dann mit Wucht gegen die Glocke angestossen.
Neben dem Kyomizu-dera-Tempel steht eine Pagode, welche, vier übereinander befindliche Hütten mit japanischen Dächern bildend, hoch emporragt. Der Altar dieses Tempels wird nur alle 33 Jahre geöffnet. Von diesem, sowie von dem erstgenannten Tempel aus geniesst man eine sehr schöne Aussicht auf die tief liegende Stadt und auf die Umgebung.
In dem San yü san gen do-Tempel erblickt man tausend nebeneinander gestellte Figuren ein und desselben Gottes, welche alle in Menschengrösse aus Holz geschnitzt, reich mit Gold verziert und mit je 50 Armen und Händen versehen sind, die bei jeder Figur eine andere Stellung haben.
Der Kodaji-Tempel besitzt in dem an ihn anstossenden Kloster sehr gute Wandbilder und einen sorgfältig gepflegten Park.
Im Daibushu-Tempel ist eine Riesenbronzestatue von Buddha's Oberkörper errichtet, und nebenan ein Glockenthurm erbaut. Die Höhe dieser Statue beträgt 20 m, die Länge des Gesichtes 10 m, die Breite 7 m und die Länge der Nase 3 m. Die Glocke hat 4½ m Höhe, 3 m Durchmesser und 30 cm Dicke, und wird, so wie oben beschrieben, zum Erdröhnen gebracht.
Der Ost-Honganji-Tempel hat neben sich ein Kloster, dessen grösster Saal 40 m lang und 25 m breit ist. An seinen reich mit Gold verzierten Wänden und auf dem schön geschnitzten Holzplafond sind Malereien angebracht, in welchen die Chrysanthemform, welche sich im kaiserlich japanischen Wappen befindet, hauptsächlich zur Geltung kommt.
Der West-Honganji-Tempel ist der grösste Tempel von ganz Japan, er misst 70 m in der Länge, 60 m in der Breite und 40 m in der Höhe, und wurde nach dem im Jahre 1864 stattgefundenen Brande ganz neu aufgebaut. Derselbe zeichnet sich durch selten schöne Bronzelaternen und Holzschnitzereien aus.
In Japan brennen, des allgemeinen Holzbaues halber, die Tempel, ja oft ganze Stadttheile häufig ab.
Die Jakashimarja- und Nishimura-Tempel sind im Innern sehr reich vergoldet und besitzen mit schwarzem Lack und Gold prunkvoll verzierte Altäre.
Zu der Besichtigung der Tempel und zu meinen sonstigen Unternehmungen in Kioto hatte ich auch den mir vom Dampfschiffe aus bekannten, sehr netten Dr. F., der mit mir im selben Hôtel wohnte, eingeladen.
Am Abend besuchte ich mit dem Secretär und Dr. F. das dortige Theater. Wir verfügten uns in eine Loge, für welche ich 1½ Yen = 1 fl. 80 kr. zu zahlen hatte. Das Theater war in den Logen und im Parterre von Zuschauern angefüllt; überall, auch in den Logen, hatten sich ganze Familien, selbst mit ihren kleinen Kindern, am Boden sitzend, häuslich niedergelassen, und verzehrten, da die Vorstellung 12 Stunden dauert, hier mit den landesüblichen zwei Holzstäben die in kleinen hölzernen Kistchen mitgebrachten, meist aus gekochtem Reis, Wurzeln, Gemüsen und Früchten bestehenden Speisen. Thee, Zuckerwerk und Früchte wurden von Theaterdienern zum Verkaufe herumgetragen. Die Vorstellung im japanischen Theater hat wohl Aehnlichkeit mit jener im chinesischen, wie ich selbe in der Schilderung meines Aufenthaltes in Shanghai beschrieb, doch wird hier viel bescheidener gespielt, kein so entsetzlicher Lärm gemacht, und es kommen auch nicht so täppische militärische Aufzüge und Kämpfe zur Darstellung. Die Scenerie ist weit schöner als in China und ist auch auf Verwechslungen eingerichtet. Bei der Vorstellung, welcher wir anwohnten, wurde mit Rücksicht auf die Zeit der Kirschenblüte, welche in ganz Japan stets gefeiert wird, die Scene in einen reizenden Kirschenbaumblütengarten verwandelt und erschienen Tänzerinnen in Kleidern von der Farbe dieser Blüten und führten mimische Tänze auf. Die einen halben Meter langen und breiten Theaterzettel bringen bildlich einzelne Scenen aus der Vorstellung zur Anschauung.
Am 7. April Nachmittags promenirte ich in der Stadt und kaufte in verschiedenen Läden einzelne Gegenstände zu mässigen Preisen ein.
Die Stadt Kioto unterscheidet sich von Kobe dadurch, dass sie so wie Osaka sehr schmale Strassen hat, ganz in einer Ebene liegt, und sehr weit ausgedehnt ist. Bis zum Jahre 1590, in welchem Jahre die Residenzstadt nach Yedo, heute Tokio genannt, verlegt wurde, war Kioto die Landeshauptstadt. Der alte kaiserliche Palast in Kioto wurde nach einem Brande im Jahre 1854 ganz neu aufgebaut. Ich konnte denselben aber nicht besichtigen, weil hierzu die nöthige Erlaubniss vom Hofstaate in Tokio hätte ertheilt werden müssen und ich zur Einholung derselben keine Zeit mehr hatte.
Am Abend gingen wir in eine Vorstellung, welche nur zur Zeit der Kirschenbaumblüte stattfindet. Da der Zuschauerraum beschränkt ist und die Vorstellung nur eine Stunde währt, so werden die sich andrängenden Leute nur partienweise eingelassen und zuerst in einen Saal geführt, in welchem ihnen Thee und Gebäck servirt wird.
Der Schauplatz gleicht einem kleinen Theater, in welchem die Bühne und zwei sehr ausgedehnte Parterrelogen mit Bäumen und Zweigen der blühenden Kirschenbäume in Wirklichkeit und Bild reizend decorirt sind, und wo man vorerst in den besprochenen Logen etwa 20 Mädchen in allegorischen Kirschenblütenanzügen erblickt. Die Mädchen spielen auf verschiedenen japanischen Instrumenten, unter welchen die Guitarre die Hauptrolle einnimmt, heimatliche Weisen und singen abwechselnd dazu. Nach etwa einer Viertelstunde öffneten sich die Deckel von der beiderseits längs des Zuschauerraumes sich hinziehenden Bodenerhebung, und nun erschienen unter Begleitung der Instrumental- und Vocalmusik, sehr langsam aus dem Unterraume emporgehoben, nach und nach zu beiden Seiten etwa 18 Mädchen in denselben oben beschriebenen Costumen, miteinander durch Kirschenblütenguirlanden verbunden, und bewegten sich, mit diesen Zweigen fächelnd und tanzend, gegen die Bühne. Auf der Bühne wurden dann bei glänzender Beleuchtung und mit Musikbegleitung Tänze mit hübschen Gruppirungen vorgeführt. Die ganze Vorstellung bot eines der reizendsten Bilder, die ich je gesehen habe. Nach beendigtem Theater begaben wir uns in ein Theehaus, wo wir ein Glas japanisches, ganz wohlschmeckendes Bier tranken, und dann ging es heimwärts.
Am 8. April machte ich nach dem Frühstück nochmals einen Rundgang durch die Stadt und besorgte dabei einige Einkäufe.
Ich hatte den Secretär des Gouverneurs schon gestern zum Diner geladen und wiederholte diese Einladung für heute. Da er beide Male unter Vorschützung von dringenden Geschäften meine Einladung dankend ablehnte, so erkannte ich daraus, dass er dies wohl aus Toiletterücksichten thun wolle, weil in den hiesigen Hôtels, sowie in Indien die Gepflogenheit herrscht, zum Mittagstische im Smokinganzuge zu erscheinen. Ich bat ihn nun, bei mir das Tiffin nehmen zu wollen, weil für diese Mahlzeit keine besonderen Bestimmungen für die Kleidung bestehen. Diese Einladung nahm der Secretär mit Vergnügen an und er erschien dann in lichter, europäischer Tracht, die ihn aber nicht gut kleidete.
Nachmittag fuhr ich mit dem Secretär und Dr. F. auf der Bahn ungefähr eine halbe Stunde nach Mukömachi, von wo aus wir einen Spaziergang nach Arashiyama machten. An diesem Orte nimmt ein enges Thal seinen Anfang, welches von einem Flusse durchzogen wird, der im oberen Laufe von Felsen eingeengt wird und dort auch schöne Katarakte bildet. Das Thal war eben mit vielen blühenden Kirschenbäumen, welche bis hoch oben auf den Hügeln standen, allerliebst geschmückt. Wir trafen dort an tausend Japaner an, und so konnte ich mir ihr Volksleben mit Musse betrachten. Die Leute sassen längs des Ufers theils unter den von Theehausbesitzern erbauten freien Dächern auf dem mit Matten bedeckten Boden, theils ganz im Freien auf hergerichteten niederen Platten familienweise beisammen, assen von den in Schachteln mitgenommenen Speisen und tranken dazu Thee, welcher in den Theehäusern sehr billig zu haben ist. Hie und da tranken Schüler höherer Classen auch Saki. Die ganze Unterhaltung war absolut nicht lärmend, und gab es keinen einzigen irgendwie angetrunkenen Japaner. Alles war seelenvergnügt, scherzte und lachte, und freute sich stillvergnügt des Daseins. Eine einzige lärmende, aber ganz kurz währende Kundgebung erfolgte, als wir Europäer bei einem Theehause, in welchem sich japanische Studenten befanden, vorübergingen. Die jungen Leute lachten wohl über unsere, ihnen nicht bekannte europäische Kleidung.
Wir gingen in dem sehr schönen Gebirgsthale aufwärts, bestiegen ein Boot, liessen uns weiter aufwärts, sonach an's andere Ufer führen, besichtigten auch von dieser Seite das Felsenthal, tranken in einem Theehause, in welchem Tische und Stühle vorhanden waren, ein Glas Japanerbier, liessen uns dann auf dem Boot thalab an's andere Ufer bringen, gingen hierauf zur Bahn und kehrten schliesslich sehr befriedigt von diesem Ausfluge heim.
Am 9. April ging ich Vormittags mit den beiden mich hier gewöhnlich begleitenden Herren in die gerade eröffnete Industrie-Ausstellung von Kioto. Es waren daselbst ganz ähnliche Artikel zur Schau gestellt, wie in dem ständigen Bazar von Kobe, nur waren die Preise hier höher gehalten. Was die Kunstarbeiten anbelangt, namentlich Malerei auf Papier oder auf Stoff, Bronze- und Cloisonet-Gegenstände, so überragte hierin die Ausstellung den Bazar von Kobe. Besonders fiel mir ein in Sepia ausgeführtes, ¾ m hohes und ¼ m breites Bild auf, welches in frappanter Naturtreue einen Baum darstellte, in dessen oberen Aesten ein Adler stand. Der Preis des Bildes, welches von einem der ersten Maler in Kioto herrührte, war mit 80 Yen = 96 fl. angegeben. Der Besuch der Ausstellung war zur Zeit, als wir dort waren, seitens der Bevölkerung ein recht mässiger; vielleicht war die Vormittagsstunde die massgebende Ursache hierfür.
Am 10. April unternahm ich in der bekannten Gesellschaft um 9 Uhr Morgens mit der Bahn eine Excursion nach Nara. Am Bahnhofe mussten wir Europäer beim Nehmen der Fahrkarte unsere Pässe vorzeigen, weil den Fremden nur, wenn sie im Besitze einer vom Consulate ausgestellten Legitimation sind, der Eintritt in das Innere von Japan gestattet ist.
Die Eisenbahnen sind in Japan schmalspurig, und daher sind auch die Waggons schmal, dafür aber sehr lang. Es gibt dort, wie bei uns, drei Fahrclassen, doch genügt selbst die erste Classe nur sehr bescheidenen Ansprüchen. Die Züge sind stets stark besetzt, und besonders die Waggons dritter Classe ganz angefüllt, doch benützen viele Japaner auch die beiden anderen Classen; Fremdländer fahren fast ausschliesslich nur in der ersten Classe. Die Schnelligkeit der Züge ist eine mässige, dafür sind auch die Fahrpreise niedrig gestellt, wenn auch bei Weitem nicht so billig wie in Indien. An allen grösseren Stationen sind Tafeln angebracht mit den Ortsnamen in japanischer und darunter in lateinischer Schrift. Auffallend ist es, dass auch in Japan in allen grossen Stationen kolossale Plakate von Firmen, auch mit Bildern in allen Farben aufgestellt sind. Es beweist dies die Nachahmungssucht der Japaner, und es muss ihnen zugestanden werden, dass sie in dieser Art der Reclame die Europäer sogar übertroffen haben. So habe ich später bei der Dampfschiffahrtsstation Moji an der Lehne eines bewaldeten Hügels den Namen einer Firma gelesen, welcher aus 2 m hohen, auf Bäumen befestigten Buchstaben zusammengestellt war.
Während der Eisenbahnfahrt beobachtete ich die Bebauung des Bodens, und erhielt hierüber nähere Aufklärung vom Secretär, und so will ich nachfolgend die bei dieser, wie auch bei späteren Gelegenheiten gemachten Erfahrungen über die Landwirthschaft in Japan kurz anführen.
Der Boden besteht hauptsächlich aus thoniger, etwas sandiger Erde und ist im Allgemeinen sehr wasserreich. Bei dem das ganze Land durchziehenden, theilweise sehr hohen und breiten Gebirgszuge ist der zum Anbau geeignete Boden verhältnissmässig beschränkt. Die vielen das Land durchziehenden Flüsse sind sämmtlich regulirt und mit starken, hohen Dämmen eingesäumt, eine Massregel zum Schutze des umliegenden Landes, welche durch die ausserordentlich heftigen Regengüsse, die in den Monaten Juni und Juli unaufhörlich niedergehen, sowie durch den torrentartigen Charakter der Flüsse geboten ist. Da die Japaner bei der Verwerthung von Grund und Boden viel Wasser benöthigen, so haben sie dort, wo sich keine Flüsse in der Nähe befinden, grosse, künstliche Teiche angelegt.
Die Ausnützung des Bodens erfolgt vorzüglich durch Anbau von Reis, dann von Getreide, hauptsächlich Weizen und Gerste, von Theestauden, Maulbeerbäumen für die Seidenzucht, von Gemüsen, Obst und Bambusrohr. Wiesen kommen beinahe gar nicht vor. Die Wälder in dem ausgedehnten Berglande liefern das in Japan sehr viel verwendete Holz.
Der Reisbau wird im grossen Massstabe betrieben und schafft das Hauptnahrungsmittel der Japaner; hierzu sind überall die Reisfelder mit grosser Sorgfalt angelegt, damit sie die zum Wachsthume und zum Gedeihen der Reispflanze nöthige Wasserfläche über denselben halten können. Ja selbst die Getreidefelder sind so eingerichtet, dass sie leicht zu Reisfeldern umgestaltet werden können, weil, der japanischen Fruchtfolge entsprechend, nach der Getreideernte das bezügliche Feld für den Reisanbau und nach der Reisfechsung wieder als Getreidefeld u. s. w. verwendet wird. Die Felder für das Getreide werden eigenartig bearbeitet und bebaut. Die Furchen sind vollkommen gerade und gleichlaufend, circa 30 cm tief, und unten 15, oben 20 cm breit, die dazwischen liegenden Feldstreifen sind oben 20, unten 30 cm breit; und werden in der oberen Fläche in zwei geraden, parallelen Linien dicht mit der betreffenden Getreidegattung bebaut. Die Wände von der oberen Fläche der Feldstreifen bis zur Sohle der Furchen sind wie bei einem Damme bearbeitet. Man ersieht daraus, dass die ganze Feldarbeit nicht mit dem Pfluge, sondern mit breiten Schaufeln und breiten Hauen, wie selbe bei uns die Teichgräber benützen, ausgeführt wird. Es ist demnach die ganze Feldarbeit eher als eine Gartenarbeit zu bezeichnen. Die angeführte Form der Felder ist in Hinsicht auf den sehr nassen Grund und auf die Regenzeit im Juni und Juli geboten.
Bei der Beurtheilung der dortigen Landwirthschaft muss man sich gegenwärtig halten, dass der Haupttheil von Japan zwischen dem 30. und 40. Grad nördlicher Breite, also in den Breitegraden von Nordafrika bis Griechenland liegt, und dass sich nur die von einem grossen Gebirgsstocke erfüllte Insel Yezo zwischen dem 40. und 45. Grade nördlicher Breite, also in der gleichen geographischen Lage wie Italien befindet, und dass also die Sommermonate im Haupttheile von Japan, mit Ausnahme der Regenzeit im Juni und Juli, sehr heiss und austrocknend sind.
Der Anbau der Theepflanze erfolgt reihenweise auf trockenen Lagen, besonders dort, wo der Boden vornehmlich aus einer Mengung von Thon und Mergel besteht und reich an Eisen ist. Die entwickelten Sträucher sind etwa einen halben Meter hoch und ebenso breit. Häufig sieht man über solche Theeanlagen weite Netze von dünnen Bambusstangen ausgebreitet, welche dazu dienen sollen, die Theepflanzen im Falle von Frösten, wie solche im Winter häufig vorkommen, etwas zu schützen.
Das Bambusrohr wird ebenfalls an trockenen Stellen waldartig und ziemlich dicht gezogen, und werden solche Bambuswäldchen ringsum von starken Laubholzbäumen umgeben zum Schutze gegen die Zerstörung durch Orkane, welche in Japan nicht zu den Seltenheiten zählen. Der Bambus wächst sehr rasch; zehn Jahre nach dem Anbau ist er schon 6 m hoch, und der Stamm hat am Boden eine Dicke von ungefähr 3 cm. In Borneo sollen aber derartige Resultate schon nach zwei bis drei Jahren erzielt werden.
Die Ortschaften liegen, wie bei uns, zerstreut im Lande, bestehen ausschliesslich aus von Holz erbauten und mit Stroh, einzelne auch mit rinnenartigen Dachziegeln gedeckten Häusern, und es umgeben diese Häuser zahlreiche Kirschenbäume, welche, zur Zeit meiner Anwesenheit in Japan, in vollster Blüte standen. Es gibt hier zwei wesentlich von einander unterschiedene Kirschenbäume. Die einen derselben sind in Blüte und Frucht den unseren ähnlich, die anderen tragen aber so reiche und schöne Blüten, dass der ganze Baum wie von einem Rosenmeere umschlossen erscheint; dafür tragen diese Bäume keine Früchte.
Von Vieh- und Geflügelzucht ist in allen jenen Theilen Japans, die ich durchreiste, gar nichts zu sehen, eine merkwürdige Erscheinung, die sich dadurch erklärt, dass die Japaner beinahe nur Fleisch von Fischen essen, auch keine Milch trinken, und dass zum Feldbau keine Thiere benöthigt werden. Nur auf der Insel Yezo soll, wie man mir sagte, Viehzucht betrieben werden. In den Städten verwendet man sporadisch Stiere, welche eine grosse und starke Race zeigen, zum Ziehen von schweren Lasten, und versieht deren Hufe mit Strohschuhen, welche lange Zeit vorhalten sollen.
Die inländischen Pferde, welche eigentlich nur bei der Cavallerie in Verwendung stehen, sind von einer kleinen, elenden Race. Hierüber werde ich noch eingehend, bei meinen Beobachtungen und Studien über das japanische Militär, zu schreiben Gelegenheit haben.
Die Strassen und Wege auf dem Lande befinden sich in einem sehr guten Zustande und werden vorzüglich erhalten, was indess wohl hauptsächlich auf den Umstand zurückzuführen ist, dass dieselben nicht von mit Thieren bespannten Wagen befahren werden. Sowohl auf dem Lande als auch fast ausnahmslos in der Stadt werden die grössten Lasten von Menschen auf zweiräderigen Karren fortgeschafft.
Nach zweistündiger Eisenbahnfahrt waren wir glücklich in Nara eingetroffen. Nara war durch etwa hundert Jahre — im 7. Jahrhundert n. Chr. — die Hauptstadt des Landes gewesen, jetzt verdankt es seine Berühmtheit einem auf dem Berge stehenden, bei den Japanern sehr hoch gehaltenen Tempel, welcher von einem sehr ausgedehnten Wildparke eingeschlossen ist, in dem sich von den Einheimischen für heilig angesehene Hirsche befinden. Dorthin begaben wir uns zuerst; unser Weg führte uns an uralten Bäumen vorüber, die oft einen Umfang von 12 m und eine immense Höhe haben, wenn sie nicht, wie dies bei manchen solchen Bäumen der Fall ist, altershalber im oberen Theile abgestorben und abgebrochen sind. Der Weg war von steinernen, ungefähr 2 m hohen Säulen, die ein Häuschen mit japanisch geformtem Steindache tragen, und welche in gewissen Distanzen von einander entfernt standen, beiderseits umgeben. Diese Häuschen sind bestimmt, Lichter aufzunehmen, welche an gewissen Festtagen angezündet werden.

Wir begegneten auf unserer Wanderung vielen Rudeln von Hirschen, welche sämmtlich ganz zahm waren, und welche die eigens für sie erzeugten Kuchen, die stellenweise zum Verkaufe angeboten wurden, ganz ungescheut aus der Hand annahmen. Nach einer approximativen Schätzung mag ich sicher hundert Hirsche, Thiere und Kälber gesehen haben.
Der auf der Bergesspitze erbaute Tempel imponirt durch Grossartigkeit und Schönheit, und hat neben sich einen Glockenthurm mit einer Riesenglocke; sonst gleicht er ganz den anderen Tempeln, wie ich dieselben bereits beschrieben habe.
Die Einheimischen, welche in diesen Tempel gehen, werfen auf den Boden vor dem Gotte, den sie für ihre Wünsche geneigt machen, oder vor jenem, dessen Zorn sie abhalten wollen, Kupfermünzen in einer gewissen Anzahl hin, ein Cultus, den ich übrigens schon in den meisten anderen Tempeln ebenfalls wahrgenommen hatte.
Nach der Besichtigung des Tempels kehrten wir in ein bei dem nahe gelegenen Orte Musashino befindliches Gasthaus ein, wo sowohl europäische als japanische Speisen zu haben sind. Ich bat den Secretär, für uns ein Tiffin zu bestellen, und so erhielten Dr. F. und ich je eine Eierspeise, Schnitzel mit Salat und Käse nebst Bier, während mein japanischer Begleiter für sich einen rohen Fisch mit der dazu gehörigen Sauce und Saki bestellt hatte. Nachdem ich der Wirthin die sehr mässige Rechnung ausgezahlt hatte, gab sie mir, wie dies in den Gasthäusern auf dem Lande allgemein der Brauch sein soll, ein kleines Andenken, und zwar in der Gestalt einer sehr gut hergestellten Photographie ihres Etablissements. Auf dem Rückwege zur Bahnstation kaufte ich in den nahe dem Tempel aufgestellten Verkaufshallen mehrere grössere Bronzefiguren und eine Menge von originell geformten Haarnadeln.
Wenn auch die bevorstehende Eisenbahnfahrt von Kioto nach Yokohama einen ganzen Tag in Anspruch nahm, so miethete ich mir hierfür dennoch keinen japanischen Diener, sondern traf nur die Vorsorge, dass uns die für einen Tag nöthigen Trink- und Esswaaren mitgegeben werden, weil auf der ganzen Strecke keine europäisch eingerichteten Bahnhofrestaurationen existiren. Es wurde mir zwar gerathen, meine Fahrt um ungefähr 1 Uhr Mittag bei Nogaya zu unterbrechen, wo man ein europäisch eingerichtetes Hôtel antrifft, und am nächsten Tage von da aus nach Yokohama zu reisen. Da mir aber diese Umsiedlung in Nogaya von der Bahn zum Hôtel und am nächsten Tag von dort zur Bahn sehr unangenehm erschien, so entschloss ich mich, die Fahrt Kioto-Yokohama in einer Tour zu machen.
Am 11. April Früh zahlte ich meine Hôtelrechnung aus, welche im ersten Hôtel in Kioto sehr mässig war. Für Sitz- und Schlafzimmer sammt der sehr guten Verpflegung rechnete man pro Tag nur 5 Yen = 6 fl. auf. Für Getränke, zwei Einladungen, Mundvorräthe für die Eisenbahnfahrt nach Yokohama und Trinkgelder hatte ich während meines fünftägigen Aufenthaltes 18 Yen = 21 fl. 60 kr. verausgabt.
Die Rikschafahrt und der Transport meiner Bagage zum Bahnhofe, die Entlohnung des Hôteldieners, die Eisenbahnkarte erster Classe, sowie die Frachtgebühr für meine Effecten von Kioto nach Yokohama, einer Route von 14 Stunden, belief sich nicht höher als auf 15 Yen = 18 fl. ö. W.
Zum Abschiede hatte sich noch der Gouverneurssecretär Kobayaski im Nationalcostume im Hôtel eingestellt. Ich dankte ihm bestens für seine freundliche Führung und Begleitung während meines Aufenthaltes in Kioto, und gab ihm als Andenken meine mit einer entsprechenden Dedication versehene Photographie. Sodann begleitete er mich noch bis zur Bahn, gab seiner Freude Ausdruck, mir als Wegweiser haben dienen zu können, und dankte nochmals für das ihm gespendete Bild. Dieser Secretär hatte sich in früheren Jahren bei der Führung weiland unseres Herrn Kronprinzen und später des Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand hervorgethan, und wurde dafür mit dem goldenen Verdienstkreuze mit der Krone und mit einer schönen Cravattennadel, welche die kaiserlichen und königlichen Initialen in Brillanten zeigt, ausgezeichnet.
Bei meiner Abreise musste ich abermals meinen Pass vorzeigen. Der Waggon erster Classe, in welchem ich mit Dr. F. untergebracht wurde, bestand aus zwei Reihen längs der Fenster sich hinziehenden gepolsterten und mit Leder überzogenen, einen halben Meter breiten Bänken, zwischen welchen sich ein 1¼ Meter breiter Gang befand. In demselben Waggon trafen wir am äusseren Ende ein junges und ein älteres englisches Ehepaar, das letztere mit einer Tochter, und am Eingange einen Japaner in mittleren Jahren mit seiner wenig schönen Frau und mit noch zwei älteren Japanerinnen an. Dr. F. und ich nahmen nebeneinander in der Mitte des Waggons näher den Engländern Platz. Die Aussicht, auf diesen Marterbänken in einem nichts weniger als reinen Wagen 14 Stunden lang ausharren zu müssen, war eben nicht sehr erquicklich. Um mir die Zeit zu kürzen und die Unbehaglichkeit ein wenig zu vergessen, begann ich mit der Fortsetzung meines Tagebuches, das einigermassen im Rückstande war, und dachte auf diese Art, wie durch die Besichtigung der Gegend, durch Lectüre und Conversation mit Dr. F. diese fatale Eisenbahnfahrt tant pis que mal überstehen zu können. Leider gestaltete sich aber die Sache ganz anders. Nach etwa drei Stunden bestiegen in irgend einer Station mehrere Japaner mit Koffern, Rollen, Bünden von Wein- und Bierflaschen unseren Waggon und richteten sich da häuslich ein. Der grösste derselben trug europäische Kleidung mit langem Gehrock und schien ein hoher Beamter zu sein, weil auf dem Bahnhofe vor dem Waggon, den er bestieg, sehr viele Japaner und Japanerinnen in Seidencostumen und auch japanische Officiere standen, und dem Abreisenden ihre Ehrfurcht bezeigten, welche sich besonders bei der Abfahrt durch tiefe Verneigungen kundgab. An dem entfernten Flügel der zum Abschiede vereinten Gesellschaft stand eine Anzahl von japanischen Polizeisoldaten in Reih' und Glied und grüssten militärisch bei der Vorbeifahrt des beschriebenen Japaners. Derselbe hatte einen Secretär bei sich, welcher gleichfalls europäisch gekleidet war. Der Secretär begann nun die Rollen zu öffnen und Plaids herauszunehmen, welche auf die Bank ausgebreitet wurden, dann stellte er auf den Boden eine kleine Theekanne und Schalen sammt Schnellsieder auf und bereitete hier den Thee.
Die eingetretenen Japaner hatten uns so gegen die Engländer zusammengedrängt, dass wir gar keinen freien Raum zwischen uns mehr hatten, während sie selbst sich Platz zum Niederlegen freiliessen. Nun war es mit dem Schreiben meines Tagebuches vorbei, und ich blieb darauf angewiesen, die recht monotone Gegend zu betrachten oder mich mit Lectüre oder Conversation zu beschäftigen. Aber auch diese Zerstreuung wurde mir durch das Benehmen der Japaner, die doch in der ersten Classe fuhren, ganz vergällt. Abgesehen von der Theebereitung war ihr Verhalten ein unglaubliches, welches sich durch Pfeifen, durch lautes, dröhnendes Gähnen, Ausziehen der Schuhe u. s. w. kundgab. Und Alles dies geschah in Gegenwart der höchst ladyliken englischen Damen, doch die Japaner schienen keine Ahnung davon zu haben, wie unschicksam sie sind. Den Engländerinnen sei es zur Ehre gesagt, dass sie alle diese Ausschreitungen unbeachtet liessen und hiervon weiter nicht Notiz nahmen.
Wieder eine Stunde mochte vergangen sein, als eine sehr alte Japanerin mit einem Manne von etwa 40 Jahren, vermuthlich ihrem Sohne, in unseren Waggon kam und mir gegenüber Platz nahm. Die Frau war in einfachster japanischer Tracht, ihr Begleiter europäisch gekleidet; sie selbst setzte sich nach japanischer Sitte mit unterschlagenen Füssen auf die Bank. Als dies geschehen war, sagte der Secretär seinem Vorgesetzten etwas in's Ohr, wahrscheinlich nannte er ihm den Namen der alten Frau und ihres Sohnes, worauf der erwähnte Dignitär aufstand und sich zuerst vor der alten Frau und dann vor ihrem Begleiter mit dem Oberleibe ganz tief hinunter verbeugte, was hierauf auch der Secretär that. Der Dank der alten Japanerin bestand darin, dass sie in sitzender Stellung ebenfalls ein tiefes Compliment machte und hierzu ihre Hände auf dem Sitze aufstemmte; ihr Sohn erwiderte den ihm dargebrachten Gruss in ganz gleicher Weise, wie er ihn empfangen hatte. Unzweifelhaft gehörten Mutter und Sohn dem hohen Geburtsadel an, der in Japan in grossem Ansehen steht. Die Begrüssungsform kam sowohl dem Dr. F., wie mir höchst komisch vor, doch liessen wir, selbstredender Weise, dies absolut nicht merken. Um die Mittagszeit packten alle Japaner ihre in flachen Schachteln eingepackten Esswaaren aus, welche vornehmlich aus gekochtem Reis, Wurzeln und dergleichen mehr bestanden, und verzehrten dieselben in der bekannten landesüblichen Art. Auch die mitgebrachten Bier- und Weinflaschen wurden hierbei ausgeleert. Auch wir Beide nahmen unser bescheidenes Mahl zu uns und konnten dann sehen, wie sich die Japaner nach ihrer Mahlzeit, wenn auch zusammengekauert, zum Schlafen niederlegten. Die Engländer folgten dem Beispiele der Eingeborenen und machten sich auf dem Fussboden ihren Thee zurecht. Nach dem Essen war der Boden des Waggons mit Kistchen, Flaschen, Theekannen und Schalen ganz bedeckt, weil es keinem Japaner einfiel, seine Sachen wegzuräumen und den Gang freizuhalten. Wollte man in einer Station mit etwas längerem Aufenthalte ein wenig aussteigen, so musste man über alle diese Gegenstände wie eine Balleteuse hinüber hüpfen, eine wahrlich nicht leichte Aufgabe. Nachmittags schliefen die Japaner um die Wette und führten ein ganzes Schnarchconcert auf. Am anständigsten war zweifelsohne das Benehmen der alten Frau und ihres Sohnes. Dieselbe blieb fortwährend mit unterschlagenen Beinen auf der Bank sitzen und wendete nur hie und da den Oberkörper um, was wohl Niemandem lästig fiel.
Was die Gegend anbelangt, welche wir durchfuhren, so war ich vorerst sehr enttäuscht bei dem Anblicke des Biwa-Sees, den die Japaner als eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges rühmen, welcher aber weit hinter allen unseren heimatlichen Gebirgsseen zurücksteht. Späterhin sah man zu beiden Seiten der Bahn nur bebaute Felder und im Norden auf weitere Entfernung hin bewaldete Berge. Hierauf gelangten wir in die Nähe des Meeres, längs dessen Ufer wir dann, auf sehr vielen und mitunter sehr langen Eisenbahnbrücken viele breite Flüsse und Rinnsale übersetzend, bis nach Yokohama fuhren. Eine sehr erwünschte Zerstreuung bot der Anblick des nördlich gelegenen, 12.000 Fuss hohen Fugyiberges, welcher, alle anderen Berge weit überragend, schon von Ferne sichtbar ist, bis er sich später in seiner Riesengestalt, aus der Ebene aufsteigend, zeigt. Es ist ein feuerspeiender Berg, dessen letzte Eruption im Jahre 1708 stattfand. Der Blick auf diesen gewaltigen Riesen ist wahrlich einzig in seiner Art.
Als nach 6 Uhr Abends die Dunkelheit anbrach, verzehrten wir noch den zweiten Theil unseres frugalen Mittagessens und warteten hierauf Gott ergeben und geduldig die Ankunft in Yokohama ab.
Diese ganze Eisenbahnfahrt war für mich eine wahre Pein; sie brachte mir aber doch den Anlass, einen Einblick in das innere Leben der Japaner und dazu noch der besseren Gesellschaft zu gewinnen. Das, gelinde gesagt, der guten Sitte sehr wenig entsprechende Benehmen derselben beweist recht drastisch den Mangel an wirklicher Civilisation. Mit Anerkennung und mit aufrichtigem Dankgefühle muss ich noch erwähnen, dass Dr. F. das Möglichste that, um mir die Beschwerlichkeiten der Reise erträglicher zu machen.
Bei meinem Ankommen in die Stadt um 10 Uhr Abends erwartete mich am Bahnhofe ein Diener des dortigen Grand Hôtel, der mir einen Rikscha besorgte, und die Ueberführung meiner Bagage in das Hôtel vermittelte. Eine ausgiebige Nachtruhe war nun für mich ein grosses Bedürfniss.
Am 12. April begab ich mich um 11 Uhr Vormittags zu unserem dortigen Consul v. F., welcher auf dem Bluff (Anhöhe) eine reizende Villa mit Nebengebäuden und Garten bewohnt. Nach erfolgter Begrüssung lud mich der Consul ein, während der Zeit meines Aufenthaltes in Yokohama bei ihm zu wohnen und sein Gast zu sein; ich nahm natürlich diesen so liebenswürdigen Antrag dankbarst an, und kehrte nun in das Grand Hôtel zurück, um die Ueberführung meines Reisegepäckes in das Consulatsgebäude anzuordnen.
Im Grand Hôtel beträgt der Preis für ein Zimmer sammt Verpflegung täglich 8 Yen = 9 fl. 60 kr. Es sind aber in Yokohama noch andere, im europäischen Stile geführte Hôtels, welche weit billiger sind, z. B. das Club Hôtel, welches eine sehr schöne und angenehme Lage innerhalb der Hauptverkehrslinie am Meeresstrande hat.
Ich machte abermals, meinem Vorsatze getreu, einen Ankauf von 80 Ansichtskarten sammt Marken zum Preise von 8 Yen = 9 fl. 60 kr. und fuhr hierauf in die Villa des Consuls, wo mir ein allerliebstes Zimmer zur Verfügung gestellt wurde, in welchem ich mich in behaglichster und comfortablester Weise zurecht machte. Die Villa ist reizend gelegen und bietet eine herrliche Aussicht auf den unten liegenden Stadttheil und auf das Meer. Ihre schöne Einrichtung wetteifert mit der praktischen Eintheilung. Im Halbgeschosse befinden sich die Kanzleiräume, zwei Sitzzimmer, ein Salon und ein grosses Speisezimmer, und im ersten Stocke ist der Platz für Schlaf-, Fremden- und Badezimmer verwendet. Küche und Dienerschaft sind im Nebentracte untergebracht. Im Garten gibt es einen hübschen Tennisplatz, und jenseits des Gartens liegt das Stallgebäude, in dem die drei Reitpferde des Consuls stehen, woran sich die Wagenremise und ein Zimmer für das Stallpersonal anschliessen.
Am 13. April wurde in Tokio ein grosses und interessantes Fest gefeiert, nämlich das vom Kaiser von Japan (Mikado) alljährlich gegebene Kirschenblüten-Parkfest, zu welchem alle fremden Vertreter mit ihren Damen, die ersten Staatswürdenträger und die vornehmsten Familien des Landes geladen waren. Durch die Liebenswürdigkeit unseres Geschäftsträgers in Tokio hatte ich auch eine Einladung zu diesem Parkfeste erhalten, und fuhr daher an diesem Tage mit dem Consul mit Benützung eines Vormittagszuges nach der, eine Stunde entfernten japanischen Hauptstadt. Von dem dortigen Bahnhofe begab ich mich sofort auf die k. u. k. Gesandtschaft, welche sich nahe dem kaiserlichen Palais auf einem, eine hübsche Aussicht gewährenden Hügel befindet. Das Gesandtschaftshôtel ist nach Bauart und innerer Einrichtung sehr vornehm und von einem grossen Garten umgeben, in welchem sich auch die Villa des Gesandtschaftssecretärs und weiter ab die Nebengebäude für die Dienerschaft und der Tennisplatz befinden. An der Grenze des Gartens stehen die Stallungen, Schupfen und Unterkunftsräume für das Stallpersonal.
Sofort nach dem Tiffin fuhren wir in zwei Equipagen zur kaiserlichen Residenz. Dort waren an den Eingängen und längs des Weges bis zur Versammlungsstelle der Gäste Wachen und reich gallonirte Lakaien aufgestellt. Der Park mit seinen vielen alten Bäumen, darunter eine grosse Menge von Kirschenbäumen der blütenreichen Gattung, seinen Zierpflanzen und Blumen, seinen Teichen und sorgsam gehaltenen Bächen macht einen ebenso hübschen als vornehmen Eindruck. Der Versammlungsort der Eingeladenen bot ein fremdartiges und fesselndes Bild. Bunt gemengt zwischen den Europäern sah man die Japaner und Japanerinnen, sämmtlich in europäischer Kleidung, sowie die japanischen Generale und sonstigen höheren Officiere in ihren Uniformen. Man merkte es aber den einheimischen Damen häufig an, dass sie sich in unserer Tracht nicht recht heimisch fühlten. Sehr eigenthümlich sahen bei dieser Adjustirung die Complimente aus, welche die einheimischen Damen in japanischer Weise mit einer tiefen Verbeugung des Oberleibes ihren Bekannten machten, eine Begrüssungsart, welche zur europäischen Kleidung wohl nicht passt. Unser zuvorkommender Geschäftsträger v. G. liess es sich angelegen sein, mich nach Möglichkeit den hohen Civil-Würdenträgern, Marschällen und Generalen vorzustellen, und ich habe an Jeden einige englische oder französische Worte gerichtet.
Plötzlich wurde gezischt zum Zeichen, dass sich die Majestäten mit ihrem Hofstaate nähern. Die Gäste bildeten eine Gasse, durch welche der Kaiser voraus, dann zehn Schritte hinter ihm die Kaiserin und wieder nach zehn Schritten der Hofstaat — alle europäisch gekleidet — gegen den weiter im Innern gelegenen, sehr geräumigen Pavillon schritten. Der Mikado ist mittleren Alters, ziemlich wohlbeleibt, und hat einen etwas schleppenden Gang; die Kaiserin ist fast klein zu nennen, zeigt Geist in ihrem Ausdrucke und Anmuth in ihrer Erscheinung. Dem Hofstaate schlossen sich dann die Gäste an, und ich hatte auf dem Wege zum Pavillon noch vollauf Gelegenheit, die schönen Anlagen des Parkes und die Pracht der in vollen Blüten entwickelten herrlichen Kirschenbäume zu bewundern.
Sofort beim Erscheinen der Majestäten intonirten die im Parke vertheilten Militär-Musikcapellen die japanische Volkshymne, welche so lange fortgesetzt wurde, bis Kaiser und Kaiserin zum Pavillon gelangt waren. Dieser Pavillon bestand aus einem sehr langen und breiten Raum, in dessen Mitte, etwas weiter zurückstehend, sich ein grosser Saal befand, in welchem die Majestäten mit dem Hofstaat Aufstellung nahmen, und den zu ihnen herangerufenen Personen Audienzen ertheilten. In den Gängen des Pavillons waren kleine Tische, Sessel und ein Buffet aufgestellt.
Der Geschäftsträger wollte mir ebenfalls eine Audienz verschaffen, erhielt aber von dem Obersthofmeister die Mittheilung, dass mich die Majestäten in Privataudienz empfangen werden, dass ich aber hierzu in Uniform zu erscheinen habe. Nachdem die Audienzertheilungen beendet waren, gingen die Majestäten mit ihren Suiten an das eine Ende des Ganges und liessen sich dort an dem für sie hergerichteten Tische nieder, worauf sich die Gäste an den übrigen Tischen vertheilten. Nun wurde das Goûter servirt, welches aus kalten Speisen, Süssigkeiten, Obst und Champagner bestand. Das Serviren wurde in guter und prompter Weise von den Lakaien besorgt, aber auch die hohen Würdenträger, Minister u. s. w. machten den fremdländischen Gästen die Honneurs und präsentirten ihnen verschiedene Platten. Während des Goûters executirten die Musikcapellen europäische Tonstücke.
Als ich mit den beiden Damen, zwischen welchen ich Platz genommen hatte, eben ein eifriges Gespräch unterhielt, und mir hierbei die aufgetragenen, wirklich exquisiten Speisen wohl schmecken liess, kam der Marschall, Marquis Ogawa, einer der Commandanten der japanischen Armee in ihrem letzten siegreichen Feldzuge gegen China, mit einem Glase und einer Flasche Champagner auf mich zu und schenkte mir ein. Glücklicherweise wusste ich bereits Bescheid, wie in Japan auf solchen Gruss erwidert wird. Ich trank nämlich, der Landessitte entsprechend, sobald ich mich erhoben hatte, mein Glas aus, nahm ihm die Champagnerflasche aus der Hand und schenkte ihm nun sein Glas voll. Er nahm diesen japanischen Gegengruss sehr freundlich auf und leerte, sichtlich angenehm berührt, sein Glas. Diese Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit des alten verdienten Marschalls freute mich sehr, denn er wollte damit zweifellos seiner Verehrung für unsere Armee Ausdruck geben.
Sowie der Kaiser und die Kaiserin sich von der Tafel erhoben, wurde abermals die japanische Volkshymne gespielt. Alles erhob sich von den Sitzen und die Majestäten zogen sich in ihre Gemächer zurück. Das Fest hatte hiermit sein offizielles Ende erreicht. Beim Abschiede lud mich unser Geschäftsträger freundlichst ein, während meines Aufenthaltes in Tokio in einem Fremdenzimmer des Gesandtschaftshôtels abzusteigen, und sein und seiner Frau Gast sein zu wollen. Ich wusste diese liebenswürdige Einladung, die ebenso freundlich angeboten, als von mir dankbarst angenommen wurde, hoch zu schätzen, da ich hierdurch die mir wirklich schon überdrüssig gewordene Hôtelexistenz gegen ein charmantes Familienleben umtauschen konnte.
Am 14. April befand ich mich wieder in Yokohama. Ich benützte den Nachmittag zu einem Besuche des dortigen United Club, der am Meeresstrande gelegen und mit grossem Comfort eingerichtet ist. Nach einem prächtigen Galadiner auf unserem Consulate verfügte sich die ganze geladene Gesellschaft zu einem Ballfeste, welches von den jungen Herren in Yokohama gegeben wurde. Die Tanzlocalitäten waren sehr geräumig und hatten einen eleganten Anstrich. Die Mehrzahl der Ballgäste recrutirte sich aus der hiesigen englischen Colonie. Die Damen erschienen meist in einfacher Toilette und sahen gut aus, ohne gerade auffallend schön zu sein. Am Balle nahm auch die Frau des japanischen Ministers des Aeussern, Vicomte A., eine geborene Deutsche, Theil, welche als einzige Ausnahme eine wirklich schöne Balltoilette trug, und mit der ich eine längere Conversation anknüpfte. Die Rundtänze wurden in einem Tempo ausgeführt, wie dies zur Zeit unserer Grossmütter der Brauch gewesen sein mag, und die Françaisen glichen mit ihren beständigen grossen Complimenten eigentlich mehr einem Lancier. Vor dem Souper, welches, wie man mir nachträglich erzählte, von den jungen Herren sehr hübsch arrangirt worden war, entfernte ich mich und legte mich zur Ruhe.
Am 15. April unternahm ich in Gesellschaft von unserem und dem belgischen Consul eine Partie nach Komakura, welcher Ort mit der Bahn 50 Minuten von Yokohama entfernt ist. Dort machten wir in einer hübschen, baumreichen Gegend einen Spaziergang zu dem Tempel von Hashiman, dem Gotte des Krieges. Dieser Tempel wurde im 12. Jahrhundert errichtet und nach einem Brande im Jahre 1828 neu erbaut. Derselbe hat schöne Altäre, rothe Säulen und bemerkenswerthe Holzschnitzereien. Nahe von diesem Tempel, auf einem Hügel, steht im Freien die kolossale Bronzestatue des Buddha, die schönste Statue dieses Gottes, welche dessen leitende Ideen, nämlich die Hochhaltung der Intelligenz und die Enthaltung von allen Leidenschaften, am besten zum Ausdruck bringt. Die Höhe der Statue beträgt 16 m, der Umfang 32 m, die Länge des Gesichtes 3 m, die der Augen und der Nase je 1 m; die Augen sind aus purem Golde eingesetzt. Die Statue, welche sich inmitten von hohen Bäumen erhebt, macht einen imposanten Eindruck.
In einem nahe gelegenen, europäisch eingerichteten Gasthause nahmen wir das Tiffin ein, machten dann einen Spaziergang und gingen über eine Brücke auf eine Insel, auf welcher eines bevorstehenden Tempelfestes halber viele Buden installirt waren. Dort kaufte ich eine Photographie der Buddhastatue und mehrere andere Kleinigkeiten.
Nachmittags um 5 Uhr sass ich wieder in meinem Zimmer in der Consulatsvilla und fertigte eben Ansichtskarten aus, als es dort zu zittern und der Boden zu schwanken begann. Dieses Zittern und Schwanken wurde immer stärker und währte auffallend lange, so dass kein Zweifel mehr darüber vorhanden war, dass ich eines der in jener Gegend ziemlich häufig vorkommenden Erdbeben mitmachte, und zwar eines Erdbebens, welches sich, nach der Aussage des Consuls, durch seine lange Dauer ganz besonders hervorthat. Ich persönlich war nicht ungehalten darüber, auch einmal im Leben bei einem Erdbeben zugegen gewesen zu sein.
Am 16. April (Sonntag) Vormittags machte ich einen längeren Spaziergang auf dem Bluff, wo sehr viele, darunter manche sehr schöne Villen im europäischen Stile mit schönen Parks stehen, und von welchen man eine sehr schöne Aussicht auf die Stadt und auf den Hafen hat. Die Stadt Yokohama hat 150.000 Einwohner, ist die grösste Hafenstadt von Japan und ihr Hafen ist eigentlich auch jener von Tokio. Eine grosse Zahl von Handlungshäusern haben sich in Yokohama etablirt und ist somit diese Stadt der bedeutendste Handelsplatz von Japan.
Mit Rücksicht darauf, dass dieser Stadttheil (Bluff) auf den hohen Ufern liegt, schafft das Heraufziehen der Fahrgäste auf dem aufsteigenden Wege den Jinrikshas schwere Arbeit. Wohl lässt sich die Mehrzahl der Europäer nicht hinaufziehen, doch sind nicht alle Leute so rücksichtsvoll, am wenigsten die Japaner. Die armen Rikscha sehen auch schlecht und abgemagert aus, und man hört aus dem beständigen Husten von so Manchem, dass er sich zu Tode arbeitet, um sich seinen kargen Lebensunterhalt zu verdienen.
Bei dem Tiffin im Grand Hôtel, an welchem unter Anderen auch die Doctoren Bieler und Honda, beide Professoren an der japanischen Universität für Landwirthschaft zu Komaba bei Tokio, theilnahmen, sprach ich dem Dr. Bieler gegenüber den Wunsch aus, verschiedene Samengattungen von Bäumen, welche in Japan, hauptsächlich auf Bergen wachsen, mit mir nach Oesterreich-Ungarn zu nehmen, damit Versuche über das Fortkommen solcher Bäume gemacht und die gut gedeihenden bei uns eingebürgert werden können. Dr. Bieler erwiderte mir hierauf, dass sein anwesender College Dr. Honda, ein Japaner, in dieser Hinsicht eine Koryphäe sei, und dass er mir gerne mit Rath und That an die Hand gehen werde. Als ich mich nun in dieser Angelegenheit an Dr. Honda wandte, versprach er mir mit grosser Bereitwilligkeit seinen Beistand, und dann, wenn ich nach Komaba kommen werde, um die dortige landwirthschaftliche Universität zu besichtigen, diese Frage der Baumsamen zu einem befriedigenden Resultate zu führen. Bei dieser Gelegenheit besprachen wir auch die mir schon in Singapore mitgetheilte Absonderlichkeit, dass in Asien als der allerbeste, aber nur in verhältnissmässig kleinen Quantitäten vorkommende Kaffee jene Sorte angesehen wird, welche den Namen Musang-Kaffee führt, und zwar deshalb, weil dieser Kaffee durch Musange — Mardergattung — durchgegangen ist. Der Musang klaubt nämlich die besten Früchte des Kaffeebaumes auf und gibt dann die Bohnen wieder von sich. Diese Kaffeebohnen werden hierauf sorgsam zusammengelesen und als Delicatesse verkauft.
Nachmittags besichtigte ich mit unserem Consul dessen Pferde, einen grösseren und einen kleineren Schimmel, sowie einen Schwarzbraun, und beobachtete die Art der Fütterung, wie selbe in Japan allgemein eingeführt ist. Die Pferde bekommen gar kein Heu, dafür aber dreimal des Tages ein Schaff mit einem Gemenge von einer grösseren Quantität Häckerling, und dann je ungefähr einen Liter von geschrotetem Korn, von ungeschrotetem Hafer, von gebrochenem Mais, von geschnittener Rübe und von halbgekochter Kleie. Die Pferde in Japan — dies schalte ich hier der Vollständigkeit halber ein — unterliegen einer eigenthümlichen Krankheit, welche sich in einer Knochenauftreibung an den Kopfschläfen zeigt.
Am 17. April nahm ich von Yokohama und meinem liebenswürdigen Gastgeber Abschied und machte die glücklicherweise recht kurze Reise nach Tokio. Bei meiner Ankunft in der japanischen Landeshauptstadt hatte der österreichisch-ungarische Geschäftsträger die grosse Aufmerksamkeit, mich am Bahnhofe abzuholen und mich in Begleitung seiner charmanten Gemahlin nach dem Gesandtschaftshôtel zu führen, wo ich, seiner Einladung gemäss, mein Absteigequartier nahm. Ich erwähne gerne diesen Umstand, weil er einen erfreulichen Beweis dafür bietet, wie ausserordentlich zuvorkommend sich unsere Vertretungsbehörden in jenen so weit entlegenen Ländern ihren Landsleuten gegenüber erweisen. An demselben Tage noch stattete ich in Begleitung unseres Vertreters den verschiedenen officiellen japanischen Persönlichkeiten Besuche ab. Ganz flüchtig will ich bemerken, dass sich zur Zeit fast alle hohen japanischen Würdenträger im Besitze von europäischen Adelstiteln befinden. Diese Einrichtung rührt erst von dem jetzt regierenden Mikado her, während früher nur die ältesten und grössten Familien den Titel »Daimo« (Fürst) inne hatten; diese Familien stehen auch heutzutage noch bei den Japanern in grösstem Ansehen.
Am 18. April machte ich mit Rikscha eine Spazierfahrt durch die Stadt. Die Adjustirung der zum Ziehen des Wagens bestimmten zwei Leute bestand aus einer Kopfbedeckung, deren weisser flacher Deckel nach innen zu ein leichtes Rohrgestell hat, welches den Kopf frei erhält, dann aus einem Wollhemd, einer blauen Blouse und einer Art von Leinenschwimmhose. Der eine der beiden Rikschas lief in der Wagengabel, und der andere zog den Wagen zwei Meter voraus an einem Stricke, welchen er über eine Schulter und die Brust geschlungen hatte. Ich begab mich in meinem Gefährte sodann zu dem Bazar, wo ich die verschiedenen Kaufläden aufmerksam musterte. Dieser Bazar steht indess hinter jenem in Kobe entschieden zurück, sowohl was die Menge als auch die Qualität der Waaren betrifft.
Nach dem Tiffin setzte ich in dem mit Pferden bespannten Wagen des Geschäftsträgers meine Besuche von Tags zuvor fort.
Bei diesem Anlasse möchte ich einige Worte über die japanischen Privatwagen und über die eigenthümliche Aufgabe sagen, welche den Bedienten bei den dortigen Equipagen zufällt. Die Wagen sind nach europäischem Muster, aber, mit wenig Ausnahmen, nicht sehr elegant gebaut; Kutscher und Bediente haben dann und wann goldbetresste Cylinder und auch mit Wappenknöpfen versehene Livréen, doch in der Mehrzahl der Fälle sieht man dieselben in einer kleidsamen japanischen Tracht. Der japanische Bediente schwingt sich, bevor der Wagen zu einer Wendung, zu einer Kreuzung des Weges oder in's Gedränge kommt, während des Trabfahrens von demselben herunter, läuft vor dem im Trab weiterfahrenden Wagen voraus, um den Weg freizumachen, oder um dem Kutscher ein Zeichen über entgegenkommende Hindernisse zu geben, läuft dann noch so lange mit den Pferden, bis dieselben wieder vollkommen freie Bahn haben, und springt sonach auf den Bock oder auf den Rücktritt hinauf. Dieses Auf- und Abschwingen, sowie das Mitlaufen der Bedienten wiederholt sich bei der Fahrt so häufig, dass dieselben sicher ein Drittheil, wenn nicht die Hälfte des ganzen Weges zu Fuss zurücklegen.
Bei Galafahrten der hohen japanischen Persönlichkeiten laufen etwa 20 Schritte vor den Pferden zwei, vier bis sechs Vorläufer voraus.
Am 19. April fuhr ich Vormittags abermals in den Strassen der Stadt herum, um ein richtiges Bild von derselben zu erhalten.
Tokio, die Hauptstadt Japans, hat gegen zwei Millionen Einwohner, nimmt einen Flächeninhalt von 250 km² auf gewelltem und von Wasserläufen durchzogenem Terrain ein und hat einen Umfang von 65 km. Diese riesenmässige Ausdehnung kommt hauptsächlich daher, weil der kaiserliche Palast mit seinen Nebengebäuden und seinem Parke einen Flächeninhalt von etwa 8 km² hat und in der Mitte der Stadt liegt, weil sich überhaupt sehr viele Paläste mit ausgedehnten Gärten im Weichbilde der Stadt befinden, und weil beinahe sämmtliche Häuser nur ein Stockwerk hoch sind. Die Stadt ist elektrisch beleuchtet, von Pferde- und elektrischen Bahnen durchzogen, und besitzt ein sehr umfangreiches Telegraphen- und Telephonnetz. Die grossen Verkaufshallen trifft man vereint nur in der Strasse Naka döri und dann in den mit derselben parallel laufenden Strassen Kyöbashi und Nihonbashi an, — mehrere andere liegen zerstreut in den übrigen Stadttheilen. Bei dem Umstande, als in Tokio weit weniger Kaufleute etwas Englisch sprechen als in Kobe und Yokohama, und dieselben auch für die Fremden die Preise viel höher ansetzen als in den genannten beiden anderen Städten, so ist es rathsamer, die Haupteinkäufe nicht in Tokio zu machen. Mit Rücksicht auf die so grosse Ausdehnung der Stadt ist die Besichtigung der vielen Sehenswürdigkeiten nur mit einem bedeutenden Zeitaufwande möglich, und so musste ich zu meinem grossen Bedauern, bei meinem nur auf zehn Tage bemessenen hiesigen Aufenthalte, darauf verzichten, mir Alles gründlich anzusehen. Besonders leid that es mir, dass ich nicht dazu kam, in den grossen Ueno-Park (mit dem darin befindlichen Landesmuseum) und in den botanischen Garten zu fahren.
Auf meinen vielen Wanderungen und Fahrten durch die Stadt fesselte manches schöne und ganz im modernen Stile erbaute Palais meine Aufmerksamkeit; von diesen Palästen dienen viele öffentlichen Zwecken.
Nach dem Tiffin holte mich der Interprête der Gesandtschaft ab, um mich in das Militärmuseum zu geleiten, welches mit der Bahn in etwa 20 Minuten zu erreichen ist. Das Museum ist in einem nicht sonderlich grossen Gebäude untergebracht, welches in einem durch seinen Baumwuchs interessanten Garten liegt. In den betreffenden Sälen gab es viel altes Rüstzeug, und zwar fratzenhafte Gesichtsvisire und Kopfhelme, schwerfällige, aber schön gearbeitete Brust- und Rückenpanzer, Schwerter, Speere, Keulen u. s. w.; dann waren altartige Schiesswaffen aller Art aufgespeichert, neben welchen koreanische Bronzekanonen standen, und den Schluss bildeten sehr viele, im letzten Kriege eroberte chinesische Kanonen, Gewehre und Fahnen. Diese chinesischen Waffen zeigen in ihrem Material und ihrer Construction die entsetzliche Vernachlässigung der Wehrmacht im chinesischen Reiche. Die Gewehre und Kanonen gehören meist ganz verschiedenen und veralterten Systemen an; da sieht man Gewehre, deren Läufe durch die abgegebenen Schüsse stellenweise ganz ausgeweitet und auch zersprungen sind, und dort erblickt man Kanonen von ganz unglaublichen Formen, von schlechtem Material und noch schlechterer Erzeugung. Ein Krieg gegen eine mit solchen Waffen ausgerüstete Armee muss dem Gegner, wenn er nur halbwegs gut und gleichmässig bewaffnet ist, zum Siege verhelfen. In einem Saale dieses Museums prangen die in Lebensgrösse ausgeführten Oelgemälde aller hohen japanischen Officiere, welche den letzten Krieg gegen China mitgemacht haben.
In dem an das Museum sich anschliessenden Garten steht der sehenswerthe Shökonsha-Tempel, von dem aus man in der Vogelperspective einen grossen Theil von Tokio überblickt. In unmittelbarer Nähe hieran dehnt sich der hauptstädtische Rennplatz aus, von welchem eine breite Strasse zu einem freien Platz führt, der eine grosse Bronzestatue eines berühmten japanischen Patrioten schmückt. Es ist das erste Mal, dass hier zu Lande einem verdienten Manne ein Monument errichtet wurde.
Das Diner nahm ich bei dem Obersthofmeister der Kaiserin, Grafen K., ein, zu welchem auch unter anderen Gästen ein katholischer Geistlicher zugezogen war — gewiss ein schönes Zeichen von Toleranz und fortschrittlicher Denkungsart. Der Graf bewohnt ein sehr elegant eingerichtetes Palais, welches im europäischen Stile montirt ist. Er besitzt zwei Töchter, von welchen die ältere die Obersthofmeisterin der Kaiserin ist und im Hause ihres Vaters die Frau des Hauses repräsentirt, nachdem ihrer Mutter Gesundheitszustand es schon seit langer Zeit nicht zulässt, sich in Gesellschaften zu zeigen. Der Ton während des ganzen Abends war ein durchaus sehr feiner und den europäischen Anschauungen nach vollständig angemessen, und ebenso waren Dienerschaft, Einrichtung, Service und das Diner nach europäischem Geschmacke sehr gut hergerichtet. Ich hebe dies besonders hervor und lasse auch die Beschreibung des Diners folgen, weil ich im Gegensatze zu den Erfahrungen, welche ich auf den Eisenbahnen gemacht habe, doch auch nachweisen muss, dass in vielen hohen Kreisen die gute Sitte und die Civilisation in bester Weise eingedrungen ist.
Das Speisezimmer des Grafen K. reiht sich den anderen Salons würdig an. Die Tafel war im europäischen Geschmack prachtvoll gedeckt und mit kunstvollem Porzellan, Glas, wappengeschmückten Silber- und Goldbestecken, Goldschüsseln und in der Mitte mit einer Jardinière ausgestattet, welche mit den blütenreichen Zweigen des japanischen fruchtlosen Kirschenbaumes derart umwunden war, dass dieselben den Eindruck machten, aus der prächtigen Vase herausgewachsen zu sein. Im Verlaufe des Diners folgte noch ein zweites Porzellanservice von wundervoller alter Arbeit, welches jeden Kenner entzücken musste. Zum Schlusse der Mahlzeit wurde als kleine Aufmerksamkeit für mich ein alter Tokayerwein servirt. Beim schwarzen Kaffee und einer guten Cigarre besah ich mir noch eingehend die vielen Kunstschätze, die allenthalben aufgespeichert waren. Graf K. zeigte mir auch mit sichtlichem Vergnügen eine ziemliche Anzahl Photographien von unseren Majestäten und von anderen erlauchten Mitgliedern unseres Kaiserhauses, welche Bilder in seinem Besitze sind. Den Schluss des Festes bildete ein recht unterhaltendes kleines Gesellschaftsspiel mit französischen Karten, welches bis gegen Mitternacht währte.
Am 20. April begegnete ich Vormittags bei einer Spazierfahrt verschiedenen Infanterie- und Cavallerie-Abtheilungen. Die Adjustirung des japanischen Militärs ist gut, nett und rein. Die Infanterie zeigte gute Haltung und stramme Disciplin, die Cavallerie konnte mir aber in keiner Hinsicht gefallen, denn der einheimische Pferdeschlag ist elend, die Pferde sind klein, schwerfällig und ganz ohne Energie. Dieselben können daher auch unmöglich nur zu halbwegs brauchbaren Cavalleriepferden abgerichtet werden, und dies umsoweniger, als die Japaner absolut kein Reitervolk sind, und dermalen, was Sitz, Führung und Einwirkung anbelangt, sehr Vieles zu wünschen übrig lassen.
Ich überlegte nun, welche Race von Pferden zur Hebung der Pferdezucht in Japan wohl am besten und zweckdienlichsten wäre, und kam nach Erwägung aller einschlägigen Factoren zu dem Resultate, dass eine wirkliche und gedeihliche Aufbesserung der hiesigen Pferde am ehesten durch unsere Lipizzaner erzielt werden könnte. Die Begründung hierfür ist eine gegebene und einleuchtende. Die Lipizzaner stehen an Grösse einigermassen dem japanischen Pferde näher als andere Racen; sie sind sehr gut gebaut und fundamendirt, ausdauernd und zähe, an heisse Sommer gewöhnt und besitzen vor Allem im hohen Grade die Energie, welche dem hier einheimischen Pferdeschlage noththut.
Gegen Abend besichtigte ich in Gesellschaft von Bekannten einen Theil der Stadt, wo in hell erleuchteten Strassen die ebenerdigen Fronten der Häuser gegen die Strassenseite mit Holzstäben abgeschlossen sind, hinter welchen sich japanisch eingerichtete Salons zeigen. Längs der Wände dieser Salons sitzen auf Polstern nebeneinander junge japanische Mädchen, mehr oder weniger hübsch, aber jedenfalls sehr reich gekleidet, welche den Vorübergehenden zur Schau ausgestellt sind. Die in diesen käfigartigen Kammern eingeschlossenen Mädchen sehen meist unschuldig in die Welt hinaus, wobei sie aus ihren kleinen Tabakpfeifchen rauchen, oder mit Zuhilfenahme des Toilettetäschchens, welches jede Japanerin stets bei sich führt, ihren Teint mit Puder, die vorderen Theile der Lippen mit Purpur oder das Haar mit einem kleinen Kamme zurecht richten. In diesen, uns Europäer wohl höchst fremdartig und seltsam berührenden Strassen wanderte ich wohl eine Stunde lang herum, reichte hin und wieder den Mädchen durch das Gitter kleine Cigarettenschachteln, und lernte da einen Theil des japanischen Volkslebens kennen, von welchem wir uns in Europa keinen Begriff machen können. Es ereignet sich nicht selten, dass solche Mädchen von ihren Liebhabern aus diesen Häusern losgekauft und dann geheiratet werden, ja es wurde mir erzählt, dass sogar japanische Officiere mitunter sich hier ihre Gattin aussuchen. Das würde nur klar beweisen, dass in Japan die Begriffe von unserer christlichen Moral gänzlich fehlen, und dass in diesem Punkte die Civilisation noch sehr im Argen liegt.
Am 21. April ging ein ziemlich starker Regen nieder, und ich benützte den Vormittag gerne dazu, um Notizen über die vergangenen Tage zur Fortsetzung meines Tagebuches einzutragen. Ausserdem schrieb ich an die mir vielseitig gerühmte Verkaufshalle von Kuhn & Cie., eines Wieners, in Yokohama, er möge mir eine Collection seiner Waaren, welche sich zu Geschenken eignen, im Gesammtwerthe von 100 Yen = 120 fl. zusammenstellen, damit ich dieselben in nächster Zeit besehen und eventuell kaufen könne. Auch sandte ich ein Schreiben an die Agentie der Messagerie maritime in Yokohama ab, um mir auf dem am 27. April von dort nach Kobe verkehrenden Dampfschiffe einen Platz erster Classe reserviren zu lassen, eine Vorausbestellung, welche aus dem Grunde nöthig erschien, weil diese Dampfschiffe oft nicht alle eintreffenden Passagiere aufnehmen können.
Für Nachmittag hatte ich den Besuch der landwirthschaftlichen Universität in Komaba in Aussicht genommen, um dieselbe zu besichtigen und die mir zugesagten Baumsamen abzuholen. Da der Legationsrath der hiesigen deutschen Gesandtschaft Graf W. an meinem Projecte lebhaftes Interesse genommen hatte, so wurde verabredet, uns an diesem Nachmittag gemeinsam nach Komaba zu begeben. Nach dem Tiffin war ich aber des anhaltend schlechten Wetters halber noch unentschlossen, dieses Vorhaben zur Ausführung zu bringen. Als jedoch Graf W. trotz Jupiter pluvius mit seinem Wagen ankam, traten wir nun zusammen unsere Fahrt an. Bei dem durch den Regen aufgeweichten, thonigen Erdreiche waren die Strassen recht schlecht geworden, und die Pferde mussten grosse Anstrengungen machen, um uns weiter zu bringen. Nach anderthalb Stunden langten wir endlich glücklich bei der Universität an, wo uns die Professoren Dr. Bieler und Dr. Honda auf das Freundlichste empfingen. Ich erhielt meinem Wunsche gemäss eine reichhaltige Sammlung von Samen für Bäume, welche von den beiden obgenannten Herren vorher ausgewählt und mit zwei erläuternden Listen versehen worden war. In zwei ansehnlichen Säcken befanden sich 22 Sorten von Baumsamen, jede Sorte numerirt und besonders in einem kleinen Beutel aufbewahrt; dann waren auf einer Liste nummernweise die lateinischen Namen der Sorten und in der zweiten Liste die Bestimmungen für die Anpflanzung und für die Behandlung der jungen Bäumchen sehr klar und genau angegeben. Ich hatte über diese so reiche und vorzüglich gut zusammengestellte Gabe eine sehr grosse Freude, und versprach den Professoren, da dieselben für die Samen keine Bezahlung annehmen wollten, ihnen von Oesterreich-Ungarn aus Samen von dort heimischen Bäumen und Pflanzen zu senden. Da die Zeit für die Anpflanzung schon weit vorgeschritten war, so benützte ich die nächste Post zur betreffenden Versendung, und so gelangten dieselben zum Zwecke von Versuchen an die landwirtschaftliche Anstalt in Klagenfurt und an verschiedene Verwandte und Bekannte, welche grössere Gütercomplexe besitzen.
Obzwar der Regen nicht nachlassen wollte, schickten wir uns dennoch an, die Universitätsbaulichkeiten, sowie den Versuchsgarten in Augenschein zu nehmen.
Die Anstalt verfügt über einen sehr ausgedehnten Raum. In dem Garten werden viele Versuche in mannigfaltigen Arten mit grosser Sorgfalt gemacht. In den Gebäuden befinden sich die Lehrsäle, die Säle mit den Sammlungen, die Locale für chemische Versuche u. s. w. Das Ganze macht einen vortrefflichen Eindruck.
Bei unserem Rundgange lernte ich einen dort weilenden deutschen Professor und Doctor der Thierarzneikunde kennen, mit welchem ich mich des Längeren über die Pferdezucht in Japan unterhielt. Auch seiner Ansicht nach bedürfen die Pferde in Japan dringend einer Aufbesserung, und es haben die bisher gemachten Versuche wegen der unrichtigen Auswahl der Hengste nur unbefriedigende Ergebnisse geliefert. So z. B. waren die Versuche mit Trakehner-Hengsten, welche für die hiesigen Stuten durchaus nicht passen, gänzlich missglückt — bessere Erfahrungen habe man mit der erst vor Kurzem begonnenen Kreuzung mit ungarischen Hengsten gemacht, doch können wirklich gute Resultate nur von der Verwendung der Lipizzaner Hengste erwartet werden. Ich war erfreut darüber, dass der Professor die gleiche Anschauung mit mir theilte. Nachdem wir den uns begleitenden Professoren für ihr freundliches Entgegenkommen bestens gedankt hatten, fuhren wir bei Wind und Regen heimwärts.
Am 22. April benützte ich Vormittags die Bahn nach Yokohama und besuchte dort unseren Consul, wo ich zufällig auch den Commandanten des Lloyddampfers Marquis Bacquehem antraf, mit welchem ich die Rückreise von Kobe aus antreten wollte. Dann fuhr ich in die Samenhandlung Böhmer & Cie., welche von einem Deutschen, Dr. Unger, geleitet wird. Auch an diese Handlung hatte ich mich seinerzeit schriftlich um Beschaffung von Baumsamen gewendet. Dr. Unger hatte mir aber keine diesbezügliche Zusammenstellung gemacht, und behauptete, dass solche Samen nur im allerersten Frühjahre von ihm versendet werden. Im weiteren Verlaufe des Gespräches erzählte er mir, dass er über Auftrag der deutschen Colonie in Kiautschau eine grosse Menge von Waldbaum-Samen dorthin expedirt habe, weil im genannten Districte viel aufgeforstet werden soll. Es schien mir hieraus zur Evidenz hervorzugehen, dass Dr. Unger überhaupt keinen Vorrath an dem gesuchten Samen mehr hatte, und mir folgerichtig auch keinen verkaufen konnte. Er übergab mir aber einen Preiscourant für Sämereien sammt Abbildungen, und sagte mir über meine Bitte zu, mehrere solche Exemplare an diverse Anstalten und Privatpersonen in Oesterreich-Ungarn senden zu wollen.
Zum Schlusse suchte ich die Verkaufshalle von Kuhn & Cie. auf. Kuhn, wie schon früher bemerkt, ein Wiener, ist bereits seit etwa 40 Jahren in Yokohama etablirt und gehört dort unbedingt zu den ersten Kaufleuten. Sein Ruf ist ein sehr guter, und allem Anscheine nach mag er sich schon dort ein beträchtliches Vermögen erworben haben. Die Collection, welche er mir zusammengestellt hatte, war sehr schön und vielfältig. Als ich dann die Preise jedes einzelnen Gegenstandes mit jenen Preisen verglich, welche in den anderen Verkaufshallen für ähnliche, aber nicht so gut angefertigte Gegenstände gefordert wurden, erkannte ich, dass man bei Kuhn & Cie. am besten, solidesten und billigsten seine Einkäufe besorgt. Ich erstand die ganze Collection zu dem gebotenen Preise und ertheilte den Auftrag, die Gegenstände in einem in Japan erzeugten, sehr praktischen, geflochtenen Koffer zu verpacken und denselben an Bord des eben in Yokohama verankerten Lloydschiffes Marquis Bacquehem spediren zu lassen.
Nach erfolgtem Ankaufe besah ich mir noch die anderen, theilweise sehr werthvollen Gegenstände, welche zum Verkaufe ausgestellt waren, darunter Credenzen, Schreibtische, Broderien, Stoffmalereien etc. Die Feinheit und Eleganz der Ausführung überraschte mich ebenso, als mich der verhältnissmässig billige Preis in Erstaunen versetzte. Ich konnte es nur bedauern, dass ich nicht über die erforderlichen Mittel verfügte, um auch einige dieser sehr werthvollen Objecte mit mir zu nehmen.
Nach dem eingenommenen Tiffin bei unserem Consul fuhr ich mit ihm und seinen anderen Gästen zu dem Rennplatze bei Yokohama, wo an diesem Tage die Pferde für die am 8., 9. und 10. Mai abzuhaltenden Rennen trainirt wurden. Ich sah dort etwa 50 Pferde, und darunter nicht eines, welches ich besitzen möchte. Die Pferde waren entweder sehr klein und dabei plump, oder sie waren gross und dabei hochbeinig, ohne Tiefe des Körpers, manche mit zu kurzem Halse; einige Thiere waren wohl schneidig, aber sehr fein, andere hatten einen zu schweren Kopf, mit einem Worte, kein einziges war von jenem Schnitte, von dem wir die guten Reitpferde bei uns sehen. Die Jockeys sind Japaner oder Chinesen und gleichen den englischen Jockeys nur durch ihre Benennung und einigermassen durch ihre Kleidung.
An jedem der drei oben angeführten Tage sollen neun Rennen abgehalten werden, bei welchen der Sieger einen Ehrenpreis und die Einsätze erhält. Die Einsätze sind im Allgemeinen auf 10 Yen = 12 fl. fixirt. Die Rennen sind getheilt in jene für chinesische Pony und in jene für die australischen Pferde, und werden alle mit Gewichtsausgleich geritten, wobei es, so wie bei uns, für Maiden oder Gewinner Gewichtsermässigungen oder Erhöhungen gibt. Die Distanzen sind für die chinesischen Pony mit 800-1000 m und für die australischen Pferde mit 1200-2400 m festgesetzt.
Des Abends kehrte ich wieder nach Tokio zurück.
Sonntag, den 23. April, begab ich mich mit dem Geschäftsträger und seiner Frau in die katholische Kirche, wo derselbe Geistliche, mit dem ich sowohl auf unserer Gesandtschaft als beim japanischen Obersthofmeister Grafen K. dinirt hatte, die Messe celebrirte. Die Kirche liegt an der äusseren Grenze der Stadt, ist ein kleiner Holzbau mit einem winzigen Thurme, und wird sammt dem angrenzenden, ebenfalls recht kleinen Pfarrhause von Bäumen förmlich versteckt. Im Innern ist die Kirche sehr bescheiden ausgestattet und besitzt als einzige Zier nur einige bemalte Fenster. Ausser uns Dreien wohnten noch ein Professor mit seiner deutschen Frau und seinen beiden Knaben, welche dem Geistlichen ministrirten, und etwa acht Japaner der Messe bei. Nach dem Gottesdienste besuchten wir den Pfarrer in seiner Wohnung, und wurden von ihm mit Kaffee und Kuchen bewirthet.
Am Abend machte ich ein exquisites Diner beim hiesigen deutschen Gesandten Grafen L. mit.
Am 24. April nahm ich nach dem Frühstück einen Rikscha und liess mich zu einem der Exercierplätze von Tokio führen, damit ich doch noch vor meiner Abreise von dort mir eine Beurtheilung des japanesischen Militärs bilden könne. Ich kam zu einem grossen freien Platze, auf welchem etwa 12 Compagnien Exercierübungen vornahmen. Die Infanterie war auch hier, gleichwie in Yokohama, gut und rein gekleidet und mit Gewehr, Bajonnett, Patrontasche und Tornister ausgerüstet. Es herrschte stramme Ordnung und absolute Ruhe. Die Ausführung der Bewegungen und der Gewehrgriffe erfolgte in voller Gleichförmigkeit mit grosser Genauigkeit und mit stricter Einhaltung der Tempi. Die Commandanten benahmen sich gut vor der Front. Die Frontmärsche wurden viel geübt und gingen fliessend, auch der Uebergang in andere Formationen erfolgte exact. Bei dem Marsche wurde eine gute Fusssetzung und strammer Gang eingehalten. So weit war Alles gut und zufriedenstellend.
Ein sehr bedeutender Fehler aber ist es, dass die Schritte nur sehr klein sind und dass die Infanterie daher nur langsam vorwärts kommt, und somit auch bei ihrer Bewegung sehr viel Zeit verliert. Wohl übt die japanische Infanterie ziemlich viel den Laufschritt, aber auch hier sind die einzelnen Schritte nur klein, und so gewinnt dieselbe auch im Laufschritte, den sie allerdings auf längere Zeit ausdehnt, und wobei der Soldat das Gewehr auf der Schulter behält, nur verhältnissmässig geringen Raum.
Das Feuergefecht wurde nur von einigen Compagnien, und von diesen ganz kurz geübt. Der Uebergang in die Feuerlinie war ein stricter, doch ebenfalls in zu langsamem Tempo. Zur Feuerabgabe wurde das Ziel und die Distanz angegeben, und von den Leuten wurden darnach die Aufsätze gerichtet. Während des Feuerns standen die Soldaten auf gleiche Entfernung nebeneinander, und hockten sich nur auf Commando und dann gleichmässig nieder. Von einem schwarmweisen Vorgehen, sowie von der Benützung des Terrains war nichts wahrzunehmen. Ich sah sogar eine langsam vorgehende Feuerlinie auf etwa 50 Schritte unter dem Rande einer Terrainwelle wieder auf Commando stehen bleiben und das Feuer eröffnen, ohne dass der Mann über die Welle sehen konnte. Bis 12 Uhr Mittag blieb ich auf dem Exercierplatze, um welche Zeit die Compagnien erst von dort abmarschirten, und ich empfing im Ganzen den Eindruck, dass in der japanischen Infanterie viel Ordnung und Disciplin herrscht, dass aber der Wesenheit ihrer Thätigkeit zu wenig oder gar kein Augenmerk zugewendet wird, oder dass dafür kein Verständniss vorhanden ist. Schiller's Worte kamen mir hierbei in das Gedächtniss: »Wie er räuspert und wie er spuckt, das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt; aber sein Genie, ich meine seinen Geist....«
Der 25. April war in seinen Vormittagsstunden dem Audienznehmen gewidmet. Zuerst fuhr ich mit unserem Geschäftsträger, der in schmucker ungarischer Tracht gekleidet war, zu dem kaiserlich japanischen Prinzen Arisugawa, welcher vermuthlich der Nachfolger des Mikado sein wird, weil der nächste Kronprätendent schon seit langer Zeit schwer krank darniederliegt. Der Prinz, ein schlanker, in Civil gekleideter Herr, war in seinem Benehmen ein wenig steif, doch waren die an mich gerichteten Worte, wie ich aus dem Munde des Dolmetschen entnahm, sehr freundliche. Diese Audienz währte ziemlich kurz, und nach ihrer Beendigung begaben wir uns zu dem kaiserlich japanischen Prinzen Kanin, welcher den letzten Feldzug gegen China mitgemacht hatte und jetzt Oberst bei der Cavallerie ist. Prinz Kanin war sehr liebenswürdig, und die mit Hilfe eines Dolmetschen geführte Conversation gestaltete sich recht lebhaft. Ich nahm die Gelegenheit wahr, dem Prinzen gegenüber meine Anschauung auszusprechen, dass die Hengste aus Sr. Majestät unseres Kaisers Gestüt Lipizza zur Hebung der japanischen Pferdezucht mir als die geeignetsten erscheinen.
Nun ging es zum japanischen Kaiserpalaste, einem sehr weitläufigen, aus Holz erbauten Gebäude, welches nur theilweise mit einem ersten Stocke versehen und durch eine Säuleneinfahrt geziert ist. Von einem japanischen Officier empfangen, gingen wir an gallonirten Bedienten vorüber, bis wir in einen Salon kamen, wo uns ein höherer Würdenträger erwartete. Nach erfolgter Vorstellung und dem Austausche einiger Phrasen setzten wir unseren Weg durch breite, mit Wandmalereien bedeckte Gänge fort, und wurden dann in einen grossen, luxuriös geschmückten und mit sehr prunkvollen europäischen Möbeln ausgestatteten Saal geführt, wo uns der Ober-Ceremonienmeister Baron S. entgegen ging und begrüsste. Nach einiger Zeit überbrachte der japanische Kammerherr J., ein sehr netter junger Herr mit distinguirten Umgangsformen, dem Baron S. die Mittheilung, dass der Mikado in kürzester Zeit die Audienz ertheilen werde. Hierauf wurden der Geschäftsträger und ich von den beiden japanischen Herren abermals durch eine Reihenfolge von breiten Gängen, deren eine Seite die gegen den Park gerichtete Glaswand, und deren andere Seite die künstlerisch bemalten Schiebethüren zu den kaiserlichen Appartements bildeten, bis zu einem kleinen Vorraume geleitet, von welchem eine geöffnete Thür in den dunkel gehaltenen und brillant eingerichteten Empfangssaal führt, in welchem die Audienz stattfinden sollte. Hier mussten wir uns neben dem offenen Eingange verdeckt aufstellen, bis der Mikado von seinen inneren Gemächern in den Audienzsaal gelangte.
Als dies nach kurzer Zeit geschehen war, traten zuerst der Ober-Ceremonienmeister, dann der Geschäftsträger und schliesslich ich in den Salon ein, gingen bis auf einige Schritte gegen den im Hintergrunde des Saales im Civilkleide stehenden Mikado vor und verneigten uns vor ihm. Zuerst sprach der Ceremonienmeister einige Worte, worauf mich der Geschäftsträger dem Kaiser vorstellte. Nach der Vorstellung richtete der Mikado die mir vom Dolmetschen übersetzte Frage an mich, seit wann ich in Japan sei. Ich verneigte mich nochmals und erwiderte, dass ich seit zwei Wochen im Lande weile, und dass ich die Reise von Oesterreich-Ungarn bis nach Japan ausgedehnt habe, um dieses interessante Land kennen zu lernen, und die im letzten Feldzuge siegreiche Armee Sr. Majestät zu sehen. Nach einer weiteren kurzen Frage und Gegenantwort wünschte mir der Mikado eine glückliche Reise, und ich sprach meinen ergebensten Dank für die Gnade aus, mich in Audienz empfangen zu haben, wodurch mein schöner Aufenthalt in Japan gekrönt worden sei.
Von dem Audienzsaale aus wanderten wir wieder durch lange Corridore zu den Gemächern der Kaiserin von Japan. Dort wurden wir von ihrem Obersthofmeister Grafen K. empfangen und sofort nach dem Salon der Kaiserin gewiesen, welche bei unserem Eintritte dortselbst bereits anwesend war. Die Vorstellungs-Ceremonie spielte sich in ähnlicher Weise wie bei dem Mikado ab. Die Kaiserin, welche eine reiche europäische Toilette trug, war sehr gnädig, richtete sehr freundliche Worte an mich und reichte mir bei der Ankunft und beim Abschiede die Hand zum Kusse. Ich gestehe gerne zu, dass diese Audienz bei mir einen besonders angenehmen Eindruck hinterliess.
Dem darauffolgenden Tiffin auf dem Gesandtschaftshôtel hatte der Geschäftsträger sämmtliche japanische Hofwürdenträger, welche bei den vorhergegangenen Audienzen intervenirt hatten, sammt ihren Familien zugezogen.
Am Abende dieses Tages war der mehrfach genannte Obersthofmeister der Kaiserin Graf K. so ausserordentlich liebenswürdig, mich zu einem glänzenden Abschiedsdiner einzuladen, dem ausser unserem Geschäftsträger und Gemahlin noch verschiedene hochgestellte Japaner, im Ganzen 20 Personen, beiwohnten. Da mein Gastgeber nur der japanischen Sprache mächtig ist, so stand ich von meinem ursprünglichen Vorhaben ab, während des Diners einen Toast zu halten, liess mir indess Alles, was ich sagen wollte, in japanische Sprache übersetzen und niederschreiben, und übergab nach aufgehobener Tafel diese Schrift dem Grafen. Meine schriftliche Mittheilung, welche Worte des Lobes und der Anerkennung über Japan enthielt, und dem Hausherrn meinen verbindlichsten Dank für alle seine Liebenswürdigkeiten zum Ausdrucke brachte, verfehlte ihren Zweck nicht. Graf K. äusserte seine grosse Freude hierüber, und übergab mir zur bleibenden Erinnerung seine und seiner Töchter wohlgelungenen Photographien.
Zum Schlusse meines Aufenthaltes in Tokio ist es für mich eine wirklich unerlässliche Pflicht der Dankbarkeit, ganz besonders hervorzuheben, in welch' hohem Grade sich sowohl die Herren der Gesandtschaften, als auch die einheimischen Würdenträger gastfrei und entgegenkommend gegen mich erwiesen haben. Dieser Dank gebührt sicherlich in erster Linie unserem so überaus liebenswürdigen Geschäftsträgerpaare, und auch sämmtlichen Herren und Damen der kaiserlich deutschen Gesandtschaft.
Wohl haben meine Audienzen, officiellen Besuche und die vielen Tiffin- und Diner-Einladungen mir weniger Zeit als anderswo frei gelassen, um mir in der japanischen Hauptstadt Alles gründlich anzusehen, allein ich gewann hierdurch einen Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse Japans.
Am 26. April musste ich schon zeitlich aufstehen, weil der Eisenbahnzug, der mich nach Yokohama bringen sollte, schon um 8 Uhr Morgens abging. Da mit diesem Zuge meine Ankunft in Yokohama nicht vor 9 Uhr Früh erfolgen konnte, das Dampfschiff der Messagerie maritime, mit welchem ich nach Kobe fahren wollte, aber schon um 10 Uhr Vormittags den dortigen Hafen verlässt, so hatte ich unseren Consul in der genannten Stadt gebeten, Jemand nach dem Bahnhof in Yokohama zu entsenden, welcher mir behilflich sein könnte, mein Gepäck sofort von der Bahn auf das Schiff zu bringen.
Bei meiner Abreise von Tokio fand sich noch ganz unerwarteterweise unser Geschäftsträger auf dem Bahnhofe ein, um mir ein letztes Lebewohl zu sagen, und ich konnte ihm somit nochmals für seine mir stets unvergesslich bleibende Gastfreundschaft herzlichst danken.
In Yokohama traf ich zu meiner grossen Freude unseren dortigen Consul auf dem Bahnhofe an, welcher Einem seiner Leute den Auftrag gab, die Ueberführung meines Gepäckes auf das Dampfschiff zu besorgen.
Zur festgesetzten Zeit, um 10 Uhr Vormittags, verliess das Schiff den Hafen, und zog, von Tücherschwenken begleitet, hinaus in die hohe See. Es befanden sich ungefähr 20 Passagiere erster Classe, darunter ziemlich viele Deutsche, auf dem Dampfschiffe; dessenungeachtet hatte der französische Schiffscapitän die Aufmerksamkeit für mich, mir eine Cabine für mich allein zuzuweisen.
Während der Fahrt hatte ich noch einmal den Genuss, den gewaltig hohen und merkwürdigen Berg Fugyi zu sehen, dann aber entfernte sich das Schiff so weit von der Küste, dass dieselbe nicht mehr erblickt werden konnte. Das Dampfschiff der Messagerie maritime begann nun, ohne dass das Wetter stürmisch geworden wäre, heftig zu rollen, wie dies bei den Schiffen des Oesterreichischen Lloyd, die ganze Zeit meiner Fahrt über, niemals der Fall war. Alle Damen und einige Herren, welche sich an Bord des französischen Dampfers befanden, wurden seekrank, wovon ich auch dieses Mal wieder verschont blieb.
Die Verpflegung auf der Messagerie maritime ist ebenso gut und reichlich, wie auf unseren Lloydschiffen, zeichnet sich aber dadurch aus, dass jeder Reisende zu jeder Mahlzeit, nach Belieben, kostenfrei rothen und weissen Wein oder Bier erhält. Der Wein ist recht gut, an Bier wird auch englisches Pale ale oder Stout und zum Diner ein Glas Sherry geboten. Dabei wird durchaus nicht geknickert, sondern jedem Passagier, der seine Flasche geleert hat, wird sofort eine andere vorgesetzt. Dieser unentgeltliche Genuss von Getränken ist schon aus dem Grunde eine grosse Annehmlichkeit, weil man dadurch der Mühe enthoben wird, täglich dem Kellner auf einem Papierstreifen angeben zu müssen, was man getrunken hat, und ausserdem hat man den Vortheil, dass beinahe alle Extraauslagen während der Fahrt entfallen. Ich zahlte für mein Billet erster Classe, sowie für mein Gepäck von Yokohama bis nach Kobe, das ist für eine Reise von 26 Stunden, den Betrag von 12 Yen = 14 fl. 40 kr., also die gleiche Summe, welche für dieselbe Strecke auf der Eisenbahn, doch ohne Verköstigung, zu entrichten ist.
Die allgemeine Bemerkung scheint mir an dieser Stelle nicht überflüssig zu sein, dass in den japanischen Hafenplätzen die Leute für den Transport des Gepäckes vom oder zum Schiffe unverschämte Forderungen stellen, und recht zudringlich werden, wenn ihrem Begehren nicht voll entsprochen wird; es ist daher für die Reisenden, welche in einem Hôtel absteigen, sehr angezeigt, vorher schriftlich an dasselbe die Ankunft mit dem Ersuchen bekannt zu geben, den Transport des Gepäckes vom Schiff oder Bahnhof in das Hôtel zu übernehmen.
Am 27. April traf ich Vormittags wohlbehalten in Kobe ein. Ich fuhr zuerst in das Hôtel, wo der Preis der Pension für den Tag auf 7 Yen = 8 fl. 40 kr. festgestellt wurde, und begab mich dann zum Lloydagenten, um mich zu erkundigen, ob der Dampfer Marquis Bacquehem die für den 30. April bestimmte Abfahrtzeit von Kobe pünktlich einhalten werde. Die mir ertheilte Antwort lautete dahin, dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine Aenderung in dem festgesetzten Fahrtprogramme eintreten werde.
Von hier aus suchte ich den Gärtner Tomiyama in der Shi-chome Nr. 5 auf, bei welchem ich die prächtige, meterhohe Pflanze Cycas revoluta zu dem billigen Preise von 3 fl. 60 kr. erstand. Hierauf verfügte ich mich in mehrere Porzellanhandlungen behufs Auswahl von schönen, grossen japanischen Vasen, und schliesslich in die Lackwaaren-Verkaufshalle von Shidzoaka Shikki Kaisha in der Thimoyamati-dori Nr. 14, wo ich eine grössere Anzahl von sehr hübschen und reizend ausgeführten Lackgegenständen kaufte.
In das Hôtel zurückgekehrt, fand ich die Visitkarte eines Herrn E. C. vor, welcher sich nach den diesfalls gepflogenen Erhebungen des Hôteliers als der Vertreter des Import- und Exporthauses Reimers entpuppte.
Am 28. April begab ich mich in den Morgenstunden zuerst in die Porzellan-Verkaufshalle Nishida, um den Ankauf der Vasen sammt Verpackung und Transport auf das Schiff perfect zu machen, und liess mich dann durch meinen Rikscha nach der Wohnung des oberwähnten Herrn C. fahren, um demselben einen Gegenbesuch abzustatten. Derselbe stellte sich mir als Oesterreicher vor, und fügte hinzu, dass er meine hiesige Ankunft den Zeitungen entnommen habe und sich mir zur Verfügung stellen wolle. In weiterer Fortsetzung des Gespräches bot er sich an, mich Nachmittags in den Deutschen Club von Kobe einzuführen, um dort des Abends einem humoristischen Vortrage eines herumreisenden deutschen Künstlers beizuwohnen. Gleichzeitig lud er mich für den nächstfolgenden Tag zum Diner ein, wozu er auch alle in Kobe weilenden Oesterreicher und Ungarn heranziehen wollte. Mit Dank nahm ich seine gefälligen Anträge und seine Einladung an.
Nach dem Tiffin ging ich in die Verkaufshalle von Kuhn & Komer gegenüber dem Hôtel Oriental und kaufte bei Kuhn, welcher ein Wiener ist, mehrere sehr interessante Gegenstände, darunter auch eine sehr alte Rüstung mit Brust-, Rücken-, Arm- und Beinschienen, sowie Seidenbroderien und eine Pickelhaube mit schreckhafter Gesichtsmaske, auf welcher ein Borstenbart angebracht war, sammt der dazu gehörigen Kiste zu verhältnissmässig billigem Preise. Dann besichtigte ich noch das übrige Waarenlager und fand dort prachtvolle Muster von Embroderien, Vorhängen, Schirmen, Cloisonnes, gemalten Porzellanservicen, Elfenbeinschnitzereien u. s. w. zu mässigen Preisen, so dass ich nach den gemachten Erfahrungen die beiden Verkaufshäuser von Kuhn in Yokohama und von Kuhn & Komer in Kobe als die besten Ankaufsstellen in Japan bezeichnen muss.
Hierauf besichtigte ich noch das Deutsche Clubhaus. Dasselbe ist ein ansehnliches Gebäude in sehr schöner Lage und hat vor sich einen grossen, gut hergerichteten Raum, auf welchem sich Tennisplätze, Radfahrschulplätze u. s. w. befinden.
Nach dem Diner kam ich abermals in den Club zurück, um den Vortrag des deutschen Dramaturgen (!) anzuhören. Die gewählten Vortragsstücke waren weder humoristisch noch geistvoll, und der Künstler hatte das Missgeschick, überhastet zu sprechen und die verschiedenen Modulationen unrichtig anzubringen. Wenn also dieser Theil der Abendunterhaltung nicht nach Wunsch einschlug, so war dies doch im vollen Masse der Fall bei den Musikvorträgen, welche einige Clubmitglieder auf Violine, Viola und Clavier zum Besten gaben. Es wurden meist Tonstücke von Mozart gespielt, und diese wurden meisterhaft vorgetragen. In den Zwischenpausen fand ich bei den mich umgebenden jüngeren Herren eine mir sehr zusagende Unterhaltung, und freute mich herzlich darüber, dass ich durch die Artigkeit des Herrn C. in einem fernen Welttheile mit sympathischen Landsleuten zusammengekommen war.
Den 29. April hatte ich dazu bestimmt, mit der Eisenbahn nach Himeji zu fahren und dort einen Generalstabs-Obersten zu besuchen, für welchen ich von dem japanischen Militär-Attaché in Wien einen Empfehlungsbrief mitbekommen hatte. In Rückerinnerung an die in Osaka gehabten Schwierigkeiten, das für den dortigen Commandanten der Truppendivision bestimmte Schreiben an seine Adresse gelangen zu lassen, hatte ich dieses Mal, bereits am 27. April, an den in Rede stehenden Generalstabs-Obersten geschrieben, und dem Schreiben den Brief des Militär-Attaché beigelegt. In diesem meinem Schreiben theilte ich dem Obersten mit, dass ich am 29. April, um halb 11 Uhr Vormittag, am Bahnhof in Himeji anlangen und von dort zu ihm zu Besuch fahren werde, und fügte die Bitte bei, mir dort einige militärische Einrichtungen freundlichst zeigen zu wollen. Diesen Brief gab ich, der grösseren Sicherheit halber, recommandirt bei der Post auf. Bei meiner Ankunft in Himeji war ich etwas verwundert darüber, Niemand auf dem Bahnhofe zu finden, der mich empfangen und zu dem betreffenden Obersten geleitet hätte. Ich nahm nun einen Rikscha auf — englisch sprechende Rikschas gibt es in Himeji nicht — und wies ihn an, mit Zuhilfenahme der Angaben über die japanische Sprache in Murray's Handbuch für Japan, mich zum Castell zu fahren. Vor dem Castell breitet sich ein grosser Exercierplatz aus, wo vielleicht an 20 Compagnien ihre militärischen Uebungen machten. Dort stieg ich aus und vermuthete, dass nun der Oberst an mich herankommen werde. Als dies aber nicht erfolgte, fragte ich einen japanischen Officier nach dem Generalstabs-Oberst. Der Officier schien mich nicht zu verstehen und wies nur mit der Hand nach dem Castelleingange. Ich folgte dieser Weisung, ging dann an der Wache vorbei, und beabsichtigte, im Innern des Castells irgendwo das Wohnhaus zu erreichen. Da wurde mir aber von der Wache nachgerufen und mimisch bedeutet, wieder das Castell zu verlassen. Ich versuchte, mich nun dem Wachcommandanten, einem Unterofficier, verständlich zu machen, allein meine Bemühungen blieben erfolglos, und so kehrte ich wieder zum Exercierplatze zurück, sah mir die Uebungen an, hoffend, dass mich endlich der Oberst aufsuchen werde. Doch wer nicht kam, war mein guter Oberst, und erst vier Monate später erhielt ich in der Heimat von ihm einen Brief des Inhalts, dass es ihn sehr freuen werde, mich in Himeji empfangen zu können. Es muss also in diesem Falle eine unerklärliche Confusion vorgewaltet haben; Thatsache ist es immerhin, dass ich mit den Anempfehlungen des Militär-Attaché in Wien kein sonderliches Glück in Japan hatte.
Um nun nicht ganz umsonst nach Himeji gekommen zu sein, sah ich längere Zeit hindurch dem Exercieren der Fusstruppen zu, und constatirte dabei, dass dasselbe noch viel exacter und strammer war, als jenes, das ich in Tokio gesehen und beschrieben habe. In Himeji wurden von der Infanterie auch der Marsch auf der Stelle und der Paradeschritt geübt, aber auch hier kam der sehr schwerwiegende Fehler der auffallend kurzen Schritte zum Vorschein. Feuergefechtübungen wurden gar nicht vorgenommen. Beim Einrücken der Truppenabtheilungen, zur Mittagszeit, beorderte ich meinen Rikscha, mich in das von Murray bezeichnete Gasthaus zu führen. Dort angelangt, sah ich weder Gäste noch Küchenvorbereitungen, und als mir gar von der Wirthin zugemuthet wurde, meine Schuhe auszuziehen, da verzichtete ich auf die sehr fragliche Bewirthung, die wohl nichts Ordentliches zum Essen geboten, aber desto sicherer, bei abgelegten Schuhen, eine Erkältung herbeigeführt hätte. Ich steuerte nunmehr dem Bahnhofe zu, und kaufte mir dort von Einem der Leute, welche bei der Durchfahrt der Züge Esswaaren und Getränke feilbieten, jene Sorte von Speisen, welche mir als die geniessbarste erschien, in Gestalt von kleinen Teigleibchen und eine Flasche Bier sammt einer Theeschale, da es keine Gläser gibt. Um nicht einen Wartesaal betreten zu müssen, der in Japan stets schmutzig ist, wo sonst doch Alles so rein gehalten wird, nahm ich mein Mahl auf dem Perron ein.
Um ½2 Uhr Nachmittags ging der Zug von Himeji ab, und um ½4 Uhr war ich wieder in Kobe.
Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, abermals einige Bemerkungen über das Fahren auf der Eisenbahn in Japan zu machen, wenn ich auch theilweise dabei auf das zurückkomme, was ich schon früher hierüber gesagt habe. Es ist unbegreiflich, wie vernachlässigt die Waggons sind, und wie rücksichtslos und ungesittet sich die Japaner auf der Eisenbahn benehmen. Räuspern, Gähnen, überlautes Husten und Brüllen, lautes Lesen, ohrenbetäubendes Singen, Ausziehen der Schuhe, des Rockes u. dgl. m. sind bei den japanischen Passagieren erster Classe an der Tagesordnung.
Die Frachten, welche auf der Bahn befördert werden, sind meist nur in ein sehr gutes und festes Binsengeflecht gewickelt.
Die Häuser auf dem Lande sind theils mit Stroh, theils mit rinnenartig erzeugten Ziegeln gedeckt, haben so wie in der Stadt Holz- oder Lehmwände, sind mit Zäunen umschlossen, haben Schiebethüren und mit Oelpapier verklebte Fenster.
Die Menschen auf dem Lande sind so wie die arme Classe in der Stadt bekleidet, und zwar ohne Kopfbedeckung, mit talarartigen Kleidern, welche die Männer häufig hoch aufgeschürzt haben, ohne Wäsche und an den Füssen Holzsandalen mit Stöckeln. Die Männer tragen oft nur kurze Hosen und gehen meist barfuss.
Bei Regen werden grosse Schirme aus Oelpapier getragen oder statt dessen überdecken sich männliche Arbeiter mit Mänteln, welche aus herabhängendem Stroh erzeugt sind und guten Schutz gegen das Nasswerden gewähren sollen.
In meinem Hôtel in Kobe angelangt, legte ich mein Gepäck zurecht und zahlte meine Hôtelrechnung aus, die für zwei und einen halben Tag sammt Trinkgeldern auf die Summe von 20 Yen = 24 fl. zu stehen kam. Dann verfügte ich den Transport meiner Colli an Bord des Dampfers Marquis Bacquehem und begab mich auch dahin.
Für die Fahrkarte von Kobe nach Colombo, das ist für 25 Tage, hatte ich 100 Goldgulden = 120 fl. ö. W. zu zahlen, und zwar 90 fl. für die Kost und 30 fl. für die Reise; die Begünstigung für Officiere abgerechnet, würde sich der gewöhnliche Preis auf 125 Goldgulden = 150 fl. ö. W. stellen.
Nachdem ich auf dem Dampfer alle meine Sachen in Ordnung gebracht und meine Toilette fertiggestellt hatte, fuhr ich in den Deutschen Club, wo ich mit Herrn C. ein Rendez-vous verabredet hatte, und ging mit ihm in seine Wohnung. Dieselbe nimmt einen ganzen ersten Stock ein, gewährt einen hübschen Blick auf den nahen, von Schiffen belebten Hafen, von welchem frische Luft zuströmt, und ist in allen Einzelheiten reizend hergerichtet. Unter anderen Kunstgegenständen stand auf einem Kamingesimse ein aus Schildkrothorn stilvoll ausgearbeiteter Rikschawagen. Als ich über denselben mein grosses Gefallen äusserte, war Herr C. so liebenswürdig, mir letzteren zu widmen, und als ich dies dankbar ablehnte, brachte er mir selben, gelegentlich der Begleitung auf das Schiff, in meine Cabine. Ich werde ihm hierfür mit Dank das Prachtwerk »Glimpses of India« senden.
Zum Diner bei Herrn C. waren noch die in Kobe wohnhaften Landsleute, sowie ein deutscher und ein russischer Staatsangehöriger eingeladen. Das Essen war ebenso gut als die Conversation unterhaltend, und die ausgebrachten Toaste, deren erster unserem Allergnädigsten Kaiser und König galt, waren ganz dazu angethan, die Stimmung zu erhöhen. Nach dem Diner producirte sich einer der Gäste, Herr v. R., ein gebürtiger Ungar, auf der Zither mit einer Kunstfertigkeit und Virtuosität, wie ich selbe auf diesem Instrumente noch selten gehört habe.
Um 11 Uhr Nachts begleiteten mich sämmtliche Herren auf das Schiff und dort empfing ich sie auf heimatlichem Boden. Noch manche Gläser wurden geleert, noch manche Toaste gesprochen, und bei ihrer Rückfahrt riefen sie mir noch, von ihrem kleinen Steamer aus, die besten Wünsche für eine glückliche Reise zu. Man muss wirklich in das weite, ferne Ausland reisen, um unsere Landsleute, welcher Nationalität sie immer angehören mögen, völlig geeint und in bester Harmonie zusammenleben zu sehen.
Am 30. April, als ich in meiner Cabine erwachte, bemerkte ich, dass wir schon in Bewegung begriffen waren. Ein herrliches Wetter begleitete unsere Fahrt durch das schöne Binnenmeer, welches ich bereits auf der Herfahrt am 1. und 2. April beschrieben habe. An Fahrgästen war ausser mir noch ein Engländer, der Chef der Eisenbahnen auf der Insel Luzon (Manila), welche zur Gruppe der Philippinen-Inseln gehört, auf dem Schiffe, und so konnte ich noch eine zweite Cabine zur Unterbringung meines Gepäckes erhalten.
Der Commandant des Lloyddampfers Marquis Bacquehem ist der Capitän Androvich. Der Dampfer gleicht vollkommen dem Schiffe Marie Valerie, mit welchem ich die Reise von Bombay nach Kobe zurücklegte, und welches ich in einem vorhergehenden Abschnitte zu schildern Gelegenheit hatte.
Anbei folgt ein Verzeichniss sämmtlicher Ausgaben, Einkäufe natürlich nicht miteingerechnet, welche ich während meines 28tägigen Aufenthaltes in Japan gemacht habe, wobei ich hervorheben muss, dass ich stets in den ersten Hôtels abstieg und es mir auch sonst an nichts fehlen liess.
Auslagen in Japan.
Wenn ich nun noch für 8½ Tage in Tokio die Hôtelrechnung sammt Getränke reichlich mit 10 Yen = 12 fl. per Tag berechne, so müsste ich zu meinen Auslagen noch 85 Yen = 102 fl. hinzufügen. In Yokohama, wo ich allerdings auch nicht im Hôtel wohnte, habe ich für grössere Diners so viel ausgegeben, als mein Aufenthalt im Hôtel für 5 Tage gekostet hätte, es ist dies daher zur Bestimmung der allgemeinen Auslagen nicht in Anschlag zu bringen.
Der vollen Klarlegung der Ausgaben halber habe ich noch zu bemerken, dass ich durch Geldwechslung und die Berechnung des bei der Chartered Bank of India, China and Japan behobenen Geldes einen Abzug von 30 Yen = 36 fl. erlitten habe. Es stellen sich daher meine Auslagen auf 333 Yen 50 Cent = 400 fl. 20 kr., und wenn ich die mir erspart gebliebene Hôtelrechnung in Tokio dazu rechne, so hätten sich die Gesammtauslagen für 28 in Japan verlebte Tage auf rund 500 fl. belaufen.
Am 1. Mai langten wir in der Gegend von Shimonoseki und Moyi an, landeten aber bei Moyi, weil der Dampfer dort 500 t Kohlen zum eigenen Gebrauche und 500 t Reis zur Verfrachtung aufnehmen wollte.
Ich fuhr mit dem Schiffsarzte auf der Dampfbarkasse des Lloydagenten nach Shimonoseki, um diesen kleinen Ort zu besichtigen.
Nach meiner Rückkehr zum Schiffe sah ich zeitweise der Einladung von Kohle und Reis zu. Die anhaltende Arbeitskraft und die Geschicklichkeit der Japaner ist hierbei staunenerregend. Das Einladen der Kohle erfolgt korbweise durch eine von Männern und einigen Frauen gebildete Kette. Die Kohle ist recht schlecht, verflüchtigt mit dem Rauche und hinterlässt viel Rückstand; allein sie ist auch ausserordentlich billig, was der fabelhaft billigen Arbeitskraft in Japan zuzuschreiben ist. Der Reis wird in Säcken mit Krahnen aus den kleinen Frachtschiffen in die unteren Räume des Dampfschiffes gebracht. Der japanische Reis gehört einer so kleinen Gattung an, wie selbe in Europa nicht vorkommt.
Am 2. Mai verliess ich das Land, in welchem ich einen Monat zubrachte. Die Temperaturverhältnisse in Kobe habe ich bereits besprochen; was den weiteren Verlauf derselben betrifft, so kann ich dieselben als recht erträgliche und angenehme bezeichnen.
Zum Schlusse meines Aufenthaltes in Japan sei es mir gestattet, noch einigen Beobachtungen, die ich gemacht, und manchen in mir aufgenommenen Eindrücken, die ich noch nicht besprach, Ausdruck zu verleihen.
Vorerst will ich von der seit Tausenden von Jahren bei den Japanern bestehenden Religion sprechen, weil diese die Grundbasis bildet für den Charakter, die Lebensanschauungen und die staatlichen Einrichtungen der Japaner.
Dass die Japaner Heiden sind, ist wohl bekannt, indess dürfte weniger bekannt sein, dass ihre Lehren auf drei verschiedenen Grundlagen beruhen, und dass sie Anhänger entweder des Confucius oder des Schinto, oder des Buddha sind.
Die Confucius-Lehre ist keine Religion in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, sondern sie ist eine Aneinanderreihung von Gesetzen und Vorschriften, deren oberster Grundsatz in der Achtung vor der väterlichen Gewalt besteht. Confucius hat keine Träger seiner Lehren eingesetzt und so gibt es auch keine Confucius-Priester.
Die Shinto-Lehre fordert die Anbetung und Respectirung der Götter, das sind die Naturkräfte, die Berge und Flüsse, die Sonne und der Mond, und schreibt das Anflehen der Winde vor, damit dieselben die Gebete den Göttern überbringen. Seiner Anschauung nach stammt der Mikado von einem Gott ab und ist selbst ein Gott; es gebührt ihm daher die höchste Verehrung. Ausserdem fordert die Shinto-Religion Gehorsam gegen die Obrigkeit und gegen die Eltern, Höflichkeit gegen Gleichgestellte und Tapferkeit bis zur Todesverachtung. Weiters lehrt die Religion, dass die Seelen der Menschen nach dem Tode in Thierkörper, mit Ausnahme jener der Fische, wandern, und daraus ergibt es sich, dass die Japaner, welche der Lehre des Shinto folgen, nur das Fleisch der Fische geniessen. Endlich empfiehlt Shinto den Ahnencultus an, und so wird denn auch in jeder Familie ein Vorfahre als Familiengott angesehen. Die Priester der Shinto-Lehre sind arm und leben nur von den Opfern, welche die Betenden den Göttern spenden. Seit Kurzem jedoch erhalten dieselben auch vom Staate eine Bezahlung, weil ihre Glaubenslehren in jüngster Zeit vom Mikado sehr gefördert werden. Die Priester haben ganz rasirte Köpfe und tragen lange, weisse Gewänder, Sandalen und im Gürtel oder in der Hand eine Art von Rosenkranz, sowie bei ihren Tempel-Functionen eine Art von Scapulier.
Die Buddha-Lehre gebietet die Anbetung der Götter, das sind meist fabelhafte Personen, und die Entsagung von jeder Leidenschaft, und stellt als höchstes Lebensziel das immer tiefere Eindringen in die Wissenschaft hin. Die Buddha-Anhänger führten nach und nach die schöne Ausschmückung der Tempel, die Verfertigung von Heiligenbildern und die Anwendung von Weihrauch und Musik bei den religiösen Ceremonien ein. Die Priester dieser Lehre sind durch Schenkungen vermögend geworden, kleiden sich ähnlich wie die Shinto-Priester, werden aber bis zum heutigen Tage nicht vom Staate bezahlt. Diese Lehre wurde etwa 800 Jahre n. Chr. von China nach Japan gebracht. Die schönen grossen Tempel in Japan sind zumeist Buddha-Tempel.
Die Japaner nehmen es mit ihren Göttern sehr leicht; sie gehen bald in einen Buddha-, bald in einen Shinto-Tempel, rufen hier den einen, dort den andern Gott an, und fühlen sich dann ganz befriedigt. Wenn sie ihre Götter anbeten oder anflehen wollen, so läuten sie zuerst in dem betreffenden Tempel, schlagen in die Hände, um die Aufmerksamkeit des Gottes auf sich zu lenken, falten die Hände, beten, reiben dann die Hände aneinander, und werfen schliesslich mehrere Kupfermünzen (Zehntel Centstücke = ⅛ kr.) auf den Tempelboden vor dem angerufenen Gott; hierauf ziehen sie ihrer Wege weiter.
Die Ehen werden in Japan sehr einfach, ohne Tempelweihe, und nur mit Zustimmung der Eltern geschlossen, und erst später im Gemeindeamte, behufs Eintragung in die Matrikelbücher, bekannt gegeben. Die Ehefrau nimmt im Hause die Stellung der ersten Magd ein. Die Scheidung der Ehe geht ebenfalls leicht von statten, kommt aber sehr selten vor, wie überhaupt sogenannte »unglückliche Ehen« bei der leichten Lebensauffassung und der angeborenen Gutmüthigkeit der Japaner zu den äussersten Ausnahmen gehören. Es soll sich sogar ereignen, dass die Ehefrau, deren Mann zu häufig die Theehäuser besucht und Geld verschwendet, ein hübsches Mädchen in das Haus nimmt, um dadurch ihren Mann an das Haus zu fesseln. Die von den Seitenfrauen geborenen Kinder werden stets mit den legitimen Kindern gleichmässig erzogen. Eifersüchteleien gehören zu den Seltenheiten. Das japanische Empfinden ist eben ein ganz anderes als das unserige.
Was die Begräbnisse anbelangt, so sind dieselben nach der Shinto-Lehre ganz einfach, nach dem Buddhaismus aber mit Feierlichkeiten verbunden, und dies ist der Grund, dass die meisten Japaner nach dem Buddha-Ritus beerdigt werden.
Der Familiensinn ist in Japan sehr stark entwickelt. Wie die Kinder ihren Eltern unbedingte Unterwürfigkeit schulden, so sind andererseits die Eltern für ihre Kinder sehr besorgt; sie sind sehr geduldig mit ihnen und lieben dieselben in ihrer Weise. So z. B. nehmen die Eltern ihre Kinder, selbst die ganz kleinen, zu allen Ausflügen und in das Theater mit sich, und bleiben dort oft halbe oder auch ganze Tage lang vereint sitzen, wozu sie die Lebensmittel vom Hause aus mitbringen. Die Kinder sind verpflichtet, für ihre alt und erwerbsunfähig werdenden Eltern zu sorgen und dieselben liebreich zu erhalten, eine Pflicht, welche von den japanischen Kindern durchwegs erfüllt wird. Der japanische Arbeiter oder Kleinbürger denkt daher nie an ein Sparen für sein Alter, sondern sieht seine Kinder als das Capital an, von welchem er im Alter leben wird. Darin ist auch der Grund zu suchen, dass in Japan die Adoption von Kindern zur Landessitte geworden ist.
Der Unterricht in Japan ist nach der Zeitdauer ein sehr weit ausgedehnter. Der erste Unterricht in der unteren Volksschule währt vier Jahre und ebensolange in der oberen Volksschule; daran schliessen sich vier Jahre untere und vier Jahre obere Mittelschule und endlich vier Jahre Hochschule. Es sind also 20 Jahre an Schulen durchzumachen, und da der Schulbesuch mit dem Alter von sechs Jahren zu beginnen hat, so kann ein Japaner, welcher sämmtliche Schulen absolviren will, nicht vor dem 27. Jahre die Schulbank verlassen. Hierbei muss noch bemerkt werden, dass die volle Kenntniss der japanischen Sprache sehr viel Zeit und sehr viel Fleiss in Anspruch nimmt. Die Schüler der Mittel- und Hochschulen sind uniformirt.
Die Wohnungen der Japaner werden, wie ich bereits mitgetheilt habe, durchwegs sehr leicht gebaut und besitzen keine Heizvorrichtungen. Es ist daher natürlich, dass dieselben bei der in Japan im Winter vorherrschenden tiefen Temperatur recht kalt sind. Diese Kälte vertragen aber die Japaner sehr gut, da sie abgehärtet sind; sie ziehen dann nur etwas wärmere Kleider an, und bedienen sich zur Erwärmung der Hände eines irdenen Topfes, welcher mit glühenden Kohlen gefüllt ist und in die Mitte des Zimmers gestellt wird.
Den Volkscharakter der Japaner kann man in Bezug auf seine guten und schlechten Eigenschaften in nachstehender Weise resumiren.
Die guten Eigenschaften der Japaner sind: patriarchalisches Wesen, Verehrung des Monarchen, Ehrfurcht vor den Eltern, Gehorsam gegen die Obrigkeit, Höflichkeit gegen die Mitmenschen, Reinlichkeit des Körpers, Nettigkeit der Kleidung und Wohnung, heiteres Temperament, Neugierde, Nachahmungsgabe, Geschicklichkeit, Abhärtung, Unverdrossenheit und Tapferkeit. Ihre schlechten Eigenschaften dagegen wurzeln in ihrer Moral und Sitte. So nehmen die Japaner oft keinen Anstand, die Rechtlichkeit ihrem Vortheile zu opfern, und sie besitzen überhaupt des Oefteren keine strengen Rechtsbegriffe, ein Mangel, welcher für den Handel sehr nachtheilig ist. Dann haben viele Japaner nur sehr lockere Anschauungen von Sittsamkeit und von Decenz. Wie tiefstehend diese Begriffe sind, zeigt sich, wie wir schon erfahren haben, darin, dass sich ältere Studenten, ja oft sogar Officiere ihre Bräute aus öffentlichen Häusern nehmen. Ueber das unartige und ungesittete Betragen von Japanern selbst aus der besseren Classe habe ich gelegentlich der Beschreibung meiner Eisenbahnfahrten schon Erwähnung gethan.
Wenn ich nun einen Rückblick auf meinen Aufenthalt in Japan werfe, so sehe ich mit Befriedigung auf die vielen, dort verlebten vergnügten Stunden, sowie auf die zahlreichen Eindrücke zurück, welche das Sehen von so mannigfachem Neuen und Interessanten in mir hinterlassen haben. Sehr leid thut es mir, dass ich aus Mangel an Zeit nicht dazu kam, die beiden Orte Miyanashitta und Nikko besuchen zu können.
Miyanashitta liegt östlich des höchsten Berges Fugyi und ist von der Station Közu der Eisenbahnlinie Kioto - Yokohama aus zu erreichen. Von Közu aus fährt man mit Rikscha oder Wagen in 2½ bis 3 Stunden dahin. Dort bietet, wie mir von verlässlicher Seite mitgetheilt wurde, das Hôtel Fuji-ya eine vorzügliche Unterkunft und sehr gute Bäder. Von Miyanashitta aus kann man nach allen Richtungen hin die lohnendsten Ausflüge machen, bei welchen sich wundervolle Fernblicke eröffnen.
Nikko liegt im Norden von Tokio und gelangt man von hier mit der Eisenbahn in fünf Stunden nach diesem Ort, der sich durch seine Naturschönheit in Japan dieselbe Berühmtheit wie Neapel in Europa erworben hat. Berge und Thäler, Wälder und Wasserfälle, sowie auch Monumente, Mausoleen mit Holzschnitzereien und Malereien, und die schönsten Tempelaltäre von Japan sind dort zu sehen. Viele schöne Villen der reichen und vornehmen Einheimischen schmücken die Gegend, von wo man allenthalben die herrlichsten Aussichten geniessen soll. Für das leibliche Wohl sorgen bestens das Kanaya- und das Nikko- oder Arai-Hôtel. Der Japaner sagt: Erst wer Nikko gesehen hat, weiss, was Pracht ist.
Miyanashitta hätte ich durch Unterbrechung meiner Reise von Kioto nach Yokohama in Közu erreichen können, doch wären zu diesem Ausfluge mindestens vier Tage nothwendig gewesen, und über so viel Zeit verfügte ich nicht nach meinem einmal fertiggestellten Reiseplane. Eine Excursion nach Nikko hätte von Tokio aus nur drei Tage in Anspruch genommen, doch habe ich in der japanischen Hauptstadt, aus schon besprochenen Gründen, viele Zeit unbenützt verlaufen lassen müssen.
Schliesslich soll hier noch eine Handelsfrage erörtert werden. Ich überlegte mir nämlich in sehr eingehender Weise, für welche Artikel aus unserer Monarchie ein gewinnreiches Absatzgebiet in Japan gefunden werden könnte, und liess mich hierbei von nachstehenden Erwägungen leiten. Der Japaner besitzt Fleiss, Geschicklichkeit und Nachahmungsgabe, und bei seiner grossen Mässigkeit erzeugt er seine Arbeiten weit billiger, als wir dies zu leisten im Stande sind. Er besitzt aber im grossen Allgemeinen keine geistige Schaffungskraft.
Es müssen also nach Japan solche Artikel in den Handel gebracht werden, welche unserer Intelligenz entspringen, welche die den Japanern eigenthümliche Neugierde anregen, die nicht theuer sind, und bei bescheidenen Mitteln den Ankauf gestatten. Zu solchen Artikeln zähle ich alle kleineren Erzeugnisse der Mechanik, Physik, Elektricität und Chemie, wie man dieselben bei uns so vielfältig antrifft und deren Herstellung auch weiter ausgedehnt werden könnte.
Auch die Einfuhr von Hengsten, welche zur Verbesserung der Pferdezucht in Japan geeignet und dort wirklich sehr nöthig sind, dürfte den Vermittlern lohnenden Gewinn abwerfen.
Inwieweit derartige commerzielle Unternehmungen begründete Aussicht auf Erfolg bieten, und wie dieselben durchzuführen wären, darüber müsste allerdings noch vorher eine genaue Enquête einberufen werden.
Am 2. Mai Vormittag fuhr ich, wie schon erwähnt, auf dem Dampfer Marquis Bacquehem bei schlechtem Wetter von Shimonoseki in westsüdwestlicher Richtung ab. Nachmittags entschwand die Küste Japans meinen Augen, und als ob auch die Natur hierzu ihren Abschluss geben wollte, entlud sich gleich darauf ein schweres Gewitter. Der Sturm peitschte das Meer derart, dass die Wogen sich hoch aufbäumten und im Zerschellen an des Dampfers Flanken die schäumende Gischt auf das Deck schleuderten; der Himmel war von stahlgrauen Wolken umdüstert, leuchtende Blitze zuckten umher und grollende Donner, sich zeitweise bis zum Kanonenknall steigernd, durchdröhnten die Luft. Ein grossartiges, gewaltiges Schauspiel.
Unser Lloyddampfer glitt aber verhältnissmässig ruhig, den Wellen nachgebend, in der vorgezeichneten Richtung weiter. Wohl machte unser Bacquehem bei diesem Nachgeben auch schaukelnde Bewegungen, doch waren diese weitaus nicht so stark, als jene auf dem Dampfer der Messagerie bei viel ruhigerem Wetter während der Fahrt von Yokohama nach Kobe.
Am 3. Mai trat bei umdüstertem Himmel wieder stilles Wetter ein, weshalb ich meine Lebensweise abermals dem Schiffsgebrauche gemäss einrichtete. Zur Morgentoilette gehörte das Wannenbad in dem 20 bis 22° warmen Meerwasser, und um 7½ oder 8 Uhr nahm ich nach altgewohnter Sitte einen Kaffee. In der Zeit bis zum zweiten Frühstück (Breakfast) bezeichnete ich auf meiner Karte die vom Dampfer zurückgelegte Strecke, wozu ich die Ausweise benützte, in welche ein Schiffsofficier täglich den um 12 Uhr Mittag erreichten Punkt und die eingehaltene Richtung eintrug; dann machte ich die sich daran fügenden geographischen Ueberlegungen und endlich auch die Notizen über die Erlebnisse des vorhergegangenen Tages.
Gemäss unserer Fahrtrichtung nach Westen muss die Uhr täglich zurückgestellt werden, das heisst, dass jetzt der Tag mehr als 24 Stunden währen wird, wogegen bei der Reise von Europa nach Japan der verkehrte Fall bestanden hatte.
Die Fahrtgeschwindigkeit des Lloyddampfers ist nicht gross, es werden von demselben stündlich im Durchschnitt 10 bis 11 Seemeilen oder 18 bis 20 km zurückgelegt.
Nach dem Breakfast setze ich mein Tagebuch über Japan fort, wozu mir einerseits die gemachten Vormerkungen und andererseits die geistige Versetzung in die entsprechenden Zeitmomente das Material liefern. Diese Beschäftigung, hie und da durch Spaziergänge auf dem Deck unterbrochen, währt bis zu dem um 1 Uhr Mittag stattfindenden dritten Frühstück (Tiffin). Ich habe schon gelegentlich der Reise nach Japan die Erfahrung gemacht, dass ich auf hoher See nicht mehr Mahlzeiten nehmen kann, als ich es seit jeher gewohnt bin, und demnach habe ich diesmal kein Tiffin gegessen, sondern diese Zeit zum Spaziergang oder zur Lectüre benützt.
Nach dem Tiffin nahm ich wieder das Tagebuchschreiben auf und betheiligte mich an dem auf diesem Dampfer eingeführten Spiele, welches darin besteht, einen Reifen aus Stricken in einen Kreis zu werfen.
Um 6 Uhr Abends findet das Diner statt. Vor demselben mache ich Toilette und nach demselben gibt es Conversation, Lectüre, hie und da Karten- oder Schachspiel u. s. w.
Während des Tages und auch am Abend erfreue ich mich oft an dem Ausblick auf das weite Meer und auf das scheinbar am Horizont in das Wasser tauchende Firmament. Abends kommt es vor, dass auf dem Schaume der Meereswellen, welcher durch das Eindringen des Schiffes in die Fluthen erzeugt wird, sich elektrische Funken erzeugen und diese schöne Erscheinung manchmal sehr intensiv wird.
Meistens ging ich schon um ½10 Uhr zur Ruhe.
Am 4. Mai war ganz klares, etwas windiges und daher frisches Wetter eingetreten. Diesen Tag benützte ich hauptsächlich zur Controlirung und Aufnahme aller der bis jetzt eingekauften Gegenstände, eine recht ermüdende und zeitraubende Arbeit.
Seit diesem Morgen hielten sich drei Vögel auf unserem Schiffe auf, indem sie dasselbe entweder begleiteten oder sich auf dasselbe setzten. Diese Vögel glichen in Gestalt und Farbe unseren Wildtauben, waren aber etwas grösser, und hatten so lange Schnäbel wie unsere Schnepfen, doch waren die Schnäbel stärker und mehr nach abwärts gebogen, und endlich besassen sie lange Ständer ohne Schwimmhaut. Mit einer Flaubertbüchse wurde nach denselben geschossen, ein Vogel getödtet und zwei verwundet. Ihre Gattung konnte Niemand auf dem Schiffe bestimmen.
Am 5. Mai begann die Temperatur schon empfindlich warm zu werden und das Meerwasser hatte 22° R. erreicht.
Ich bekam die Küste Asiens, und zwar jene von China zu Gesicht, und wusste, dass sich auf der anderen Seite unserer Fahrtlinie die Insel Formosa befinde. Diese Insel ist seit dem letzten japanisch-chinesischen Kriege Japans Eigenthum. Diese Errungenschaft ihres glücklichen Feldzuges macht den Japanern manche Sorge. Wohl soll die Insel reich an Erzen und auch an Edelsteinen sein, aber sie besitzt keinen Hafen, und der Bau eines solchen, welcher für den Handel unbedingt nöthig ist, kostet ungeheuer viel. Ausserdem halten sich in den Klüften des von Norden gegen Süden sich hinziehenden Gebirges, dessen höchste Spitze, der Monte Morrison, 13.000 Fuss hoch ist, noch wilde Menschenstämme auf, die den Genuss des Menschenfleisches lieben. Bisher konnten die Japaner ihrer nicht Herr werden.
Den 6. Mai benützte ich zur sorgsamen Verpackung der gekauften Gegenstände, dann auch zur Scheidung des Gepäckes in jenes, welches ich mit mir nehmen, und in jenes, welches ich seines Volumens, seines Gewichtes oder dessen gegenwärtiger Entbehrlichkeit halber auf dem Dampfer Marquis Bacquehem belassen und als Fracht an ihre Bestimmung senden lassen will.
Gegen Abend sahen wir schon viele kleine Segelschiffe, in welchen die am Ufer wohnenden Fischer zum Fischfang ausgefahren waren, dann auch hie und da einen Leuchtthurm als Wahrzeichen für die Schiffe, und hiermit wussten wir, dass wir uns schon nahe dem Hafen von Hongkong befinden.
Am 7. Mai (Sonntag) Morgens langten wir im Hafen von Hongkong an. Ich fuhr in die Stadt, besuchte dort den Consul, Linienschiffslieutenant K., und besprach mit ihm die bei dem vorhergegangenen Aufenthalt in Hongkong für diesmal in Aussicht genommene Fahrt nach der grossen, vollständig chinesischen Stadt Kanton. Diese Stadt hat gegen zwei Millionen Einwohner und bietet das wahre Bild des echt chinesischen Lebens mit engen Strassen und unbeschreiblichem Schmutz, und hat noch die besondere Eigenthümlichkeit, dass anschliessend an die Stadt auf dem Lande eine Stadt auf dem Wasser besteht, wo auf tausenden kleinen Schiffen mit elenden Hütten chinesische Familien ihr ganzes Leben verbringen. Auf diesen Schiffen werden die Kinder geboren, dort wachsen sie heran, dort lieben sie und vermehren sich und dort sterben sie. Ausserdem befinden sich auf dem Wasser sogenannte Blumenschiffe, welche dazu eingerichtet sind, dort glänzende Mahlzeiten zu nehmen, wobei neben jeden Gast ein hübsches chinesisches Mädchen gesetzt wird, welches derselbe aber nur anschauen darf. Für solche Mahlzeiten sind indess ausserordentlich hohe Preise zu zahlen. Zu diesem Ausfluge wäre Sonntag Abends mit dem Dampfschiffe hinzufahren, am Montag die Besichtigung von Kanton vorzunehmen und am Montag Abends die Rückfahrt anzutreten gewesen, wonach dann das Eintreffen auf dem Dampfschiffe Marquis Bacquehem am Dienstag Früh erfolgt wäre.
Auf das Dampfschiff zur Tiffinzeit zurückgekehrt, erfuhr ich aber von dem Lloydagenten, dass diese Unternehmung ohne irgend eine besondere Unterhaltung, natürlich auch ohne Besuch eines Blumenschiffes, wenigstens 50 Dollars = 60 fl. ö. W. kosten würde. In Folge dieser Aufklärung habe ich den Ausflug aufgegeben, denn mir war noch in Erinnerung, was für einen Ekel mir der chinesische Stadttheil von Shanghai verursacht hatte, und ich empfand keine Lust, für die Erweckung eines ähnlichen Gefühles einen so namhaften Betrag auszugeben.
Unmittelbar nach dem Tiffin besuchte ich den Commandanten des eben in Hongkong weilenden österreichisch-ungarischen Kriegsschiffes Saida. Dieses Kriegsschiff ist schon seit acht Monaten auf der Reise, war durch das Rothe Meer längs der Ostküste von Afrika, dann nach Australien gefahren, hatte sich an vielen Orten aufgehalten und erwartete nun den Befehl für seine weitere Bestimmung. Der Commandant, Linienschiffscapitän C., war sehr liebenswürdig und erzählte mir bei einem Glase Champagner sehr interessante Erlebnisse von seiner Weltreise. Am meisten erregte meine Aufmerksamkeit die Mittheilung über die seit wenig Jahren eröffneten Goldfelder von Südwestaustralien, wohin der Linienschiffscapitän von dem Hafen bei Perth aus zur Besichtigung derselben gefahren war. Die Goldfelder befinden sich 500-600 km östlich des genannten Hafens, dann nördlich des dort liegenden Lefroy-Sees, und diese Gegend ist Coolradie benannt. Eine Eisenbahn dahin führt durch wüstenartiges Land, in welchem nur Gras in Buschform wächst, wo es kein Süsswasser gibt und man gleich unter der Erdoberfläche auf Salzwasser gelangt. Auch die dortigen Landseen enthalten nur Salzwasser.
Vor acht Jahren wurden die Goldfelder entdeckt und jetzt leben dort etwa 50.000 Menschen. Der Grund und Boden ist sehr billig. Er wird von der australischen Regierung um fl. 6 per Ar verkauft. Der Besitzer kann dort nachgraben und aushauen und das dort gefundene Metall gehört ihm. Die ganze Arbeit bis zum Erhalt des reinen Goldes ist aber sehr schwer und anstrengend, und deshalb kann ein einzelner Arbeiter in der Woche nicht mehr als etwa 50 fl. Gold gewinnen. Wenn aber bedacht wird, dass der Arbeiter, um nur einigermassen entsprechend zu leben, für den Tag 5 fl. braucht (ein Liter Wasser kostet 5-10 kr.), so bleibt ihm für seine Mühe und Plage ein nur sehr geringer Gewinn in Händen. Jetzt haben sich dort grosse Actiengesellschaften gebildet, welche sich vorzügliche, aber sehr theuere Maschinen angeschafft, damit aber schon so viel gewonnen haben, und auf einen noch viel grösseren Gewinn rechnen, dass sie nun daran gehen, eine Süsswasserleitung aus der Gegend von Perth nach Coolradie mit den Baukosten von etwa zehn Millionen Gulden zu erbauen.
Der Linienschiffscapitän hatte die Güte, mir einen von diesen Goldfeldern stammenden Goldstein und ein diese Gegend beschreibendes Heft zu schenken, und ich werde diese beiden sehr interessanten Gegenstände dem Landesmuseum in Klagenfurt widmen.
Bei dem einige Stunden später erfolgten Gegenbesuch des Linienschiffscapitäns wurden die staatlichen Verhältnisse von Australien besprochen, und theile ich Nachstehendes von denselben mit. Dass Australien beinahe ausschliesslich von Engländern bewohnt wird, ist bekannt. Das ganze Land ist in fünf von einander ganz unabhängige Staaten getheilt und deren Präsidenten, sowie deren oberste Gerichtsbeamten werden von der Königin von Grossbritannien ernannt. Die Minister dieser Präsidenten, sowie die Abgeordneten in jedem Staate werden von der Bevölkerung gewählt, bleiben aber je nach dem Staate nur vier bis sechs Jahre in ihrem Amte und sind dann nicht wieder wählbar. Dieses Gesetz wird aber hie und da in der Weise umgangen, dass ein Minister vor dem Ablaufe seiner Frist demissionirt und sich dann wieder auf die festgesetzte Zeit zum Minister wählen lässt.
Am Abend besuchte ich mit dem Arzte des Dampfschiffes das chinesische Theater in Hongkong und sah dort eine ähnliche Vorstellung, wie jene in Shanghai, von welcher ich seinerzeit erzählt habe.
Von dort ging ich mit dem Arzte in ein Theehaus, blieb aber dort des abscheulichen Schmutzes und der greulichen Musik halber nur kurze Zeit, und übernachtete in einem Hôtel, weil es wegen des hohen Seeganges nicht rathsam war, in der Nacht auf einem kleinen Kahn zum Dampfer zurück zu fahren.
Am 8. Mai wurde, soweit es das unbeständige Wetter gestattete, die Verladung auf das Schiff vorgenommen; dabei befanden sich viele Colli aus Manila mit Tabak-Deckblättern für unsere Tabakfabriken.
Am 9. Mai machte mir der Consul, Linienschiffscapitän K., einen Besuch und klagte bei dieser Gelegenheit darüber, dass so wenige Einwohner von Oesterreich-Ungarn nach Asien, speciell in die Hafenplätze von China kommen, um hier Geschäfte zu machen, wo es doch erfahrungsgemäss sichergestellt ist, dass jeder sich in Hongkong etablirende Kaufmann nach 20-30 Jahren ein Vermögen erworben hat. Diese Erkenntniss befestigte meine schon öfter ausgesprochene Anschauung, dass sich die nach Asien ziehenden reellen Handelsleute dort einen bedeutenden Verdienst erwerben können.
Mit dem Consul fuhr ich dann nach Hongkong, um diese Stadt noch einmal zu besichtigen. Wenn ich Hongkong auch schon beschrieben habe, so will ich doch noch den Eindruck erwähnen, welchen diese Stadt bei jedesmaligem Besuche macht. Sie ist eine überaus reiche Handelsstadt mit grossartigen Gebäuden am Hafen, mit sehr vielen prachtvollen Villen an den Lehnen der hinter der Stadt aufsteigenden Berge und mit einem äusserst lebhaften Getriebe auf dem Strande und in den Gassen. Dazwischen bewegen sich Chinesen mit langen Stangen auf dem Rücken, welche beiderseits mit unglaublich schwer wiegenden Waaren belastet sind; dann sieht man dort die Chinesinnen auf ihren verkrüppelten, kleinen Füssen, wie auf Stelzen gehend, daherhumpeln, und endlich gewahrt man auch Albions Söhne von Bureau zu Bureau, von Bank zu Bank wandern und den Reichthum der die Stadt umgebenden chinesischen Provinzen einheimsen.
Auf den Dampfer zurückgekehrt, sah ich, dass einstweilen 600 bis 700 Chinesen eingeschifft worden waren, welche theils nach Singapore, theils nach Penang transportirt werden sollten, um dort für wenig Geld grosse, schwere Arbeit zu verrichten.
Diese Chinesen reisen familienweise, mit ihren kleinen, ja mit neugeborenen Kindern, und sind ungeachtet dessen, dass sie wissen, sich nur einen sehr bescheidenen Unterhalt verschaffen zu können, dennoch stets guter Dinge, heiter und gutwillig. Dieselben waren theils auf dem Deck, theils im Zwischendeck untergebracht, und zwar so dicht, dass sie nur wenig Bewegungsfreiheit hatten. Ueber ihre Bekleidung habe ich wiederholt geschrieben. Nun will ich nur noch mittheilen, dass die Männer, wenn es heiss wird, ihre Kleider ausziehen und nur in kurzen, schwimmhosenartigen Beinkleidern verbleiben, so dass man dann dort so viel Menschenhaut sieht und auch solchen Duft riecht, wie vermuthlich im Leben noch nie vorher.
Zu den Cabinenpassagieren war ein in Hongkong lebender italienischer Musikmeister mit seiner Frau gekommen. Diese Frau war ein Mischling von einem Engländer und einer Chinesin. Sie war gross und schlank, hatte etwas braune Gesichtsfarbe und schwarzes Haar. Ihre Sprache war die englische. Mischlinge werden von den Engländern nicht beachtet, und es wird nie vorkommen, dass ein Engländer mit einem Mischling verkehrt, oder dass Mischlinge in irgend eine englische Gesellschaft zugelassen werden, sowie auch kein Einheimischer je in einen englischen Club Zutritt hat.
Schon um 4 Uhr Nachmittags war die Verladung auf unseren Dampfer vollendet und um 5 Uhr Nachmittags hätte die Weiterfahrt beginnen sollen. Da aber der Lloydagent von Hongkong noch nicht angelangt war, um dem Schiffscapitän die vor der Abfahrt nöthigen Papiere zu übergeben, so sandte derselbe den zweiten Capitän zum Agenten, um denselben zu ersuchen, diese Papiere gleich zu bringen, damit das Schiff abfahren könne. Dies war aber umsonst. Der Agent kam erst um 8 Uhr Abends mit den Papieren, und da war es nach den in Hongkong bestehenden Hafengesetzen schon zu spät, um aus dem Hafen auszulaufen. Der Dampfer konnte hiermit erst am folgenden Morgen weiterfahren. Diese Verzögerung des Agenten zog daher eine solche von einem halben Tag für den Dampfer nach sich, ein Umstand, welcher sowohl die Interessen der Lloydgesellschaft, als auch jene der Passagiere verletzte. Für die Lloydgesellschaft fällt es auch in's Gewicht, dass sie wegen dieser Verzögerung die 600-700 Chinesen um einen halben Tag mehr als nöthig verpflegen muss. Es hat die Agentur in Hongkong auch die Abfahrt des Lloyddampfers Marie Valerie am 23. März verzögert, und es scheint demnach, dass dort eine Saumseligkeit zu Ungunsten der Lloydgesellschaft herrscht. Meiner Ansicht nach sollten die Lloydagenturen, welche aus ihrer Stellung ohnehin einen grossen Vortheil und Profit ziehen, das Wohl ihrer Gesellschaft besser im Auge behalten.
Am 10. Mai, zeitlich Früh, fuhren wir von Hongkong ab, gegen Singapore. Im Osten der Fahrtlinie befanden sich die Philippinen-Inseln Luzon, Mindsop, Negros u. s. w., welche noch immer im Kriege stehen, um nun »ihre Befreier vom spanischen Joche« abzuwehren. Viele dort einheimische Familien sind schon ausgewandert und viele wandern noch aus; die Landwirthschaft, sowie der Handel liegen brach, und so ist nun das von der Natur so reich gesegnete Land ganz verarmt. Das sind die Resultate der sogenannten Volksbeglücker und die Folgen von Staatsumwälzungen.
Am 11. Mai hatten wir schon zeitlich Früh eine sehr drückende Hitze zu ertragen. Es war dies der Vortag der in unserem Heimatlande gefürchteten Eistage. Wieder haben sich bei unserem Schiffe ein Paar Vögel eingefunden, welche von China zu uns kamen und nun der Entfernung halber nicht mehr zum Festlande zurückfliegen konnten. Es sind Singvögel mittlerer Grösse mit grauem Kopfe, dunklen Flügeln, schwarzweissem, langem Stoss und gelber Brust.
Auch muss ich eine neue Frucht anführen, welche uns bei dem Diner auf dem Lloydschiffe vorgesetzt wurde. Sie heisst Laitshi, ist eine braune Baumfrucht in der Grösse der Kastanie, umschliesst im Innern einen kleinen, festen Kern und hat innerhalb der leichtbrüchigen Rinde eine lichte, fleischige Masse, welche einen angenehmen, etwas süsslichen Geschmack hat.
Am 12. Mai. Unsere Fahrt geht langsam vorwärts. Wir machen kaum 10 Seemeilen = 18·5 km in der Stunde. Dies ist für mich recht verdriesslich, weil ich dadurch später nach Colombo gelangen werde und mich somit auf der herrlichen Insel Ceylon nicht lange werde aufhalten können. Ich habe nämlich, wie schon erwähnt, den Plan gefasst, von Colombo mit dem am 1. Juni von dort nach Port Said u. s. w. gehenden Dampfschiffe der Messagerie maritime nach diesem Ort zu fahren, weil ich dadurch dem zwischen 10. und 15. Juni im Indischen Ocean beginnenden Monsum entgehe. Die Stürme und der hohe Seegang während des Monsums sind wohl nicht so schwerwiegend, aber entsetzlich ist es, dass während der Monsumzeit der unaufhörlich dicht fallende Regen und die dadurch erzeugte nasse Luft bis in die Cabinen des Schiffes eindringt, dort die Kleider, die Wäsche, das Bettzeug u. s. w. durchfeuchtet, und dass man während dieser Zeit nicht ein Stück trocken erhalten kann. Abgesehen von dieser Unannehmlichkeit, entsteht dadurch auch das Verderben der in den Koffern verpackten Stoffe, ein Umstand, welcher mir vornehmlich wegen der gekauften Seidenwaaren sehr peinlich sein würde.
13. Mai. Seit zwei Tagen haben wir auf dem Schiffe eine Temperatur von mehr als 25° R. Wohl wurde diese Hitze durch zeitweilig eintretende Gewitter momentan etwas vermindert, doch leider nur für kurze Zeit, und bald darauf herrschte wieder die frühere Hitze. Das italienische Ehepaar ist wenig seetüchtig und erkrankte, wenn auch nur leicht, in Folge des Gewittersturmes, respective der dadurch erzeugten Schiffschwankungen.
Am 14. Mai (Sonntag) war das Wetter ruhig, leicht bewölkt und die Temperatur auf 23° R. herabgesunken. Ich befand mich demnach während des Tages sehr wohl, aber die Nacht in der Cabine war dennoch schwül, und so geht es in den Nächten ohne Schwitzbad nicht ab. Man gewöhnt sich aber daran und schlaft dennoch sehr gut.
Am 15. Mai machte ich an mir die Erfahrung, dass die Erhaltung der Gesundheit es erfordert, während des Tages unter der Wäsche ein Wolleibchen und eine Wollbinde zu tragen, denn als ich vor zwei Tagen der grossen Hitze halber diese weggegeben hatte und nur ein einfaches Wollhemd trug, fühlte ich an dem darauffolgenden Tage Schmerzen in der Kreuzgegend. Ein über die Nacht genommener Priessnitz-Umschlag und dann das Wiederanlegen der besagten Wollunterkleider behob sofort das Unwohlsein.
Den 16. Mai trafen wir in Singapore ein, also mit einem Tage Verspätung im Vergleiche zu dem officiell angegebenen Ankunftstage. Nach dem Anlangen des Schiffes in den Hafen kam der Hafenarzt auf den Dampfer zur Inspicirung des Gesundheitszustandes auf demselben und zur Feststellung, ob auf dem Schiffe keine ansteckenden Krankheiten vorgekommen sind. Diese Massregel muss in dem Hafen von Singapore mit um so grösserer Genauigkeit durchgeführt werden, als dort alle von Bombay und von Hongkong, also von den beiden pestinfiscirten Städten kommenden Schiffe anhalten, mithin Singapore der Ansteckungsgefahr sehr ausgesetzt ist.
Der von der Lloydgesellschaft auf dem Dampfer Marquis Bacquehem angestellte Arzt, ein vor kurzer Zeit promovirter Doctor, hatte die Pflicht, dem inspicirenden Arzt von Singapore die Aufklärung über den Gesundheitszustand auf dem Schiffe zu geben.
Während der Fahrt des Dampfers von Hongkong nach Singapore waren von den ganz kleinen Kindern, welche die Chinesen mit sich genommen hatten, zwei Kinder gestorben, da sie die Seereise und ganz geänderte Lebensweise nicht überstehen konnten. Ausserdem befand sich auf dem Schiffe ein Matrose, welcher seit vier oder fünf Tagen an geschwollenen Drüsen erkrankt war und ein Fieber mit 38 Grad Körperwärme hatte. Nun befürchtete der Lloydarzt darin gleich einen Pestfall. Ich machte ihn wohl darauf aufmerksam, dass nach meiner Erfahrung aus Bombay dort die Pestkranken binnen 24 Stunden dem Tode erlagen oder, und zwar in den allerseltensten Fällen, nach dieser Zeit der Genesung entgegen gingen. Der Lloydarzt hielt dessenungeachtet seine Befürchtung aufrecht und gab trotz meiner ihm dringlich gemachten Gegenvorstellung dem inspicirenden Arzt aus Singapore Kenntniss davon. Dieser Inspicirungsarzt war nicht Doctor, sondern Apotheker, hatte also selbst kein Urtheil in diesem Falle. Er nahm mithin die ihm vom Doctor gegebene Befürchtung in sich auf, weil er die Verpflichtung in sich fühlte, die Stadt Singapore vor der Gefahr einer Ansteckung zu beschützen. Obgleich bei der nachfolgenden Einzeluntersuchung aller Chinesen, der übrigen Passagiere und der ganzen Schiffsbemannung kein Pestkranker gefunden wurde, so erklärte der inspicirende Arzt dennoch den Dampfer Marquis Bacquehem bis auf Weiteres in Contumaz und ordnete an, dass sämmtliche Chinesen auf die zum Quarantaineplatz bestimmte Insel zu überführen seien. Da aber dieser Arzt doch einsah, dass diese Massregel nicht ganz gerechtfertigt war, so erlaubte er, dass die europäischen Passagiere nach Singapore fahren können.
Ich benützte diese Erlaubniss und fuhr gleich mit dem Arzte nach Singapore, besuchte dort den Honorar-Generalconsul v. Brandt und seinen Stellvertreter v. Pustau, später dann auch den Dr. Rasch, welcher auf dem Dampfschiffe Marie Valerie mit mir nach Singapore gefahren war und sich dort zur Uebernahme einer ärztlichen Praxis niedergelassen hatte. Daselbst empfand ich eine grosse Freude darüber, bei Dr. Rasch wahrzunehmen und es auch von ihm bestätigt zu hören, dass es ihm vorzüglich gut ergehe und er ausserordentlich viel zu thun habe. Da hat sich wieder die Initiative glänzend belohnt.
Den folgenden Tag, 17. Mai, kam der inspicirende Arzt Vormittag wieder auf unseren Dampfer und fand den erkrankten Matrosen, welcher nach der Meinung des Lloydarztes einen »leichten Pestanfall« haben sollte, schon ziemlich wohl. Da mag es dem Apotheker eingeleuchtet haben, dass die Diagnose des Doctors unrichtig war, aber er fand es dennoch angezeigt, die Contumaz nicht aufzuheben, sondern verfügte noch eine Untersuchung des Blutes von dem erkrankten Matrosen und nahm zu diesem Zwecke einige Tropfen Blut desselben mit sich. Die Contumaz unseres Schiffes hatte demnach noch wenigstens 24 Stunden zu währen.
Der vom Lloyd angestellte Schiffsarzt hat durch seine ausgesprochene Befürchtung nicht nur dem Lloyddampfer viele Unannehmlichkeiten, sondern auch namhafte Auslagen bereitet, weil derselbe bedeutende Expensen für den längeren Aufenthalt im Hafennetz zu entrichten hat. Mich aber traf diese Verzögerung sehr unangenehm, weil meine Ankunft in Colombo hierdurch noch weiter hinausgeschoben und somit mein Reiseplan sehr gestört wurde.
An diesem Tage war ich vom Festlande ganz abgesperrt, weil der inspicirende Arzt mich aus dem Grunde nicht auf seiner Dampfbarkasse mitnehmen konnte, weil er noch zu anderen Schiffen fahren musste, und weil kein Boot vom Lande sich dem in Contumaz befindlichen Dampfer zu nähern wagte. Ja, nicht einmal der Lloydagent kam an den Dampfer heran.
Bei alledem fühlte ich mich auf dem Deck des Schiffes sehr wohl, denn Vormittags war es geradezu herrlich, es wehte hier eine so liebliche, angenehme Luft über das Deck, wie wir eine solche in unserem Lande nur in den schönsten Tagen des Mai oder Juni erleben können.
Abends erschien der inspicirende Arzt neuerdings und theilte mit, dass von den vom Dampfer Marquis Bacquehem auf die Quarantaine-Insel transportirten Chinesen ein Mann an der Pest erkrankt und auch gestorben sei, und behauptete, dass dieser Chinese schon auf dem Schiffe erkrankt gewesen sei, sich aber der Untersuchung entzogen haben müsse. Tags vorher wurde aber constatirt, dass alle auf dem Schiffe befindlichen Leute untersucht und pestfrei befunden wurden. Es hatte demnach diese nachträgliche Angabe keine rechtmässige Basis, wohl bot sie aber der Behörde in Singapore das Mittel, nach Gutdünken mit dem Dampfer zu verfahren. Die Ansteckung des Chinesen konnte ja auf der von Pest durchseuchten Quarantaine-Insel vorgekommen sein. Diese Einwendung fruchtete nichts. Der inspicirende Arzt theilte nun mit, er werde den Todesfall dem Gouverneur melden, und dieser werde die weitere Contumaz des Dampfschiffes verfügen.
Dies war ein schlimmer Fall für mich, denn der Aufenthalt in Singapore konnte sich nun so weit hinausziehen, dass ich mit Einschluss des Aufenthaltes in Penang, welcher auch unvorhergesehene Verzögerungen bringen konnte, erst nach dem 1. Juni nach Colombo gelangen würde, dass ich daher dort den Dampfer der Messagerie nicht mehr angetroffen haben würde, folglich auf ein später abgehendes Schiff hätte warten müssen. Dann aber stand mir bevor, in den für meine Garderobe und für das gekaufte Seidenzeug gefürchteten Monsum zu kommen. Dies wollte ich, wie schon erwähnt, vermeiden, und so erwog ich es, den Dampfer Marquis Bacquehem zu verlassen und mit dem Dampfer einer andern Dampfschifffahrts-Gesellschaft von Singapore nach Colombo zu fahren. Wohl hatte ich die Fahrkarte von Kobe bis Colombo genommen, aber ich hoffte, dass die Lloyddirection in Triest den Betrag von Singapore nach Colombo mir zurückerstatten werde. (Dies ist später auch erfolgt.) Andererseits sah ich es voraus, dass durch diesen Wechsel sich meine Fahrt sehr vertheuern werde, aber dies war schon dadurch herbeigeführt, dass unser Dampfer zur Einhaltung der Contumaz bestimmt worden war, und dass ein Erlass besteht, nach welchem jeder Passagier im Falle der Contumaz für jeden solchen Tag 15 Francs zu zahlen hat.
Ich entschloss mich demnach, den nächsten Tag nach Singapore zu fahren, dort alle Eventualitäten zu erforschen und dann auf Grund der darauf gestützten Erwägungen das mir am zweckdienlichsten Erscheinende zu unternehmen. Als nun am nächsten Tag, den 18. Mai, der inspicirende Arzt Vormittags wieder auf das Schiff kam und mittheilte, dass die Dauer der Contumaz des Dampfers Marquis Bacquehem noch nicht festgestellt wurde, machte ich von meiner Freiheit, auf das Land zu fahren, Gebrauch und schiffte mich mit dem Inspicirenden nach Singapore über. Während dieser Fahrt erhielt ich von demselben die Zusage, dass seinerseits kein Bedenken erhoben werden soll, wenn ich gleich auf einem andern Dampfer weiterfahren werde.
In Singapore verfügte ich mich gleich zum österreichisch-ungarischen Consulat und brachte dort in Erfahrung, dass der Dampfer Marquis Bacquehem im Hinblick auf die vom inspicirenden Arzt abgegebene Darlegung der Verhältnisse voraussichtlich noch längere Zeit in Contumaz gehalten sein werde, dass dann derselbe erst die Verladungsarbeiten vornehmen könne und demnach die Abfahrt des Dampfers von Singapore sich weit hinausziehen dürfte. Weiters wurde dort gesprochen, dass der Dampfer auch von Singapore nach Penang eine grosse Zahl von Chinesen transportiren müsse, dabei wieder ein Pestfall vorkommen oder vermuthet werden, und dass dann in Penang ein gleiches Zeitversäumniss wie in Singapore eintreten könnte. Darauf hin entschloss ich mich, auf einem andern Dampfer weiter zu reisen.
Von Singapore gingen zu dieser Zeit nach Colombo ab: am 19. Mai der Dampfer Coromandel der englischen P and O- (Peninsula and Oriental-) Gesellschaft, und am 25. Mai ein Dampfer der französischen Gesellschaft Messagerie maritime. Im Hinblicke darauf, dass ich bald von Singapore wegkommen und in Colombo eintreffen wollte, wählte ich zur Weiterfahrt das Dampfschiff Coromandel, war aber dadurch zur Eile gedrängt, weil dieser Dampfer den nächsten Tag schon um 8 Uhr Früh abfuhr. Vorerst traf ich die Vorkehrung, dass am Abend mein Gepäck von dem Dampfer Marquis Bacquehem abgeholt und auf den Dampfer Coromandel geführt werde. Dann liess ich mir von unserem Consulate ein Certificat für die mitgenommene Cycas revoluta ausstellen, weil ohne solche Belege keine Pflanzen oder Blumen nach Oesterreich-Ungarn eingeführt werden dürfen. Hierauf nahm ich eine Fahrkarte erster Classe für den Dampfer Coromandel von Singapore nach Colombo auf der Insel Ceylon. Diese Karte kostete 140 Dollars = 168 fl. ö. W. Der Betrag erscheint für eine fünf und einen halben Tag währende Fahrt sammt Unterkunft und Verpflegung, also für den Tag etwa 30 fl. 50 kr. ö. W., ziemlich theuer. Nachdem dies besorgt war, fuhr ich auf den Dampfer Marquis Bacquehem zurück, um dort mein Gepäck in Ordnung zu bringen. Hierzu theilte ich meine Effecten, die einstweilen auf 22 Colli angewachsen waren, derart, dass ich 9 Stück auf dem Lloyddampfer zur Ueberführung nach Triest beliess und 13 Stück mit mir nahm.
Vor dem Scheiden von dem Dampfer Marquis Bacquehem dankte ich noch dem Schiffscapitän und den Schiffsofficieren für die mir bezeigte Zuvorkommenheit und wünschte ihnen, bald von der Contumaz loszukommen.
Die Nacht schlief ich vortrefflich im Adelphi-Hôtel in Singapore. Des andern Tags zeitlich Früh besichtigte ich die vom Hôtelier Hassner, einem Oesterreicher, aus seiner Sammlung alter Waffen und sonstiger Gegenstände von wilden Völkern für mich gewählten Curiositäten, und zwar: einen Buka Bogen mit Sehne, circa 2 m lang, zehn Buka Rohrpfeile mit Widerhaken, circa 1½ m lang, sechs Rohrspeere, circa 1½ m lang, und zwei Speere, circa 2½ m lang, von den Neu-Irland-Inseln (Neu-Mecklenburg); einen Bogen mit Sehne, circa 1½ m lang, und sechs Speere mit sägeartigen Spitzen, circa 1¾ m lang, von den Salomons-Inseln; eine Arbeitshacke, eine mit Muscheln besetzte Tasche und ein Olivenheft von der Admiralitäts-Insel; zwei aus Bast erzeugte Taschen und eine Holzmaske aus Neu-Guinea; ein Beil mit einem Ruthenbündel und Klappern zum Vertreiben der Weiber bei dem Essen von Neu-Pommern; zwei Speere von den Marschall-Inseln und ein Tempel-Aufsatz von der Bougainville-Insel.
Da der Hôtelier Hassner für diese interessanten Antiquitäten, welche ich für das kärntnerische Landesmuseum bestimmt habe, keine Bezahlung annehmen wollte, so werde ich demselben nach meiner Rückkunft eine grössere Zahl von Flaschen mit rothem und mit weissem Chateau Palugyay-Wein zusenden lassen.
Das Hôtel Adelphi in Singapore ist sehr gut und schön gelegen, besteht aus einem prächtigen und grossen Hause mit vielen geräumigen, luftigen Gesellschaftsräumen und mit schönen, sehr gut eingerichteten Passagierzimmern, und ist von einem sehr gut gehaltenen Garten umgeben. Die Verpflegung ist dort sehr gut, die Bedienung vortrefflich und dabei sind die Pensionspreise ausserordentlich billig. Der Hôtelier Hassner, wie gesagt, ein Oesterreicher aus Nordböhmen, ist schon seit einer langen Reihe von Jahren im Hôteldienste thätig, in der Stadt Singapore allgemein hochgeachtet und beliebt, für seine Gäste sehr aufmerksam und sorgsam, und so kann das Hôtel Adelphi mit gutem Gewissen jedem nach Singapore Reisenden bestens anempfohlen werden.
Am 19. Mai, um 7¼ Uhr Früh, nach erfolgter rascher Verpackung und Abfertigung der mir übergebenen Antiquitäten, fuhr ich zum Dampfer Coromandel, wo ich mein sämmtliches Gepäck, und zwar sechs Stück in meiner Cabine und acht Stück auf dem Schiffsdeck vorfand. Der mich begleitende Hôtelier überwachte speciell, dass das Stück mit den Antiquitäten zu den Effecten auf das Deck gelegt worden war. Der mit der Ueberwachung des Gepäckes betraute Schiffsofficier hat die auf dem Deck befindlichen Colli gesehen und in dem Gepäcksraum unterbringen lassen. Ich hebe diese Angelegenheit hervor, weil es bei dem Ausschiffen einen sehr unliebsamen Anstand wegen meines Gepäckes gab.
Das englische Schiff Coromandel ist weit grösser und in mancher Richtung besser eingerichtet, als das Lloydschiff Marquis Bacquehem. So z. B. geniesst der Reisende auf dem Deck des Coromandel viel mehr Bewegungsfreiheit und hat nicht die Unannehmlichkeit, an dem heissen Dampfkessel vorbeigehen zu müssen, wie auf Marquis Bacquehem. In den Cabinen befinden sich grössere Fenster und demnach sind dieselben kühler, als bei Marquis Bacquehem. Im Uebrigen sind aber die Verhältnisse auf dem Coromandel, ungeachtet des vierfach höheren Fahrpreises als auf dem Lloydschiff, nicht besser als auf diesem. Die Mahlzeiten sind wohl ein wenig reicher, aber nicht besser, dagegen gibt es zum Tiffin nur kalte Speisen und der Wein ist sehr theuer. Eine Flasche des billigsten Weines kostet 2 Dollars = 2 fl. 40 kr. ö. W.
Auch auf dem englischen Dampfer wurde mir eine für drei Personen eingerichtete Cabine zur Verfügung gestellt, eine Zuvorkommenheit, für welche ich dem Schiffscapitän meinen Dank aussprach.
Ich befand mich auf dem Schiffe inmitten von Engländern, auch einige Frauen mit ihren Männern und selbst Kinder fehlten dort nicht. Im Ganzen befanden sich in der ersten Classe etwa 30 Engländer und ich war der einzige Nichtengländer. Das Leben unter den Engländern ist insofern recht angenehm, als dieselben ein durchaus sehr anständiges und ruhiges Betragen haben und Niemanden in seiner Lebensweise stören.
Die englischen Herren sind meist gross, schlank, haben durchschnittlich blonde oder braune Haare, und viele haben lichtblaue Augen. Sie tragen entweder gar keinen Bart oder nur einen Schnurrbart, diesen aber nach abwärts, und sind sonst stets sorgfältig rasirt. Die englischen Damen sind auch sehr schlank, jene auf dem Schiffe waren aber nicht besonders hübsch.
In der äusseren Erscheinung sind die Engländer sich beinahe ganz gleich. Während des Tages tragen sie leichte, lichte, einfarbige oder leicht gerippte kurze Röcke und Beinkleider von gleichem Stoffe, und zwar entweder von Wolle oder von roher Seide, unter demselben ein Wollhemd mit umgelegtem Kragen und auf dem Kopfe die bekannte Reisemütze. Morgens tragen die Engländer bis zum Breakfast um 9 Uhr weite Leibchen und Beinkleider aus grobem, lichtem Wollstoff (Pangshyana) und Abends zum Diner sind sie in schwarzem Frack oder Smoking, schwarzen Pantalons, tief und breit ausgeschnittenen Gilets, Hemden mit glattgestärkter Brust, in welcher sich meist nur ein Knopfloch befindet, das mit einem ziemlich grossen Gold- oder Perlenknopf geschlossen wird, und mit schwarzer Cravatte gekleidet. Nach dem Diner wechseln manche Engländer bei grosser Hitze den Frack oder Smoking mit einem weissen, gestärkten Piquetleibchen, welches in der Form dem Smoking ähnlich ist, aber nur bis zur Taille reicht und dort gerade endet. Die auf dem Schiffe befindlichen Damen machten zum Diner auch Toilette, aber nicht mit ausgeschnittenen Kleidern. Sie wussten wohl warum.
Alle Reisenden brachten auf das Schiff Rohrfauteuils oder Rohrsofas mit, die mit ihrem Namen versehen waren, und welche sie dann stets an jene Stelle auf dem Deck schoben, welche ihnen zur Ruhe am besten dünkte. Die englischen Ehepaare sassen dort während des ganzen Tages ohne geringste Unterbrechung stets nebeneinander. Nun that es mir recht leid, dass ich, der Gepäcksverminderung halber, meine Rohrmöbel nicht mitgenommen hatte. Auch in der Art und Weise des Essens und Trinkens gleichen sich die Engländer. So z. B. nehmen sie beim Essen der Suppe stets den breiten Theil des Löffels an den Mund, die Trinkgefässe stellen sie rechts seitwärts der Teller, und als Getränke nehmen sie Whisky mit Soda. Die Begrüssungsform der Engländer besteht nur in einem leichten Nicken des Kopfes, höchstens in dem Erheben der Hand wie zum Salutiren, und nur bei grösserer Intimität in der Phrase: How do you do?
Ich nahm von keinem Menschen Notiz und beschäftigte mich mit Lesen und Schreiben. Es scheint den Engländern mein Wesen nicht fremdartig gewesen zu sein, weil sie sich allmälig zuvorkommend gegen mich benahmen, mich begrüssten und die bei den Mahlzeiten neben mir Sitzenden mit mir conversirten. Freilich sah ich mich genöthigt, denselben gleich mitzutheilen, dass es mir noch schwer wird, die Engländer beim Sprechen zu verstehen. Darauf bemühten sie sich, recht langsam und deutlich zu reden, und hierin hat der links neben mir sitzende Engländer sein Möglichstes geleistet. Bei dieser Gelegenheit will ich zur Charakterisirung der Engländer eine kleine Episode aus unserer Conversation erzählen. Als ich nämlich dem Nebensitzenden auf seine Frage, ob ich in Nikko gewesen sei, antwortete, dass ich hierzu leider nicht die Zeit finden konnte, weil ich in Tokio bei Gesandten und anderen hohen Personen eingeladen war, und weil ich bei dem Kaiser und der Kaiserin Audienz genommen hatte, so erwiderte er nach einer Weile: »Der Thee ist im Preise erheblich gestiegen«, und als wir bei einer andern Gelegenheit über Oesterreich-Ungarn sprachen, fragte er unvermittelt: »Welche Gattung Kaffee wird in Oesterreich-Ungarn hauptsächlich getrunken?« Man erkennt daraus, dass des Engländers Geist bei Allem und Jedem vom Geschäft erfüllt ist.
Am 20. Mai, gegen 3 Uhr Nachmittags, kamen wir in Penang an und blieben dort bis nach 6 Uhr Abends. Ich benützte diese Zeit, mich nach dem Festlande übersetzen zu lassen und dort eine Rikschafahrt nach dem Rennplatz, dem Garten und dem Wasserfalle von Penang zu machen, weil ich diese herrliche Gegend wieder sehen und einen dort befindlichen Händler antreffen wollte, welchen ich bei der Herreise entdeckt hatte und von dem ich wusste, dass er solche ausgestopfte Thiere besitze, die ich für das Landesmuseum in Klagenfurt mitbringen wollte. Diese Fahrt zwischen den weit ausgedehnten Cocosnusswäldern und zwischen den in denselben eingestreuten schönen Villen und eigenthümlich gebauten Bauernhäusern hat mich wieder sehr entzückt. Bei dem Händler kaufte ich die Bälge von drei buntfärbigen, grossen Vögeln, und ich hätte auch gerne einen dort befindlichen ausgestopften Pelzflatterer, einen sogenannten geflügelten Affen, gekauft, war aber daran verhindert, weil der Händler keine Kiste zum Verpacken dieses grossen Thieres beistellen konnte und ich dasselbe unverpackt nicht mitnehmen wollte.
Während meiner Abwesenheit vom Schiffe waren mehrere neue Passagiere erster Classe, darunter auch eine schwarze Indierin mit ihrem kleinen schwarzen Bebé und mit ihren halbwüchsigen schwarzen Dienern, einem Burschen und einer Magd, eingestiegen. Wenn nun wohl auch kein Passagier in meiner Cabine untergebracht worden war, so erwuchs mir doch die Unannehmlichkeit, dass die Indierin mit Kind und Dienern in die Nebencabine einquartiert wurde und dass ich Tags über, ja sogar auch Nachts das Raunzen, Weinen und Schreien des kleinen, schwarzen Unholdes hören musste.
Am 21. Mai (Pfingstsonntag) befand ich mich auf hoher See, bei leichtgetrübtem Wetter und bei ziemlich heftigem Winde. Das Schiff schwankte recht kräftig auf und ab. Dies gereichte mir aber zum Vergnügen und so fühlte ich mich dabei sehr wohl.
Meine Gedanken überflogen den weiten, weiten Raum, der mich von meinen Lieben trennte, und dieselben liessen mich in meinem schönen, trauten Heimatlande das Pfingstfest recht heiter und freudevoll begehen, und sie trugen meinen Lieben die Empfindungen hin, welche meinem, von inniger Liebe für sie erfüllten Herzen entstammten und die allerbesten Wünsche für ihr Wohlergehen enthielten. Ich war davon überzeugt, dass auch meine Lieben in ähnlicher Weise meiner gedachten.
Während der weiteren Fahrt bewegten wir uns einerseits längs der Nordküste der gebirgigen Insel Sumatra und andererseits südlich der Nikobar-Inseln. Ein sehr heftiger Sturm hatte sich nach und nach entwickelt. Die Wogen rollten in mächtiger Höhe heran und der Dampfer hob sich, diese Wogen passirend, gewaltig empor und senkte sich wieder tief hinab. Die Fenster der Cabinen wurden mit starken Eisenplatten geschlossen. Alle Damen und manche Herren zogen sich zurück, um dem Meergott Neptun ihren Tribut zu zahlen. Ich zahlte dem Neptun in dieser Hinsicht keinen Tribut und doch ging ich nicht frei aus. Bei der fortwährenden Transpiration, welche die grosse Hitze in den Tropen verursacht, sind nur die in diesem Klima lebenden Menschen gegen die ewige Zugluft, welche überall erzeugt wird, immun, ich aber, der in dieser Richtung verwöhnte Festländer, konnte diese Combination nicht ertragen, und so habe ich mir ein kleines Rheuma in der linken Hüfte (Ischias) zugezogen. Meinem Grundsätze getreu, mir nichts gefallen zu lassen, sondern gleich alle Unannehmlichkeiten zu bekämpfen, machte ich mir vor dem Schlafengehen einen Priessnitz-Umschlag mit Kautschukpapier-Umhüllung, dann massirte ich mich am nächsten Morgen kräftig, nahm darauf ein Meerwasser-Wannenbad und machte endlich noch entsprechende Gelenksübungen. Gebessert wurde mein Leiden wohl, aber nicht vollkommen behoben, und so nahm ich mir vor, diese Procedur am nächsten Abend und Morgen zu wiederholen.
Am 22. Mai (Pfingstmontag) war das Wetter klarer geworden und es hatte der Sturm ein wenig nachgelassen, dennoch erhob und verbeugte sich unser Dampfer noch so bedeutend, dass die Damen sich noch nicht aus ihren Verstecken herauswagten.
Nirgends mehr war Land zu sehen. Wir durchquerten das Meer von Osten nach Westen; im Norden war das Bengalische Meer und im Süden der Indische Ocean.
Diesen Tag benützte ich emsig zur Fortsetzung meines Tagebuches. Mein Ischias war wohl besser geworden, aber noch nicht behoben.
Auch das am 23. Mai vorgenommene Heilverfahren, bestehend in Massiren, Gelenksübungen, Bädern, Einreiben mit Gichtfluid und Nachts über in Priessnitz-Umschlägen, behob wohl zeitweilig, aber nicht für immer den Schmerz in der linken Hüfte, und so muss ich mit dieser Procedur so lange täglich fortfahren, bis ich das Leiden vollständig bewältigt haben werde.
Die Reise auf dem Dampfschiffe bietet ungeachtet des durch die Hitze entstehenden Ungemaches sehr viel Schönes. Die tiefblaue Farbe des Meeres, die rollenden Wellen und Wogen mit den auf ihren Scheiteln thronenden Schaumperlen, das Kräuseln der ganzen Oberfläche, der lichtblaue Himmelsbogen mit seinen eingestreuten weissen und grauen Wölkchen, welcher sich am Horizont in's Meer zu tauchen scheint, das Rauschen und Brausen des vom Schiffe durchfurchten Meeres, alles dies gibt dem Gesicht, dem Gehör und der Phantasie reichliche Anregung.
Eben auf diesem Schiffe, umgeben von Engländern, welche in ihrer ruhigen, schön gesitteten Lebensweise die sich erhebenden Stimmungen nicht beeinträchtigen, sondern durch ihr durchaus anständiges Wesen eher fördern, eben hier empfand ich das Gefühl der Freude und Lust über die Meerfahrt am allermeisten.
Bei alledem darf man sich das Leben der Engländer nicht so wie ihre Aussenseite als hölzern und steif vorstellen. Sie spielen hier auf dem Schiffe theils Schieb-, theils Wurfspiele, theils Karten, und zwar Whist, theils »langen Puff«, Schach, Domino u. s. w., oder sie lesen, oder führen Conversation. Dabei bleibt aber Alles in voller Ruhe, und sie sind stets recht heiter. Bei Whistpartien kommt es absolut nicht vor, dass ein Partner gegen den andern eine Kritik übt.
Das englische Schiff Coromandel hält ein weit besseres Tempo ein, als es die gewöhnlichen Schiffe des Oesterreichischen Lloyd gethan haben, denn die letzteren hinterlegten in der Stunde etwa 10 Seemeilen = etwa 18 km, während Coromandel in der Stunde 13-13½ Seemeilen = 24-25 km zurücklegt. Daraus folgt, dass zur Fahrt der Strecke von Hongkong über Penang nach Colombo auf dem Lloydschiffe acht Tage und auf dem Coromandel nur sechs Tage erforderlich sind. Wir werden demnach am 25. Mai Früh in Colombo eintreffen.
Am 24. Mai war der Himmel ganz bewölkt, der Sturm hob die Wellen und diese hoben und senkten das Schiff, und die Luft war schwül.
Im Laufe des Tages sprach ich den Schiffscapitän wegen des Zeitpunktes meiner Ausschiffung in Colombo, und erhielt von demselben die Aufforderung, es ganz nach meinem Belieben einzurichten, jedenfalls aber noch vorher, am 25. Mai um 9 Uhr, das Breakfast auf dem Schiffe einzunehmen.
Als ich am 25. Mai Morgens auf das Deck des Schiffes Coromandel kam, befanden wir uns in dem von den Engländern bei Colombo kunstvoll hergerichteten Hafen, und ich sah dort das grossartig schöne Schauspiel, wie sich die heranstürmenden Meereswogen an den gewaltig fest erbauten Steinmauern des Hafens brachen, dann in Millionen Wasserperlen zerstoben, und dabei viele Meter hoch in die Luft stiegen, um von dort als dichter, weisser Schaum wieder in das Meer zurückzufallen. Diese Erscheinung wiederholte sich fort und fort, bald hier, bald dort.
Nach dem Breakfast liess ich durch einen auf das Dampfschiff gelangten Diener des Grand Oriental-Hôtel aus meiner Cabine die dort befindlichen sechs Gepäckstücke auf das Deck schaffen und sah mich dann um meine im Gepäcksraume des Schiffes untergebrachten acht Colli um. Es waren aber zu dieser Zeit von denselben nur zwei Stück auf das Deck geschafft worden. Als ich mich nun an dem bei dem Gepäcke befindlichen Beamten des Coromandel mit der Bitte wandte, gefälligst dahin zu wirken, dass alle meine Colli bald aus dem Gepäcksraume geschafft werden, erwiderte mir derselbe in durchaus nicht höflicher Weise, es kümmere ihn dies nichts und ich möge mich an den Gepäcksofficier wenden. Erst nach vielfachem Fragen konnte ich bei dem nicht artigen Benehmen der Schiffsofficiere endlich den Gepäcksofficier ausfindig machen. Ich theilte ihm nun mit, dass mir noch sechs Gepäckstücke fehlen, von welchen fünf Stück mit meiner Adresse versehen sind, während ich auf das lange Paket mit Speeren, Bogen, Pfeilen u. s. w. bis jetzt noch keine Adresse habe anbringen können. Der Gepäcksofficier erwiderte darauf, dass er sich speciell an das lange Paket, aus welchem beiderseits die Enden der beinahe 3 m langen Speere herausstanden, gut erinnere, und dass ich in mein Hôtel fahren und von dort einen Bediensteten zur Uebernahme und Ueberführung der fehlenden sechs Colli auf das Schiff senden soll. Ich könne beruhigt sein, ich werde bis am Abend Alles bei mir haben.
Ich fuhr also Mittags mit den bei mir habenden acht Gepäckstücken in das Grand Oriental-Hôtel und sandte von dort einen Diener mit einem Certificat, in welchem die fehlenden Colli genau bezeichnet waren, auf das Schiff. Dieser Diener musste aber dort von Mittag bis 6 Uhr Abends warten, bekam dann nur fünf von den bezeichneten Effecten ausgefolgt, und es wurde ihm mitgetheilt, dass das sechste Stück, nämlich das Paket mit den alten Waffen, nicht vorgefunden werden konnte. Da nun das Schiff Coromandel am nächsten Tag weitergefahren war, so ging ich zur Agentschaft der P and O-Gesellschaft in Colombo, um das fehlende Stück zu reclamiren. Der Agent versprach, deshalb Nachforschungen zu erheben, und gab der Hoffnung Ausdruck mir das fehlende Stück noch vor meiner Abreise von Ceylon zustellen zu können.
Nachdem ich in das genannte Hôtel in Colombo gelangt war, fuhr ich mit einem Rikscha zu dem Honorarconsul für Oesterreich-Ungarn, Schulze, mit welchem ich schon in schriftlichen Verkehr getreten war, um mich persönlich mit demselben bekannt zu machen und ihn zu fragen, ob Sendungen an mich bei ihm angelangt seien, und ihn zu bitten, mir Auskunft über Herrn Dumaresq-Thomas zu verschaffen, welcher mich gebeten hatte, ihm meine Ankunft in Colombo nach Jawalakelle telegraphisch bekannt zu geben. Das Resultat dieser Besprechung war nachfolgendes: dem in Ceylon sehr angesehenen Engländer und Theeplantagenbesitzer Dumaresq-Thomas werde der Consul meine Ankunft in Colombo telegraphisch anzeigen, und dem Besitzer des Queen Hôtel in Kandia, dem Ungarn Raden, werde er mein Eintreffen dort am 27. Mai aus dem Grunde telegraphisch bekannt geben, damit in dem stets angefüllten Hôtel ein Zimmer für mich bereit gestellt werde. Schliesslich lud mich der Consul für den 26. Mai, um ½8 Uhr Abends, zu sich zum Diner ein.
Am 26. Mai erfuhr ich bei dem Consulate, dass von Dumaresq-Thomas auf telegraphischem Wege die Bitte eingelangt sei, gleich zu ihm nach Nowera Elya in seine Villa Astley-House zu kommen und hierzu mit der Bahn nach Nuna oya zu fahren, von wo er mich abholen lassen werde. Hierauf wurde dem Herrn Dumaresq-Thomas telegraphisch bekannt gegeben, dass ich am 28. Mai Mittags in Nuna oya eintreffen werde.
Vom Consulate ging ich zur Agentschaft der französischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft Messagerie maritime, um dort die Reiseverhältnisse zu besprechen und dementsprechend eine Fahrkarte zu nehmen. Nach den dort erhaltenen Aufklärungen fasste ich nachstehenden Reiseplan. Am 2. Juni Abends werde ich mit dem französischen Dampfer Australien nach Ismaila in Aegypten, von dort, nach meiner Ankunft am 12. Juni, nach dem mit der Eisenbahn in einer Stunde zu erreichenden Kairo, sonach von dort mit derselben nach dem in 2½ Stunden entfernten Alexandrien, und endlich von dort mit dem Oesterreichischen Lloyd-Schnelldampfer nach Triest fahren. Nachdem ich später bei der Lloydagentschaft erfahren hatte, dass die Schnelldampfer von Alexandrien nach Triest jeden Samstag abgehen und nach vier Tagen in Triest anlangen, präcisirte ich meinen Plan dahin, dass ich am 12. Juni von Ismaila nach Kairo fahren, dort vom 12.-15. Juni verweilen, am 15. Juni nach Alexandrien fahren, dort vom 15.-17. Juni verbleiben, und an diesem Tage mit dem Lloyddampfer nach Triest fahren werde, wo ich sonach am 21. Juni einzutreffen Aussicht habe.
Die Fahrkarte erster Classe auf dem Dampfer der Messagerie maritime von Colombo nach Ismaila oder nach Port Said kostet 625 Rupien = 500 fl. ö. W. Da die Fahrt zehn Tage währt, so entfällt auf jeden Tag der Fahrt 50 fl. ö. W. Es ist dies ein abnorm hoher Preis, und dieser entsteht daraus, dass die Gesellschaft Messagerie maritime jene Reisenden, welche nicht nach Frankreich fahren, einen verhältnissmässig sehr gesteigerten Fahrpreis zahlen lassen.
Die in einer späteren Tageszeit mit der Chartered Bank zu Colombo eingeleiteten Geldgeschäfte wickelten sich sehr gut ab. Ich erhielt nämlich bei dem Wechseln der noch vorräthigen 100 Yen = 120 fl. ö. W. und 36 Singapore-Dollars = 43 fl. ö. W. den Betrag von 200 Rupien oder 160 fl. ö. W. und für die mit dem Creditbrief behobenen 100 Pounds erhielt ich 650 Rupien = 520 fl. ö. W. und 55 Pounds = 660 fl. ö. W., also für 100 Pounds 1180 fl. ö. W. Es hatte demnach die Bank bei dem Wechseln und bei der Ausgabe von zusammen 1363 fl. ö. W. nur 23 fl. Gewinn genommen, mithin um ein Drittheil des Gewinnes weniger, als die gleiche Bank in Yokohama von mir gefordert hatte.
Dann kaufte ich noch in dem grössten Geschäfte von Colombo, Cargill, welches aber nicht sehr vertrauenerweckend ist, zwei Pagshyanas, das sind Leibchen und Beinkleider aus einem groben Flanellstoff, welche in den Tropen zur heissen Zeit als Schlaf- und Morgenkleider getragen werden.
Im Hôtel empfing ich vor dem Tiffin den Besuch des Consuls Schulze, und nach dem Tiffin jenen des Consularsecretärs. Mit dem Consul wurde ausgemacht, dass ich, um zu seinem Diner zu kommen, mit der bestehenden elektrischen Bahn bis zu einem bestimmten Punkte fahren und von dort in seiner Equipage abgeholt werde. Den Secretär bat ich, bei der P. and O.-Agentschaft den nöthigen Nachdruck zu geben, damit mein fehlendes Gepäckstück zu Stande gebracht werde.
Nachmittags fertigte ich die gekauften 50 Ansichtscorrespondenzkarten aus, und fuhr dann um 6¼ Uhr mit jenem Zuge der elektrischen Bahn ab, welcher, nach Aussage des Hôtelportiers, mich an den bestimmten Punkt bringen werde. Nach mehr als viertelstündiger Fahrt nahm ich aber wahr, dass dieser Zug in einer andern, als der mir angegebenen Direction ging, und nun musste ich aussteigen und im Monsumregen lange warten, bis ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Zug kam, der mich wieder zum Hôtel zurückführte. Von hier aus suchte ich nun selbst den elektrischen Zug und kam endlich, wenn auch etwas verspätet, bei dem Consul an.
Die Villa desselben ist gross, sehr hübsch und liegt im Villenviertel inmitten tropischer Gärten. Die Frau des Consuls und ihre Schwester, sehr nette, aus Deutschland stammende Damen, mit welchen ich mich während des vortrefflichen Diners recht gut unterhielt, erzählten mir, dass, laut Zeitungsnachricht, nun in Alexandrien auch die Pest herrsche. Hierdurch wurde mein entworfener Reiseplan umgestossen, denn ich hatte den Gedanken, über Alexandrien zu fahren, aus dem Grunde aufgenommen, weil ich nicht mit dem aus Bombay, wo noch die Pest grassirt, kommenden Lloyddampfer nach Triest reisen, und mich dadurch aussetzen wollte, dort Quarantaine halten zu müssen. Wenn aber auch in Alexandrien die Pest herrscht, so haben die von dort kommenden Reisenden ganz sicher in Triest eine Quarantaine zu halten, und ich hätte, um nach Alexandrien zu gelangen, durch das von der Pest inficirte Aegypten fahren müssen. Ich entschloss mich demnach, mit dem französischen Dampfer von Colombo bis nach Port Said und von dort mit dem Lloyd-Schnelldampfer Bombay-Triest nach der letztgenannten Stadt zu fahren. Bezüglich dieser Reise stellte ich später durch Umfrage fest, dass der französische Dampfer am 12. und der Lloyddampfer am 15. Juni in Port Said ankommen und abgehen, und dass ich hiermit in Port Said drei Tage zu verweilen haben werde.
Nach der Rückkunft in's Hôtel brachte ich noch mein Gepäck in Ordnung, weil ich den andern Tag früh aufbrechen musste.
Am 27. Mai Morgens bezahlte ich die Hôtelrechnung für zwei Tage mit 23 Rupien = 18 fl. 40 kr., und zwar je 3 Rupien für Zimmer und Bedienung, ¾ Rupien für Koffer, 2 Rupien für Tiffin und 3 Rupien für Diner, den Rest für Getränke und Gepäckbeförderung. Im Hôtel liess ich von meinem Gepäck sieben Stück zurück und nahm sechs Stück, darunter die Kiste mit den Jagdgewehren, mit mir. Für die Eisenbahnfahrkarte erster Classe von Colombo nach Kandy, vierstündige Fahrt, und binnen acht Tagen zurück, zahlte ich 9 Rupien = 7 fl. 20 kr. ö. W. und für das Gepäck 2½ Rupien. Um 8 Uhr Früh fuhr ich von Colombo ab.
Ich will nun nachfolgend eine kurze Beschreibung von Ceylon, von Colombo und von dem Lande zwischen Colombo und Kandy geben.
Die überwiegende Zahl der Einwohner von Ceylon sind die Singhalesen. Es sind dies grosse, schlanke, braune Gestalten mit schwarzen Haaren und gleichen unseren Zigeunern. Die Haare werden von den Singhalesen rückwärts in einen Zopf gebunden, und auf dem Kopfe tragen sie einen runden, horizontal liegenden, aufrecht stehenden, gelben Hornkamm, wie eine vorn offene Krone. Um die Hüften haben sie ein bis etwa an die Knie reichendes Tuch oder nur einen stramm gebundenen Leinwandstreifen gewunden. Der Oberleib und die Füsse sind bloss. Die Frauen tragen um die Hüften einen auch die Füsse bedeckenden Rock, über den Oberleib entweder ein kreuzweise gelegtes Tuch oder ein kurzes, enges, weisses Leibchen und um den Hals bunte Ketten oder sonstigen Putz.
Einen zweiten Volksstamm bilden die Neger. Es sind dies kleine schwarze Gestalten mit gekräuselten schwarzen Haaren, auf welchen sie als Muhamedaner den Turban tragen. Der Muhamedanismus hat sich überhaupt in Asien und auf dem malayischen Archipel sehr viele Anhänger erworben.
Die Stadt Colombo macht mit den schönen, grossen Gebäuden an dem Hafen und in der Nähe desselben einen grossartigen Eindruck; hinter derselben stehen aber unzählige armselige, mit Stroh gedeckte Häuser und Hütten, und erst am Umfange der grossen Stadt stehen sehr viele schöne Villen inmitten herrlicher tropischer Gärten. Durch die Stadt ziehen in verschiedenen Richtungen elektrische Bahnen. Der Hafen von Colombo soll nun mit einem Aufwand von 24 Millionen Rupien = 19,200.000 fl. ö. W. vergrössert werden.
Das Grand Oriental-Hôtel ist recht gut. In dem sehr grossen, prachtvollen Speisesaal sind an den Wänden, etwa 4½ m hoch, acht Windmotoren angebracht, welche während der Mahlzeiten maschinenmässig in rasche Drehung versetzt werden, um die Luft in Bewegung zu setzen und dadurch Kühlung zu erzeugen. Diese Windmotoren haben 3 m im Durchmesser und besitzen vier schief gestellte, etwa ½ m lange und ⅓ m breite Löffel.
Der Boden des ganzen Landestheiles von Colombo bis gegen das nordöstlich davon gelegene Kandy ist in den Thalniederungen und theilweise an den Lehnen für die Reiscultur planirt und eingedämmt. An den Lehnen sind hierzu mit staunenswerthem Fleiss und Sachverständniss die Felder stufenweise geebnet und hergerichtet worden, so dass die kleinen Dämme wie Horizontallinien auf einem Plane aussehen.
Die höher gelegenen Theile der Berge und Hügel sind mit Bäumen bestanden, und zwar zum grossen Theil mit Bambus, Cocusnuss- oder anderen Laubbäumen und Gesträuchern, die sich durch Dichtigkeit, intensives Grün und hie und da auch durch Pracht der Blüten auszeichnen. Auffallend ist es, dass die Stämme sämmtlicher Laubbäume nicht gerade, sondern sehr gekrümmt emporwachsen.
In diesen Baumbeständen stehen einfache, strohgedeckte und halboffene Bauernhäuser, und nach allen Richtungen führen sehr gut angelegte und erhaltene Fahr- und Fusswege. Die Eisenbahn steigt bis Kandy 1700 Fuss empor und ist meist an den Lehnen der Berge geführt. Von dem dahinfahrenden Zuge aus geniesst man eine herrliche Aussicht weit hinaus auf das umliegende Bergland, welches bis hinauf in die obersten Theile mit Tropenpflanzen und Bäumen bewachsen ist, und man erfreut sich an dem Anblick des unten liegenden schönen Thales, welches von einem reissenden Gebirgswasser durchzogen wird. Diese Gebirgslandschaft mit ihrem tropischen Charakter, grossen Blätterformen, lebhaftem Grün, dichten und bunten Blüten und riesiger Ueppigkeit ist wunderbar schön.
Um 12 Uhr Mittags langte ich in Kandy an und wurde dort von dem Besitzer des Hôtel Queen, Raden, einem Ungar aus Budapest, mit seinem Wagen abgeholt.
Kandy, die alte singhalesische Hauptstadt, liegt 1700 Fuss über dem Meeresspiegel reizend in einem tropisch bewaldeten Bergland, das Hôtel Queen liegt am Ufer eines schönen Gebirgssees, von dem man eine prachtvolle Aussicht auf die umliegenden Berge geniesst. Dieses Hôtel besteht aus einem ausgedehnten stattlichen Gebäude sammt einem grossen Garten und entspricht allen modernen Anforderungen, hat luftige Schlafzimmer und Wohnräume, mit Badezimmern verbunden, grosse Speisesäle und Gesellschaftszimmer und eine 420 Fuss lange Veranda. Die Frau des Besitzers Raden, eine Deutsche aus Königsberg, leitet mit grossem Verständniss die Küche. Im Hôtel sind Lohnfuhrwerke, Rikschas und Boote zu erhalten, und so gehört der Aufenthalt in diesem Hôtel zu den allerschönsten und angenehmsten Wohnstätten, die man finden kann.
Mir hatte der Hôtelier ein Appartement von vier sehr elegant eingerichteten Zimmern mit einem belaubten, etwa 20 m langen Balkon zugewiesen und dafür sammt Pension für einen Tag nur 8 Rupien = 6 fl. 40 kr. aufgerechnet. Freilich war zu dieser Zeit die Saison vorbei, sonst wäre dieser niedrige Preis nicht möglich gewesen.
Nachmittag fuhr ich mit einem Lohnfuhrwerk nach dem ½ Stunde entfernten botanischen Garten von Peradenia, einem Musterbild der tropischen Flora. Ich ging darin vorerst mit dem Leiter des Gartens spazieren, fuhr dann mit dem Wagen noch ¾ Stunden an der Grenze desselben herum, und war entzückt von der Pracht und Herrlichkeit der dort befindlichen Pflanzen und Bäume. Ich habe eine lange Reihe von Namen der dort stehenden Bäume und Sträucher notirt, will aber hier davon nur nachstehende bekannt geben: Mongo-, Durjan-, Pellaginella- und Cassiabaum, letzterer reich mit lila Blüten geziert, Pfeffer-, Zambodiabaum mit blauen, Poingianabaum mit ziegelrothen, Jacorandabaum mit blauen und Randiabaum mit weissen Blüten, Oel-, Muscatnuss-, Benzoin-, Todten-, Cocca- und Termindiabaum, riesig hohe Antiayo und Erika, Ixorastrauch mit unzählig vielen kleinen, rothen Blüten, Petreastrauch mit blauen Blüten und viele Gattungen prachtvoller Orchideen und Palmen.
Die sehr gute Strasse von Kandy nach Peradenia ist beiderseits mit Akazienbäumen bepflanzt, welche aber dort weit grösser und umfangreicher gedeihen als bei uns. Während der Hin- und Rückfahrt auf dieser Strasse konnte ich wahrnehmen, dass der Reinlichkeitssinn bei den Singhalesen auf sehr niedriger Stufe steht. Die Häuser, welche sich beiderseits der Strasse befinden, sehen sehr schmutzig aus, und vor manchen Häusern konnte man die Bewohner sehen, wie sie sich gegenseitig in ihren langen Haaren nach Inwohnern suchten, diese aber nicht tödteten, sondern wegwarfen, weil die Singhalesen, so wie die Indier, an die Seelenwanderung glauben und daher kein Thier tödten dürfen. Da sieht man curiose Familienbilder, wie z. B. dass die stehende Tochter der sitzenden Mutter und diese ihrem, mit dem Kopfe auf ihrem Schoss liegenden Manne diesen Liebesdienst erweist.
Nach Kandy zurückgekehrt, besuchte ich die dort befindliche grosse katholische Kirche, von Papst Pius IX. gestiftet, dann die schöne anglikanische Kirche und endlich den ausgedehnten, aus mehreren Gebäuden bestehenden Buddhatempel, in welchem ein Riesenzahn des Buddha aufbewahrt gehalten werden soll. Bei dieser Gelegenheit sah ich auch ziemlich viele Singhalesen in europäischer Tracht herumgehen. Komisch sehen die braunen weiblichen Gestalten in Corsets und in eleganten, lichten europäischen Kleidern aus, mit Silberketten auf dem blossen braunen Nacken und mit verzierten Silbernadeln in den pechrabenschwarzen Haaren.
Nach dem sehr guten Diner im Hôtel Queen erzählte mir Frau Raden, dass nach Ceylon leider sehr wenig Oesterreicher kommen, und dass in den letzten zwei Jahren nur der Hôtelier Sarnsteiner von Ischl mit seiner Frau auf diese paradiesische Insel gekommen und in diesem Hôtel abgestiegen waren. Es ist wahrlich schade, dass sich Niemand aus Oesterreich-Ungarn den hohen Genuss gönnt, in dieser wunderbaren, grossartigen Natur einige Zeit zu verweilen. Die Ausgaben werden hier jedenfalls geringer sein, als in den meisten eleganten Curorten.
Nach einer in den kühlen Räumen des Hôtels verbrachten sehr guten Nacht machte ich am Morgen des folgenden Tages, am 28. Mai, noch einige Einkäufe an Edelsteinschmuck, da die Insel Ceylon ihres Reichthums an Edelsteinen halber berühmt ist und ich davon einige Andenken in die liebe Heimat mitbringen wollte.
Am 28. Mai, um 10 Uhr Vormittags, fuhr ich mit der Eisenbahn von Kandy ab, um den auf der Dampfschiffahrt von Colombo nach Penang bekannt gewordenen Herrn Dumaresq-Thomas, Besitzer der Theepflanzung Sindovla bei der Eisenbahnstation Tawalakelle, des Norton-House in Malmesbury in England und endlich des Astley-House in Nuwera Eliya, in der letztgenannten Villa zu besuchen. Hierzu musste ich mit der Bahn nach der Station Nuna oya fahren, wo ich um 4 Uhr Nachmittag anzukommen hatte.
Nuna oya liegt südlich von Kandy und östlich von Colombo, beiläufig in der Mittellinie der Insel, westlich des 7500 Fuss hohen Pedroberges und nördlich des 6900 Fuss hohen Adamspeak, und befindet sich etwa 5800 Fuss über dem Meeresspiegel. Von dort fährt man mittelst Wagen in ¾ Stunden auf einer sehr gut angelegten und vortrefflich erhaltenen Serpentinenstrasse nach dem 6200 Fuss hohen Villenort Nuwera Eliya, in dessen Bereich die Villa Astley-House liegt.
Der Charakter des Landstriches zwischen Kandy und N. Eliya ist jener des Berglandes mit Felsenformation und reissenden Gebirgswässern, welche hie und da über Felsenmassen in die Tiefe stürzen und hierdurch herrliche, grossartige Cascaden bilden. Die Lehnen der Berge sind meist mit gelbsandigem Erdreich bedeckt und von den Kuppen bis zu den Thälern mit Theesträuchern bewachsen. Diese Theesträucher haben eine Höhe und Breite von etwa 30 cm, sind daher etwas kleiner als jene in Japan, stehen in 50 bis 60 cm von einander entfernten Reihen und haben oft das Ansehen von kleinen Zwergbäumen. Die Theeplantagen sind meilenweit ausgedehnt und machen beinahe den gleichen monotonen Eindruck, welchen bei uns die Weingärten erzeugen; doch wird dieses Bild hier häufig verschönert durch die stellenweise, besonders an den Ufern der Wässer und in der Nähe der Bahnen befindlichen reichen Tropengewächse, wie z. B. Buschwerk mit Blüten in allen Farben, Farrenkräuter in Riesendimensionen, Aloen von enormer Grösse und Prosperität, bei welchen aus der Mitte einzelner solcher Aloen grüne Stämme mit kleinen Zweigen und Blättern 6 m hoch gerade emporsteigen. Solche Theepflanzungen bestehen in Ceylon in weitumfassendem Masse, und es werden dieselben noch immer weiter angelegt, so weit als es die Bodenverhältnisse gestatten. Kaffeepflanzungen sind dagegen schon seit einer Reihe von Jahren in Ceylon ganz verschwunden, weil sie sich zu schlecht rentirten. Es gibt also keinen Ceylonkaffee mehr. Die Anlage einer Theeplantage ist aber ebenso, wie die Anlage eines Weingartens, sehr mühsam und kostspielig Erst drei Jahre nach dem Anbau der Theepflanze ergibt sich eine kleine Fechsung, und erst in den folgenden Jahren wird die Ernte derselben befriedigend. Auch in diesem Landestheil von Ceylon sind die Fahr- und Fusswege sehr gut angelegt und erhalten.
Was nun die Witterung anbelangt, so war dieselbe in der Zeit meines Aufenthaltes auf der Insel Ceylon nicht gut. Es war nämlich in diesem Jahre die Monsumzeit mit ihren Stürmen und Regengüssen früher als gewöhnlich eingetreten. In den vergangenen Tagen hatte sich der Monsum des zunehmenden Mondes halber nur durch Düsterkeit geäussert, als ich aber später im Astley-House anlangte, fing es heftig zu regnen und zu stürmen an. Uebrigens beginnt der Monsum in den höher gelegenen Theilen von Ceylon früher als in den tiefer gelegenen Gegenden.
Um 4 Uhr Nachmittags auf dem Bahnhofe von Nuna oya angekommen, übergab mir der Diener des Herrn Dumaresq-Thomas einen Brief, in welchem derselbe seiner Freude Ausdruck gab, mich bei sich in seinem Astley-House empfangen zu können, und mich bat, mir meine Gepäcksangelegenheit durch seinen Diener besorgen und mich in dem gesandten Wagen zu sich führen lassen zu dürfen. Während der Zeit der Gepäcksauslösung und Aufpackung ereignete sich nachfolgender, mich frappirender Vorfall. Es trat nämlich auf der Eisenbahnstation Nuna oya ein mir ganz fremder Herr auf mich zu, stellte sich in deutscher Sprache als Herr v. Blücher vor und fragte mich, ob ich nicht der Feldmarschall-Lieutenant Baron E. sei, nachdem er in der dortigen Zeitung meine Ankunft gelesen habe. Auf meine zustimmende Antwort theilte mir Herr v. Blücher mit, dass er sich mit einem Freunde aus Deutschland auf einer Vergnügungsreise befinde, jetzt aber diese Gegend verlasse, weil der Monsum keine Ausflüge mehr gestatte. Ich war wahrlich sehr überrascht, in wildfremder Gegend plötzlich deutsch angesprochen zu werden.
Ich fuhr dann auf der besprochenen Serpentinenstrasse nach N. Eliya, von dort in einer Allee von mit tausend grossen kelchartigen Blüten bedeckten Bäumen eine gute Strecke weiter und dann aufwärts bis zu dem Astley-House. Diese Villa liegt etwa 6300 Fuss hoch auf einem kleinen Hügel mit herrlicher Aussicht auf das umliegende, meist bewaldete Bergland und steht in der Mitte von Beeten mit prächtigen Tropenblumen. Das Haus besitzt einen grossen, mit Glasplatten gedeckten Hof, von welchem man in die zahlreichen Wohnräume, darunter Salon, Speise-, Sitz-, Schreib- und Schlafzimmer, sowie Baderäume u. s. w., gelangen kann.
Von Herrn Dumaresq-Thomas und seiner Frau sehr freundlich empfangen, ging die Unterhaltung dadurch ziemlich gut von statten, dass Herr Thomas ein wenig Deutsch, seine Frau ein wenig Französisch, ihre Schwester auch etwas Deutsch und ich ein wenig Englisch und ziemlich gut Französisch sprechen, und dass wir uns somit in drei Sprachen durcheinander verständlich machen konnten.
Die Lady ist eine nicht mehr ganz junge, aber jedenfalls sehr hübsche und charmante Dame mit einem stets heiteren und sehr anmuthsvollen Wesen. Ihre Schwester, ein recht hübsches Fräulein, ist auch stets heiter und sehr nett. Ausserdem befand sich im Astley-House zu jener Zeit noch eine ältere Dame, welche aus der Umgebung auf einige Zeit zu Besuch gekommen war.
Um 7½ Uhr Abends fand ein grossartiges Diner in voller Toilette statt. Die Damen erschienen mit ausgeschnittenen Kleidern und mit reichem Schmuck, und die Herren in Frack und weisser Halsbinde. Nach dem Diner ging ich mit Herrn Thomas in's Rauchzimmer und später in den Salon, wo wir dann eine kleine Whistpartie machten.
Ungeachtet des in der darauffolgenden Nacht mit starkem Tosen ausgebrochenen Monsums schlief ich in meinem Zimmer des Astley-House vortrefflich.
Da aber Sturm und Regen auch am 29. Mai Vormittags in unverminderter Weise fortdauerten, so war an kein Ausgehen zu denken, und ich benützte die Zeit nach dem um 8 Uhr eingenommenen reichen Frühstück, auf dem mir zur Disposition gestellten Schreibtisch mein Tagebuch fortzusetzen. Wenngleich das Wetter nach dem Tiffin nicht viel besser geworden war, da es nur zeitweilig zu regnen aufhörte, so machten wir, die Damen und die Herren, dennoch eine Ausfahrt in einem dort gebräuchlichen zweispännigen Wagen, welcher oben und seitwärts nach Bedarf mit wasserdichter Leinwand abgeschlossen werden kann. Wir fuhren in einem wunderschönen, mit Wald bedeckten Bergland längs eines ausgedehnten Gebirgsees nach dem 1½ Stunden entfernten Hackgalle Garden und ich entzückte mich an dem Ausblicke auf die umliegende herrliche Gegend. Besonders ragte dort der 6900 Fuss hohe Adamspeak hervor. Auf der Kuppe dieses Berges soll sich im Felsen eine Aushöhlung befinden, welche von den Christen als die Riesenfusspur von unserem Stammvater Adam und von den Heiden als jene des Buddha angesehen wird.
Der Hackgalle Garden wird von einem englischen Garten-Inspector sehr gut und schön gehalten, und es werden dort hauptsächlich europäische Pflanzen und Blumen gepflegt, welche aber theilweise bei dem dortigen Klima besser und stärker gedeihen als bei uns. Auch finden sich in dem ausgedehnten Garten einzelne Punkte, welche einen wunderbaren Ausblick auf die umliegende reizende Gegend gewähren. Mit Regenschirmen und Regenmänteln versehen, liessen sich auch die englischen Damen ungeachtet des strömenden Regens nicht abhalten, den Park zu besichtigen und blieben dabei heiter und guter Dinge.
Nach der Rückkunft in die Villa wurde wieder ein glänzendes Diner servirt und hierauf eine Whistpartie gemacht.
Am 30. Mai Morgens, als ich noch mit dem Ankleiden beschäftigt war, kam Herr Thomas zu mir, um mich aufzufordern, sofort mit ihm an einer eben stattfindenden Elkjagd theilzunehmen. Ich war natürlich gleich dazu bereit, wechselte rasch meine Kleider und wollte eben mein Gewehr und Munition auspacken, als Herr Thomas mir mittheilte, dass bei dieser Jagd nicht geschossen, sondern dass der Elk, ein mittelgrosser Hirsch, von Hunden gesucht, getrieben und gestellt und dann von dem Jäger mit dem Waidmesser gekillt wird. Natürlich war ich umsomehr erfreut, diese mir ganz fremde Jagdart kennen zu lernen.
Als wir, zur Jagd gerüstet, auszogen, waren die übrigen Jagdtheilnehmer und die ganze Hundemeute auf den Hängen des höchsten Berges in Ceylon, des 7500 Fuss hohen Pedroberges, schon weit vorgedrungen, und so musste ich mit Herrn Thomas auf diesen Berghängen, durch dichte Dschungeln, so rasch wie möglich vordringen, um rechtzeitig dorthin zu gelangen, wo die Hunde etwa einen Elk treiben oder denselben gar schon gestellt haben. Dieses Passiren von Dschungeln ist eine höchst anstrengende Arbeit, denn hier stehen Aeste, Zweige, kleine Stämmchen und Gestrüppe so dicht aneinander, dass man nur mit Gewalt durchzukommen vermag, ja manchmal, sich tief zu Boden neigend, durchschliefen, dann wieder einzelne Theile überspringen muss. Dabei war der Hang vom Regen aufgeweicht und rutschig, und es lagen auf dem Boden abgebrochene Aeste und gestürzte Stämme. Soll nun da rasch vorgegangen und auch gelaufen werden, so ist es selbstverständlich, dass man sich Hände und Gesicht blutig aufreisst und dass man auch zeitweise hinhaut. Das macht aber nichts. Die Jagdpassion ist erweckt und es geht mit Aufbietung der ganzen Kraft und mit Nichtbeachtung aller Unbilden lustig vorwärts. Nach dem wenigstens eine Stunde währenden Vorwärtseilen und Kämpfen gegen alle entgegenstehenden Beschwerlichkeiten erreichten wir die Gesellschaft und den Hundsmann, gingen nun mit diesem weiter vor, bis wir auf eine Blösse gelangten, auf welcher constatirt wurde, dass die Hunde nun keinen Elk mehr finden werden.
Wir kamen ganz durchnässt in die Villa und hier wurde mir auf Anordnung des Herrn Thomas gleich ein heisses Bad gerichtet, dessen Gebrauch mir ausserordentlich wohl that. Mein Ischias, welches sich noch zeitweilig fühlbar machte, hatte mir während und nach der Jagd keinerlei Schmerzen bereitet.
Der Nachmittag brachte eine ganze Reihe von Unterhaltungen. Vorerst fuhr ich mit Herrn Dumaresq-Thomas in eine Thee-Factorei, weil es mich sehr interessirte, die Bearbeitung des Thees kennen zu lernen. Es werden in geräumigen luftigen Sälen auf reihenweise übereinander gespannten Flanellagen die von den Theesträuchern abgenommenen Blätter gelegt und halb getrocknet. Dann gelangen diese halbgetrockneten Theeblätter in eine Maschine, welche dieselben zusammenrollt, und hierauf werden diese gerollten Blätter in einen Betrieb gebracht, in welchem dieselben mehr und mehr erhitzte Räume passiren. Nun wird dieser vollkommen getrocknete und hiermit fertige Thee noch maschinenmässig nach der Grösse sortirt, dann in sehr grosse Metallgefässe gepresst und schliesslich in die von England bezogenen Kisten verpackt. Da die jungen, kleinen Blätter einen höheren Werth haben als die alten grossen, so hat der Factorei-Besitzer auch eine Schneidemaschine zur Benützung gestellt, wo die zu grossen, schon gerollten Theeblätter in kleinere Formen geschnitten werden.
In der Factorei, in welcher ich war, werden in der trockenen Zeit täglich 3000-4000 Pfund, in der nassen Monsumzeit aber in drei Tagen nur 6000 Pfund Theeblätter verarbeitet. Hierzu will ich noch bemerken, dass man aus 4000 Pfund grünen Blättern etwa 1000 Pfund Thee erzeugt.
Dann besichtigte ich mit Herrn Thomas die anliegende Theepflanzung. Die ganz jungen, von Natur aus gerollten Blätter des Theestrauches liefern den besten Thee, je grösser und stärker aber die Blätter werden, um desto mehr vermindert sich der Werth des Thees. Der Theestrauch bringt kleine, weisse Blüten hervor; die Frucht, der Same ist grün und kugelförmig und hat etwa 1½ cm im Durchmesser. Dem Ansetzen der Frucht wird entgegen gearbeitet, weil fruchttragende Sträucher weniger Blätter ansetzen.
Von dieser Theeplantage fuhren wir in den Herrenclub, wo ich den Master der Elkjagd kennen lernte und von ihm eingeladen wurde, die am nächsten Tage, den 31. Mai, stattfindende Jagd, die letzte in dieser Saison, da am 1. Juni die Schonzeit eintritt, mitzumachen. Ich sagte mit Vergnügen zu. Dann machte ich dort mit Herrn Thomas eine Verlaufbillardpartie, welche ich respectabel verlor.
Sonach fuhren wir in ein anderes Clublocal, in welches auch Damen Zutritt haben, und in welchem sich die grossen Spielplätze für Fussball, Criquet, Croquet und Tennis befinden und auch ein Saal für das Balminsterspiel hergerichtet ist. Dort trafen wir verabredeterweise die Frau und die Schwägerin des Herrn Thomas, die auf Bicycles hingekommen waren. Wir spielten vorerst Balminster, eine Art Federballspiel über ein hoch gespanntes Netz, worin ich mich unter den anderen Spielern als Meister erwies. Dann spielten wir Croquet, wo ich aber aus dem Grunde weit zurückblieb, weil ich dieses Spiel schon seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe und an die dort eingeführten, sehr schweren Croquetschläger nicht gewohnt war. Ein plötzlich eintretender Monsum-Regenguss machte dem Spiele bald ein Ende. Tennis konnte des aufgeweichten Bodens halber nicht gespielt werden. Auf diese Weise war der Nachmittag recht unterhaltend vergangen. Wir fuhren heim. Da theilte mir Herr Thomas mit, dass in zwei Tagen in Colombo die Pferderennen beginnen, dass somit bei dem grossen Zuzug von Familien aus dem Innern des Landes das Hôtel überfüllt sein werde und dass er deshalb gleich an den österreichisch-ungarischen Consul telegraphiren wolle, mir ein Zimmer im Hôtel sicherstellen zu lassen. Auch dieser Vorfall zeigt, welche Aufmerksamkeit Herr Dumaresq-Thomas mir zuwendete.
Nach dem vortrefflichen Diner und einer kurzen Whistpartie ging ich bald zur Ruhe, da wir am anderen Tage schon um 6 Uhr frühstücken und um 6¼ Uhr Früh wegfahren mussten, um rechtzeitig bei dem Meet zu erscheinen.
Am 31. Mai langten wir ungeachtet des wieder eingetretenen schlechten Monsumwetters um 7 Uhr Früh zum Meet bei den Moonplains am Fusse der Patnasberge an. Die Moonplains sind in Ceylon dadurch berühmt geworden, weil unter den tiefen Wassertümpeln, die sich in dem kleinen Thale befinden, die sogenannten Mondsteine ausgegraben werden.
Einige Zeit später erschienen der Master der Jagd, sowie auch die Hundsmänner mit zwölf Koppeln (24 Stück) Hunde. Diese Hunde waren von verschiedenen Racen, und zwar vom Foxterrier bis zum Hirschhund. Die letztgenannten Hunde werden an der Kette geführt und erst dann losgelassen, wenn der Elk von den anderen Hunden gestellt worden ist. Dann stürzt sich der Hirschhund auf den Elk und haltet ihn fest, bis der Jäger denselben mit dem Waidmesser killt. Es sollen aber bei diesem Stellen und Killen des Elks schwere Verletzungen von Hunden nicht selten und selbst Todesfälle von Jägern vorgekommen sein. Der Elk ist, wie gesagt, ein Hirsch mittlerer Gattung, kommt im Geweih nicht über den Sechsender hinaus, ist aber sehr kräftig und zähe.
Die Hunde wurden nun losgekoppelt, erkletterten rasch die Lehne und eilten in die von dort aus sich weit auf- und abziehenden Dschungeln in der Suche nach einem Elk. Ich ging über Einladung des Jagdmasters mit demselben und auch Herr Thomas schloss sich uns an, während die übrigen Jagdtheilnehmer in verschiedenen anderen Richtungen den Hunden in die Dschungeln nacheilten. Auch wir erkletterten den Hang und drangen in die Dschungeln ein. Bald darauf hörten wir aus dem Laut der Hunde, dass dieselben einen Elk aufgestöbert hatten. Nun liefen wir, so schnell es in den Dschungeln bergauf und bergab gehen konnte, in einer Richtung vorwärts, in welcher wir den Elk anzutreffen hofften. Dann blieben wir zeitweilig an kleinen, dschungelfreien Stellen momentan stehen, um aus dem Laut der Hunde die Direction zu erkennen, in welcher der Elk weiter vorläuft; hierauf ging es wieder kopfüber in die Dschungeln hinein. Ich wurde von einer Art Jagdfieber ergriffen und kämpfte mich laufend durch die dichtesten Dschungeln durch, glitt auf dem nassglatten Boden aus, stolperte über liegende Aeste, zerkratzte mir Gesicht und Hände und fiel verschiedene Male gewaltig hin; doch beachtete ich dies kaum und lief nur dem vorauseilenden Master nach. Bald ging es vorwärts, bald nach rechts, bald nach links oder auch nach rückwärts, sowie es den Anschein hatte, dem Elk nahe zu kommen. Nachdem wir uns mühsam über eine Stunde in den Dschungeln durchgearbeitet hatten, wurden die Hunde nach und nach still, und dies bewies, dass sie den Elk momentan verloren hatten. Wir gingen nun wieder auf eine dschungelfreie Stelle, wo man aufrecht stehen konnte, um dort den weiteren Fortgang der Jagd zu erwarten. Da kam auch Herr Thomas zu uns heran, nachdem er sich im Verlauf der Jagd von uns getrennt und eine selbstgewählte Richtung eingeschlagen hatte, und erzählte, dass dort, wo er vorausgeeilt war, ein Elk auf ihn zugekommen sei, den er mit einem Seitensprung an sich vorbeitrollen liess, und dass er denselben hätte killen können, wenn er ein Jagdmesser bei sich gehabt hätte.
Nun ging ich mit Herrn Thomas, mich von dem Master trennend, in eine andere Richtung vor, wo nach Thomas' Meinung Aussicht war, dass ein Elk vorbeikommen werde. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde bald dahin, bald dorthin geeilt waren, hörten wir plötzlich auf einer offenen Anhöhe, etwa 500 Schritte von uns entfernt, die Hunde im tollen Laufe Laut geben. Dort wurde also der Elk von den Hunden aus den Dschungeln herausgetrieben, und nun ging es mit Aufbietung aller Kräfte im Laufschritt hinauf auf die Höhe. Als wir dort anlangten, waren der Elk und hintendrein die Hunde schon über die Höhe und von dort auf die jenseitige bewaldete Anhöhe gelaufen. Also jetzt vorwärts längs der Lehne, dann hinunter in das Thal, dort durch morastigen Grund bis an die an der jenseitigen Lehne sich hinziehende Strasse. Das war eine harte Arbeit. Herz und Lunge pochten und keuchten zum Zerspringen, und der Schweiss rann in Verbindung mit dem Wasser des strömenden Regens gemeinsam herab. Auf der Strasse fanden wir den Master und noch andere Jagdtheilnehmer, mit welchen besprochen wurde, die Jagd auf dem vorliegenden Berge fortzusetzen. Es ging also wieder hinauf und oben kreuz und quer, und dort begegneten wir einem Jagdgenossen, welcher einen der Hirschhunde an der Kette mit sich führte. Es schien aber, dass die Jagd zu Ende gehen werde, weil in keiner Richtung mehr ein Lautgeben der Hunde zu vernehmen war. Und so stiegen wir jenseits des Berges wieder thalab, bis zu der dort befindlichen Strasse, wo wir dann einen grossen Theil der Jagdtheilnehmer antrafen. Die Hunde hatten die Spur des Elks verloren und so musste die Jagd nach mehr als dreistündiger Dauer resultatlos geschlossen werden.
Herr Dumaresq-Thomas liess nun die auf der Strasse der Jagd beiläufig nachgefolgten Rikschas herbeiholen, und wir fuhren, nachdem ich noch dem Master meinen Dank für seine Einladung ausgesprochen hatte, heimwärts. Lange aber hielten wir das Fahren nicht aus, denn bei unserer totalen Durchnässung wurde uns zu kalt, und so stiegen wir aus und gingen noch 4 oder 5 km bis zum Astley-House zu Fuss. Dort thaten mir ein tüchtiger Schluck heissen Wassers mit Whisky, ein heisses Bad, tüchtiges Frottiren und frische Kleidung ausserordentlich gut, so dass ich mich dann voll Wohlbehagen fühlte.
Nach dem Tiffin machte ich mit den Damen noch eine nette Whistpartie und nach dem Diner rüstete ich mich zur Abreise. Der liebenswürdige Herr Dumaresq-Thomas begleitete mich bis nach Colombo.
Drei Tage habe ich in dem Hause des Herrn Thomas geweilt und hier das erste Mal das innere Leben einer englischen Familie kennen gelernt, und davon bin ich geradezu entzückt. Ein wahrlich guter Ton, ein ruhiges, heiteres Wesen und angenehme Umgangsformen breiten über das Haus ein einnehmendes und anmuthiges Wesen aus. Die Frau des Hauses besorgt ohne Unterlass den ganzen Tag in friedfertiger Ruhe die Haushaltung, sie lehrt und überwacht ihr Gesinde, controlirt die Einkäufe, leitet die Mahlzeiten u. s. w. Nachmittags sitzen die Damen in traulicher Weise bei einander und sind an der Anfertigung ihrer Toiletten u. s. w. beschäftigt, und Abends nach dem Diner vereinigt eine gemüthliche Whistpartie die Familienmitglieder. Dabei ist die Frau des Hauses stets von Anmuth und liebenswürdiger Heiterkeit erfüllt. Der Herr des Hauses ist immer zuvorkommend und sehr artig, und erfüllt im Uebrigen seine Functionen in Bezug auf seine Besitzungen und als Repräsentant seines Hauses. Die Tage, welche ich im Astley-House auf der paradiesischen Insel Ceylon zugebracht habe, gehören zu den schönsten Momenten während meiner fünfmonatlichen Reise.
Auf dem Bahnhofe in Nuna oya zahlte ich auf meine Retourkarten eine Kleinigkeit auf, um im Waggon ein Bett hergerichtet zu erhalten, und so schlief ich recht gut, bis ich am 1. Juni um 6 Uhr Früh in Colombo anlangte. Auf dem dortigen Bahnhofe verabredete ich mit Herrn Dumaresq-Thomas das Zusammentreffen auf dem Rennplatze bei Colombo und lud ihn, da er am 1. Juni nicht zu mir in's Hôtel zum Diner kommen konnte, für den 2. Juni zum Tiffin ein. Hierauf übergab ich dem in Folge des Telegrammes auf dem Bahnhofe erschienenen Diener des Grand Oriental-Hôtels meinen Gepäcksschein, fuhr in einem Miethwagen in's Hôtel und der Diener führte mir mein Gepäck in einem mit zwei Ochsen bespannten Wagen nach. Solche Ochsenwagen und auch Personenmiethwagen, welche mit Ochsen bespannt sind, gibt es in allen Städten von Indien und von Ceylon. Diese Ochsen sind, wie schon erwähnt, klein, haben einen sehr hohen Widerrist und gehen auf längere Strecken in ununterbrochenem Trab vorwärts.
Im Hôtel wurde mir ein Brief übergeben, welcher die Antwort der Lloyddirection in Triest auf mein Schreiben aus Bombay enthielt. Ich hatte nämlich gebeten, mir eine combinirte Fahrkarte zukommen zu lassen, und zwar für die Fahrt von Kobe bis Colombo und von Port Said nach Triest auf den Dampfern des Lloyd, und von Colombo nach Port Said auf dem Dampfer einer anderen Gesellschaft, und erhielt nun die Antwort, dass die Lloyd-Dampfschiffahrtsgesellschaft mit keiner andern Dampfschiffahrtsgesellschaft im Verbanddienste stehe, dass aber die auswärtigen Lloydagenten mir bei dem Lösen der Karten der andern Gesellschaft nöthigenfalls behilflich sein werden. Auf diesen letztbezeichneten freundlichen Antrag bin ich aber nicht eingegangen, weil die Erfahrungen bei den Lloydagenturen in Kobe, in Hongkong, in Singapore und in Colombo mir nicht die Ueberzeugung verschafft haben, dass die Passagiere des Lloyd dort so eingehende Rathschläge und so zuvorkommende Unterstützung finden werden, wie solche sicher bei der Lloyd-Generalagentur in Bombay jedem Passagier zu Theil werden.
Bei unserem Consul Schulze, welchem ich einen Besuch machte, erfuhr ich, dass das Rennen Nachmittags um 4 Uhr beginnen werde. Von dort fuhr ich in Begleitung des Consulatssecretärs zur Agentschaft der P and O-Dampfschiffahrtsgesellschaft, um dort wegen des in Verlust gerathenen Gepäckstückes nachzufragen. Als mir der Agent mittheilte, dass ungeachtet der sorgsamsten Nachforschung dieses Collo nicht vorgefunden werden konnte, eröffnete ich ihm, dass zwei Zeugen vorhanden seien, welche in Kenntniss davon sind, dass das Gepäckstück mit den alten Waffen auf den Dampfer Coromandel gekommen ist, und zwar: der Hôtelier Hassner vom Hôtel Adelphi in Singapore und der Gepäcksofficier vom Dampfer Coromandel, und dass ich für den Fall, als das Collo mir nicht bald nachgesendet werde, die weiteren Schritte zu unternehmen willens sei. Nun bat der Agent, ihm eine geschriebene Klage einzuhändigen, da er dieselbe an die Direction der P and O-Gesellschaft nach London senden wolle, damit von dort aus die weitere Nachforschung und die Verfügung zur Austragung dieser Angelegenheit getroffen werde. Diese Zuschrift habe ich später gemacht und dieselbe durch die Gefälligkeit des Consulatssecretärs in die englische Sprache übertragen und expediren lassen. Nun will ich hier gleich mittheilen, dass ich zwei Monate später das Gepäckstück von London aus erhalten habe, dass aber der Inhalt theilweise beschädigt war, und mir daraus namhafte Transportsauslagen erwachsen sind.
Dann fuhr ich auf Anempfehlung des Consulatssecretärs in das Lagerhaus des Kaufmannes Telleri, welcher ein Landsmann aus Oesterreich-Ungarn sein soll, um dort irgend etwas von seinen Schmuckwaaren oder Curiositäten zu kaufen. Da aber die Preise der Waaren bei Tellerie beiläufig die doppelte Höhe der ähnlichen Gegenstände in Hongkong oder in Japan betrugen, so kaufte ich nur wenige Kleinigkeiten. Dort wurde mir mitgetheilt, dass sich eben vor kurzer Zeit noch ein Oesterreicher zum Zwecke des Verkaufes von Schmuckwaaren etablirt hatte. Ich fuhr nun auch dorthin und fand die Aufschrift »Moonshine«, zu deutsch »Mondschein«, und beurtheilte den Verkäufer für einen Galizianer. Er besass noch wenige Artikel und so kaufte ich bei ihm nur wenige der in Ceylon heimischen »Mondsteine« zu mässigen Preisen. Endlich fuhr ich dann noch in die Arcade nächst dem Grand Oriental-Hôtel, um bei den dort etablirten Juwelieren die Schmuckgegenstände mit den berühmten Ceylon-Edelsteinen zu besichtigen. Dort war ich bei wenigstens acht solchen Juwelenhändlern, welche sämmtlich aus ihren Gewölben herausgelaufen waren, um mich zur Ansicht ihrer Waaren zu bewegen, und nahm bei Allen wahr, dass sie von ihren gestellten Preisen um die Hälfte und noch mehr herabgingen.
Nach dem Tiffin wollte ich gelegentlich der Fahrt zum Rennplatz in die Villa des Consuls Schulze fahren, um dort seiner Frau noch einen Besuch zu machen, doch konnte der Kutscher, welcher vorher gesagt hatte, er wisse genau, wo die Villa stehe, nicht hinfinden, und so fuhr ich dann weiter auf den Rennplatz. Die Kutscher und die Rikschas sind in Colombo sehr unverlässlich. Dieselben sagen stets beim Einsteigen, sie kennen die ihnen angegebene Adresse, dann fahren sie eine Zeit lang herum und schliesslich gestehen sie, dass sie nicht wissen, wohin sie fahren sollen. Sie thun dies, um sich einen Fuhrlohn zu erwerben.
Der Rennplatz ist gut angelegt und wird in sehr gutem Stand erhalten. Die Pferde gehören einer besseren Classe an als jene, die ich bei den Rennen in Bombay, und einer weit besseren Classe als jene, die ich auf dem Rennplatze in Yokohama sah, denn in Colombo waren gute und schöne, auch aus England importirte oder nach englischen Pferden gezüchtete Rennpferde auf dem Platze erschienen.
Das Rennen gehörte zu den kleinen Racen, während das Hauptrennen im Herbste stattfindet. Es wurden am 1. Juni sieben Items auf flacher Bahn mit den Distanzen von etwas über und etwas unter einem Kilometer geritten. Im Allgemeinen wurde sowohl von den Herren, als auch von den Jockeys gut geritten, wenn auch keinesfalls in jenem Stil und mit jener Eleganz, wie wir sie bei unseren Officiersrennen zu sehen gewohnt sind.
Auf dem Rennplatze traf ich den Consul Schulze, Herrn Dumaresq-Thomas und die beiden deutschen Herren, welche sich mir in Kandy vorgestellt hatten. Ich lud den erstgenannten Herrn für den folgenden Tag zum Tiffin ein, wozu ich schon Herrn Thomas geladen hatte, und ich unterhielt mich während dieses Sportfestes recht gut.
Das Diner nahm ich dann im Hôtel in der Gesellschaft des Herrn v. Blücher und seines Freundes ein und ging frühzeitig zur Ruhe.
Am 2. Juni erhielt ich von der Agentie der Messagerie maritime die Nachricht, dass der Dampfer Australien schon um 4 Uhr Nachmittags abfahren werde, und so musste ich gleich die nöthigen Vorkehrungen für die Abreise treffen. Um 1 Uhr Mittags kamen meine Gäste Thomas und Schulze zum Tiffin, und verlief dasselbe in sehr animirter Stimmung. Der erstgenannte Herr lud mich noch beim Abschiede sehr freundlich ein, im nächsten Winter, in der Zeit von December bis April, auf mehrere Wochen zu ihm zu kommen, auch meinen Sohn mitzubringen, und wenn ich nicht kommen sollte, so möge doch mein Sohn ihn besuchen.
Mein siebentägiger Aufenthalt auf der Insel Ceylon hat mich ausserordentlich befriedigt, und wenn ich somit dem allenthalben landläufigen Dictum mich anschliesse, dass Ceylon das Paradies der Welt sei, so hat hierzu mein Aufenthalt im Astley-House sehr viel beigetragen.
Nach 3½ Uhr fuhr ich mittelst Wagen und dann mittelst Kahn zum Dampfer Australien. Bei dieser Gelegenheit will ich eine dort eigene Art von Kähnen besprechen. Der Kahn ist so schmal gebaut, dass darin nur eine Person der Breite nach sitzen kann, ausserdem ist der Kahn sehr lang und hat senkrecht aufstehende Seitenwände, welche weit über das Wasser hinaufreichen. Um diesem Kahn Stabilität zu geben, verbinden ihn an einer Seite zwei lange, gebogene Hölzer, mit einem gleichlaufend mit demselben auf der Wasseroberfläche schwimmenden Stamme. Dieser Kahn nimmt nebst den zwei Ruderern noch zwei Personen auf und fährt pfeilschnell über das Wasser hin.
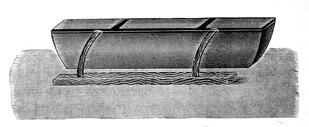
Auf dem Dampfer Australien angelangt, übergab ich persönlich dem Gepäcksofficier meine im Gepäcksraume unterzubringenden Effecten, und stand nur aus dem Grunde von der Ausstellung eines Scheines ab, weil der Officier mir für die richtige Abgabe garantirte.
Auf dem Dampfer zeigte es sich, dass derselbe noch bis Abend mit Aufnahme von Kohle zu thun habe, und dass somit die Abfahrt erst spät Abends stattfinden wird. Die von der Messagerie-Agentie ausgegebene Nachricht von dem früheren Abgang des Australien war demnach unrichtig und es hat dieser Mangel an Voraussicht des Agenten mir leider die Möglichkeit benommen, Nachmittags einem grossen Criquetmatch beizuwohnen, zu welchem ich eingeladen war.
Auf dem Schiffsdeck wurde ich wieder von Schmuckhändlern, welche mit ihren Waaren auf den Dampfer gekommen waren, überlaufen, und sie überflutheten mich mit den Lobpreisungen ihrer Schmuckgegenstände und Edelsteine. Scherzweise drückte ich die gestellten Preise sehr stark herab und so musste ich dann, weil die Händler auf die niedrigen Preise eingegangen waren, noch einige Schmucksachen kaufen.
Eben zu dieser Zeit, als ich auf dem Australien-Deck stand, um die Abfahrt dieses Schiffes aus dem Hafen von Colombo zu sehen, wurde ich gewahr, dass der Lloyddampfer Marquis Bacquehem, welchen ich am 18. Mai in Singapore verlassen hatte, in den Hafen von Colombo einlief.
Am 2. Juni Abends fuhr ich auf dem Dampfer Australien der französischen Dampfschiffahrt Messagerie maritime von Colombo in westlicher Richtung ab, an dem Südcap von Vorderindien vorbei und quer durch den Indischen Ocean gegen den Golf von Aden. Von dort hatte der Dampfer durch das Rothe Meer und hierauf durch den Suez-Canal zu fahren, und sollte nach zehn Tagen, also am 12. Juni, in Port Said eintreffen.
Mir wurde eine Cabine mit zwei Betten zugewiesen. Diese war aber kleiner und schmäler als die Cabinen auf den Lloyd- und auf den P and O-Dampfern sind. Für die Fahrkarte erster Classe hatte ich, wie schon gesagt, von Colombo bis Port Said 500 fl. ö. W., d. i. für jeden Tag 50 fl. zu zahlen, während die Fahrkarte erster Classe von Colombo bis Marseille 570 fl. ö. W., d. i. für jeden der 14½ Tage Fahrtzeit 40 fl., kostet. Wenn auch die Dampfer der Messagerie maritime schneller fahren als die Dampfer der übrigen Gesellschaften, und weiter berücksichtigt wird, dass auf diesem Dampfer das Getränk zu den Mahlzeiten kostenlos beigestellt wird, so sind die Preise doch verhältnissmässig sehr hoch. Auf dem Dampfschiffe der P and O-Gesellschaft hatte ich, wie seinerzeit angeführt, für sechs Tage Fahrt 168 fl. ö. W., d. i. für den Tag 28 fl. ö. W., zu zahlen.
Um sich ein Bild über die Fahrtverhältnisse bei den verschiedenen Dampfschiffahrtsgesellschaften zu machen, folgt nachstehend eine Zusammenstellung der approximativen Fahrtgeschwindigkeit und der Fahrpreise erster Classe auf den Dampfern der vier hervorragendsten Dampfschiffahrtsgesellschaften. Bei der Fahrtgeschwindigkeit sind die Aufenthaltszeiten eingerechnet. Für die Preise erster Classe werden die Fahrt, die Unterkunft in der Cabine, fünf Mahlzeiten, Beleuchtung, Bad u. s. w. geboten; auf den Dampfern der Messagerie auch die Getränke zu den Mahlzeiten.
| Dampfschiffahrtsgesellschaft | Seemeilen per Tag |
Preis per Tag in fl. ö. W. |
Preis für 100 Seemeilen in fl. ö. W. |
|
| Messagerie maritime | 350 | 40·— | 11·43 | |
| P and O | 277 | 28·— | 10·11 | |
| Norddeutscher Lloyd | 280 | 25·50 | 9·11 | |
| Oesterreichischer Lloyd |
Schnelldampfer | 294 | 30·— | 10·20 |
| Gewöhnlicher Dampfer |
für vereinte erste und zweite Classe |
|||
| 166 | 8·50 | 5·12 | ||
Ein sehr verdienstvolles Werk wäre es, wenn Jemand ein Coursbuch für den Personenverkehr der bedeutenden Dampfschiffahrtsgesellschaften herausgeben würde, aus welchen die Fahrtzeiten und die Preise entnommen werden können, wie solche Bücher für die Eisenbahnzüge bestehen. Cook gibt wohl ein ähnliches Buch heraus, es sind aber in demselben nur die Fahrtzeiten und nicht die Preise angegeben.
Ueber die Fahrt von Colombo nach Port Said werde ich gleich die gesammten, während der Fahrt erhaltenen Eindrücke anführen, und werde dann für die einzelnen Tage nur die besonderen Ereignisse anfügen.
Die Reinlichkeit auf dem französischen Dampfschiffe Australien war sowohl im Allgemeinen als auch in den Cabinen viel geringer als jene auf den Schiffen des Oesterreichischen Lloyd und der P and O-Gesellschaft. Bei der letztgenannten Gesellschaft besteht die sehr gute Gepflogenheit, dass der Schiffscapitän mit den dienstfreien Schiffsofficieren um 11 Uhr Vormittags das ganze Schiff und auch alle Cabinen besichtigt, und dass er dabei die Wünsche und Beschwerden der Passagiere entgegennimmt.
Auch die Kost war auf dem Australien nicht so gut und nicht so reichlich bemessen, wie auf den Dampfern des Oesterreichischen Lloyd und der P and O-Gesellschaft.
Die Bewegung des Schiffes, speciell das Rollen, war auf den Schiffen der Messagerie sehr arg, so dass sehr viele Passagiere sich auf demselben unwohl fühlten, und dass manche seekrank wurden. In dieser Hinsicht fährt es sich auf den Dampfern des Oesterreichischen Lloyd am besten.
Die Seekrankheit entsteht häufig aus der Schwierigkeit des Stehens und Gehens auf schwankendem Boden. Beim Stehen soll der Oberleib sich immer nach den verschiedenen Seiten derart neigen, damit er die verticale Haltung einnimmt, und dies kann so schwierig werden, dass man es nur mit dem Anhalten an festen Gegenständen erlangen kann. Beim Gehen kommt noch dazu, dass der Fuss keine gleichmässige Basis findet, dass er bald tiefer und bald höher auftreten muss, und dass dadurch das Schwanken noch ärger wird. Dieses fortwährende Schwanken und die damit in Verbindung stehende Anstrengung erzeugen bei manchen Menschen das Gefühl des Schwindels, und hierzu mag dann noch bei Manchen das Gefühl der Angst hinzutreten. Die Mittel zur Bekämpfung dieses Uebels liegen zum grossen Theil in der Ruhe des Nervensystems, in der Aufnahme der begründeten Ueberzeugung, dass das Umkippen eines so grossen Dampfers ganz unmöglich ist, und in der Angewöhnung des Körpers an die schaukelnde Bewegung, wie dies auf Schaukeln oder auf Schaukelstühlen herbeigeführt werden kann. Alle übrigen angerathenen Mittel betreffs Essens, Trinkens etc. erscheinen nicht massgebend. Jedenfalls wird ein kräftigeres Nervensystem einem solchen Unwohlsein viel besser widerstehen können, als ein geschwächtes oder ein krankes Nervensystem.
Was die Ventilation anbelangt, so war für selbe auf Australien sehr gut gesorgt, und dies ist eine Massregel, welche bei der grossen Hitze in den Tropen sehr wohlthuend wirkt.
Die Gesellschaft der ersten Classe auf dem Dampfer bestand aus 70 Personen, darunter etwa 20 Engländer und Engländerinnen, etwa 20 französische Officiere, welche nach 1½ jähriger Dienstverrichtung in Tonking wieder nach Frankreich versetzt wurden, etwa 10 andere Franzosen, dann 10 Spanier, welche von den Philippinen flohen und nun nach Spanien zurückkehrten, und 10 Personen verschiedener Nationalitäten, worunter auch ich mich befand. Dabei gab es leider viele Kinder jeden Alters, und unter diesen Kindern viele, die schlecht erzogen, und unter den betreffenden Müttern manche, welche ihren Kindern zu Liebe gegen die Mitreisenden recht rücksichtslos waren. Das gesellschaftliche Verhalten der Reisenden in der ersten Classe war weit weniger angenehm, als auf dem Dampfer des Lloyd und auf jenem der P and O-Gesellschaft. Lärmen, Pfeifen etc. und mangelhafte Toiletten waren hier nicht selten. Die Engländer, welche sich auf ihren Schiffen so correct benehmen, zeigten sich hier weit weniger ruhig und zurückhaltend. Ich verhielt mich ganz zurückgezogen, machte mich nur mit dem Schiffscapitän bekannt und ersuchte ihn, mich den anwesenden zwei höchsten französischen Officieren zu nennen, weil ich dies, als auf dem französischen Boden befindlich, für angezeigt erachtete. Diese beiden Herren, ein Oberst der Infanterie und ein Linienschiffscapitän, waren sehr artig und höflich, doch blieb ich auch gegen diese beiden Herren nur auf dem Begrüssungsfusse. Meine Tischnachbarn waren der Holländer N. v. H. und der russische Schiffsingenieur L. mit seiner Frau, und mit diesen führte ich während der Mahlzeiten Conversation, mit Ersterem spielte ich auch Abends auf dem Damenbrett oder Domino und dergleichen. Bezüglich des russischen Ingenieurs will ich noch mittheilen, dass ihm als russischen höheren Beamten der Titel »General« zukam, und dass er von Wladiwostok, dem Orte, an welchem die der Vollendung entgegen gehende sibirische Bahn ihren Abschluss finden wird, nach Petersburg versetzt wurde.
Im Uebrigen beschäftigte ich mich Vor- und Nachmittags mit dem Schreiben meines Tagebuches und mit Lectüre, und befand mich dabei sehr wohl. Mein Hüftschmerz war wohl nicht ganz behoben, bestand aber doch nur, dank meiner täglichen Früh- und Abendbehandlung, im geringen Masse.
In der Zeit vom 2.-7. Juni fuhren wir quer durch den Indischen Ocean und hatten dabei grosse Hitze, hie und da auch Regengüsse und meistentheils heftigen Wind, somit starkes Rollen des Schiffes zu ertragen. Der gefürchtete Monsum meldete sich auf diese Weise an, war aber noch nicht voll eingetreten.
Am 7. Juni hatte sich ein heftiger Orkan erhoben, und dieser brachte den Australien in ein derartiges Rollen und überschüttete das Deck in so starker Weise mit Wogenschaum, wie ich solches bisher nicht erlebt hatte. Mein Wohlbefinden wurde aber dadurch nicht berührt. Um 2 Uhr Mittags, als das Schiff längs der Nordküste der Insel Sokotra vorbeifuhr, trat rasch windstilles Wetter und ganz ruhige See ein, worüber die armen Seekranken hoch erfreut waren. Diese Insel liegt nahe der Nordostspitze von Afrika am Eingange in den Golf von Aden.
Am 8. Juni durchfuhren wir diesen Golf bei spiegelglatter See. In der Luft befand sich Nebel, daher waren der Himmel hellblau, der Sonnenschein getrübt und die Temperatur schwül. Am südlichen Horizont sah man das Somaliland. Die Hitze nahm zu, und damit stellte sich ein unstillbarer Durst ein, welcher gelöscht werden musste. In den Tropen ist es nicht gerathen, viel geistige Getränke zu sich zu nehmen; da aber das Trinken nur destillirten Wassers zu fade ist und hier auf dem französischen Schiffe Whisky mit Soda nicht gebräuchlich war, so trank ich mit Wasser verdünnten Wein, wozu die Diener reichlich Eisstücke zugaben oder sehr viele Tassen Thee, welche ich mit kaltem Wasser verdünnte. Auf den Schiffen kann das Eis unbesorgt in das Getränk gegeben werden, weil dasselbe aus destillirtem Wasser erzeugt ist.
Die Nacht vom 8. zum 9. Juni war entsetzlich. Ich musste nämlich das Fenster meiner Cabine schliessen, weil sonst eine so arge Zugluft entstanden wäre, die eine weitere Verkühlung trotz angezogener Wollnachtkleider herbeigeführt hätte, dann jedoch befand ich mich in einem derartigen Schwitzbade, dass meine Wollkleider ganz durchnässt waren. Aber auch diese Nacht hatte ein Ende, und das in der Früh genommene 22° R. betragende Meerwasserbad brachte doch einigermassen Abkühlung.
Am 9. Juni fuhren wir durch die Wasserstrasse von Babel Mandeb (Thor der Thränen) in das wegen seiner formidablen Hitze gefürchtete Rothe Meer. Eine kühle Nordbriese behütete mich vor allzu grossen Leiden, und auch die Nacht war besser, als die vorhergegangene.
Auch am 10. Juni brachte uns eine Nordbriese in wohlthätiger Weise etwas Kühlung zu. Im Laufe des Vormittags begleiteten das Schiff eine Strecke weit eine Schaar von Delphinen, welche sich durch Springen über die Oberfläche des Meeres bemerkbar machten.
Am 11. Juni (Sonntag) las ein mit dem Schiffe reisender katholischer Missionär, mit langem grauen Bart, die Messe und derselben wohnten alle auf dem Schiffe anwesenden Katholiken bei.
Wir waren bei Passirung des Rothen Meeres sehr begünstigt, denn bei heiterem Himmel blies ein frischer Nordwind immer heftiger, welcher die glühend heisse Luft abkühlte und dabei doch nicht so heftig war, dass das Schiff in starke Schwankungen versetzt wurde.
Am 12. Juni war in Folge des fortgesetzten Nordwindes die Temperatur schon so mässig geworden, dass statt der Leinenkleidung solche aus Wolle genommen werden musste. Nach dem Fahrplan der Messagerie maritime hätte der Dampfer heute nach Port Said gelangen sollen, es wurde aber durch den entgegen blasenden Wind etwas an Zeit verloren, und so kommt das Schiff heute um 3 Uhr Nachmittags nach Suez und wird erst am 13. Juni etwa 9 Uhr Früh in Port Said eintreffen.
In Suez wurde das Deck des Schiffes von Kaufleuten überschwemmt, welche ihre Waare, auf dem Boden ausbreitend, zum Verkaufe feilboten. Darunter befand sich viel werthloser Kram, aber auch sehr schöne und gute Waaren, welche jedoch sämmtlich im Preise zu hoch gestellt waren. Ich erstand nach längerem Feilschen ein Spitzentuch, welches sehr gut zu sein scheint, weil vorher mehrere Damen dasselbe bewundert hatten.
Wegen des kurzen Aufenthaltes in Suez überschiffte ich mich nicht auf's Land, gab aber ein Telegramm an das Consulat in Port Said auf, in welchem ich bat, dortselbst einen Hôtel-Boy auf das Schiff senden und bei der Lloydagentur einen Platz für mich reserviren zu lassen.
Die Einfahrt in den Suez-Canal, sowie die weitere Fahrt in demselben war, wie immer, höchst interessant. Ich habe darüber schon geschrieben, und ich will nur noch erwähnen, dass für die Erhaltung des Canales wenig geschieht, dafür aber die dort Angestellten überaus gut leben, und dass auch sehr grosse Dividenden ausgezahlt werden. Der Ausblick auf die beiderseits des Canales sich unabsehbar ausdehnende Wüste mit allen den Sandwellen und Sandhügeln im gelben Abendsonnenschein fascinirte mich in ebenso hohem Masse, wie bei der Hinfahrt.
Am 13. Juni Früh hatte ich mein Gepäck für die Ueberschiffung nach Port Said bereit gestellt und wartete nach der Einfahrt unseres Dampfers in den Hafen auf den Boy, welcher meine Colli übernehmen und in das Hôtel bringen sollte. Dieser Boy kam aber nicht, sondern es erschien der Vertreter des Consuls, nachdem Consul M. auf Urlaub gefahren war, und brachte mir die für mich sehr fatale Nachricht, dass die von Bombay nach Triest verkehrenden Lloydschiffe, der Pest in Aegypten halber, in Port Said keine Passagiere aufnehmen dürfen. Es werden also von Oesterreich-Ungarn strengere Massregeln gegen die Einschleppung der Pest getroffen als von Frankreich, denn die Schiffe der Messagerie maritime nehmen in Port Said anstandslos Passagiere auf und laufen vier Tage später ungehindert in den Hafen von Marseille ein.
Ich war demnach gezwungen, meinen Plan für die Weiterreise wieder zu ändern. Vorerst erwog ich, ob es nicht am zweckmässigsten sei, von Port Said nach Alexandrien zu fahren, mich dort in dem jeden Samstag nach Triest abgehenden Lloyddampfer einzuschiffen und dann vor Triest eine achttägige Quarantaine mitzumachen. Darauf theilte mir jedoch der Consulstellvertreter mit, dass er bestimmt wisse, in Alexandrien seien schon auf mehrere Wochen hinaus alle Plätze auf den Lloyddampfern vergeben, weil von dort sehr viele Europäer, der Pest halber, fliehen. Hiermit entfiel diese Unternehmung und es blieb mir nichts Anderes zu thun übrig, als mit dem Dampfer Australien weiter bis Marseille zu fahren, um von dort dann in die Heimat zu gelangen. Dies war für mich wohl sehr unangenehm, weil daraus einerseits bedeutende Mehrauslagen erwuchsen, und weil mir andererseits die Beschwerlichkeit einer sehr langen Eisenbahnfahrt bevorstand; ich ertrug aber mit Ruhe dieses auf mir ruhende Fatum, nur mit Bewältigung vieler Schwierigkeiten heimkehren zu können, und liess mir meine gute Stimmung nicht verderben, sondern suchte nun die besten Verhältnisse für die Weiterreise zu finden.
Vorerst theilte ich dem Gepäcksofficier von Australien mit, dass ich weiterfahren werde, und bat ihn, meine Cabine nicht an neu eintretende Passagiere zu vergeben und mein Gepäck bis nach Marseille weiter zu führen; dann löste ich in der Messagerie maritime-Agentur zu Port Said die Karte zur Weiterfahrt nach Marseille um 70 fl. ö. W., und endlich erhob ich, dass die beste Linie für die Heimkehr von Marseille jene über Paris nach Wien sei. Von Marseille geht täglich nach 7 Uhr Abends ein Eisenbahnzug nach Paris ab und dieser langt dort am folgenden Tage, etwa 9 Uhr Früh, an. Von Paris geht dann wieder Abends ein Eisenbahnzug ab, welcher nach circa 24 Stunden in Wien eintrifft. Die Fahrkarte erster Classe von Marseille nach Paris kostet 95 Francs und jene von Paris bis Wien 195 Francs, also beträgt der Preis für die Bahnfahrt 290 Francs oder etwa 140 fl. ö. W. Es bleibt mir dann ein Tag zur Besichtigung des mir ohnehin schon bekannten Paris zur Verfügung.
Nun ging es wieder weiter, und zwar in das Mittelländische Meer hinaus. Die Route des Dampfers geht durch die Wasserstrasse von Messina zwischen Italien und Sicilien, dann durch jene von Bonifacio zwischen den Inseln Corsica und Sardinien nach Marseille, und es soll dieser Hafenplatz in vier Tagen, also am 17. Juni, erreicht werden.
Am 14. Juni war das Wetter klar, aber windig und so kühl, dass man sich in Wolle kleiden musste. Im Laufe des Nachmittags kamen die Berge und die Südküste von Kandia zu Gesicht, und ich dachte zurück an die Zeit, in welcher ich diese Insel vor etwa fünf Monaten gesehen habe, als ich auf dem Lloyddampfer Maria Theresia in freudevoller Hoffnung in die Ferne hinausfuhr, und nun fühlte ich mich hoch befriedigt über das grosse Vergnügen, welches mir diese Reise bereitet hat.
Am 15. Juni waren die gleichen Witterungsverhältnisse wie am Tage vorher. Nachmittag sah ich die Berge von Süditalien und im Laufe der Nacht durchfuhren wir die Meerenge von Messina und kamen an der einst so gefürchteten Scylla und Charybdis vorbei.
Der 16. Juni ist der letzte volle Tag, welchen ich auf dem Dampfer Australien der französischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft Messagerie maritime verlebte, und da will ich nun noch meine weiteren Erfahrungen über die Existenz auf diesem Schiffe mittheilen. Der Mangel an Reinlichkeit auf dem Schiffe zeigte sich auch darin, dass Bettwäsche, Handtücher, Servietten u. s. w. recht selten gewechselt, und dass das Putzen der Kleider und Schuhe recht mangelhaft war. Die Bedienung war nicht sorgsam und bei der Kost musste ich es sehr oft beklagen, dass alle Gattungen gekochten oder gebratenen Fleisches recht zähe, hie und da auch angebrannt waren. Wie schon erwähnt, wurde das Leben auf dem Dampfer auch durch das den ganzen Tag währende Schreien, Quitschen und Tollen der Kinder verbittert. Wenn schon die betreffenden Eltern dies ungeahndet geschehen liessen, so hätte doch der Schiffscapitän oder einer seiner Organe zum Wohl der übrigen Passagiere dagegen einschreiten sollen. Aber auch in dieser Hinsicht war keine Einwirkung wahrnehmbar, dagegen wurden die Passagiere gedrängt, Geldspenden zu geben, und zwar einerseits in Form einer Lotterie für ein kleines Schiffchen zu dem Zwecke, den Erlös der Schiffsmannschaft des Dampfers zukommen zu lassen, und andererseits in Form eines recht unmusikalischen Concertes, um den Ertrag desselben der Sammlung für die verunglückten französischen Schiffsleute zuzuwenden.
Am 17. Juni langten wir endlich um 2½ Uhr Nachmittags im Hafen von Marseille an. Bis wir aber vom Schiff auf's Land kamen, vergingen beinahe drei Stunden, weil die hygienischen Massregeln in nachstehender Weise getroffen wurden. Zuerst fuhr der Schiffscapitän in einer Zille auf's Land, dann langte nach ½ Stunde ein französischer Arzt auf dem Dampfer an und verfügte, dass jeder Passagier in einem Blankette des »Passeport sanitaire« seinen Namen, den Ort der Herkunft und den Ort des künftigen Aufenthaltes eintrage. Dann unterschrieb der Arzt alle Passeports sanitaires, vertheilte sie wieder an die Passagiere und somit konnten diese, ohne vorher ärztlich untersucht worden zu sein, und ohne dass das Gepäck desinficirt worden wäre, vom Schiffe auf das Land gehen.
Ich übergab zu diesem Zwecke meine 13 Gepäckstücke an den Bediensteten der Speditionsfirma King, einem Wiener, welcher auf den Dampfer Australien gekommen war, und bezeichnete ihm jene sechs Stücke, welche ich mit mir nehmen wollte, und die übrigen sieben Colli, welche mittelst Fracht an mich nach Wien zu senden sein werden. Nach Passirung des Zollamtes, wo von den Effecten nichts visitirt worden war, fuhr ich zum Bahnhof und von dort um 7 Uhr Abends nach Paris, wo ich am andern Tag um 9 Uhr Früh anlangte.
In Paris wollte ich am 18. Juni verweilen und hierzu stieg ich in dem Terminus-Hôtel ab. Nachmittags fuhr ich mit dem holländischen Herrn, welcher sich mir auf dem Schiffe angeschlossen hatte, über den Boulevard, die Champs elysées, den Arc de triomphe und das Bois de Boulogne zu den Rennen nach Auteuil, und dann besichtigte ich auf der Rückfahrt von Auteuil nach Paris den eben an diesem Tage stattfindenden grossen, historischen Festzug, welcher jedes Jahr um diese Zeit abgehalten wird. Bei diesem Festzuge erscheinen in der Tracht aus dem 13. Jahrhundert Soldaten und Zünfte zu Fuss und zu Pferd, grosse allegorische Carossen und prachtvoll ausgestattete Schiffe und Musikcorps, welche in ähnlichen Trachten die zeitgemässen Tonstücke spielen. Endlich sah ich auch den Ausstellungsraum für das Jahr 1900 und nahm dort wahr, dass schon eine immense Zahl von kolossal grossen Gebäuden errichtet wurde.
Nach 7 Uhr Abends fuhr ich mit dem Orientexpresszuge von Paris nach Wien ab. Als ich dann am 19. Juni in mein geliebtes Vaterland gelangte und wieder unsere schönen bewaldeten Berge, die grünen Fluren, die heimlichen Wohnräume, sowie die lieben, guten Landsleute gewahrte, dann erweiterte sich das Herz in Freude und meine tiefen Gefühle gaben deutlich Zeugniss davon, dass die Vaterlandsliebe in des Menschen Brust tief begründet ist.
Nach einer 24 stündigen Eisenbahnfahrt, also am 19. Juni, um 7 Uhr Abends, langte ich in meinem geliebten Wien an und somit war meine Reise beendigt.
Nachfolgend gebe ich die Ausgaben genau specialisirt an, welche ich ohne Einbeziehung der besonderen Einkäufe während der Reise gemacht habe, und bemerke hierzu, dass die Auslagen in vielen Fällen, speciell in Bombay, hätten bedeutend vermindert werden können.
Dieser Betrag, auf die Zeit von fünf Monaten repartirt, ergibt für jeden Monat circa 484 fl. ö. W. Die Höhe dieses Betrages ist hauptsächlich durch den Wechsel der Schiffe und den Umweg über Marseille und Paris entstanden.
Wenn ich nun nach den gemachten Erfahrungen noch einmal eine Reise nach Indien, China und Japan machen wollte, so würde ich dieselbe nach einen der beiden nachfolgenden Reisepläne unternehmen:
A. Vom 23. October bis 16. November Lloyddampfschiffahrt von Triest nach Bombay.
Vom 16. November bis 7. Jänner Besichtigung von Bombay, Eisenbahnfahrten nach und Besichtigung von Delhi (Rom von Asien), Agra mit den herrlichsten Bauwerken der Welt, Benares (Mekka der Indier), Calcutta (Sitz der englischen Regierung) und Darshilling, reizend 7200 Fuss hoch auf dem Himalaya gelegen.
Vom 7. bis 13. Jänner Lloyddampfschiffahrt von Calcutta nach Colombo.
Vom 13. Jänner bis 26. Februar Aufenthalt auf der Insel Ceylon.
Vom 26. Februar bis 27. März Lloyddampfschiffahrt von Colombo über China nach Japan.
Vom 27. März bis 30. April Aufenthalt in Japan.
Vom 30. April bis 1. Juli Lloyddampfschiffahrt von Kobe über China und Indien nach Triest.
Die Auslagen für diese 8¼ Monate währende Reise würden beiläufig betragen:
| Lloyddampfschiffahrt von Triest nach Kobe und zurück, sowie von Calcutta nach Colombo sammt Verpflegung nach dem allgemeinen Tarif mit 20% Nachlass für die Hin- und Rückkarte mit neunmonatlicher Dauer circa | 870 | fl. ö. W. |
| Getränke und Bedienung für die ausgewiesenen 118 Tage circa | 150 | " |
| Aufenthalte und Eisenbahnfahrten in Indien und Ceylon für 96 Tage reichlich mit 18 Rupien = 14·40 fl. ö. W. per Tag berechnet macht | 1380 | " |
| Aufenthalt in Japan, 34 Tage reichlich mit 12½ Yen = 15 fl. ö. W. per Tag macht | 510 | " |
| Summe der Auslagen | 2910 | fl. ö. W. |
Nach dem Officierstarif auf dem Lloyd vermindert sich der Betrag um 90 fl. ö. W., mithin entfällt nach dem allgemeinen Tarif auf den Monat circa 353 fl. und auf den Tag 11 fl. 64 kr., nach dem Officierstarif auf den Monat circa 342 fl. und auf den Tag 11 fl. 28 kr.
B. Vom 23. October bis 16. November Lloyddampfschiffahrt von Triest nach Bombay.
Vom 16. November bis 7. December Besichtigung von Bombay, Eisenbahnfahrt nach und Besichtigung von Delhi, Agra, Benares, Calcutta und Darshilling auf dem Himalaya.
Vom 7. bis 13. December Lloyddampfschiffahrt von Calcutta nach Colombo.
Vom 13. December bis 26. Jänner Aufenthalt auf der Insel Ceylon.
Vom 26. Jänner bis 3. Februar Lloyddampfschiffahrt von Colombo nach Singapore.
Vom 3. Februar bis 7. März Aufenthalt in Singapore, Fahrt nach und Aufenthalt in Bangkok, der Hauptstadt von Siam und Fahrt nach Singapore.
Vom 7. bis 27. März Lloyddampfschiffahrt von Singapore nach Kobe in Japan.
Vom 27. März bis 30. April Aufenthalt in Japan.
Vom 30. April bis 1. Juli Lloyddampfschiffahrt von Japan über China und Indien nach Triest.
Die Auslagen für diese ebenfalls 8¼ Monate währende Reise würden beiläufig die gleichen sein, wie solche oben sub A angegeben wurden.
Nun will ich noch das Eingangs erwähnte Gutachten über die von mir getroffenen Vorkehrungen zur Reise abgeben.
Die Kenntniss und das Verständniss der englischen Sprache sind unbedingt erforderlich, weil sonst der Genuss der Reise sich in hohem Grade vermindern würde.
Einen wesentlichen Vortheil bringt es den Reisenden, sich Vorschreiben zu verschaffen und rechtzeitig die Ankunft in den zu berührenden Orten an die zur Unterkunft gewählten Hôtels bekannt zu geben. Die vorhergehende Lectüre von Beschreibungen der zu durchziehenden Länder ist sehr angezeigt. Ich wählte hierzu: »Tagebuch meiner Reise um die Erde 1892/93 von Sr. k. u. k. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Franz Ferdinand«, die zwei Bände »Japan« von Baron Siebold, die zwei Bände »Autour du monde« von Baron v. Hübner, und die zwei Handbücher »Indien«, sowie »Japan« von Murray. Die Mitnahme eines Creditbriefes für verschiedene, in den zu bereisenden Ländern etablirte Banken ist geboten. Es sollte aber für die Erhebung von Geld ein allgemein giltiger Abzug festgestellt werden, damit diese Banken nicht nach Willkür vorgehen können.
Von den mitgenommenen Bekleidungssorten habe ich mit Ausnahme des Klapphutes und des weissen Filzhutes im Laufe der fünf Monate jedes einzelne Stück benöthigt. Den Cylinder und einige Paare Glacéhandschuhe habe ich nur bei den officiellen Besuchen in Tokio gebraucht, weil in den beschriebenen Ländern die Herren weder solche Hüte noch Handschuhe tragen. Von den Oberkleidern hätte ich am ehesten die Jagdkleider und den Jaquet-Anzug entbehren können. Betreffs der Unterkleider erscheint es rathsam, so wie die Engländer Tags über leichte Flanell- und nur zum Diner gesteifte Leinenhemden zu tragen. Es kann dann die Zahl der letzteren im Vergleiche zu jener, die ich mitgenommen habe, verringert, dagegen muss eine grössere Zahl der ersteren mitgenommen werden.
Für die Tropenländer habe ich in Port Said und in Bombay den Tropenhut, weisse und färbige Leinenanzüge, Merinoleibchen, Leibbinden, weisse Zeugschuhe und weissen Sonnenschirm angeschafft.
Jagdzeug ist nur dann mitzuführen, wenn ein längerer Aufenthalt in Aussicht genommen ist und wenn für die Jagd entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Desgleichen ist auch Bettzeug nur in dem Falle erforderlich, wenn ein Eindringen in das Innere des Landes bevorstehen sollte.
Eine bedeutende Ermässigung der Auslagen in den Städten kann durch Erwerbung und Ausgabe der Hôtel-Coupons von dem Reisebureau Cook & Comp. erreicht werden.
An Cigarren hätte ein Drittheil der beigeschafften Menge genügt, weil man in den bezeichneten Ländern gute Cigarren zu mässigen Preisen erhalten kann.
Von den mitgenommenen Medicinen habe ich in den fünf Monaten nur ein- oder zweimal Soda, Fiakerpulver, Opium und Salicyl, dagegen öfter die Leinen- und Flanellbandage sammt Kautschukpapier gebraucht.
Das Mitnehmen von hergerichteten Adressen, um selbe auf Ansichtskarten zu kleben, hat sich nur theilweise vortheilhaft erwiesen, weil die Postbehörden in Hinterindien und auch an manchen Orten in Japan Anstand erhoben, solche Karten mit aufgeklebten Adressen zu expediren. Die Briefe an die Reisenden sollen mit dem Namen derselben, ferner mit dem Namen des Dampfers, auf welchem dieselben die Reise unternehmen, mit dem Bestimmungsort und mit der Anweisung: »Agentur des Oesterreichischen Lloyd« adressirt werden.
Das Versehen aller Gepäckstücke mit dem Namen des Besitzers ist sehr wichtig und wird auf den Dampfschiffen gefordert.
So eine überseeische Reise verursacht eine unvergleichliche Freude, sie regt den Geist lebhaft an und kräftigt den Körper. Es ist eine wahre Lust, auf einem guten Dampfschiffe über das Meer hinzugleiten, wochenlang die gesunde Meeresluft einzuathmen, den freien Ausblick nach allen Richtungen auf den weiten Ocean und auf das Firmament in seinen verschiedenartigen Gebilden zu geniessen, ferner sich nach Belieben frei bewegen, lesen, schreiben, spielen und ruhen zu können, und endlich auch durch gute Mahlzeiten behaglich erfrischt zu werden. Treten auch hie und da Unannehmlichkeiten ein, sei es durch arges Schaukeln des Schiffes, sei es durch abnorme Hitze, so werden diese doch leicht überwunden, einerseits in der Betrachtung des schönen Bildes, welches das Meer eben dann darstellt, wenn es vom Sturme aufgewühlt wird, und andererseits in dem Genusse der erfrischenden Seewasser-Douchen und Wannenbäder.
Bereitet schon die Wasserfahrt ein hohes Vergnügen, so steigert sich dasselbe in vielfältiger Weise und in erhöhtem Masse bei den Besuchen der verschiedenen Handelsplätze durch Betrachtung, Beobachtung und Erforschung der sich dort entfaltenden neuen Formen und Gestalten und des fremdartigen Lebens; weiteres Eindringen in das Innere der Länder vermehrt nicht nur dieses Vergnügen, sondern ist auch von hervorragendem Interesse.
Aber nicht nur Lust und Freude erzeugt das Reisen, sondern es kann auch die Basis für einträglichen Erwerb, für ergiebigen Gewinn oder zur Erlangung einer dauernden und werthvollen Lebensstellung werden, und zwar nicht nur für Handels- oder Kaufleute, sondern auch für Aerzte, Ingenieure, Techniker, Mechaniker, Chemiker oder Elektrotechniker. Auf diese Weise wird sich die intelligente Bevölkerung, welche das Mutterland nicht immer hinreichend beschäftigen und entlohnen kann, eine gedeihliche Thätigkeit erwerben und dort mit den Waffen des Geistes und mit der Thatkraft der Initiative nicht nur materielle, sondern auch ethische Erfolge erringen.
Der Reichsraths- und Landtagsabgeordnete Baron Kübeck spricht sich in seinem am 28. März 1898 gehaltenen Vortrage über den überseeischen Handel in dieser Hinsicht dahin aus, dass Oesterreichs innere Kraft nur im lebhaften Wechselverkehr mit der Aussenwelt genährt und gestählt werden kann, während sie durch Isolirung unter den heutigen Verhältnissen verkümmern und verschrumpfen müsste. Rings um unsere Grenzen besteht Rührigkeit in den Handelskreisen für den Welthandel, und nur bei uns herrscht darin theils Unlust, theils Apathie. Es ist bekannt, dass heute viele Erzeugnisse österreichischer Provenienz durch die Vermittlung englischer oder auch deutscher Handelshäuser auf den transatlantischen Markt und dort unter fremder Firma an den Mann gelangen. Unsere Consuln wissen darüber sehr eingehende Schilderungen zu geben.
So wie überhaupt im Leben sich Lust und Unternehmungsgeist nur entwickeln können, wo genaue Kenntniss und klares Verständniss in der angestrebten Richtung vorhanden sind, so wäre es zur Belebung unseres Welthandels sehr angezeigt, wenn von den grossen industriellen und mercantilen Häusern der Monarchie geeignete Kräfte, die Lust und inneren Trieb dazu besitzen, in die fernen Länder entsendet würden, welche dort die Verhältnisse für Export and Import gewissenhaft zu recognosciren, die Handelsconjuncturen zu erforschen, sowie etwa Verbindungen anzubahnen und hierüber ihren Absendern genaue und erschöpfende Nachrichten zu geben haben. Daraus werden sich die richtigen Folgerungen ableiten lassen, es werden in günstigen Lagen sich Handlungshäuser oder Verkaufshallen etabliren und gewinnbringend werden, und diese Häuser werden die Pflanzstätte bilden für den Nachwuchs von tüchtigen Geschäftsleuten für den Welthandel. Unser Consul in Hongkong ist, wie ich schon anführte, bereit, den statistischen Nachweis zu liefern, dass sich die Kaufleute in der dortigen Gegend binnen etwa 30 Jahren Vermögen erworben haben.
Es wäre dringend zu wünschen, dass die in unserer Bevölkerung noch von altersher bestehende, ganz ungerechtfertigte Scheu gegen grosse Seereisen behoben, dass in unseren industriellen und mercantilen Kreisen die Wichtigkeit des Welthandels erfasst und dass bei denselben dafür ein wetteifernder Unternehmungsgeist zur Thätigkeit gelangen würde.
Unsere Handelsmuseen informiren diese Kreise in allgemeinen Zügen über die Bedürfnisse der weitabliegenden Völkerschaften, die von ihnen zur Recognoscirung hinausgesendeten Agenten werden die näheren Aufklärungen schaffen und unsere Consulate werden sie sicher in allen billigen Wünschen unterstützen.
Es werden aber auch vom Staate und von Gesellschaften entsprechende Massregeln zu treffen sein, um eine immer zahlreichere Bethätigung zu ermöglichen und zu fördern, sowie um günstige Resultate zu erzielen. Von solchen Vorkehrungen sollen nur nachstehende angedeutet werden: Die Schulbildung und die Erziehung der Jugend sollte bei der Entwicklung des Geistes und des Körpers die Anforderungen des praktischen Lebens mehr im Auge behalten und ähnlich der englischen Manier nicht zu vielerlei lehren, dafür aber dem Brotstudium mehr Gründlichkeit zuwenden, und schliesslich sollte mit Rücksicht auf die überaus grosse Verbreitung der englischen Sprache in der Welt auf die Erlernung dieser Sprache ein grosses Gewicht gelegt werden.
Zur Erleichterung des Personen- und Frachtenverkehres aus dem Innern des Reiches zu den Häfen sollten insbesondere die Tarife der Süd- und der Nordbahn ermässigt werden, aber auch alle übrigen Bahnen sollten die heutigen enorm hohen Transportkosten des Reisegepäckes herabsetzen, und endlich sollten bei den Zollauslagen die bedeutenden Nebengebühren entfallen, sowie bei den Zollämtern ein ähnlich coulanter Vorgang geübt werden, wie er zumeist bei den Postämtern besteht. Die österreichischen und ungarischen Dampfschiffahrtsgesellschaften, in dem vorliegenden Falle der Lloyd, werden einem ausgedehnteren Handelsverkehr Rechnung zu tragen, für den Transport der Waaren nach aus- und einwärts einen gleichmässig billigen Tarif aufzustellen und nach Bedarf die Schiffszahl zu vermehren haben.
Zur Erweiterung des Verkehres auf dem Meere würde es sich auch empfehlen, den Schiffbau in unseren Küstenländern, namentlich in Dalmatien, zu unterstützen und zu fördern.
Auf die Nothwendigkeit unserer Rüstung für den immer drohender werdenden Kampf gegen die überseeische Concurrenz wurde schon häufig hingewiesen und dabei hervorgehoben, dass zur erspriesslichen Betheiligung an dem Welthandel eine mächtige Kriegsflotte erforderlich wäre. Heute ist in den beschriebenen Ländern Asiens der Bestand der österreichisch-ungarischen Monarchie nur wenig bekannt. Werden sich aber künftig in den Handelsplätzen häufig Kriegsschiffe unter unserer Flagge zeigen, so wird das Ansehen der Monarchie dort sehr wachsen, unsere Consuln werden eine einflussreichere Stellung einnehmen, wenn sie auf die ehernen Zungen der Kriegsschiffe hinweisen können, und ebenso wird den Handelshäusern, Kaufleuten und Handelsschiffen eine bedeutende moralische Unterstützung geboten werden, wenn ihnen die Macht des Vaterlandes schützend zur Seite steht.
Was nun die Erwerbung eines entsprechenden Gebietes in jenen Ländern und die Gründung einer Niederlassung daselbst anbelangt, so ist es wohl fraglos, dass die Bildung eines maritimen Stütz- und Verproviantirungspunktes zur weiteren belebenden Anregung für den auswärtigen Handel sehr förderlich wäre.
Es erscheint demnach aus Gründen der allgemeinen und individuellen Wohlfahrt unbedingt geboten, dass seitens der österreichischen und ungarischen Bevölkerung die Initiative ergriffen wird, welche sich in zahlreichen Reisen nach den überseeischen Ländern und in der Entwicklung von Unternehmungen äussern müsste, dass die Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsgesellschaften zu ihrem eigenen Vortheile die Bewegungen bestens erleichtern, und dass der Staat zur Ausdehnung und Kräftigung der Weltwirthschaft mit seiner vollen Macht unterstützend eingreife.
Und so schliesse ich mein bescheidenes Tagebuch über die Erlebnisse, Wahrnehmungen und Eindrücke meiner ebenso genuss- als lehrreichen Reise, und ich hege hierbei nur den innigen Wunsch, dass diese Blätter dazu dienen mögen, bei meinen Landsleuten die Reiselust zu wecken und den Unternehmungsgeist mächtig zu fördern. Sollte ich zu dieser grossen, für die geistige und materielle Entwicklung, sowie für die Machtstellung unseres geliebten Vaterlandes überaus wichtigen Aufgabe ein kleines Scherflein beitragen, so wäre ich wohl für alle Mühe und allen Fleiss, welchen ich bei der Zusammenstellung meiner Reisebeschreibung aufwandte, reichlich belohnt!

Der Text des Originalbuches wurde grundsätzlich beibehalten, mit folgenden Ausnahmen:
der Halbtitel wurde entfernt;
das Inhaltsverzeichnis sowie eine Kartenskizze wurden vom Buchende an den Textbeginn verschoben;
Seite 5:
"Tropenkeider" geändert in "Tropenkleider"
(An Tenniskleidern, auch als Tropenkleider zu benützen)
Seite 15:
"ägyptschen" geändert in "ägyptischen"
(Bewilligung hierzu seitens der ägyptischen Regierung)
Seite 18:
"Pord" geändert in "Port"
(Die Strecke von Triest nach Port Said)
Seite 24:
"häuptsächlich" geändert in "hauptsächlich"
(3000 Seelen auf Europäer, hauptsächlich Engländer, entfallen)
Seite 34:
"Jokeys" geändert in "Jockeys"
(Die Jockeys waren zum grossen Theile Einheimische)
Seite 40:
"seinem" geändert in "seinen"
(Malabar Hill mit seinen schönen Bungallows)
Seite 40:
"Gymkhara" geändert in "Gymkhana"
(an den Spielplätzen (Gymkhana) für die Parsen)
Seite 65:
"Kriegschiffes" geändert in "Kriegsschiffes"
(machte ich Toilette und begab mich an Bord unseres Kriegsschiffes)
Seite 70:
"," eingefügt
(durch seine goldgestickten bunten Kleider, durch vier)
Seite 79:
"sparch" geändert in "sprach"
(der Capitän die englische Sprache geläufiger sprach als ich)
Seite 79:
"Gässen" geändert in "Gassen"
(welches in den engen Gassen herrscht)
Seite 85:
"Shangai" geändert in "Shanghai"
(in der Schilderung meines Aufenthaltes in Shanghai beschrieb)
Seite 85:
"sowie" geändert in "so wie"
(dass sie so wie Osaka sehr schmale Strassen hat)
Seite 102:
"goldbedresste" geändert in "goldbetresste"
(Bediente haben dann und wann goldbetresste Cylinder)
Seite 105:
"Pölstern" geändert in "Polstern"
(sitzen auf Polstern nebeneinander junge japanische Mädchen)
Seite 119:
"Cens" geändert in "Cents"
(Yen Cents fl. kr.)
Seite 137:
"Schiffsoffieren" geändert in "Schiffsofficieren"
(dankte ich noch dem Schiffscapitän und den Schiffsofficieren)
Seite 140:
"demselben" geändert in "denselben"
(sah ich mich genöthigt, denselben gleich mitzutheilen)
Seite 175:
"Singapora" geändert in "Singapore"
(Vom 3. Februar bis 7. März Aufenthalt in Singapore)
End of the Project Gutenberg EBook of Reise über Indien und China nach Japan., by
Richard von und zu Eisenstein
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REISE ÜBER INDIEN UND CHINA ***
***** This file should be named 47260-h.htm or 47260-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/7/2/6/47260/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by The Internet Archive/Canadian
Libraries)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation information page at www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at 809
North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email
contact links and up to date contact information can be found at the
Foundation's web site and official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For forty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.