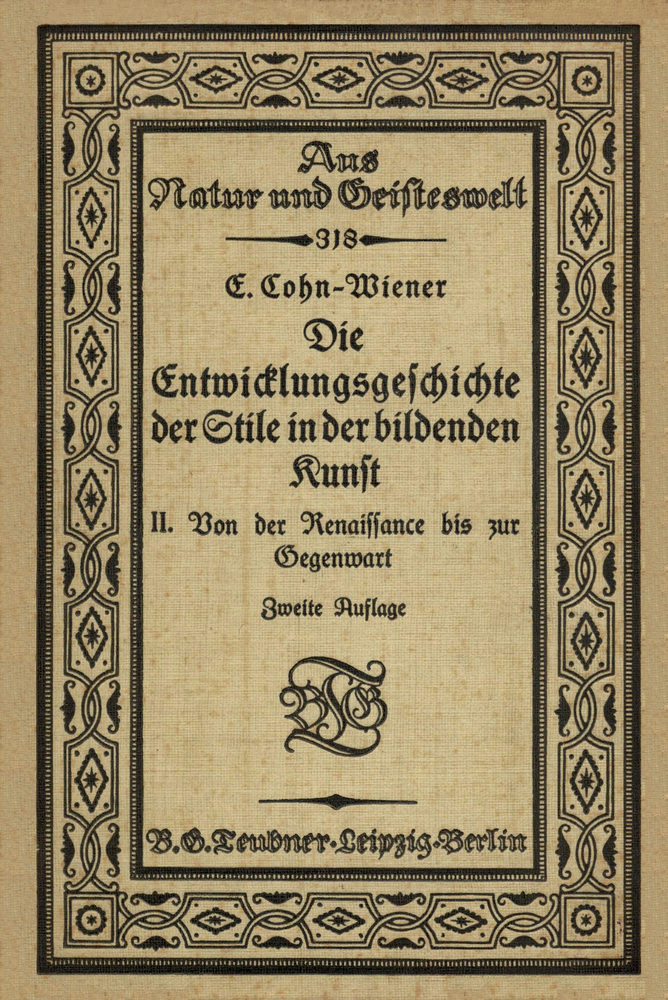
Title: Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst. Zweiter Band.: Von der Renaissance bis zur Gegenwart
Author: Ernst Cohn-Wiener
Release date: June 8, 2022 [eBook #68263]
Language: German
Original publication: Germany: B. G. Teubner
Credits: the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1917 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Begriffe wurden nicht korrigiert.
Das Original enthielt einen Gesamtkatalog der Buchreihe „Aus Natur und Geisteswelt“, welcher bereits auf Project Gutenberg veröffentlicht wurde (https://www.gutenberg.org/ebooks/53614). Die restlichen Buchanzeigen wurden zusammengefasst am Ende des Texts wiedergegeben.
Dieses Buch enthält Verweise auf Passagen im ersten Band, welcher auf Projekt Gutenberg veröffentlicht wurde und dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden kann (https://www.gutenberg.org/ebooks/68262).
Die gedruckte Ausgabe wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift erscheinen im vorliegenden Text kursiv. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
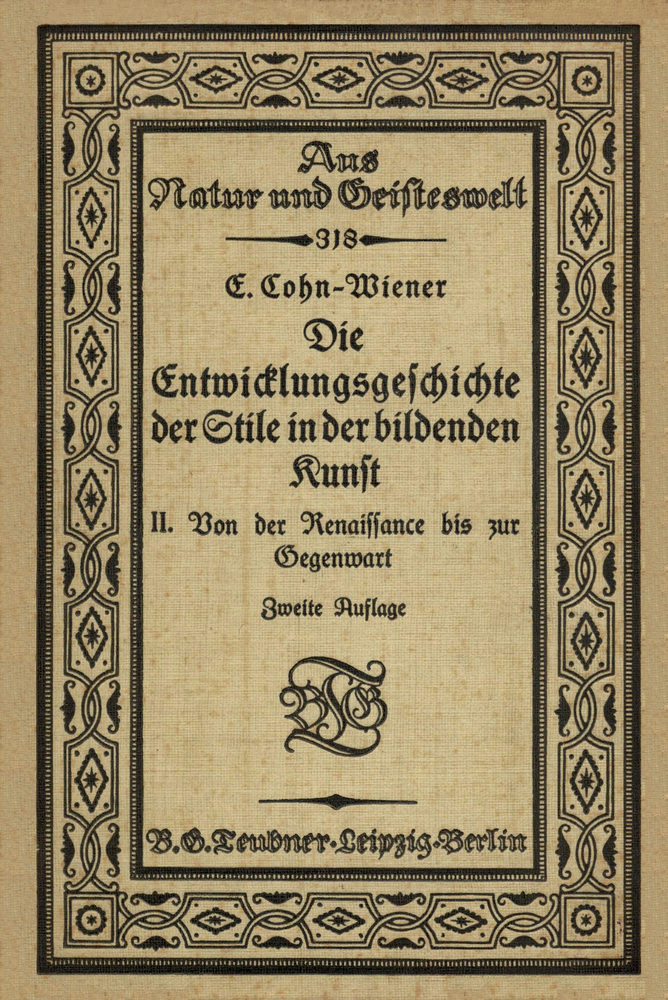
Aus Natur und Geisteswelt
Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen
318. Bändchen
Von
Dr. phil. Ernst Cohn-Wiener
Dozent an der Humboldt-Akademie — Freie Hochschule Berlin
Zweiter Band:
Von der Renaissance
bis zur Gegenwart
Zweite Auflage
Mit 42 Abbildungen im Text
Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1917

|
Seite
|
|||
|
Erstes
|
Kapitel.
|
Die italienische Renaissance
|
|
|
Zweites
|
„
|
Die bürgerliche Gotik in Deutschland und die
sogenannte deutsche Renaissance
|
|
|
Drittes
|
„
|
Der Barockstil
|
|
|
Viertes
|
„
|
Der Stil Régence und der Rokokostil
|
|
|
Fünftes
|
„
|
Der Stil Louis XVI. und der Stil Empire
|
|
|
Sechstes
|
„
|
Die Kunst des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart
|
|
|
Siebentes
|
„
|
Das Wesen des Stilwerdens und die historische
Stellung der gegenwärtigen Kunst
|
|
Schutzformel für die Vereinigten Staaten von Amerika:
Copyright 1917 by B. G. Teubner in Leipzig.
Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechts, vorbehalten.
[S. 1]
In keiner anderen Äußerung des menschlichen Geistes heben sich die Hauptrichtungslinien so eindeutig klar heraus, wie in der Kunstgeschichte, unterjochen so tyrannisch feindliche Strömungen oder lassen sie in provinziellem Dunkel. Der Grund dafür könnte sein, daß das Kunstwerk, als anschauliches Resultat eines sehr verwickelten seelischen Vorganges, doch fixierter ist als die Gedankengänge beispielsweise der Literatur oder die Tonfolgen der Musik, die sozusagen durch ganze Abfolgen von Stunden laufen, während das Kunstwerk als Objekt in jedem Augenblick dasselbe bleibt. Kein Land zeigt jene Einzigkeit des kunstgeschichtlichen Stilvorganges deutlicher als Italien, das im Mittelalter neben den Ländern des Nordens nur vegetiert, um seit dem 15. Jahrhundert ihre maßgebende Führerin zu werden. Obgleich das italienische Mittelalter eines der am wenigsten erforschten Gebiete der Kunstgeschichte ist, weil der glänzende Mantel der Renaissance es allzulange dem Auge entzog, ist es doch fraglos, daß, während sich nördlich der Alpen die wichtigsten Stilbewegungen vollziehen, Italien zwar eine Fülle interessanter Stilerscheinungen, aber keinen einheitlichen Stil geschaffen hat. Seine Lage im Schnittpunkte der großen mittelalterlichen Kunstkreise mit Frankreich, Deutschland, dem maurischen Spanien und dem Byzantinischen Reich als Zentren, dazu die fortwährenden Kämpfe auf seinem Boden, die allen diesen Ländern für längere oder kürzere Zeit Anteil am Lande selbst gaben und ihnen so den direktesten Einfluß sicherten, all das brachte es mit sich, daß in Italien fast alles Autochthone mit fremden Anregungen verschmilzt und eine Fülle der verschiedenartigsten Erscheinungen ausbildet. Während im Norden die romanische und gotische Kathedrale sich entwickeln, behält die kirchliche Architektur Italiens den altchristlichen Basilikatypus mit dem Eingange an der Schmalseite und dem freistehenden Campanile bis in den Beginn der Renaissance hinein bei; die eigengeschaffenen romanischen und die übernommenen gotischen Formen werden nicht Stilglieder, sondern nur Schmuck.
[S. 2]
Man kann sagen, daß die Gotik auch in Italien alle anderen Formen verdrängt, aber wesentlich als Stil des Wimpergs und der Fiale angewandt wird. Während man ihre Gewölbekonstruktion und ihre Dekoration verwertet, scheut man doch jede konsequente Durchführung der Vertikalen. Vollends dekorativ gestaltet das Land dort, wo es mit orientalischen Stilelementen in Berührung kommt, wie in romanischer Zeit in Süditalien, in gotischer in Venedig. Hier verwandeln sich die gotischen Formen in eine elegante Steindekoration von der feinen Arbeit durchbrochener Spitzen. Man arbeitet, um die Zartheit des Eindrucks zu steigern, selbst mit Kontrastwirkungen, setzt auf zarte Arkaden ein derbes mauerfestes Obergeschoß, wie beim Dogenpalast, während man doch das Verhältnis umgekehrt erwartet, oder neben sie als Gegensatz das geschlossene Mauerwerk, wie an Ca d’oro. Nur daß in romanischer Zeit Oberitalien, allerdings wiederum mit Ausnahme Venedigs, in engem Zusammenhang mit Deutschland stehend, an dessen Formenergie Anteil nimmt.
Mit dieser Art, den Charakter der Bauten durch ihre Dekoration bestimmen zu lassen, stimmt es überein, daß Plastik und Malerei als Werte im Gesamtbild die Architektur überwiegen, im Gegensatz zum Norden, und die große Zahl überlieferter Künstlernamen beweist, daß sie ihren Wert kennen. Dabei ist es natürlich kein Zufall, daß auch hier die Bewegung gleichzeitig mit der Loslösung der Plastik von der Baukunst einsetzt, d. h. mit dem Ende der romanischen Periode, daß also auch hierin Italien an den nordischen Bewegungen teilnimmt. Aber das geschieht ganz unwillkürlich, genau so selbstverständlich, wie die Glieder in den Blutumlauf des Herzens miteinbezogen sind. Als Formvorbilder dienen nicht die französischen Schöpfungen, sondern die antiken Überreste im Lande, und man hat geradezu von einer Proto-Renaissance (Ur-Renaissance) gesprochen, zumal diese Zeit die Vorbilder willenloser, weniger umformend übernimmt, als später die Renaissance. Die Frucht ist in Mittelitalien die antikisierende Umgestaltung des Architektur-Ornaments und die Kunst des ersten Meisters aus dem Kreis der Pisani, des Niccolo, tätig zwischen 1260–1280, dessen malerisch hohe Kanzelreliefs ohne das Vorbild der römischen Sarkophage schlechterdings nicht denkbar sind. Noch intensiver ist diese Bewegung in Süditalien, wo die geniale Persönlichkeit des Hohenstaufen Friedrich II. für die Kunst dieselbe Rolle spielt, wie Karl der Große für die karolingische Renaissance. Er errichtet Triumphbögen mit Skulpturen,[S. 3] in deren Überresten antiker Geist seltsam lebendig ist. Er schreibt ein Buch über die Falkenjagd, und die Illustrationen dazu geben die Tierformen mit der subtilen Genauigkeit eines zoologischen Werkes. Man muß freilich feststellen, daß der Einfluß der hohen maurischen Kultur gerade hier den Boden sehr geebnet hatte.
In der gotischen Generation, repräsentiert durch den Sohn des Niccolo, Giovanni (um 1250–1328), wirkt das jetzt voll entfaltete Frankreich stärker ein. Doch wird der Stil niemals weich, und in der Malerei vollends wird die ganz byzantinisierende romanische Generation durch den Gotiker Giotto (1266 bis nach 1317) abgelöst, der als Übergang zur Renaissance anzusehen ist. Wenn auch die religiöse Inbrunst in seinen Darstellungen aus dem Leben des heiligen Franziskus ganz gotisch im Gefühl, die Gebundenheit seiner Formen noch mittelalterlich ist, so ist doch die Bestimmtheit des Gefühlsausdruckes bei ihm die Ankündigung des neuen Zeitalters.
Für uns Heutige hat das Wort Renaissance nicht mehr den Sinn, den es einst hatte: Wiedergeburt der Antike. Wir, die wir einen Stil nicht mehr äußerlich nach den Detailformen analysieren, sondern nach dem Sinn, den sie im Stilbild haben — wir sehen, daß die Renaissance die antiken Formen nur in den Dienst ihrer ganz selbständig gerichteten Absichten stellt. Für uns bedeutet sie eine Wiedergeburt der starken Persönlichkeit, der schaffenden Kraft des Menschen, welche die Formen der antiken Kunst, die sie vor Augen hatte, als Hilfsmittel für das eigene Wollen mit eigenem Ausdruck übernahm. Von hier aus beantwortet sich auch die Frage, warum man gerade an die römische Antike anknüpfte und nicht an die hellenische, deren Werke doch in Unteritalien noch vor aller Augen standen. Die Begründung, man hätte die römische Kunst gewählt, weil die italienischen Städte stolz waren, ihren Ursprung von Rom abzuleiten, scheint uns zu äußerlich für Erscheinungen, die so gesetzmäßig verlaufen. Vielmehr scheint dafür entscheidend gewesen zu sein, daß die Freude dieser enthusiastischen Zeit am Reichtum und am Prunk, die in ihren Festen und Bauten so hohen Ausdruck findet, in den reichbewegten Formen der römischen Bauornamentik sich eher befriedigen mußte, als in den schlichten, griechischen Architekturen, dann, daß die Renaissancebauten Mauerbauten waren, bei denen vor allem Wände dekoriert werden sollten, so daß sie in den reich dekorierten Mauern römischer Bauten ihr gegebenes Vorbild hatten: der strenge griechische Säulenbau mit seinen frei tragenden[S. 4] Stützen konnte für diese Aufgaben keine Lösungen bieten. Dafür, daß die Antike für die Renaissance im Grunde keine Triebkraft, sondern nur ein Hilfsmittel war, ist beweisend, daß sie sich nicht im päpstlichen Rom entwickelte, wo die meisten und reichsten Römerbauten damals noch standen, sondern in Florenz, das fast ohne antike Überreste war, wo aber ein freies und starkes Bürgertum sich entwickelte in einem Kampf, der halb kaufmännische Konkurrenz, halb Ringen um die Macht war.
Diese Entwicklung der Persönlichkeit ist das wichtigste Ergebnis der vorhergehenden Jahrhunderte und die Schöpferin der Renaissance, die man meist um 1420 beginnen läßt. An Stelle der christlichen Demut tritt der bürgerliche Stolz, an Stelle der Aufgabe der Persönlichkeit ihre Pflege, an Stelle des Feudalismus die städtische Freiheit. Durch ihren Handel erstarkt, erobern sich die Städte mit geworbenen Söldnern oder Bürgerheeren einen Platz in der Reihe der Fürsten. Waren sie bisher um ihres Reichtums willen Objekt des Streites zwischen diesen, so erwerben sie jetzt mit diesem Reichtum das Recht ihrer Freiheit. Diese neue Macht hat in Italien vielleicht früher ihre Erfolge errungen, als nördlich der Alpen. Es genügt an die Schlacht von Legnano zu erinnern, wo der langobardische Städtebund Friedrich Barbarossa schlug. Es war der Stolz des Bürgers, Glied einer freien Stadt zu sein, die er mitregierte, und so entstanden alle jene kleinen, aber mächtigen Stadtrepubliken. Aber es war derselbe Bürgerstolz, der den einzelnen antrieb, in diesem Staat unter den Mitbürgern sichtbar zu sein, hervorzuragen durch Macht und Wissen, und so erscheinen jetzt alle jene Mäzene, alle jene geschmackvollen Dilettanten, erwacht jenes große bewegte Leben der Epoche, das uns Heutigen noch in seiner leuchtenden, blühenden Triebkraft wie das Ziel einer Sehnsucht vor Augen steht. In keiner Zeit war der Ehrgeiz so allgemeine Triebfeder für den Feldherrn wie für den Staatsmann, den Gelehrten wie den Künstler, in keiner Zeit aber wurde auch der Tüchtige so geschätzt. Es ist bezeichnend für die Differenz zweier Weltanschauungen, wenn Dürer aus Venedig schreibt: „Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer.“ Der Künstler des Mittelalters war fast stets anonym gewesen. Je mehr man sich der Renaissance nähert, auf desto mehr Künstlernamen trifft man. Während noch die Meister der Frührenaissance selten ihre Bilder signieren, und nur die allgemeine Wertschätzung das Ziel ihres Ehrgeizes ist, während Botticelli Truhenbretter bemalt, und Verocchio Turnierfahnen, also das Gefühl[S. 5] eines Unterschiedes zwischen Kunst und Handwerk noch völlig fehlt, setzt man später auf jedes lächerlich geringfügige Bildchen seinen Namen und arbeitet ebenso für seinen Ruhm wie für das Werk, bis schließlich die Arroganz eines Barockmeisters wie des Cellini unerträglich wird. Das geht so weit, daß man schon in der frühen Renaissance von dem kaum verlassenen Stil mit allertiefster Verachtung spricht, so daß damals das Wort „Gotik“ geprägt wird im Sinne einer barbarischen Kunst, über die man sich hoch erhaben fühlte.
Allein dieser Gegensatz war nicht so einschneidend, wie die Epoche glaubte. Das neue Kunstwollen ist zwar von vornherein sehr stark, die Problemstellung sehr neu, aber die Lösungen entwickeln sich auf der Basis der gotischen. Der erste Florentiner Renaissance-Architekt, Brunelleschi (1377–1446), stellt die Tendenzen des neuen Stiles fast dogmatisch fest, und doch hat seine Kuppel des Florentiner Domes noch viel gotische Streckung, und seine Capella Pazzi noch die Dreiteilung mittelalterlicher Kirchen in Vorhalle, Hauptraum und Altarnische, ohne daß die Kuppel über dem Mittelraum für mehr als nur für diesen ein Sammelbecken wäre. Erst die Hochrenaissance bringt in Bramantes Tempietto die absolute Vereinheitlichung des Raumes unter einer Kuppel. Wichtiger ist in diesem unkirchlichen Zeitalter der Profanbau, für den ebenfalls die Gotik den Typus, zugleich mit der bürgerlichen Gesinnung überhaupt, schon vorgebildet hat (Abb. 1). Die Rathäuser der Städte mußten in jenen Zeiten der Kämpfe von Stadt gegen Stadt, von Partei gegen Partei feste Gebäude, Kastelle im kleinen sein, Bauten, deren starke Mauern nur von kleinen Fenstern durchbrochen werden durften, während im Hofraum freiere Dekoration sich entfalten konnte. Das ist die gegebene Form der Feste, wie schon die deutschen Burgen der romanischen Zeit sie haben, und wie sie selbst dem Heidelberger Schloß noch zugrunde liegt. Diese kleinen Städte Italiens aber geben vielleicht ihre reinste Form, weil dort die kirchlichen Einbauten fehlen, die in Deutschland üblich sind, und nicht die Plattform einer Bergkuppe ihren Grundriß bedingt. Er ist so knapp wie denkbar, rein quadratisch, die Mauern sind nur in ganz kleinen Fenstern und knappen Türen nach außen geöffnet, der kraftvoll horizontale Abschluß des Daches ist mit wehrhaften Zinnen gekrönt; aber die kleinen Simse, die sich unter den Fenstern um das Gebäude herumziehen, zeigen doch, daß man sich der gedrungenen Kraft dieser Horizontalen bewußt ist und ihr durch die Parallele Nachdruck geben will. Nur der Turm durchbricht, senkrecht emporsteigend,[S. 7] die Richtung dieser ruhenden Linien, ein ungesucht starker Akzent in diesem Bau, der als Ganzes die Energie eines neuen bürgerstarken Zweckgefühls in Formen von selbstbewußter Klarheit ausspricht. Nach dem Hof zu aber öffnen sich schon jetzt im Erdgeschoß säulengetragene Arkaden, umgürten weitgeöffnete Fensterreihen die oberen Stockwerke.
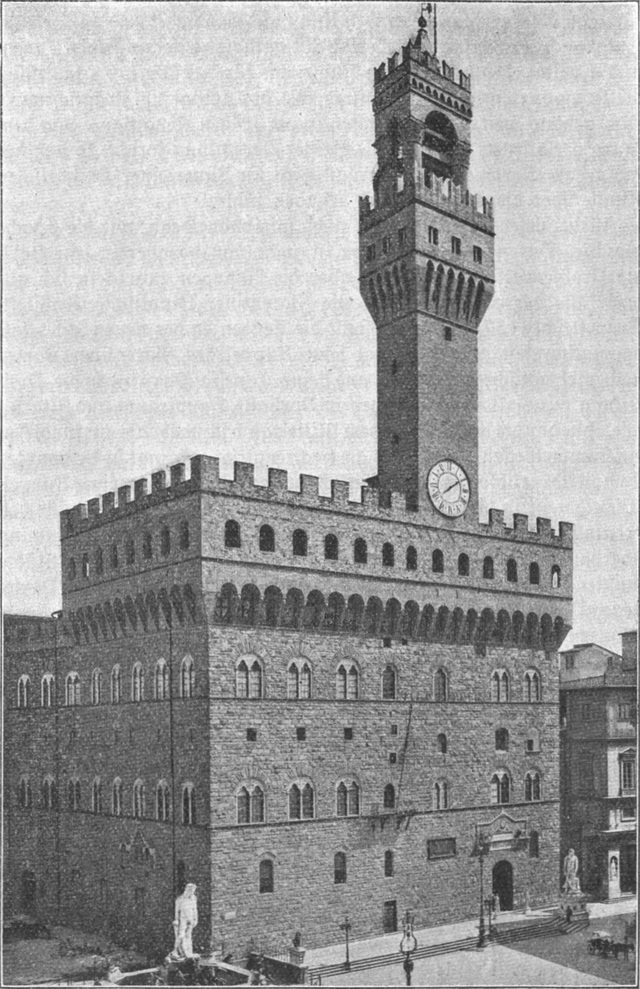
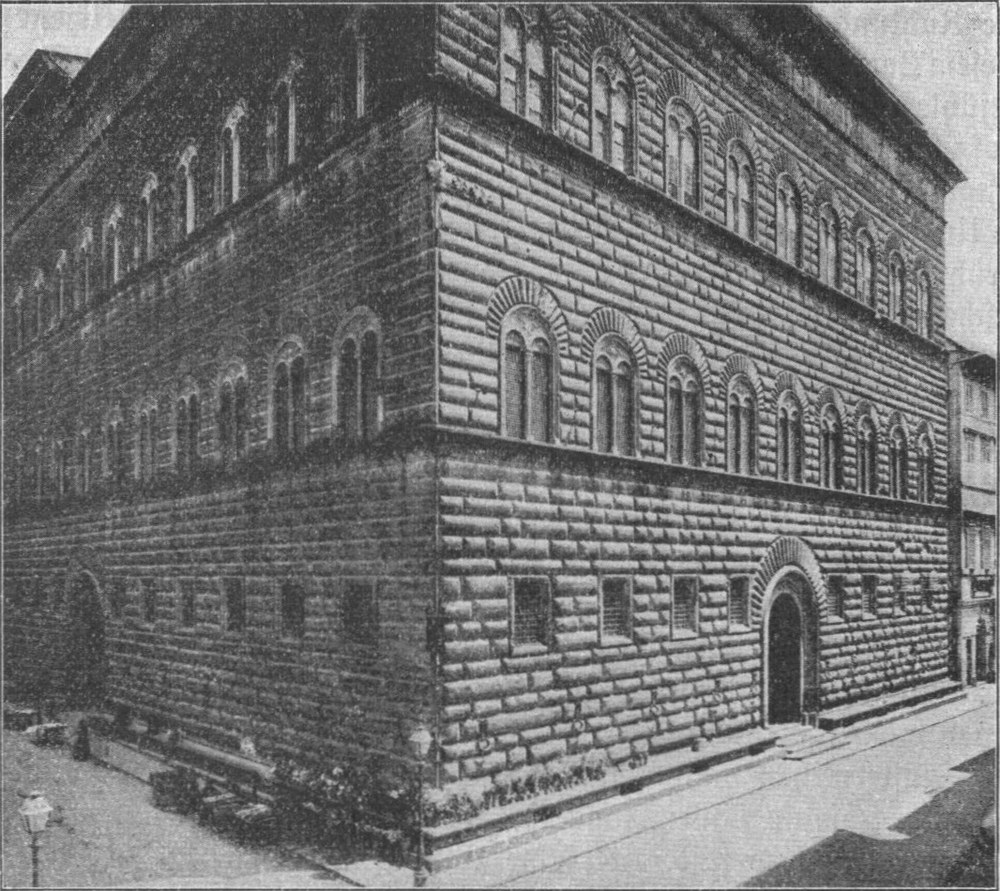
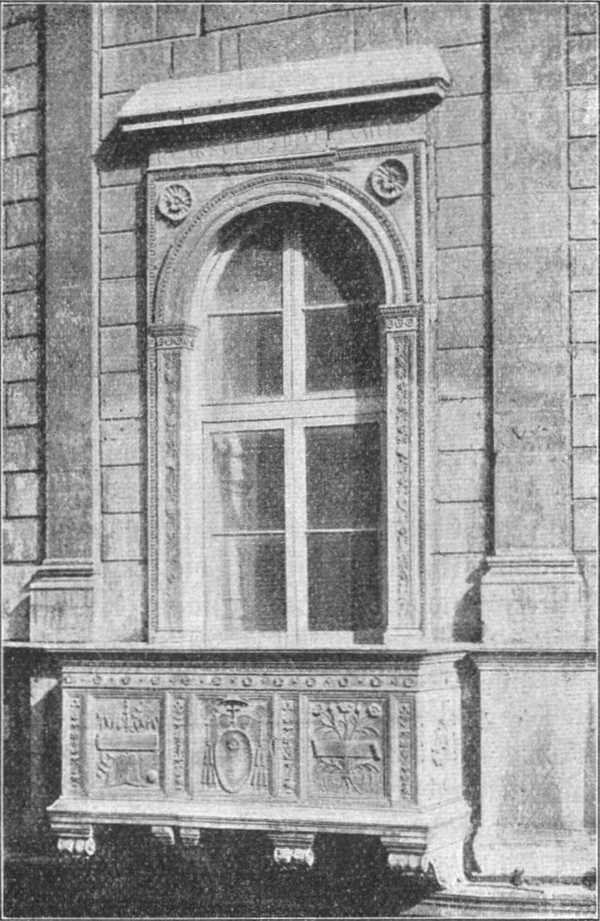
Und nun ist das Verhältnis dieser gotischen Form zum Palazzo der Frührenaissance dasselbe, wie das der frühchristlichen zur romanischen Basilika. Was vorher dumpf war, wird jetzt klar funktionell ausgedrückt, wobei allerdings wichtig ist, daß dieses Zeitalter an und für sich bewußter schafft als das Mittelalter. Der Palazzo Strozzi (Abb. 2) drückt die Bauwerte viel redender aus, als St. Michael in Hildesheim, und bei ihm und seinen Stilverwandten ist die Wagerechte nicht allein Zweck- sondern schon Ausdrucksform. Ein weit ausladendes Kranzgesims ist an die Stelle des Zinnenkranzes gesetzt worden, mit der ästhetischen Funktion, das Haus in stark betonter Horizontallinie abzuschließen. Am Fuß des Gebäudes wirken die starken wagerecht fortlaufenden Ruhebänke ebenso als Sockel, und zwischen diesen Hauptlinien wiederholt sich die Wagerechte zweimal in den Simsen, die unter den Fensterreihen hinlaufen und hier nicht mehr, wie beim gotischen Palazzo, schmale Linien, sondern regelrechte Simse von äußerst kräftiger Profilierung sind. Hier eine Parallele zur Energie der Wagerechten im romanischen Stil zu sehen, ist ganz logisch. Aber sie ist hier mehr, als nur der Steinschichtung abgewonnene Begrenzungslinie, wie auch die Wand mehr Absichten hat, als nur Raumabschluß oder Dachstütze zu sein. Indem die Renaissance die Mächtigkeit der einzelnen Quader innerhalb des Gefüges dadurch ausdrückt, daß sie die Fugen tief als beschattete Linien einschneidet (sog. Rustika), erzielt sie mehr den Eindruck von Körper als von Fläche, von Mauer als von Wand. Fenster und Türen sind nicht mehr bloße Öffnungen in der Mauer, wie noch im Palazzo Vecchio. Symmetrisch angeordnet, bestimmen sie die Gliederung der Wand, und es ist ausdrucksvoll, wie die Rustika, daß man den Bogen, der sie oben abschließt, in seiner Technik, dem Keilschnitt, angibt. Nun sieht man, wie fest die Steine ineinander verkeilt sind, und weiß, wie sicher der Bogen die darüber lastende Mauermasse trägt. Später wird sogar der mittelste Keilstein, wie der Schlußstein im gotischen Gewölbe, durch seinen Schmuck noch besonders hervorgehoben (Abb. 4), weil er dem Bogen den sicheren Zusammenhalt gibt. Ebenso schließt sich der Hof mit offenen Bogengängen im Erdgeschoß an den[S. 8] ursprünglichen Plan der Gotik an; aber alle gotisch eckig profilierten Formen sind auf einfachere Querschnitte unter Zugrundelegung antiker Formen zurückgeführt — aus Pfeilern, die Spitzbögen trugen, sind korinthisierende Säulen mit Rundbögen geworden, besonders aber bevorzugt man den Pilaster als Rahmenform für Fenster und Türen, als Stützform bei Grabmälern oder als Wanddekoration. Aber all diese Formen werden viel schlanker, dünner und graziler; ja man kann sagen, daß in der Betonung der kantigen Randlinien beim Pilasterschaft ein Rest gotischen Gefühles liegt und ebenso in der knolligen Behandlung der Akanthusblätter, die, in springbrunnhaft aufsteigender Anordnung auf der eingesenkten Mitte des Pilasters angebracht, dessen Bewegung mit ihrem Aufsteigen begleiten. Erst allmählich mit dem wachsenden Vollklang des Stiles werden diese Formen breiter, üppiger und gesammelter. Zugleich wird die Palastfassade auf größere Wirkungen gestimmt. Allein auch zum 16. Jahrhundert, der Hochrenaissance,[S. 9] vollzieht sich der Übergang ganz allmählich. Ein Palast, wie die um 1500 von Bramante gebaute Cancelleria (Abb. 3), geht noch auf einen Typus der Frührenaissance zurück, in dem indessen Keime für Zukünftiges lagen. Fest im Umriß und in der Begrenzung, sind auch bei der Cancelleria die Horizontallinien der unter den Fenstern durchgeführten Simse noch die wichtigsten Gliederungen, scheint die Wand um die kleinen Fenster von ungebrochener Festigkeit. Aber in der Gliederung der Mauerflächen machen sich dennoch neue Tendenzen fühlbar, wenn auch nur in den beiden oberen Geschossen, während das untere der starke Träger bleibt. Man muß eine ruhige Wandfläche, wie die des Palazzo Strozzi, damals beinahe schon als kühl, als unbelebt empfunden haben. Wie die Stärke der Zeit im Widerspiel der strebenden Kräfte sich äußert, so gestaltet man die Mauer ausdrucksvoller, indem man außer der wichtigen Horizontale, die die Hauptlinie bleibt, die Vertikale als Wandgliederung anwendet, zwar nur schüchtern als antikisierender Pilaster zwischen die horizontalen Simse gestellt und wenig aus der Wand hervorspringend, aber um so wirksamer, als sie zugleich den Fenstern, die sie aus der Wand herauslöst, ihren besonderen Wert innerhalb der Fläche gibt. Das Fenster ist jetzt nicht mehr ein Loch in der Mauer, sondern selbständiger Bauteil. Es wird durch einen Rahmen gegen die Mauerfläche[S. 10] abgegrenzt, außerordentlich energisch dadurch, daß dieser nur innen den Konturen des Fensters folgt, außen aber rechteckig ist, wie die Wandglieder. Allein obgleich diese Zusammenfassung sehr geistvoll ist, wird man gerade hier einen Zwiespalt fühlen, der für die neue Absicht charakteristisch ist. Keine Frage: gegenüber der strengen Folgerichtigkeit der Wand beim Palazzo Strozzi stellt sich nun als Gliederung eine Dekoration ein, die ihren eigenen Ausdruck hat und die Struktivität der Mauer vernichtet. Es ist kein Zufall, daß das Kranzgesims hier weit weniger vorragt, an den äußersten Ecken Pilaster die scharfen Kanten der zusammenstoßenden Wände abschwächen, die horizontalen Simse verdoppelt werden, und dadurch den Hauptlinien viel von ihrer Kraft genommen wird, sie gewissermaßen zerfließen. Unzweifelhaft bedeutet auch hier der neue Reichtum des Ausdrucks eine Schwächung der Gesetzmäßigkeit. Und nun kann man stufenweise die konsequente Weiterentwicklung dieser Prinzipien verfolgen, wie Fenster und Pilaster allmählich immer kräftiger, die Wände immer schwächer werden, bis schließlich die Bauten des Palladio (1508–1580) in Vicenza oder des Jacopo Sansovino die letzte Stilstufe bezeichnen, auf der eine einheitliche Wirkung, allerdings bereits von ganz malerischer Art, noch möglich ist. Die Wand des Untergeschosses von Sansovinos Markusbibliothek in Venedig (Abb. 4) öffnet sich in weiten Bögen, die durch dekorierende Säulen voneinander getrennt sind. Noch ziehen über ihnen die Simse und Friese in horizontalen Reihen, aber die beherrschende Kraft ihrer Linien zersetzt sich. Ein dorischer Fries mit Tropfenregula, von deren vermittelndem Sinne schon die Rede gewesen ist, führt vom Untergeschoß aufwärts, und ebenso allmählich oberhalb des trennenden Simses die Balustergalerie. Es kommt dazu, daß nicht nur die oberen Säulen mit den unteren korrespondieren, sondern daß die oberen Säulen innerhalb der Balustergalerie auf isolierten Sockeln stehen und so die Linien der unteren für das Auge geradezu fortsetzen. Wie die Fenster dieses Stockwerks eleganter, zierlicher sind als die Bögen des Untergeschosses, auf denen es lastet, so ist auch die abschließende Horizontale noch weicher behandelt als das trennende Sims zwischen beiden. Sie ist geradezu aufgelöst, nach unten in ein breites Friesband von kränzetragenden Putten, durchbrochen von kleinen Fenstern, nach oben in eine freistehende Balustergalerie (Attika), die den ganzen Bau weich in die Luft sich lösen läßt. Allein auch diese Auflösung wird von den vertikalen Linien unterstützt. Die Putten im Fries nehmen die Linien der Säulen auf und führen sie in eine Basis hinauf,[S. 11] auf der jedesmal eine Statue steht, von allegorischer Bedeutung, was nebensächlich ist, aber mit der Funktion, auch die letzte Horizontallinie, die obere Begrenzung der Attika, zu zerstören und den Abschluß noch weicher zu gestalten. Es beginnt also die Auflösung der Wagerechten zugleich mit der Auflösung der Wand weiter vorzuschreiten und zu ihrer tatsächlichen Zerstörung durch die Durchbrechung gesellt sich ihre optische durch das starke Wechselspiel von Licht und Schatten in der reichen Dekoration. Während die frühe Renaissance ganz flache Formen isoliert benutzt (Abb. 3), häuft die Hochrenaissance weit ausspringende Glieder. Es ist von derselben Art, wenn sie in der Flächenfüllung an Stelle der einfachen, dünnen, aber klargeführten Ranken der frühen Zeit das volle, quellende Ornament bringt, die breithängenden Kränze und schweren Füllungen (Abb. 4). Der Ausdruck bleibt also groß, wird nicht etwa spielerisch. Aber immerhin tritt das Pathos an die Stelle der Sachlichkeit. Ein Bau wie etwa der bereits dem Barock zugerechnete Palast Pesaro in Venedig führt alle diese Absichten zur letzten Konsequenz. Hier ist die Wand völlig verschwunden. Selbst der Rest, der in der Bibliothek Sansovinos an den Seiten der Säulen steht, hat einer Säule Platz gemacht. Ebenso ist neben die Horizontallinie nun völlig gleichberechtigt die Vertikale getreten. Die Gesimse verkröpfen sich oberhalb der Säulen und das Auge wird ohne Hindernis vom Erdboden bis[S. 12] hinauf ans Dach geführt. Dieser Widerstreit zwischen den Richtungslinien wird noch ausdrucksvoller durch das starke Vor- und Zurückspringen der Gliederungen, das im malerischen Wechsel von Licht und Schatten die Fläche vollends ausschaltet. Kurzum, die Absicht ist möglichster Reichtum auf Kosten des tektonischen Ausdrucks, von dem nun auch nicht mehr das geringste Element äußerlich sichtbar in die Erscheinung tritt. Wand und Dach sind durch die Dekoration vollkommen verdrängt, und über die Fassade hin gleitet von oben nach unten, von Seite zu Seite im regelmäßigen Wechsel des Vordrängens und Zurücktretens das Licht, so daß eine vollkommene Wellenbewegung entsteht. Auf diesen Tendenzen baut sich dann der Barockstil auf.

Die Einheit des Gesamtkunstwerkes, die diese Zeit bewußter fordert, als jede voraufgegangene, hält die Ausstattung des Hauses und dieses selbst in jedem Augenblick in derselben Stilphase. Das Zeitalter ist nicht reich an Möbelformen; die wichtigste, die Truhe, ist in der bürgerlichen Gotik des Palazzo Vecchio ein schlichter Kasten, mit stilisierter Bemalung von Wappen oder Ornamenten. Die Hochrenaissance, die für ihre Prunksäle auch monumentalere Möbelformen, wie den Thron, ausbildet, betont den Formgehalt der Truhe, stellt sie auf eine schwer profilierte Basis, rahmt die reich bemalte oder mit Stuckornamenten gezierte Wand durch Pilaster oder Wappenhalter und macht den oberen Abschluß ebenso ausdrucksvoll (Abb. 5). In der Spätrenaissance überwuchert hier wie am Palast der Schmuck. Man stellt das Gerät auf katzenartig vorschnellende Löwenklauen, die einerseits die Truhe vom Boden anheben, ihr jede Schwere des Stehens nehmen, andererseits den Körper des Möbels in weichen Linien in den Boden führen. Das Gerät nimmt diese Linien auf. Der Leib der Truhe biegt sich nach der Mitte zu aus, um nach dem Deckel zu wieder schmäler zu werden und so die bewegte Form des Gerätes als weiche Kurve endigen zu lassen. Ist schon durch so starke Bewegung dem Gerät das Kastenartige genommen, so tritt die überaus lebhafte Dekoration des Körpers mit reichem figürlichen und ornamentalen Schnitzwerk dazu, um vollends jede Fläche zu zerstören. Die Keramik beginnt, von maurischen Erzeugnissen angeregt, mit übersichtlich geformten Kannen und Schüsseln, deren Ton durch durchsichtige Glasur mitwirkend sichtbar ist und deren Wandungen einfaches, aber sehr großzügiges Ornament unterstützt. In der Hochrenaissance will auch der Töpfer prunken. Die großen Manufakturen, wie Faenza (von dem die Technik den Namen Fayence[S. 13] erhält) und Urbino fertigen Majoliken von großen bauchigen Formen, bei denen nur die undurchsichtige Glasur, die Haut also, statt des Kernes, sichtbar und also wirksam ist und figürliche Malereien trägt, die über jede Gefäßteilung, selbst über Rand und Boden der Schüssel gleichmäßig hinweggehen. Das Gerät ist nur noch Malgrund, kein zweckgeschaffenes Gebilde.
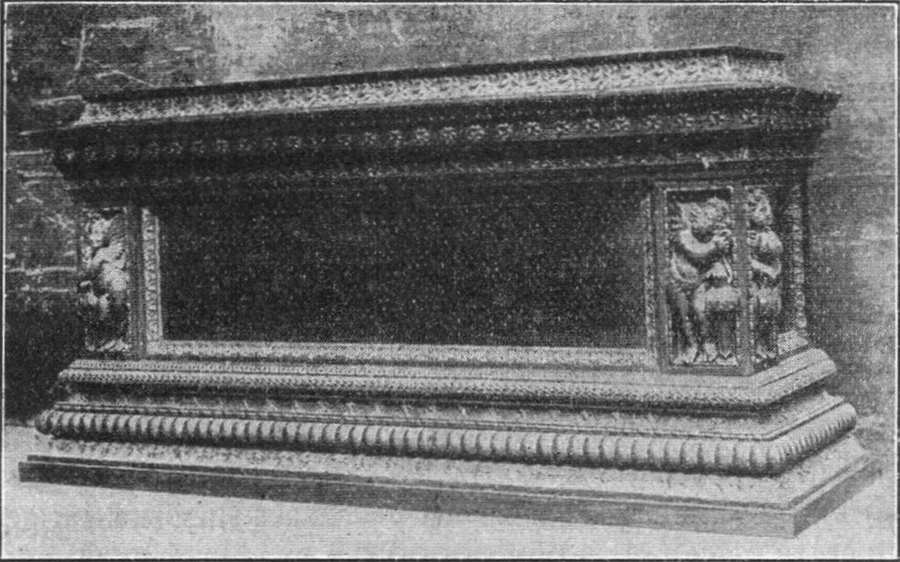
Dieses Übergewicht der freien Kunst, das schon von der Gotik übernommen wird, läßt die Einheit im Zweck, die alle Künste im dorischen Tempel oder in der romanischen Kirche organisch verband, hier nicht zu. Daß die langen Freskenreihen des Gozzoli und Ghirlandajo Wandschmuck sind, setzt der Plastik ihres Ausdrucks keine Grenzen und schreibt ihrem Stil keine Gesetze vor. Vielmehr trifft die beginnende Renaissance Plastik und Malerei bereits als selbständige Künste von großer Freiheit des Ausdrucks an und mit der Tendenz, jede Ausdrucksform durch eine noch freiere abzulösen. In derselben Weise etwa, wie die archaische griechische Kunst aus dem Steinblock und den späten Formen griechisch-mykenischer Kunst allmählich den menschlichen Körper entwickelt, seine Glieder immer stärker zu beherrschen lernt, entwickelt die Renaissance unter den Gewandmassen, mit denen die Gotik die Gestalten verbirgt, die menschliche Form zu immer größerer Freiheit, zu immer sichererem Verständnis. Die disziplinierte Kraft, die im Rahmen des Gesamtkönnens das Höchste[S. 14] leistet, fehlt diesem erregten Zeitalter des Individualismus, das die Fülle erzeugt. Der Weg, den Hellas in fast drei Jahrhunderten zurückgelegt hat, wird in kaum drei Generationen durchmessen.
Mißt man ihn an der Plastik, die die Aufgabe am engsten, auf eine oder wenige umgrenzte Gestalten konzentriert und so die schöpferische Bildnerin des Körpers wird, so sind Ghiberti (1378–1455) Donatello (1386–1466) und Verocchio (1435–1488) die Marksteine. Ghiberti ist in der kurvigen Bildung seiner Gestalten, unter deren weichgleitenden Gewändern der Körper noch nicht gefühlt ist, fast noch Gotiker. Die beiden anderen, von der Tradition sich befreiend, sind schöpferische Menschen der Renaissance, Donatello ein Ekstatiker, tiefster seelischer Erschütterungen voll, seine Puttenreigen wirbelnde Tänze, seine Antoniuslegenden erregte Dramen, seine Propheten und Täufer tief innerlich durchflammte Visionäre, bei denen der Ausdruck im gepreßten Munde, in gekrampften Händen und tief durchfurchten Gewändern verhalten aber glühend wirksam ist. Er stellt das plastische Problem nicht nur als Form-, sondern als Inhaltsproblem, läßt seinen Gestalten die Anlehnung an architektonische Hintergründe, die Entwicklung der Bewegungen für eine Ansicht und entblößt vom Körper nur, was der innere Ausdruck fordert. Mit dem Problem der körperlichen Klarheit stellt Verocchio der nächsten Generation die Aufgabe, ja, man kann sagen, daß die nach Erkennen strebende Renaissance erst mit ihm ihr erstes Wort spricht. Es ist frappant, hier, wie im klassischen Altertum, die wissenschaftliche und gestaltende Analysis nebeneinander hergehen zu sehen; wie Polyklet sucht auch Verocchio das Wesen der Schönheit in der menschlichen Proportion, erforscht die Perspektive und treibt mathematische Studien. Ebenso aber studiert er Bewegung und Zusammensetzung des Menschen- und Pferdekörpers, differenziert die Muskeln und Gelenke in seinen Skulpturen, so daß man selbst unter dem Panzer des jugendlichen David noch jede Muskel, jede Hautfalte spürt. Kraft dieser Kenntnis werden die Drehungen seiner Gestalten ausdrucksfreier als bei Donatello, bis zu Werken, die ohne Hintergrund, frei inmitten eines Hofes stehend von allen Seiten reizvolle Ansichten gewähren. Wenn Donatellos Gattamelata der klug überblickende Heerführer war, auf seinem Pferde sitzend, wie auf einem Thron, so ist Verocchios Colleoni, in Bewegung und Gegenbewegung von gespanntester Führerenergie. Diese klare Formulierung der neuen Probleme und die Vielseitigkeit des Mannes, der zugleich auch Maler und Goldschmied war,[S. 15] machen ihn wie die ihm verwandten Brüder Pollajuolo zu Lehrmeistern der ganzen zweiten Generation, auch ihrer Maler.
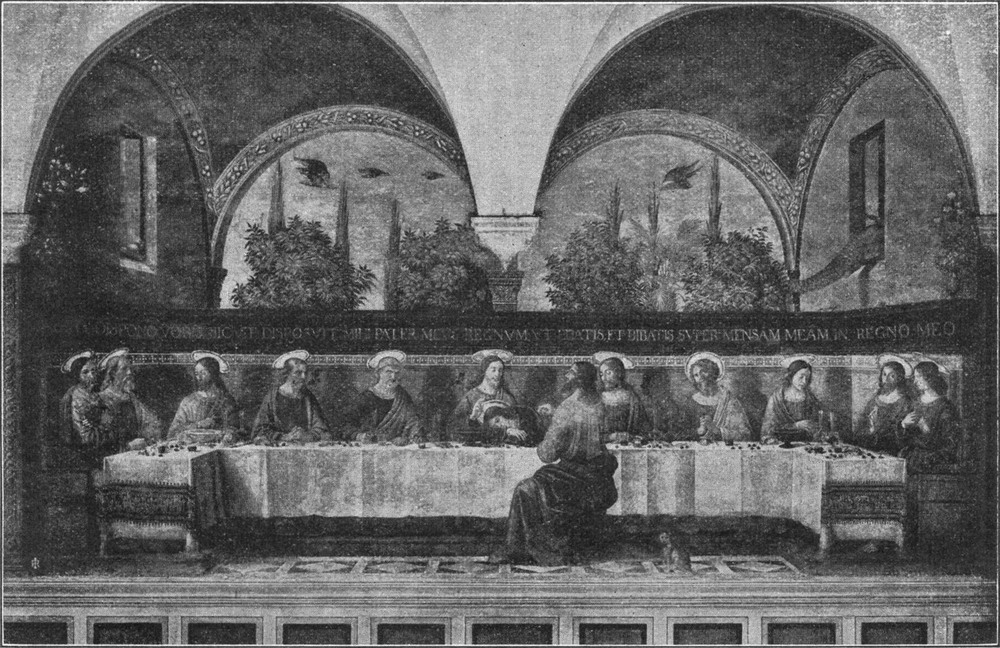
Denn die Entwicklungslinie der Malerei ist im ganzen die gleiche. Von den Zeitgenossen Ghibertis war Fra Angelico noch Gotiker gleich ihm, während Masaccio, der erste, der seinen Menschen standfeste Realität und ein Größenverhältnis zu den Häusern und Dingen in der Landschaft gibt, zugleich noch aus der gotischen Verallgemeinerung der Form ihre Größe gewinnt. Mit ihm hört das mittelalterliche Gedränge auf, und die Dinge werden plastisch. Nun setzt die schöpferische Kraft des Zeitalters mit all ihrer Fülle ein. Padua, wo Mantegna in harter Zeichnung sich um Menschencharaktere und Perspektive müht, Venedig, wo die Farbe herrscht, Umbrien, das weiche, idealistische Gestalten sucht, und am vielseitigsten Florenz, wo neben Gegenwartsmalern wie Ghirlandajo, Theoretikern, wie eben Verocchio, tiefe Empfinder schaffen, wie Fra Filippo Lippi und sein Schüler, der Mystiker Botticelli (1444 bis 1510), diese beiden letzten die deutlichsten Repräsentanten der zwei Frührenaissance-Generationen in der Malerei. Allein die Entwicklung kommt hier nirgends vom Tektonischen her. Das Wandgemälde sucht durchaus die Tiefe, den Raum. Lionardo da Vinci (1452–1519), der die Hochrenaissance einleitet, ist durchaus nur Fortbilder dieses Suchens, wenn er den Gestalten dadurch die Freiheit im Raum gibt, daß er ihren Umrissen die Härte nimmt und sie so schwebend unsicher machte, wie man sie sieht. Auch Ghirlandajos Abendmahl (Abb. 6) war räumlich gemeint. Was Lionardo (Abb. 7) vor ihm voraus hat, ist die größere Intensität der Gesten, die jedem Ausdruck die Bestimmtheit gibt, die bedeutendere Komposition, die das Nebeneinander der Apostel zu großen Hauptgruppen sammelt. Es ist dieselbe Entwicklung, die von den gleichmäßigen Wänden der Frührenaissance-Paläste zu den sammelnden Achsen des Sansovino (Abb. 4) führt. Wohl gibt es einmal in einem tektonischen Stil eine gleichartige Komposition: der Giebel von Ägina (Bd. 1, Abb. 12) faßt seine vier Einzelgruppen so durch die Säulen zusammen, wie Lionardo durch die Tischböcke und läßt ihre Bewegung ebenso an der göttlichen Mittelfigur abprallen. Aber der entscheidende Unterschied ist, daß die Wand hinter dem Renaissance-Werk verschwindet, während die antike Komposition nur in und mit der Architektur Bedeutung hat. Gewisse Gleichartigkeiten in der Entwicklung sind jedoch auch hier nicht zu verkennen. So entstehen auch hier aus der strengen, dabei zaghaften Auffassung des Frührenaissancemeisters Können und Pathos,[S. 18] aus dem unsicheren Vielerlei die Einheit der großen Bewegung, und es darf uns nicht wundernehmen, hier die Antithese von Skopas und Praxiteles wiederzufinden, die Steigerung des Ausdrucks zu gleicher Zeit nach den beiden scheinbar entgegengesetzten Richtungen zartester Lieblichkeit und kräftigsten Bewegungsausdruckes. Zog sich dieser Gegensatz schon durch die ganze Frührenaissance, in der der umbrische Kreis ausnützte, was Florenz sich erarbeitet hatte, wie Athen einst das Körperstudium der Dorer, so gewinnt er jetzt in Raffael und Michelangelo seinen stärksten Ausdruck. Raffael (1483–1520) fängt noch ganz altertümlich an; seine Vermählung Mariä ist keineswegs als räumlicher Organismus verstanden, der Vorgang im Vordergrund ist ohne Beziehung zum Raum, in dem hier und da einzelne Gestalten ohne Zusammenhang mit der Handlung verteilt sind. In seinen reifen Werken aber, etwa von 1506 ab, schmiegt sich die Handlung vollkommen mit dem Raum zusammen. Die Komposition wird räumlich gegliedert, während andererseits die Verteilung der Gestalten den Raum in allen seinen Teilen belebt und zugleich die Entfernungen bestimmt. Ebenso wie Raffael gelernt hat, den Menschen in seinen Bewegungen zu verstehen und zu formen, hat er aus dem Bild einen bewegten Organismus geschaffen, in dem alles Flächenhafte sich gelöst hat. Allein er bleibt dabei immer ruhig und zart bis zur Weichheit. Er zeichnet gelassen stehende, ruhig schreitende und lagernde Gestalten und seine Komposition beruht nicht auf der Wirkung von Kontrasten, sondern auf der weichen Führung der Bildlinien, auf feinster Abstufung im Nebeneinander der Gestalten. Ganz anders Michelangelo. Er empfindet nicht nur Schönheit, sondern seelische Erschütterungen. Seine Menschen sind in scharfen Richtungskontrasten bewegt, so daß ihr Ausdruck sich bis aufs äußerste steigert, und die Komposition seiner Werke beruht nicht auf feinfühliger Abstufung, sondern auf der Dramatik des Gegensätzlichen. Man nehme seine Erschaffung Adams aus den Fresken an der Decke der Sixtinischen Kapelle (Abb. 8). Zwei Massen begegnen einander. Gottvater durch die machtvollen Linien des Mantels mit den Engeln zusammengeballt, und Adam, dessen stark differenzierte Bewegung durch die Linien des Hügels hinter ihm zusammengenommen ist. So treffen sich die Hände, von deren Berührung die bewegende Kraft in den Körper strömt, im leeren Raum, und der Kontrast verbindet sich zur Einheit. Zu diesem räumlichen Gegensatz tritt der Gegensatz der Gestalten. Gottvater und sein Gefolge erscheinen als eine ungeheure Masse. Man sollte[S. 19] meinen, gegenüber dem machtvoll thronenden Gott der frühen Renaissance müsse dieser heranfliegende würdelos erscheinen. Allein daran ist nicht zu denken. Gott und die ganze Masse von Engeln um ihn sind durch gewaltige horizontale Linien zusammengeschlossen, und er überspannt mit der Wucht seines Körpers ihre ganze Schar. Der Akt Adams ist dagegen aufs feinste gegliedert. Mit beabsichtigter Gegensätzlichkeit sind der rechte Arm und das linke Bein gebeugt, liegen das rechte Bein und der linke Arm wagerecht. So bekommt der Körper Schwere und ist doch alle seine Bewegung durch diese Wendungen und die Drehungen in Hüfte und Hals Gottvater zugewandt. Die Differenzierung der Gelenke geht bis in die Finger, von denen nicht ein Glied ohne Beugung, ohne Bewegung ist. Dieses Verständnis des menschlichen Körpers in seinem dreidimensionalen Wert, vor dem auf unserem Bilde alles Landschaftliche zurückstehen muß, ist die neue Erkenntnis Michelangelos, auch wenn sie ihm selbst nur Ausdrucksmittel ist. Der letzte Gedanke an die Fläche des Gemäldes ist verschwunden; die Gestalten bewegen sich vollkommen im Raum. Man wird von hier aus verstehen, warum Michelangelo, der von der Plastik herkommt, seine stärksten Gedanken über die Bewegung des Aktes im Gemälde niedergelegt hat, wo die räumlichen Entwicklungen reicher ausgesprochen, mehrere Gestalten zueinander in Gruppenbeziehung gesetzt werden konnten. Die Bildfläche ist völlig zerstört; die Decke hat ihren Sinn als Raumabschluß völlig verloren. Die Fresken der Frührenaissance waren wenigstens noch annähernd durch die Wand gebunden. Michelangelos flächensprengende Fresken an der Decke der Sixtinischen Kapelle aber, zu denen auch die Erschaffung Adams gehört, bedeuten den vollkommenen Verlust des tektonischen Zweckgefühls.
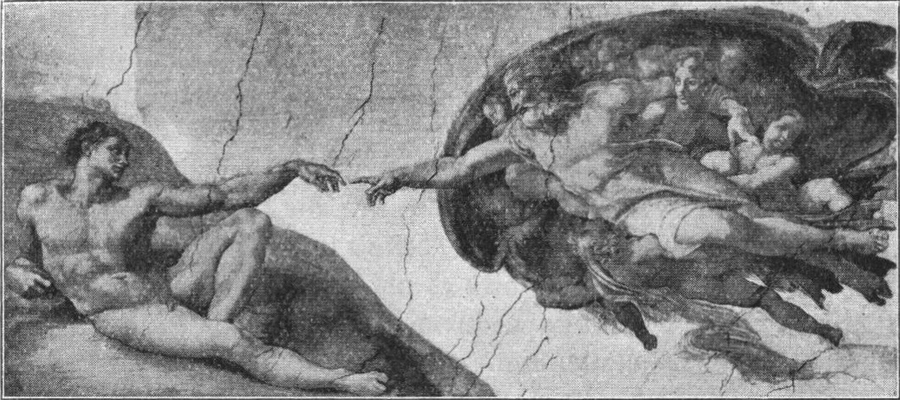
[S. 20]
So ist die Stilentwicklung der Renaissance festgelegt: Architektur und Kunstgewerbe beginnen noch sachlich; dann nimmt die Dekoration überhand, und der Schmuck vernichtet die Form. Plastik und Malerei gehen parallel. Sie beginnen mit flächenmäßig entwickelten Gestalten, um dann mit gestärktem Körper- und Raumbewußtsein die Grenzen zu sprengen. Auch hier ist, wie in der Antike, die Lockerung in der Haltung des Menschen die Folge; eine Gestalt wie der Adam des Michelangelo ist ohne Beispiel. So wird es als Parallelbewegung verständlich, daß in der Frührenaissance die gerade, fast steife Haltung, in der Hochrenaissance die gelöste, ungezwungene gesellschaftlich als vornehm gilt. Es ist dieselbe Differenz wie zwischen dem Apollo von Tenea und der Art der Praxitelischen Zeit, und auch hier führt sie zu immer stärkerer Vernichtung des Tektonischen im Gefüge des Kunstwerks, zum Barock.
Wenn es noch irgend eines Beweises dafür bedürfte, daß die Bewegungen der Kunst mit den allgemeinen Kulturbewegungen zusammentreffen, so würde ihn die Erscheinung geben, daß zur Zeit der Gotik und der Spätgotik, die in Deutschland erst nach 1500 der Renaissance weicht, das deutsche Bürgertum wie das italienische sich in seinem Erstarken einen Stil der Profankunst schafft, der vollkommen gotisch und doch von sachlicher Formbildung ist. Eine stärkere bauliche Logik läßt sich kaum denken, als in der Anlage des spätgotischen Rathauses von Saalfeld in Thüringen (Abb. 9). Es ist notwendig, dem Nahenden den Eingang zum Hause kenntlich zu machen, entweder mit leiser Selbstverständlichkeit, wie bei der romanischen Kirche und dem Palast der italienischen Frührenaissance, oder mit lauterem Hinweis, wie im Stil der Gotik und der Spätrenaissance. Allein der Stil des deutschen Bürgertums ist hier von besonders fein durchbildendem Gefühl. Er empfindet den Eingang zusammen mit der Treppe als den Verkehrsweg im Haus, als einen einheitlichen Teil gegenüber dem Gesamtorganismus. So wird die Wendeltreppe hier hinter einem von spätgotisch krausen Linien gerahmten Portal in einem gekanteten Treppenturm geführt und dieser[S. 21] halb aus der Mauer hinausgelegt, so daß er in ihrer gleichmäßigen Fläche die stärkste Bedeutung erhält. Zugleich aber ergibt sich ein Vorteil für den Innenraum, der diese Anlage mit veranlaßt haben muß. Sie ermöglicht es nämlich, die emporführende Treppe auf mehr als die Hälfte jeder Windung von Fenstern begleiten zu lassen und so auch hier die gleichmäßige Lichtverteilung des Zimmers zu erzielen. Um die Vollkommenheit dieser Lösung zu erkennen, genügt es, darauf hinzuweisen, wie bei den eingebauten Treppen unserer Zeit, auf die in jedem Stockwerk nur ein Fenster führt, dieses Fenster unerträglich blendet, während fast die ganze Länge der Treppe im Dunkel bleibt. Wollte man nun aber in der Treppe tatsächlich einen bequemen Verkehrsweg schaffen, so war es notwendig, den Treppenturm so zu legen, daß von ihm aus alle Teile des Hauses gleichmäßig leicht zu erreichen waren.[S. 22] Daher kommt es, daß die Treppentürme in den Höfen des Merseburger und Marburger Schlosses in die Ecken gelegt sind, während der Turm des Saalfelder Rathauses nahezu in der Mitte liegt. So werden beim viereckigen Schloßhof die Ecken betont, während der Turm hier die Wandfläche gliedert, nicht nach dem Gesichtspunkt der Symmetrie, sondern mit zweckvoller Notwendigkeit. Die unsymmetrische Anlage der Erker, die von vollkommener Schönheit ist, ist ebenso rein aus dem Zweck gewonnen. Es ist nicht nur Eigentümlichkeit des Rathauses von Saalfeld, sondern fast Regel in dieser Zeit, in die Wandfläche Erker von viereckigem, an die Hausecke, wenn sie zugleich Straßenecke ist, Erker von rundem Querschnitt zu legen, um von der Ecke aus den vollkommenen Umblick, von der Wand aus sowohl den Überblick über die eigene, wie über die gegenüberliegende Straßenseite zu gestatten. Man kann an den Bauten der Gegenwart überall sehen, wie viereckige Erker an der Ecke jeden weiten Blick, flachrunde in der Wandfläche das Überschauen der darunterliegenden Straßenseite unmöglich machen. Den energischen Abschluß gibt dann dem Saalfelder Rathaus das hohe Dach, kräftig belebt durch die großen Linienführungen der Quergiebel, die den Treppenturm begleiten.

Dieselbe Logik des Zweckbewußtseins bedingt die Einheitlichkeit im Verhältnis von Innenbau und Außenbau. Die Anlage der Fenster ist natürlich innen und außen dieselbe; wenn aber etwa beim Fachwerkhaus dieser Zeit jedes Stockwerk über das darunterliegende etwas vorragt, so werden die Unterzugbalken des Innenraumes einfach nach außen weitergeführt, tragen so den überhängenden Gebäudeteil und geben dem Außenbau nicht nur dieselbe Klarheit der baulichen Konstruktion wie dem Innenbau, sondern motivieren ihn geradezu durch diesen.
Dessen Durchführung ist ebenso tektonisch bedingt. Ein gotisches Zimmer, wie etwa das, in das Albrecht Dürer seinen heiligen Hieronymus gesetzt hat (Abb. 10), ist von sicherer Klarheit der architektonischen Konstruktion. Zwei mächtige Unterzugbalken, senkrecht zur Fensterwand durchs Zimmer geführt, tragen eine Balkenlage, auf der die eigentliche Decke ruht. So kennt man genau die Festigkeit der Decke. Sie gibt zusammen mit der klaren Ruhe der Wand dem Zimmer jenes Sicherheitsgefühl, das für den Bewohner die Behaglichkeit bedeutet. Die warme Farbe der Holztäfelungen und die Verteilung des Lichtes durch die Anlage der Fensterwand wirkt hierzu mit. Sie ergibt sich mit zwingender[S. 24] Logik aus der geringen Intensität des Lichtes im Norden; während unter dem klaren Himmel Italiens das Fenster schmal und hoch ist, nimmt es in Deutschland den oberen Teil der Wand in seiner ganzen Breite ein und ergibt so eine gleichmäßig ruhige Verteilung des Lichtes. Es ist kein Zufall, daß die Gemälde dieser Epoche, die in unseren Museen hängen, nicht bei hellem Sonnenschein, sondern bei dem gleichmäßigen Licht des bedeckten Himmels die höchste Kraft ihrer Farben entwickeln und geradezu von innen heraus zu leuchten beginnen. Sind sie doch für das ebenso gleichmäßige und wenig intensive Licht des breiten Butzenscheibenfensters gemalt worden.


So erklärt sich der Eindruck harmonischer Schönheit bei den Bauten der bürgerlichen Gotik. Außenbau und Innenbau sind in vollkommener Einheit, weil beide allein abhängig sind vom Zweck und damit jeder durch den anderen bedingt ist; nirgends drängt sich das Ornament vorlaut in die ruhige Klarheit des organischen Gefüges. Es gibt überhaupt kein Haus in dieser Zeit, das nur gebaut ist, um schön auszusehen, und eben deshalb sind die unverletzt erhaltenen Häuser und Straßenzüge von vollkommener Schönheit. Denn nicht nur die Schönheit des einzelnen Baues, auch die des größeren Organismus, der Stadt, ist wesentlich Zweckschönheit. Die Art, wie der Marktplatz aufgebaut ist, wie Brunnen und Rathaus und Zunfthäuser auf ihm stehen, wie die Straßen einmünden, ist genau geregelt nach den Forderungen des zuströmenden Marktverkehrs, die Anlage der Stadt den Terrainverhältnissen angepaßt und nicht, wie heute, das Terrain einem willkürlichen Schönheitsgesetze unterworfen. Daher jener erstaunliche Zusammenhang mit der Natur in Nürnberg oder Heidelberg, daß es scheint, als wüchse die Architektur wie eine wurzelnde Pflanze aus dem Boden.
Allerdings leben die Stilelemente der kirchlichen Spätgotik fort, aber sie werden nur dort wirksam, wo Schmuck gefordert wird, also an bürgerlichen Prunkbauten wie dem Rathaus von Münster in Westfalen. Noch widerstreitender erscheint dieses Nebeneinander von bürgerlichem Zweckstil und prunkhafter Spätgotik im Kunstgewerbe. Der Tisch[S. 25] in Dürers Hieronymus (Abb. 10) ist ganz konstruktiv gewonnen. Man stellt zwei Bretter hin, die die Platte tragen, steckt zwei schmale Balken durch dazu ausgeschnittene Löcher in ihnen und hält das Ganze durch außen vorgelegte Keile zusammen. Aber gleichzeitig entstehen elegante, hochbeinige Prunkmöbel wie der Stollenschrank, deren Flächen aufgelöst sind in dem graziösen Maß- und Krabbenwerk des spätgotischen Ornamentes. Beim Gerät greift diese Spaltung der Formstile noch tiefer ein. Das Gebrauchsgerät, aus dem billigen Ton, ist absolut tektonisch. Beispielsweise ist die niederrheinische Schnelle (Abb. 11) ein walzenförmiges Gefäß, dessen obere und untere Begrenzung durch ringförmige Säume ausgedrückt, dessen Oberfläche aus dem Eigenmaterial des unglasierten Tones gebildet ist. Das goldene Prunkgerät dagegen wird zunächst spätgotisch reich bewegt und geziert, um dann schnell zu ebenso reichen Renaissanceformen überzugehen (Abb. 14 und 15). Denn die italienische Renaissance wird in Deutschland nicht tektonisch, sondern nur ornamental wirksam. Ihre Formen treten einfach an die Stelle der spätgotischen Schmuckelemente, ohne das Gerüst wesentlich zu ändern.
Schon in der Kunst der römischen Kaiserzeit überraschte die Leichtigkeit, mit der man fremde, selbst exotische Formen aufnahm und sich assimilierte. Hier — bei der deutschen Spätgotik — finden wir die gleiche Fähigkeit, und das Rokoko hat sie ebenso besessen. Denn das Streben nach Formenreichtum, das im Charakter dieser dekorativen Epochen liegt, mußte in den Gebilden fremder Kunst viel reichere Vorbilder sehen, viel stärkere Ausdrucksmöglichkeiten finden, als in den mit dem Geschmack des Stiles entwickelten und daher für ihn weniger interessanten eigenen Formen. So erklärt sich die Freude an den zu Trinkgefäßen gefaßten Straußeneiern und Nautilusschalen, ja, es findet sich selbst zartes chinesisches Seladon-Porzellan in gotische Silberstreifen gefaßt, wie später in die Bronzeranken des Rokoko. So erklärt sich aber auch die Gier, mit der sich die deutsche Spätgotik auf die Formen der italienischen Renaissance stürzte, sie vollkommen zusammenhanglos in die eigene Dekoration mit aufnahm und die eigenen Formen in sie wandelte, Pfeiler in Baluster, Laubwerk in Akanthus, Fialen in Obelisken, Maßwerk in Voluten, ohne daß dadurch etwa ein einheitlicher Renaissance-Stil in Deutschland entstand. Es ist eben falsch, den Stil nur nach dem Ornament zu benennen. Vielmehr kann man durchaus sagen, daß die sogenannte deutsche Renaissance nur eine deutsche Spätgotik[S. 26] mit italienisierendem Ornament ist. Vielleicht versteht man auch von hier aus, wie es möglich war, eben bei Albrecht Dürer, dem Hauptmeister der deutschen Renaissance, dessen Hieronymus-Stich gleichzeitig ist mit der sixtinischen Decke Michelangelos, so rein die Formen der deutschen Spätgotik wiederzufinden.
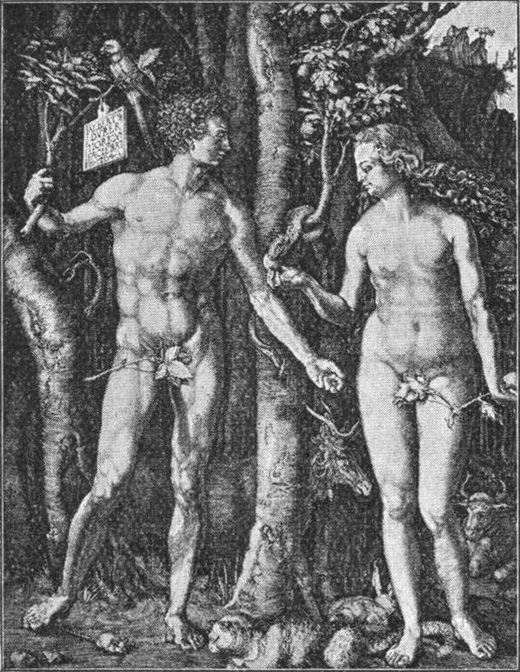
Gerade bei Dürer (1471 bis 1528) wird es deutlich, daß der Stil dieser Zeit mit allen Wurzelfasern in der Spätgotik haftet. Der Kampf zwischen den alten Formen und dem neuen Kunstwollen war es, der bei ihm alle Schaffenskraft entwickelte. So stark wie er hat keiner um die neue Schönheit gerungen; ihm genügt es nicht, die Vorbilder der Italiener verstehend nachzubilden, ihm genügt es nicht, die Schönheit zu schaffen, sondern er ringt um sie, wie Verocchio, und sucht ihrer Gesetze Herr zu werden im Studium der Proportionen. Daß er es an dieser formalen Schönheit nicht Genüge sein ließ, sondern in seinen Bildern phantastisch reichen Formen und Gefühlen Ausdruck gab, unterscheidet ihn vom Italiener der Renaissance. Allein eben dieses Interesse am Gedanken, das naturgemäße Resultat der gotischen Geistesrichtung, gehört zum Spätgotischen seiner Erscheinung. So erklärt sich im Hieronymusblatt die fein empfundene Stimmung des Gelehrtenzimmers, so aber erklärt es sich auch, daß er selbst in dem Werke, in dem er vielleicht dem italienischen Schönheitsgefühl am nächsten gekommen ist, im Sündenfall von 1504 (Abb. 12), dessen Gestalten ganz auf Grund seiner Proportionsstudien entstanden sind, in wesentlichen Zügen Spätgotiker bleibt. Man sieht freilich, es ist eine neue Schönheit in diesen Gestalten, die mit stolzer Bewußtheit zur Schau gestellt wird. Allein schon die Art, wie der Akt uns hier vor Augen tritt, ist Beweis einer neuen Gesinnung. Zwar, auch das Mittelalter hat Adam und Eva nie anders als nackt geformt (Bd. I, Abb. 45). Aber erst in der Renaissance[S. 27] wird die Nacktheit des menschlichen Körpers die entscheidende Form seiner Schönheit, während sie vorher nur Symbol war, und Dürers Stich ist das wichtigste Denkmal der neuen Gesinnung in Deutschland. In diesen schlanken und doch kraftvoll geformten Gestalten ist von dem überzierlichen Schönheitsgefühl der gotischen Kurve keine Spur. Großlinig werden die Körper umgrenzt, großflächig durchgeformt, und die ruhig fließende, durch keine Einschnürung zerstörte Linie des Frauenkörpers steht der Antike so nahe, wie weniges damals selbst in Italien. Die Freude an so großen einfachen Formen hatte dann die fast primitive Anordnung im Gefolge, die in diesem Kupferstich die Körper in breiter Vorderansicht zur Schau stellt, die Köpfe aber ins Profil wendet. Allein die krause Zeichnung des zierlichen Lockenhaares verrät noch das spätgotische Gefühl, und ebenso die Bevorzugung des leichtgestützten Spielbeines. Es ist ungemein bezeichnend, daß das erste Problem, das Dürer aus der italienischen Renaissance übernimmt und mit hartnäckiger Intensität studiert, gerade dieses zwanglose Stehen mit gehobenem Fuße ist. Es liegt noch ein Rest von der Spitzfüßigkeit der späten Gotik in seinem Interesse an dieser Art des Stehens. Ja, das Problematische des Zeitalters, sein innerer Widerstreit, macht das ganze Blatt zwiespältig. Diese klassisch gedachten Akte stehen vor einem Hintergrunde von spätgotischem Reichtum und spätgotischer Enge, ohne auch nur den Versuch zu machen, mit ihm zur Bildeinheit zu verschmelzen. Spätgotisch gefühlt ist diese Zerlegung des Waldes in Einzelstämme, ihre Überschneidung durch das ornamenthaft knorrige Geäst mit seinen krausen Blättern. Allerdings gab Italien damals die klarste Antwort auf viele Fragen der Raumgestaltung und Körperbildung, die schon das 15. Jahrhundert gestellt hatte, und das erklärt den Enthusiasmus, mit dem Dürer und seine Zeitgenossen, besonders Hans Holbein d. ä., seine Lösungen ergriffen. Aber eine Einheit, ein Stil entsteht auch in der Malerei nicht. Dürer gelingt in den Werken seiner letzten Jahre eine Synthese deutschen Reichtums mit italienischer Größe, die ihm das innere Gleichgewicht, seinen Werken die monumentale Sicherheit gibt. Aber noch in der nächsten Generation steht neben Hans Holbein d. j. (1497–1543), dessen Werke die renaissancehafte Ruhe erreicht haben, Mathias Grünewald, der die gotische Gefühlserregtheit bis zur Ekstase treibt und seine Altäre mit gotischem Laubwerk krönt.
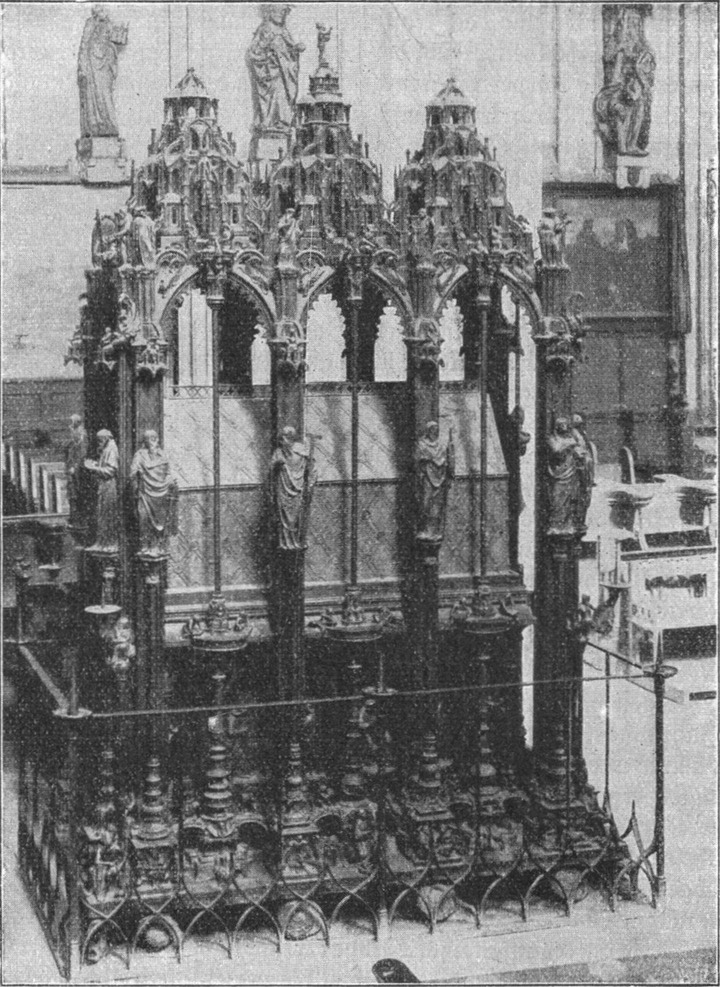
Genau dieselbe Aufnahme der Renaissanceformen in das Stilgefühl der Spätgotik, wie in der Malerei, findet auch in der Plastik statt.[S. 29] Am meisten von ihnen berührt wird Peter Vischer. Sein Sebaldusgrab in Nürnberg, das geradezu als das Hauptwerk der deutschen Renaissance gilt, ist trotz seiner italienischen Balusterformen das Werk eines echten Spätgotikers (Abb. 13). Es ist schon bezeichnend, daß man das früher geformte Reliquiar überhaupt mit einem dekorativen Gehäuse zu umkleiden für nötig hielt. Die Art, wie der ganze Aufbau nicht fest auf dem Boden steht, sondern auf Schnecken ruht, die als Füßchen dienen, wie man das Reliquiar und die Reliefs durch das davorgelegte kleinformige Gerüst zerschneidet, schließlich die Auflösung des oberen Abschlusses durch die drei ornamental zerlegten kleinen Kuppeln, all das ist vollkommen im Sinne der Spätgotik empfunden, und es ist nicht nur äußerlich interessant, sondern sehr bezeichnend, daß die Apostelfiguren des Grabes stilistisch den Gestalten des Italieners Ghiberti so ähnlich sind, den wir ja als einen von gotischer Schulung noch sehr stark abhängigen Künstler kennen lernten. Peter Vischers künstlerische Entwicklung geht ähnlich wie die Dürers von der spätgotischen Zerfaserung zu einer renaissancehaften Beruhigung der Formen.
Damit ist die kunsthistorische Stellung von Malerei und Plastik in dieser Epoche gegeben. Sie ist der letzte Ausläufer derselben Bewegung, die mit der Gotik als Reaktion gegen die zweckvolle romanische Kunst begann, und in allen Beziehungen ihre höchste Steigerung. Plastik und Malerei gingen hier denselben Weg, den sie unter parallelen Entwicklungsbedingungen in der hellenistisch-römischen Zeit gegangen sind, befreien sich von den Fesseln der Architektur, werden Freiplastik, Hochrelief und Tafelmalerei, steigern ihre Ausdrucksformen bis zur höchsten Freiheit des Malerischen und ihre Ausdrucksmöglichkeiten über die Genrekunst hinaus bis zur Charakteristik des Menschen, zum Realismus. Aber es ist kein starkes Bewußtwerden seiner Kraft wie in Italien, sondern die letzte Konsequenz gotischen Gefühls. So erklärt es sich, daß sich Malerei und Plastik nicht verhalten wie der neue tektonische Bürgerstil, sondern wie der spätgotisch kirchliche. Denn sie sind Kirchenschmuck wie die Monstranz. So bleiben sie noch mittelalterlich dumpf. Erst das bewußte Erkennen der Umwelt, der Struktur des Raumes und des Menschen konnte sie zu einer Vollkommenheit bringen, die sie aus eigener Kraft nicht erreichen konnten. Um so begieriger ergriff das Zeitalter Dürers die italienischen Lösungen all dieser Probleme: die Erkenntnisse von Perspektive, Proportion und Anatomie. Das geschieht in derselben Weise, in der der Norden den Humanismus versteht. Er ist als Trieb zur[S. 30] wissenschaftlichen Erkenntnis genau so die höchste Steigerung spätgotisch-mystischer Gefühlserregtheit auf weltlichem Gebiet, wie die Reformation auf religiösem. Man hat es also keineswegs, wie oft behauptet wird, in Italien und in Deutschland mit derselben Strömung realistischer Kunst zu tun. Vielmehr beginnt diese Stilbewegung in Italien mit der Frührenaissance und erreicht den höchsten Ausdruck im Barock, während es in Deutschland noch die mittelalterliche Kunst ist, die hier die letzten ihrer Werke schafft, um unmittelbar darauf zu erlöschen. Die sogenannte deutsche Renaissance ist so sehr eine Episode, der eigentlichen Stilbewegung Deutschlands so fremd, daß die Anlehnung an Italien nur ein letzter Notbehelf ist, um das Ende dieser tausendjährigen Entwicklung aufzuhalten. Gegen 1550 gibt es in Deutschland keinen bedeutenden Maler oder Plastiker mehr.

Die Aufnahme der italienischen Formen in Architektur und Kunstgewerbe geschieht ebenso unter Zugrundelegung der alten gotischen. Die tragkräftigen Balkenköpfe an der Außenseite des deutschen Fachwerkhauses verwandeln sich in dekorative Konsolen, die hohen Füße des Stollenschrankes in italienisierende Säulen, ohne das Gerät oder die Hausfront, geschweige den Grundriß wesentlich[S. 31] umzuwandeln. Das Resultat ist natürlich ein Kompromiß. So, wenn bei einem Tafelaufsatze des berühmten Goldschmiedes Jamnitzer die weibliche Figur, die ganz renaissancemäßig die Schale trägt, aus feinstem Gras- und Pflanzenwerk emporsteigt, das das Stehen ihrer Füße verunklärt und von genau derselben Art ist, wie das feinlinige Pflanzenwerk der Spätgotik. Die Entwicklung eines einzelnen Gerätes, etwa des Pokals, kann den Weg der neuen Formen vielleicht am klarsten aufzeigen.
Die Gliederung des gotischen Pokals (Abb. 14) ist nicht Klarlegung, wie beim romanischen Kelch (Bd. I Abb. 46), sondern Bewegung des Gefäßes. Auf schmaler, durch hohe Buckel zerteilter Platte hebt ein dünner, steil ansteigender Fuß den nach oben sich verbreiternden Leib des Gefäßes empor. Buckel begrenzen die Kuppa am oberen und unteren Rand, aber von ihnen laufen Zungen aus, die sich lückenlos ineinander verzahnen und so diesen Teil des Gefäßes in sich zusammenschließen. Wenn von seinem unteren Rand aus loses Rankenwerk nach unten weiterleitet, so führt das den Fuß ebenso in sich zurück, wie die Doppelvolute die ionische Säule. Obgleich der Deckel durch einen schmalen Rand gegen das Gefäß abgegrenzt wird, bildet er doch in allen Linien dessen unmittelbare Fortsetzung. Dann erst stockt die Bewegung, und hastig endet der Pokal in einen dünnen Stab, der nicht Deckelgriff ist, sondern den Sinn der gotischen Kreuzblume hat. Das Verhältnis des gotischen Pokals zum romanischen ist also dasselbe, wie das der gotischen Kirche zur romanischen. War für den Eindruck des romanischen Kelches nur der Zweck seiner Teilung bestimmend, so geht hier die Absicht auf eine Eleganz, die in dem Aufbau ebenso zum Ausdruck kommt, wie in der Ausgestaltung der einzelnen Teile. Schlank und schmal steigt das Gerät pfeilschnell in die Höhe, und alle größeren Formen an ihm sind zerspalten durch Buckel und Ornamente in Treibarbeit oder in plastisch aufgelegtem Email, so daß auch in der Dekoration an Stelle der flächenmäßigen romanischen Verzierung die plastische getreten ist. Und nun werden gegen das Ende des Jahrhunderts die Einzelformen immer stärker herausgehoben gegenüber der Grundform, die Buckel stärker herausgetrieben, die Zungen in Windungen um den Pokalleib gelegt, so daß er geradezu in Drehung befindlich scheint, wie die Säulen des Braunschweiger Domes. Allein das bedeutet zugleich eine erhöhte Wichtigkeit der Buckelreihen, die nicht mehr mit den gegenüberliegenden eng verflochten sind, sondern einen Wert bekommen, der sie dann im Buckelpokal der Renaissance zur wichtigsten Gliederung[S. 32] macht (Abb. 15). Seine Abstammung vom spätgotischen Pokal ist evident; es ist derselbe schmale Fuß, derselbe breite Leib, dieselbe schmale Endigung im Deckelgriff. Allein hier handelt es sich nicht mehr um Bewegung, sondern um Ordnung, nicht mehr um die gotische Senkrechte, sondern um die renaissancehafte Wagerechte. Die drei Buckelreihen von Körper und Deckel wollen allein von der Proportion aus verstanden sein. Von der mittleren aus, die so energisch ausladet, der oberen des Pokalleibes also, wird die Gliederung im Gleichgewicht gehalten. Nicht nur, daß die untere Buckelreihe des Leibes und die des Deckels, daß Fuß- und Deckelgriff sich in den Gliederungen entsprechen: es ist aufs genaueste abgewogen, daß, wenn auf den kleinen Deckelgriff der Deckel mit breiter Ausladung folgt, über dem hohen Fuß ein schmalerer Buckelkranz sich anschließt. Allein das ist nur eine schmückende, keine funktionelle Teilung, nur vom Aussehen, nicht vom Zweck des Gerätes aus gewonnen. Es will dabei gar nichts besagen, daß die eleganten Formen der Spätgotik durch die knollige, derbere Art der Renaissance verdrängt worden ist, etwa der kantige Fuß durch den italienischen Baluster. Darin spricht sich nur die Absicht auf den wuchtigen, massigeren Eindruck aus. Ein Ornament an und für sich kann nie konstruktiv sein, sondern wird es erst durch seine Anwendung. So ist für den untektonischen Sinn dieser Epoche die Vorliebe für den sog. Ornamentstich ganz bezeichnend, den Stich ornamentaler Blätter als Vorlage für den ausführenden Handwerker. Ist schon die Arbeitsteilung zwischen entwerfendem Künstler und ausführendem Arbeiter charakteristisch für den Sinn der Zeit, so war es außer Frage, daß diese Vorlagen in den Händen von Handwerkern mit geringem Stilgefühl ebenso sehr verderblich wirken mußten, wie sie andererseits das energische Durchdringen der fremden Formen erklären.
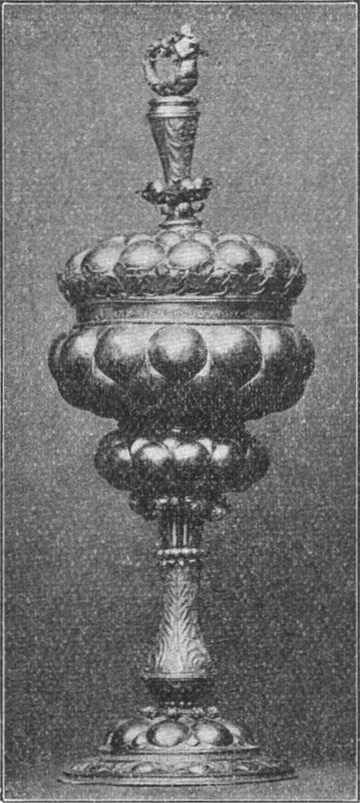
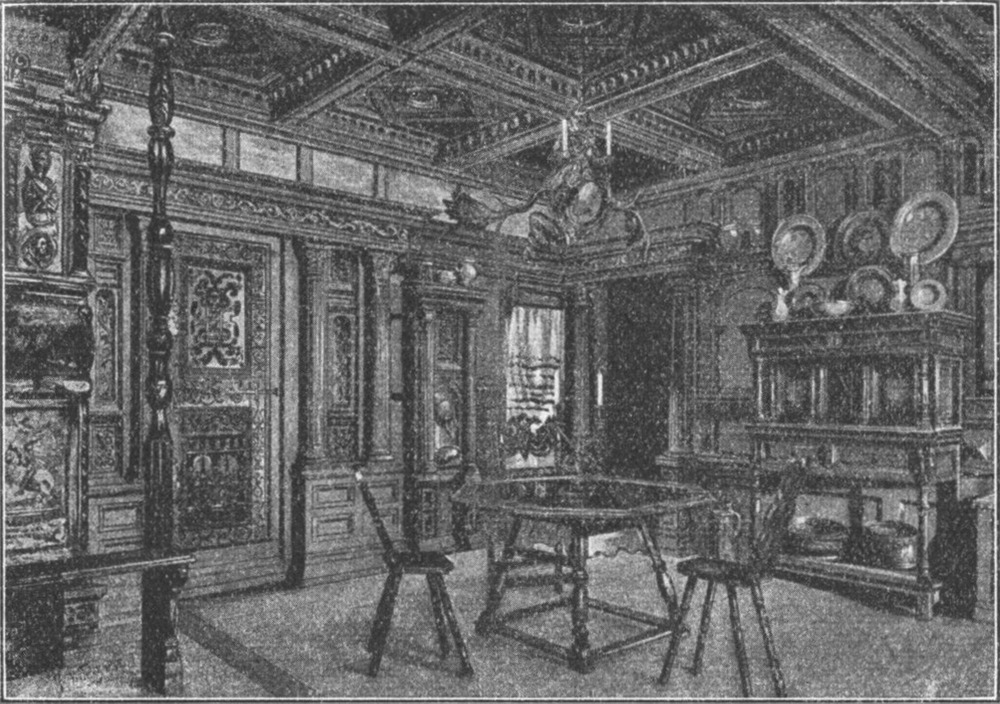
So wandelt sich auch das gotische Zimmer (Abb. 10) in das der[S. 33] Renaissance (Abb. 16). Aus der Balkendecke, die als Stützform des Plafonds dem Raum Sicherheit gab, wird die italienische Kassettendecke, die nur den oberen Abschluß des Zimmers ausdrückt; aus der wandhaften Holztäfelung, die das Klima verlangt, wird eine bloße architektonische Dekoration. Bei einer Lübecker Täfelung (Abb. 17) teilen paarweis gestellte korinthische Säulen, deren Schaft mit einer reich ornamentierten Trommel beginnt, die Wand in Felder. Ist schon die Säule durch diese phantastische Zusammenstellung italienischer Elemente mehr Schmuck- als Trageform, so ist sie auch tatsächlich funktionslos — sie und das Gebälk, das sie tragen sollte, sind als bloße Scheinarchitektur vor die Wand gesetzt, um deren Erscheinung zu bereichern. Geradezu peinlich ist dann der Eindruck des Mittelfeldes. Denn hier ist eines der kraftvollsten Architekturmotive als bloße Dekoration verwertet. Wir sprachen beim Palast der italienischen Frührenaissance davon, wie klar die Tragkraft des Bogens sich zum Ausdruck bringt, wenn man seinen Organismus dadurch klarlegt, daß man die Keilsteine aufzeigt, und den Schlußstein, der die ganze Konstruktion zusammenhält, figürlich betont. Dieses edle Motiv wird nun hier aus jedem Zusammenhang gerissen und einfach als Rahmung verwandt für eine[S. 34] Wappentafel, bei der willkürlich verknüpfte Architekturteile mit gleicher Unsachlichkeit als bloßes Rahmenwerk verwertet sind. Es wird also nicht nur der architektonische Sinn der Wandtäfelung durch die Dekoration verschleiert — diese selbst verwendet architektonische Trageformen widersinnig dekorativ und wendet Steinformen als Holzformen an. Die Vorbedingung hierfür war gegeben durch das kirchlich spätgotische Stilgefühl, das mit seinen eigenen Bauformen ebenso umsprang[S. 35] (Bd. I Abb. 62), nur geht die Ausdrucksabsicht jetzt nicht mehr auf Zierlichkeit, sondern auf Würde, nicht mehr auf Zerlegung, sondern auf Ordnung.
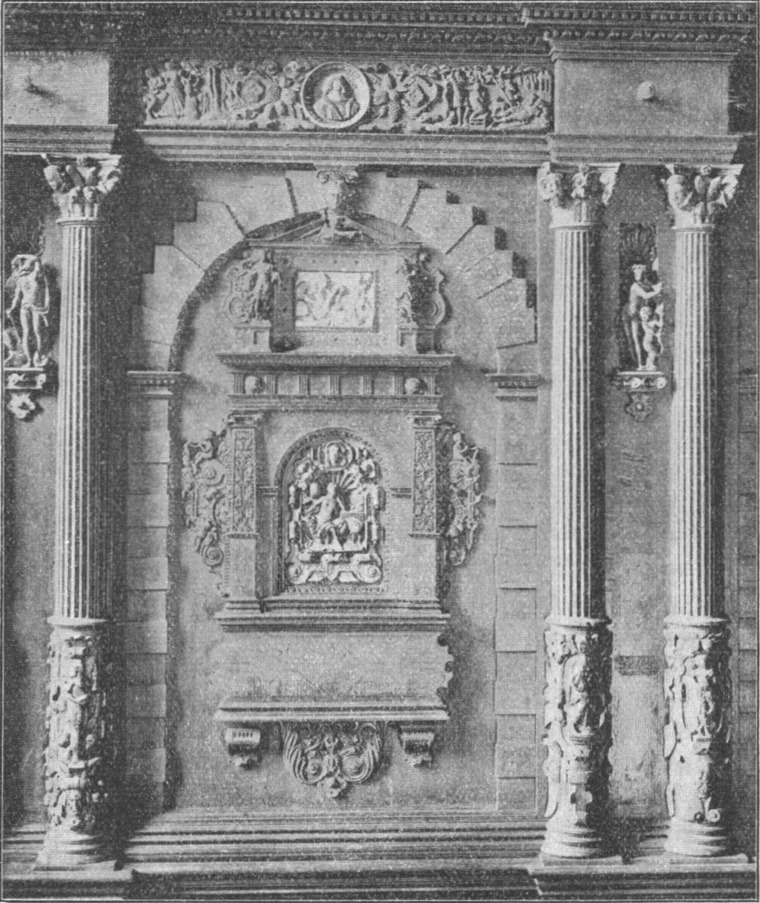

So kommt es, daß die Fassade, die Schauseite des Hauses, nun plötzlich eine Wichtigkeit erhält, die sie bis dahin nicht besessen hat, und unabhängig von der Innenarchitektur zu einem eigenen Ausdruckswert gelangt (Abb. 18). Zwar die breiten Fenster, die eine so gute Lichtverteilung schufen, sind noch beibehalten, auch die klaren Horizontallinien der Simse, die außen anzeigen, wo die Stockwerke innen sich scheiden. Aber genau so wie in Italien und abhängig von ihm stellt auch in Deutschland die Hochrenaissance vertikale Gliederungen zwischen die horizontalen, setzt an die Stelle des sachlichen Ausdrucks den ästhetischen.
Die Front des Braunschweiger Gewandhauses, 1591 errichtet (Abb. 18), ruht auf einem Laubengang von drei wuchtigen, gleich breit gespannten Bogen. Durch Säulen sind sie voneinander geschieden, und Säulen wiederholen in den drei darüberliegenden Stockwerken dieselbe Einteilung. So ist das eigentliche Gebäude gegenüber dem Giebel zu einem festen Organismus zusammengeschlossen. Tatsächlich wird hier ein Gegensatz beabsichtigt: über das Sims, das den Giebel vom Hause scheidet, geht keine der Gliederungen hinweg. Über ihm setzt eine neue, reichere Dekoration ein. Die Horizontalsimse verdoppeln sich; damit sind die scharfgezogenen Grenzlinien zwischen den Stockwerken zwar verwischt, aber die Mauerfläche ist stärker belebt. Wurden im eigentlichen Hause je zwei Fenster durch die Säulen zu einer Einheit[S. 36] zusammengeschlossen, so wird im Giebel jedes Fenster durch einen Pilaster oder eine Herme vom Nachbarfenster geschieden. In jedem Giebelstockwerk nehmen diese vertikalen Teilungen die des darunter liegenden Stockwerks auf, die horizontalen Linien eines jeden Simses werden durch gleitende Voluten am Rande zum nächsten Sims emporgeführt, und allegorische Gestalten oder kleine Obelisken sammeln diese Linien und führen sie über den Umriß des Hauses hinaus in die Luft. Allein auch das ist Kulisse, ein Randornament, das mit dem wirklichen Giebelrand nichts zu tun hat, genau so wenig, wie diese ganze Gliederung mit dem ganz traditionell beibehaltenen Grundriß- und Aufbautypus dahinter.
Auch in diesem Fassadenaufbau ist gotisches Gefühl überall lebendig. Gotisch ist das entschiedene Betonen des Aufstiegs, trotz aller wagerechten Gliederungen. Schon im ersten Geschoß über der Laube sondert sich das Mittelfenster durch seine Breite heraus, die Mittelfenster der darüber liegenden Geschosse stehen geradezu isoliert, in denen des Giebels geht die Linie weiter, steigt immer steiler an und schließt sich zuletzt mit der Linienführung des Giebels in der krönenden Figur auf der Spitze zusammen. Man kann nicht umhin, auch bei seinen Obelisken und Figürchen an gotische Fialenarchitektur zu denken, wie sich auch zwischen allem Renaissanceornament spätgotisches Maßwerk als Brüstung im ersten Stock findet, so gleichwertig, daß man fühlt, wie hier ein dekorativer Stil von einem anderen abgelöst wird, der nicht strenger empfindet. Tatsächlich geht die Verwandtschaft bis ins einzelne, und die ganze Fassade ist schließlich nur die Übersetzung einer spätgotischen, wie der des Rathauses von Münster, in die Renaissance. Es ist hier dieselbe malerische Tendenz in der wellenförmigen Bewegung der Wand durch das weiche, regelmäßige Ineinanderströmen von Licht und Schatten, dieselbe malerische Tendenz in der Verwischung der Randkontur. Es ist frappant, wie auch hier eine große Vertikalachse durchgeht und zugleich jeder Rest, den sie im Ansteigen läßt, von den kleinen Obelisken und Figürchen, die an der Stelle der Fialen stehen, in die Luft geführt wird. Allein der Unterschied ist derselbe wie zwischen den spätgotischen Zaddeln und der frühbarocken Spitzenmanschette in ihrem Verhältnis zum Gewand. Der Turm der gotischen Kirche und der Giebel des gotischen Hauses wachsen, wie der Deckel aus dem gotischen Pokal, mit vollkommener Selbstverständlichkeit aus dem Gebäude hervor, die Renaissance aber gliedert, grenzt diese Dinge gegeneinander[S. 37] ab und vereinigt sie dann in überlegter Harmonie. Auch das ist keine funktionelle Teilung, wie man wohl gemeint hat, sondern eine symmetrische Gliederung durch die Dekoration mit der Absicht einer bestimmten Schönheit. So wirken die Fassaden der deutschen Renaissancearchitektur sehr harmonisch, aber eigentlich nur, solange man sie als Bilder und nicht als zweckbedingten Aufbau betrachtet.
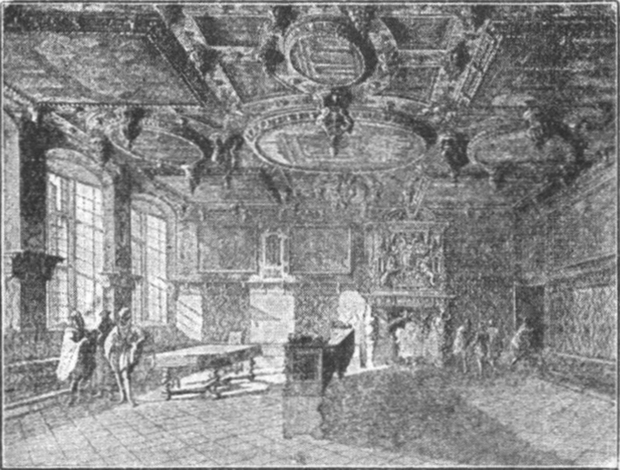
Man hat Bauten vom Ende des 16. Jahrhunderts, wie das Braunschweiger Gewandhaus, schon dem deutschen Barock zugerechnet, und nicht mit Unrecht. Ist doch gerade das Pathos in der Dekoration das spezifische Kennzeichen des italienischen Barockstiles. Und es ist bezeichnend, daß erst in diesem völlig dekorativen Stil eine Eingliederung der deutschen Kunst in die allgemeine Stilentwicklung erreicht wird. In der Sommerratsstube des Danziger Rathauses vom Anfang des 17. Jahrhunderts (Abb. 19) ist die Verschmelzung mit dem italienischen Frühbarock vollkommen. Alle Täfelungen, Türfüllungen und Möbel sind hier in pathetisch-schweren Formen gehalten. Die Decke hängt geradezu über dem Raum, alle ihre Formen wirken nach unten. Allein diese Schwere ist nicht die Ruhe konstruktiver Ehrlichkeit, sondern das Pathos, das durch große Formen imponieren will. Während die gotische Zimmerdecke fest auf Stützbalken lag, die Renaissancedecke, in ihrer Konstruktion weniger entschieden, in quadratische Kassetten geteilt das Zimmer objektiv abschloß, hängen hier gewaltige Zapfen, schwer profilierte Kassetten geradezu von der Decke herab. Sie wird also für das Auge nicht mehr von den Balken getragen, wie es natürlich wäre, sondern läßt sie von sich herabhängen; die Dekoration ist nicht mehr logischer Schmuck, sondern Feind der tektonischen Bedingungen, und strebt danach, an Stelle des konstruktiven den Stimmungsausdruck, Wucht und Würde, zu setzen. Es ist von derselben Art, wenn jetzt in der Kleidung die großen, sog. „Mühlsteinkrausen“ aus Spitzen[S. 38] kommen, die die wichtige Ansatzstelle des Halses, das eigentliche Scharnier zwischen Kopf und Rumpf, einfach überbrücken, um die Silhouette der ganzen Gestalt einheitlich zu machen.
So gerät zu dieser Zeit Deutschland völlig in künstlerische Abhängigkeit von Italien, dessen Kunstformen es zwar nicht unverarbeitet, aber doch in allem Wesentlichen übernimmt. Im Anfang des 17. Jahrhunderts vernichtet der Dreißigjährige Krieg Deutschlands letzte Volkskraft. Das Resultat ist für Deutschland dasselbe, wie das der dorischen Wanderung für die kretisch-mykenische Kultur, das der Völkerwanderung für Italien. Im 17. Jahrhundert ist Deutschland künstlerisch als eine Provinz Italiens anzusehen, im 18. gerät es wie unter die politische auch unter die künstlerische Suprematie der französischen Kultur.
Während italienische Formen immer stärker in die Kunst Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande eindringen, hat Italien selbst, das so fast ganz Europa sich künstlerisch unterworfen hat, den Bauausdruck immer stärker im Gegensatz zur Zweckform entwickelt. Jene Tendenz auf das Pathos groß wirkender Bauformen, die schon der Renaissance zugrunde lag, wird im Barock zu einer architektonischen Geste, die, weit ausholend, an der Villa den Park, vor der Kirche den ganzen Platz in den Dienst desselben Eindruckes stellt. Der Name des Stiles, der die bizarre Krümmung der Bauformen bezeichnet, trifft hier so wenig wie sonst sein Wesen. In Wahrheit handelt es sich um so tiefe seelische Erschütterungen, daß Visionäre auftreten, wie Ignatius von Loyola, daß die Kunst überwiegend kirchlich wird und ihre Wirkungen sich bis zur Ekstase steigern. Kein Stil war innerlich der Gotik verwandter.
Wo die Renaissance vom Kirchenbau sprach, war die Absicht, wie im Profanbau, äußerste Konzentration der Anlage bei strenger Betonung von Ecke und Wand. Der fast quadratische Grundriß ist ebenso straff wie der des Palazzo, und an die Stelle des sammelnden Hofes tritt die Kuppel. So ist der Idealgrundriß einer Kirche gedacht, den Filarete in seiner theoretischen Schrift entwirft, und auch Michelangelos berühmte Kuppel für St. Peter in Rom war so beabsichtigt. Machtvoll sollte sie den Kirchenraum zusammenfassen, machtvoll den Außenbau[S. 39] krönen. Und nun ist es charakteristisch für die Stilwandlung, zu sehen, wie das Barock, der Vollender des Baues, die Absichten des Schöpfers umgeformt hat. Es hat ein tonnengewölbtes Langschiff vor diese Kuppel gelegt, so daß am Ende des düsteren Tunnels ihr leuchtender Glanz über dem Altare um so heller strahlt. Und im Außenbau nimmt die Kuppel die Formen der Fassade auf; ihre aufwärts fließenden Linien bedeuten für sie die Auflösung nach oben. So ist sie in Außen- und Innenbau gleich eindrucksvoll aufgenommen; allein man muß sich fragen, wie es möglich war, Michelangelos Kuppel in einer Weise zu vollenden, die für unser Auge die vollkommene Vernichtung der Absichten des Meisters bedeutet. Hat doch das Barock sich überall an Michelangelo angeschlossen und ihn gefeiert wie nie einen zweiten.
Die Lösung gibt eine zweite scheinbare Vergewaltigung. Michelangelos gewaltiger Moses ist vom Barock in S. Pietro in Vincoli in eine viel zu enge Nische gestellt worden, die uns Heutigen unerträglich auf das Bildwerk zu drücken scheint. Allein man hat festgestellt, daß das Barock es liebte, Skulpturen in einen engen Raum zu stellen, um so ihre Bewegung um so sieghafter erscheinen zu lassen. Von diesem Gesichtspunkt genommen, ist die Aufstellung des Moses zu ihrer Zeit eine Idealaufstellung gewesen, trotz der anderen Wirkungsabsicht des Schöpfers, der eben einer früheren Periode angehörte. Und genau so muß die Verwendung der Kuppel Michelangelos für den Barockgeschmack eine außerordentliche Steigerung ihrer Wirkung bedeutet haben. Um das zu verstehen, ist es notwendig, den Kirchenbau des neuen Stiles genauer kennen zu lernen.
Es ist dabei fast gleichgültig, wo man seine Denkmäler aufsucht. Niemals vorher ist der Katholizismus so international gewesen wie gerade jetzt. Das liegt nicht nur an der Arbeit des Jesuitenordens, nicht nur an der Arbeit der Kirche selbst; diese ist vielmehr Gegenwirkung gegen die Loslösung der politischen Faktoren von der kirchlichen Macht, die ihrerseits immer weniger weltlich, immer mehr Religion werden muß. Es ist dieselbe Scheidung, die jetzt Wissenschaft und Religion, welche die Scholastik in sich vereint hatte, voneinander trennt, und das Endresultat ist die Gesinnungsfreiheit Friedrichs des Großen: „Hier muß ein jeder nach seiner Façon selig werden.“ Der Absolutismus der Fürsten, der sich jetzt als Regierungsform entwickelt, erlaubt der Kirche keine tatsächlichen Eingriffe in die aktive Politik; allein sie herrscht mittelbar durch ihren Einfluß, der international und um so[S. 40] gefährlicher ist. Auch dieser staatliche Absolutismus konnte sich nur als internationaler Gedanke entwickeln. Die Landesgrenze ist keineswegs mehr die Grenze des Volkes, und über dessen Bedürfnisse hinweg, oft ohne sie zu kennen, strebt der Fürst nach Idealen internationaler Kultur, die sein Volk nicht begreift. Wohin das führt, zeigen die ehrgeizigen Prachtbauten kleiner Fürsten, die es Ludwig XIV. gleich tun wollten, zeigen aber auch die Versuche Peters des Großen und Josephs II., ihr Volk zu kultivieren. So ist es kein Zufall, wenn das Barock nach einem internationalen katholischen Kirchenbaustil einen ebenso internationalen Palaststil ausgebildet hat. Es ist ganz bezeichnend, daß die Kirchen des Protestantismus, wenn auch aus denselben Stilelementen gebildet, doch wesentlich ruhiger geformt sind, und die protestantische Dresdener Frauenkirche ein Bau von erhabenster Größe ist.
So haben wir ein Recht, das Beispiel für den katholischen Kirchenbau nicht aus dem Italien des Vignola, Maderna und Bernini zu holen, sondern aus dem katholischen Bayern, wo die Zahl der Barockkirchen schlechterdings Legion ist. Die Theatiner-Hofkirche in München (Abb. 20) bietet nicht nur ein besonders edles Beispiel des Stiles, sondern gestattet selbst, seine beiden Entwicklungsphasen zu erkennen, deren jede am Bau Teile, wie Jahresringe, angesetzt hat. In der Hauptsache 1661–1675 errichtet, ist der mittlere Hauptteil der Fassade durchaus ein Beispiel des strengen römischen Stiles. In zwei Geschosse zerlegt, fließt in jedem die Bewegung in großen Wellen dahin, mit Doppelpilastern im Untergeschoß beginnend, über andere Pilaster der Mittelachse zugeführt. Das Barock liebt den schweren Wandpilaster; nur wo die Welle dieser Bewegung einen Moment gehemmt wird, vor dem Mittelportal, das durch diese Pause seine Betonung bekommt, steht, überleitend, eine runde Säule. Auf jeder Seite dieser Mittellinie symmetrisch an- und abschwellend fließt die Welle über die ganze Fassade, um sich in der Mitte mit großem Schwung zu erheben. Hier strebt der Bau energisch aufwärts. Was die Reihe der übereinanderstehenden Pilaster, die durch die Vasen in die Luft gelöst wird, vorbereitete, gipfelt in der Kontur des Giebels, die allmählich steigend nach der Mitte sich erhebt. Es ist die Funktion dieses wichtigsten zusammenfügenden Bauteiles, die in St. Peter von der Kuppel übernommen wurde. Die Kuppel der Theatinerkirche ist für die Fassade überhaupt ohne Wert, und eben das ist beweisend für die Absicht, der Kuppel Michelangelos in der heutigen Verwendung eine beherrschende Stellung in der Fassade zu sichern. So ist die Wandauflösung[S. 41] vollkommen. Ihren Eindruck bestimmt nicht der Innenbau, sondern eine wagerecht durchgeführte und in der Senkrechten gesammelte Bewegung von erstaunlicher Lebhaftigkeit, vergleichbar dem musikalischen Gebilde der Fuge, und es ist vielleicht kein Zufall, daß auch diese derselben Zeit ihre Entstehung dankt.

Die Türme, 1690 hinzugefügt, zeigen in jeder Linie die Absicht, die Fassadenbewegung noch zu verstärken, zeigen die Ekstase vom Ende des Stiles. Vom Erdboden bis in den Turmhelm gehen hier die Linien[S. 42] der Pilaster über die verkröpften Simse hinweg. Und die Weichheit dieser Übergänge von der Basis in den Pilaster, vom Pilaster in den Architrav, vom Architrav in das horizontale Sims, vom Sims in die Pilasterbasis des zweiten Stockwerks und weiter bedeutet für das Auge eine Bewegung der Wand in vertikaler Richtung, deren Wellen viel leiser, aber auch viel unabirrbarer ziehen als die des Mittelschiffes. Es ist von derselben Art, wenn auch die seitlichen Begrenzungen der Türme nicht streng sind, wenn ihre Wände an den Ecken nicht in scharfen Kanten zusammenstoßen, vielmehr durch Abstufung der Pilaster in weicher Biegung über die Ecken hinweggeführt werden. Da diesen Pilastern nach der Wandfläche zu ebensolche Halbpilaster vorgelegt werden, so entsteht eine zweite Bewegung in horizontaler Richtung, die der ersten entgegenarbeitet und dadurch die lebhafte Bewegung des ganzen Bauteiles bewirkt. Es ist ungemein interessant, daß die Voluten am Turmhelm keineswegs die Linien der Hauptpilaster weiterführen, sondern von ihnen aus einander genähert werden, und zwar bis zum gleichen Abstand voneinander. So hört im Turmhelm die Betonung der Ecke auf, entsteht eine vollkommene Rundung, die in der Auflösung des Turmes nach oben zugleich eine Auflösung seiner Motive bewirkt.
Überraschend ist die Verwandtschaft der Fassade mit der Front der gotischen Kathedrale (Bd. I, Abb. 58). Daß das Malerische der Gliederung, die auch hier wesentlich als Abfolge von Licht und Schatten wirkt, die Auflösung durch zwei Türme und einen Mittelgiebel oder durch Fialen, an deren Stelle hier die Vasen stehen, und anderes an beiden Kirchenfronten sich findet, ist mehr als bloßer Zufall. Hören wir doch gerade im Barock von gelegentlicher Wiederbelebung der Gotik. Hat es doch unzählige romanische Kirchen in seinen Geschmack umzugestalten für nötig befunden, da sie ihm kahl und nüchtern schienen, aber keine einzige gotische. Tatsächlich ist zwischen diesen malerisch empfindenden Stilen eine innerliche Verwandtschaft. Auch im Barock ist die Ausgestaltung eine lediglich dekorative. Ihre Absicht geht auf eine Bewegung, die groß und würdig ist. Sie ist zweifellos erreicht, allein nicht mit der sachlichen Würde etwa des romanischen Stiles, sondern mit dem Pathos dekorativer Gesten.

Wie in der Gotik ist auch hier das Verhältnis zum Innenraum kein tektonisches, ist nicht bedingt durch den Grundriß des Baues, sondern durch den wirkungsvollen Eindruck. Auf die in ihren großen Formen verhältnismäßig ruhige Front folgt ein Kirchenraum von überraschender[S. 43] Größe des Raumgefühls und, bei aller Pracht, fast klassischen Formen (Abb. 21). Die Großlinigkeit dieser korinthischen Säulen, Gebälkfriese und kassettierten Bögen steht zu den kleinen Teilungen derselben Formen in der deutschen Renaissance (Abb. 17) in völligem Gegensatz. Nichtsdestoweniger zeigt eine so häufige Form wie die spindelförmig gedrehten Säulen am Altar wieder eine innere Verwandtschaft mit der[S. 44] Gotik. In deren Spätstil wurden solche geschraubten Säulen erwähnt, aber was dort ein Aufwirbeln bedeutet, ist hier ein mühevolles Sichemporwinden gegen eine drückende Last. Ebenso ist der gebrochene Giebel darüber zu verstehen, der hier auch im Außenbau vorkommt und überhaupt charakteristisch für den Stil ist. Zu ebenso großer Bewegung wie der Einzelteil sammelt sich der ganze, festlich geschmückte Innenraum. Auf antikisierender Bogenarchitektur ruhend, mit schweren Tonnengewölben geschlossen, führt das Hauptschiff unter der Kuppel weg bis zum Altarraum; das Sims vor allem, das die Obermauer des Mittelschiffs von der Stützenreihe scheidet, ist hier führende Linie. Die Absicht geht allerdings darauf, im Innen-, wie schon im Außenbau, die Teile zu großen Wirkungen zu verschmelzen, an Stelle ihrer tektonischen Scheidung den Zusammenfluß zu geben. So verkröpfen sich die dekorativen Säulen des Mittelschiffes im darübergelagerten Sims, um, als Gurtbögen fortgesetzt, das Gewölbe in sich einzubeziehen. So wächst die Kanzel als Form geradezu aus der Säule heraus, an der sie befestigt ist, bildet auch der Altar nur einen Bestandteil des Altarraumes, keinen selbständigen Organismus. Nicht nur, daß das Fenster in der Kirchenmauer als leuchtendes Auge Gottes zu einem Glied des Altars wird, ebenso werden seine gedrehten Säulen durch die Linien der Gewölbe fortgesetzt. Auch der Beginn dieser Tendenz liegt in Italien. Ihre Geburtsstätte ist vielleicht die Mediceerkapelle Michelangelos, wo der Meister die Fensteranlage zusammen mit der Grabanlage schuf, nicht nur mit der Absicht, die volle Beleuchtung zu erzielen, sondern um bestimmte Ausdrucksakzente in die Figuren zu legen, etwa durch die Beschattung von Giulianos nachdenklichem Kopf. Allein wir sehen nun, daß solche Verschmelzung jeden Teil um den klaren Ausdruck seiner Funktionen bringt und eine charakteristische Eigenschaft untektonischer bewegungsuchender Stile ist. In der späten Gotik fanden wir sie ebenso wie im Stil der ausgehenden Antike. Während der romanische Altar eben nur ein Tisch war, war beim spätgotischen der Aufsatz Hauptsache geworden, der für das Auge seine feinen Spitzen mit den ruhelos aufwärts strebenden Pfeilerlinien verflicht. Man wird nun auch den Außenbau der Barockkirche und seinen Parallelismus zur gotischen Fassade verstehen. Es handelt sich in beiden Fällen nicht nur um eine Verknüpfung der horizontalen Geschosse, sondern zugleich auch um eine weiche Auflösung nach oben, nach Analogie der eben festgestellten Wirkung um eine Art Verschmelzung mit dem Luftraum. Und[S. 45] es ist nur natürlich, wenn wir eine parallele Erscheinung auch im Innenraum der Barockkirche finden. Hier ist die Kuppel zugleich Zusammenfassung und Auflösung; nach ihr zu öffnen sich Hauptschiff, Seitenschiffe und Altarraum in mächtigen Bögen. Sie faßt den Raum in sich zusammen und läßt ihn mit ihrer großen Zahl von Fenstern in den Luftraum verströmen. Sie beherrscht den Raum, und es war daher keine Pietätlosigkeit, sondern im Gegenteil die Absicht einer besonderen Wirkungssteigerung, die der leuchtenden Kuppel Michelangelos ein düsteres Langschiff vorlegte.
Die Kuppel der Barockkirche ist keine tektonische Verknotung der Bauteile, wie die der romanischen Kirche (Bd. I, Abb. 41). Sie schließt den Bau nicht als Architekturglied zusammen, sondern wirkt durchaus malerisch und zwingt durch ihr Licht das Auge nach der Stelle des intensivsten Ausströmens hin. Sie ist nicht so sehr Körper wie Beleuchtungseffekt, ja neben der ruhigen Architektur der romanischen Kuppel ist sie geradezu formlos. Nicht nur weil bei dieser nur vier Fenster in den Ecken die Struktur betonen, während hier acht Fenster das ganze Rund durchbrechen und in Schein und Widerschein ihre Konturen und die Konturen der Kuppelteilungen verwischen; auch der Dekor wirkt an dieser Zersetzung mit. Zwar noch werden die Hauptlinien, die Begrenzungen der Kuppel und der Zwickel, von denen sie getragen wird, festgehalten, allein überall hinein setzt sich schon das lebhafteste Ornament, Ranken, die in kompliziertesten Kurven bewegt sind, oder figürlicher Schmuck. Gerade er gibt den Formen die Überleitung zur Nebenform, so, wenn der Schlußstein der Bögen, in denen sich das Hauptschiff nach dem Seitenschiff öffnet, und dem eigentlich ein ganz tektonisches Gefühl zugrunde lag, in eine Ranke umgeformt wird, von der aus ein kleiner Engel mit den Händen bis in die Obermauer hinübergreift, oder wenn die Zwickel, auf denen die Kuppel ruht, diese wichtigen struktiven Glieder, nicht nur mit reichverschlungenem Bandornament gefüllt, sondern von ihm geradezu zerrissen und am Rand vollkommen aufgelöst werden. Für diesen Aufputz fand man im Stuck den schmiegsamen Stoff, der sich willig jeder Form fügte. Gerade dieses Material hat ungeheure Verheerungen in den romanischen Kirchen angerichtet, die man mit seiner Hilfe sehr leicht barock umdekorieren konnte.
Die vollkommene Überwindung der Zweckbedingungen durch technische Gewandtheit und die reichste Ausbildung der dekorativen Formen macht also das Bauwerk frei für jede Art des künstlerischen Ausdrucks.[S. 46] Die vollkommene Sprengung des früher durch seine natürlichen Bedingungen begrenzten Raumes ist seine erste Absicht, ihr Resultat an der Fassade die Auflösung der Stockwerksbegrenzungen nach oben, im Innenbau die Raumauflösung durch die Kuppel. Daß man andererseits danach strebt, die Bauteile möglichst miteinander zu verknüpfen, ist nur scheinbar ein Paradoxon. Vielmehr bedeutet beides eine Aufhebung der funktionellen Differenzierungen zugunsten einer einheitlich dekorativen Wirkung.
Damit aber hört die Kirche auf, allein ihrem Zwecke zu dienen, und wird ein künstlerisch repräsentatives Monument. Der Architekt selbst wird ein großer Hofherr mit vielen Titeln, den man sich von weit her, in Deutschland meist aus Italien oder Frankreich kommen läßt. Das Wort „Künstler“ bekommt damals schon jenen Sinn des herrischen Gegensatzes zum Handwerk. Und die Zünfte führen oft einen verzweifelten Kampf gegen Leute, die ihnen nicht angehören und unmittelbar im Dienste der Fürsten an den einträglichsten Stellen stehen. Wie die Kirche wird auch die Messe aus einem Gottesdienst immer mehr zu einem ekstatischen Schauspiel. Ihr Eindruck liegt nicht mehr in ihren klaren Worten, sondern in der Musik, die ausdrucksvoller Träger ihrer Stimmung wird. Hier bedeutet Bachs Hohe Messe in H-Moll den Höhepunkt. Man darf die Rückkehr unserer Zeit zu Bach nicht als Rückkehr zum Primitiven ansehen, wie das wohl geschehen ist. Er ist nicht primitiv. Die mittelalterliche Messe mochte es sein, die ihre Musik aus dem Rhythmus des gesprochenen Textes folgerte. Bach ist der echte Barockmeister, wie Mozart in seinem gesteigerten Ausdruck der echte Rokokomeister ist. Wie im Credo der H-Moll-Messe sich die Oboe um die Solostimme legt, das hat seine frappantesten Parallelen im Verhalten der Barockranke zu den gedrehten Säulen, in deren tiefe Windungen sie sich einschmiegt. Mit der Messe wird auch ihre Zelebration zum Schauspiel. Wie der Römer an die Stelle der kunstreichen griechischen Arbeit das Prunken mit pfundschweren Goldarmbändern setzte, so tritt nun an die Stelle der fein geformten Geräte die Pracht reicher Gewänder, mit Edelsteinen übersäter Mitren und Bischofsstäbe. Es macht einen seltsamen Eindruck von kultivierter Barbarei, im Domschatz zu Limburg a. L. neben den edlen mittelalterlichen Emailreliquiaren Ornatstücke des Barock zu finden, die in der Form ohne jede Feinheit sind, bei denen aber die Fülle der Perlen und glitzernden Edelsteine kein Fleckchen des Grundes freiläßt.
[S. 47]
Diese Absicht, Repräsentation und Prunk geradezu zum Zweck des Lebens zu machen, ist der Grund dafür, daß sich diese Kultur in den öffentlichen Bauten ihren wichtigsten Ausdruck geschaffen hat. Die bürgerliche Baukunst tritt hinter ihnen zurück, sucht jedoch ebenso das Pathos wuchtiger Formen, wie der Danziger Innenraum (Abb. 19) zeigte. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts aber ist die Stilbewegung in eine neue Phase getreten. Was Italien bisher für das kirchliche Barock ist, wird Frankreich jetzt für das profane Barock, und sein Einfluß auf die gesamte europäische Kunst ist nicht geringer dank der Hilfsquellen, die dem Absolutismus Ludwigs XIV. zu Gebote standen, und der Rolle, die er im politischen Leben Europas spielte. Es ist ungemein interessant, hier die Pfade zu verfolgen, die Politik und Kultur verbinden. Sicher in der Absicht, Frankreichs Kunstindustrie zu heben, verpflanzt der tüchtige Finanzminister Colbert fremde Techniken nach Frankreich und gründet hier jene königliche Manufaktur, die unter der künstlerischen Leitung des Malers Lebrun eine Zentrale des Barockgeschmacks in Frankreich wird. Zusammen mit den charakteristischen Werken des Königs, seinen Schloßbauten, wie Versailles, deren bedeutende Meister Hardouin Mansard und Robert de Cotte sind, wird sie der eigentliche Träger des Zeitgeschmackes. Aber es ist gar keine Frage, daß diese offizielle Kunst den letzten Rest der Volkskunst überwinden mußte, weil sie an Geldmitteln und Nachfrage konkurrenzlos war, und daß sie in Frankreich wie den übrigen Ländern Europas alle bodenständige Kunst vollkommen nivellieren mußte. Europa war damals selbst in eminent nationalen Fragen sehr wenig national gesinnt; in dem zerrissenen Deutschland herrschten französisches Geld und französische Kultur unumschränkt. So kann sich im 17. und 18. Jahrhundert von Frankreich aus eine einheitliche Lebenskultur verbreiten, wie sie in der Gotik von demselben Lande ausgegangen ist. Auch die deutschen Architekten der Barockzeit, wie Schlüter (1664–1714) und Neumann (1687–1753), haben in ihren Schlössern jeden Festungscharakter aufgegeben; sie sind nichts weiter als Prunkbauten, die nur noch durch die Rücksicht auf den möglichst wirkungsvollen Eindruck bestimmt sind.
In imposanter Breite lagert sich Balthasar Neumanns Würzburger Schloßfront, mit den vorgestreckten Flügeln weit nach den Seiten ausgreifend (Abb. 22). So sehr wird der Ton auf diese repräsentative Aufrollung der Fassade gelegt, daß das Gebäude unverhältnismäßig niedrig ist und nur sehr geringe Tiefe hat. Wie beim Kirchenbau[S. 48] werden auch hier die seitlichen Bauendigungen als Ablauf der Fassadenbewegung und der Mittelteil als ihr Sammelpunkt durch eigene Frontbildung, sog. Risalite, betont. In zwei Geschosse geordnet, von denen das untere gewöhnlich als Sockel gedacht und in Rustika ausgeführt ist, während das obere schlankere oft noch ein Halbgeschoß (Mezzanin) einschließt, werden sie durch übereinandergestellte Säulen oder Pilaster einem Giebelfeld zugeführt, das das Risalit zusammenfaßt. Zwischen diesen Fixpunkten wird die Wand entwickelt, in gleicher Dekoration, deren Säulen die wagerechte Bewegung schrittweise begleiten. Aber wie hier alle Formen reduziert, flächenhaft sind, ist es auch der obere Abschluß. Seine Führung bleibt wagerecht, eine Attika meist, die den Bau längs der ganzen Dachlinie auflöst, wie der durchbrochene Kamm das Reliquiar im Übergangsstil des 13. Jahrhunderts, und diese Auflösung wird noch weicher durch die Vasen oder Skulpturen, die auf der Brüstung verteilt stehen. Hinter ihr schließt das breit gelagerte Mansardendach (so genannt nach seinem Schöpfer, dem Architekten Mansard) den Bau ab.
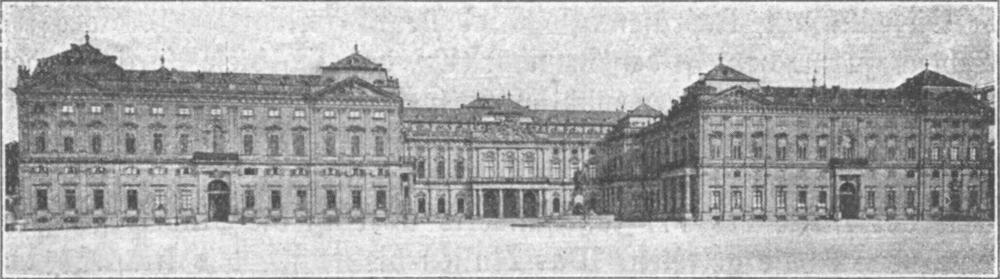

Es ist beim Palast dieselbe Absicht wirksam wie beim Kirchenbau, wenn hinter dieser verhältnismäßig ruhigen Fassade sich Räume voll unerhörten Prunkes öffnen. Vor den Repräsentationszimmern des Schlosses, die das Gebäude mit ihrer prunkvollen Eleganz beherrschen, treten alle Privatgemächer zurück. Ein großes Stiegenhaus öffnet sich im Mittelbau unmittelbar hinter dem Hauptportal. Zwei breite Treppen steigen in ihm durch die Stockwerke empor, von elegant geformten Geländern begrenzt, in weichen Kurven sich begegnend, geschaffen zur prunkvollen Entfaltung festlicher Züge, dabei von größter Weiträumigkeit, wie die Prunksäle, die sich von ihnen aus öffnen. Der Hauptsaal desselben Schlosses gibt ein gutes Bild von der Art, wie hier allmählich von der Absicht möglichst wirkungsvoller Raumgestaltung alle[S. 49] Zweckgliederungen verdrängt werden (Abb. 23). Im viereckigen Zimmergrundriß, der den Raum zwischen vier Wände und vier Ecken gespannt hätte, hat man die Ecken abgeschrägt, und so eine polygonale, weichere Form gewonnen. Und wenn auch jeder Wandteil durch dekorative Säulen nach den Seiten, durch das auf ihnen ruhende Gebälk nach oben abgegrenzt scheint, so wird er doch durch die Füllung zerfasert. War schon die Täfelung der deutschen Renaissance bloße Wanddekoration,[S. 50] so folgte sie doch in den Hauptlinien der äußeren Begrenzung; hier aber arbeitet sie der Wandbegrenzung an ihren empfindlichsten Stellen geradezu entgegen. Die Gliederung der Palastfassade lehrte, daß dieser symmetrisch empfindenden Zeit die seitlichen Begrenzungen und der Mittelteil als die gliedernden Punkte, als die empfindlichsten Stellen des Gefüges gelten. Gerade an diesen Stellen setzt im Wandgetäfel das leichte Gerank an, zerfasert die rechteckige Tafel oben und unten und reißt sie in der Mitte auseinander. Die Begrenzungen zwischen den einzelnen Wandfeldern werden ebenso unwirksam gemacht. Bei näherer Überlegung erweist es sich, daß eben das Sims, das jeden Teil nach oben abzuschließen scheint, zugleich die einzelnen Felder, über die Säulen hinweggleitend, miteinander verbindet. So beginnt die Wand in fließender Rundung das Zimmer zu umkreisen, und diese Bewegung wird dadurch gesteigert, daß jeweils nach einer horizontal geführten Simspartie ein Aufsteigen über einer Fenster- oder Türnische einsetzt. Mit ihm ist gleichzeitig jene Aufwärtsbewegung eingeleitet, die dem Plafond ebenso den Wert als Abschluß raubt. Sie beginnt vom Fußboden an. Denn die Säulen sind keineswegs Träger, sondern elegant aufsteigende Dekorationsmotive, und Beweis dafür ist das untektonische Gefühl im Kapitell. Gerade diesem entscheidenden Gebälkträger ist jede tragende Kraft geraubt; durch Ranken wird er aus dem Schaft emporgeleitet, mit weichen Kurven in das verkröpfte Gesims hinaufgeführt. Von ihm aus streben Zwickel aufwärts, von einem schon dem Rokoko sich nähernden plastischen Rankenornament immer bunter, immer reicher bewegt, bis schließlich reich geformtes, wirr verschlungenes Gerank die Zimmerwände in bunte Fetzen zerreißt. Dadurch wird jeder festen Abgrenzung des Plafonds gegen die Zimmerwand so entgegengearbeitet, wie durch den polygonalen Grundriß der festen Abgrenzung der Wandteile gegeneinander, und ebenso wie die Struktur der Zimmerwand selbst durch die Ranken des Ornamentes zerstört wird, zerstört eine illusionistische Dekoration auch den Plafond. Er wird über unserm Haupt geöffnet wie ein Himmel, in den man hineinschaut, in dessen Wolken Götter auf Wagen fahren, Genien sich emporschwingen. Hier ist die Stelle, wo die antikisierende Allegorie eine Stätte zu jeder noch so plumpen Huldigung an den Herrn des Hauses findet.
Schon Michelangelos sixtinische Decke zeigt die Empfindungslosigkeit der Zeit für die Funktion eines Plafonds (Abb. 8). Er malte die[S. 51] Bilder ebenso an die Decke, wie er sie auf die Tafel gemalt hätte. So führen bei ihm Gemälde und Saaldecke nebeneinander jedes sein eigenes Leben. Dem Barock aber geht der Zweckwert des Plafonds vollkommen verloren. Es nützt ihn zu einer Illusion aus, die ihn zerstört. Es kann vorkommen, daß dieser als geöffneter Himmel gemalte Plafond in Kirchen geradezu an die Stelle der Kuppel tritt. Die kühnste Fortsetzung der Wandarchitektur nach oben wird durch die Malerei vorgetäuscht und mit Gestalten bevölkert. Engel schweben aus ihm empor, und strahlend scheint über unsern Häuptern der Heilige selbst gen Himmel zu fahren. Das ist ein neuer Beweis dafür, daß man ein Recht hat, der Kuppel in der Barockkirche, ebenso wie der Wandgestaltung, wesentlich raumsprengende, raumerweiternde Wirkung zuzusprechen.
Von hier aus läßt sich die Stilentwicklung und die Stiltendenz der Barock-Architektur vollkommen übersehen. Von der strengen Frührenaissance geht der Weg zur Hochrenaissance, in der die Dekoration mit großen Linien die Wand bewegt, zum italienischen Frühbarock, in dem das reichere Ornament diese Gliederungen zerfetzt und den Raum sprengt, schließlich zum französischen Hochbarock, wo Wand und Raum völlig gelöst erscheinen.
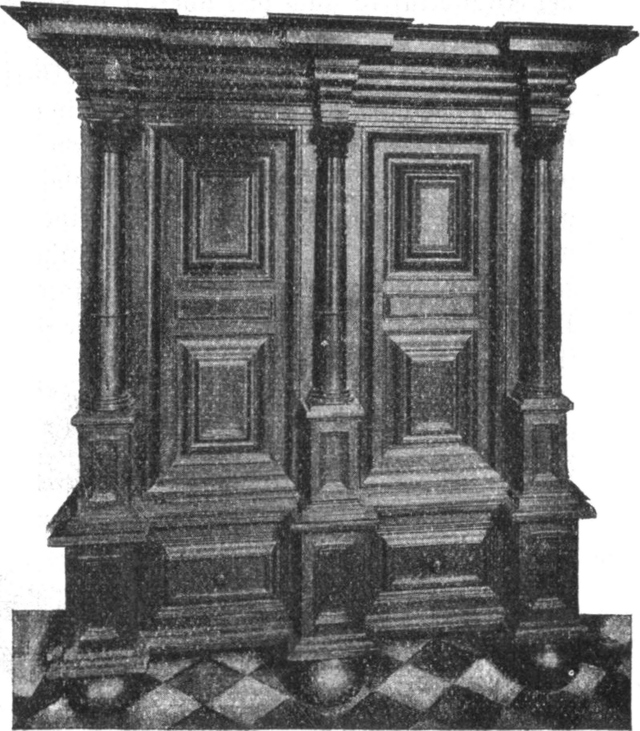
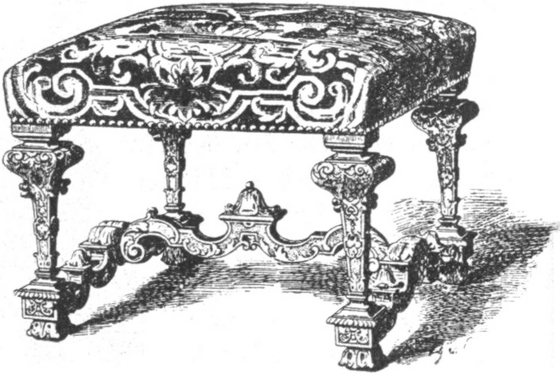
Für die Formen, die dieser Kampf der Schmuckformen gegen die Struktur im Kunstgewerbe schafft, mag ein Schrank aus der Mitte des 17. Jahrhunderts (Abb. 24) und ein Sessel Beleg sein, wie Abb. 25, der, etwa um 1700 entstanden, dem Stil des Andreas Schlüter, des Erbauers des Berliner Schlosses, angehört. Der Schrank entspricht genau dem Stil des hohen Barock, wie ihn die römischen Kirchen und der Danziger Saal (Abb. 19)[S. 52] zeigen. Alles an ihm ist massig und schwer. Drei große Halbsäulenformen geben der Front ihre Wucht, auf Kugelfüßen stehend und ein weit vorragendes schwer profiliertes Horizontalsims auf schweren Rankenkapitellen tragend. Schwer, nach der Mitte zu sich verdichtend, sind auch die Türfüllungen, und die neue Technik der Furnitur, des Aufleimens edler Hölzer, dient zur Farbenbetonung dieser Schwere. Wo die Renaissancefüllung (Abb. 17) gelockert und geteilt war, faßt dieser Schrank zusammen; die spätgotische Bewegung ist endgültig zur Ruhe gekommen. Den Stilformen nach etwas früher als das Würzburger Schloß, ist der Berliner Sessel (Abb. 25) für die Entstehung der späteren Barockformen, besonders für das ornamentale Detail ein gutes Beispiel. Das Motiv ist aus der denkbar struktivsten Form gewonnen. An den vier Ecken wird der Polstersitz von vier Füßen getragen, von denen je zwei durch Leisten verbunden sind, die ihrerseits durch eine Querleiste zusammengehalten werden, also etwa das Motiv des spätgotischen Tisches, wie ihn Dürers Hieronymus im Gehäus (Abb. 16) zeigt. Allein wie in der Architektur ist auch hier überall an Stelle der sachlichen Struktur ein gewollter Bewegungsausdruck getreten. Er führt, etwa beim Bein des Sessels, sofort zur Disharmonie. Vom Würfel aus, der den Ansatz der Leisten bezeichnet, gliedert sich das Bein in einen — wie bei allen dekorativen Stilen — spitzen Fuß als stehenden Teil, der durch eine abwärts gerichtete Akanthusform zu Boden geleitet wird, und in einen tragenden Teil, der in gleicher Weise aus einer aufwärts gerichteten Ranke nach oben steigt, sich plötzlich, in der Silhouette dem spätgotischen Pokal ähnlich, ausbreitet, noch einmal zusammenzieht, und ausladend die Last des Sessels aufnimmt. Allein diese Teilung des tragenden Fußes ist in der Konstruktion nicht begründet. Sie bedeutet nur ein weiches Hinaufführen des Beines in den Sitz einerseits, ein Hinabführen in den Boden andererseits, und das Resultat ist die dekorative Zerlegung eines einheitlichen Gliedes bis zur vollkommenen Divergenz der Richtungen. Ebenso ist die Wahl des Leistenansatzes zum Gelenk dieser Teilung ganz willkürlich. Sie hätte allenfalls[S. 53] einen Sinn, wenn die Leiste hier festansetzen, stark ablaufen würde. Allein der Würfel dient auch hier dem Auge nur als Vermittlung, da die Leisten unfest, mit eingerollten Voluten beginnen und als geknickte S-Ranken weiter laufen. Sie begegnen sich in der Mitte, und an diesem Punkt setzt mit derselben eingerollten Volute ebenso unfest die Querleiste an, läuft in denselben Ranken dem Mittelpunkte zu, wo ihre Linien sich ausladend vereinigen, um dann weich in eine umgekehrte Blüte auszulaufen. So ist also die Leiste keine feste Trageform, sondern eine gekrümmte Ranke, und der gliedernde Mittelpunkt, der sachlich nicht vorhanden, sondern erst durch die Dekoration gefunden ist, ist nicht struktiv gemeint, sondern weicher Zusammenfluß der Linien. So entscheidet sich auch hier der Kampf zwischen Struktur und Dekoration zugunsten der letzteren. Die Formen aber sind noch übersichtlich und klar, und trotz der weichen Überführungen ist jede Holzform durch die dem Material angemessenen scharfen Kanten abgegrenzt.
Innerhalb der Flächen, die dadurch bestimmt sind, entwickelt sich dann das Ornament, das ein gutes Beispiel für die Form des späteren Barockornaments überhaupt ist. Als flaches Band ist es aus der Fläche gewonnen, über die es sich wenig erhebt, während seine Form aus der Bewegung der Gerätteile gefolgert ist. Die feinen Bänder und Ranken, die sich vom Rande abzweigen, sind es, die dem Auge die Richtung der Leisten und der Fußglieder erläutern.
Die Vase (Abb. 26) ist ein gutes Beispiel für die bewegungsreiche Keramik der Zeit, deren Hauptfabrikationsort, Delft, und deren wichtigste Technik, Fayence, sie repräsentiert. Zwar ist der Fuß gegen das Gefäß abgegrenzt, das Gefäß selbst durch einen ausladenden Rand vom Deckel geschieden, zwar scheiden sich die Wandflächen, die den Leib des Gefäßes bilden, deutlich voneinander. Aber der Fuß ist absichtlich nur mehr ein kleiner Rand, als tragendes Glied möglichst wenig zur Geltung gebracht zugunsten der Form des eigentlichen Gefäßes, das, von schmalem Boden ansteigend, in breiter Kurve sich erhebt, seine Linien über den Rand hin bis in den Deckel fortsetzt und hier in die Form eines Löwen ausmündet, der den Deckel mehr krönt, als daß er ihm als Griff dient. Durch eine gleich weiche Bewegung beginnt man auch die Grenzkanten im Gefäßleib unwirksam zu machen. Man riefelt die Fläche, so daß auch hier das Auf- und Abwogen einer Welle das ganze Gefäß umkreist und die Kanten zum Glied der Bewegung macht.
[S. 54]
Zwischen dem Schrank und der Vase liegt dieselbe Entwicklung wie zwischen dem italienischen Kirchenbarock und dem französischen Palastbarock, das erste seine dekorativen Gliederungen scheidend, das zweite sie immer stärker durch reiche Dekoration verwischend. Gerade der Schmuck chinesischer Motive, der sich gleichmäßig ohne Rücksicht auf die Gliederung und die Riefelung um die ganze Fläche der Vase zieht, ist hierfür bezeichnend, und es ist kein Zufall, daß die Schlösser der zweiten Stilstufe an chinesischen Motiven so reich sind. In den feinen Linien der Form, die das in Europa damals noch nicht erfundene Porzellan den chinesischen Geräten gestattete, im Reichtum buntfarbiger seltsamer Dekoration mit bizarren Landschaftsmotiven, steif gekleideten Menschen, starr geformten Blumen mußten die Erzeugnisse chinesischer Kunstindustrie damals für die dekorativen Tendenzen der abendländischen Kunst unerreichte Vorbilder sein. Man kopierte chinesische Porzellanvasen im roheren Material der Fayence, bildete Lackarbeiten nach, und sammelte die Originale mit Leidenschaft, um sie in eigenen chinesischen Kabinetten, Zimmern von derselben bizarren Dekoration, aufzustellen.

Gerade die Absicht der Stimmungseinheit, die hierin liegt, lernten wir in beiden Phasen des Stiles als charakteristisch für ihn kennen. Was im italienischen Barock erst Vereinigung ist, wird im französischen zur Verschmelzung. Und dieses weite Ausgreifen des Kunstwerks in seine Umgebung macht es nötig, über die Kunsterzeugnisse im engsten Sinne hinauszugehen, um den Stil zu verstehen. Denn man sucht der[S. 55] Fassade durch Ausgestaltung ihrer Umgebung eine genau bemessene Wirkung zu sichern. Bernini schließt die Peterskirche und den Petersplatz in Rom zu einer äußerst wirkungsvollen Einheit zusammen, indem er von den Ecken der Fassade aus Arkaden um den ganzen Platz führt und ihn in die Anlage mit einbezieht. So wurde der Blick auf streng begrenztem Wege immer auf die Kirche als sein Ziel geführt und die Wirkung der Fassade außerordentlich gesteigert. Genau so wie im Schloß jedes einzelne Zimmer in Form und Farbe der Möbel und der Wandbekleidung eine Einheit bildet, wie wir den Innenraum mit der Fassade sich zur Wirkung eines abgestimmten Gegensatzes vereinen sahen, ist die Umgebung des Schlosses auf seine Fassade abgestimmt. Zu ihr hin führt meist ein Hof, umgeben von einer Mauer oder von Arkadengängen, die die Wirkungsabsicht der Kolonnaden vor der Peterskirche in Rom haben; im Hof verteilt, oft auch statt seiner, stehen staffelförmig gereiht kleinere Gebäude, die nur dem dekorativen Zweck dienen, das Auge allmählich auf die breitgelagerte Schloßfront hinzuführen. Hinter dem Schloß öffnet sich dann der Park, kein naturgewachsener Baumpark mehr, sondern Alleen künstlich verschnittener Bäume auf kurzgeschorenem Rasen. Schon die Hochrenaissance in Italien leitet diese Entwicklung ein. Sie schuf bereits Alleen, die nicht nur zum Schloß führten, sondern bestimmte wirkungsvolle Ausblicke eröffneten, setzte diese Alleen aus Bäumen zusammen, die in regelmäßiger Form emporwachsen, vor allem aus Pappeln und Zypressen, und die in ruhiger Aufeinanderfolge den Wandelnden geleiten. Jetzt aber breitet sich vor der Gartenfront des Schlosses ein weiter Platz mit geschorenen Rasenbeeten aus, deren Ränder in den regelmäßigen Schnörkeln der Barockranke verlaufen, dazwischen Alleen von Bäumen, die in unnatürliche Kugel- und Pyramidenformen oder zu glatten fortlaufenden Wänden verschnitten sind. Sie eröffnen überraschende Ausblicke auf das Schloß und seine Nebengebäude, oder auf Wasserkünste von erstaunlicher technischer Kühnheit, auf ungeheure Fontänen in großen Becken, in die kleine Wasserstrahlen von der Mitte und vom Rande her springen, aus Tritonenhörnern oder aus Urnen fließend, die von Meergöttern gehalten werden. Man darf sich nicht wundern, wenn die Absicht so weit geht, selbst über Menschenmöglichkeit hinaus die Natur diesen Wirkungen untertänig zu machen, wenn das zerstörte und nur in Abbildungen noch bekannte Schloß Favorita bei Mainz aus seinen Alleen überraschende Ausblicke auf den Rheinstrom eröffnet haben muß, und am Ende einer gewaltigen[S. 56] Allee von zwei geschorenen Baumwänden im Park von Oliva die weite Fläche der Ostsee sich dehnt. Wir wundern uns nicht, in Anlagen, in denen die Natur so zur Schaustellung mitwirkt, Naturtheater zu finden, in denen Alleen und Gesträuche als wirkungsvolle Kulissen dienen. Die dramatische Literatur und Kunst ist ja in dieser Zeit in Frankreich durch Molière, Racine, Corneille zur höchsten Wirkung emporgeführt. Und ebenso wie an den Plafonds der Säle benutzt man die antike Allegorie in pompösen Balletts zur Huldigung für irgendeinen Fürsten, vergleicht ihn, von dem die Geschichte uns oft kaum den Namen überliefert hat, mit allen antiken Göttern und Heroen. Damals werden die Urkunden geschrieben mit Titeln und Würden, Siegeln und Stempeln, hinter denen keine Macht steht, damals erscheinen die feierlichen Anreden und die lange, unterwürfige Unterschrift, damals kommt das Pochen auf Rang und Titel, so daß es nichts Schwierigeres gibt, als einen Zug von Fürstlichkeiten zu ordnen, und man eigene Bücher von der Zeremoniellwissenschaft verfaßt hat; damals aber ist auch die Zeit, in der kein Niedriggestellter sein Recht finden kann. Die breit auf dem Kopfe thronende Allongeperücke wird das Zeichen der Würde, die französischen Brocken im Brief das Zeichen der Bildung, und alle Gefühle werden so ins Äußerliche übersetzt. Das Hochzeits- oder gar Trauerkarmen, das man selbst den nächsten Verwandten schreibt, wird guter Ton, und von geradezu grotesker Komik wird die Verlogenheit, wenn hier der kleine Bürger mitmachen will, wenn die Stadttore antike Triumphpforten werden, auf dem Marktbrunnen jedes Nestes ein grollender Neptun erscheint, aus dem ehrsamen Goldschmied Peter Dingsda in den Innungslisten in einem Jahr plötzlich ein Monsieur wird, oder Joh. Seb. Bach alle Götter des Olymps zur keineswegs scherzhaft gemeinten Huldigung an den Obstzüchter Augustus Müller aufruft. Man trieb solche Dinge bis zur Spielerei, ließ vom Zuckerbäcker Schaugerichte mit allegorischen Darstellungen anfertigen, die gar nicht zum Essen bestimmt waren, und benutzte die Geschicklichkeit des Handwerkers zur Herstellung spielerischer Kuriositäten und mechanischer Kunststücke. Es ist ohne Sinn, hier Beispiele zu häufen, genug, daß überall hinter einer prunkvollen Außenseite ein wenig inhaltreiches Leben sich verbirgt, wie hinter den bombastischen Buchtiteln der Zeit oft der geringfügigste Inhalt sich findet, oder die Kriege zwar von den Heeren gekämpft, aber von den Diplomaten entschieden werden.
Bei diesem Kulturstand der Epoche, bei dieser Steigerung der individualistischen[S. 57] Tendenz bis zur eigenwilligen Arroganz mußten die vom Zweck gelösten Künste, mußten Freiplastik und Tafelmalerei zur höchsten Freiheit künstlerischen Wollens sich entwickeln, Reliefplastik und Wandmalerei ihren tektonischen Bedingungen sich ganz entfremden. Es genügt, auf die Illusionen in den Plafonds hinzuweisen, von denen schon die Rede war, um das ohne weiteres festzulegen. Es kam dazu, daß die prunkliebenden Fürsten und das reiche Bürgertum durch die Menge der Kunstwerke, deren sie zur Verewigung ihrer Persönlichkeit und zum Schmuck ihres Lebens bedurften, dem Künstler ebenso reiche Arbeitsmöglichkeiten boten. Allein schon von der Plastik wurden in einem fürstlichen Schloß, an den Wegen seiner Parks, in den Becken seiner Wasserkünste, an der Fassade und in den Räumen des Schlosses Hunderte von Skulpturen gefordert, die sie vor eine Fülle künstlerischer Probleme stellten. Naturgemäß aber stehen in dieser Zeit die Aufgaben im Vordergrund, die der Verherrlichung des Bestellers dienen; wie die Poesie der Zeit Huldigungskarmina, schafft die Plastik Porträts und Denkmäler. Gerade hier spielt die Veräußerlichung der Gefühle, die dieser Epoche eigen ist, eine Hauptrolle. Nicht nur daß man pompöse Grabdenkmale aufführt mit Wappen und mit den Allegorien der Tugenden übersät, wie man den Lebenden mit Titeln überschüttete — man kommt sogar so weit, der heiligen Dreifaltigkeit und der Madonna auf offenem Markt Monumente zu setzen, die nicht Altäre, sondern im eigentlichsten Sinne des Wortes Denksäulen sind.
Gegenüber solchen Dingen ist das Monument eines Fürsten, wie Andreas Schlüters Denkmal des Großen Kurfürsten in Berlin (Abb. 27), nur das typische Beispiel einer Sitte, die in Frankreich damals zahlreichere Werke schuf, und zugleich ein äußerst charakteristisches Beispiel für die Plastik des Barock. Der bauchige Sockel erhält die Struktur durch vier schwere Ranken an den Ecken, die zugleich die Funktion der Pilaster in der Architektur ausüben, seine horizontalen Gliederungen zusammenfassen und aufwärts führen zum ausladenden oberen Rand, über dem die Standplatte für das Reiterbild ansetzt. Vier gefesselte Sklaven schmiegen sich eng mit diesen Ranken zusammen, von starrster Verzweiflung bis zu ergebener Huldigung alle Empfindungen des unterworfenen Feindes aussprechend, in Gesicht und Körper erregt bis zu äußerster Leidenschaftlichkeit des Affekts. Von gleich ausdrucksvollem Pathos ist die Gestalt des triumphierenden Fürsten. Sein Roß schreitet erregt vorwärts, die Mähne gesträubt, die Nüstern gebläht, energisch[S. 59] in der Bewegung, die über das absichtlich schmale Postament Kopf und Hals hinausführt. Wir sahen ja, daß das Barock Skulpturen in zu enge Nischen setzt, um ihren Ausdruck zu steigern. Die ruhige Sicherheit des Reiters bekommt ihren Wert durch den Kontrast, in dem das Zurückbiegen und die stolze Seitwärtsdrehung seines Körpers zu dem vorwärtsgerichteten Schreiten des Pferdes steht. Das Werk ist ausgeglichen in Kunstform und Gedankeninhalt. Die Kunstform hat jenes feine Verschmelzen und Ineinanderstimmen der Teile, das wir als Stileigenschaft kennen lernten, bis ins feinste durchgebildet. Wie die Sklaven den Ansatz der Ranken verhüllen, um von den Stufen zu ihnen eine weiche Überleitung zu schaffen, wie die Reiterfigur diese aufsteigenden Linien fortsetzt, die sich im Haupt des Mannes vereinigen, ist außerordentlich fein berechnet. Man denke an ein Reiterstandbild der Renaissance, etwa Donatellos Gattamelata. Dort ist der Sockel durchaus nur Träger des Denkmals. Dem Barock aber, dem die weiche Linienbewegung Stilbedingung ist, muß Schlüters Bildwerk ein Muster von Würde gewesen sein. Denn überall dort, wo lebhaftere Empfindungen geweckt werden sollten, wäre im Barock das Monument jäh vom schmalen Postament aufgestiegen, während dieses langsame Ansteigen von breiter Grundfläche äußerst würdig gewirkt haben muß. So begreift sich der Sinn der pompösen Allongeperücke, während jene lebhafte Bewegung das Interesse der Zeit am ägyptischen Obelisk erklärt. Beruht so die architektonische Wirkung im Denkmal auf der harmonischen Verschmelzung der Teile, so beruht die innere Wirkung auf der energischen Differenzierung der Kontraste. Der Gesamteindruck des Monuments ist bedingt durch den Gegensatz zwischen den Unterjochten und der Triumphgebärde des Herrschers, zwischen besiegter Schwäche und siegender Kraft. Der Kampf spielt in dieser Zeit dieselbe Rolle wie in der Kunst der hellenistisch-römischen Epoche auch. Und die Wirkung beruht ebenso auf dem Gegensatz des Besiegten und des Siegers, von denen der eine unser Mitleid um so mehr erregt, je mehr wir der Stärke des anderen uns freuen. So wird im Barock die Kraft des Siegers gewalttätig bis zur Roheit, die Hoheit, wie im Denkmal des Großen Kurfürsten, stolz bis zur pathetischen Geste, die Schwäche des Unterliegenden gesteigert bis zur sentimentalen Weichheit. Daher die vielen Schilderungen von mythologischen Kämpfen zwischen Männern und Frauen, die uns gerade jetzt, etwa bei dem Hauptmeister der italienischen Barockplastik, Lorenzo Bernini, begegnen, Apoll und Daphne, Pluto[S. 60] und Proserpina, am ausdrucksvollsten Rubens’ Gemälde: Die Amazonenschlacht und Der Raub der Töchter des Leukippus. Auch hier ergibt sich dasselbe wie in der deutschen Spätgotik und der spätrömischen Kunst, daß erregtester Zorn und sentimentalste Weichheit nur Ausdrucksformen derselben dramatischen Erregung der Zeit sind.
Hand in Hand damit geht die physische Erregung in der Körperbewegung der Gestalten. Die Zeit hat die Studien der Renaissance weiter geführt, kennt den Körper bis in die letzten Geheimnisse des Gelenkes, weiß jedes Glied zu bilden und zu bewegen und nutzt diese Kenntnis aus bis zur letzten Möglichkeit dreidimensionalen Ausdrucks. Man nehme etwa den vordersten Sklaven des Denkmals, bei dem jedes Glied im Kontrast zum anderen steht, schon hier, wo die Gestalt doch durch ihren Hintergrund gebunden ist, während bei Freiskulpturen, namentlich bei Gruppen, der Körper sich nach allen vier Seiten hin entwickelt. Einer kühnen Bewegung zuliebe, an deren Gelingen man sich freut, wird die Grenze manierierter Verdrehung oft hart genug gestreift. Und alle diese Bewegungen sind um so eindrucksvoller, je momentaner sie sind, um so interessanter und reicher, je mehr sie für den nächsten Augenblick eine Veränderung verheißen, und, wie beim römischen Laokoon, um so kräftiger, je kleiner das Hindernis ist, gegen das die Bewegung sich richtet. Die Kleinheit der Ketten, mit denen die Sklaven an den Sockel des Kurfürstendenkmals gefesselt sind, ist ein gutes Beispiel dafür.
Es ist von vornherein anzunehmen, daß die Malerei sich nach denselben Geschmackstendenzen entwickelt, parallele Erscheinungsformen schafft und daß diese nur gemäß der größeren technischen Beweglichkeit mannigfaltiger sich aussprechen. Denn die Plastik, deren Werke materiell kostbar sind, ist in dieser Epoche die eigentlich höfische Kunst geblieben, während die Malerei und mehr noch der Kupferstich bis in jedes Bürgerhaus gelangen konnte. Man darf sich also nicht wundern, die Malerei geradezu in sozialen Schichten entwickelt zu sehen. Sie erscheint als repräsentative Malerei, die mit antiken Mythologien großen Formates Wände und Decken der Paläste füllt, und als bürgerlicher Zimmerschmuck voll einfach klaren Gefühls, ein Unterschied, der selbst im Porträt fühlbar wird. Immer aber steht sie ganz selbständig, oft, wie wir sehen, selbst auflösend, innerhalb der Architektur, die diese vorgetäuschte Raumerweiterung ebenso fordert, wie einst im pompejanischen Haus. Auch hier also handelt es sich um den räumlichen Ausdruck[S. 61] des Bildes, der gegenüber der Renaissance freier und reicher geworden ist. Landschaften, Räume und Körper sprechen in den naturgesehenen Lichtabstufungen die räumlichen Differenzen aus, und allein die impressionistische Malweise und die schnelle und weiche Radiertechnik, deren Aufkommen für diese Zeit bezeichnend ist, vermag sie vollkommen wiederzugeben.
Allein innerhalb dieses gemeinsamen Stilgefühls differenzieren sich die einzelnen Kunstkreise sehr stark. Während Italien teilweise durch seine früh erworbene Kenntnis des Körpers zu weichlichem Manierismus gelangt, bringt Venedigs starkes Farbengefühl in Veronese einen großen Dekorator, in Tintoretto einen genialen Ekstatiker, in Tiepolo (Gemälde auf Abb. 23) einen fast schon pleinairistischen Lichtmaler hervor. Der spanische Kreis mit Velazquez (1599–1660) und Murillo (1618–1682) ist nicht weniger monumental, aber feiner im malerischen Ausdruck. Gerade hier ist der Naturalismus in den Porträts, in den Darstellungen aus dem Volksleben, selbst in der Mythologie von starkem Wirklichkeitsgefühl getragen. Aber eine außerordentlich feinfühlige Licht- und Farbenbehandlung ordnet alles Gegenständliche der großen Bildwirkung unter. Im aristokratischen Flandern, dessen Hauptmeister Rubens (1577–1640) und van Dijk (1599–1641) sind, dient die Malerei hauptsächlich denselben pompösen Zwecken, zu denen das Zeitalter die Plastik verwandte. Des van Dijk, unter dem Einfluß von Rubens entstandenes Altarbild mit den beiden Johannes (Abb. 28) ist nur im Rahmen einer Altararchitektur, wie auf Abb. 21, zu verstehen. Nicht nur, daß das Heroische im antiken Sinne und mit antiker Geste, Gewandung und Nacktheit ausgedrückt an Stelle des Geistigen tritt — die Bewegung der Gestalten ist Fortführung des architektonischen Rahmens, nicht denkbar ohne die gedrehten Säulen an der Seite, und die Kurve, mit der der Adler des Johannes dessen Bewegung fortführt, wirkt wie die Bewegung der Giebelfeldplastik im Risalit. Gegenständlich und künstlerisch reicher entfaltet sich die Kunst in den Niederlanden. Der Boden dieses kleinen Landes, in dem ein reiches Bürgertum den Ertrag seines Handels nützt, ist Wurzelland für alle wichtigen Strömungen der Kunst, die von hier aus auf andere Länder, wie Spanien und das wenig tüchtige Deutschland sich verpflanzen. Wie die Baukunst hier keine Prunkpaläste schafft, sondern behagliche, wohnliche Bürgerhäuser, so ist auch die Malerei in ihrer schlichten Auffassung wie in ihren anspruchslosen Formaten für das Bürgerhaus berechnet, aber vielgestaltig[S. 62] und kraftvoll. Nur die besten Namen ist hier zu nennen möglich. Der froh-kräftige Impressionist Franz Hals, von Landschaftern der pathetische Ruisdael und der feiner differenzierende Hobbema, der Delfter Vermeer, der mit letzter Feinfühligkeit die Farbstimmung des Innenraumes gibt, Brouwer und Ostade, die Szenen aus dem Leben des Bauern und Bürgers[S. 63] mit gegenständlich und farbig gleich großer Ausdruckskraft malen. Ganz einsam aber steht unter ihnen Rembrandt van Rijn (1606–1669). Wie seine Kunst in immer fortschreitender Vertiefung religiöse und menschliche Themata bis zu Visionen von nie erlebter Gefühlstiefe steigert, wird bei ihm das Licht aus einem realistischen Ausdrucksmittel zu dem für Einheit und unwirkliche Steigerung des Werkes entscheidenden Wert. Wenn er, je älter, desto mehr, Impressionist wird, so deshalb, weil er immer sicherer im Erschauen der inneren Vision wird, wie der moderne Künstler zum Impressionismus gelangt aus der Sicherheit, mit der sein Auge den äußeren Eindruck aufnimmt.

Von dieser Tendenz der Zeit auf das malerisch Bewegte aus wird man verstehen, warum die Bandornamente des Barock einen guten Teil ihrer räumlich auflösenden Wirkung durch den Gegensatz ihrer hellen Fläche gegen den beschatteten Grund erhalten, und warum diese Epoche eine so durchaus koloristische Ornamenttechnik geschaffen hat wie die Boulearbeit, die im Gegensatz von vergoldetem dichtem Ornament auf tiefrotem Grund geradezu die nächste Verwandte der spätantiken Verroterie ist. Ja die Auflösung aller Bau- und Gerätformen durch plastisch hohe Dekoration ist im Grunde malerisch gefühlt, wie in der späten Antike und in der Gotik. Das Barock ist ein Stil, der den wirkungsvollen Eindruck entwickelt hat auf Kosten des Zweckgefühls in Architektur und Kunstgewerbe, die ganz dekorativ geworden sind, während Malerei und Plastik selbständige, sogar bevorzugte Künste werden. Das Rokoko bedeutet nichts weiter als eine noch stärkere, noch konsequentere Ausbildung dieser Prinzipien.
Schon im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts beginnen neue Gedankengänge Kulturinhalt der Zeit zu werden. An Stelle des Pathos wird die Grazie der Affekt der Zeit so sehr, daß alle Künste, auch die Architektur, miniaturenhaft produzieren, und das Leben, in allen Poren von Kunst durchtränkt, ihre Gesinnung vollkommener ausdrückt, als sie selbst. Die Tracht des Barock wollte mit ruhigen Gewändern und Mänteln von dunkler Farbe, mit dem großen weißen Kragen und der Perücke dem Träger einen Ausdruck von Würde geben, schon ohne Rücksicht[S. 64] auf den Körper. Beim Rokoko aber tritt an die Stelle der ruhigen die grazile Linie, und damit die Kunstform des Körpers so sehr in Gegensatz zu seiner Naturform, daß kaum die Tracht der kretisch-mykenischen Epoche ihn so in ihre Fesseln zwang. Wennschon beim Manne die Verengung der Kleidung in der Taille, die prall anliegenden Kniehosen und Seidenstrümpfe mehr auf Zierlichkeit als auf irgendwelche Arbeitsleistung berechnet sind, so hebt der breite Reifrock der Frau die Zierlichkeit der kleinen Schuhe auf hohem Absatz und der schmal geschnürten Taille hervor, und Busen und Arme sind, zur Hälfte entblößt, reizvoller im Kontrast zum bekleideten Teil. So beruht auch hier noch ein wesentlicher Teil der Wirkung auf dem Gegensatz, auch wenn er zarter abgestimmt ist. Denn das Rokoko ist keineswegs nur weich. Allein schon eine Erscheinung wie Mozarts Musik müßte hier das Gegenteil beweisen, die die unerhörte Dramatik des Don Juan und der Symphonien neben die köstliche Musik seiner Intrigenopern stellt. Dabei ist ein Werk wie die „Entführung aus dem Serail“ ebenso bezeichnend für die exotische Bizarrerie des Rokoko wie das chinesische Teehäuschen im Park von Sanssouci.
Gerade diese Entwicklung in der Musik vom pompösen mythologischen Ballett des Barock zur Oper, zur Symphonie, zum Quartett Haydns und Mozarts, ist ungemein bezeichnend für die Differenz zwischen den beiden Stilen. Für das Rokoko ist der Genuß Sinn und Ziel des Lebens und die Liebe mit ihrer für unser Gefühl affektierten, für das der Zeit feinfühligen Sentimentalität. Verborgene Pavillons, versteckte Teehäuschen, lauschige Grotten im dichten Garten werden die bevorzugten Zufluchtsorte dieser galanten Zeit und die Aufgabe der fürstlichen Architekten. Fraglos bedeutet diese Annäherung an die Stimmungen der Natur eine psychische Verfeinerung, die eines ihrer interessantesten Denkmale in Haydns „Jahreszeiten“ gefunden hat. Man liebt an der Natur nicht mehr, wie die holländischen Landschafter, die kraftvolle Schönheit im Wechsel ihres Ausdrucks, sondern die idyllischen Stimmungen der Wiesen und Bäche, und es ist das Unerhörteste von Unwahrhaftigkeit, wenn die vornehmen Damen und Herren des Hofes das Leben des Menschen in der Natur zu leben glauben, wenn sie im affektierten Schäferkostüm liebeln und ländliche Feste geben von dem Geld, das den Ärmsten im Volke abgepreßt ist.
Dieser Übergang vom Barock zum Rokoko vollzieht sich wesentlich unter Führung des französischen Hofes, und es ist nicht unberechtigt,[S. 65] wie man schon die letzte Stufe des Barock als Stil Ludwigs XIV. bezeichnet hat, so auch die folgenden Phasen mit den Namen der französischen Herrscher zu verknüpfen. Allein auch hier wird deutlich, wie wertlose Klassifikationen unsere Stilbenennungen sind. In dieser Zeit ästhetischer Kultur bildet jede Generation einen neuen Stil, aber keiner läßt sich streng vom anderen scheiden. Alle sind nur Übergangsphasen, und gerade der Stil der Régence, der, nach der Regentschaft des Herzogs von Orleans (1715–1723) genannt, am Anfang dieser Entwicklung steht, bezeichnet nur den Übergang vom Barock zum Rokoko, dort, wo sich die Übergangsformen am eigenartigsten aussprechen.
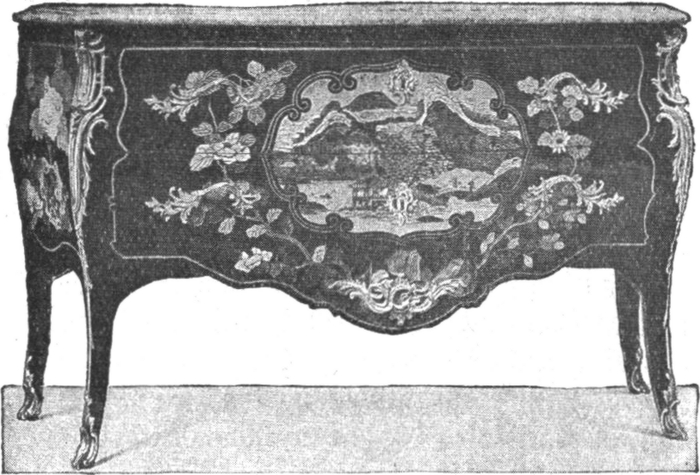
Eine Kommode dieses Stiles, wie Abb. 29, zeigt aufs deutlichste den Weg, den man zu gehen willens ist. Der Zweck jedes Teiles ist mit voller Absicht durch seine Form negiert. Der Fuß steht nicht fest — seine Endigung biegt sich in einer Bronzeranke, und er selbst ist, wenn auch in der Form vierkantig, so doch in der fließenden Kurve einer zart geschwungenen Linie bewegt. Im Leib der Kommode setzen sich seine durch feine Bronzelinien hervorgehobenen Konturen fort. Der äußere Rand geht ohne weiteres in die seitliche, der innere Rand in die untere Begrenzungslinie des Kommodenkastens über. Der ist keine Truhe mehr, wie noch der Schrank des hohen Barock (Abb. 24). In geschwungener Linie ist er nach unten, in geschwungener Fläche nach vorn und den Seiten bewegt, und obendrein ist über seine Vorderseite eine Chinoiserie, chinesische Blumen und Landschaften, gemalt, nicht nur ohne Berücksichtigung der Schubladen, die herausgezogen das Bild für den Moment zerstören mußten, sondern mit der offenen Absicht, jedem funktionellen Ausdruck dieser Gerätteile geradezu entgegenzuarbeiten. Denn wie hier durch das Bild werden die Fugen gelegentlich[S. 66] durch Bronzebeschläge in Rankenform zugedeckt. Von irgendwelcher Abgrenzung tragender und getragener Teile, wie noch beim Barockgerät (Abb. 25), ist gar keine Rede mehr; dessen abgesetzte Bewegung ist zur fortlaufenden geworden und die Absicht geht allein auf die graziöse Form. Und genau so frißt in der Zimmerdekoration die Zerfaserung durch das Ornament weiter, das noch immer bandartig, aber schon weniger flach ist.
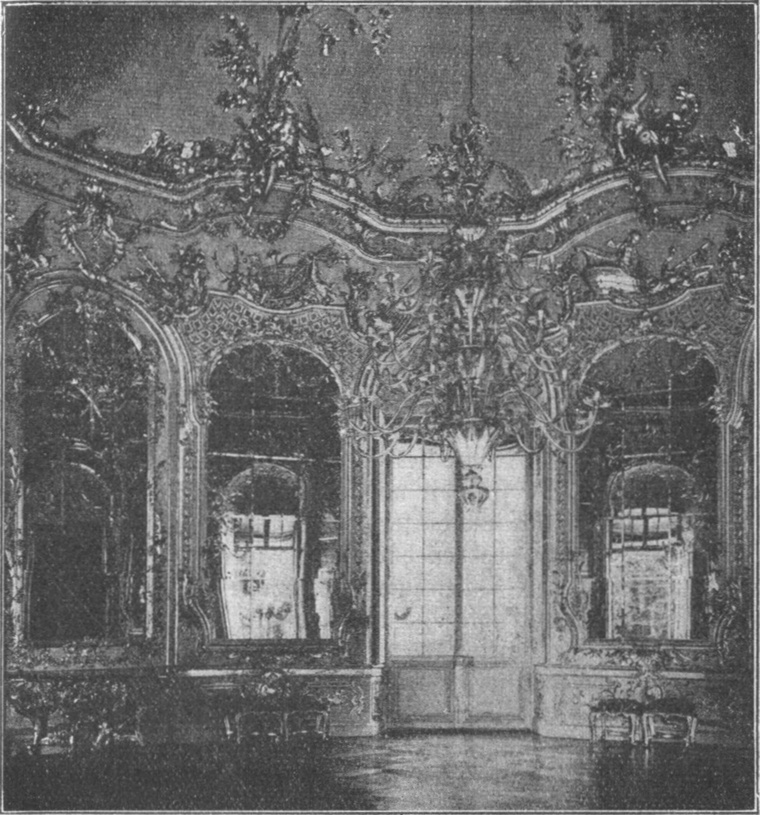
Man sollte meinen, daß eine noch intensivere Zerstörung der Zweckformen überhaupt nicht denkbar wäre. Und doch hat der Stil Louis XV., das eigentliche Rokoko, das etwa 1725 einsetzt, jedes Gefühl für die Funktion im Bauorganismus bis zu einem solchen Grade vernichtet, daß im wandlosen Wohnraum das Gebrauchsgerät feinliniges Gerank geworden ist. Ein Gemach, wie der Spiegelsaal der Amalienburg (Abb. 30), von Cuvilliés um 1740 gebaut, hat auch das letzte gliedernde Gerüst aufgegeben und das Zimmer wie in einem schimmernden Meer glitzernden Gerankes gelöst. Was von der Zimmerwand noch übrig ist, hat jede Flächenhaftigkeit verloren, ist vollkommen zersetzt durch das weichlinige Ornament. Der Stil meidet geradezu solche Holzflächen, verkleidet sie mit Gemälden, deren romantisch sehnsüchtige Landschaften sie noch intensiver zersetzen, am liebsten aber, wie in unserem Beispiel, mit Spiegeln. Bedeuten die beiden andern Arten der Wandfüllung eine Zerstörung ihrer Fläche, so bedeutet der Spiegel ihre vollkommene Regierung. Wo er steht, ist die Wand einfach nicht vorhanden, und das Spiegelbild tritt an ihre Stelle, das einen neuen Raum hinter sich zu öffnen scheint. Gerade hier wird klar, wie die raumerweiternde Tendenz des Barock eigentlich erst jetzt zur konsequenten Ausbildung gelangt. Man liebt es, den Spiegel einer weiten Flucht von Zimmern gegenüberzustellen, oder einem anderen Spiegel, so daß jeder im andern ein unendliches Hintereinander von Räumen vortäuscht. Leuchtet dann die große Lichtkrone in der Mitte, so ist der Eindruck von einer fast märchenhaften Körperlosigkeit. Und während noch im Saal des Würzburger Schlosses (Abb. 23) der Grundriß eckig war und die Wandteile sich durch die Säulen gegeneinander abgrenzten, umzieht hier die Wand das Gemach in weicher Rundung, in der Wellenbewegung vorspringender Wandteile und rückspringender Nischen, deren Füllungen durch das Geflecht des Ornaments miteinander verbunden sind. Denn wie die Türfüllung, das Gemälde, der Spiegel in sich als Wandfläche nicht fest sind, so sind sie es auch nicht in ihrer Umrahmung. Von den[S. 67] vorgestreckten unteren Ecken, von der ausgeschweiften Seitenrahmung sendet der Spiegel feine Ranken aus und klammert sich mit ihnen in die umgebende Wandfläche. Wie die Wand den weichgerundeten oberen Abschluß des Spiegels durch hängende Blumengewinde mit sich verbindet, sendet der Spiegel ihr Ranken entgegen, verknüpft sich durch eine breite Leiste, die der Rahmen am Beginn der oberen Rundung aussendet, mit den Nebenfüllungen, und verläuft nach oben in ein Gitterwerk, dessen geschwungene Begrenzungslinie durch musizierende Putten, durch Vasen, Füllhörner und andere Bildungen ebenso aufgelöst wird, wie es selbst die Wandfläche zerstört, auf der es aufliegt. So wird zugleich der Übergang in die Decke gewonnen, die sich in ebenso[S. 68] weicher Kurve an die Zimmerwand anschließt, wie diese selbst um das Zimmer geführt ist. Denn die beiden Leisten, die als einzige Überbleibsel der horizontalen Barocksimse sich oberhalb der eigentlichen Wand rings um das Zimmer ziehen, sind kaum als trennende Glieder gedacht, vermitteln vielmehr durch ihre eigene Abstufung, durch ihre Wellenbewegung und die ornamentale Zerfaserung den Übergang um so unauffälliger. Gerade hier läßt sich das Rokoko-Ornament in der ganzen Feinheit seines Gefüges studieren. Während die Barockranke (Abb. 25) in ihrer Führung übersichtlich war, so daß Haupt- und Nebenzweige sich klar voneinander scheiden, die einzelne Ranke eckig und bandartig flach, in ihrer Struktur also ruhig, ist die Rokokoranke unübersichtlich in ihrem ornamentalen Reichtum, biegsam und rund in ihrer Linienführung und Modellierung. Man trifft keine gerade Linie in diesem Ornament, bei dem die reichste Bewegung Schönheit ist, und die fein geschwungene Kurve des ganzen Gebildes noch in der letzten Ranke nachzittert. So sind die muschelartigen Gebilde mit kurvigen Endungen Hauptmotive und die felsartigen Ornamente, Rocaillen, die dem Stil den Namen gegeben haben. Und wenn auch jedes Motiv, wenn Putten und Tiere, Vasen und blumenvolle Füllhörner, Pflanzen und Girlanden sich mit ihnen zu einem bunten Reichtum vereinigen, so werden doch die Vasen rankenartig gebogen, die Putten in vielkurvigen Drehungen bewegt, die Füllhörner gewunden. Jedes Ziermotiv wird weich und schmiegsam wie die Ranke selbst, die sich in tausend Fasern löst, drängt sich in sie hinein, hemmt ihren Verlauf, und die Feinfühligkeit der Modellierung vereint sich mit der Zartheit der Farbenstimmung zur wohltönenden Harmonie. Wenn in der Amalienburg das matte Kerzenlicht über die Silberranken und ihren hellblauen Grund gleitet und mit seinen Schatten die zarten Formen modelliert, so ist ein Reichtum kleinster Schönheiten, eine Stimmung gegeben, die dem verfeinerten Auge den höchsten Genuß gewähren. Und doch muß man sich gegenwärtig halten, daß dieser Stimmungseindruck erreicht ist auf Kosten jeder Energie, daß das Rokoko ein aufs äußerste verfeinerter Dekorationsstil ist, aus dessen Formen auch der letzte Rest von Sachlichkeit gewichen ist. Das konstruktivste Gerät wird zum bloßen Ornament: während der Sessel des Barockstils doch wenigstens Sitz und Fuß trennte und auf seinen Füßen stand, geht auf den Sesseln unseres Saales das Polster durch die weiche Vermittlung des Ornamentes in die Beine über, die ihrerseits nichts weiter als feingezeichnete[S. 69] Ranken sind, springt ein Tisch nur wie eine feingeschwungene Ranke aus der Wand vor. Ebenso hat ein Gerät, wie das Paar Kaminböcke (Abb. 31), jeden Zweckausdruck verloren und ist zum bloßen Ornament vor dem ebenso ornamentalen Kamin geworden. Die Funktion der Böcke ist ja ganz zwecklicher Art: festzustehen und die brennenden Scheite zurückzuhalten. Aber selbst den Ausdruck dieser einfachen Funktion erstickt das Rokoko in geradezu genialer Weise. Das Gerät ist nichts weiter mehr als ein breites Rankengewinde, rund und weich, das nicht fest auf dem Boden steht, sondern aus einer ebenso weich zusammengerollten Ranke sich emporwindet, sich zurückbiegt, sich verschlingt, um in einer elegant aufsteigenden zerfaserten Blütenform zu endigen. Und zum Überfluß hat man auf dieses Gerät, von dem man kaum begreift, wie es überhaupt steht, noch ein Chinesenpaar gesetzt und Papageien, die sich zwar äußerst graziös in dem Gewinde bewegen, aber in Größe und Realität der Erscheinung außer allem Verhältnis zur Ranke sind und dem Ganzen selbst den letzten Rest von Wirklichkeitssinn nehmen, das Gerät zur bloßen Spielerei machen.
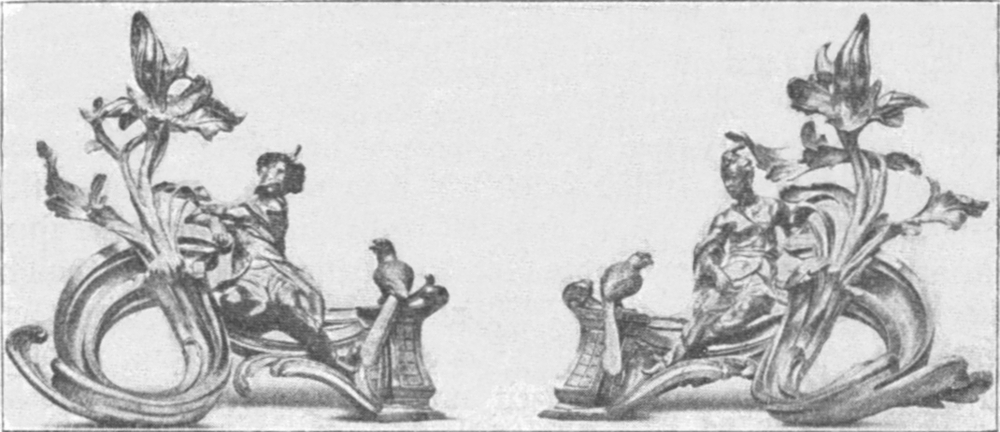

Bei dieser Weichheit und Schmiegsamkeit der Ornamente mußte das Streben der Epoche von vornherein dahin gehen, auch in der Keramik einen gefügigeren Stoff zu finden, als die dickwandige, in ihrer Struktur fast grob geschichtete Majolika. Das dünnwandige chinesische Porzellan, das den feinen Formen sich so schmiegsam fügte und die zarte Bemalung so willig in sich aufnahm, war das Ideal der Zeit. Daß man es nicht nur um seiner Schönheit willen sammelte, sondern sein Herstellungsgeheimnis auch als Ausdrucksmittel für die eigenen, ebenso graziösen Formgedanken zu besitzen strebte, war nur naturgemäß.[S. 70] Daß man Majolikavasen in chinesischem Stil herstellte (Abb. 26), war für das Barock ein Ersatz gewesen, dessen Abstand von der Qualität der Originale trotz der Verfeinerung der Technik stets fühlbarer werden mußte. So kam es schließlich, daß man um die Wende des 18. Jahrhunderts chinesische Porzellane übermalte oder europäische Vorlagen in China auf Porzellan kopieren ließ. Seltsam bizarr umgestaltet erscheinen die würdevollen Kupferstichporträts des holländischen Barock von chinesischen Schlitzaugen gemalt. Aber die Experimente, die den kostbaren Werkstoff für das Abendland erobern wollen, laufen vom Beginn der Barockzeit durch die ganze Epoche, und als schließlich, etwa im Jahre 1709, Böttger in Dresden das Geheimnis des Porzellans enthüllt hatte, wurde Meißen sein Hauptfabrikationsort und das Porzellan selbst der wichtigste, fast der einzige Stoff der abendländischen Keramik. Allerorten entstehen nun Fabriken; mit List und forschender Arbeit, mit Gewalt und Bestechung sucht man sich des Geheimnisses der Fabrikation zu bemächtigen, ein deutliches Zeichen für das Bedürfnis, das die Zeit nach einem keramischen Material von dem starken Glanz und der Formbeweglichkeit des Porzellans hatte. So lassen sich vom zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts an die Stilphasen des Rokoko an der ungeheuren Fülle der erhaltenen Porzellangeräte am subtilsten verfolgen. Zeitlich und stilistisch fallen die ersten Stücke mit dem Übergangsstil zusammen, den wir unter dem Namen Régence kennen lernten. Noch stoßen die Wandflächen gern in Kanten zusammen, allein sie sind der fließenden Linien halber elegant gebogen; Henkel und Ausguß sind zwar vom Gefäß abgesetzt, bewegen sich aber in weichen Kurven. Von hier aus zeigt das Porzellan den Gang der Entwicklungslinien bis in die feinsten Abstufungen: wie die Kanten verschwinden, die Wand rund um das Gefäß läuft, sich immer stärker krümmt und biegt, wie die Henkel immer weicher aus dem Gefäß hervorgehen, bis schließlich in einer Terrine, wie Abb. 32, um 1740 der vollkommene Rokokotypus erreicht ist, wie ihn die Amalienburg und die Kaminböcke uns schon kennen lehrten. Der Körper der Terrine hat jeden Halt in der Form verloren, ist vollkommen in Bewegung aufgelöst. In kräftiger Kurve biegt sich das Gefäß aufwärts, lädt in der Mitte in einer zweiten Welle weit aus, um in einer wieder beruhigteren Bewegung zu endigen, in die der Deckel, kaum durch eine schmale Grenzlinie vom Körper getrennt, mit aufgenommen ist. Diese Bewegung kreuzend läuft noch schneller, noch ruheloser die Seitwärtsbewegung,[S. 71] die nicht in einfacher Rundung auf- und abschwillt, sondern jedesmal eine stark ausspringende Kante zwischen zwei Ausbiegungen schiebt, die in dem starken Glanz des Porzellans ein außerordentlich erregtes Licht- und Schattenspiel entwickeln. Die Weichheit dieser Bewegungen fordert als Vollendung ein allmähliches Abschwellen des Gefäßkörpers nach außen. So kommt es, daß man das Gerät nicht fest hinstellt, sondern, als letzte Konsequenz der Löwenklauen der Hochrenaissance, Füßchen unterschiebt, die in ganz weichem Übergang die Kurve des Gefäßes als zusammengerollte Ranken fortsetzen und jeden Eindruck festen Stehens vermeiden. Ebenso sind die anderen Zweckglieder des Gefäßes, Henkel und Deckelgriff, funktionslos gemacht und zum gleichen Ausklingen der Gefäßform verwandt. Dort, wo die mittelste Ausladung den Gefäßleib am stärksten nach außen biegt, setzen zwei in ihren weichen Formen sehr charakteristische Rokokoranken, die an Stelle der Henkel Halbfiguren von Mädchen tragen, die Linie fort. In weicher Kurve läuft der Deckel nach oben aus; Putten schmiegen sich in seine Form und geben den Übergang zum Apoll, der als Deckelgriff das Ganze krönt. Ungemein bezeichnend ist die Gestalt dieser Figuren für den Geschmack der Zeit: wie die gekreuzten Beine Apolls absichtlich parallel den ansteigenden Deckellinien verlaufen, wie die stark zurückgebogenen Oberkörper der Henkelfiguren mit ihrem, auf geschwungener Nackenlinie vorgeschobenen Kopf die Formen der Rokokoranken vollkommen stilgemäß fortsetzen und die Bewegungen ihrer Arme wie Rankenausläufe behandelt sind, wie schließlich die weich geformten rundlichen Köpfe als Knaufendigungen empfunden werden.[S. 72] Man begreift von hier aus, warum Säle, Sessel und Gärten dieser Zeit vom stilvollen Menschen eine ganz bestimmte kurvige Haltung verlangten. Die Eigenart des Rokokocharakters präzisiert sich besonders scharf, wenn man die Terrine mit der barocken Keramik (Abb. 26) vergleicht. Stand die Delfter Vase, wenn auch nach unten zu schmäler werdend, doch immerhin auf festem Untersatz, war in ihr der Deckel vom Gefäß geschieden, wenn auch in den Linien nicht ohne Zusammenhang mit ihm, so steht hier das Gerät auf eleganten Füßchen, die zu schwach zum Tragen scheinen, und verschmilzt alle Teile vollkommen miteinander. War das Barockgerät von oben nach unten leicht gebogen, seitwärts durch Wellenparallelen bewegt, so schwillt hier die Bewegung von oben nach unten dreimal an und ab, gekreuzt von noch lebhafteren seitwärts gerichteten Schwingungen. Die Differenz ist dieselbe wie zwischen dem Barocksaal und seinem Gegenstück im Rokoko und beruht auf dem allmählichen Verschwinden der eckigen Formen zugunsten der weich gerundeten, und sämtlicher kantiger Trennungen zugunsten kurviger, zart fließender Vereinigungen.
Malerei und Plastik zeigen dieselbe Weiterentwicklung der Barocktendenzen. Wie die weiche Verschmelzung, die zarte Abstimmung in Architektur und Kunstgewerbe herrscht, herrscht sie auch in der Malerei. Die Themata Watteaus und seiner Zeitgenossen sind romantische Stimmungen, Schäferszenen und galante Feste unter dunklen Baumgruppen und in ländlicher Einsamkeit. Allein das erfordert die höchste Fähigkeit farbiger Darstellung, das stärkste Gefühl für räumlichen Ausdruck und für die Nuancen der Bewegung. Und so wird der Impressionismus des Barock immer konsequenter ausgebildet. Watteau ist selbst im Freien gebunden in den Farben; Fragonard aber, der vollkommene Plein-air-Maler, gibt jede Bewegung des Lichtes und die schnellgesehene Schwingung einer fliegenden Schaukel mit temperamentvoll erfaßtem Strich. Dieses Wirklichkeitssehen führt bis zum Realismus. Trocken, aber von großer Sachlichkeit ist die Porträtkunst Graffs und Chodowieckis in Deutschland. Goya (1746–1828) vollends ist nur als Abkömmling dieser Epoche zu verstehen. Dieser kühnste Impressionist des Zeitalters besitzt die letzten Geheimnisse der Freilichtmalerei und benutzt sie zu den erregtesten Bildern. Unvergleichlich kühn sind die Farbenbewegungen seiner Stierkämpfe und Volksfeste im glühenden Sonnenlichte, bis zum letzten grauenvoll nächtliche Hinrichtungen und gespenstische Inquisitionsprozessionen. Mit derselben Intensität sieht er Porträts.[S. 73] Er geht selbst bis zur Satire und verhöhnt Priester, Aristokraten und Dirnen in kühnen Radierungen. Und wie sein impressionistischer Realismus die völlige Befreiung der Malerei von jeder architektonischen Schranke bezeichnet, ist seine satirische Kritik schon Protest gegen die Genußsucht des Zeitalters.
Daß gerade zersetzende Epochen Zeitalter künstlerischer und wissenschaftlicher Kritik sind, war schon in Rom, schon in der Gotik zu lernen. Mit dieser Kritik aber zerstören sie sich selbst und schaffen die kommende Welt. Das letzte Resultat der Philosophie dieses Zeitalters war die Negierung seiner selbst, war der Nachweis des gleichen Rechtes aller Menschen auf der Grundlage des Naturgemäßen. Das letzte Resultat der Zeitkultur war die Verzweiflung der Massen und die französische Revolution. Diese Tendenzen haben auch in der Kunst ihren Widerhall gefunden. Das Wort „Sansculotte“ bedeutet nicht nur eine neue politische, sondern auch eine neue Geschmackstendenz.
Das Feingefühl, das formende Element bei der Bildung des Rokokostiles, war es, das seit 1760 zu dem in Farben und Formen schlichteren Stil geführt hat, den man mit dem Namen des letzten französischen Königs als den Stil „Louis seize“ bezeichnet. Die Auffassung dieses sog. Zopfstiles als eine Verödung der Kunstformen ist ganz unberechtigt. Unsere Zeit, die einen ganz ähnlichen Stilwandel durchgemacht hat, müßte die raffinierte Verfeinerung empfinden, die hier beabsichtigt war, und die ganz allmählich zu immer einfacheren Formen führte. Der Stil Louis XVI. bedeutet noch keine Umwandlung der Grundtendenzen des Rokoko, sondern nur eine Reaktion gegen die Erregtheit seiner Formen. Seine frühe Zeit kennt noch all die raffinierten Boudoirmöbel, läßt die Tische in eleganten Kurven aus der Wand hervorgehen, und nur diese Kurven selbst werden schlichter. Der Stuhl der Zeit steht noch nicht mit breiter Endigung fest auf dem Boden, krümmt sich aber auch nicht mehr in elastischer Ranke zusammen, sondern seine Füße sind als antike Pfeilbündel geformt, die sich geradlinig nach unten zuspitzen. In der geschweiften Zarge bilden sie mit ornamentierten Würfeln Ruhepunkte, an denen zugleich die Armlehnen sich abgrenzen. Mit zwei[S. 74] Sphingen beginnen sie, deren Flügel in die Lehnen hinaufführen; diese, an einem bärtigen Kopf in zwei Teile geschieden, werden durch Akanthusranken in die Rückenlehne geleitet. Auch diese ist gut begrenzt: seitwärts von zwei antiken Fackeln, oben von einem Stab, auf dem zwischen zwei symmetrischen Füllhörnern eine Kartusche ruht. Aber man sieht, daß die Teile des Gerätes noch ineinander übergeführt sind, die Flammen der Fackel und das Füllhornmotiv den oberen Abschluß noch weich machen. Indes, die Teile beginnen sich zu scheiden, und wie in der Architektur herrschen auch im Ornament die mathematisch einfachen Linien und Flächen. Dasselbe gilt auch für das Flächenornament, wie es die Holztäfelungen der Zimmer geschnitzt, Rückenlehne und Kissen unseres Stuhles gestickt zeigen. Es wird übersichtlich im Gefüge des Ganzen, einfacher, fast dünn in der Struktur der einzelnen Ranken. Der bunte Überschwang des Rokoko hat auch hier aufgehört, und einfachere Formen, denen antike Motive zugrunde liegen, treten an seine Stelle. Auch das Farbengefühl ist feiner geworden; die Hauptfarbe in der Stickerei unseres Sessels ist ein zartes Grün, und seine anderen Farben sind darauf eingestimmt. In den Holzteilen selbst werden jetzt Weiß und Gold bevorzugt.

Wenn diese Zeit, wie das Rokoko, chinesische Geräte in Bronze montiert (Abb. 34), bevorzugt sie feingeführte Formen, einfachere Konturen, einheitliche Farben und mit ihren ruhigeren Formen fließen die Linien des neuen Stiles in eins zusammen. Zeigt doch gerade diese Montierung, daß man die starken Formen noch immer nicht liebt, daß man sich scheut,[S. 75] ein Gerät fest auf den Boden zu stellen, und es auch jetzt noch auf Rankenfüße setzt. Aber die Ranken sind nicht mehr rund geführt, schlingen sich nicht mehr in weicher Drehung zusammen wie im Rokoko, sondern sind im Querschnitt kantig und in den Biegungen strenger gegeneinander begrenzt. Man sieht, daß diese Vereinfachung gelegentlich Formen schafft, die denen des Barock überraschend ähnlich sind. Girlanden schlingen sich von einem Fuß zum anderen, aber nicht die bunten, schwellenden Blumengirlanden des Rokoko, sondern regelmäßig begrenzte von ruhigen Lorbeerblättern, noch immer ein kurviger Abschluß des unteren Gefäßrandes, aber von strengerer Form. Und ebenso ist alles andere im Gerät auf einfachere Formen gebracht, die Henkel, die als Widderköpfe ansetzen, wie der Deckel, in dessen Bronzerand sogar schon die ruhende Horizontallinie sich einzustellen beginnt.

Aus antiken Motiven hellenischen Ursprungs ist dieses Ornament abgeleitet, und wenn auch das Pathos überrascht, das Pfeilbündel als Stuhlbeine, Sphinge als Armlehnen und als Kaminböcke verwendet, so beweist doch das Heranziehen gerade hellenischer Vorbilder den zu ruhigerer Art gewandelten Geschmack. Aber er bedingt auch, daß der Zeit der Glasurglanz des Porzellans zu leuchtend, seine Farben zu bunt erscheinen. Wie die Puderperücke Glanz und Farbe des Haares, so verdrängt das glanzlos weiße Biskuit jetzt vielfach das Porzellan. Es war die große Erfindung Wedgwoods, dieser Masse die gebrochenen feinen Farbentöne zu geben, die das Ideal der Zeit sind, das matte Grün, das zarte Blau, das tiefe Schwarz. Während die Wirkung der schimmernden Porzellanglasur die Durchbrechung der Gefäßoberfläche ist, ist das Wedgwoodgerät in der Färbung und der Masse vollkommen gleichmäßig und ruhig. All das also eine Rückkehr zu struktiveren Absichten, mit denen der Stil Louis XVI. als Vorläufer des Empirestils zu den Prinzipien des Rokoko in Gegensatz tritt.
[S. 76]
Man hat geglaubt, und noch jetzt ist es in allen Handbüchern zu lesen, daß diese Anlehnung an die hellenische Antike das eigentliche Wesen des Empirestiles bedeutet. Allein sie ist nur ein Symptom. Wir sahen ja, wie die Antike seit der Renaissance immer wieder als Vorbild dient, und es ist interessant, zu beobachten, wie sie jedesmal der Zeittendenz entsprechend umgeformt wird. Hogarth zeichnet 1753 den Apoll von Belvedere und den Herakles Farnese, von denen er ein treues Abbild geben will, ganz unwillkürlich in seltsame Bildungen um, um seine Rokokotheorie von der Schönheit der S-Linie an ihnen zu beweisen, und Lessing, der objektivere, wählt die Laokoon-Gruppe, dieses Ergebnis einer antiken Barockkunst, um auf sie seine Kunsttheorien aufzubauen, die der moderne Mensch die Forderung des Pathos nennen muß. Aber ebensowenig stand das Empire der griechischen und ägyptischen Antike, die seine Wissenschaft genauer kennen lehrte, objektiv gegenüber. Nicht einmal das ist richtig, daß es die klassischen Formen reiner aufnimmt als der Stil Louis XVI. Kein Stil saugt fremde Elemente auf, ohne sie seinem Geschmack entsprechend umzuformen. Ebensowenig wie die italienische Renaissance nur eine Neugestaltung der römischen Antike ist, ist das Empire eine Wiedergeburt der hellenischen. Die Wahrheit ist, daß die Renaissance, wie wir sahen, ihre Motive der römischen Kunst entnahm, weil diese für die majestätische Pracht den stärksten Ausdruck gefunden hatte, und das Empire der hellenischen, weil es hier jene Ruhe der Formen fand, der die Epoche selbst zustrebte, nachdem sie im Ornament des Rokoko sich übersättigt hatte. Beide Stile aber formten das Gegebene ihren Zielen entsprechend um, und gerade diese oft unbewußte Differenz zwischen dem Vorbild und dem Kunstwerk spricht das eigene Wollen des Stiles aus. Es ist ebenso äußerlich, zu sagen, die Entdeckungen in Pompeji und Herkulanum hätten das Empire geschaffen, wie es äußerlich ist, zu behaupten, die Renaissance wäre ein Kind der römischen Kunst. Dann hätte das Empire ebensogut im südlichen Italien entstehen können, wo man nicht nur Pompeji und Herkulanum, sondern die edlen Formen der Tempel von Paestum und Agrigent täglich vor Augen hatte. Allein es entstand in Frankreich aus dem Stil Louis XVI. und führt seinen Namen nach dem Kaiserreich Napoleons.
Dessen Arbeitszimmer im Schloß Fontainebleau (Abb. 35) zeigt den Stil in all seiner Wucht. Die Wand ist in streng abgegrenzte Felderflächen geteilt, Tür und Kaminspiegel von geraden Rahmen umgeben. Die[S. 77] rechteckig feste Platte des Arbeitstisches tragen balkenhafte Beine auf breiten Löwentatzen. Jede Form ist kantig fest begrenzt, jedes Material nur durch sich selbst zur Geltung gebracht: die antikisierenden Bronzeornamente des Schreibtisches nicht schmiegsam, wie im Louis XVI., sondern geschaffen, die Oberflächenebenen des Möbels zu betonen, nicht aber seine Funktion. Alles scheint rein zweckvoll und ist doch so pathetisch, wie die Schwurgeste der Horatier auf Davids Bild. Nicht Stehen oder Lasten ist ausgedrückt, sondern Wucht und Größe, nicht selbstverständliche Ordnung herrscht, sondern bewußte Wirkung. Und was für die Möbel gilt, gilt ebenso für die Wandung des Zimmers und für die Architektur.
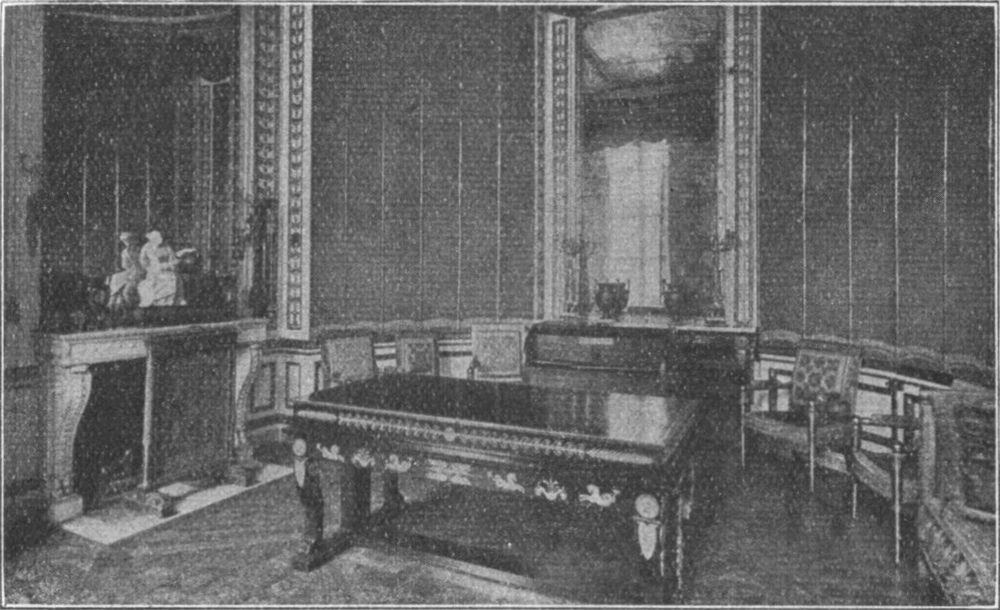
In Frankreich sind uns von ihr weniger Denkmale erhalten geblieben als in Deutschland, dessen schlichtsachlicher Handwerklichkeit der Stil sehr willkommen sein mußte. Schinkel ist hier der Hauptmeister, seine neue Wache in Berlin (Abb. 36) ein Zeugnis für die Selbständigkeit, mit der das Zeitalter den Vorbildern gegenüberstand. Denn die Front des dorischen Tempels ist hier nur Bauglied. Ihre aufsteigende Kraft wird zusammengepreßt durch die Turmformen zu ihren Seiten, niedergedrückt durch die über ihr ruhende Horizontale. Bei all ihrer Energie bleibt sie wirkender Teil eines größeren Ganzen von pathetischer Ruhe. Und man soll nicht vergessen, daß Schinkel daneben romantische Landschaften gemalt und gotische Dome projektiert hat.
[S. 78]
Dieses Unterordnen aller Formabsichten unter Gefühle erklärt das Hervorgehen dieses Stiles aus Rokoko und Louis seize. Das Empire ist kein tektonischer, sondern ein pathetischer Stil; und wenn das Kunstgewerbe noch nicht überzeugend ist, so ist es sicher die Tracht der Zeit.

Gerade für das Empirekleid, wie es Madame Recamier auf dem Bild von David, dem Maler des Napoleonischen Kaiserreichs, trägt (Abb. 37), ist die Ableitung vom hellenischen Stil evident, aber die Umformung ist charakteristisch für die Eigenart des Empire. In vollkommener Harmonie schmiegt sich die Linie der Frau der Lehne und dem Lager ein, überbrückt mit dem herabfließenden Gewand die Strenge seiner Horizontalen, ja, der Hals scheint, der Linienparallele zuliebe, übermäßig in die Länge gezogen. Es kommt nicht auf die gesunde Umhüllung des Körpers an, wie die Antike sie schuf, sondern auf den zarten Fluß der Linien. Das Korsett ist hier keineswegs verschwunden.
Das Verhältnis des schlichtlinigen Kostüms im Empire zu dem kontrastbewegten im Rokoko spiegelt das aller Künste wider. Auch in der Malerei erstirbt alle Bewegung. Flächig entrollte Vorgänge spielen vor flachen Hintergründen, alle Gestalten, selbst die Porträts werden dem antiken Gipsschema angenähert und jeder Individualität entkleidet. Nicht mehr die Plastik der Form, sondern der Rhythmus der abstrakten Linien bestimmt das Bild. In Davids (1748–1825) Madame Recamier (Abb. 37) ist es die fein geführte Linie, die von der Lampe des Kandelabers aus über das Haupt der Frau und den gleitenden Fluß des Gewandes hinweg in die Lehne am Fußende führt. Auch die Farben haben sich immer mehr gedämpft, sind trüber, erdiger geworden, und es kommt bei den deutschen Klassizisten, wie Carstens und Genelli, so weit, daß sie nur noch auf den edlen, d. h. unplastisch abstrakten Umriß sehen und in der Graphik an Stelle des belebten Farbstiches der bloße Umrißstich tritt.

Es handelt sich hier nicht um eine sachlich flächenhafte Bildruhe,[S. 79] die die Wand zugrunde legt, sondern um eine pathetische oder sentimentale Weichheit des Ausdrucks, geschult an antiken Vorbildern, die aber ganz ins Gefühlvolle gezogen werden. Auch die Plastik des Empire ist trotz ihres Flachreliefs nicht struktiv gemeint, sondern bloße Mäßigung der Bewegungen, die eine vorhergehende Zeit in allen ihren Komplikationen ausgeschöpft hatte. Ganz scharf bezeichnet Canova (1757–1822) den Übergang, den Stil Louis XVI. Seine Bildwerke haben noch die gegensätzlichen Bewegungen von Licht und Schatten, die starken Kontrastformen des Barock, aber schon gehemmt durch eine Tendenz der Beruhigung, die keine energievolle Handlung mehr wagt. Für uns ist es unerträglich, wenn bei Canovas Amor und Psyche Amor wild dahergestürzt ist, mit gespreizten Beinen und gespreizten Flügeln dasteht, sich auf die Frau wirft, und wenn dann plötzlich die Bewegung stockt, und aus dem heißen Begehren ein zages Tasten wird. So wirkt er in seiner Absicht, einfach und edel zu sein, süßlicher als irgendein anderer. Aber die Berühmtheit gerade seiner Skulpturen in ihrer Zeit beweist, daß sie den Geschmack der Epoche am klarsten aussprachen. Die laute Bewegung wird ihr allmählich immer unsympathischer und mäßigt sich, wenn auch noch nicht zu verinnerlichter Ruhe, so wenigstens[S. 80] zu äußerlicher Zartheit. Selbst Thorwaldsen sagte von Canovas Amor und Psyche, die Gruppe wäre komponiert wie eine Windmühle, und es könnte wohl im Stil der Zeit begründet sein, was als ein Charakterfehler Thorwaldsens ausgelegt worden ist, daß er Canovas Arbeiten weniger geschätzt habe, als Canova die seinen.
Denn Thorwaldsen (1770–1844) ist der klassische Plastiker des Empire. Auch er ist ein Routinier, der nicht vom eigenen Studium der Natur ausgeht, sondern von der erlernten Form, und den Wert seines Werkes nicht durch die subjektiv erschaute Erscheinung, sondern durch Gefühle und Sentiments bestimmt. Insofern lebt auch in seiner Kunst noch die Art des Barock und des Rokoko fort. Aber der beabsichtigte Eindruck selbst ist ein anderer geworden. An die Stelle der großen pathetischen Bewegung ist jene Zagheit der Darstellung getreten, die die Empfindsamkeit des Beschauers erwecken soll und in fortschreitender Entwicklung notwendig zur Sentimentalität werden mußte. So wird auch hier die Form beruhigt; an Stelle des Hochreliefs ist das Flachrelief getreten, an Stelle der bewegten Formrundung der zart geführte Kontur. Trotzdem ist diese Stilisierung im Grunde stillos, weil sie ohne Architekturenergie nur von der Wirkung der Darstellung ausgeht. So charakterisiert sich hier das Epigonentum der Epoche. Gerade für diese Schlichtheit der Darstellung erscheint der Zeit die Antike als das beste Vorbild, und eben in der Differenz zwischen Antike und Empire erweist sich, wie in der Baukunst, die eigene Art des Stiles. Wenn beispielsweise die Antike die drei Grazien bildet, so sind es drei nackte Frauen, von denen jede ihre Arme mit den Armen der Schwestern verflicht, so daß sich alle zu einem Kreis der Schönheit verbinden, der, von wo immer gesehen, ein vollkommener Ring ist. Thorwaldsen dagegen stellt zwischen zwei Frauen eine dritte, die um jede Schwester einen Arm schlingt und die Reihe zur Gruppe schließt — eine ruhige Gruppe, nicht als kreisender Reigen gedacht, wie das Werk der Antike, sondern von einer Gestalt aus zartlinig gegliedert. Die Antike schafft den kraftvollsten Ausdruck des Gedankens, das Empire den ruhigsten, in seinem Sinn, in dem das Wort leider auch uns noch gilt, idealsten. Gerade diese Gruppe spricht den Geist der Zeit ganz klar aus. Die Architektur hat Parallelen geschaffen: Klenzes Königsplatz in München mit dem Abschluß durch die Propyläen, oder Schinkels Gedanke, das Gegenüber der beiden Barockdome auf dem Berliner Gendarmenmarkt durch das Schauspielhaus in ein Miteinander zu verwandeln.
[S. 81]
Daß die Einfachheit des Empire kein prinzipieller Stilwechsel, sondern nur die Reduktion eines Stiles auf neue Gefühle ist, zeigt die Leichtigkeit, mit der die Gefühlsinhalte wechseln. Schon in Thorwaldsens Skulpturen für die Kopenhagener Frauenkirche und auch sonst in der Empirekunst verschmolzen antike Schlichtheit und christliche Milde zu einer Formeinheit. Derselbe Weg, der zum Klassizismus führte, führte in Deutschland weiter zum Nazarenertum.
Im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts hat das Ziel der romantischen Zeitsehnsucht, aber auch nur dieses, nicht das Gefühl, gewechselt. Statt für die Antike begeistert man sich nun für das Mittelalter, aber nicht für die kraftvolle romanische Epoche, die man kaum kennt, sondern für die weichere gotische, die man für klassisch deutsch hält. Schon Klopstock dichtete Bardengesänge neben Oden in antiker Form. Jetzt schreibt man ritterliche Balladen und Dramen, malt christliche Legenden, und um auch des Glaubens nicht zu ermangeln, der die Vorbilder geschaffen, treten die feinsten Geister Deutschlands scharenweis zur katholischen Kirche über. Es ist bezeichnend, daß nicht die Baukunst, die wesentlich klassizistisch bleibt, sondern die Malerei den Ausdruck hierfür gegeben hat. Die Malerschule der sog. Nazarener, die sich gegen 1815 in Rom um Cornelius und Overbeck schart, hat die christlichen und mittelalterlichen Gedanken dieser Zeit am schärfsten ausgesprochen. Mit bewußter Einfachheit erzählte rührende Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, Mariensagen und die Geschichte des Jünglings Joseph, daneben die geistlichen und ritterlichen Legenden des Mittelalters geben ihren Werken den Inhalt, der Umriß ihren Gestalten die Form. Während noch bei den Malern des Empire die Farbe dem Bild wenigstens nicht seine Ruhe nimmt, mußte für diese malerisch uninteressierten Augen das Gemälde zur kolorierten Zeichnung werden. Die Bilder der Nazarener sind für uns nur noch in den Kartons zu genießen, wo der Gegenstand allein zur Geltung kommt. Auf den ausgeführten Werken überschreien die grellen Farben einander.
Wie stark empfindungsgemäß hier alles ist, zeigt am besten der Hang dieser romantischen Periode zur Lyrik, die das Drama allmählich geradezu verkümmern läßt. Poesie durchtränkt das tägliche Leben, und man scheint bestrebt, mit ihr jede Alltäglichkeit in eine ideale Sphäre[S. 82] zu heben. Verse auf jedem Schlummerkissen, auf jedem Klingelzug, auf jedem Stammbuchblatt.
Die Bau- und Gerätformen, die diese Gefühlsrichtung geschaffen hat, sind unter dem Namen Biedermeierstil zusammengefaßt worden. Allein der Begriff ist schwer greifbar. Man kann kaum von einem Stile im üblichen Sinne reden, denn er hat nie, auch nicht in Teilgebieten eine unumschränkte Herrschaft gehabt. Goethes Beschreibung des Stilwandels vom Rokoko zu ihm:
läßt einen tektonischen Stil erwarten, dessen Möbel ihre Form vom Zweck, ihre Oberfläche vom Material erhalten. In der Tat sind seine Häuser einfache Mauerbauten mit schlichten, breitdeckenden Ziegeldächern. Die Wände seiner Zimmer sind kantenfest begrenzt, mit Papiertapeten von flächenhafter Musterung bekleidet, die sich zu den glänzenden Seidentapeten des Rokoko verhalten wie das Wedgwood zum Porzellan. Für die Form seiner Möbel ist ihr Holzgerüst entscheidend, Tischplatte und Stuhlpolsterung als gesonderte Formen auf ihm angebracht, und seine Schränke sind kastenförmige geradflächige Behältnisse (Abb. 38). Immer ist der Holzform die natürliche des vierkantig behobelten oder rund behauenen Balkens zugrunde gelegt, immer bildet Holzmaserung den einzigen Oberflächenschmuck. Aber es fällt doch auf, wie der Stil runde weiche Übergänge und spitzes Stehen liebt und daß beim Öffnen des Schreibsekretärs hinter der einfachen Wand eine so prunkvolle Ausstattung, selbst mit ganzen antiken Tempelarchitekturen, sich öffnet, daß man an das Verhältnis von Fassade und Prunkräumen in Barock und Rokoko erinnert wird. Es handelt sich in der Tat nur um eine Abwandlung des Empirestils ins Kleinbürgerliche. Die Formen sind wohl ornamentlos und einfach, aber ihre Ordnung, ihre Übergänge ineinander und zur Erde sind von einer Ruhe, die nicht die energievolle Festigkeit bewußter Kraft, sondern gefühlvolle Zartheit geschaffen hat. In der Malerei entsprechen ihr Romantiker, die ohne das Pathos und die große Form der Nazarener zu haben, doch ihre Gefühlsweichheit besitzen und sie in schlicht empfundene Naturformen kleiden, wie der Landschafter Kaspar David Friedrich,[S. 83] der Farbensymboliker Runge und der Impressionist Waßmann. Aber dieses Gefühl verlangt nach gegenständlichen Bildinhalten, und Schwind und Spitzweg werden die Übergänge zu einer Historien- und Genremalerei, die schließlich den Wert des Bildes nur noch im erzählten Vorgang sieht. Das wirkt wiederum auf die Zweckkünste zurück. Das Interesse an historischen Stimmungen läßt den im Biedermeier schlummernden tektonischen Gedanken sich nicht erst entfalten, führt zum Nachahmen der historischen Stilarten und schließlich zu jener Stilwirrnis, die die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihren seltsamen Geschmacklosigkeiten anfüllt.
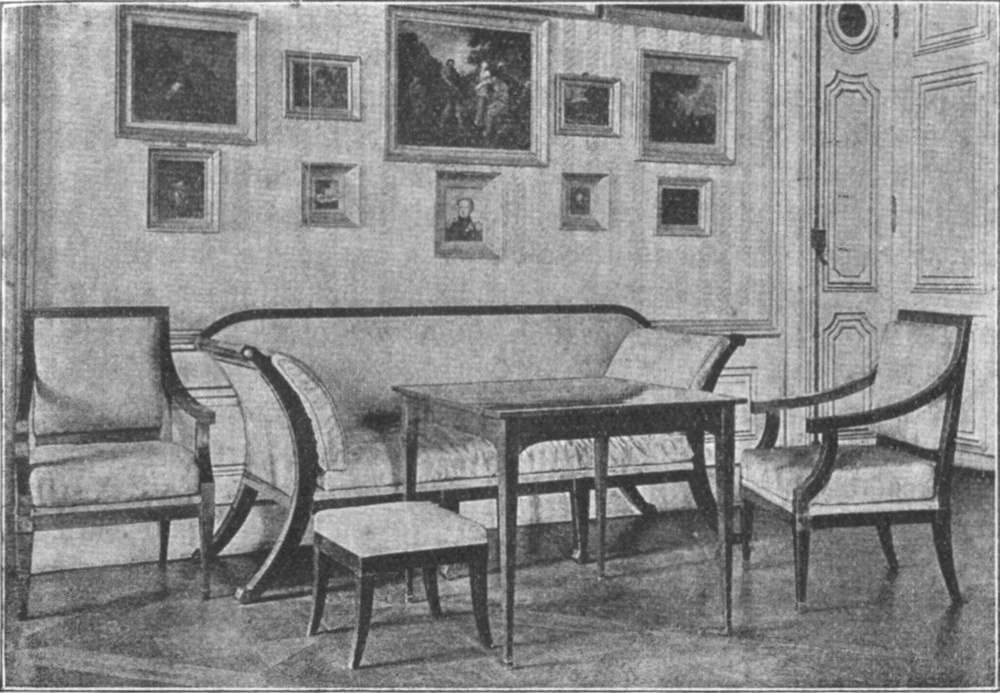
Zu diesem Resultat, dem völligen Mißverhältnis zwischen Form und Zweck, wirken soziale Entwicklungen nach zwei Seiten mit, die den Handwerker in demselben Maße unschöpferisch werden lassen, in dem der entwerfende Künstler an Stolz und Eigenwillen zunimmt.
Man braucht kein Reaktionär zu sein, um zu bedauern, wieviel durch die Aufhebung der alten Innungsorganisation von der soliden Tradition zerstört wurde, auf der die Leistungsfähigkeit des Kunstgewerbes beruhte, jedenfalls aber hat man kein Recht, von ihr als einem alten Zopf zu reden, der nichts weiter war als ein Hemmnis[S. 84] für die freie Entwicklung des Gewerbes. Es ist ganz selbstverständlich, daß, wenn die alten Innungen die Zahl der ausübenden Meister beschränkten, sie nicht nur den Konkurrenzkampf abschwächten, der so sehr auf Güte des Materials und Gediegenheit der Arbeit zurückwirkt, sondern zugleich der Überfüllung des Handwerks vorbeugten. Um hier nicht ungerecht zu sein, mußten sie zugleich auch die Zahl der Lehrlinge beschränken. Damit fiel gleichzeitig das zweite Hauptübel unserer Zeit fort, die Lehrlingszüchterei, und dem, der aufgenommen wurde, wurde wenigstens die gediegene Ausbildung garantiert. Ließ man dem Publikum nur die Auswahl zwischen wenigen Fachleuten, so schützte man die Käufer andererseits gegen jeden Betrug, in der Goldschmiedekunst z. B. durch ein überaus raffiniertes Kontrollstempelsystem, das zu jeder Zeit Ort, Zeit und Meister eines Gerätes zu erkennen gestattete. Jene schäbigen Surrogate edlen Materials, die das Elend unserer Zeit sind, waren unmöglich in einer Epoche, in der Vergoldung edlen Metalles nur gestattet wurde, wenn eine unvergoldete Stelle über den wahren Wert des Materials Aufschluß gab, und die Vergoldung unedlen Metalls überhaupt verboten war. In der gewissenhaften Ausbildung des Handwerkers wurde jener sichere Grund technischen Könnens gelegt, das die Jahrhunderte dem einzelnen überliefert hatten und das jedem Stil der gerade gegenwärtigen Zeit die vollkommene Schönheit im kleinsten Erzeugnisse sicherte. Wieviel Meisterschaft hier mit der Aufhebung der Innungen zum Absterben verurteilt worden ist, weiß jeder, der einmal an irgendeinem Familienjuwel einen gelösten Goldfaden hat wieder befestigen lassen wollen. Heute bedeutet eine solche notwendige Reparatur fast stets eine Entstellung des Stückes, und auch hier wieder ist es die Schönheit, die den Schaden trägt.
Nun wurde ja die Aufhebung der Innungen nicht nur von den Freiheitsidealen der Zeit gefordert, sondern auch von dem immer zunehmenden Fabrikbetrieb notwendig gemacht, der sich jetzt sofort an die Stelle des Handwerks setzte. Und während so die Ausführung der Arbeit immer schematischer wurde, stellte sich zugleich dem ausübenden Arbeiter eine Klasse entwerfender Künstler gegenüber, die, an Kunstgewerbeschulen erzogen und im Grunde ohne Stilgefühl, ihre Formmotive ganz äußerlich den Vorbildern der Vergangenheit entnahmen, vor allem den Werken der deutschen Renaissance. Was dabei herauskam, war ganz ohne Zusammenhang mit dem Zweck, ein[S. 85] reines Gemengsel verschiedener Ornamente. Allein es muß einmal dagegen protestiert werden, daß man diese Epoche der Stillosigkeit kurzerhand aus der Geschichte der Entwicklung streichen will. Der spätrömische Stil etwa der Kaiserzeit mit seinem Durcheinander von ägyptischen, hellenischen und hellenistischen Motiven, die das wenige im römischen Volk Geborene erstickten, mit seiner vollkommen dekorativen Verwertung konstruktiver Bauglieder ist um nichts stilvoller als die Mitte des 19. Jahrhunderts, und nur die Zeitdistanz läßt dort eben in der Stilwirrnis eine Einheit dekorativen Empfindens sehen. Bedürfte es noch eines positiven Beweises, daß es sich hier um eine regelmäßige Stilabfolge handelt, so wäre es die Tatsache, daß die logische Reaktion gegen das Empire ganz klar zutage tritt, und sich selbst unbewußt, aber für den Historiker deutlich ausgesprochen ist in Sempers Anschauung, daß die Antike eine sentimental schwächliche Kunst sei, während in der Renaissance das starke Vorbild der Zeit liege. Dieses seltsame Urteil wird erst erklärlich, wenn man sieht, wie stark die Biedermeierzeit alles Empfinden, auch im Nachfühlen der Antike, ins Weichliche verzogen hatte, so sehr, daß nur das geradezu Robuste, wie Semper es in seinen Bauten gestaltete, als Antitoxin erscheint.
Und so entstehen jene Bauformen, die die schnell aufwachsenden Stadtteile der Zeit so unerträglich machen, gerade Straßen, die keiner natürlichen Bedingung des Bodens gehorchen, Plätze, die nichts weiter sind als Straßenkreuzungen, und in deren Mitte Monumentalbrunnen und Denkmäler Verkehrshindernisse bilden. Die Hausfassaden sind nicht durch die Anlage der Wohnräume bedingt, sondern nur durch die Absicht, möglichst reich und prunkvoll zu wirken. So werden sie überladen mit Balustraden, Friesen, Pilastern und Ornamenten, die aus Gotik, Renaissance, Barock, Rokoko und allen anderen Stilarten zusammengetragen und aus Stuck geformt und ausgeführt werden. Die Wirkung ist denn auch für jedes geschmackvolle Auge unerträglich. Keine Konsole hat etwas zu tragen, kein Sims etwas zu begrenzen, keine Galerie einen Weg zu zeigen, und das Ornament überkleidet und zerstört jedes Stückchen Wand, das etwa noch übrig ist. Dazu kommen Erker, die keinen Weitblick gestatten, Fensterrahmen, mit gemalten Fenstern gefüllt oder einfach leer gelassen, Dachtürmchen und Mansarden, die nichts weiter als Attrappen sind. Ebenso unkultiviert sieht es im Innern eines solchen Hauses aus. Auf einen mit derselben Talmipracht ausgestatteten „hochherrschaftlichen“ Treppenaufgang folgen[S. 86] Wohnungen, in denen die besten Zimmer zu Repräsentationszwecken verwandt, als sog. gute Stube für die Hausbewohner verschlossen bleiben, während die Familie selbst in unhygienisch kleinen Schlaf- und Wohnzimmern zusammengepfercht bleibt. In den Räumen selbst kleben Papiertapeten und Stuckdecken mit sinnlosen Ornamenten, sind die Möbelformen ebenso aus allen Stilarten zusammengeholt (Abb. 39). Was soll man zu romanischen Eßzimmern, gotischen Schlafzimmern, Herrenzimmern in flandrischem Barockstil schließlich sagen? Es ist kaum begreiflich, daß solche Dinge, die Widersinnigkeiten in sich sind, jemals die Häuser aller Gebildeten beherrschten. Und über all das hin verteilt sich eine Unmenge sinnloser Stoffdraperien, Makartbuketts, Nippes, unechter Bronzen usw. Was gerade in diesen zwecklosen Zieraten geleistet wurde, was hier von Reiseandenken, Vasen, Väschen und Biskuitfiguren, unter denen man selbst plastische Kopien von Gemälden finden kann, fabriziert, gekauft und aufgestellt wurde, zeigt einen schmachvoll tiefen Kulturstand.

In der gleichzeitigen Malerei und Plastik herrscht dieselbe Zuchtlosigkeit. Die Künstler sind zahllos, und es wird alles gemalt, aber ohne Charakter und Augenkultur; der Gegenstand entscheidet. Drollige Kinderbildchen, süßliche Liebesszenen, fade Frauengestalten, charakterlose Allegorien sind das letzte Resultat der sentimentalen Empfindelei.[S. 87] Und neben ihnen herrscht das falsche Pathos der historischen Schlachtendarstellungen und Herrscherapotheosen. Aus dem Historienbild, für das Piloty in seinen ersten Werken einen guten Anlauf nahm, wird der vollkommene Maskenball, in dem der Reichtum der Kostüme jeden Ausdruck verdrängt. Malt man Bauern oder sonst armes Volk, so nur, um zu amüsieren oder zu rühren, und das Gemälde wird zum süßlichen Genrebild. Auch die Plastik geht mit ihren gezierten weiblichen Akten und pathetischen Herrscherdenkmalen denselben Weg. Dabei sind oft die technischen Qualitäten die denkbar geringsten. Nur wenige Meister beherrschen Form und Material.
Es ist unmöglich, hier auch nur die wichtigsten Namen zu nennen. Die Zahl der Schaffenden ist Legion; Historienmaler wie Lessing und Kaulbach, Genremaler wie Knaus und Vautier bedeuten in der Zeit den Höhepunkt des Könnens und sind uns heute nur noch Repräsentanten einer Vergangenheit. Daneben stehen als stärkere Erscheinungen echte Romantiker, wie Böcklin und Feuerbach. Aber noch in dieser Generation beginnt eine Gegenbewegung, deren erstes Symptom die künstlerische Erscheinung Menzels ist.
Diese Bewegung setzt in der Malerei bewußt und energisch ein. Im Kampf gegen eine Historien- und Genremalerei, die sich von der deutschen nur durch das stärkere Temperament unterscheidet und deren Hauptmeister Meissonier ist, entwickelt sich in Frankreich allmählich ein Wirklichkeitsstil (Realismus), der in seiner Konsequenz zum temperamentvollen Impressionismus wird. Schon Millet (1814–1875) erkennt das Gegenständliche des Problems mit aller Schärfe, sucht den Bauer bei seiner Arbeit auf, und wenn bei ihm die Darstellung noch nicht frei vom Pathos ist, so bringt dafür Courbet das rein Malerische des Problems zum Bewußtsein, das für den Kreis der „Impressionisten“ die einzige Aufgabe der Malerei wird. Manet, Monet, Degas erobern die neue Anschauung in Frankreich in denselben Kämpfen, mit denen in Deutschland Leibl, Liebermann, Trübner, Uhde und die ganze Gefolgschaft der Sezession gegen die Historienmalerei und Genrekunst kämpfte. Ihnen ist der Gegenstand an und für sich nichts, das Formproblem, das er stellt, der eigentliche Inhalt des Bildes. Nicht Vorgänge oder Stimmungen bestimmen seinen Gefühlswert, sondern der farbige, unmittelbar dem Auge gehörende Reiz. Fabriken und Werkstätten, Landschaften und Innenräume, Akte und Porträts interessieren um des Wertes willen, den sie als malerisches Problem durch die Farbwerte haben,[S. 88] die das Auftreffen des Lichtes auf sie erzeugt. Lokalfarben, scharfer Kontur, theoretische Perspektive erscheinen jetzt als bloße Abstraktionen kühler Köpfe. Es gilt, mit temperamentvoll zugreifendem Auge von den jeden Augenblick wechselnden Lichtbewegungen die interessantesten zu ergreifen. Monet malt einen Heuhaufen oder eine Kathedrale immer wiederholt in ganzen Serien von Bildern, aber jedesmal in der Beleuchtung einer anderen Tagesstunde; nicht um keinen Gegenstand suchen zu müssen, wie törichte Gegnerschaft gemeint hat, sondern weil sich so die feinsten Differenzierungen in der Beleuchtung mit wissenschaftlicher Exaktheit feststellen lassen. Man kommt bis zum Erfassen der reinen Farben, die das strahlende Sonnenlicht den Dingen gibt (Pleinair) und gibt selbst sein Vibrieren durch prismatisches Zerlegen (Pointillismus).
Es ist von vornherein anzunehmen, daß die Plastik die Absichten des Impressionismus weniger scharf ausspricht. Ihr fehlt die Möglichkeit, die Raum- und Lichtprobleme zu erörtern, und an der freien Ausgestaltung des Formproblems ist sie durch die notwendigen scharfen Begrenzungen gehindert. So legt man den Hauptton auf eine Modellierung, die nicht wie in der Renaissance die anatomische Struktur des Körpers studiert, sondern seine Oberfläche charakterisiert. Aber jene Begrenzung der plastischen Aufgaben ist der Grund dafür, daß die impressionistischen Skulpturen viel stärker literarische Gedanken und Gefühle aussprechen als die Malerei. Wenn Rodin die Bürger von Calais, die sich selbst in die Hände des Feindes geben, in Bronze formt, so ist das vom Entsagen bis zum Entschluß erstaunlich ausdrucksvoll. Allein das Nebeneinander der Skulpturen ist ganz untektonisch, folgt nicht aus der Struktur der Plastik selbst. Man muß das Mienenspiel sehen, um die Gruppenbildung, das Neben- und Hintereinander der Gestalten zu begreifen. Und es ist ungemein bezeichnend, daß Constantin Meunier, der von allen Plastikern der Gegenwart am fanatischsten das Thema des Arbeiters in der Industrie variiert hat, die kraftvollsten Reliefs und Freiskulpturen für ein Monument der Arbeit schafft, dessen Form noch nicht feststeht. Eine tektonische Zeit würde den Skulpturenschmuck aus der Anlage des Monuments gefolgert haben. Und in der Tat geht diese Bewegung nicht mit der neuen Stilbewegung in den Zweckkünsten zusammen, die funktionelle Klarheit sucht. Ihre Freude an bewegten Kompositionen entspricht vielmehr der überreichen Ornamentarchitektur vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts,[S. 89] mit der sie auch gleichzeitig ist, genau so, wie der spätantike Impressionismus dem hellenistisch-römischen Stil. Der Realismus hat wohl der Architektur das Gewissen für bauliche Ehrlichkeit geschärft, aber ist mit ihr keine Stilverbindung eingegangen.

Der neue Stil beginnt um 1900 auch nicht kraftvoll und zweckbewußt, sondern graziös und zartlinig, gleichzeitig mit der Vorliebe für englische Präraffaeliten, japanische Farbenholzschnitte, Debussy, Maeterlinck und Rilke. Man erkennt zwar, daß das stillose Ornament unschön ist, aber man ersetzt es nur durch ein selbstgefundenes geschmackvolleres und wagt noch nicht, die Formen durch den Zweck bedingen zu lassen. Die französischen Möbel dieser Zeit (Abb. 40) beruhen nicht auf der Formkraft, sondern auf der Linienbewegung, wie die des Rokoko. In flüssigen elegant geschwungenen und gewundenen Linien gleiten die Beine aufwärts in die ebenso weich geschwungenen Umrisse der Platte. Keine Trennung der Glieder, kein festes Aneinanderstoßen; alle Linien gehen aus jeder anderen hervor, in jede andere über. Man hat das Gefühl einer kultivierten, aber kraftlosen Schöpfung.
Von Frankreich und Belgien ausgehend, durch Van de Velde nach Deutschland gebracht, sind die ersten Werke des Stiles bei uns die Häuser, die Olbrich und Behrens 1901 in Darmstadt errichten. Sie sind schon nicht mehr mit Rücksicht auf die Fassade gebaut, sondern die Außenseite wird aus der zweckbedingten Verteilung der Räume, dem Grundriß gefolgert; das Dach wird Abschluß oder Bedeckung. Aber[S. 90] auch hier ist das Flächenornament die eigentliche Neuschöpfung des Stiles, die Verknüpfung und Gliederung. So umziehen breite Ornamentbänder stilisierter Pflanzen, in weiche Kurven gebogen, das Haus Olbrichs, um seiner fensterdurchlöcherten Wand die Einheit zu geben, betont Peter Behrens durch Lisenen aus dunkelglasierten Ziegeln die Umrisse seines Hauses, aber nicht ohne auf schön geschwungene Parallelkurven im Dachgiebel Wert zu legen.
Die Absicht geht nicht auf konstruktive Klarheit, sondern auf harmonische Stimmung, und das spricht sich naturgemäß im Innenraum noch stärker aus als im Außenbau. Nimmt man den Katalog der Darmstädter Künstlerkolonie zur Hand, so findet man bei jedem Raum ein erklärendes Wort über seine Stimmung, fein stilisiert wie ein Gedicht in Prosa. Heute erscheint es uns schon etwas seltsam, Zimmer zu denken, die ihren Bewohnern die Stimmung vorschreiben, anstatt sie von ihnen zu empfangen. Allein das entspricht dem Geschmack einer Zeit, in der Melchior Lechter den Pallenberg-Saal des Kölner Kunstgewerbemuseums schafft, ein Zimmer, durchleuchtet von tieffarbigen Glasfenstern, geschmückt mit symbolischen Gemälden und Skulpturen, mit Sprüchen von Nietzsche und Stephan George, ein Zimmer, das überhaupt nicht zum Bewohnen geschaffen wurde, sondern als ein von weihevoller Stimmung durchfluteter Raum. Diese Stimmungseinheit, durch überall sich verschmelzende Formeinheit ausgedrückt, ist das Gesetz dieses Übergangsstiles. Kein Möbel ist ohne Beziehung zum nächsten, zur Wand, zur Decke, zum Nebenraum. So führt die Täfelung mit ihrem zart holzfarbenen, flächigen Intarsiaschmuck gleitend über die Wandfläche hin, läßt sie allmählich „verklingend“ in die Decke übergehen und ummantelt die Ecken. Wie Ornamente wachsen die Möbel aus diesen Wänden hervor (Abb. 40), wie Blumen liegen Kissen auf ihnen. Vasen stehen umher, die in feingeschwungener Kurve vom Boden bis zum Rand aufsteigen und im Dekor, in Farbe und Form von der Feinheit der japanischen Keramik sind, die gerade hier vielfach Vorbild war. Aber sie sind, wie die Köpping-Gläser, nur um dieser Zartheit willen geschaffen, nicht als Gerät, und es ist ungemein bezeichnend, daß die Keramik der Zeit sich nicht am Hausrat, sondern am Ziergerät, vor allem an den Vasen entwickelt hat. Allmählich beginnt man, die Tektonik der Fläche zu empfinden, umkleidet das Glas mit undurchsichtiger irisierender Masse und bevorzugt in der Keramik das Steinzeug. Man sieht, der entscheidende Schritt ist getan. Dem Zurückführen[S. 91] vom überreichen, selbst wirren Ornament zum gut empfundenen liegt bereits ein Zweckbewußtsein zugrunde. Niemand hat gerade dieses Gefühl stärker besessen, als Van de Velde. Wie seine Möbel im Material die sachlichsten sind, so hat er dem modeverschnürten Körper der Frau im ruhigen Fluß des Reformkleides neue Schönheit zu geben gesucht. Er besaß schon damals das Empfinden für die Zweckschönheit der Maschine, die bisher als nüchtern und häßlich galt, und seine Schriften, interessante Denkmale der Zeit, sprechen von „hoher Kunst“, von Plastik und Malerei, schon fast wie von einem Zersetzungsprodukt in der Entwicklung der Kultur. Das war bedeutungsvoll, da dadurch die Zweckkünste wieder gleichberechtigt in die Reihe der übrigen Künste eintraten.
Es war keine Frage, daß hier konstruktive Tendenzen sich entwickeln mußten, um so mehr, als in jener Feinfühligkeit eine Gefahr lag. Diese Kunst war durchaus aristokratisch, ihre zarten Formen nur in den Händen der feinsten Empfinder ausdrucksvoll. Da in ihr das Ornament als Stilinhalt, nicht aus dem Zweck geformt, eine so selbständige Rolle spielte, so übernahmen Handwerker und Gewerbezeichner nur die ornamentale Form und verwandten sie ebenso unsinnig, wie bis dahin die Motive der Renaissance und des Barock. Das deutsche Handwerk in seinem weitesten Umfang hatte nur einen neuen Ornamentstil gewonnen, und in seinen Vorlageheften figurierten neben den historischen Stilformen nun auch diese Formen des sog. Jugendstiles, übel stilisierte und ärmliche, endlos lange Linien, aus denen in diesen groben Händen jedes feine Gefühl verschwunden war. Sie gehen ins Buchgewerbe über und in die Tapetenmuster, werden, in Eisen getrieben, als Gitter verwandt und als Stuckornament an die Häuser geklebt. Daß man an Stelle der Rokoko- und Barockmöbel in den Salons jetzt die einfacheren Louis XVI.- und Biedermeierformen zu kopieren beginnt, war immerhin ein kleiner Fortschritt. Aber im allgemeinen tritt doch nur eine Stillosigkeit an die Stelle einer anderen.
Die Forderungen, die Industrie und Handel an die Kunst stellten, Fabriken und Eisenwerke, Warenhäuser und Ausstellungshallen, galten dem an historischen Bauten erzogenen Auge als unschön, Beton und Eisenträger als nüchtern, und man war bestrebt, sie nach Möglichkeit zu Renaissancepalästen umzumaskieren. Das neue Sehen erkennt in ihnen die monumentalen Werte der Zeit. Ihr Maßstab duldet kein Ornament, ihr Material verlangt die reinste Form. Es hat ein Jahrzehnt[S. 92] gedauert, bis diese Erkenntnis reif war. Messel, um die Jahrhundertwende tätig, ist fast noch Klassizist. Seine Wohnhäuser, selbst sein Darmstädter Museum, sind nur wandmäßig gebundenes Barock, sein Wertheimhaus ist zur Zweckform verdichtete Gotik. Behrens beginnt in Darmstadt persönlicher und gelangt nach der kurzen Episode einer Flächentektonik zum modernen Raumstil. Seine Turbinenfabrik (Abb. 41) ist bereits Anfüllen des Bauraumes in seiner Tiefe, und seine Gliederung nach Funktionen. Die Wand ist Raumbegrenzung — hohe, lichtaufnehmende Glasfenster zwischen Eisenträgern. Die Ecken sind von starken, nach oben sich verengenden Betonpfeilern akzentuiert. Auf diesen Trageformen ruht, durch starkes Vorkragen abgesondert, ein Dach von stark beschwerter Silhouette, das Spannung verhüllt, und wie Last und Abschluß wirkt. Doch hat das Ornament bis auf die Pseudo-Rustika an den Betonpfeilern endgültig jeden Wert verloren, und es ist ernst damit gemacht, die Form als Zweckausdruck zu sehen. Und mit Poelzigs Bauten stellt sich neben den Analytiker Behrens eine Architekturphantasie, die nicht nur den Zweckforderungen gerecht wird.
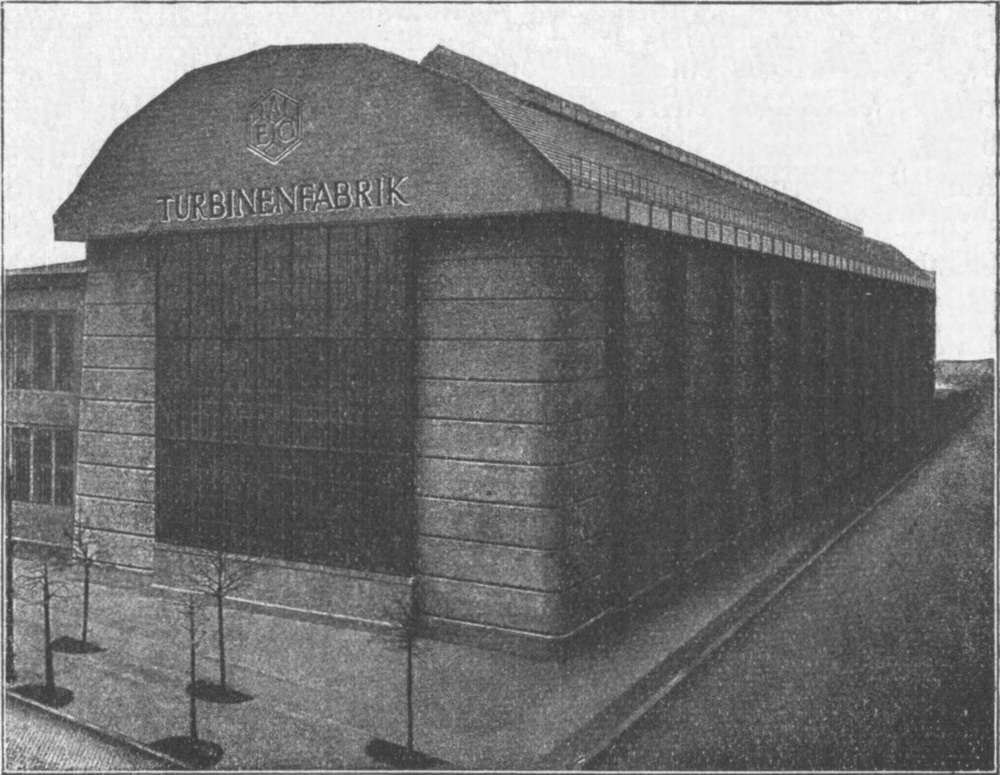
[S. 93]
Damit werden auch die alten Aufgaben neu definiert. Villa und Wohnhaus werden von Muthesius, Geßner und Tessenow neu untersucht, Grundrißverteilung und Aufbau nach dem Bedürfnis bestimmt. Ihre Möbel (Abb. 42) sind in Stimmungs- und in Stileinheit mit den Bauten. Stühle und Tische von ihnen, von Bruno Paul und Heidrich stehen, ihre Teile fest gegeneinander begrenzend, auf stark geformten tragenden Beinen. Ja, Riemerschmied in München geht geradezu bis zur sichtbaren Zerlegung der Struktur des Möbels, um die tektonische Klarlegung zu erzielen.
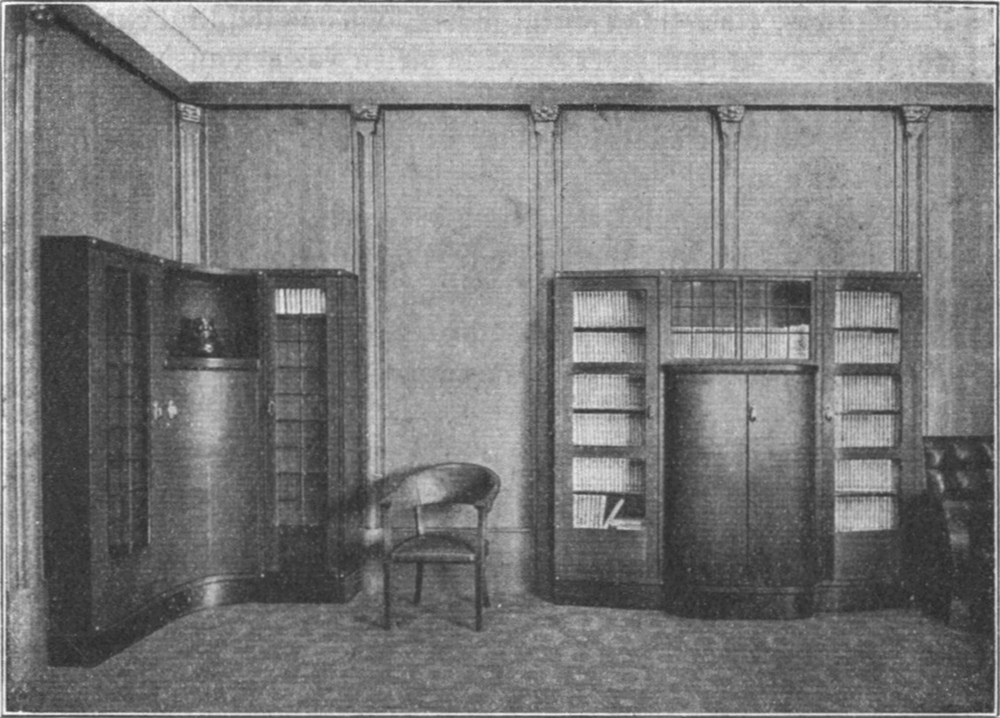
Diesen Stil heute schon nach seinen Absichten und Formen zu definieren ist natürlich unmöglich. Alles ist noch im Fluß, und von den vielen Stilformen unserer vielen Künstler hat noch keine das Recht, für kanonisch zu gelten, zumal fast überall unwillkürlich klassizistische Reminiszenzen mit im Spiel sind. Wir ahnen wohl das Ziel der modernen Bewegung, aber es erscheint noch nicht klar und der Weg ist noch von vielen anderen Spuren gekreuzt. Noch wissen wir nicht, wie die Stilformen aussehen werden, die für das moderne Gefühl so notwendiger Ausdruck sind, wie die romanischen Formen für die Kirche[S. 94] des Mittelalters. Aber sicher scheint zu sein, daß das Resultat ein Zweckstil sein wird, wenn auch jeder Zweck in vielen Formen ausdrückbar ist.
Auch die Entwicklung der Malerei deutet darauf hin. Schon spricht man von der Naturform wie von einer Fessel, sucht das Bild auf Linienrhythmen aufzubauen, die es zum tektonischen Teil der Wandfläche machen. Cézanne begann mit Verdichtung der Form, Hodler mit dem Flächenrhythmus der Linien, und eine ganze Generation ist eben jetzt am Werk, die Anschauung auf dem Gesamtstilgefühl aufzubauen, an Stelle der Darstellung von Naturdingen das „Bild an sich“ als Endzweck zu suchen, wie der Künstler des romanischen Stiles.
Die Stilerscheinungen, die wir vom Beginne menschlicher Kultur bis in unsere Zeit überblicken konnten, sind so mannigfaltig, daß sich ein objektiver Standpunkt zu ihnen zunächst schwer zu finden scheint. Fraglos ist, daß unser Begriff von Schönheit durchaus relativ und hier überhaupt nicht verwendbar ist. Nicht nur die Meinungen der einzelnen Menschen gehen hierüber weit auseinander, sondern auch die Meinungen der Epochen. Es genügt, darauf hinzuweisen, wie jede Zeit eine andere Epoche des griechischen oder römischen Altertums als edelste Schönheit empfand, von unserer Liebe zu den straffen Gebilden des frühdorischen Stiles bis zur Vorliebe des Barock für die Werke der spätrömischen Kunst. Der Begriff „Schönheit“ ist nichts weiter als ein subjektives Werturteil, gefällt auf Grund unseres Gefühls und der Erziehung unserer Augen.
Unsere von den Erscheinungen ausgehenden Beschreibungen der Stile, die jedes Werturteil nach Möglichkeit vermieden, ergaben für den Verlauf der Entwickelung drei Stilstufen, die aber jedesmal ohne feste Trennung ineinander übergehen.
Die gebundenste ist die tektonische Form. Dies Wort kann nicht so verstanden werden, wie es oft angewandt wird, daß die Kunstwerke in ihrer subjektiven Bauabsicht gut und klar durchgeführt sind — das ist jede gute Architektur, und in diesem Sinne sind auch der gotische Dom und die Barockkirche tektonisch —, sondern daß sie es objektiv, vom Standpunkt der Bauaufgabe aus sind. Es kommt darauf an, daß jeder Bau für einen notwendigen Zweck geschaffen, sein Grundriß durch[S. 95] diesen bestimmt ist, daß die Innenanlage wiederum den Außenbau bestimmt, somit der ganze Bau in Harmonie mit seinem Zweck und auch die Einzelgliederung durch die Baufunktionen bedingt ist. Klar und übersichtlich drücken die Teile das Tragen und Lasten, Begrenzen und Ordnen aus, in Wand und Säule, Dach und Turm und den anderen Baugliedern, denen sie anvertraut sind. Wie die Säule Stütze, bleibt die Wand Fläche, und die Lagerung der Steinschichten dem Gesetz der Schwerkraft gemäß bedingt, daß die Horizontale die wichtigste Baulinie ist. Das Ornament, aus derselben Baulogik gewonnen, ist nicht äußerlich angeklebter Schmuck, der dem Bau willkürliche Bewegung mitteilt, sondern sachlicher Ausdruck des Steines, der es trägt. Dessen zweckliche Ruhe betont seine Flächenhaftigkeit, die nirgends aus der Wand herausdrängt. Selbständigen oder gar naturalistischen Ausdruck kennt es nicht, und es entspricht der mathematischen Logik der Flächendimensionen, daß seine Ausdrucksform allein die lineare ist.
Genau dasselbe Gesetz gilt im Kunstgewerbe. Alle Geräte unterscheiden funktionsgemäß, welcher Teil zum Stehen dient und welcher zum Bewahren des Inhaltes. Alle stehen fest auf dem Boden, am liebsten mit runder Platte, als saugten sie sich an ihn an. Das Material kommt in der Oberfläche voll zum Ausdruck: Ton wird nicht glasiert, Holz nicht fourniert und, damit die Tafel einheitlich bleibt, kaum in Rahmen und Füllung geschieden.
Zwecklose Dinge existieren nicht, Prunkpaläste, die nur der Repräsentation dienen, Prunkgeräte ohne Gebrauchswert werden nicht geschaffen. Stile von so konstruktiver Art sind der dorische Stil des griechischen Altertums, der romanische des Mittelalters, die früheste Renaissance in Italien. Sie entstehen jedesmal aus einer dumpfen Vorform, die schon das tektonische Gefühl, aber noch keine tektonische Gliederung hat, die Teile schon sondert und festhält, aber noch nicht funktionell durcharbeitet. Dahin gehören der Dipylonstil, der frühchristliche Stil und die Profangotik in Italien.
Die pathetisch bewegte Form löst diese strengen Grenzen auf. Der Bau ist kein Ausschnitt aus dem Weltraum mehr, sondern ein Teil seiner Ausdehnung. Man liebt den feierlichen Schritt großer Fronten und Säulenreihen, hohe Stufenbauten, Kuppeln und steigende Türme. Jeder Bauteil ist in Bewegung, schreitend, steigend oder fallend, und an den nächsten angeknüpft. Das Ornament wirkt dabei als wichtiger Faktor mit. Es betont nicht mehr die Funktion des Bauteils, sondern[S. 96] löst ihn in plastischem Hervorquellen auf und führt ihn über sich hinaus. Auch die Fassade ist nicht mehr Mantel um den Innenraum, sondern Einleitung zu ihm und aufgelöst, um wieder zusammengefaßt zu werden. So ist der Bau selbst über seine Grenzen in den Raum erweitert, um mit ihm zusammenzuwirken; durch ansteigende Gewölbe, lichte Kuppeln oder Raumtiefe vortäuschende Deckengemälde im Inneren, durch Vasen, Statuen und Türme über der Dachlinie gegen den Luftraum und durch Stufenbauten, Arkaden und Alleen mit seiner Umgebung zusammengeschlossen. Zugrunde liegen Gefühle, die durch die Kunst seelischen Stimmungen den Ausdruck geben wollen. Es ist nur ein Symptom für diese starke Raumauflösung, wenn hier die vertikale Tendenz, die doch der natürlichen Schichtung der Steine widerspricht, an die Stelle der horizontalen getreten ist.
Im Kunstgewerbe wirken dieselben Kräfte. Der Becher wird zum Pokal und zum prunkvollen Tafelaufsatz, die Truhe zum Schrank und seine Wand zur architektonischen Fassade. Man löst die Flächen in plastische Bewegungen auf, und faßt sie in großen Linien wieder zusammen; man bestimmt die Oberflächenwirkung nicht mehr durch das Kernmaterial, sondern deckt das Holz durch Fournierung, den Ton durch glänzende Glasuren, wenn nicht überhaupt das transparente Glas eintritt, das jede Wandfestigkeit negiert. Dieser Stilform gehören der hellenistische Stil mit dem frühen römischen, die hohe Gotik und das Barock an.
Die richtungslos bewegte Form treibt diesen Reichtum ins Phantastische. Da die Verstärkung der Bewegung im Baukörper selbst kaum noch möglich ist, ohne die Festigkeit zu gefährden, wird das Ornament ihr Träger. Hemmungen durch den Zweck oder die Disziplin bestehen nicht mehr, die Phantasie schaltet völlig frei und ist so reich, daß das Ornament in kleinste Teile zerspalten wird, jeder von neuer Form und in freier Bewegung mit dem nächsten verflochten. Gerade Linien vermeidet man und liebt die wirbelnde Drehung. Jeder Kurve entspricht eine Gegenkurve, jede Tiefe hebt eine Höhe auf, Begegnungen verflechten sich und lösen sich in Wirbeln. Einheimische und exotische, stilisierte und realistische Formen, Natur- und Architekturelemente stehen im selben Wandteil nebeneinander, und ihre Kurven geben der Wand für das Auge eine Tiefenbewegung, die sie selbst mit Rundungen und Ausbauchungen begleitet.
Das kunstgewerbliche Gerät, dessen Formen durch diese Freude am Reichtum zahllos vermehrt werden, wächst aus dem Zimmer heraus[S. 97] wie ein Teil des Ornaments. Es wird vom Boden aufgehoben, auf Ranken federnd oder auf hohen Füßen gleichsam balanzierend, indem es sich von schmaler Basis nach oben verbreitert. Seine Struktur wird weiter zerstört durch malerisches Auflösen der Wandungen in Gegensätze heller und dunkler Flächen, in tiefschimmernden Emails und Glasuren und in plastischen Modellierungen, denen die Kurven frei aufgelegter Ranken begegnen.
Stile dieser Art sind der spätantike Stil, die Spätgotik, das Rokoko.
Und so ergibt sich, daß sich in der geschichtlichen Reihenfolge der abendländischen Stile, vom kretisch-mykenischen angefangen bis zum 19. Jahrhundert, dieser Zirkel der drei Stilformen dreimal wiederholt, je einmal die Entwicklung in Antike, Mittelalter und Neuzeit durchführend. Es ist auffallend, wie ähnlich die Symptome an den entsprechenden Stilpunkten in den drei Zeitaltern sind. Auf vieles wurde schon hingewiesen; aber wie überraschend ist beispielsweise das Vorkommen der gedrehten Säulen an römischen Kandelabern, im spätgotischen nördlichen Seitenschiff des Braunschweiger Domes und an Barockaltären oder die Gefühlsverwandtschaft der spätantiken Verroterie, der auf rotem Grund aufgelegten zerpflückten Metallbeschläge spätgotischer Truhen und der Bouletechnik! Die stilgeschichtliche Bewegung ist also eine vollkommene Wellenbewegung zwischen strenger und freier Form. Sie fließt vom dorischen Stil zum spätrömischen, vom altchristlich-romanischen zum spätgotischen, von der italienischen Profangotik bis zum Rokoko. Wenn uns eine Periode als Aufstieg und eine andere als Niedergang erscheint, so trägt allein unsere Abhängigkeit vom eigenen Geschmack die Schuld. Wertet man objektiv, so ist die Kunst jeder Periode als Ausdruck ihres besonderen Schönheitsgefühls der jeder anderen gleichwertig.
Daraus folgt, daß unsere Stilbenennungen objektiv unrichtig sind, insofern sie bloße Klassifikationen von Erscheinungen sind, zwischen denen sich Grenzen eigentlich nicht recht ziehen lassen; aber auch subjektiv sind sie falsch, weil, wenn man überhaupt klassifizieren will, man die Bewegung vom konstruktiven Beginn bis zum ornamentalen Abschluß als einheitlich zusammenfassen muß. Wir sind hier überaus inkonsequent; wir unterscheiden in der mittelalterlichen Stilbewegung nur zwei Hauptformen, nämlich Romanisch und Gotisch, in der ganz parallelen Bewegung der neuen Zeit aber mindestens acht Formen, von der Renaissance bis zur sog. Stillosigkeit des 19. Jahrhunderts. Es[S. 98] ist absolut notwendig, diese einzelnen konventionellen Benennungen, die obendrein selbst als Worte nicht immer verständlich sind, zu verlassen und von größeren entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten aus etwa von der antiken, der mittelalterlichen, der neuzeitlichen Stilbewegung zu sprechen.
Faßt man die Linie so, dann ergibt sich auch für Plastik und Malerei ein Verhältnis zu den Stilbewegungen, das nach der bisher üblichen Methode, die nur von freigeschaffenen Werken ausging, garnicht zu gewinnen war. Es ist gar keine Frage, daß sie im Anfang jeder Stilwelle nicht selbständig gewertet werden wollen, sondern wie die Baukunst den Gesetzen des Zweckes untergeordnet sind; ihre wichtigste Aufgabe ist die architektonische Dekoration. Hier stehen sie unter demselben Gesetz wie das Ornament: die Plastik als an die Fläche gebundene, figurale Dekoration oder als Flachrelief, die Malerei als linear geführte Wandmalerei, beide durch die Architekturanlage bedingt und ihrer Klarheit dienend. Die Wand ist nicht nur Bildgrund, sondern Bildteil und Bildgrenze und die Komposition daher friesartig. Jede Gestalt steht für sich, und die Gruppe ist eine Aufreihung paralleler Gestalten. Wo die Einzelfigur erscheint, beim Grabmal etwa, ist sie Denkmal und dadurch gebunden. Dem entsprechend ist das Interesse am Erfinden neuer Formen nicht sehr groß; die Tradition herrscht, und die Disziplin eines auf die Tätigkeit konzentrierten Willens hemmt die Phantasie ebenso wie der Mangel an Stoffen infolge der Interesselosigkeit für die umgebende Welt. Was wir „Seele“ nennen, scheint das früheste Hellas und der Mensch der romanischen Kunst vielleicht nicht einmal gekannt zu haben. Den Ausdruck gibt die Kraft des Linienstiles, und er ist ebenso reich an Form wie die freieste Modellierung. Allein hier tritt dieselbe Bewegung ein wie in der Architektur; die Gebundenheit der Gestalten beginnt sich durch eine Bewegung zu lösen, die ihre Grundlage im sich ausbreitenden Raumgefühl hat, das die Zweckbedingungen negiert und die Flächen allmählich sprengt. Wir sahen oft genug, wie die Bewegung, die sich bei der einzelnen Gestalt schließlich bis zum Fixieren des Momentanen steigert, im Raum zur Gruppenbildung führt, also zu einer Verknüpfung der Teile, die der in der Architektur ganz parallel läuft, bis das Hochrelief und die freie Form in der Plastik und die freie Modellierung in der Malerei den letzten Rest von tektonischem Flächenbewußtsein brechen. Wie der Ausdruck der Form steigert sich der des Gefühls, und wie Ruhe und Bewegung[S. 99] werden Pathos und Weichheit. Und immer reicher erfindet die befreite Phantasie Stoffe, Gebilde und Formen. Die letzte Phase verhilft dem Gefühl und der Form zu noch feineren Differenzierungen, sie ist einerseits naiv, andererseits sentimental im Sinne Schillers, die realistische und die zugleich eigentlich romantische Periode, die daher, archaisierend, gern Werke strengerer Zeiten nachbildet, als könnte sie dadurch ein innigeres Gefühl aussprechen als ihr eigenes. Entsprechend werden die Formen zarter, die Kurven weicher und das Relief flacher, um nach Art der Malerei die tiefsten Raumwirkungen allen vom Material geforderten Beschränkungen zum Trotz vorzutäuschen. Diese Art des Flachreliefs ist natürlich ebensowenig tektonisch wie das Vorhandensein einer Fläche unter dem zerstörenden Ornament des Rokoko. Entsprechend dieser malerischen Plastik findet die Malerei selbst jetzt ihren räumlich freiesten Ausdruck im Impressionismus. Dabei muß betont werden, daß zeichnerische und malerische Darstellungsweise, wie Wölfflin[1] diese Worte braucht, beide diesen Spätperioden gehören, die erstere mehr der zweiten, die letztere mehr der dritten Stilphase vorbehalten. Die Ausdrucksform der ersten, strengsten Periode, die auch von zeichnerischer Art ist, ist bisher unerörtert geblieben, weil eben die Tendenz besteht, unter Malerei und Plastik nur die künstlerisch freien Zeiten zu verstehen. In der Tat ist der Grundsatz l’art pour l’art der jeder untektonischen, von Sachbedingungen freien Epoche. Während im tektonischen Beginn der Bewegung die Zweckkünste herrschen, treten im Ausklang diese, mit einer gewissen Arroganz „hohe Kunst“ genannten Kunstübungen mindestens gleichberechtigt, oft bevorzugt neben sie. Interessanterweise ergab es sich, daß beim Beginn der dorischen Epoche wie der romanischen und der Renaissance diese beherrschende Stellung noch fortdauert, obgleich die konstruktiven Tendenzen in Architektur und Kunstgewerbe bereits zum Durchbruch gekommen sind.
[1] Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. München 1915.
Das Gesetz der drei Stilphasen gilt also auch für die sogenannten „freien Künste“, die in denselben Zeiten frei sind, in denen die Zweckkünste phantasievoll gestalten, und in denselben Zeiten gebunden, in denen auch diese bedingt sind. Aber man darf dieses ganze Gesetz in seiner Wichtigkeit nicht überschätzen. Innerhalb seiner hat jede Menschheitsperiode ihre eigene künstlerische Gesinnung. Das Mittelalter ist dumpfer, unbestimmter in all seinen Ausdrucksformen als die in der[S. 100] Klarheit großer Anschauungen schaffende Antike, beide aber sind stärker vom Stilgesetz abhängig als die neuzeitliche Bewegung, die in ihrer Gesinnung sehr persönlich ist und den Eigenwert der Dinge betont. Trotzdem ist der Unterschied vom Stilstandpunkt aus gesehen nur graduell; das Gesetz gilt auch hier, und so trägt die gesamte Kunstgeschichte nicht den Charakter einer fortlaufenden Entwicklung, sondern den einer Wellenbewegung.
Aber das Stilwerden selbst aus den bloßen Erscheinungen erklären zu wollen, erscheint so unmöglich wie alle rationalistischen Ausdeutungen tief seelischer Phänomene. Man hat versucht, das Stilgefühl der Zeit von Haltung und Kleidung des Menschen abzuleiten, und dabei nicht bedacht, daß gerade sie Glieder des Kunstschaffens sind, ein plastisches Bilden des eigenen Leibes. Wie in der zierlichen Eckigkeit des Gerankes äußert sich das spätgotische Schönheitsgefühl auch darin, daß die spitze Stuhlecke zwischen den Beinen sitzender Männer hervorsieht, oder der Präsidentenstuhl einer Gerichtssitzung nicht, wie in der Renaissance, an der Langseite, sondern in einer spitzen Ecke steht, als wäre dort der ausgezeichnetste Platz. Und verlangt nicht der hellenistische Spiegel wie der kleine Henkel der Rokokotasse ein elegantes Fassen mit spitzigen Fingern?
Man hat das Stilwerden ferner auf die Entwicklung der Technik, den Stilausdruck auf das Material zurückführen wollen. Aber auch das führt nicht weiter. Denn es erklärt nicht, warum sich Materialien, die so verschieden sind wie Stein, Holz, Silber und Fayence im selben Zeitalter völlig gleichartig verhalten, und öffnet wiederum die Frage nach der Ursache für die Entwicklung der Technik. Nein, es ist völlig unmöglich, den Stil von außen her zu erklären. Vielmehr macht sein Geschmack Material und Technik zu seinen Werkzeugen, wählt den Werkstoff, der seinen Absichten entspricht, und die Technik, die sie am besten in ihm herausarbeitet. Wie lange hat nicht das Rokoko sich um das Porzellan gemüht, dessen Schmiegsamkeit es als keramisches Ziel immer vor Augen sah! Nein, die griechische Plastik ist um 550 nicht dadurch verfeinert worden, daß sie in Marmor zu arbeiten begann, während sie bisher den groben Muschelkalk verwandte, die Gotik hat nicht das durchsichtige Email um des schimmernden Silbergrundes willen verwandt. Vielmehr hat die hellenische Skulptur zu dem edleren Werkstoff gegriffen, weil ihren neuen Absichten der grobe nicht mehr genügte, hat die malerische Gotik den Silbergrund verwandt, um die[S. 101] Farbenwirkung des durchsichtigen Schmelzes zu steigern. Wenn tatsächlich die Verwendung von Stuck am Ende des 12. Jahrhunderts die strengen Formen der romanischen Plastik gelockert hat, hat er dann auch die Rokokoranke geschaffen oder hat nicht vielmehr in beiden Fällen der beweglich gewordene Stil zu dem gefügigen Material gegriffen, wie das Rokoko zum Porzellan? Nur dadurch, daß der Stil Material und Technik bedingt, ist das seltsame Paradox erklärlich, daß die Hausteinkirchen der Spätgotik eleganter sind als die ernsten Gotteshäuser, die die strengen Stämme Norddeutschlands in weichem Backstein bauten, ebenso wie das Berliner Barock gehaltener ist als das Münchener, das Rokoko von Sanssouci trockener als das von Würzburg. Gerade das aber erweist, daß die Eigenschaften des schaffenden Volkes von starkem, ja maßgebendem Einfluß auf die Formgestaltung sein müssen.
Für das Stilwollen ist also das Schönheitsgefühl, der Geschmack die ästhetische Grundlage. Es sichtet, siebt und ordnet die von den Augen gesammelte Vorstellungswelt des Künstlers für das neue Werk. Auch unsere drei Stilkategorien, obgleich vom Verhältnis der Stile zum Zweck hergeleitet, sind doch nicht äußerlich zu verstehen. Denn es gibt kein Kunstwerk, kein geformtes Werk überhaupt, bei dem nicht zwischen Absicht und Ausführung das Schönheitsgefühl oft unbewußt mittätig ist. Objektiv genommen ist das freie Kunstwerk ebenso vom Stilgesetz gehemmt wie das dem Zweck unterworfene, und dieses nicht mehr gefesselt als jenes. In beiden Fällen sind gleich viel Formen denkbar und nicht nur theoretisch. Hat man sich einmal in die besondere Schönheit etwa der romanischen Buchmalerei eingefühlt, so ist man erstaunt über den Reichtum in der Strenge, der sich hier offenbart. Während sich aber die Empfindung des Künstlers in den tektonischen Stilen nur auf das zu schaffende Werk konzentriert, entwickelt sie sich von hier aus immer reicher, spaltet Gefühlselemente ab, differenziert sich, nimmt Elemente aus der Verstandeswelt und aus anderen Nichtgefühlskreisen auf. So werden schließlich Empfindungen ausgedrückt, die nicht mehr rein ästhetisch sind, sondern auf Stimmungsausdruck abzielen.
Dieser Gefühlsweg ist ganz einheitlich, und das erklärt, warum sich alle Künste gleichartig verhalten. Malerei und Plastik sind nicht von der Baukunst abhängig, sondern von denselben Gefühlen wie sie, und werden bewegt und sentimental, sobald auch der Bau nicht mehr seinen Zweck, sondern Gefühle ausdrücken will.
[S. 102]
Nun versteht man auch, warum die Kunst nicht mit dem Zweckgefühl beginnt, sondern in den Steinzeithöhlen und in Kreta mit sehr freiem „impressionistischem“ Gestalten. Doch offenbar, weil Auge und Gefühl bei Menschen, die mit der Natur unmittelbar zusammenhängen, weil sie überall von ihr abhängig sind, sehr viele Eindrücke empfangen müssen, die sie aber noch nicht zu vereinigen verstehen, während erst nachdenklichere, bewußtere Zeitalter das Interesse am Ordnen des Kunstwerks haben.
Trotz alledem bleibt die Einheitlichkeit aller dieser Vorgänge rätselhaft. Warum ist das Schönheitsgefühl aller Menschen einer Zeit im Grunde genommen dasselbe, ein Stil? Warum findet auch der begabteste Künstler eine Schranke für seine künstlerische Freiheit im Geschmack seiner Welt und unterwirft sich ihm unbewußt und im Glauben, er schüfe völlig Neues? Schinkel, Semper, Van de Velde haben alle in ihren Schriften das tektonische Programm aufgestellt, und doch sind die beiden ersten Eklektiker und die Werke des letzteren ersticken in den Schlangenwindungen seines Ornamentes. Warum macht ferner diese Stileinheit nicht nur als Ganzes eine Entwicklung durch, sondern vollzieht sich diese so gesetzmäßig, mehr als dreimal schon in der von uns überblickten Spanne der Kunstgeschichte?
Daß sich Parallelerscheinungen in anderen Gebieten menschlichen Schaffens finden, daß Religion, Musik, Literatur und selbst die Wissenschaft sich ebenso und in denselben Perioden von der Enge zur Freiheit entwickeln, ist keine Begründung für die Wege der Kunst. Die ganze Gesinnung ist eben in der Frühzeit einfach und „naiv“, in der Spätzeit kompliziert, „sentimental“ und selbst ekstatisch. Keine dieser Parallelen ist von der andern abhängig, sondern alle beruhen auf der gemeinschaftlichen Entwicklung der menschlichen Gefühlskomplexe.
Nun ist aber der Mensch, der Träger dieser Empfindungen, selbst kein Einzelwesen, sondern sozial geordnet, Glied einer Gemeinschaft, die in Bedürfnissen, Neigungen, Befriedigungen verflochten und abhängig von allen ihren Gliedern ist. Was wir Stil nennen, bezeichnet die künstlerische Gefühlsgemeinschaft als dem Gefühl des Einzelwesens übergeordnet. Schon oben ergab sich die Wichtigkeit der Eigenschaften des kunstschaffenden Stammes für das Kunstwerk. Sie bedingt es, daß sich italienische Bilder von deutschen oder niederländischen prinzipiell unterscheiden. Noch interessanter ist, daß unser ganzes Stilsystem offenbar nur für die arischen Völker gilt. Ägypten verhielt sich nur ähnlich, aber keineswegs gleich, und wenn es von einer Art Tektonik herkommt, so endet es nicht im Ornament, sondern in dumpfer Schwere.[S. 103] Mesopotamien, Indien, China, Japan, die Negervölker und die amerikanischen Urstämme verhalten sich gänzlich anders.
Und nun kennt die soziale Struktur Entwicklungen von ähnlicher Art wie die Kunst. Ich spreche dabei nicht von der Regierungsform, sondern von der Schichtung des Volkes in sich. Man kann sagen, daß die frühe Antike und das frühe Mittelalter Völkern angehören, deren Aufbau ziemlich einheitlich ist. Große Unterschiede an Besitz und Bedürfnis werden nicht bestanden haben. Gerade daß die Vorrenaissance sich auch hierin etwas anders verhält, erklärt ihre künstlerisch freiere Artung. Später setzen sich Schichten ab, der Besitz sammelt sich in immer weniger Händen, einzelne Schichten sinken auf den Grund, andere tauchen empor, bis schließlich eine dünne Oberschicht über einer großen Masse wenig Begüterter lagert. In ihr sammelt sich nicht nur der Reichtum, sondern auch das Bedürfnis nach Wissenschaft, Prunk und Behaglichkeit. Von solchen Schichtungen ist aber die Kunst direkt abhängig; wenn auch das Schönheitsgefühl des Künstlers ihre Werke schafft, so ist sie doch Ware, abhängig, oft unbewußt, vom materiellen und religiösen Bedürfnis. Dies ist in der Frühzeit einfach und der Gesamtheit gemeinsam, und so erklärt sich ihr geschlossenes Stilbild und die Einfachheit, um nicht zu sagen Armut, seiner künstlerischen Glieder. Aber im selben Maße, wie für die geringer begüterten Volksteile die Kunst überhaupt ausschaltet, wird sie für die Reichen zum Bedürfnis. Jeder tektonische Stil ist echt sozial, weil die Schlichtheit seiner Formen auch dem Ärmsten jede Stilschönheit gönnt und sie auch der letzte Handwerker in gleicher Folgerichtigkeit und mithin Schönheit schaffen konnte, ja mußte. Der ornamentreiche Stil dagegen erlaubt nur dem Begüterten den vollen Genuß seiner Stilschönheit; in ihm werden die Arbeiten des Handwerkers, wie Bauernrokoko und Jugendstil lehren, immer minderwertige Produkte sein, da sein einfacher Sinn ihn die komplizierten Formen nicht in all ihrer Feinheit wird empfinden lassen.
Liegt also der Stilentwicklung ein soziales Gesetz zugrunde, so wäre es nötig, jenes zu begründen, um dieses zu verstehen. Dann wird vielleicht klar werden, warum auch die Geschichte Parallelgänge zeigt, sie, die ja im eminentesten Sinne von der Struktur der Völker abhängt. Es ist eine historische Probe aufs Exempel, daß die großen Völkerkatastrophen, wie die dorische Wanderung, die Völkerwanderung und der Krieg, den wir eben jetzt erleben, genau an dem Punkt stehen, wo eine Stilwelle die andere ablöst.
[S. 104]
|
Abb.
|
Seite
|
|
|
Florenz. Palazzo Vecchio. Aufnahme der Neuen
Photographischen Gesellschaft A.-G., Berlin-Steglitz
|
6
|
|
|
Florenz. Palazzo Strozzi. Nach Photographie von Brogi
|
8
|
|
|
Rom. Fenster der Cancelleria. Nach Photographie
|
9
|
|
|
Venedig. Markusbibliothek. Nach Photographie von Brogi
|
11
|
|
|
Florentiner Truhe. Nach Cornelius, Elementargesetze.
2. Aufl.
|
13
|
|
|
Ghirlandajo. Abendmahl. Nach Photographie von Alinari
|
16
|
|
|
Lionardo da Vinci. Das Abendmahl. (Die Veröffentlichung
verdanken wir der Freundlichkeit des Herrn Prof. Vogel vom Museum der
bild. Künste in Leipzig.)
|
17
|
|
|
Michelangelo. Erschaffung Adams. (Rom, Sixtinische
Kapelle.) Nach Photographie
|
19
|
|
|
Saalfeld. Rathaus. Nach Photographie von Zedler und
Vogel, Darmstadt
|
21
|
|
|
Albrecht Dürer. Der heilige Hieronymus. Kupferstich
|
23
|
|
|
Niederrheinische Schnelle. Aus Haendcke, Deutsche Kunst
im tägl. Leben. 1908
|
24
|
|
|
Dürer. Der Sündenfall. Kupferstich
|
26
|
|
|
Peter Vischer. Sebaldusschrein (sog. Sebaldusgrab) in
Nürnberg, St. Sebald. Nach Photographie
|
28
|
|
|
Gotischer Pokal von 1462 in Wiener-Neustadt. Nach
Photographie
|
30
|
|
|
Buckelpokal aus Lüneburg. Nach Photographie
|
32
|
|
|
Zimmer aus Schloß Höllrich. Aus v. Falke, Geschichte
des deutschen Kunstgewerbes
|
33
|
|
|
Lübeck. Täfelung im Fredenhagenschen Zimmer. Nach
Lübeck, seine Bauten und seine Kunstwerke
|
34
|
|
|
Braunschweig. Gewandhaus. Nach einer Aufnahme der Neuen
Photographischen Gesellschaft, A.-G., Berlin-Steglitz
|
35
|
|
|
Saal im Rathaus zu Danzig. Nach Schultz, Danzig und
seine Bauten
|
37
|
|
|
München. Theatiner-Hofkirche. Äußeres. Photographie
G. Stuffler, München. (Nach einer Photographie aus dem Jahre 1769.)
|
41
|
|
|
München. Theatiner-Hofkirche. Inneres. Nach
Photographie
|
43
|
|
|
Würzburg, Schloß. Gesamtansicht. Photographie Dr. F.
Stoedtner, Berlin
|
48
|
|
|
Würzburg, Schloß. Kaisersaal. Photographie Dr. F.
Stoedtner, Berlin
|
49
|
|
|
Schrank des Barock. Photographie von H. Keller. Aus
Danziger Barock, Frankfurt a. M. 1909
|
51
|
|
| [S. 105] |
Sessel aus dem kgl. Schloß zu Berlin. Nach Graul, das
18. Jahrhundert
|
52
|
|
Delfter Fayencevase. Um 1700. Nach Brinckmann, Das
Hamburgische Museum
|
54
|
|
|
Schlüter. Denkmal des Großen Kurfürsten. Nach einer
Aufnahme der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G., Berlin-Steglitz
|
58
|
|
|
Van Dijk: Johannes der Täufer und Johannes der
Evangelist. Photographie von F. Hanfstaengl, München
|
62
|
|
|
Kommode des Régencestiles. Nach Williamson,
Le mobilier national
|
65
|
|
|
Schloß Amalienburg bei München. Spiegelsaal. Nach
Photographie
|
67
|
|
|
Kaminböcke des Rokokostils in Schloß Fontainebleau
|
69
|
|
|
Rokokoterrine im Kölner Kunstgewerbemuseum. Nach dem
Katalog
|
71
|
|
|
Lehnstuhl von Jacob. Stil Louis XVI. Berliner
Kunstgewerbemuseum. Nach Graul, Das 18. Jahrhundert
|
74
|
|
|
Chinesische Gefäße in Bronze gefaßt. Stil Ludwig XVI.
Paris, Louvre
|
75
|
|
|
Fontainebleau, Schloß. Arbeitszimmer Napoleons I.
Photographie Dr. F. Stoedtner, Berlin
|
77
|
|
|
Berlin, Neue Wache. Photographie
Dr. F. Stoedtner, Berlin
|
78
|
|
|
J. L. David. Madame Recamier. Paris, Louvre. Nach einer
Originalaufnahme von Hanfstaengl, München
|
79
|
|
|
Möbel des Biedermeierstils. Nach Lux, Von der
Empire-Biedermeierzeit. Verl. v. Jul. Hoffmann, Stuttgart
|
83
|
|
|
Möbel vom Ende des 19. Jahrh. in Pseudorenaissance. Nach
Cornelius, Elementargesetze 2. Aufl.
|
86
|
|
|
Tisch von Majorelle in Nancy. Nach Lambert, Das moderne
Möbel auf der Pariser Weltausstellung 1900
|
89
|
|
|
Behrens. Turbinenfabrik. Berlin. Aus „Moderne Arbeit“,
Hoeber, Behrens
|
92
|
|
|
Heidrich. Zimmer des Reichskommissars. Brüsseler
Weltausstellung 1910. Photographie Dr. F.
Stoedtner
|
93
|
Druck von B. G. Teubner in Leipzig.
Die Sammlung
„Aus Natur und Geisteswelt“
nunmehr schon über 600 Bändchen umfassend, sucht seit ihrem Entstehen dem Gedanken zu dienen, der heute in das Wort: „Freie Bahn dem Tüchtigen!“ geprägt ist. Sie will die Errungenschaften von Wissenschaft, Kunst und Technik einem jeden zugänglich machen, ihn dabei zugleich unmittelbar im Beruf fördern, den Gesichtskreis erweiternd, die Einsicht in die Bedingungen der Berufsarbeit vertiefend.
Sie bietet wirkliche „Einführungen“ in die Hauptwissensgebiete für den Unterricht oder Selbstunterricht, wie sie den heutigen methodischen Anforderungen entsprechen. So erfüllt sie ein Bedürfnis, dem Skizzen, die den Charakter von „Auszügen“ aus großen Lehrbüchern tragen, nie entsprechen können; denn sie setzen vielmehr eine Vertrautheit mit dem Stoffe schon voraus.
Sie bietet aber auch dem Fachmann eine rasche zuverlässige Übersicht über die sich heute von Tag zu Tag weitenden Gebiete des geistigen Lebens in weitestem Umfang und vermag so vor allem auch dem immer stärker werdenden Bedürfnis des Forschers zu dienen, sich auf den Nachbargebieten auf dem laufenden zu erhalten.
In den Dienst dieser Aufgabe haben sich darum auch in dankenswerter Weise von Anfang an die besten Namen gestellt, gern die Gelegenheit benutzend, sich an weiteste Kreise zu wenden, der Gefahr der „Spezialisierung“ unserer Kultur entgegenzuarbeiten an ihrem Teil bestrebt.
Damit sie stets auf die Höhe der Forschung gebracht werden können, sind die Bändchen nicht, wie die anderer Sammlungen, stereotypiert, sondern werden — was freilich die Aufwendungen sehr wesentlich erhöht — bei jeder Auflage durchaus neu bearbeitet und völlig neu gesetzt. So konnte der Sammlung auch der Erfolg nicht fehlen. Mehr als die Hälfte der Bändchen liegen bereits in 2. bis 6. Auflage vor, insgesamt hat sie bis jetzt eine Verbreitung von weit über 3 Millionen Exemplaren gefunden.
Alles in allem sind die schmucken, gehaltvollen Bände, denen Professor Tiemann ein neues künstlerisches Gewand gegeben, durchaus geeignet, die Freude am Buche zu wecken und daran zu gewöhnen, einen kleinen Betrag, den man für Erfüllung körperlicher Bedürfnisse nicht anzusehen pflegt, auch für die Befriedigung geistiger anzuwenden. Durch den billigen Preis ermöglichen sie es tatsächlich jedem, auch dem wenig Begüterten, sich eine Bibliothek zu schaffen, die das für ihn Wertvollste „Aus Natur und Geisteswelt“ vereinigt.
Jedes der meist reich illustrierten Bändchen
ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich
Jedes Bändchen geheftet M. 1.20, gebunden M. 1.50
Werke, die mehrere Bändchen umfassen, auch in einem Band gebunden
Leipzig, im Juni 1917. B. G. Teubner
Jedes Bändchen geheftet M. 1.20, gebunden M. 1.50
Zur bildenden Kunst, Musik und Schauspielkunst
sind bisher erschienen:
Bildende Kunst
Allgemeines:
Ästhetik. Von Professor Dr. R. Hamann. (Bd. 345.)
*Einführung in die Geschichte der Ästhetik. Von Dr. H. Nohl. (Bd. 602.)
*Das Wesen der deutsch. bildend. Kunst. V. Geh. Rat Prof. Dr. H. Thode. (Bd. 585.)
Bau und Leben der bildenden Kunst. Von Direktor Prof. Dr. Th. Volbehr. 2. Aufl. Mit 44 Abbildungen. (Bd. 68.)
Kunstpflege in Haus und Heimat. Von Superintendent R. Bürkner. 2. Auflage. Mit 29 Abbildungen. (Bd. 77.)
Grundzüge der Perspektive nebst Anwendungen. Von Prof. Dr. K. Doehlemann. Mit 91 Fig. u. 11 Abb. (Bd. 510.)
*Projektionslehre. Von Zeichenlehrer A. Schudeisky. Mit Abbildungen. (Bd. 564.)
Der Weg zur Zeichenkunst. Von Dr. E. Weber. M. 82 Abb. u. 1 Tafel. (Bd. 430.)
Geschichte:
Die Entwicklungsgeschichte d. Stile in d. bildenden Kunst. Von Dr. E. Cohn-Wiener. 2 Bde. 2. Aufl. (Auch in 1 Bd. geb.) Bd. I: Vom Altertum bis zur Gotik. Mit 66 Abb. (Bd. 317.) Bd. II.: Von d. Renaissance b. z. Gegenw. M. 31 Abb. (Bd. 318.)
Altertum:
Die Blütezeit der griechischen Kunst im Spiegel der Reliefsarkophage. Eine Einführung in die griechische Plastik. Von Dr. H. Wachtler. Mit 8 Tafeln und 32 Abbildungen. (Bd. 272.)
Pompeji, eine hellenistische Stadt in Italien. Von Prof. Dr. Fr. v. Duhn. 2 Aufl. Mit 62 Abbildungen. (Bd. 114.)
Die Kunst des Islam. Von Prof. Dr. P. Schubring. (Bd. 593.)
Mittelalter und Neuzeit:
Deutsche Baukunst im Mittelalter. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Matthaei. 3. Auflage. Mit zahlreichen Abb. im Text und auf 2 Doppeltafeln. (Bd. 8.)
Die altdeutschen Maler in Süddeutschland. Von H. Nemitz. Mit einem Bilderanhang. (Bd. 464.)
Die Renaissancearchitektur in Italien I. Von Dr. P. Frankl. Mit 12 Tafeln und 27 Textabbildungen. (Bd. 381.) II. (Bd. 382.) In Vorb.
Michelangelo. Eine Einführung in das Verständnis seiner Werke. Von Prof. Dr. E. Hildebrandt. Mit 44 Abbildungen. (Bd. 392.)
Albrecht Dürer. Von weil. Prof. Dr. R. Wustmann. Mit 33 Abb. (Bd. 97.)
Rembrandt. Von Prof. Dr. P. Schubring. Mit 50 Abbildungen. (Bd. 158.)
Niederländische Malerei im 17. Jahrhundert. Von Prof. Dr. H. Jantzen. Mit 37 Abbildungen. (Bd. 373.)
Deutsche Baukunst seit dem Mittelalter bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Matthaei. Mit 62 Abb. u. 3 Tafeln. (Bd. 326.)
19. Jahrhundert:
Deutsche Baukunst im 19. Jahrhundert. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Matthaei. Mit 35 Abbildungen. (Bd. 453.)
Die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert. Von Prof. Dr. R. Hamann. 2 Bände Text. 2 Bände mit 57 ganzseitigen und 200 halbseitigen Abbildungen. (Bd. 448–451, in 2 Doppelbänden zu je M. 2.50, auch in 1 Halbpergamentband zu M. 6.—)
Die Maler des Impressionismus. Von Prof. Dr. B. Lázàr. Mit 32 Abbildungen und 1 farbigen Tafel. (Bd. 395.)
Kunstgewerbe:
Die dekorative Kunst des Altertums. V. Dr. Fr. Poulsen. M. 112 Abb. (Bd. 454.)
Deutsche Kunst im tägl. Leben bis zum Schlusse d. 18. Jahrhunderts. Von Prof. Dr. B. Haendcke. Mit 63 Abbildungen. (Bd. 198.)
Ostasiatische Kunst und ihr Einfluß auf Europa. Von Direktor Professor Dr. R. Graul. Mit 49 Abbildungen. (Bd. 87.)
Geschichte der Gartenkunst. Von Baurat Dr.-Ing. Chr. Ranck. Mit 41 Abb. (Bd. 274.)
Die künstlerische Photographie. Von Dr. W. Warstat. Mit 12 Tafeln. (Bd. 410.)
Musik
*Geschichte der Musik. Von Dr. Alfred Einstein. (Bd. 438.)
*Beispielsammlung zur älteren Musikgeschichte. Von Dr. A. Einstein. (Bd. 439.)
Haydn, Mozart, Beethoven. Von Prof. Dr. C. Krebs. 2. Aufl. M. 4 Bildn. (Bd. 92.)
Die Blütezeit der musikalischen Romantik. Von Dr. E. Istel. Mit 1 Silhouette. (Bd. 239.)
Das Kunstwerk Richard Wagners. Von Dr. E. Istel. Mit 1 Bildnis Richard Wagners. (Bd. 330.)
Die moderne Oper. Vom Tode Wagners bis zum Weltkrieg (1883–1914). Von Dr. E. Istel. Mit 3 Bildnissen. (Bd. 495.)
Die Grundlagen der Tonkunst. Versuch einer genetischen Darstellung der allgemeinen Musiklehre. Von Prof. Dr. H. Rietsch. (Bd. 178.)
Musikalische Kompositionsformen. Von S. G. Kallenberg. 2
Bände. (Bd. 412, 413, auch in 1 Band gebunden.)
Bd. I: Die elementaren Tonverbindungen als Grundlage der Harmonielehre.
Bd. II: Kontrapunktik und Formenlehre.
Das moderne Orchester in seiner Entwicklung. Von Prof. Dr. Fr. Volbach. Mit Partiturbeispielen u. 3 Tafeln. (Bd. 308.)
Die Instrumente des Orchesters. V. Prof. Dr. Fr. Volbach. Mit 60 Abb. (Bd. 384.)
Klavier, Orgel, Harmonium. Das Wesen der Tasteninstrumente. Von Professor Dr. O. Bie. (Bd. 325.)
Schauspielkunst
Das Theater. Schauspielhaus und Schauspielkunst vom griechischen Altertum bis auf die Gegenwart. Von Dr. Chr. Gaehde. 2. Aufl. Mit 18 Abb. (Bd. 230.)
*Die griechische Tragödie. V. Prof. Dr. J. Geffcken. Mit 1 Plan u. Abb. (Bd. 566.)
Die griechische Komödie. Von Prof. Dr. A. Körte. M. Titelb. u. 2 Taf. (Bd. 400.)
Das Drama. Von Dr. B. Busse. Mit 3 Abb. 3 Bde. I: Von der Antike z. franz. Klassizismus. II: Von Versailles bis Weimar. III: Von der Romantik zur Gegenwart. (Bd. 287/289.)
Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts. In seiner Entwicklung dargestellt von Prof. Dr. G. Witkowski. 4. Auflage. Mit 1 Bildnis Hebbels. (Bd. 51.)
Die mit * bezeichneten und weitere Bände in Vorbereitung.
Als erstes Bändchen der „Entwicklungsgeschichte der Stile“
ist von demselben Verfasser erschienen:
Vom Altertum bis zur Gotik
2. Auflage. Mit 66 Abb. (ANuG. Bd. 317.) Geh. M. 1.20, geb. M. 1.50
Geschichte der bildenden Künste
Eine Einführung von Dr. E. Cohn-Wiener. Preis ca. M. 4.—
Das Buch will kein historisch geordnetes Nachschlagebuch sein, sondern möglichst viel vom Wesen der Kunst und des Kunstwerkes geben. Es sucht neben dem bloßen Wissen die Freude am Kunstwerk zu vermitteln, erkennen zu lassen, daß hinter dem Werk der Künstler als schöpferische Persönlichkeit steht. Seine Aufgabe, der Selbstbelehrung und als Lehrbuch zu dienen, sucht es nicht zu lösen, indem es durch oberflächliche Behandlung eines verwirrenden Vielerlei „mitzureden“ befähigt, sondern durch eingehende Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit anstrebende Besprechung der behandelten Kunstwerke sucht es dem Leser den inneren Gehalt der Kunstepochen so vor Augen zu stellen, daß er auch die Werke, die das Büchlein selbst nicht erwähnen kann, zu verstehen vermag. Eine reiche Zahl von Abbildungen — darunter auch farbige — dient der Anschaulichkeit. Die neueste Zeit ist besonders eingehend behandelt worden, weil hier das Bedürfnis am unmittelbarsten ist.
Wörterbuch zur Kunstgeschichte
Von Dr. Ernst Cohn-Wiener. Gebunden M. 3.—
Elementargesetze der bildenden Kunst
Grundlagen einer praktischen Ästhetik von Prof. Dr. Hans Cornelius. 2. Auflage. Mit 245 Abb. und 13 Tafeln. Geh. M. 7.—, geb. M. 8.—
„Es gibt kein Buch, in dem die elementarsten Gesetze künstlerischer Raumgestaltung so klar und anschaulich dargelegt, so überzeugend abgeleitet wären. Wir haben hier zum ersten Male eine zusammenfassende, an zahlreichen einfachen Beispielen erläuterte Darstellung der wesentlichsten Bedingungen, von denen namentlich die plastische Gestaltung in Architektur, Plastik und Kunstgewerbe abhängt.“
(Zeitschrift für Ästhetik.)
Die bildenden Künste
Ihre Eigenart und ihr Zusammenhang. Vorlesung von Professor Dr. Karl Doehlemann. Geheftet M. —.80
„Eine tiefgründige Besprechung der bildenden Künste — Malerei, Plastik und Architektur umfassend — in durchweg anregender Form. Die Fachwelt wie die gebildeten Stände werden die Schrift mit hoher Befriedigung aufnehmen.“
(Wiener Bauindustrie-Ztg.)
Unser Verhältnis zu den bildenden Künsten
Von Geh. Hofrat Prof. Dr. A. Schmarsow. Geh. M. 2.—, geb. M. 2.60
„Diese Vorträge bilden den wertvollsten Beitrag zur Literatur über die Kunsterziehungsfrage. Schmarsow entwickelt seine Anschauung über das Verhältnis der Künste zueinander, um zu zeigen, wie jede einzelne einer besonderen Seite der menschlichen Organisation entspreche, wie darum auch alle Künste eng miteinander verknüpft sind, da alle von einem Organismus ausstrahlen.“
(Deutsche Literaturzeitung.)
Psychologie der Kunst
Darstellung ihrer Grundzüge. V. Dr. R. Müller-Freienfels. 2 Bde. I: Die Psychologie d. Kunstgenießens u. Kunstschaffens. II: Die Formen d. Kunstwerks u. d. Psychol. d. Bewertung. Geh. je M. 4.40, in 1 Bd. geb. M. 10.—
„Was diesem Werke Beachtung und Anerkennung erworben hat, ist zum Teil der Umstand, daß es zu den sehr seltenen wissenschaftlichen deutschen Büchern gehört, die auch einen ästhetischen Wert besitzen, aus denen eine Persönlichkeit spricht, die über eine ungewöhnliche Gabe der Synthese verfügt.“
(Zeitschrift für Ästhetik.)
Die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert
Von Prof. Dr. R. Hamann. Mit 57 ganzseitigen und 200 halbseitigen Abbildungen. In Halbpergament M. 7.—
„H. hat eine ausgezeichnete Darstellung des Entwicklungsganges der Malerei während des letzten Jahrhunderts gegeben. Meines Wissens gibt es in der ganzen modernen Kunstgeschichtschreibung keine annähernd so vortreffliche Darstellung des Wesens der Malerei seit 1860 bis zum Einbruch des Naturalismus, als sie H. im 6. Kap. seines Werkes gibt. Es ist ein Genuß, sich der meisterhaften Behandlung dieser Epoche ruhig hinzugeben.“
(Preuß. Jahrb.)
Mathematik und Malerei
Von Oberlehrer Dr. G. Wolff. Mit 18 Figuren und 35 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln. Kart. M. 1.60
Die nahen historischen Beziehungen zwischen Malerei und mathematischer Perspektive werden dazu benutzt, um aus formaler Darstellung eines Bildes dessen künstlerischen Wert zu beurteilen. Der erste Teil entwickelt im engsten Anschluß an die Malerei die Grundlagen der Perspektive. Der zweite Teil analysiert mit den so gewonnenen Mitteln einzelne perspektivisch besonders lehrreiche Bilder.
Fr. Baumgarten, Fr. Poland, R. Wagner:
Die hellenische Kultur
3., stark vermehrte Auflage. Mit 479 Abbildungen, 9 bunten, 4 einfarbigen Tafeln, einem Plan und einer Karte. Geh. M. 10.—, geb. M. 12.50
„... In schöner, ebenmäßiger Darstellung entrollt sich vor dem Blick des Lesers die reiche hellenische Kulturwelt. Wir sehen Land und Leute im Lichte klarer und scharfer Charakteristik. Das staatliche, gesellschaftliche und religiöse Leben, das Schöpferische in Kunst und Schrifttum steigt in leuchtenden Farben vor uns auf; der feine kritische Sinn, der die Verfasser niemals verläßt, erfüllt mit Zuversicht in ihre Urteile.“
(Hochland.)
Die hellenistisch-römische Kultur
Mit 440 Abb., 5 bunten, 6 einfarb. Taf., 4 Kart. u. Plän. M. 10.—, geb. M. 12.50
„... Die Verfasser des vorliegenden Buches haben Hervorragendes geleistet; mit außerordentlichem Geschick und sicherem Urteil haben sie die Ergebnisse der Einzelforschung zu einem glänzenden Bild des Gesamt-Hellenismus und seiner Folgeerscheinungen, wie sie in der ganzen Kultur der römischen Republik und Kaiserzeit zutage treten, zusammengefaßt. Technisch ausgezeichnet sind die Reproduktionen; ein nicht zu unterschätzender Vorzug gegenüber anderen Werken ähnlicher Art liegt in der Verwendung von mattem Kunstdruckpapier, das scharfe Abbildungen ermöglicht, ohne durch störenden Glanz unbequem zu werden; hervorragend ist überhaupt die ganze Ausstattung des prächtigen Buches.“
(Frauenbildung.)
Die Renaissance in Florenz und Rom
8 Vorträge von Prof. Dr. K. Brandi. 4. Aufl. Geh. M. 5.—, geb. M. 6.—
„... Meisterhaft sind die Erscheinungen von Politik, Gelehrsamkeit, Dichtung, bildender Kunst zum klaren Entwicklungsgebilde geordnet, mit großem Takte die Persönlichkeiten gezeichnet, aus freier Distanz die Ideen der Zeit betrachtet. Die Ausstattung des Buches dürfte zum Geschmackvollsten der neueren deutschen Typographie gehören.“
(Hist. Jahrbuch.)
Kunst und Kirche
Vorträge aus dem 1913 zu Dresden abgehaltenen Kursus für kirchliche Kunst- und Denkmalspflege. Herausgegeben vom Evang.-luther. Landeskonsistorium. Mit 61 Abbild. auf 32 Tafeln. Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—
Inhalt: Gurlitt: Kunst und Kirche. — Schmidt: Der sächs. Kirchenbau bis auf Georg Bähr. — Bestelmeyer: Baukünstl. Aufgab. der ev. Kirche in der Gegenwart. — Gurlitt: Kirchl. Denkmalspflege. — Berling: Die Sonderausstellung kirchl. Kleinkunst. — Högg: Friedhofskunst.
Geschichte der deutschen Dichtung
Von Oberlehrer Dr. H. Röhl. 2. Aufl. Gebunden M. 3.—
„Immer kommt es ihm darauf an, das lebendige Verständnis des Lesers zu heben, den geistigen Extrakt bestimmter Literaturperioden, -werke und -größen heranzuziehen, und fast immer gelingt es ihm, mit ein paar kurzen Worten den Nagel auf den Kopf zu treffen. So lernen wir das Wesen des lyrischen Impressionismus eines Liliencron in seiner ganzen kampfesfrohen Natürlichkeit ebenso wie die unwahre Romantik Auerbachschen Salon-Bauerntums erkennen, werden in die stille Kleinmalerei der Naturschilderungen eines A. Stifter wie in d. erschütternde Gefühlswelt des unglückl. J. Chr. Günther eingeführt. So wandern wir durch d. Geschichte unserer Literatur wie durch ein. blühenden Garten.“
(Fränk. Kurier, Nürnberg.)
Das Erlebnis und die Dichtung
Lessing. Goethe. Novalis. Hölderlin. Von weil. Geh. Regierungsrat Prof. Dr. W. Dilthey. 5. Auflage. Geh. M. 6.—, geb. M. 7.50
„Den Aufsätzen Diltheys gebührt ein ganz einziger Platz in allem, was jemals über Dichtung und Dichter geschrieben ist. Aus den tiefsten Blicken in die Psyche der Dichter, dem klaren Verständnis für die historischen Bestimmungen, in denen sie leben, kommt Dilthey zu einer Würdigung poetischen Schaffens, die jenseits aller Kritik und Literaturhistorie eine selbständig-freie Stellung einnimmt. Dies Buch muß wie eine Befreiungstat wirken.“
(Die Hilfe.)
Die neuere deutsche Lyrik
Von Prof. Dr. Ph. Witkop. I. Von Spee bis Hölderlin. II. Von Novalis bis Liliencron. Geh. je M. 5.—, geb. je M. 6.—
„... In solcher Vollständigkeit und doch solcher Beschränkung besitzen wir kein Werk über Lyrik wie dieses, dessen Wert neben der wissenschaftlichen Bedeutung im Durchdringen der Materie mit dichterischem Einfühlen ruht. So werden die Namen zu lebenden, leidenden und freudig erglühenden Menschen, die durch die Wahrheit ihres Gefühls oder das Erkünstelte ihrer Dichtung uns nahetreten oder abstoßen.“
(Frauenbildung.)
Heidelberg und die deutsche Dichtung
V. Prof. Dr. Ph. Witkop. M. 5 Taf., 1 farb. Beil., Buchschm. u. Silhouetten. Geh. M. 3.60, in Pappb. M. 4.—, in Ganzperg. mit Goldschnitt M. 8.40
Heidelberg ist uns zum Symbol der Poesie geworden aus der wunderbaren Einheit von Geschichte und Kunst und Wissenschaft und Jugend und Natur heraus. So wird eine Darstellung der Beziehungen Heidelbergs zur deutschen Dichtung uns zu mehr als einem Stück Literaturgeschichte. Auch der großen deutschen Zukunft wird Heidelberg der Quell der Jugend und Dichtung bleiben. Jetzt aber wird dies Buch von ihm den Leser aufatmen lassen von der Last der großen schweren Zeit, denen draußen zumal ein verklärtes Bild der deutschen Heimat bieten. Die Ausstattung ist in Einband und Buchschmuck eine gleich stimmungsvolle.
Psychologie der Volksdichtung
Von Dr. Otto Böckel. 2. Aufl. Geheftet M. 7.—, gebunden M. 8.—
„Es liegt eine Fülle des Schönen und Wahren in dem Böckelschen Werke. Den Forscher muß die reiche, mit kundiger Hand gewählte und wertvolle Literatur befriedigen, den Laien muß die klare, schlichte, reine Sprache erfreuen, das poetische Empfinden mitreißen. Böckels Buch ist eine wertvolle Bereicherung der Poetik, Literaturkunde und Völkerpsychologie und sei jedem Freunde des Volkes wärmstens empfohlen.“
(Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien.)
Der Roman der deutschen Romantik
Von Dr. Paula Scheidweiler. Geh. M. 4.—, geb. M. 5.40
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin
Deutschkunde
Ein Buch von
deutscher Art und Kunst
Herausgegeben von Dr. Walther Hofstaetter
Mit 2 Karten, 32 Tafeln und 8 Abb. Gebunden M. 2.70
Ein Bild all dessen, was deutsch ist, will dieses Buch gewinnen helfen, indem es in Wort und Bild von deutscher Art und Kunst erzählt, vom deutschen Land, von dem, was in ihm lebt und wächst, von seinen Dörfern, Burgen und Städten, von all dem, was unser Volk an geistigen Gütern geschaffen in Sprache, in Sitte und Brauch, aber auch in Wirtschaft, in Recht und Staat, in der Kunst, in Dichtung und Musik, von allem, was es gesonnen u. gedacht, von da an, wo deutsche Stämme zuerst deutschen Boden betraten, bis zum heutigen Tage. So bietet das Buch einen zusammenfassenden Überblick über die Gesamtentwicklung unseres Volkes, der heute auch unseren Gebildeten oft noch fehlt, und vermittelt zugleich die Erkenntnis der inneren Zusammenhänge, sowie dessen, was in dem allen deutsch ist. Es soll schon dem heranwachsenden Geschlecht in die Hand gegeben werden, es möchte aber auch den Männern u. Frauen, die im Leben stehen, ein treuer Weggenosse werden in den Stunden rückschauender Betrachtung.

Das Buch wird die Herzen erheben zu freudigem Bewußtsein des reichen Erbes unseres Volkes und den Willen stärken, dies Erbe treu zu bewahren und zu mehren.
B. G. Teubner/Leipzig und Berlin