
Title: Der rote Stern: Ein utopischer Roman
Author: A. Bogdanov
Translator: Hermynia Zur Mühlen
Release date: August 20, 2020 [eBook #62985]
Language: German
Credits: Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed
Proofreading Team at https://www.pgdp.net. This book was
produced from scanned images of public domain material,
provided by the German National Library.

Erstes Buch der Internationalen Jugendbücherei
A. Bogdanoff
Ein utopischer Roman
Aus dem Russischen übertragen
von Hermynia Zur Mühlen

1923
Verlag der Jugendinternationale
Berlin-Schöneberg
Die mit diesem Eindruck versehenen Exemplare dürfen nur an Mitglieder der der 3. Internationale angeschlossenen Organisationen zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
Alle Rechte insbesondere das der Uebersetzung vorbehalten
Copyright by Verlag der Jugendinternationale, Berlin-Schöneberg, 1923
Druck der Vereinsdruckerei G. m. b. H., Potsdam
Lieber Genosse, ich sende Ihnen Leonids Schriften. Er wollte sie veröffentlichen, – Sie verstehen sich auf diese Dinge besser als ich. Leonid hat sich verborgen. Ich verlasse das Krankenhaus, um ihn zu suchen. Meiner Ansicht nach wird er in den Bergwerksgebieten zu finden sein, wo sich eben gewaltige Ereignisse vorbereiten. Anscheinend ist das Ziel seiner Flucht – ein verborgener Selbstmordversuch, die Folge seiner Geisteskrankheit. Und er war doch der völligen Heilung schon so nahe.
Sobald ich etwas erfahre, werde ich Sie verständigen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
N. Werner.
24. Juli 19..
Es war zu jener Zeit, da in unserem Lande der gewaltige Zusammenbruch seinen Anfang nahm, jener Zusammenbruch, der noch heute weiter geht und der sich, meiner Ansicht nach, dem unvermeidlichen, drohenden Ende nähert.
Die ersten blutigen Tage erschütterten dermaßen das gesellschaftliche Bewußtsein, daß alle den raschen und leuchtenden Ausgang des Kampfes erwarteten; es schien, als wäre das Aergste bereits geschehen, als könne es gar nichts Aergeres mehr geben. Niemand vermochte sich vorzustellen, wie unerbittlich starr die knochige Gespensterhand sei, die alles Lebendige erdrosselt hat und auch noch heute in ihrer verkrampften Umarmung festhält.
Die Erregung des Kampfes durchströmte die Massen. Die Seelen der Menschen eilten unbändig der Zukunft entgegen, die Gegenwart verschwamm in einem rosigen Nebel, die Vergangenheit entschwand irgendwo, in weiten Fernen, wurde aus den Augen verloren. Alle menschlichen Verhältnisse waren unsicher und verschwommen, wie noch nie zuvor.
In jenen Tagen ereignete sich all das, was mein Leben verwandelte und mich aus der Sturzflut des proletarischen Kampfes fortriß.
Trotz meiner siebenundzwanzig Jahre war ich in der Arbeiterpartei einer der „Alten“. Es wurden mir sechs Jahre der Arbeit angerechnet, unterbrochen durch ein Jahr Gefängnis. Früher als manch anderer fühlte ich das Nahen des Sturmes, und ging ihm auch gelassener entgegen. Es war nötig, weit mehr als bisher zu arbeiten, dennoch gab ich meine Studien nicht auf; besonders interessierten mich die Fragen der Struktur der Materie. Doch war dies nicht nur platonisch, sondern ich schrieb auch für wissenschaftliche Zeitschriften, verdiente auf diese Art mein Brot. Zu jener Zeit liebte ich, oder glaubte zumindest zu lieben.
In der Partei war ihr Name Anna Nikolajewna.
Sie gehörte der anderen, der gemäßigteren Richtung unserer Partei an. Ich erklärte mir dies aus der Weichheit ihres Charakters, sowie aus der allgemeinen Verworrenheit der politischen Verhältnisse unseres Landes. Obgleich sie älter war als ich, hielt ich sie dennoch nicht für einen völlig geklärten Charakter. Doch irrte ich.
Bald nachdem wir einander näher gekommen waren, zeigte sich die Verschiedenheit unserer Charaktere auf schmerzlichste Art. Allmählich bildeten sich die tiefsten gedanklichen Widersprüche aus, die sich sowohl auf unsere Stellung zur revolutionären Arbeit, als auch auf unser persönliches Verhältnis bezogen.
Sie war unter der Fahne der Pflicht und des Opfers zur Revolution gekommen – ich unter der Fahne des eigenen freien Verlangens. Sie hatte sich der großen proletarischen Bewegung als Moralistin angeschlossen, suchte darin die Befriedigung höherer Sittlichkeit – ich hingegen gehörte der Bewegung als Amoralist an, als Mensch, der das Leben liebt, dessen höchste Blüte ersehnt und sich jener Bewegung zuwendet, die den zur Entwicklung und Blüte führenden Weg der Geschichte verkörpert. Für Anna Nikolajewna war die proletarische Ethik heilig in sich selbst, ich jedoch betrachtete diese als nützliche Anpassung, die im Klassenkampf wohl unerläßlich sei, aber vergänglich wie der Kampf selbst, und bloß aus der Lebensordnung geboren. Anna Nikolajewna erwartete von der sozialistischen Gesellschaft ausschließlich eine Umwandlung und Erneuerung der proletarischen Klassenmoral, während ich behauptete, daß das Proletariat schon heute die Vernichtung jeglicher Moral anstrebe und daß das sozialistische Gefühl, indem es die Menschen zu Kameraden der Arbeit, der Freude und des Leids mache, nur dann völlig ungehemmt herrschen könne, wenn es den Fetisch-Mantel der Sittlichkeit von sich werfe. Aus dieser Meinungsverschiedenheit entstanden gar häufig Widersprüche über die Wertung politischer und sozialistischer Faktoren, Widersprüche, die zu schlichten unmöglich war.
Noch weit schärfer zeigte sich unsere Meinungsverschiedenheit, wenn es sich um unser persönliches Verhältnis handelte. Sie fand, daß die Liebe zur Nachgiebigkeit, zum Opfer, vor allem aber zur Treue verpflichte, solange der Bund bestehe. Ich dachte gar nicht daran, eine neue Verbindung einzugehen, doch vermochte ich die Treue als Pflicht nicht anzuerkennen. Ja, ich behauptete sogar, daß die Polygamie höher stehe als die Monogamie, weil sie dem Menschen ein reicheres persönliches Leben und den Nachkommen mehr Vielartigkeit zu geben vermag. Meiner Ansicht nach ist die sogenannte Unmöglichkeit der Polygamie nur von den Widersprüchen der bürgerlichen Ordnung geschaffen, gehört zu den Privilegien der Ausbeuter und Parasiten, zu deren schmutzigen, sich zersetzenden Psychologie. Auch hierin muß die Zukunft eine gewaltige Wandlung bringen. Diese Auffassung erschütterte Anna Nikolajewna aufs tiefste: sie sah darin einen Versuch, in der Form der Idee die groben sinnlichen Beziehungen zum Leben zu rechtfertigen.
Trotz allem sah ich, ahnte ich nicht die Unvermeidlichkeit eines Bruches. Da drang in unser Leben ein von außen kommender Einfluß, der die Entscheidung beschleunigte.
Um diese Zeit kam in die Hauptstadt ein junger Mann, der den in unseren Kreisen ungewöhnlichen Decknamen Menni trug. Er brachte aus dem Süden Berichte und Aufträge mit, die klar erkennen ließen, daß er das völlige Vertrauen der Genossen besitze. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte, beschloß er, noch einige Zeit in der Hauptstadt zu verweilen, und suchte uns häufig auf; es schien ihm viel daran gelegen, meine Freundschaft zu erwerben.
Er war in vielem ein origineller Mensch. Schon sein Aeußeres war ungewöhnlich. Seine Augen wurden derart von dunklen Brillen verdeckt, daß ich nicht einmal ihre Farbe kannte, sein Kopf war unproportioniert groß, seine Gesichtszüge waren schön, doch seltsam unbeweglich und leblos, sie harmonisierten nicht im geringsten mit der weichen ausdrucksvollen Stimme und der schlanken, jünglinghaft-biegsamen Gestalt. Er sprach frei und fließend, und was er sagte, war stets gehaltvoll. Seine Bildung war äußerst einseitig; dem Beruf nach schien er Ingenieur zu sein.
Im Gespräch hatte Menni die Gepflogenheit, einzelne praktische Fragen auf allgemeine Grundideen zurückzuführen. Befand er sich bei uns, so geschah es stets, daß die zwischen meiner Frau und mir bestehenden Charakter- und Meinungsverschiedenheiten irgendwie in den Vordergrund gelangten, und zwar derart deutlich und scharf, daß wir voller Qual die Aussichtslosigkeit des Ganzen erkannten. Mennis Weltanschauung glich der meinen; er verlieh ihr der Form nach voller Vorsicht und Zartheit, dem Inhalt nach jedoch voller Schärfe und Tiefgründigkeit Ausdruck. Er verstand es, unsere verschiedenartigen politischen Ansichten derart geschickt mit der Verschiedenartigkeit unserer Weltanschauung zu verknüpfen, daß dieser Unterschied als psychologische Notwendigkeit erschien, ja schier als logische Schlußfolgerung; jegliche Hoffnung der gegenseitigen Annäherung entschwand, der Möglichkeit, über die Meinungsverschiedenheiten hinweg, zu irgendetwas Gemeinsamem zu gelangen. Anna Nikolajewna empfand für Menni eine Art mit lebhaftem Interesse gemischten Haß. In mir erweckte er große Achtung und ein unklares Mißtrauen; ich fühlte, daß er ein Ziel verfolgte, wußte jedoch nicht, welches.
An einem Januartag – es war bereits gegen Ende Januar – wurde den Parteiführern beider Richtungen der Plan einer Massendemonstration unterbreitet, einer Demonstration, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem bewaffneten Zusammenstoß führen würde. Am Vorabend der Demonstration erschien Menni bei uns und warf die Frage auf, ob Anna Nikolajewna entschlossen wäre, falls die Demonstration stattfände, selbst die Parteiangehörigen anzuführen. Es entstand ein Streit, der bald einen erbitterten Charakter annahm.
Anna Nikolajewna vertrat die Ansicht, daß ein jeder, der für die Demonstration gestimmt habe, moralisch verpflichtet sei, in den ersten Reihen mitzugehen. Ich hingegen behauptete, dies wäre keineswegs verpflichtend, es müßten nur jene mitgehen, die unentbehrlich oder von wirklichem Nutzen seien; ich dachte dabei an mich selbst, als an einen in derartigen Dingen erfahrenen Menschen. Menni ging noch weiter und erklärte, angesichts des unvermeidlichen Zusammenstoßes mit der bewaffneten Macht dürften nur redegewandte Agitatoren und Kampforganisatoren mitgehen; die politischen Führer hingegen hätten bei der Demonstration nichts zu suchen, Schwächlinge und nervöse Leute könnten sogar gefährlich werden. Anna Nikolajewna war über dieses Urteil gekränkt; es schien ihr, als sei es gegen sie gerichtet. Sie brach das Gespräch ab und zog sich in ihr Zimmer zurück. Auch Menni entfernte sich bald darauf.
Am folgenden Tage stand ich frühmorgens auf und verließ das Haus, ohne Anna Nikolajewna gesehen zu haben. Es wurde Abend, ehe ich heimkehrte. Die Demonstration war von unserem Komitee abgelehnt worden, und soweit mir bekannt war, hatten auch die Führer der anderen Richtung den gleichen Beschluß gefaßt. Ich war mit dieser Lösung äußerst zufrieden, denn ich wußte genau, wie wenig wir auf einen Konflikt mit Waffen vorbereitet waren, und hielt ein derartiges Vorgehen für eine nutzlose Kraftvergeudung. Auch glaubte ich, der Entschluß werde Anna Nikolajewnas Erregung über das gestrige Gespräch ein wenig beschwichtigen ... Daheim fand ich auf Anna Nikolajewnas Tisch folgenden Brief:
„Ich gehe fort. Je mehr ich mich selbst und Sie begreife, desto klarer wird mir, daß wir verschiedene Wege gehen und daß wir uns beide geirrt haben. Es ist besser, wenn wir einander nicht mehr begegnen. Verzeihen Sie mir.“
Lange durchwanderte ich die Straßen, erschöpft, mit dem Gefühl der Leere im Kopf und der Kälte im Herzen. Als ich heimkehrte, fand ich einen unerwarteten Gast vor; am Tisch saß Menni und schrieb einen Brief.
„Ich muß mit Ihnen über eine äußerst wichtige und einigermaßen seltsame Angelegenheit sprechen“, sagte Menni.
Mir war alles einerlei; ich setzte mich nieder, bereit, ihn anzuhören.
„Ich las Ihre Abhandlung über die Elektrone und die Materie“, begann er. „Ich studierte selbst einige Jahre diese Frage und finde in Ihrer Abhandlung viele wertvolle, richtige Ideen.“
Ich verbeugte mich schweigend, und er fuhr fort:
„Ihre Arbeit enthält eine für mich besonders interessante Bemerkung. Sie gelangen dort zu der Annahme, daß die elektrische Theorie der Materie zur unvermeidlichen Voraussetzung eine Schwerkraft hat, die sich aus der elektrischen Kraft, sowohl als Anziehungskraft wie auch als Abstoßungskraft ergibt, was zu einer neuen Auffassung der elektrischen Schwerkraft unter einer andern Formel führen muß. Das heißt: wir erhalten dadurch eine Art der Materie, welche die Erde abstößt anstatt sie anzuziehen, und das gleiche gilt auch für die Sonne und die anderen uns bekannten Körper. Sie bringen als Vergleich die diamagnetische Abstoßungskraft der Körper und die Abstoßung der Parallelströme. All dies ist bei Ihnen nur angedeutet, doch glaube ich trotzdem, daß Sie diesen Voraussetzungen größere Bedeutung beimessen, als Sie in Ihrer Arbeit zugeben wollten.“
„Sie haben recht“, erwiderte ich. „Ich glaube, dies ist der einzige Weg, auf dem die Menschheit das Problem der freien Bewegung in der Luft, sowie jenes der Verbindung zwischen den Planeten zu lösen vermag. Aber mag nun diese Idee in sich richtig sein oder nicht, jedenfalls ist sie bis zum heutigen Tage fruchtlos geblieben, weil uns die richtige Theorie der Materie und der Schwerkraft fehlt. Gibt es noch eine andere Art der Materie, so ist es scheinbar unmöglich, diese zu entdecken: die Anziehungskraft besteht für das ganze Sonnensystem, aber ebenso wahr ist, daß sie bei dessen Entstehung, als sich dieses aus der Nebulosität herausbildete, noch nicht bestand. Dies bedeutet, daß wir diese Art der Materie noch theoretisch bilden und erst dann praktisch schaffen müssen. Heute fehlen uns hierzu noch Mittel und Wege, wir ahnen bloß die Aufgabe, die wir zu lösen haben.“
„Trotzdem ist das Problem bereits gelöst“, erklärte Menni.
Ich blickte ihn verblüfft an. Sein Gesicht war, wie immer, völlig unbewegt, aber im Ton seiner Stimme lag etwas, das mich hinderte, ihn für einen Charlatan zu halten.
„Vielleicht ist er geisteskrank“, fuhr es mir durch den Kopf.
„Ich habe keineswegs den Wunsch, Sie zu täuschen, weiß genau, was ich sage“, mit diesen Worten antwortete er auf meine Gedanken. „Hören Sie mich geduldig an, später, wenn es nötig ist, werde ich Ihnen die Beweise erbringen.“ Und nun berichtete er folgendes:
„Die gewaltige Entdeckung, von der hier die Rede ist, war nicht die Leistung einzelner Personen. Sie gehört einer ganzen wissenschaftlichen Gesellschaft an, die seit recht geraumer Zeit besteht und schon lange an diesem Problem arbeitete. Diese war bis heute eine Geheimgesellschaft, und ich bin nicht bevollmächtigt, Ihnen Näheres über deren Ursprung und Geschichte mitzuteilen, solange ich nicht mit dem Oberhaupt zusammengekommen bin.
Unsere Gesellschaft hat in vielen wichtigen Dingen die akademische Welt weit überholt. Die Radium-Elemente und deren Zersetzung waren uns lange vor Curie und Ramsey bekannt, und unseren Genossen gelang eine weit tiefgehendere Analyse der Materie. Auf diesem Weg ahnten wir die Möglichkeit des Bestehens von Elementen, die die Erdkörper abstoßen und vervollkommneten die Synthese dieser Minus-Materie, wie wir sie abgekürzt nennen.
Nun fiel uns die technische Ausarbeitung und Anwendung dieser Entdeckung nicht mehr schwer, – vor allem, einen Flugapparat zu bauen, der sich in der Atmosphäre unserer Erde zu bewegen vermag, dann einen Apparat, der imstande ist, die Verbindung mit den übrigen Planeten herzustellen.“
Mennis gelassener, überzeugter Ton vermochte nicht zu verhindern, daß mir seine Erzählung äußerst seltsam und unwahrscheinlich erschien.
„Und es gelang Ihnen tatsächlich, all dies zu leisten und dabei das Geheimnis zu wahren“, unterbrach ich seine Rede.
„Ja, denn dies erschien uns von ungeheuerer Wichtigkeit. Wir fanden, daß es äußerst gefährlich wäre, unsere wissenschaftliche Entdeckung bekannt zu geben, solange der größte Teil der Länder eine reaktionäre Regierung besitzt. Und Ihr russischen Revolutionäre müßt, mehr als alle anderen, mit dieser unserer Ansicht übereinstimmen. Betrachtet doch, wozu Eure asiatische Regierung die europäischen Verbindungs- und Vernichtungsmittel benützt: sie wendet sie an, um hier alles Lebendige, Fortschrittliche zu erdrosseln und samt der Wurzel auszureißen. Was ist an diesem halb feudalen, halb konstitutionellen Reich Gutes, auf dessen Thron ein kriegslustiger, schwatzhafter Dummkopf sitzt, der sich von allbekannten Gaunern lenken läßt? Wozu bestehen in Europa bereits zwei kleinbürgerliche Republiken? Es ist klar, daß, wenn unsere Flugmaschinen bekannt würden, die Regierung sich ihrer bemächtigen, sie zu einem Monopol umwandeln würde, um sie zur Machtstärkung der herrschenden Klassen auszubeuten und anzuwenden. Dies wollen wir auf keinen Fall gestatten, deshalb soll auch in der Erwartung günstigerer Bedingungen das Monopol in unseren Händen bleiben.“
„Ist es Ihnen tatsächlich gelungen, einen anderen Planeten zu erreichen?“ erkundigte ich mich.
„Ja, wir erreichten die zwei nächsten tellurischen Planeten, Venus und Mars; den toten Mond rechne ich selbstverständlich nicht mit. Wir sind nun damit beschäftigt, die Einzelheiten genauer kennen zu lernen. Wir besitzen alle nötigen Mittel; was uns fehlt, sind starke, hoffnungsvolle Menschen. Bevollmächtigt von meinen Genossen, fordere ich Sie auf, sich uns anzuschließen. Selbstverständlich würden Sie dadurch alle unsere Pflichten auf sich nehmen und alle unsere Rechte genießen.“
Er verstummte, wartete auf eine Antwort.
„Die Beweise“, sagte ich. „Sie versprachen mir Beweise zu geben.“
Menni zog aus der Tasche eine Glasflasche, gefüllt mit einer metallischen Flüssigkeit, die ich für Quecksilber hielt. Seltsamerweise jedoch füllte diese Flüssigkeit bloß den dritten Teil der Flasche, und zwar befand sie sich nicht auf dem Grund, sondern im oberen Teil, in der Nähe des Flaschenhalses, ja sie reichte sogar bis an den Pfropfen. Menni drehte die Flasche um, und nun sank die Flüssigkeit auf den Grund, das heißt, sie strebte abermals in die Höhe. Menni ließ das Fläschchen los, und es schwebte in der Luft. Dies war unglaublich, aber dennoch sah ich es genau, konnte nicht daran zweifeln.
„Die Flasche besteht aus gewöhnlichem Glas“, erklärte Menni. „Sie ist mit einer Flüssigkeit angefüllt, die die Körper des Sonnensystems abstößt. Die Flüssigkeit verfolgt nur den Zweck, der Flasche Gleichgewicht zu verleihen; hat sonst keinerlei Bedeutung. Nach dieser Methode verfertigten wir die Flugapparate. Sie bestehen aus gewöhnlichem Material, enthalten aber ein Reservoir, das mit der nötigen Menge der Materie der negativen Art gefüllt ist. Dann galt es noch, diesem Apparat die gebührende Bewegungsschnelligkeit zu verleihen. Für die irdischen Flugmaschinen genügt ein elektrischer Motor mit Luftschrauben, für die interplanetare Bewegung freilich genügen diese Mittel nicht. Dort verwenden wir eine völlig andere Methode, mit der ich Sie später bekannt machen werde.“
Es war unmöglich, noch weitere Zweifel zu hegen.
„Was fordert Ihre Gesellschaft außer der Pflicht, das Geheimnis zu wahren, von jenen, die sich ihr anschließen?“
„Sie stellt fast keine anderen Forderungen. Kümmert sich weder um das Privatleben, noch um die gesellschaftliche Tätigkeit der Genossen, falls letztere nicht für die Ziele unserer Gesellschaft schädlich ist. Doch muß ein jeder, der sich der Gesellschaft anschließt, irgendeine wichtige verantwortungsvolle, von der Gesellschaft gestellte Aufgabe erfüllen. Dies dient einerseits dazu, die Verbindung zwischen ihm und der Gesellschaft zu verstärken, andrerseits aber dazu, seine Fähigkeiten und seine Energie zu beweisen.“
„Es würde also auch mir ein derartiger Auftrag, eine derartige Aufgabe auferlegt werden?“
„Ja.“
„Was?“
„Sie müßten sich der Expedition anschließen, die sich morgen im großen Aetheroneff nach dem Planeten Mars begibt.“
„Wie lange wird diese Expedition währen?“
„Das ist noch unbekannt. Der Flug hin und zurück nimmt wenigstens fünf Monate in Anspruch. Es ist auch möglich, daß die Expedition überhaupt nicht zurückkehrt.“
„Das begreife ich, und daran liegt mir auch nichts. Aber meine revolutionäre Arbeit? Sie sind, wenn ich nicht irre, selbst Sozialdemokrat und werden diese Schwierigkeit begreifen.“
„Wählen Sie! Wir halten die Unterbrechung Ihrer Arbeit unumgänglich notwendig für Ihr Werk. Für die einmal Aufgenommenen gibt es kein Zurück. Eine einzige Weigerung ist eine Weigerung auf ewig.“
Ich überlegte. Ob sich der eine oder andere Arbeiter aus der breiten Masse ausschaltete, hatte für die Sache und das Ziel nicht die geringste Bedeutung. Auch vermöchte ich, nach dieser vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit, unserer revolutionären Bewegung vermittels der neuen Verbindungen, Kenntnisse und Mittel weit nützlicher zu sein. Ich entschloß mich.
„Wann muß ich zur Stelle sein?“
„Sofort, Sie kommen gleich mit mir.“
„Können Sie mir noch zwei Stunden geben, damit ich die Genossen verständige? Sie müssen mich morgen im Bezirk vertreten.“
„Dies ist schon fast getan. Heute kam Andrej, der aus dem Süden geflohen ist. Ich teilte ihm mit, Sie würden vielleicht verreisen, und er ist bereit, Ihre Stelle einzunehmen. Während ich Sie hier erwartete, schrieb ich auf gut Glück an ihn und erteilte ihm die nötigen Anweisungen. Wir können unterwegs den Brief für ihn abgeben.“
Ich vermochte nicht länger zu schwanken. Rasch vernichtete ich einige persönliche Schriften, schrieb an meine Wirtin und kleidete mich an. Menni war schon bereit.
„So, gehen wir. Von diesem Augenblick an bin ich Ihr Gefangener.“
„Sie sind mein – Genosse“, entgegnete Menni.
Mennis Wohnung nahm das ganze fünfte Stockwerk eines großen Gebäudes ein, das an dem einen Ende der Stadt vereinsamt zwischen niederen Häuschen aufragte. Wir begegneten niemandem. Die Zimmer, die ich mit Menni durchschritt, waren leer; im grellen Licht der elektrischen Lampen mutete diese Leere besonders trübselig und unnatürlich an. Im dritten Zimmer blieb Menni stehen.
„Hier“, und er wies auf die Tür des vierten Zimmers, „befindet sich das kleine Luftschiff, in dem wir uns nach dem Aetheroneff begeben werden. Vorher aber muß ich noch eine kleine Verwandlung bewerkstelligen. In dieser Maske fiele es mir schwer, das Schiff zu lenken.“ Er knöpfte den Kragen auf, nahm zugleich mit den Brillen die erstaunliche Maske ab, die wir, sowohl ich wie alle anderen, bis dahin für sein wahres Gesicht gehalten hatten. Ich war von dem sich mir bietenden Anblick äußerst verblüfft. Mennis Augen waren ungeheuer groß, waren größer, als dies Menschenaugen je zu sein pflegen. Die Pupillen waren sogar für diese unnatürlich großen Augen außerordentlich geweitet, was einen schier erschreckenden Eindruck hervorrief. Der obere Teil des Gesichtes und der Schädel waren so breit, wie dies bei den großen Augen notwendig schien, hingegen war der untere, völlig bartlose Teil des Gesichtes ungewöhnlich klein. All das machte einen sehr originellen Eindruck, gemahnte an eine Mißgeburt, doch keineswegs an eine Karikatur.
„Sie sehen, was für ein Aeußeres mir die Natur gab“, sprach Menni. „Werden begreifen, daß ich es verbergen muß, schon um die Menschen nicht zu erschrecken, mehr noch aber aus konspirativen Gründen. Sie jedoch müssen sich an meine Häßlichkeit gewöhnen, denn Sie werden gezwungen sein, lange Zeit mit mir zu verbringen.“
Er öffnete die Tür des anstoßenden Zimmers und entzündete das Licht. Ich erblickte einen großen Saal. In der Mitte lag ein kleiner, ziemlich breiter Kahn aus Metall und Glas. Vorderteil, Bord und Boden bestanden aus Glas und Stahlgeflecht; die durchsichtigen Wände von etwa zwei Zentimeter Dicke waren augenscheinlich sehr fest. Am Vorderteil des Schiffes befanden sich, in einem spitzen Winkel vereinigt, zwei starke Kristallplatten; diese mochten die Luft zerschneiden und gleichzeitig die Passagiere gegen den durch die rasche Bewegung erzeugten Wind schützen. Die Maschine füllte den Mittelteil des Schiffes aus, die Schrauben und die etwa einen halben Meter breiten Schaufeln nahmen den Hinterteil des Schiffes ein. Der halbe Vorderteil des Schiffes, sowie die Maschinen waren von einem feinen, dünnplattigen Schutzdach bedeckt; den Glasbord verstärkten Metallbänder und leichte Stahlsäulen. Das Ganze war fein und zierlich wie ein Spielzeug.
Menni gebot mir, auf der Seitenbank der Gondel Platz zu nehmen, dann verlöschte er das elektrische Licht und öffnete das riesige Saalfenster. Er selbst setzte sich vorne an die Maschine und warf aus der Gondel einige Säcke Ballast. Das Schiff zitterte, setzte sich langsam in Bewegung und schwebte lautlos zum offenen Fenster hinaus.
„Dank der Minus-Materie“, sagte Menni, „brauchen unsere Aeroplane nicht die wichtigtuerischen und ungelenken Flügel.“
Ich saß wie angeschmiedet, wagte nicht, mich zu rühren. Der Lärm der Schrauben wurde immer stärker, die kalte Winterluft überströmte uns, kühlte mir das glühende Gesicht, doch vermochte sie nicht durch meine warmen Kleider zu dringen. Ringsum funkelten, schwebten tausend Sterne, und unter uns ... Durch den durchsichtigen Boden der Gondel sah ich, wie die dunklen Flecken der Häuser immer kleiner wurden und die hellen Pünktchen der elektrischen Lampen immer mehr in der Ferne verschwammen; in der Tiefe leuchteten die schneeigen Ebenen unter dem düsteren, blaßblauen Himmel. Das Gefühl des Schwindels, das mich zuerst leicht und fast angenehm gedeucht hatte, nahm heftig zu, und ich schloß die Augen, um ihm zu entkommen.
Schärfer wurde die Luft, mächtiger der Lärm der Schrauben und das Pfeifen des Windes – augenscheinlich steigerte sich unsere Geschwindigkeit. Mein Ohr unterschied durch alle Geräusche einen feinen ununterbrochenen, gleichmäßigen, silbrigen Ton – die Luft peitschend, erschütterte dieser die Glaswände der Gondel. Eine seltsame Musik erfüllte das Bewußtsein, die Gedanken verwirrten sich, verschwanden, zurück blieb einzig und allein das Gefühl einer elementar-leichten und ungehemmten Bewegung, die uns weitertrug, vorwärts, vorwärts in den unendlichen Raum.
„Vier Kilometer in der Minute“, sprach Menni, und ich öffnete die Augen.
„Ist es noch weit?“ fragte ich.
„Noch etwa eine Wegstunde auf eisgebundenem See.“
Wir hatten eine Höhe von etlichen hundert Metern erreicht; das Flugschiff bewegte sich horizontal, ohne sich zu senken und ohne höher zu steigen. Nun hatten sich meine Augen bereits an das Dunkel gewöhnt und ich vermochte alles ringsum klar zu erkennen. Wir waren in der Gegend der Seen und Granitfelsen. Ueber den Schnee aufragend, dunkelten die Felsen. Zwischen ihnen klebten Dörfchen.
Zu unserer Linken blieben in der Ferne zurück die Flächen der von gefrorenem Schnee bedeckten Felder, zu unserer Rechten die weiße Ebene eines ungeheueren Sees. In dieser leblosen Winterlandschaft schickten wir uns an, das Band zwischen uns und der alten Erde zu zerreißen. Und jählings fühlte ich nicht nur die Ahnung, nein, die Gewißheit, daß dieses Band nun auf ewig zerrissen werde ...
Die Gondel senkte sich langsam zwischen die Felsen nieder, hielt an in der kleinen Bucht des Bergsees, vor einem dunklen, aus dem Schnee aufragenden Bau. Weder Fenster noch Türen waren zu sehen. Die Metallhülle schob sich langsam zur Seite, eine schwarze Oeffnung kam zum Vorschein, in die unsere Gondel hineinflog. Dann schloß sich die Oeffnung von neuem, der Raum, in den wir gelangt waren, erhellte sich im Licht elektrischer Lampen. Es war dies ein großes, langgestrecktes Zimmer ohne Möbel; auf dem Fußboden lagen viele Säcke mit Ballast.
Menni befestigte die Gondel an einem eigens dazu bestimmten Pfosten und schob eine der Seitentüren auf. Sie führte auf einen langen, hell erleuchteten Korridor. An den Seiten des Korridors befanden sich Kajüten. Menni geleitete mich in eine derselben und sprach:
„Hier ist Ihre Kajüte. Richten Sie sich hier ein; ich muß mich ins Maschinenabteil begeben. Wir sehen uns morgen früh wieder.“
Ich war froh, allein zu sein. Nach der durch die seltsamen Ereignisse des Abends hervorgerufenen Aufregung machte sich bei mir große Erschöpfung bemerkbar. Ohne das auf dem Tisch vorbereitete Abendessen anzurühren, verlöschte ich die Lampe und warf mich aufs Bett. In meinem Kopf vermischten sich auf unsinnigste Art die Gedanken, jagten von Thema zu Thema, nahmen die unerwartetsten Formen an. Ich bemühte mich hartnäckig, einzuschlafen, doch wollte mir dies lange Zeit nicht gelingen. Endlich jedoch verdunkelte sich das Bewußtsein, unklare, schwankende Gestalten begannen vor meinen Augen zu reigen, meine Umgebung zerfloß ins Weite, und schwere Träume suchten mein Gehirn heim.
Das Ganze endete mit einem furchtbaren Alpdruck. Ich stand am Rande eines ungeheueren schwarzen Abgrunds, in dessen Untiefe Sterne funkelten. Menni riß mich mit unbesiegbarer Kraft hinab, sagend, ich dürfe nicht die Schwerkraft fürchten, wir würden nach einigen hunderttausend Jahren des Sturzes die nächsten Sterne erreichen. Ich stöhnte auf in der Qual des letzten Kampfes und erwachte.
Weiches blaues Licht erfüllte meine Stube. Niedergebeugt zu mir, saß auf meinem Lager – Menni? Ja, er war es, aber phantastisch verändert: mir schien, als sei er um vieles kleiner und seine Augen blickten nicht mehr so scharf aus dem Antlitz; seine Züge waren weich und gütig, nicht kalt und abstoßend, wie sie am Rande des Abgrunds gewesen ...
„Wie gut Sie sind ...“, murmelte ich, unklar diese Veränderung erfassend.
Er lächelte und legte mir die Hand auf die Stirne. Eine kleine weiche Hand. Ich schloß die Augen, mir kam der sinnlose Gedanke, daß ich diese Hand küssen müßte, dann vergaß ich alles und versank in einen ruhigen, wohltuenden Schlaf.
Als ich erwachte und meine Stube erhellte, war es zehn Uhr. Nachdem ich mich angekleidet hatte, drückte ich auf die Schelle, und gleich darauf betrat Menni das Zimmer.
„Werden wir bald abfahren?“ fragte ich.
„In einer Stunde“, erwiderte Menni.
„Kamen Sie heute Nacht zu mir, oder träumte ich dies nur?“
„Es war kein Traum, doch kam nicht ich zu Ihnen, sondern unser junger Arzt Netti. Sie schliefen unruhig und gequält, er mußte Sie mit Hilfe des blauen Lichtes und der Hypnose einschläfern.“
„Ist er Ihr Bruder?“
„Nein“, entgegnete Menni lächelnd.
„Sie sagten mir noch nie, welcher Nation Sie angehören. Sind auch Ihre übrigen Genossen vom gleichen Typus, wie Sie?“
„Ja“, antwortete Menni.
„Dies bedeutet, daß Sie mich betrogen haben“, sprach ich scharf. „Hier handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Gesellschaft, sondern um etwas ganz anderes?“
„Ja“, erwiderte Menni gelassen. „Wir alle sind Bewohner eines anderen Planeten, gehören einer andersgearteten Menschheit an. Wir sind – Marsbewohner.“
„Weshalb betrogen Sie mich?“
„Hätten Sie mich angehört, wenn ich Ihnen mit einem Male die ganze Wahrheit gesagt haben würde? Ich hatte äußerst wenig Zeit, um Sie zu überzeugen. Deshalb mußte ich um der Wahrscheinlichkeit willen die Wahrheit fälschen. Ohne diesen Uebergang wäre Ihr Bewußtsein allzusehr erschüttert worden. In der Hauptsache aber – was diese unsere Reise anbelangt – sprach ich die Wahrheit.“
„Ich bin also dennoch Ihr Gefangener?“
„Nein, noch sind Sie frei. Es bleibt Ihnen eine Stunde Zeit, Ihren Entschluß zu fassen. Wollen Sie die Fahrt aufgeben, so werden wir Sie zurückbringen und unsere Reise aufgeben, denn es hätte für uns keinen Sinn, allein heimzukehren.“
„Wozu brauchen Sie mich?“
„Um ein lebendiges Band zwischen uns und der irdischen Menschheit herzustellen. Damit Sie unsere Lebensordnung kennen lernen und den Marsbewohnern die nähere Bekanntschaft mit der irdischen Ordnung vermitteln, damit Sie, falls Ihnen dies erwünscht ist, in unserer Welt Vertreter Ihres Planeten seien.“
„Ist dies nun bereits die volle Wahrheit?“
„Ja, die volle Wahrheit. Falls Sie die Kraft fühlen, diese Rolle durchzuführen.“
„In einem solchen Fall muß ich es eben versuchen. Ich bleibe bei Ihnen.“
„Ist dies Ihr endgültiger Entschluß?“ fragte Menni.
„Ja, wenn nicht auch diese letzte Erklärung irgend eine Art Uebergang bedeutet.“
„Also wir reisen“, sprach Menni, ohne meine Stichelei zu beachten. „Ich gehe noch, um dem Maschinisten einige Weisungen zu erteilen, dann komme ich wieder und wir wollen zusammen die Abfahrt des Aetheroneff beobachten.“
Er verließ das Zimmer, und ich blieb von den verschiedensten Gedanken bewegt zurück. Noch war die Erklärung nicht vollständig. Es blieb eine recht bedeutsame Frage übrig. Doch konnte ich mich nicht entschließen, sie an Menni zu stellen. Hatte er bewußt, wissentlich meinen Bruch mit Anna Nikolajewna herbeigeführt? Mir erschien dies so. Wahrscheinlich sah er in ihr ein Hindernis für seine Ziele. Vielleicht mit Recht. Doch hatte er den Bruch höchstens beschleunigen, nicht aber schaffen können. Freilich war dies eine dreiste Einmischung in meine persönlichen Angelegenheiten gewesen. Da ich aber nun bereits mit Menni verbunden war, mußte ich meine Feindseligkeit gegen ihn unterdrücken. Es galt, das Vergangene nicht mehr zu berühren; am besten würde es sein, nicht mehr an diese Frage zu denken.
Im allgemeinen bedeutete diese neue Wendung für mich keinerlei besondere Erschütterung. Der Schlaf hatte mich gekräftigt, und es war schwer, nach dem am gestrigen Abend Verlebten noch über irgend etwas in Verblüffung zu geraten. Nun galt es bloß, den Plan künftiger Tätigkeit auszuarbeiten.
Offensichtlich bestand meine Aufgabe darin, mich so schnell und so vollkommen wie möglich mit meiner neuen Umgebung vertraut zu machen. Am besten wird es wohl sein, ich befasse mich zuerst mit dem Zunächstliegenden, strebe dann Schritt für Schritt dem Fernerliegenden zu. Als Zunächstliegendes erschienen mir der Aetheroneff, seine Bewohner und unsere beginnende Fahrt. Der Mars war noch fern, im besten Fall würden wir ihn, Mennis Worten zufolge, in zwei Monaten erreichen.
Die äußere Form des Aetheroneff hatte ich bereits am vorhergehenden Abend erblickt: sie war fast kugelförmig, mit abpolierten Enden, gemahnte an das aufgestellte Ei des Kolumbus. Selbstverständlich war diese Form gewählt worden, um bei möglichst kleiner Oberfläche die größtmögliche Ausdehnung zu erhalten, das heißt, bei dem geringsten Aufwand von Material die der Abkühlung ausgesetzte möglichst geringe Fläche. Was das Material anbelangte, so schien dieses aus Aluminium und Glas zu bestehen. Die innere Einrichtung sollte mir von Menni gezeigt und erklärt werden, auch wollte er mich mit den übrigen „Ungeheuern“ bekannt machen, wie ich bei mir meine neuen Genossen nannte.
Menni kehrte zurück und führte mich zu den übrigen Marsbewohnern. Sie waren alle in dem Seitensaal versammelt, dessen ungeheueres Kristallfenster die eine Hälfte der Wand einnahm. Das echte Sonnenlicht wirkte nach der phantastischen Helle der elektrischen Lampen angenehm. Es waren etwa zwanzig Marsbewohner zugegen; mich deuchte, sie hätten alle die gleichen Gesichter. Der Mangel eines Bartes oder Schnurrbartes, ja sogar das völlige Fehlen von Runzeln und Falten schien die Verschiedenheit ihres Wuchses gleichsam zu verwischen. Unwillkürlich heftete ich die Augen auf Menni, um ihn unter diesen mir fremden Kameraden nicht zu verlieren. Uebrigens gelang es mir bald, zwischen ihnen meinen nächtlichen Gast Netti zu erkennen, der sich durch seine Jugendlichkeit und Lebhaftigkeit auszeichnete, sowie den breitschultrigen Riesen Sterni zu unterscheiden, der mich mit kaltem, fast unheildrohendem Gesichtsausdruck betrachtete. Außer Menni sprach nur Netti Russisch. Sterni und drei oder vier andere redeten Französisch, noch andere Englisch oder Deutsch; untereinander unterhielten sie sich in einer mir völlig neuen Sprache, anscheinend ihrer Muttersprache. Diese war wohlklingend und schön, und ich bemerkte mit Vergnügen, daß die Aussprache offensichtlich keine großen Schwierigkeiten bot.
Wie interessant auch immer die „Ungeheuer“ sein mochten, so wurde meine Aufmerksamkeit dennoch unwillkürlich von ihnen abgelenkt und richtete sich auf den feierlichen, immer näher kommenden Augenblick der „Abfahrt“. Ich starrte beharrlich auf die sich vor uns dehnende schneeige Fläche und nach der steil aufragenden Granitwand. Jeden Augenblick erwartete ich, einen starken Stoß zu verspüren, glaubte, alles werde rasch zurückbleiben, in weiter Ferne verschwimmen. Doch wurde ich in meiner Erwartung enttäuscht.
Eine geräuschlose, langsame, kaum wahrnehmbare Bewegung entfernte uns ein wenig von der Schneeplatte. Nach etlichen Sekunden erst wurde der Aufstieg bemerkbar.
„Eine Beschleunigung von zwei Zentimeter“, erklärte Menni.
Ich verstand, was dies bedeute. In der ersten Sekunde legten wir einen Zentimeter zurück, in der zweiten drei, in der dritten fünf, in der vierten sieben usw. Die Geschwindigkeit veränderte sich unablässig, entwickelte sich nach dem Gesetz der arithmetischen Progression. In vier Minuten hatten wir die Schnelligkeit eines gehenden Menschen, in fünfzehn die eines Personenzuges erreicht usw.
Wir bewegten uns dem Gesetze der Schwerkraft zufolge, doch fielen wir hinauf, und zwar um fünfhundertmal langsamer, als auf der Erde ein Körper von gewöhnlicher Schwere fällt.
Die Glasplatte des Fensters begann sich vom Feld zu erheben, bildete mit diesem einen stumpfen Winkel, analog der Kugelform des Aetheroneff, dessen einer Teil nun sichtbar wurde. Wir vermochten, uns vorneigend, all das zu sehen, was sich gerade unter uns befand.
Immer rascher sank die Erde unter uns nieder, immer weiter ward der Horizont. Die dunklen Flecken der Felsen und Dörfchen wurden kleiner, die Umrisse des Sees zeichneten sich ab wie auf einem Plan. Der Himmel aber ward immer dunkler; während ein blauer dem Meer gleichender Streifen den westlichen Horizont überzog, vermochten meine Augen trotz dem Tageslicht die heller leuchtenden großen Sterne zu unterscheiden.
Die äußerst langsame, kreisende Bewegung des Aetheroneff um die eigene vertikale Achse gestattete uns, den ganzen Raum ringsum zu überblicken.
Es deuchte, als erhebe sich der Horizont zusammen mit uns, die Erdoberfläche erschien als ungeheuere, ausgehöhlte, mit Reliefs geschmückte Schüssel. Die Konturen wurden verschwommener, die Reliefs flacher, immer mehr nahm die Landschaft den Charakter einer Landkarte an, scharf gezeichnet in der Mitte, verschwommen und unklar an den Rändern, die von halbdurchsichtigem, bläulichem Nebel bedeckt waren. Der Himmel wurde immer schwärzer, und zahllose Sterne, dicht gesät, funkelten ungetrübt in ihrem stillen Licht, nicht fürchtend die strahlende Sonne, deren Helle schier schmerzhaft brannte.
„Sagen Sie mir, Menni, wird sich diese Beschleunigung von zwei Zentimetern, mit der wir uns jetzt bewegen, bis ans Ende der Reise erhalten?“
„Ja“, entgegnete er. „Nur daß die Richtung etwa auf halbem Weg ins Gegenteil umschlägt, wir mit jeder Sekunde die Geschwindigkeit nicht beschleunigen, sondern verzögern. So daß diese, wenn die höchste Geschwindigkeit des Aetheroneff ungefähr fünfzig Kilometer in der Sekunde beträgt, die mittlere aber fünfundzwanzig Kilometer, im Augenblick der Ankunft abermals ebenso gering ist, wie sie im Augenblick der Abfahrt war. Dies ermöglicht uns, ohne Stoß und Erschütterungen an der Oberfläche des Mars zu landen. Ohne diese ungeheuerliche wechselnde Geschwindigkeit vermöchten wir niemals weder die Erde, noch die Venus zu erreichen, denn sogar die kürzeste Strecke beträgt sechzig bis hundert Millionen Kilometer, – bei der Geschwindigkeit, sagen wir, Ihrer Erdeneisenbahnen würde eine derartige Reise ein Jahrhundert, aber nicht, wie in unserem Fall, Monate währen. Was den „Schuß mit der Kanonenkugel“ anbelangt, über den ich in Eueren phantastischen Romanen las, so ist dies selbstverständlich ein bloßer Scherz, denn den Gesetzen der Mechanik zufolge gäbe es dabei nur eine praktische Möglichkeit – entweder sich im Augenblick des Schusses im Inneren der Kanonenkugel zu befinden, oder sie im eigenen Inneren zu haben.“
„Auf welche Art erhalten Sie diese gleichmäßige Beschleunigung und Verlangsamung?“
„Die bewegende Kraft des Aetheroneff ist einer jener radiumausstrahlenden Stoffe, die uns in großen Mengen hervorzubringen gelang. Wir fanden ein Mittel, um die Zerlegung der Elemente ums Hunderttausendfache zu beschleunigen; dies geschieht in unseren Motoren durch ein äußerst einfaches elektrisches Verfahren. Durch unsere Methode wird eine ungeheure Menge Energie entbunden. Die Teilchen der zerfallenden Atome besitzen im Flug, wie Ihnen bekannt ist, eine zehntausendmal größere Geschwindigkeit, als das Artilleriegeschoß. Wenn diese Teile nun aus dem Aetheroneff bloß nach einer einzigen bestimmten Richtung fliegen können, – das heißt, durch einen einzigen Kanal zwischen den sonst undurchdringlichen Wänden, – dann bewegt sich der Aetheroneff in der entgegengesetzten Richtung, wie der Rückschlag beim Gewehr. Da Ihnen das Gesetz der lebendigen Kraft bekannt ist, werden Sie ja auch wissen, daß ein unbedeutender, milligrammgroßer Teil pro Sekunde völlig genügt, um unserem Aetheroneff die regelmäßige Beschleunigung zu verleihen.“
Während wir also redeten, hatten sich die übrigen Marsbewohner entfernt. Menni forderte mich auf, mit ihm in seiner Kajüte zu frühstücken. Wir gingen zusammen hin. Die Kajüte glich den Wänden des Aetheroneff, auch sie hatte das gleiche große Kristallfenster. Wir frühstückten. Ich wußte, daß mir neue, noch nie empfundene Gefühle bevorstanden, da ich ja die Schwere meines Körpers verlieren würde. Ich befragte Menni darüber.
„Ja“, erwiderte er. „Obgleich uns die Sonne noch immer anzieht, so ist doch hier ihre Anziehungskraft eine sehr geringe. Und auch jene der Erde wird morgen oder übermorgen unmerklich werden. Nur dank der stets zunehmenden Geschwindigkeit des Aetheroneff bleibt uns ein Vierhundertstel, mindestens ein Fünfhundertstel unseres Gewichtes bewahrt. Es fällt ein wenig schwer, sich zum ersten Mal daran zu gewöhnen, obwohl die Veränderung ganz allmählich vor sich geht. Mit zunehmender Leichtigkeit werden Sie Ihre Geschicklichkeit verlieren, eine Menge falscher, nicht berechneter Bewegungen machen, über das Ziel hinausschießen. Was das unvermeidliche Herzklopfen, das Schwindelgefühl und die Uebelkeit anbelangt, so wird Ihnen Netti darüber hinweghelfen. Es wird Ihnen auch schwer fallen, Wasser und andere Flüssigkeiten zu handhaben, die beim leichtesten Anstoß aus dem Gefäß fließen und sich überallhin verbreiten. Doch waren wir nach Kräften bemüht, derartige Unbequemlichkeiten zu vermeiden und abzuschwächen. Möbel und Gefäße sind an Ort und Stelle befestigt, die Flüssigkeiten verkorkt, überall befinden sich Griffe und Riemen, um den unfreiwilligen Sturz zu verhindern, der bei rascherer Bewegung leicht vorkommt. Sie werden sich schon daran gewöhnen, haben hierzu genügend Zeit.“
Seit der Abfahrt waren etwa zwei Stunden verflossen. Schon war die verminderte Schwere fühlbar, doch war diese Empfindung bis jetzt noch angenehm: der Körper fühlte Leichtigkeit, die Bewegungen waren frei und ungehemmt, dies war alles. Dem atmosphärischen Druck wichen wir völlig aus; er kümmerte uns nicht, besaßen wir doch in unserem hermetisch verschlossenen Schiff einen genügenden Vorrat an Sauerstoff. Das uns sichtbare Erdgebiet glich immer mehr einer Landkarte im verkleinerten Maßstab. Im Süden, am Mittelländischen Meer, waren zwischen dem blauen Dunst Nordafrika und Arabien klar ersichtlich, im Norden, über Skandinavien, verlor sich der Blick in schneeigen vereisten Leeren, nur die Felsen Spitzbergens dunkelten als schwarze Flecke empor. Im Osten, im grüngestreiften Ural, wurde das Grün von weißen Schneeflecken durchbrochen, hier herrschte wieder völlig das weiße Licht, vermischt mit leichtem, grünlichem Schimmer, eine zärtliche Erinnerung an die ungeheueren Nadelwälder Sibiriens. Im Westen verloren sich in den hellen Konturen Mitteleuropas die Küste von England und Nordfrankreich. Ich vermochte nicht lange auf dieses gigantische Bild zu blicken; der Gedanke an die schauerliche Untiefe, über der wir schwebten, erweckte in mir ein ohnmachtsnahes Gefühl. Ich wandte mich abermals an Menni.
„Sind Sie der Kapitän dieses Schiffes?“
Menni nickte bejahend und erwiderte:
„Doch bedeutet dies keineswegs, daß ich über die Macht eines Kommandanten verfüge, wie dies Ihrer irdischen Auffassung entspräche. Ich habe bloß in der Führung des Aetheroneff mehr Erfahrung als die anderen; meine Verfügungen in dieser Hinsicht werden berücksichtigt, wie ich Sternis astronomische Berechnungen annehme, oder wie wir Nettis medizinische Ratschläge zur Erhaltung unserer Gesundheit und Arbeitskraft befolgen.“
„Wie alt ist Doktor Netti? Er dünkte mich äußerst jung.“
„Ich erinnere mich nicht genau, sechzehn oder siebzehn“, entgegnete Menni lächelnd.
Das hatte auch ich gedacht. Staunte aber über eine derart junge Gelehrsamkeit.
„In diesem Alter bereits Arzt sein!“, entfuhr es mir unwillkürlich.
„Und fügen Sie hinzu: ein äußerst geschickter und erfahrener Arzt“, ergänzte Menni.
Damals überlegte ich nicht, – und Menni erinnerte mich absichtlich nicht daran, – daß die Marsjahre fast doppelt so lang sind, wie die unseren: der Mars umkreist die Sonne in 686 Erdentagen und Nettis sechzehn Jahre kamen etwa dreißig Erdenjahren gleich.
Nach dem Frühstück forderte mich Menni auf, unser „Schiff“ zu besichtigen. Vor allem begaben wir uns in den Maschinenraum. Dieser nahm das unterste Stockwerk des Aetheroneff ein – stieß direkt an dessen verdichteten Boden und bildete die Scheidewand zwischen fünf Zimmern – das eine in der Mitte, die anderen an den Seiten gelegen. Inmitten des zentralen Raumes erhob sich der Treibmotor, an seinen vier Seiten von in den Boden eingelassenen runden Glasfenstern umgeben; das eine Fenster bestand aus reinem Kristall, die anderen waren bunt gefärbt; das Glas hatte eine Dicke von etwa drei Zentimetern und war außerordentlich durchsichtig. Im gegebenen Augenblick vermochten wir durch diese Fenster bloß einen Teil der Erdoberfläche zu sehen.
Die Basis der Maschine bildete ein vertikaler Metallzylinder, drei Meter hoch und einen halben Meter im Durchmesser. Menni erklärte mir, dieser Zylinder bestehe aus Osmium, einem schwer schmelzenden Edelmetall, aus der Gruppe des Platins. In diesem Zylinder ging die Zerlegung der radiumausstrahlenden Stoffe vor sich; die zwanzig Zentimeter dicken Wände bewiesen zur Genüge die bei diesem Prozeß entwickelten Energien. Im Raum herrschte keine besondere Hitze; der ganze Zylinder war von zwei großen, breiten, aus irgendeinem durchsichtigen Material bestehenden Futteralen umgeben. Diese Futterale schützten vor der Hitze; beide vereinigten sich unter der Decke zu einem Rohr, aus dem die erhitzte Luft nach allen Seiten ausströmte und den Aetheroneff gleichmäßig „heizte“.
Die übrigen Teile der Maschine waren durch verschiedene Zylinder miteinander verbunden, bestanden aus elektrischen Spulen, Akkumulatoren, einem Meßapparat mit Zifferblatt usw. Alles befand sich in tadelloser Ordnung, und verschiedene Spiegel gestatteten dem diensthabenden Maschinisten, den ganzen Umkreis zu überblicken, ohne sich von seinem Lehnstuhl zu erheben.
Von den Seitenstuben war die eine das „astronomische“ Zimmer, rechts und links von diesem befanden sich der „Wasserraum“ und der „Sauerstoffraum“ und auf der entgegengesetzten Seite der „Rechenraum“. Im astronomischen Zimmer waren der Fußboden und die Wände aus dickem Kristall; das in geometrischen Formen geschliffene Glas zeigte ideale Reinheit. Die Durchsichtigkeit dieses Glases war so groß, daß ich, während ich Menni über die Schwebebrücke folgte und hinabblickte, zwischen mir und dem Abgrund unter uns nichts sah; ich mußte die Augen schließen, um nicht von qualvollem Schwindel überwältigt zu werden. Ich bemühte mich, seitwärts, nach den Instrumenten zu schauen, die sich zwischen der Brücke auf Stativen befanden, oder sich von der Decke und der Außenwand herabsenkten. Das Hauptteleskop war etwa zwei Meter lang, die Linse von unproportionierter Größe und augenscheinlich von einer entsprechenden optischen Stärke.
„Als Ferngläser verwenden wir nur Diamanten“, sagte Menni. „Sie geben ein bedeutend größeres Gesichtsfeld.“
„Wie stark ist die gewöhnliche Vergrößerung dieses Teleskops?“ fragte ich.
„Die klare Vergrößerung beträgt etwa das Sechshundertfache“, entgegnete Menni. „Genügt uns dies nicht, so photographieren wir das Gesichtsfeld und betrachten die Photographie unter dem Mikroskop. Derart vermögen wir eine sechzigtausendfache und noch bedeutendere Vergrößerungen zu erzielen, und das Photographieren nimmt kaum eine Minute Zeit in Anspruch.“
Menni forderte mich auf, durch das Teleskop die entschwindende Erde zu betrachten und stellte es ein.
„Die Entfernung beträgt nun ungefähr zweitausend Kilometer“, erklärte er. „Wissen Sie, was vor Ihnen liegt?“
Mit einem Mal erkannte ich den Hafen der skandinavischen Hauptstadt, die ich häufig in Parteiangelegenheiten besucht hatte ... Es interessierte mich, die Dampfer in der Reede zu betrachten. Menni drehte einen an der Seite befestigten Griff, setzte anstelle des Fernrohrs den photographischen Apparat, nahm dann nach wenigen Sekunden Teleskop und Apparat und schob beide in eine riesenhafte, in der Ecke stehende Vorrichtung, die sich als Mikroskop erwies.
„Wir entwickeln und fixieren das Bild dort“, sprach er, ohne die Platte mit den Händen zu berühren. Nach wenigen belanglosen Griffen, die höchstens eine halbe Minute währten, schob er das Mikroskop vor mich hin. Mit verblüffender Klarheit sah ich einen mir bekannten, einer nordischen Gesellschaft gehörenden Dampfer; er schien sich etliche zehn Schritte von mir entfernt langsam zu bewegen; im kreisenden Licht war das Bild reliefartig und hatte eine völlig natürliche Färbung. Auf der Brücke stand der grauhaarige Kapitän, mit dem ich auf meinen Fahrten häufig geplaudert hatte. Ein Matrose, der eine Kiste an Deck schleppte, blieb plötzlich stehen, neben ihm ein Passagier, der mit der Hand auf etwas wies. Und all dies war zweitausend Kilometer entfernt ...
Ein junger Marsbewohner, Sternis Gehilfe, betrat den Raum. Er mußte über die vom Aetheroneff zurückgelegte Strecke eine genaue Messung anstellen. Wir wollten ihn in seiner Arbeit nicht stören und begaben uns weiter, in den „Wasserraum“. Dort befanden sich ein ungeheures mit Wasser gefülltes Reservoir und große Filtrierapparate. Eine Anzahl Röhren leitete das Wasser durch den ganzen Aetheroneff.
Nun betraten wir den „Rechenraum“. Hier standen für mich unverständliche Maschinen mit unzähligen Zifferblättern und Zeigern. Sterni arbeitete an der größten Maschine. Von dieser hing ein langes Band nieder, augenscheinlich das Resultat der Berechnungen. Die auf dem Band stehenden, sowie die auf den Zifferblättern sich befindenden Zeichen waren mir völlig unbekannt. Ich wollte Sterni nicht stören, empfand überhaupt keine Lust, mit ihm zu sprechen. Rasch verließen wir diesen Raum und betraten die letzte Seitenstube.
Diese war der „Sauerstoffraum“. Hier wurden die Sauerstoffvorräte aufbewahrt, in der Gestalt von fünfundzwanzig Tonnen Bertholetschen Salzen, aus denen, durch eine entsprechende Methode, bis zu zehntausend Kubikmetern Sauerstoff hergestellt werden konnten, eine genügende Menge für einige Fahrten gleich der unseren. Hier befanden sich auch die Apparate zur Spaltung der Salze, sowie Vorräte von Bariumoxyd und Aetzkali, die die Bestimmung hatten, der Luft die Kohlensäure zu entziehen, Vorräte von Schwefel-Anhydrid zur Absorbierung der überschüssigen Feuchtigkeit und des Leuhomain, – jenes durch das Atmen erzeugten physiologischen Giftes, das unvergleichlich gefährlicher ist, als die Kohlensäure. Dieser Raum unterstand Dr. Netti.
Dann kehrten wir in den mittleren Maschinenraum zurück, fuhren mit einem kleinen Aufzug ins höchste Stockwerk des Aetheroneff. Hier war der Mittelraum als zweites Observatorium eingerichtet; es glich in allem dem unteren Raum, nur daß hier die Kristallhülle sich oben und nicht unten befand, und daß die Instrumente größere Dimensionen hatten. Aus diesem Observatorium vermochte man die andere Hälfte der Himmelssphäre zu sehen, und die Planeten zu bestimmen. Der Mars leuchtete mit seinem roten Licht etwas abseits vom Zenith. Menni richtete auf ihn das Teleskop, und ich erblickte die mir durch Schiaparellis Landkarten bekannten Konturen, die Meere und Kanäle. Menni photographierte den Planeten und legte unter das Mikroskop eine detaillierte Karte. Doch vermochte ich von dieser ohne Mennis Erklärungen nichts zu verstehen: die Flecken der Städte, Wälder und Seen unterschieden sich voneinander durch für mich unmerkliche und unverständliche Einzelheiten.
„Wie groß ist die Entfernung?“ fragte ich.
„Verhältnismäßig gering; sie beträgt ungefähr hundert Millionen Kilometer.“
„Weshalb befindet sich der Mars nicht im Zenith der Kuppel? Fliegen wir denn nicht geradewegs, sondern seitlich auf ihn zu?“
„Ja, anders geht es nicht. Indem wir uns von der Erde fortbewegen, bewahren wir unter anderem durch die Kraft der Trägheit auch die Geschwindigkeit, mit der die Erde um die Sonne kreist, das heißt, dreißig Kilometer in der Sekunde. Die Geschwindigkeit des Mars jedoch beträgt vierundzwanzig Kilometer, und flögen wir perpendikular in der Bahn zwischen Mars und Erde, so würden wir mit der restlichen Geschwindigkeit von sechs Kilometern in der Sekunde gegen die Oberfläche des Mars stoßen. Dies darf nicht geschehen, wir müssen deshalb den krummlinigen Pfad wählen, damit die überflüssige Geschwindigkeit ins Gleichgewicht kommt.“
„Wie lange ist in diesem Fall unser Weg?“
„Etwa hundertsechzig Millionen Kilometer. Die zur Zurücklegung dieser Strecke nötige Zeit beträgt im Mindestfall zweieinhalb Monate.“
Wäre ich nicht Mathematiker gewesen, so hätten diese Zahlen meinem Herzen nichts gesagt. So jedoch erweckten sie in mir ein dem Alpdruck ähnliches Gefühl, und ich beeilte mich, den astronomischen Raum zu verlassen. Die sechs Seitenabteilungen des obersten Abschnitts umgaben ringförmig das Observatorium; sie hatten keine Fenster, und ihre Decke, die ein Teil der Oberfläche der Kugel war, neigte sich fast zum Fußboden hinab. An der Decke waren große Reservoire für die Minus-Materie angebracht, deren Repulsion alles auf dem Aetheroneff zu paralysieren vermochte.
Die mittleren Stockwerke, das dritte und vierte, umfaßten Säle, Laboratorien für die einzelnen Mitglieder der Expedition, Kajüten, Baderäume, die Bibliothek, den Turnsaal usw.
Nettis Kajüte befand sich neben der meinen.
Immer merklicher empfand ich den Verlust der Schwere. Das sich steigernde Gefühl der Leichtigkeit hörte auf, angenehm zu sein. Es vermischte sich mit einem Element des Mißtrauens, irgendeiner unklaren Unruhe. Ich begab mich in meine Kammer und legte mich auf die Pritsche.
Zwei Stunden des ruhigen Liegens und angestrengten Nachdenkens ließen mich unmerklich in Schlaf versinken. Als ich erwachte, saß Netti vor dem Tisch. Mit einer unwillkürlichen heftigen Bewegung erhob ich mich vom Lager, wurde gleichsam hochgeschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Decke.
„Wenn man weniger als zwanzig Pfund wiegt, muß man vorsichtiger sein“, bemerkte Netti in gutmütig philosophischem Ton.
Er hatte mich aufgesucht, um mir die nötigen Anweisungen zu geben, für den Fall, daß ich „seekrank“ würde. Tatsächlich fühlte ich bereits die durch den Verlust der Schwere erzeugten ersten Symptome. Von meiner Kajüte ging eine elektrische Schelle in die seine, so daß ich ihn immer zu rufen vermochte, falls ich seines Beistandes bedurfte.
Ich benützte die Gelegenheit, um mit dem jungen Arzt zu plaudern; dieser sympathische, gelehrte und dennoch so fröhliche junge Bursche zog mich an. Ich fragte ihn, wie es komme, daß außer Menni von allen sich auf dem Schiff befindlichen Marsbewohnern nur noch er meine Muttersprache könne.
„Dies ist ganz einfach“, erklärte er. „Als wir Menschen suchten, wählte Menni für sich und mich Ihr Vaterland, und wir verbrachten daselbst mehr als ein Jahr, bis es uns endlich gelang, mit Ihnen die Angelegenheit zu erledigen.“
„Die andern suchten Menschen in anderen Ländern?“
„Selbstverständlich; bei allen größeren Völkern der Erde. Aber, es fiel, wie Menni vorausgesehen hatte, in Ihrem Lande am leichtesten, jemanden zu finden, denn bei Ihnen ist das Leben entschlossener und glühender, die Menschen sind mehr als in anderen Ländern gezwungen, vorwärts zu blicken. Nachdem wir einen Menschen gefunden hatten, benachrichtigten wir die übrigen; sie kamen aus allen Ländern herbei, und wir traten die Fahrt an.“
„Was verstehen Sie, persönlich, unter den Ausdrücken ‚einen Menschen suchen‘ und ‚einen Menschen finden‘? Ich begreife, daß es sich hier darum handelte, ein Subjekt zu finden, das der vorgeschriebenen Rolle entsprach, – darüber hat mich Menni aufgeklärt. Es schmeichelt mir, daß gerade ich gewählt wurde, doch möchte ich wissen, welchen Ursachen ich dies verdanke.“
„In großen Umrissen vermag ich es Ihnen mitzuteilen. Wir brauchten einen Menschen, dessen Natur äußerst gesund, aber auch schmiegsam und anpassungsfähig ist, der für die verschiedenartigsten Arbeiten Fähigkeiten besitzt, durch möglichst wenig persönliche Bande an die Erde geknüpft und so wenig wie möglich individualistisch veranlagt ist. Unsere Physiologen und Psychologen legten dar, daß der Uebergang aus den Lebensbedingungen Ihrer Gesellschaft zu den Lebensbedingungen der unseren, die sozialistisch organisiert ist, für den einzelnen Menschen äußerst schwer sei und eine besonders günstige Anpassungsfähigkeit erfordere. Menni entdeckte, daß Sie diese Ansprüche besser erfüllten, als andere.“
„Und Mennis Ansicht war für Sie alle maßgebend?“
„Ja, wir haben völliges Vertrauen in sein Urteil. Er ist ein Mensch von hervorragenden Kräften und klarem Verstand, der sich äußerst selten irrt. Auch besitzt er mehr Erfahrungen und eine engere Verbindung mit den Erdenmenschen, als irgendeiner von uns; er hat als erster diese Verbindungen angeknüpft.“
„Wer eröffnete die Verbindung zwischen den Planeten?“
„Dies war nicht das Werk eines Einzelnen, sondern vieler. Die Minus-Materie wurde schon vor etlichen zehn Jahren entdeckt. Doch vermochten wir sie anfangs bloß in geringer Menge herzustellen, bedurften hierzu der Kraft äußerst vieler Fabrikskollegen, um die Mittel zu finden, durch die sie in größeren Mengen gewonnen werden konnte. Dann galt es, die Technik der Gewinnung und Entwicklung der radiumausstrahlenden Stoffe zu vervollkommnen, um den Motor des Aetheroneff herstellen zu können. Dies nahm ebenfalls viele Kräfte in Anspruch. Auch die klimatischen Verhältnisse zwischen den Planeten verursachten große Schwierigkeiten: die furchtbare Kälte, sowie die brennende Sonnenhitze, die Unmöglichkeit, die umhüllende Luft zu temperieren. Desgleichen war die Berechnung des Weges sehr schwer; es unterliefen dabei Fehler, die man nicht hatte voraussehen können. Mit einem Wort: die früheren Expeditionen nach der Erde endeten mit dem Tod aller Teilnehmer, bis es endlich Menni gelang, die erste erfolgreiche Expedition zu organisieren. Jetzt jedoch gelang es uns unlängst, dank seiner Methode, auch die Venus zu erreichen.“
„Wenn dem so ist, dann ist Menni wahrlich ein großer Mensch“, sprach ich.
„Wenn es Ihnen beliebt, einen Menschen, der tatsächlich viele und gute Arbeit geleistet hat, so zu nennen.“
„Nicht dies wollte ich sagen: viele und gute Arbeit vermögen auch vollkommen gewöhnliche Leute zu leisten, genaue, pflichttreue Menschen. Menni jedoch ist offensichtlich etwas ganz anderes: er ist ein Genie, ein schöpferischer Mensch, der Neues gibt und die Menschheit vorwärts bringt.“
„Was Sie da sagen, ist unklar und unrichtig. Jeder Arbeiter ist ein schöpferischer Mensch, aber in jedem Arbeiter schaffen die ganze Menschheit und die Natur. Besaß denn Menni nicht alle Versuche vorhergegangener Geschlechter, und auch die seiner Zeitgenossen, benützte er nicht bei jedem Schritt seiner Arbeit diese Versuche? Gab ihm die Natur nicht alle Elemente, alle von ihr hervorgebrachten Kombinationen? Hat nicht gerade der Kampf des Menschen gegen die Natur den lebendigen Anstoß zu neuen Kombinationen gegeben? Der Mensch ist persönlich, – aber sein Werk ist unpersönlich. Der Mensch stirbt früher oder später, – das Werk jedoch bleibt im unermeßlich sich entwickelnden Leben bestehen. Hierin gleichen sich alle Arbeiter, der Unterschied besteht nur darin, was von ihrem Schaffen sie überlebt, was im Leben weiterbesteht.“
„Ja, aber zum Beispiel: der Name eines Menschen wie Menni stirbt nicht zusammen mit ihm, sondern lebt weiter in der Erinnerung der Menschheit, während unzählige andere Namen völlig verschwinden.“
„Der Name eines jeden wird so lange vor dem Vergessen bewahrt, wie jene leben, die zusammen mit ihm lebten und ihn kannten. Die Menschheit bedarf keineswegs der toten Symbole der Persönlichkeit, wenn diese nicht mehr ist. Unsere Wissenschaft und unsere Kunst bewahrt auf unpersönliche Art das, was von der allgemeinen Arbeit geschaffen wurde. Der Ballast vergangener Namen ist nutzlos für das Gedächtnis der Menschheit.“
„Sie haben recht, aber das Gefühl unserer Welt lehnt sich gegen diese Logik auf. Für uns sind die Namen der Meister des Gedankens und der Werke lebendige Symbole, ohne die weder unsere Wissenschaft, noch unsere Kunst, noch unser ganzes gesellschaftliches Leben zu bestehen vermöchten. Im Kampf der Gewalt gegen die Ideen bedeutet der auf den Fahnen stehende Name häufig mehr, als die gegebene Losung. Und der Name des Genies ist wahrlich kein Ballast für unser Gedächtnis.“
„Dies kommt daher, weil für Euch das einzige Werk der Menschheit noch nicht das einzige Werk ist; in den durch den Kampf der Menschen hervorgebrachten Illusionen wird das Werk scheinbar zerstückelt, erscheint Euch als Werk einzelner Menschen und nicht der Menschheit. Auch mir fiel es schwer, mich an Euere Auffassung zu gewöhnen, als ich nach Ihnen suchte.“
„Nun, möge dies gut oder schlecht sein, bei Ihnen gibt es also keine Unsterblichen. Aber die Sterblichen hier sind wohl alle auserlesen von jenen, die ‚viele und gute Arbeit leisten‘, nicht wahr?“
„Im allgemeinen: ja. Menni wählte die Genossen aus vielen Tausenden heraus, die den Wunsch hegten, mit ihm zu gehen.“
„Der gröbste und kräftigste von allen dürfte wohl Sterni sein?“
„Ja, wenn Sie hartnäckig darauf bestehen wollen, die Leute zu messen und zu vergleichen. Sterni ist ein hervorragender Gelehrter, wenngleich von ganz anderer Art, als Menni. Er ist Mathematiker. Er war es auch, der eine ganze Anzahl jener Berechnungsfehler entdeckte, denen zufolge alle vorherigen Expeditionen nach der Erde mißglückten, er bewies, daß selbst wenige dieser Fehler genügten, um den Untergang der Menschen und des Werkes herbeizuführen. Er fand neue Berechnungsmethoden, und von dieser Zeit an sind die Berechnungen fehlerlos.“
„So stellte ich ihn mir nach Mennis Worten und meinem ersten Eindruck vor. Trotzdem, es ist mir selbst unbegreiflich, erweckt sein Anblick in mir ein unbehagliches Gefühl, eine unbegründete Unruhe, eine Art sinnlose Antipathie. Können Sie mir, Doktor, dafür eine Erklärung geben?“
„Sehen Sie, Sterni hat einen starken, aber kalten, vor allem: analysierenden Verstand. Er zergliedert alles auf unerbittliche, folgerichtige Art, seine Schlüsse jedoch sind oft einseitig, bisweilen außerordentlich streng, denn die Analyse der einzelnen Teile ergibt nicht das Ganze, sondern weniger als das Ganze. Sie wissen, daß überall, wo Leben besteht, das Ganze größer ist, als seine einzelnen Teile, und so ist denn auch der lebendige menschliche Körper größer, als dessen einzelne Glieder. Die Folge dieser Charaktereigenschaften ist, daß Sterni sich weit weniger als andere in die Stimmung und die Gedanken anderer Leute zu versetzen vermag. Er wird Ihnen stets gerne bei jenen Dingen behilflich sein, die Sie ihm selbst klar machen, niemals aber wird er erraten, was Sie brauchen. Dies hängt natürlich auch damit zusammen, daß seine Aufmerksamkeit fast immer völlig von der Arbeit in Anspruch genommen wird, sein Kopf stets von irgend einer schweren Aufgabe erfüllt ist. Darin unterscheidet er sich von Menni in hohem Maße: dieser sieht immer alles ringsum, und mehr als einmal erklärte er mir, wonach ich selbst verlangte, was mich beunruhigte, was mein Verstand oder mein Gefühl suchte.“
„Wenn die Dinge so stehen, so muß Sterni uns widerspruchsvollen, fehlerhaften Erdenmenschen gegenüber doch Feindseligkeit empfinden?“
„Feindseligkeit! Nein, dieses Gefühl ist ihm fremd. Aber ich glaube: starken Skeptizismus. Er verbrachte ein halbes Jahr in Frankreich und telegraphierte an Menni: ‚Hier hat es keinen Sinn, zu suchen.‘ Vielleicht hatte er zum Teil recht, denn auch Letta, der mit ihm war, fand keinen entsprechenden Menschen. Aber seine Charakteristik der Leute jenes Landes war bei weitem strenger, als jene Lettas, und selbstverständlich auch viel einseitiger, wenngleich sie nichts tatsächlich Unwahres enthielt.“
„Wer ist dieser Letta, von dem Sie sprechen? Ich entsinne mich seiner nicht.“
„Ein Chemiker, Mennis Gehilfe; er gehört nicht zu den Jüngsten, ist auf unserem Aetheroneff der älteste. Mit ihm werden Sie sich leicht verständigen können, und dies wird für Sie sehr nützlich sein. Er besitzt einen weichen Charakter und viel Verständnis für eine fremde Seele, obgleich er nicht, wie Menni, Psychologe ist. Suchen Sie ihn im Laboratorium auf; er wird sich darüber freuen und Ihnen allerlei Interessantes zeigen.“
In diesem Augenblick fiel mir ein, daß wir uns von der Erde schon weit entfernt hatten, und es verlangte mich, sie zu betrachten. Wir begaben uns zusammen in einen der mit großen Fenstern versehenen Seitensäle.
„Werden wir uns nicht dem Mond nähern?“, erkundigte ich mich im Gehen.
„Nein, der Mond bleibt weit abseits liegen, und dies ist recht schade. Auch ich sähe den Mond gerne aus der Nähe. Von der Erde aus erschien er mir so seltsam. Groß, kalt, langsam, rätselhaft ruhig, gleicht er nicht im geringsten unseren zwei kleinen Monden, die so eilig am Himmel dahinrennen, und ihre Gesichtchen so rasch verändern wie lebhafte launische Kinder. Auch Euere Sonne ist bei weitem leuchtender, darin seid Ihr glücklicher als wir. Euere Welt ist doppelt so hell als unsere, deshalb bedürft Ihr auch nicht derartiger Augen, wie wir, braucht nicht die großen Pupillen, um das schwache Licht unserer Tage und unserer Nächte aufzufangen.“

Wir setzten uns ans Fenster. In der Ferne glänzte die Erde wie eine ungeheuere Sichel, auf der bloß die Umrisse Westamerikas und des nordöstlichen Asiens als dunkle Flecke erkennbar waren; auch ein Teil des Stillen Ozeans war sichtbar, und ein heller Fleck: das Nördliche Eismeer. Der Atlantische Ozean und die alte Welt versanken in Nacht, konnten am verschwommenen Rand der Sichel bloß erraten werden, denn der unsichtbare Teil der Erde verbarg die Sterne im ungeheuren Raum. Unsere schiefe Bahn, sowie die Drehung der Erde um ihre Achse, verursachten dieses veränderte Bild.
Ich blickte hinab, und mir wurde schwer ums Herz, weil ich nicht mehr meine Heimat sah, wo so viel Leben, Kampf und Leiden herrschen, wo ich noch gestern in den Reihen der Genossen stand, und wo heute ein anderer meine Stelle einnimmt. Zweifel schlichen sich in meine Seele.
„Dort unten fließt Blut“, sprach ich. „Hier jedoch ist aus dem gestrigen Arbeiter ein beschaulicher Betrachter geworden.“
„Das Blut fließt um einer besseren Zukunft willen“, entgegnete Netti. „Und dieser Kampf fordert das Kennen einer besseren Zukunft. Um diese Kenntnisse zu erwerben, sind Sie hier.“
Von unwillkürlicher Bewegung erfaßt, griff ich nach seiner kleinen, fast kindlichen Hand.
Die Erde entfernte sich immer mehr und verwandelte sich, gleichsam als zürnte sie ob dieser Trennung, in eine Mondsichel, die die winzige Sichel des wirklichen Mondes begleitete. Parallel damit waren wir, die Bewohner des Aetheroneff, gleich phantastischen Akrobaten, die ohne Flügel zu fliegen und nach Belieben im Raum jede Stellung einzunehmen vermögen, mit dem Kopf bald auf dem Fußboden, bald auf der Decke, bald auf den Wänden stehen ... darin fast keinen Unterschied sehen ... Allmählich näherte ich mich meinen neuen Gefährten und begann mich unter ihnen heimisch zu fühlen.
Schon am Tag nach unserer Abfahrt (wir hielten an dieser Zeitberechnung fest, obgleich es für uns natürlich weder wirkliche Tage, noch Nächte gab) legte ich, dem eigenen Wunsch zufolge, die Kleidung der Marsbewohner an, um weniger von den übrigen abzustechen. Freilich gefiel mir diese Kleidung auch an und für sich: sie war einfach, bequem, ohne nutzlose Einzelheiten wie Kragen und Manschetten, gestattete die größtmöglichste Freiheit der Bewegung. Die einzelnen Teile des Gewandes wurden durch Klammern verbunden, so daß das ganze Gewand zwar einheitlich, aber dennoch leicht an- und auszuziehen war; so vermochte man zum Beispiel den einen, oder beide Aermel, oder aber die ganze Bluse abzulegen. Und die Manieren meiner Mitreisenden glichen ihrem Gewand: sie waren einfach, ermangelten alles Ueberflüssigen, jeder Konventionalität. Sie begrüßten einander nicht, verabschiedeten sich nicht, dankten nicht, verlängerten nicht aus Höflichkeit ein Gespräch, wenn der Zweck desselben erreicht war. Zur gleichen Zeit jedoch gaben sie voller Geduld jedem die erwünschten Erklärungen, paßten sich genau der geistigen Einstellung des Fragenden an, nahmen Rücksicht auf dessen Psychologie, wenngleich diese auch nicht im geringsten der ihren glich.
Selbstverständlich ging ich gleich am ersten Tag an das Erlernen ihrer Sprache, und sie waren alle gerne bereit, mir als Lehrer zu dienen, vor allem aber Netti. Die Sprache war äußerst originell, und trotz der einfachen Grammatik und Regeln eigneten ihr Einzelheiten, an die ich mich schwer anzupassen vermochte. Die Regeln hatten keine Ausnahmen, es gab auch keine Unterschiede, kein männliches, weibliches oder sächliches Geschlecht. Hingegen besaßen die Namen der Gegenstände und die Eigennamen eine Biegung, die sich auf das Zeitliche bezog. Dies wollte mir nicht recht in den Kopf.
„Was für einen Sinn haben diese Formen?“ fragte ich Netti.
„Begreifen Sie es denn nicht? Wenn Sie in Ihrer Sprache einen Gegenstand benennen, so achten sie sorgsam darauf, ob er männlich oder weiblich ist, was bei leblosen Gegenständen äußerst unwichtig, bei lebendigen aber sehr merkwürdig erscheint. Es ist bei weitem wichtiger, zwischen jenen Gegenständen zu unterscheiden, die jetzt bestehen, und jenen, die waren oder erst sein werden. Bei Euch ist das Haus sächlich, der Kahn männlich, bei den Franzosen ist das Haus weiblichen Geschlechtes, das Ding an sich aber bleibt dasselbe. Wenn Ihr aber von einem Haus redet, das bereits abgebrannt oder das noch nicht erbaut ist, so verwendet Ihr das gleiche Wort und die gleiche Form, wie wenn Ihr von dem Hause sprecht, in dem Ihr lebt. Gibt es denn in der Natur einen größeren Unterschied als den zwischen einem lebenden und einem toten Menschen, zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist? Ihr braucht ganze Worte und Sätze, um diesen Unterschied auszudrücken – ist es nicht weit besser, dies durch das Hinzufügen eines Buchstabens zu tun?“
Netti war mit meinem Gedächtnis zufrieden; seine Lehrmethode schien äußerst gut, und ich kam rasch vorwärts. Dies half mir bei der Annäherung an meine Reisegefährten, ich begann der Reise auf dem Aetheroneff mit großem Vertrauen entgegenzusehen, begab mich in Kajüten und Laboratorien, befragte die Marsbewohner über alles, was mich beschäftigte.
Der junge Astronom Enno, Sternis Gehilfe, ein lebhafter, heiterer Mensch, dem Wuchs nach fast noch ein Knabe, zeigte mir eine Menge interessanter Dinge, nicht bloß Berechnungen und Formeln – auf diesem Gebiet war er Meister – sondern auch die Schönheit dieser Beobachtungen. Mir war in der Gesellschaft des jungen Astronom-Dichters wohl zumute; der Trieb, mich über unsere Lage in der Natur genau zu orientieren, lenkte meine Schritte immer von neuem zu Enno und seinem Teleskop.
Einmal zeigte mir Enno durch das stärkste Vergrößerungsglas den winzigen Planeten Eros; ein Teil seiner Bahn lag zwischen Erde und Mars, der andere befand sich weiter als der Mars, im Gebiet der Asteroiden. Damals befand sich der Eros auf hundertfünfzig Millionen Kilometer von uns entfernt, aber die Photographie seiner kleinen Scheibe zeigte im mikroskopischen Maßstab die ganze Landkarte, die der des Mondes glich. Selbstverständlich war auch der Eros ein toter Stern, gleich dem Monde.
Ein anderes Mal photographierte Enno einen Schwarm Meteore, die etliche hundert Millionen Kilometer von uns entfernt waren. Auf diesem Bild waren natürlich nur verschwommene Nebel zu sehen. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir Enno, daß eine der früheren Expeditionen zur gleichen Zeit zugrunde ging, als ein derartiger Schwarm Meteore niederschoß. Die Astronomen, die mit großen Teleskopen die Fahrt des Aetheroneff beobachteten, sahen, wie plötzlich das elektrische Licht erlosch – der Aetheroneff verschwand auf ewig im Raum.
Wahrscheinlich war der Aetheroneff mit einigen dieser winzigen Körper zusammengestoßen; bei der ungeheuerlichen Geschwindigkeit mochten diese die Wände durchbohrt haben. Die Luft drang in den Raum und die Kälte der zwischen den Planeten befindlichen Sphäre ließ die bereits toten Körper der Reisenden gefrieren. Nun fliegt der Aetheroneff dahin, folgt der Bahn der Kometen, entfernt sich auf immer von der Sonne. Niemand weiß, wo der Weg dieses schauerlichen, von Leichen bemannten Schiffes enden wird.
Bei diesen Worten schien eine eisige Leere in mein Herz zu dringen. Ich stellte mir lebhaft vor, wie unser winziges leuchtendes Schifflein im unendlichen toten Ozean des Raumes schwebt. Ohne Stützpunkt in der schwindelerregend schnellen Bewegung, und ringsum die schwarze Leere ... Enno erriet meine Stimmung.
„Menni ist ein vortrefflicher Steuermann ...“, sagte er. „Und Sterni irrt sich nicht ... Und der Tod ... Sie haben ihm sicherlich schon oft im Leben ins Auge geblickt ... Was uns droht ... ist der Tod, weiter nichts.“
Gar bald kam die Stunde, da wir im Kampf mit einem schweren Kummer gezwungen wurden, an diese Worte zu denken.
Der Chemiker Letta zog mich nicht nur durch seine sanfte Natur an, von der mir Netti bereits gesprochen hatte, sondern auch durch sein großes Wissen und sein Interesse für eine von mir viel studierte Frage: die Struktur der Materie. Außer ihm war in dieser Frage nur noch Menni kompetent, doch wandte ich mich so wenig wie möglich an Menni, verstehend, daß dessen Zeit äußerst wertvoll sei, sowohl im Interesse der Wissenschaft, als auch in dem der Expedition, und daß ich nicht das Recht habe, sie für mich in Anspruch zu nehmen. Der gutmütige alte Letta hingegen ließ sich mit derart unerschöpflicher Geduld zu meiner Unwissenheit herab, erklärte mir mit solcher Bereitwilligkeit, ja sogar mit offensichtlicher Freude das Alphabet dieser Wissenschaft, daß ich niemals das Gefühl hatte, ihn zu belästigen.
Letta hielt mir einen ganzen Kurs über die Struktur der Materie, illustrierte diesen durch verschiedene Experimente der Zerlegung der Elemente und durch deren Synthese. Viele dieser Experimente hatte er anscheinend allein ausführen und sich darauf beschränken müssen, bloß Schlagworte niederzuschreiben, insbesondere bei jenen, die einen stürmischen Verlauf nehmen; diese Elemente zersetzten sich in der Form einer Explosion, oder die Zersetzung konnte zumindest unter gegebenen Bedingungen diese Form annehmen.
Einmal betrat während einer mir erteilten Lektion Menni das Laboratorium. Letta beendete eben die Niederschrift eines äußerst interessanten Experimentes und schickte sich an, dasselbe anzustellen.
„Seien Sie vorsichtig“, sprach Menni. „Ich entsinne mich, daß dieses Experiment eines Tages für mich schlecht ausfiel; es genügt die kleinste Menge nebensächlicher Ingredienzien in der von Ihnen zu zerlegenden Materie, um bei der Erhitzung selbst durch den schwächsten elektrischen Strom eine Explosion herbeizuführen.“
Schon wollte Letta das geplante Experiment aufgeben, aber Menni, der mir gegenüber unveränderlich aufmerksam und liebenswürdig war, schlug vor, bei der genauen Vorbereitung für das Experiment zu helfen; das Experiment wurde ohne Unfall beendet.
Am folgenden Tag stellten wir mit dem gleichen Stoff neue Experimente an. Mir schien es, als entnähme Letta die Materie nicht demselben Glas wie am vorhergehenden Tag. Als er bereits die Retorte in das elektrische Bad stellte, dachte ich daran, ihn darüber zu befragen. Gelassen schritt er an den die Reagenten enthaltenden Schrank, stellte das Bad mit der Retorte auf das an der Wand stehende Tischchen; an die gläserne Außenwand des Aetheroneff. Ich folgte ihm.
Jählings erfolgte ein ohrenbetäubender Knall, und wir wurden beide mit ungeheurer Kraft gegen die Schranktür geschleudert. Ein furchtbar lauter Pfiff, entsetzlicher Lärm und metallisches Klirren. Ich fühlte, daß eine orkanartige, unbezwingliche Kraft mich nach rückwärts, an die Außenwand riß. Schier mechanisch gelang es mir, nach dem starken Riemen zu greifen, der horizontal befestigt am Schrank hing. In dieser Lage vermochte ich dem gewaltigen Luftstrom standzuhalten. Letta war meinem Beispiel gefolgt.
„Halten Sie sich fest“, schrie er mir zu; ich vermochte im Dröhnen des Orkans kaum seine Stimme zu vernehmen. Eine scharfe Kälte durchdrang meinen Körper.
Letta blickte sich rasch um. Seine Züge waren erschreckend in ihrer Blässe, doch verwandelte sich plötzlich der Ausdruck des Entsetzens in den klarer Vernunft und festen Entschlusses. Er sprach bloß zwei Worte, – ich vermochte sie nicht zu hören, erriet aber, daß sie ein Abschied auf ewig waren. Dann ließ er den Riemen los.
Ein dumpfer Schlag, und das Dröhnen des Orkans verebbte. Ich fühlte, daß ich nun den Riemen loslassen und um mich blicken könne. Vom Tischchen war nichts mehr zu sehen, an der Wand jedoch, dicht mit dem Rücken an sie gepreßt, stand unbeweglich Letta. Seine Augen waren geweitet, das ganze Gesicht schien gleichsam erstarrt. Ich vernahm an der Tür ein Geräusch und öffnete sie. Ein starker warmer Wind stieß mich zurück. Eine Sekunde nachher betrat Menni das Zimmer. Er eilte zu Letta hin.
Wenige Augenblicke später war der Raum voller Menschen. Netti stieß alle zur Seite, stürzte zu Letta. Die übrigen umringten uns in bewegtem Schweigen.
„Letta ist tot“, klang Mennis Stimme auf. „Die bei dem chemischen Experiment erfolgte Explosion zerschmetterte die Wand des Aetheroneff, und Letta verstopfte mit seinem Leib die Bresche. Der Luftdruck zerriß seine Lungen und lähmte sein Herz. Der Tod war ein augenblicklicher. Letta rettete unseren Gast, hätte er anders gehandelt, sie hätten beide unweigerlich den Tod gefunden.“
Netti brach in heftiges Schluchzen aus.
Die ersten Tage nach der Katastrophe blieb Netti in seinem Zimmer, und ich las in Sternis Augen einen fast mißgünstigen Ausdruck. Zweifellos ergab sich aus Lettas Tod eine Lehre, und Sternis mathematisch eingestelltes Gehirn konnte nicht umhin, einen Vergleich zwischen dem hohen Wert jenes Lebens zu ziehen, das geopfert, und jenes das bewahrt worden war. Menni blieb, wie immer, unverändert freundlich und gelassen, brachte mir sogar noch mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge entgegen; seinem Beispiel folgten auch Enno und die übrigen.
Ich lernte eifrig die Sprache der Marsbewohner; bei der ersten günstigen Gelegenheit wandte ich mich an Menni und bat ihn, mir irgendein Buch zu geben, das die Geschichte ihrer Menschheit behandle. Menni fand diesen Gedanken vortrefflich und brachte mir ein Werk, das die Marskinder in die allgemeine Weltgeschichte einführte.
Ich begann mit Nettis Hilfe dieses Buch zu lesen und zu übersetzen. Der Geschmack, mit dem der unbekannte Verfasser die auf den ersten Blick abstrakt, allgemein und schematisch wirkenden Dinge zu beleben, zu konkretisieren und zu illustrieren verstanden hatte, versetzte mich in Erstaunen. Dieser Geschmack gestattete ihm, ein geometrisch aufgebautes System mit derart folgerichtigen Schlüssen für Kinder zu erörtern, wie dies bei keinem unserer populär schreibenden irdischen Verfasser gelungen wäre.
Der erste Teil des Werkes hatte geradezu einen philosophischen Charakter und war der Idee des Weltalls als einheitliches Ganzes geweiht, das in sich alles einschließt und sich alles dienstbar macht. Dieser Teil erinnerte lebhaft an die Ausführungen jener Arbeiter-Denker, die auf naive und schlichte Art die erste proletarische Naturphilosophie schufen.
Im folgenden Teil wandte sich die Ausführung jener unermeßlich fernen Zeit zu, da im Weltall noch keine uns bekannten Formen bestanden hatten, im gewaltigen Raum das Chaos und die Unbestimmtheit die Herrschaft geführt. Der Verfasser berichtete über die Abtrennung der ersten formlosen, unmerklich feinen Materie, die chemisch nicht festzustellen ist. Diese Abtrennung bewirkte die Entstehung der gigantischen Sternenwelt, die als Sternnebel erscheint und zu der auch die Milchstraße mit zwanzig Millionen Sonnen gehört, unter denen unsere Sonne eine der kleinsten ist.
Weiterhin war die Rede von der Konzentrierung der Materie und dem Uebergang zu einer festeren Verbindung, die die Form chemischer Elemente annahm; zu diesen ersten formlosen Materien gehören auch die gasförmigen Sonnennebel, von denen wir mit Hilfe des Teleskops viele Tausend zu unterscheiden vermögen. Die Geschichte der Entwicklung dieser Nebel, die Herauskristallisierung der Sonnen und Planeten, ist bei uns nur in der Kant-Laplaceschen Entstehungstheorie zu finden, aber mit größerer Bestimmtheit und mehr Einzelheiten.
„Sagen Sie mir, Menni“, fragte ich, „halten Sie es wirklich für richtig, den Kindern gleich zu Anfang diese allgemeinen, fast abstrakten Ideen zu vermitteln, diese farblosen Weltbilder zu zeigen, die der ihnen naheliegenden konkreten Umgebung so fern sind? Bedeutet dies nicht, das kindliche Gehirn mit leeren, fast nur wörtlichen Bildern füllen?“
„Die Sache ist die“, erwiderte Menni, „daß bei uns der Unterricht niemals mit dem Buch beginnt. Das Kind schöpft seine Kenntnisse aus der lebendigen, von ihm beobachteten Natur, aus der lebendigen Verbindung mit anderen Menschen. Ehe es nach einem derartigen Buch greift, hat es bereits allerlei Reisen unternommen, verschiedene Bilder der Natur betrachtet, es kennt viele Pflanzen- und Tierarten, kennt das Teleskop, das Mikroskop, die Photographie, den Phonograph, hat von älteren Kindern und erwachsenen Freunden allerlei Erzählungen über Vergangenes und Fernes gehört. Das Buch erfüllt bloß die Aufgabe, all diese Kenntnisse zu verknüpfen und zu stärken, zufälliges Wissen zu vervollkommnen und den künftigen Bildungsweg zu weisen. Vor allem gilt es natürlich, ein genaues Wissen zu erzielen, das Kind vom Anfang bis zum Ende zu führen, auf daß es sich nicht in Einzelheiten verliere. Der vollkommene Mensch muß bereits im Kind geschaffen werden.“
All dies erschien mir äußerst ungewohnt, doch wollte ich Menni nicht weiter befragen; ich werde ja unmittelbar die Bekanntschaft der Marskinder machen, sowie des dort herrschenden Erziehungssystems. Ich kehrte zu meinem Buch zurück.
Der Gegenstand des folgenden Teils war die geologische Geschichte des Mars. Diese Ausführungen brachten trotz ihrer Kürze zahllose Vergleiche mit der Geschichte der Erde und der Venus. Bei einem bedeutenden Parallelismus aller drei ergab sich als wichtigster Unterschied, daß der Mars doppelt so alt wie die Erde und viermal so alt wie die Venus war. Es wurde in Zahlen die Entwicklung der Planeten angegeben, ich entsinne mich ihrer noch genau, doch will ich sie hier nicht anführen, um den irdischen Gelehrten eine Erschütterung zu ersparen, denn diese Zahlen wären für sie etwas äußerst Unerwartetes.
Dieser Abhandlung folgte die Geschichte des Lebens von seinem Anbeginn. Es wurden hier geschildert jene ersten Verbindungen, die das Cyanradical enthielten und die noch keine lebendige Materie waren, obzwar sie viele ihrer Eigenheiten besaßen. Desgleichen wurden hier jene geologischen Bedingungen geschildert, unter denen sich die chemischen Verbindungen vollzogen. Die Ursachen wurden erklärt, vermittels derer sich die eine Materie im Gegensatz zu anderen, die zwar eine stärkere aber weniger schmiegsame Verbindung besaßen, bewahrte und anhäufte. Schritt für Schritt wurde hier die Entwicklung und Differenzierung dieser chemischen Ahnen jeglichen Lebens verfolgt, bis zur Bildung der ersten wahrhaft lebendigen Zelle, mit der die „Herrschaft der Einzeller“ anhebt.
Nun folgte das Bild der stufenweisen Entwicklung der lebendigen Wesen, ihrer allgemeinen Genealogie, vom Einzeller bis zu ihrer höchsten Entwicklung – dem Menschen einerseits, sowie andrerseits zu seinen verschiedenen Abarten. Im Vergleich mit der „irdischen“ Entwicklungslinie zeigte sich, daß auf dem Weg von der ersten Zelle bis zum Menschen die ersten Glieder der Kette fast gleich waren und auch bei den folgenden nur ein geringer Unterschied bemerkbar wurde; bei den mittleren Gliedern jedoch begann der Unterschied bedeutsam zu werden. Das erschien mir äußerst seltsam.
„Diese Frage“, sagte Netti, „ist, so viel ich weiß, noch nicht zum Spezialstudium geworden. Wußten wir doch vor zwanzig Jahren noch nicht, wie die höchst entwickelten Erdentiere beschaffen seien. Wir waren äußerst erstaunt, als wir sahen, wie sehr sie unserem Typus gleichen. Anscheinend ist die mögliche Zahl der höchsten, das vollkommenste Leben ausdrückenden Typen eine geringe, und auf den dem unseren gleichenden Planeten vermag bei den gleichartigen Bedingungen der Natur dieses Maximum des Lebens bloß eine Form hervorzubringen.“
„Außerdem“, bemerkte Menni, „ist der höchste Typus, der sich der Planeten bemächtigt hat, jener, der am stärksten der ganzen Summe der Lebensbedingungen Ausdruck verleiht, bei den Zwischenstufen hingegen, die sich nur einem Teil der Bedingungen anzupassen vermögen, bleibt mehr Raum für Verschiedenheit.“
Ich entsann mich, daß mir bereits in meinen Studentenjahren der Gedanke an die mögliche Zahl der höchsten Typen durch den Kopf gegangen war, aber freilich aus einer ganz anderen Ursache: bei den Achtfüßlern, den Kopffüßlern des Meeres, besitzt die höchstentwickelte Art Augen, die denen unserer Wirbeltiere seltsam ähnlich sind. Und doch ist die Entwicklung des Auges bei den Kopffüßlern eine ganz andere, insofern, als die entsprechenden Gewebe des Sehapparates bei ihnen in entgegengesetzter Ordnung angebracht sind.
Wie dem auch immer sei, eines stand fest: auf dem anderen Planeten lebten Menschen, die uns gleichen und es verlangte mich, mit ihrem Leben und ihrer Geschichte bekannt zu werden.
Was die prähistorische Zeit und die ersten Phasen des menschlichen Lebens auf dem Mars anbelangte, so bestand zwischen diesen und denen der Erde eine ungeheure Aehnlichkeit. Die gleichen Stammesverhältnisse hatten geherrscht, einzelne Stämme hatten bestanden, die untereinander durch Tauschhandel verbunden gewesen waren. Nachher jedoch zeigte sich ein Auseinandergehen, nicht in der Richtung der Entwicklung, sondern in der Schnelligkeit und der Art ihres Charakters.
Der Gang der Geschichte auf dem Mars war irgendwie glatter und einfacher, als der auf der Erde. Freilich gab es Kriege zwischen den Stämmen und Völkern, und es gab auch den Klassenkampf; doch spielten im historischen Leben die Kriege eine äußerst kleine Rolle und wurden verhältnismäßig früh aus der Welt geschafft; auch der Klassenkampf war geringer und weniger scharf, was die rohe Gewalt anbelangte. Dies ging selbstverständlich nicht alles aus dem Buch hervor, aber ich vermochte es dennoch zu erkennen.
Die Sklaverei hatten die Marsbewohner überhaupt nie gekannt; ihre Feudalzeit war im geringen Maßstab militaristisch gewesen, ihr Kapitalismus befreite sich frühzeitig vom nationalistisch-imperialistischen Charakter, und es gab nichts, was unserer zeitgenössischen Armee entsprach.
Die Erklärung für alle diese Tatsachen mußte ich selbst finden. Die Marsbewohner und selbst Menni begannen erst jetzt die Geschichte der Erdenmenschheit zu studieren, und es war ihnen noch nicht gelungen, aus unserer und ihrer Vergangenheit vergleichende Folgerungen zu ziehen.
Ich entsann mich eines früheren Gespräches mit Menni. Als ich mich anschickte, die von meinen Reisegefährten benützte Sprache zu lernen, interessierte es mich zu erfahren, ob diese von allen Marssprachen die verbreitetste sei. Menni erklärte mir, sie sei die einzige auf dem Mars geredete Sprache.
„Auch bei uns“, fügte Menni hinzu, „verstanden die Bewohner der verschiedenen Länder einander nicht, aber schon vor langer Zeit, etliche hundert Jahre vor dem sozialistischen Umsturz, wurden alle Dialekte zu einer einzigen Sprache verschmolzen. Dies vollzog sich auf freie, elementare Art – niemand bemühte sich darum oder schenkte der Angelegenheit besondere Aufmerksamkeit. Etliche örtliche Sprachgebräuche erhielten sich noch längere Zeit, doch waren diese allen verständlich. Und die Entwicklung der Literatur fegte auch diese hinweg.“
„Diese Tatsache vermag bloß auf eine Art erklärt zu werden“, meinte ich. „Offensichtlich ist auf Ihrem Planeten die Verbindung zwischen den Menschen weit besser, leichter und enger, als bei uns.“
„Dies stimmt“, erwiderte Menni. „Auf dem Mars gibt es weder Euere ungeheuren Ozeane, noch Euere unübersteigbaren Berggipfel. Unsere Meere sind klein, trennen nirgends die einzelnen Landteile in selbständige Kontinente, unsere Berge sind nicht hoch, abgesehen von einigen Gipfeln. Die ganze Oberfläche unseres Planeten ist viermal kleiner, als die der Erde. Außerdem ist bei uns die Schwerkraft zweieinhalbmal geringer, als bei Euch; dank der Leichtigkeit unseres Körpers vermögen wir uns auch ohne besondere Mittel rasch und leicht zu bewegen, wir laufen ohne zu ermüden ebenso schnell wie Ihr zu Pferde weiterkommt. Die Natur hat zwischen unseren Völkern weit weniger Mauern und Scheidewände aufgerichtet, als bei Euch.“
Dies war offensichtlich eine der Hauptursachen, die bei der Marsmenschheit die scharfe Trennung der Rassen und Nationen verhindert hatte, sowie das Emporkommen der Kriegerkaste, des Militarismus und des ganzen Systems des Massenmordens. Wahrscheinlich hatte auch hier der Kapitalismus mit seinen Widersprüchen zur Erschaffung all dieser, der höheren Kultur angehörenden Eigenheiten geführt, doch wurde die Entwicklung des Kapitalismus von der Nebenerscheinung begleitet, für die politische Vereinigung aller Völker und Nationen neue Bedingungen zu schaffen. Grund und Boden der Kleinbauern wurden frühzeitig vom Großgrundbesitz verschlungen, und bald darauf wurde der ganze Grund und Boden nationalisiert.
Die Ursache hierfür lag in der stetig stärker werdenden Trockenheit des Bodens, gegen welche die Kleinbauern nicht erfolgreich zu kämpfen vermochten. Die Erde des Planeten verschlang das Wasser und gab es nicht wieder zurück. Dies war die Fortsetzung jenes elementaren Prozesses, vermittels dessen die einst auf dem Mars bestehenden Ozeane seichter geworden und sich in kleine Binnenmeere verwandelt hatten. Ein derartiger Prozeß geht auch auf unserer Erde vor sich, doch ist er noch nicht so weit gediehen; auf dem Mars hingegen, der doppelt so alt ist wie die Erde, wurde die Lage bereits vor tausend Jahren äußerst ernst. Die Verminderung der Meere führte zu einer Verminderung der Wolken und des Regens, zum Seichterwerden der Flüsse und zum Austrocknen der Quellen. An den meisten Orten mußte die künstliche Bewässerung eingeführt werden. Wie hätten sich unter diesen Bedingungen die unabhängigen Kleinbauern halten können?
In dem einen Fall gingen sie einfach zugrunde und ihr Boden fiel in die Hände der benachbarten Großgrundbesitzer, die über genügend Kapital verfügten, um die künstliche Bewässerung durchführen zu können. Im anderen Fall schlossen sich die Bauern zusammen, vereinigten ihre Kräfte für das gemeinsame Werk. Doch gingen diesen Genossenschaften früher oder später die Mittel aus; anfangs dünkte sie dies ein vorübergehendes Uebel, sie machten bei den großen Kapitalisten die ersten Anleihen. Trotzdem ging es mit ihnen immer rascher bergab, die Prozente der Anleihe vergrößerten ihre Ausgaben, führten unweigerlich zu neuen Anleihen usw. Die bäuerlichen Genossenschaften unterlagen der wirtschaftlichen Macht ihrer Gläubiger und gingen zugrunde, rissen ihre Mitglieder, bisweilen hundert oder tausend Bauern, auf einmal mit sich.
Derart gelangte die urbar gemachte Erde in den Besitz etlicher tausend großer Bodenkapitalisten; aber der innere Teil des Landes blieb eine Wüste; hierher gelangte kein Wasser, und die einzelnen Kapitalisten besaßen nicht genügend Mittel, um diese Landstriche zu bewässern. Als die Staatsgewalt, die damals schon völlig demokratisch war, sich gezwungen sah, diese Sache in die Hand zu nehmen, um das allzu zahlreich werdende Proletariat zu beschäftigen und der sterbenden Bauernschaft zu Hilfe zu kommen, verfügte selbst sie nicht über die zum Bau der gigantischen Kanäle nötigen Mittel. Kapitalistische Syndikate wollten die Sache übernehmen, – doch war das ganze Volk dagegen, wohl wissend, das dies eine Stärkung der Syndikate und deren Herrschaft bedeuten würde. Nach langem Kampf und verzweifeltem Widerstand von seiten der Bodenkapitalisten wurde eine große progressive Einkommensteuer auf landwirtschaftliche Erzeugnisse eingeführt. Die durch diese Steuer erzielten Summen wurden zum Fonds der ungeheuren Arbeit: des Baues der Kanäle. Die Macht der Gutsbesitzer war gebrochen, und der Uebergang zur Nationalisierung von Grund und Boden vollzog sich rasch. Damit verschwanden auch die letzten Reste der Kleinbauern, da die Regierung im eigenen Interesse ausschließlich den Großkapitalisten Land überlassen hatte, so daß die landwirtschaftlichen Unternehmungen noch größer geworden waren als zuvor. Nun wurden die hauptsächlichsten Kanäle geschaffen, was zu einer mächtigen wirtschaftlichen Entwicklung führte und die politische Vereinigung der Menschheit näher brachte. Dies lesend, konnte ich nicht umhin, Menni meine Verwunderung darüber auszudrücken, daß Menschenhände vermocht hatten, solche riesenhaften Wasserwege zu erbauen, die selbst mit unseren mangelhaften Teleskopen von der Erde aus gesehen werden konnten.
„Sie befinden sich in einem kleinen Irrtum“, erwiderte Menni. „Zwar sind diese Kanäle tatsächlich ungeheuer groß, aber sie müßten noch um etliche zehn Kilometer breiter sein, um von Eueren Astronomen unterschieden werden zu können. Was diese sehen, sind die gewaltigen Waldstreifen, die wir längs der Kanäle pflanzten, damit eine gleichmäßige Verdunstung der Feuchtigkeit erzielt und das allzurasche Austrocknen des Wassers verhindert werde.
Die Zeit der Kanalbauten brachte einen ungeheueren wirtschaftlichen Aufschwung; die Industrie blühte und der Klassenkampf ebbte ab. Es gab eine große Nachfrage nach Arbeitskräften, die Arbeitslosigkeit verschwand völlig. Als jedoch das große Werk beendet war, und zusammen mit ihm auch die kapitalistische Kolonisierung der wüsten Gegenden, kam es bald zu einer wirtschaftlichen Krise, und die „soziale Welt“ wurde durchschaut. Die soziale Revolution brach aus. Und abermals spielte sich alles verhältnismäßig friedlich ab; die Hauptwaffe der Arbeiter war der Streik, und nur in seltenen Fällen und an einigen Orten, fast ausschließlich in ländlichen Bezirken, kam es zu Aufständen. Schritt für Schritt unterlagen die Grundbesitzer dem Unvermeidlichen; selbst als die Regierungsgewalt schon in den Händen der Arbeiterpartei lag, versuchten die Sieger nicht, ihre Sache mit Gewalt zu fördern.
Es gab, nachdem die Produktionsmittel sozialisiert worden waren, keine Entschädigung im wahren Sinne des Wortes, doch wurden die Kapitalisten pensioniert. Später spielten viele von ihnen bei der Organisation kooperativer Unternehmungen eine große Rolle. Zuerst fiel es schwer, der Schwierigkeit bei der Verteilung der Arbeit im Sinne der Arbeiter zu begegnen. Ungefähr hundert Jahre bestand für alle, ausgenommen die pensionierten Kapitalisten, die allgemeine Arbeitspflicht; zuerst der Sechsstundentag; später wurde die Arbeitszeit verkürzt. Der Fortschritt der Technik sowie die genaue Berechnung der freien Arbeit gestatteten, bei dieser die letzten Ueberreste des alten Systems auszumerzen.“
Das ganze Bild war schön und harmonisch, nicht wie bei uns von Blut und Pulverrauch befleckt; ich empfand unwillkürlich ein Gefühl des Neides und sprach darüber mit Netti, da wir zusammen das Buch lasen.
„Ich weiß nicht“, meinte der Jüngling, „mir scheint, daß Sie unrecht haben. Es ist wahr, daß auf der Erde die Gegensätze weit stärker sind, und daß die Natur der Erde weit freigebiger Schläge und Tod verteilt, als unser Mars. Doch ist dies vielleicht darauf zurückzuführen, daß der Reichtum der Erde von allem Anfang an unvergleichlich größer war, als der unsere; die bedeutend größere Sonne gibt ihr die lebendige Kraft. Bedenken Sie, um wie viele Millionen Jahre unser Planet älter ist, als der Euere; unsere Menschheit jedoch entstand bloß einige zehntausend Jahre vor der Eueren, und ist letzterer heute vielleicht nur um zwei, höchstens drei Jahrhunderte voraus. Ich stelle mir diese beiden Menschheiten als zwei Brüder vor. Der ältere besitzt einen ruhigen, gleichmäßigen Charakter, der Jüngere ist stürmisch und explosiv. Der jüngere Bruder versteht es schlechter, seine Kräfte zu verwerten, vergeudet sie, begeht mancherlei Fehler; seine Kindheit war voller Krankheiten und unruhig. Jetzt, da er ins Jünglingsalter kommt, leidet er unter qualvollen krampfartigen Anfällen. Wird er aber nicht zu einem schaffenden Künstler werden, der weit größer und stärker ist, als der ältere Bruder, wird er nicht dann unsere alte Natur weit schöner und reicher gestalten? Ich weiß es nicht, doch scheint mir, daß dem so sein wird.“
Geführt von Mennis klarem Kopf, setzte der Aetheroneff ohne weitere Unfälle den Weg nach dem fernen Ziel fort. Schon war es mir gelungen, mich den ungewohnten Lebensbedingungen anzupassen und auch mit den größten Schwierigkeiten der Marssprache fertig zu werden, als Menni uns eines Tages mitteilte, die Hälfte des Weges sei zurückgelegt, die höchste Geschwindigkeit erreicht worden, von nun an werde sich diese vermindern.
Im gleichen Augenblick, da Menni diese Worte sprach, drehte sich rasch und gleitend der Aetheroneff. Die Erde, die sich schon seit langer Zeit aus einer großen, leuchtenden Sichel in eine kleine, und aus der kleinen Sichel in einen grünschimmernden, nahe der Sonnenscheibe schwebenden Stern verwandelt hatte, glitt nun aus dem unteren Teil des schwarzen Himmelsgewölbes in die obere Halbkugel, und der rote Stern, der Mars, der hell über uns gefunkelt hatte, sank zu unseren Füßen nieder.
Noch einige hundert Stunden, und der Mars verwandelte sich in eine kleine helle Scheibe, und gar bald unterschieden wir auch zwei kleine Sternchen, seine Weggenossen, – Deimos und Phobos, unschuldige, winzige Planeten, die ihre furchtbaren Namen wirklich nicht verdienten. Diese Namen bedeuten auf griechisch „Schrecken“ und „Grauen“. Die ernsten Marsbewohner wurden lebhafter, begaben sich immer häufiger in Ennos Observatorium, um ihre Heimat zu betrachten. Auch ich tat dies, doch verstand ich, trotz Ennos geduldigen Erklärungen, gar schlecht, was ich vor mir sah; freilich gab es da viel, was mir völlig fremd war.
Die roten Flecken erwiesen sich als Wälder und Wiesen, und die dunkleren als erntebereite Felder. Die Städte erschienen als bläuliche Flecken, – und einzig und allein Wasser und Schnee hatten eine mir verständliche Farbe. Der muntere Enno ließ mich bisweilen erraten, was es sei, das ich auf der Linse des Apparates erblickte, und meine naiven Irrtümer reizten ihn und Netti zum Lachen; ich rächte mich, indem ich über ihre Ordnung scherzte, ihren Planeten das Königreich der gelehrten Eulen und der verwirrten Farben nannte.
Der Umfang der roten Scheibe wuchs immer mehr an. Schon übertraf sie an Größe die merklich kleiner werdende Sonnenscheibe und glich einer astronomischen Karte ohne Aufschriften. Auch die Schwerkraft begann sich zu steigern, was mich sehr angenehm berührte. Deimos und Phobos verwandelten sich aus leuchtenden Pünktchen in winzige, aber klar umrissene Scheiben.
Noch fünfzehn bis zwanzig Stunden – und schon umkreiste uns der Mars als Planiglob und ich vermochte mit freiem Auge mehr zu sehen, als auf allen astronomischen Karten unserer Gelehrten vermerkt ist. Die Scheibe des Deimos glitt über diese runde Landkarte dahin, Phobos jedoch war nicht zu sehen, – befand sich nun auf der anderen Seite des Planeten.
Freude herrschte ringsum, nur ich allein vermochte nicht eine zitternde, quälende Erwartung zu überwinden.
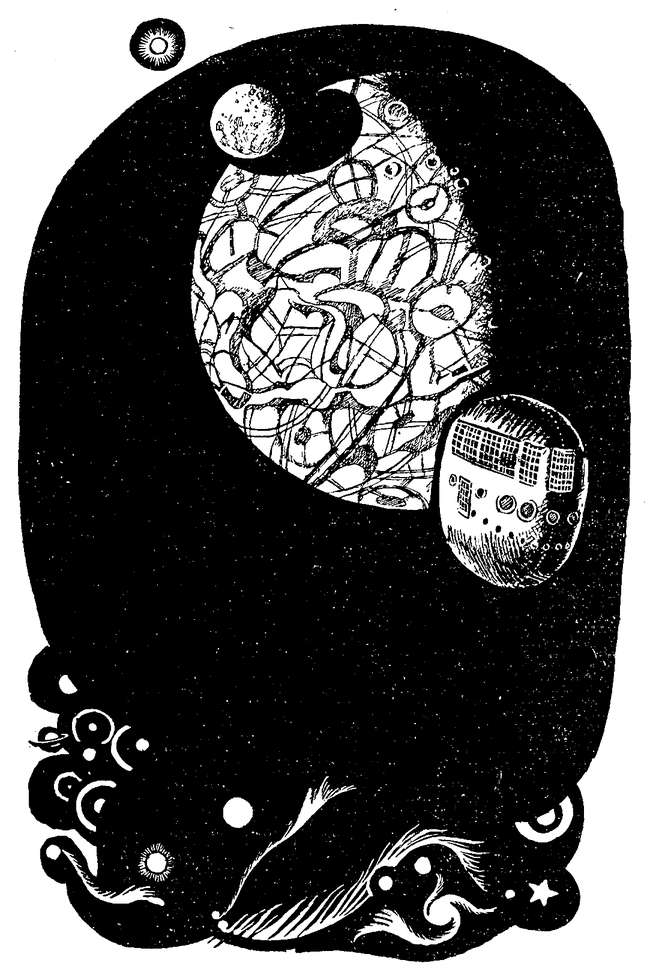
Näher und näher ... Keiner von uns brachte es über sich, etwas zu tun, – alle blickten unentwegt abwärts, dorthin, wo eine andere Welt kreiste, – eine Welt, die für sie die Heimat, für mich aber ein Ort des Geheimnisses und der Rätsel war. Nur Menni befand sich nicht unter uns, er stand im Maschinenraum: die letzten Wegstunden waren die allergefährlichsten, es galt, die Entfernung festzustellen und die Schnelligkeit zu regulieren.
Wie kam es eigentlich, daß ich, ein unfreiwilliger Kolumbus dieser Welt, weder Freude, noch Stolz, ja nicht einmal Beruhigung fühlte, jetzt, da wir ans feste Land gelangen sollten?
Künftige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus ...
Noch etwa zwei Stunden! Rasch überschritten wir die atmosphärische Grenze. Mein Herz begann schmerzhaft zu pochen, ich vermochte nichts mehr zu sehen, eilte in meine Stube. Netti folgte mir.
Er begann mit mir zu plaudern, – nicht über die Gegenwart, sondern über die Vergangenheit, die ferne Erde, die dort oben lag.
„Sie werden noch dorthin zurückkehren, wenn Sie Ihre Aufgabe erfüllt haben“, sprach er, und seine Worte klangen mir wie eine zarte Aufforderung, mich mannhaft zu halten.
Wir redeten über diese Aufgabe, über ihre unbedingte Notwendigkeit und Schwere. Unmerklich verging die Zeit.
Netti blickte auf den Chronometer. „Wir sind angekommen“, sagte er. „Gehen wir zu ihnen!“
Der Aetheroneff stand still, schaukelte die breiten ungeheueren Metallplatten; von außen drang frische Luft herein. Ueber unseren Häuptern leuchtete klar der grünlich blaue Himmel, – eine Menschenschar umdrängte uns.
Menni und Sterni gingen als erste an Land; sie trugen den durchsichtigen Sarg, in dem der tote Kamerad Letta lag.
Ihnen folgten die anderen. Ich und Netti kamen als letzte; Hand in Hand verließen wir den Aetheroneff, schritten hinein in die Menschenmenge, die völlig Netti glich ...
Die erste Zeit lebte ich bei Menni in der Fabrikstadt, deren Mittelpunkt und Basis das große chemische, sich tief unter der Erde erstreckende Laboratorium bildete. Der sich über der Erde befindende Teil der Stadt, der, zwischen Parken und Anlagen erbaut, etwa zehn Quadratkilometer einnahm, beherbergte etwa hundert Arbeiterhäuser, die von den Laboratoriumsarbeitern bewohnt wurden, sowie das große Versammlungshaus, das Konsumwarenhaus und die Verbindungsstation, die diese Stadt mit der ganzen umgrenzenden Welt verband. Hier war Menni der Leiter der Arbeit; er lebte in einem der Gemeinschaftsgebäude, nahe dem Abstieg zum Laboratorium.
Das erste, was mich bei der Natur des Mars verblüffte und woran ich mich nicht recht gewöhnen konnte, war die rote Farbe der Pflanzen. Dieser Farbstoff, seiner Substanz nach dem Chlorophyll der irdischen Pflanzen äußerst ähnlich, spielte auch hier in der Natur eine völlig analoge Rolle: er schuf das Gewebe der Pflanzen aus dem Sauerstoff der Luft und der Kraft des Sonnenlichtes.
Der vorsorgliche Netti schlug mir vor, Schutzbrillen zu tragen, um das Auge vor der ungewohnten Reizung zu bewahren. Ich weigerte mich, dies zu tun.
„Diese Farbe trägt auch unsere sozialistische Fahne“, sagte ich. „Ich muß daher mit Ihrer sozialistischen Natur vertraut werden.“
„Wenn dem so ist, so müssen Sie wissen“, warf Menni ein, „daß auch bei der Erdflora der Sozialismus besteht, freilich auf eine verborgene Art. Die Blätter der Erdpflanzen besitzen eine rote Färbung, maskieren diese bloß durch eine starke grüne Farbe. Es genügt, Brillen anzulegen, die das grüne Licht verschlingen und das rote Licht abstoßen, damit auch Ihre Wälder und Felder, gleich den unseren, rot erscheinen.“
Ich darf nicht Zeit und Platz vergeuden, indem ich die eigenartigen Formen der Pflanzen und Tiere auf dem Mars beschreibe, noch die reine und durchsichtige Atmosphäre, die zwar äußerst dünn, aber dennoch voller Sauerstoff ist, noch den tiefen, dunklen, grünlichen Himmel, mit der mageren Sonne und den winzigen Monden, mit dem doppelt so hellen Abend- und Morgenstern – der Venus und der Erde. Alldies, damals seltsam und fremdartig, deucht mich heute, durch die Erinnerung verklärt, schön und teuer. Aber es stand mit der Aufgabe meiner Sendung nur in losem Zusammenhang. Die Menschen, die Verhältnisse, in denen sie lebten, dies war für mich wichtig, und sie waren selbst in dieser märchenhaften Umgebung das Allerphantastischste, das Allerrätselhafteste.
Menni wohnte in einem nicht sonderlich großen zweistöckigen Haus, das sich der Architektur nach nicht von den übrigen Gebäuden unterschied. Der originellste Zug dieser Architektur bestand in dem durchsichtigen, aus riesenhaften himmelblauen Platten gebildeten Dach. Unter diesem Dach befanden sich die Schlaf- und Wohnzimmer. Die Marsbewohner verbrachten ihre Mußestunden in dieser blauen Beleuchtung, schätzten deren beruhigenden Einfluß, und fanden die Farbe, die jenes Licht auf den Gesichtern hervorruft, keineswegs unangenehm, wie es bei uns der Fall gewesen wäre.
Die Arbeitszimmer, das Hauslaboratorium, sowie der Verbindungsraum lagen im unteren Stockwerk; große Fenster ließen gewaltige Wogen des beunruhigenden roten Lichtes, das von den Blättern der Parkbäume ausging, in die Räume fluten. Dieses Licht, das in der ersten Zeit bei mir eine unruhige und verwirrte Stimmung hervorrief, erregte bei den Marsbewohnern eine gewohnte, der Arbeit günstige Erregung.
In Mennis Arbeitszimmer befanden sich viele Bücher und die verschiedensten Schreibgeräte, angefangen vom einfachen Bleistift bis zum Druckphonographen. Dieser Apparat besaß einen äußerst komplizierten Mechanismus: jedes deutlich ausgesprochene Wort wurde sofort vermittels eines Hebels auf der Schreibmaschine wiedergegeben und von dieser, je nach Bedarf, auf die Setzmaschine gebracht.
Auf Mennis Schreibtisch stand das Porträt eines mittelgroßen Marsbewohners. Die Gesichtszüge erinnerten lebhaft an Menni, doch eignete ihnen ein Ausdruck strenger Energie und kalter Entschlossenheit, ja fast der Grausamkeit, die Menni fehlte, dessen Gesicht nur einen ruhigen, festen Willen ausdrückte. Menni erzählte mir die Geschichte dieses Mannes.
Er war ein Ahne Mennis, ein großer Ingenieur. Er lebte vor der sozialen Revolution, zur Zeit der großen Kanalbauten. Dieses grandiose Werk wurde nach seinen Plänen und unter seiner Leitung ausgeführt. Sein erster Gehilfe, der ihm den Ruhm und die Macht neidete, zettelte gegen ihn Intrigen an. Einer der Hauptkanäle, an dem einige hunderttausend Menschen arbeiteten, mußte in einer sumpfigen, ungesunden Gegend begonnen werden. Viele tausend Arbeiter starben und erkrankten, allgemeine Unzufriedenheit gärte. Zur gleichen Zeit, als der Oberingenieur mit der Zentralregierung des Mars Besprechungen pflog, um für die Familien der bei dem Bau verstorbenen Arbeiter und für jene, die durch Krankheit an weiterer Arbeit gehindert wurden, Pensionen durchzusetzen, agitierte der erste Gehilfe im Geheimen wider ihn, hetzte zum Streik für die Forderung, die Arbeit an einen anderen Ort zu verlegen, was bei dem jetzigen Stand der Arbeit unmöglich war, weil dadurch der ganze Plan des großen Werkes und des Ingenieurs zerstört worden wäre. Als der Ingenieur dies erfuhr, berief er den ersten Gehilfen zu sich, verlangte von ihm eine Aufklärung und tötete ihn auf der Stelle. Vor Gericht verschmähte der Ingenieur jegliche Verteidigung, beschränkte sich auf die Erklärung, daß er seine Handlung für völlig gerecht und notwendig halte. Er wurde zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt.
Doch stellte sich gar bald heraus, daß keiner seiner Nachfolger die Kraft besaß, die gigantische Organisation der Arbeit durchzuführen. Mißverständnisse entstanden, Raub und Betrug, gewaltige Verwirrung; der ganze Apparat des Werkes war nahe daran zugrunde zu gehen, die Ausgaben wuchsen in die Hunderte von Millionen, unter den Arbeitern gärte heftige Unzufriedenheit, die bereits fast zu Aufständen führte. Die Zentralregierung wandte sich in aller Eile an den früheren Ingenieur, bot ihm Begnadigung und Wiedereinsetzung ins Amt an. Er wies die Begnadigung zurück, willigte jedoch ein, vom Gefängnis aus die Arbeit zu leiten.
Durch die Berichte seiner Revisoren wurden die Vorgänge an der Arbeitsstelle rasch aufgeklärt. Hundert Ingenieure und Unternehmer wurden fortgejagt und vor Gericht gestellt. Der Arbeitslohn wurde erhöht, ein neues System für die Lieferung der Nahrung, Kleidung und Werkzeuge eingeführt, der Arbeitsplan revidiert und verbessert. Bald war die Ordnung wieder völlig hergestellt, der gewaltige Apparat arbeitete rasch und genau, wie ein gehorsames Werkzeug in der Hand des Meisters.
Aber dieser Meister leitete nicht bloß das ganze Werk, sondern arbeitete auch die Pläne für dessen Fortsetzung in den folgenden Jahren aus, bereitete gleichzeitig auch noch einen Stellvertreter vor, einen jungen, energischen, begabten, dem Arbeiterstand entstammenden Ingenieur. Da der Tag nahte, an dem er aus dem Gefängnis entlassen werden sollte, war alles so gut vorbereitet, daß der große Meister die Möglichkeit hatte, das Werk, ohne es zu gefährden, einer anderen Hand zu übergeben. Im Augenblick, als sich der erste Minister der Zentralregierung dem Gefängnis näherte, um den Gefangenen freizulassen, tötete dieser sich selbst.
Während Menni mir dies erzählte, veränderte sich sein Gesicht auf seltsame Art; es erschien darauf der gleiche unbeugsam strenge Ausdruck, der seinem Ahnen eignete, und in diesem Augenblick glich er ihm. Ich fühlte, wie sehr er diesem Ahnen, der hundert Jahre vor seiner, Mennis, Geburt gestorben war, nahestand und wie gut er ihn begriff.
Das Verbindungsbureau nahm den mittleren Raum des unteren Stockwerkes ein. Hier befanden sich die Telephone und die optischen Apparate, die auf jede beliebige Entfernung hin das Bild all dessen wiedergaben, was sich vor ihrer Linse befand. Einer dieser optischen Apparate verband Mennis Wohnung mit der Verbindungsstation, und über diese mit allen Städten des Planeten. Ein anderer stellte die Verbindung mit dem unterirdischen Laboratorium her, das von Menni geleitet wurde. Dieser letztere arbeitete unaufhörlich: etliche dünne, gitterartige Platten zeigten verkleinert das Bild eines hellerleuchteten Saals, wo sich mächtige Metallmaschinen und gläserne Apparate befanden, an denen Tausende von Leuten arbeiteten. Ich wandte mich an Menni mit der Bitte, mich in das Laboratorium zu führen.
„Dies geht nicht“, erwiderte er. „Dort wird mit der noch nicht stabilen Materie gearbeitet, und wie gering auch immer, dank unserer Vorsichtsmaßregeln, die Gefahr einer Explosion oder einer Vergiftung durch unsichtbare Strahlen ist, so besteht trotzdem noch eine gewisse Gefahr. Sie dürfen sich dieser nicht aussetzen, denn Sie sind hier einzigartig, und Sie zu ersetzen wäre unmöglich.“
In seinem Privatlaboratorium verwahrte Menni bloß jene Apparate und Materialien, die zu seinen früheren Experimenten und Untersuchungen in Beziehung standen.
Im Korridor des untersten Stockwerkes war an der Decke ein Luftschiff befestigt, mit dem man in jedem Augenblick dorthin fliegen konnte, wohin es einem beliebte.
„Wo lebt Netti?“ fragte ich Menni.
„In einer großen Stadt, auf zwei Luftschiffstunden entfernt. Dort befindet sich eine große Maschinenfabrik mit etlichen zehntausend Arbeitern, so daß Netti für seine Untersuchungen weit mehr Material besitzt, als hier. Wir haben einen anderen Arzt.“
„Ist mir auch nicht gestattet, die Maschinenfabrik zu besuchen?“ erkundigte ich mich.
„Nein; dort droht ja keine besondere Gefahr. Wenn es Ihnen recht ist, werden wir uns morgen zusammen hinbegeben.“
Wir beschlossen, dies zu tun.
Ungefähr fünfhundert Kilometer in zwei Stunden, – die Schnelligkeit eines Falkenflugs, die bisher nicht einmal von unseren elektrischen Eisenbahnen erreicht worden ist ... Unter uns kreiste in raschem Wechsel die unbekannte, fremdartige Landschaft, und noch rascher flogen seltsame, mir fremde Vögel an uns vorbei. Das Sonnenlicht warf blaue Farben auf die Dächer der Häuser und färbte mit dem mir gewohnten gelben Licht die ungeheuere Kuppel eines unbekannten großen Gebäudes. Flüsse und Kanäle schimmerten als Stahlbänder, mein Auge ruhte auf ihnen, weil sie denen der Erde glichen. In der Ferne ward eine gewaltige Stadt sichtbar, umsäumt von kleinen Seen und durchschnitten von Kanälen. Das Luftschiff verlangsamte seine Fahrt und senkte sich gleitend zu einem kleinen schönen Haus nieder, Nettis Wohnung.
Netti war daheim und begrüßte uns freudig. Er stieg in unser Luftschiff, und wir flogen weiter; die Fabrik befand sich noch etliche Kilometer entfernt, an dieser Seite des Sees.
Fünf riesenhafte Gebäude, kreuzförmig gelegen, vereinigten sich zu einem einzigen Bau; Kuppeln aus reinem Glas wurden von etlichen zehn dunklen Säulen getragen, bildeten einen Kreis oder eine verlängerte Ellipse. Die Glasplatten waren abwechselnd durchsichtig oder matt, bildeten zwischen den Säulen die Wände. Wir machten am Mittelbau Halt, vor dem Tor, das den ganzen Raum zwischen zwei Säulen, zehn Meter breit und zwölf Meter hoch, einnahm. Die Decke des ersten Stockwerks durchschnitt horizontal den Mittelraum des Tores; etliche Schienenpaare mündeten beim Tor, zogen sich durch den äußeren Korridor.
Wir glitten zur halben Höhe des Tores, und jählings stürzte sich das alles verschlingende Geräusch der Maschinen aus dem zweiten Stockwerk auf uns nieder. Uebrigens war dieses Stockwerk nicht im eigentlichen Sinne des Wortes ein eigenes, abgetrenntes Stockwerk; es war vielmehr ein Netz aus Luftbrücken, das über den gewaltigen, mir unbekannten Maschinen schwebte. Wenige Meter über den Maschinen befand sich ein ähnliches Netz, noch höher ein drittes, viertes, fünftes; diese Netze bestanden aus einem Glasparkett, das von vierkantigen Eisengittern eingefaßt war; alle waren durch Fallgatter und Stufen miteinander verbunden, und jedes Netz war kleiner, als das vorhergehende.
Weder Dunst, noch Ruß, noch Gestank, noch Staub. In der reinen, frischen Luft arbeiteten die Maschinen kraftvoll und gleichmäßig, das Licht war nicht schmerzlich grell, doch drang es überall hin. Die Maschinen schnitten, sägten, hobelten ungeheuere Eisenstücke, Aluminium, Nickel, Kupfer. Hebel, stählernen Riesenhänden ähnlich, bewegten sich gleichmäßig und glatt, große Plattformen glitten mit sorgfältig berechneter Genauigkeit hin und her; die Räder und Transmissionsriemen schienen hingegen unbeweglich. Hier herrschte nicht die rohe Gewalt des Feuers und Dampfes; die feine und dabei weit mächtigere Kraft der Elektrizität war die Seele dieses unheimlichen Mechanismus.
Sogar der Lärm der Maschinen schien, sobald man sich ein wenig daran gewöhnt hatte, schier melodisch, ausgenommen in jenen Augenblicken, da der gewaltige Hammer niederschlug, und von dem mächtigen Schlag alles ringsum erbebte.

Hunderte von Arbeitern gingen gelassen durch den Raum; in dem Meeresrauschen der Maschinen waren ihre Schritte und Stimmen nicht vernehmbar. Auf ihren Zügen lag keine angespannte Sorge, sondern bloß ruhige Aufmerksamkeit; sie glichen wißbegierigen, gelehrsamen Betrachtern; es interessierte sie nur, zu sehen, wie die ungeheueren Metallstücke auf den unter der durchsichtigen Kuppel gelegenen Schienenplattformen in die eiserne Umarmung der dunklen Ungeheuer stürzten, wie die Ungeheuer diese mit ihren starken Kinnbacken zermalmten, mit den schweren, harten Tatzen festhielten, mit den scharfen, glänzenden Krallen durchbohrten und schließlich, im grausamen Spiel innehaltend, sie auf die andere Seite zu den dort befindlichen elektrischen Eisenbahnwaggons beförderten, als prächtige Maschinenteile, deren Bestimmung rätselhaft war. Es erschien völlig natürlich, daß die stählernen Ungeheuer die kleinen großäugigen Betrachter nicht anrührten, die so vertrauensvoll zwischen ihnen dahinschritten. Diese Tatsache entsprang der Geringschätzung ihrer Schwäche, der Erkenntnis, daß diese kleinen Geschöpfe eine allzu unbedeutende Beute seien, unwürdig der ungeheueren Kraft der Giganten. Unmerkbar und unsichtbar waren jene Fäden, die das zarte Menschenhirn mit dem unzerstörbaren Organ des Mechanismus verbanden.
Als wir endlich den Bau verließen, fragte der uns führende Techniker, ob wir sofort die anderen Gebäude besichtigen, oder ob wir uns zur Erholung eine kleine Unterbrechung gönnen wollten? Ich war für eine Unterbrechung.
„Ich sah nun die Maschinen und die Arbeiter“, sprach ich. „Die Organisation der Arbeit jedoch vermag ich mir nicht vorzustellen. Und gerade darüber möchte ich Sie befragen.“
Statt einer Antwort führte uns der Techniker in einen kubisch gebauten, zwischen dem Mittel- und einem Eckgebäude gelegenen Bau. Aehnlicher Bauten gab es noch drei, die alle die analoge Lage hatten. Die schwarzen Mauern waren mit Reihen von glänzend weißen Zeichen bedeckt; dies waren die statistischen Arbeitstabellen. Auf der einen, mit Nummer eins bezeichneten, stand:
„Der Maschinen-Betrieb verfügt über einen Ueberschuß von 968757 täglichen Arbeitsstunden, davon 11325 Arbeitsstunden erfahrener Spezialisten.
Die Fabrik weist einen Ueberschuß von 753 Stunden auf, davon 29 Stunden erfahrener Spezialisten.
In den folgenden Zweigen herrscht kein Mangel an Arbeitskraft: in der Landwirtschaft, in den Bergwerken, bei den Erdarbeiten, in den chemischen Betrieben usw. (Die verschiedenen Arbeitszweige wurden in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt.)“
Auf der Tabelle, die die Nummer zwei trug, war zu lesen:
„In den Konfektionsbetrieben ist ein Mangel von 392685 täglichen Arbeitsstunden, davon 21380 Arbeitsstunden erfahrener Mechaniker für Spezialmaschinen und 7852 Arbeitsstunden der Spezialisten für Organisation.“
„Die Schuhfabriken benötigen 79360 Arbeitsstunden, davon ...“ usw.
„Das Institut für Rechnungswesen benötigt 3078 Arbeitsstunden ...“
Der Inhalt der Tabellen Nummer drei und vier war ein ähnlicher. Auf den Listen der Arbeitszweige stand auch die Erziehung von kleinen, sowie von mittelgroßen Kindern, medizinische Hilfe für die Stadt, oder für Landbezirke usw.
„Weshalb ist der Ueberschuß an Arbeitskraft nur in der Maschinenfabrik so genau angegeben, der Mangel an Arbeitskräften jedoch überall so ausführlich vermerkt?“ fragte ich.
„Das ist leicht zu erklären“, entgegnete Menni. „Vermittels dieser Tabellen wird die Verteilung der Arbeit vorgenommen. Dazu ist nötig, daß ein jeder zu sehen vermöge, wo die Arbeitskräfte nicht ausreichen, in welchem Maße sie fehlen. Dann vermag der Mensch, der für zwei Beschäftigungen die gleiche oder verhältnismäßig gleiche Neigung besitzt, jene der beiden Beschäftigungen zu wählen, bei der es an Arbeitskraft gebricht. Den genauen Ueberschuß an Arbeitskraft zu kennen, ist jedoch nur dort vonnöten, wo dieser Ueberschuß besteht. Auf diese Art kann jeder Arbeiter selbst die Berechnung und das Maß des Ueberschusses feststellen, sowie seine Neigung, die Beschäftigung zu wechseln.“
Während wir so sprachen, bemerkte ich plötzlich, daß auf den Tabellen einige Zahlen verschwanden und durch andere, neue, ersetzt wurden. Ich fragte, was dies bedeute.
„Die Zahlen ändern sich stündlich“, erklärte Menni. „Im Verlauf einer Stunde melden einige tausend Arbeiter ihren Wunsch, zu einer anderen Arbeit überzugehen. Dies wird vom zentralen statistischen Apparat vermerkt, und die Mitteilung wird auf elektrischem Wege stündlich weitergeleitet.“
„Auf welche Art vermag der zentrale statistische Apparat die Zahlen des Ueberschusses und des Mangels festzustellen?“
„Unser Institut für Rechnungswesen besitzt überall seine Agenturen; diese verfolgen genau die Bewegung in der Produktion, die Warenmengen der einzelnen Betriebe, die Zahl der dort schaffenden Arbeiter. Auf diesem Weg wird genau ersichtlich, wieviel Arbeitsstunden erforderlich sind. Das Institut berechnet, welcher Unterschied zwischen den tatsächlichen und den erforderlichen Arbeitsstunden in den einzelnen Betrieben besteht, und gibt dies überall bekannt. Die Flut der Freiwilligen verteilt sich auf gleichmäßige Art.“
„Ist das Anrecht auf Produkte in keiner Weise eingeschränkt?“
„Nein; jeder nimmt das, was er braucht, nimmt soviel, wie er will.“
„Und wird niemals etwas unserem Gelde entsprechendes verlangt? Ein Beweis für die Menge der geleisteten Arbeit, oder der Verpflichtung, diese zu leisten?“
„Keineswegs. Bei uns ist die Arbeit frei, es herrscht an nichts Mangel. Der erwachsene soziale Mensch fordert nur eines: Arbeit. Wir brauchen ihn weder auf verhüllte noch auf offene Art zur Arbeit zu zwingen.“
„Wenn aber die Forderungen durch nichts begrenzt werden, ergibt sich daraus nicht die Möglichkeit scharfer Schwankungen, die alle Berechnungen des Instituts über den Haufen werfen?“
„Selbstverständlich nicht. Der einzelne Mensch kann für einen oder zwei Menschen essen, ja auch die für drei Leute bestimmte Menge von Nahrungsmitteln verzehren, oder aber er kann in zehn Tagen zehn Anzüge tragen; bei einer Gesellschaft von dreitausend Millionen Menschen hingegen gibt es keine derartigen Schwankungen. Bei so großen Zahlen bedeuten die Schwankungen nach der einen oder anderen Seite hin nichts, verteilen sich gleichmäßig; der Durchschnitt verändert sich äußerst langsam, in strenger, gesetzmäßiger Kontinuität.“
„Dann arbeitet also Ihre Statistik völlig automatisch, ist weiter nichts, als eine Berechnung?“
„Das will ich nicht sagen. Es gibt dabei auch große Schwierigkeiten. Das Institut für Rechnungswesen muß scharfsichtig alle neuen Erfindungen verfolgen, sowie die durch diese im Betrieb hervorgerufenen Veränderungen, damit es diese richtig einzuschätzen vermag. Erscheint eine neue Maschine, so fordert dies nicht nur eine Veränderung der Arbeit in jenen Betrieben, wo sie benützt wird, sondern auch in den Maschinenfabriken, und bisweilen in den Betrieben für Rohmaterial bei ganz anderen Zweigen. Wird eine Erzgrube erschöpft, oder werden neue mineralische Reichtümer entdeckt, so bedeutet das abermals eine völlige Veränderung der Arbeit in einer ganzen Reihe von Betrieben, – in den Bergwerken, dem Bau der Eisenbahnstrecken usw. All dies muß von allem Anfang an berechnet werden, wenn auch nicht ganz genau, so doch annähernd, und das ist keineswegs leicht, solange nicht die Daten von Augenzeugen erbracht werden können.“
„Bei derartigen Schwierigkeiten“, bemerkte ich, „ist es offensichtlich nötig, stets über einen Vorrat an überschüssigen Arbeitskräften zu verfügen?“
„Ja, gerade dies ist der Stützpunkt unseres Systems. Vor zweihundert Jahren, als die kollektive Arbeit nur gerade genügte, um die Forderungen der Gesellschaft zu befriedigen, war eine völlige Genauigkeit der Berechnung unentbehrlich, und die Verteilung der Arbeit konnte nicht ganz frei sein. Es gab Pflicht-Arbeitstage, und die Verteilung derselben fand nicht immer die Zustimmung unserer Genossen. Doch brachte jede Erfindung, wenngleich sie zuerst vorübergehende statistische Schwierigkeiten bedeutete, eine gewaltige Erleichterung der Aufgabe. Zuerst wurden die Arbeitstage gekürzt, dann, als sich allerorts ein Ueberschuß an Arbeitskraft zeigte, wurde die Verpflichtung zur Arbeit endgültig aufgehoben. Beobachten Sie, wie unbedeutend die Zahlen sind, die sich auf den Mangel an Arbeitsstunden beziehen: tausend, zehn-, hunderttausend Arbeitsstunden, nicht mehr, – und dies bei Millionen und zehn Millionen von Arbeitsstunden, die in den Betrieben unnötig verbracht werden.“
„Dennoch besteht ein Mangel an Arbeitsstunden“, warf ich ein. „Freilich dürfte er durch den darauffolgenden Ueberschuß gedeckt werden.“
„Nicht bloß durch diesen Ueberschuß. Bei den lebenswichtigen Betrieben wird derart gearbeitet, daß die Grundziffern noch überboten werden. In den für die Gesellschaft wichtigsten Industriezweigen – den Betrieben für Lebensmittel, Kleidung, Maschinen, Bauten – erreicht dieses Ueberangebot die Höhe von 6 Prozent, bei den weniger wichtigen 1 bis 2 Prozent. Auf diese Art drücken die den Mangel bezeichnenden Zahlen, allgemein gesprochen, nur den relativen, aber nicht den absoluten Mangel aus. Selbst wenn auf den Tabellen ein Mangel von zehn- und hunderttausend Arbeitsstunden vermerkt ist, so bedeutet dies noch nicht, daß die Gesellschaft unter einem wirklichen Mangel leidet.“
„Wieviel Stunden werden täglich vom Einzelnen, zum Beispiel in dieser Fabrik, gearbeitet?“
„Die meisten arbeiten zwei, anderthalb und zweieinhalb Stunden“, erwiderte der Techniker. „Doch gibt es auch welche, die länger oder kürzer arbeiten. Jener Genosse dort, der den großen Hammer handhabt, läßt sich derart von seiner Arbeit fortreißen, daß er niemandem gestattet, ihn abzulösen, ehe nicht die volle Arbeitszeit, sechs Stunden, vorüber ist.“
Ich übertrug im Gedanken die Marszahlen auf irdische Zahlen: ihr Tag bestand, da ihre Stunden etwas länger waren aus zehn Stunden. Demzufolge war ein Arbeitstag von vier, fünf, sechs Stunden ungefähr unserem Arbeitstag von fünfzehn Stunden gleich, – einer Arbeitszeit, die nur bei den ausbeuterischsten Unternehmen vorkam.
„Ist es denn für den Genossen am großen Hammer nicht schädlich, so lange zu arbeiten?“ fragte ich.
„Bisher noch nicht“, entgegnete Netti. „Er wird sich diesen Luxus noch ein halbes Jahr lang gestatten können. Ich habe ihn selbstverständlich auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die ihm von seiner Leidenschaft drohen. Eine derselben ist die Möglichkeit eines krampfartigen psychischen Anfalls, der ihn mit unwiderstehlicher Kraft unter den Hammer reißen würde. Im Vorfahr ereignete sich in dieser Fabrik ein derartiger Fall mit einem jungen Mechaniker, der ebenfalls die starken Empfindungen liebte. Dank eines glücklichen Zufalls gelang es, den Hammer aufzuhalten, und der unfreiwillige Selbstmord mißlang. Die Gier nach starken Empfindungen ist an und für sich noch keine Krankheit, doch kann sie sich leicht in eine verwandeln, falls das Nervensystem durch Erschöpfung, seelische Kämpfe oder eine zufällige Krankheit erschüttert ist. Selbstverständlich verliere ich niemals jene Genossen aus dem Auge, die sich hemmungslos der gleichen Arbeit hingeben.“
„Sollte aber nicht jener Genosse, von dem die Rede ist, seine Arbeitszeit auch schon deshalb abkürzen, weil in der Maschinenfabrik ein Ueberschuß an Arbeitsstunden besteht?“
„Selbstverständlich nicht“, lachte Menni. „Weshalb sollte gerade er das Gleichgewicht herstellen? Die Statistik verpflichtet keinen. Jeder nimmt sie zur Kenntnis, doch kann er sich nicht einzig und allein von ihr leiten lassen. Wenn es Sie danach verlangte, baldigst in dieser Fabrik zu arbeiten, so würden Sie höchstwahrscheinlich eine Anstellung finden, und die statistische Zahl des Ueberschusses würde sich auf ein bis zwei Stunden vergrößern. Der Einfluß der Statistik macht sich bei der Massen-Umstellung der Arbeit ununterbrochen bemerkbar, doch ist jeder Einzelne frei.“
Wir hatten uns nun zur Genüge ausgeruht und gingen daran, die Besichtigung der Fabrik fortzusetzen. Nur Menni begab sich heim, denn er war ins Laboratorium gerufen worden.
Am Abend beschloß ich, bei Netti zu bleiben; er versprach, mir am folgenden Tag das „Haus der Kinder“ zu zeigen, wo seine Mutter eine der Erzieherinnen war.
Das „Haus der Kinder“ nahm den wichtigsten und schönsten Teil einer Stadt von fünfzehn- bis zwanzigtausend Einwohnern ein. Diese Einwohner bestanden freilich hauptsächlich aus Kindern und deren Erziehern. Es gab in allen größeren Städten auf dem Planeten derartige Anstalten, in vielen Fällen bildeten sie sogar selbständige Städte; bloß an kleineren Orten, wie etwa in Mennis „Chemischer Stadt“, fehlten sie bisweilen.
Das große zweistöckige Haus mit dem üblichen blauen Dach lag in von Bächen durchzogenen Gärten; hier gab es auch Teiche, Spiel- und Turnplätze, Gemüsegärten, Blumen und nützliche Gräser, Häuschen für zahme Tiere und Vögel ... Eine Menge kleiner Ungeheuer spielten dort, man vermochte, dank der für Mädchen und Knaben gleichen Bekleidung, nicht zu unterscheiden, welchem Geschlecht sie angehörten ... Es war ja auch bei den erwachsenen Marsbewohnern schwierig, der Kleidung nach die Männer von den Frauen zu unterscheiden, – die Grundzüge der Gewänder waren die gleichen, nur bei kleinen Einzelheiten bestand ein Unterschied: die engeren Gewänder der Männer paßten sich genauer an den Körper an, während bei den Frauen dieser mehr verhüllt wurde. Jedenfalls aber war die ältliche Person, die uns beim Verlassen der Gondel an der Tür eines der großen Häuser begrüßte, eine Frau, denn Netti umarmte sie und nannte sie „Mama“. Im weiteren Gespräch jedoch redete er sie, gleich den anderen Genossen, nur mit dem Namen: „Nella“ an.
Nella hatte bereits gewußt, daß wir kommen würden und führte uns sofort in das „Haus der Kinder“, zeigte uns alle Abteilungen, bei der von ihr geleiteten für die Allerkleinsten beginnend, bis zu jener, die für die ans Knaben- und Mädchenalter grenzenden Kinder bestimmt war. Unterwegs schlossen sich uns die kleinen Ungeheuer an, betrachteten mit ihren riesigen Augen den Menschen, der von einem anderen Planeten stammte; sie wußten genau, wer ich sei, und als wir die letzte Abteilung erreichten, begleitete uns bereits eine ganze Schar, wenngleich die meisten Kinder seit dem Morgen im Garten spielten.
Im Haus der Kinder lebten etwa dreihundert Kinder verschiedenen Alters. Ich fragte Nella, weshalb die verschiedenaltrigen Kinder zusammen, und nicht in einzelnen Häusern untergebracht waren, was doch sicherlich die Arbeit der Erzieher erleichtern und vereinfachen würde.
„Weil es auf diese Art keine wirkliche Erziehung geben könnte“, erwiderte Nella. „Um für die Gesellschaft erzogen zu werden, muß das Kind ein gesellschaftliches Leben führen. Jede lebendige Erfahrung, jedes lebendige Wissen verbindet die Kinder miteinander. Wollten wir das eine Alter vom anderen isolieren, so gäben wir den Kindern dadurch ein einseitiges und enges Milieu, in dem die Entwicklung der zukünftigen Menschen nur langsam, träge und einseitig vor sich ginge. Die verschiedenen Alter hingegen lassen der Aktivität weit mehr Spielraum. Die älteren Kinder sind unsere besten Gehilfen beim Erziehen der Kleinen. Doch bringen wir nicht nur deshalb absichtlich die Kinder der verschiedenen Altersstufen zusammen, sondern die Erzieher in jedem Kinderhaus bemühen sich auch, die verschiedenen Alter und verschiedenen praktischen Eigenheiten gleichsam zu sammeln.“
„Dennoch sind in diesem Haus der Kinder die Kleinen dem Alter nach in den verschiedenen Abteilungen untergebracht“, warf ich ein. „Dies widerspricht Ihren Worten.“
„Die Kinder begeben sich nur in die verschiedenen Abteilungen, um dort zu schlafen und zu speisen; hierbei muß man selbstverständlich die einzelnen Altersstufen trennen. Beim Spiel und der Beschäftigung jedoch gruppieren sich die Kinder, wie es ihnen beliebt. Auch wenn irgend welche belletristischen oder wissenschaftlichen Vorträge gehalten werden, finden sich unter den Zuhörern stets auch Kinder aus anderen Abteilungen ein. Die Kinder wählen sich selbst ihren Umgang, und lieben es, mit den andersaltrigen Kameraden, vor allem aber mit den Erwachsenen zu verkehren.“
„Nella“, rief aus der Menge hervorspringend ein kleiner Junge. „Esta hat das Schiff, das ich selbst verfertigt, fortgenommen. Nimm es ihr wieder und gib es mir.“
„Wo ist sie?“ fragte Nella.
„Sie lief zum Teich, um das Schiff auf dem Wasser schwimmen zu lassen“, erklärte das Kind.
„Ich habe jetzt keine Zeit, um dorthin zu gehen; eines von den älteren Kindern soll mit dir gehen und Esta sagen, sie möge dich nicht kränken. Am besten aber wäre es, du gingest allein hin und hülfest ihr, das Schiff schwimmen zu lassen. Es ist gar nicht erstaunlich, daß ihr das Schiff gefällt, wenn du es schön gemacht hast.“
Das Kind lief fort und Nella wandte sich an die Uebrigen.
„Hört Kinder, es wäre gut, wenn Ihr uns allein ließet. Dem Fremden kann es nicht angenehm sein, von hundert Kinderaugen angestarrt zu werden. Stelle dir einmal vor, Elwi, daß dich eine ganze Schar Fremder anstarrte. Was tätest du?“
„Ich liefe fort“, entgegnete tapfer das uns zunächst stehende Kind, an das sich Nella gewandt hatte. Und schon im gleichen Augenblick rannten alle Kinder lachend von dannen.
„Da sehen Sie selbst, wie mächtig die Vergangenheit ist“, meinte lächelnd die Erzieherin. „Man könnte glauben, bei uns herrsche vollkommener Kommunismus, von dem die Kinder fast nie abweichen, – woher stammt das Gefühl des Privateigentums? Da kommt nun ein Kind und sagt „mein“ Schiff, das „ich selbst“ verfertigt habe. Und derartiges ereignet sich häufig, führt manchmal bis zu Prügeleien. Dagegen läßt sich nichts tun – ein allgemeines Lebensgesetz lautet: die Entwicklung des Organismus gibt im verkleinerten Maßstab die Entwicklung des Aeußeren wieder, und die Entwicklung des Einzelnen wiederholt auf gleiche Art die Entwicklung der Gesellschaft. Der Selbstbestimmung der Kinder mittleren und reiferen Alters eignet in vielen Fällen dieser unklar individualistische Charakter. Und diese Färbung wird mit der Reife stärker. Nur bei der jüngsten Generation besiegt das sozialistische Milieu endgültig die Reste der Vergangenheit.“
„Machen Sie die Kinder mit dieser Vergangenheit bekannt?“ fragte ich.
„Selbstverständlich. Sie lieben sehr die Gespräche und Erzählungen über vergangene Zeiten. Zuerst erscheinen diese ihnen als Märchen, als schöne, ein wenig seltsame Märchen von einer anderen Welt, die mit ihren aufregenden Bildern des Krieges und der Gewalt in den atavistischen Tiefen des Kinderinstinktes einen Widerhall finden. Die unbesieglichen lebendigen Ueberreste der Vergangenheit, die es in der eigenen Seele findet, ermöglichen dem Kinde genau den Zusammenhang der Zeiten zu erkennen, die Märchen und Bilder verwandeln sich in wahrhafte Weltgeschichte, – in die lebendigen Glieder einer unzerreißbaren Kette.“
Wir durchwanderten die Alleen eines weiten Gartens, begegneten von Zeit zu Zeit Kindergruppen, mit Spielen beschäftigt, Graben auswerfend, mit Werkzeugen arbeitend, in ernste Gespräche vertieft, oder lebhaft plaudernd. Alle wandten sich mir mit Aufmerksamkeit zu, doch folgte uns niemand; anscheinend waren sie bereits von den andern benachrichtigt worden. Die meisten Gruppen bestanden aus Kindern verschiedenen Alters; in vielen gab es auch ein bis zwei Erwachsene.
„In diesem Hause sind viele Erzieher“, bemerkte ich.
„Ja, besonders wenn wir, was nur gerecht ist, die größeren Kinder dazu rechnen. Wirkliche Erziehungsspezialisten gibt es hier nur drei; die übrigen Erwachsenen, die Sie sehen, sind zum großen Teil Väter und Mütter, die auf kurze Zeit bei ihren Kindern leben, oder junge Leute, die sich für den Erzieherberuf vorbereiten wollen.“
„Wie, es ist den Eltern gestattet, hier mit ihren Kindern zu leben?“ „Natürlich. Einige der Mütter leben etliche Jahre hier. Die meisten jedoch kommen von Zeit zu Zeit her, verbringen hier eine Woche, zwei Wochen, einen Monat. Die Väter leben selten hier. In unserem Haus gibt es sechzig Einzelzimmer für die Eltern, oder für jene Kinder, die den Wunsch nach Einsamkeit verspüren. Ich entsinne mich nicht, daß diese Zimmer je unbenützt blieben.“
„Es kommt demnach auch vor, daß Kinder nicht in den allgemeinen Räumen leben?“
„Ja; die älteren Kinder verlangt es häufig danach, abgesondert zu leben. Dies ist zum Teil ein Ueberrest jenes unbesieglichen Individualismus, von dem ich bereits sprach, zum Teil das bei Kindern häufige Verlangen, sich in die Studien zu vertiefen, der Wunsch, all das zu verbannen, was die Aufmerksamkeit ablenkt und zerstreut. Gibt es doch bei uns auch Erwachsene, die einsam zu leben wünschen, insbesondere jene, die sich mit wissenschaftlichen Forschungen, oder aber mit Kunst beschäftigen.“
In diesem Augenblick sahen wir vor uns auf einer kleinen Wiese ein Kind, – es mochte sechs oder sieben Jahre zählen – das, mit einem Stock in der Hand, ein Tier verfolgte. Wir beschleunigten unsere Schritte; das Kind beachtete uns nicht. Als wir an es herantraten, hatte es eben seine Beute erreicht – diese schien eine Art großer Frosch zu sein. Das Kind schlug heftig auf die Pfote des Tieres los. Dann schleppte sich das Tier mit gebrochener Pfote langsam über den Rasen.
„Weshalb tatest du dies, Aldo?“ fragte Nella in aller Ruhe.
„Ich konnte es nicht fangen, es lief immer fort“, erklärte der Knabe.
„Weißt du auch, was du tatest? Du hast dem Frosch weh getan und ihm die Pfote gebrochen. Gib den Stock her, ich werde es dir erklären.“
Das Kind gab Nella den Stock, und diese schlug ihm mit rascher Bewegung kräftig auf die Hand. Der Knabe schrie auf.
„Tut es weh, Aldo?“, fragte die Erzieherin gelassen.
„Sehr weh; böse Nella!“, entgegnete das Kind.
„Ich verletzte dir nur leicht die Hand, du aber hast den Frosch noch viel stärker geschlagen. Hast ihm die Pfote gebrochen. Er hat nicht nur viel größere Schmerzen, als du, sondern kann auch nicht mehr laufen und springen, kann sich nicht mehr seine Nahrung suchen, wird vor Hunger sterben, oder von einem bösen Tier, dem er jetzt nicht entfliehen kann, verschlungen werden. Was denkst du darüber, Aldo?“
Das Kind schwieg; in seinen Augen standen Tränen des Schmerzes, es hielt die verletzte Hand mit der anderen fest. Dann sagte es: „Man muß ihm die Pfote flicken.“
„Das ist richtig“, erwiderte Netti. „Komm, ich werde dir zeigen, wie man es macht.“
Sie begaben sich zu dem verwundeten Tier, das sich nur auf wenige Schritte hatte entfernen können. Netti nahm sein Taschentuch hervor, zerriß es in Streifen, gebot Aldo, einige dünne Zweiglein zu bringen. Mit dem tiefen Ernst echter Kinder, die einer äußerst wichtigen Beschäftigung obliegen, legten sie beide dem Frosch einen festen Verband an.
Bald darauf schickten Netti und ich uns an, heimzukehren.
„Ach ja“, erinnerte sich Nella. „Heute Abend können Sie bei uns Ihren alten Freund Enno antreffen. Er wird den älteren Kindern eine Vorlesung über den Planeten Venus halten.“
„Wohnt er denn in dieser Stadt?“ erkundigte ich mich.
„Nein, das Observatorium, in dem er arbeitet, liegt auf drei Stunden von hier. Aber er liebt die Kinder sehr und vergißt auch mich, seine alte Erzieherin, nicht. Deshalb kommt er häufig her und erzählt den Kindern jedesmal etwas interessantes.“
Am Abend fanden wir uns selbstverständlich zur festgesetzten Stunde abermals im „Hause der Kinder“ ein. Alle Kinder, mit Ausnahme der allerkleinsten, hatten sich bereits versammelt; unter ihnen befanden sich auch einige Erwachsene. Enno begrüßte mich freudig.
„Ich wählte Ihnen zuliebe dieses Thema“, meinte er scherzend. „Sie sind betrübt über die Rückständigkeit Ihres Planeten und die schlechten Sitten der dort lebenden Menschheit. Ich werde von einem Planeten erzählen, wo die höchsten Vertreter des Lebens – Dinosaurier und fliegende Eidechsen sind, bei denen ärgere Sitten und Gebräuche herrschen, als bei Ihrer Bourgeoisie. Dort brennen Euere Steinkohlen nicht im Herde des Kapitalismus, sondern befinden sich noch im Pflanzenzustand, als gewaltige Wälder. Wollen wir uns dorthin begeben und zusammen auf die Ichthyosaurusjagd gehen? Diese Tiere stellen die dortigen Rothschilds und Rockefellers vor; freilich sind sie gemäßigter und gelinder als die Ihren, dafür aber besitzen sie weniger Kultur. Dort finden wir das Reich der ersten Kapitalsanhäufung in ihren Uranfängen, die im „Kapitalismus“ Ihres Marx vergessen wurde ... Aber Nella runzelt schon die Stirne über mein leichtfertiges Geschwätz. Ich beginne sofort.“
Mit hinreißender Beredsamkeit schilderte er den fernen Planeten mit den tiefen, sturmgepeitschten Ozeanen, den furchtbar hohen Bergen, der brennenden Sonne, den dichten, weißen Wolken, den schauerlichen Orkanen und Gewittern, den unförmigen Ungeheuern und der üppigen, riesenhaften Vegetation. Seine Erzählung illustrierte er durch die Vorführung lebendig wirkender Photographien, die auf der über die eine Wand des Saales gespannten Leinwand dahinzogen. Einzig und allein Ennos Stimme durchtönte die Dunkelheit; tiefes, aufmerksames Schweigen herrschte im ganzen Raum. Als er das Schicksal der ersten Reisenden in jener Welt schilderte und berichtete, wie einer derselben mit einer Handgranate eine Rieseneidechse tötete, spielte sich eine seltsame, von den meisten Zuhörern nicht bemerkte, kleine Szene ab. Aldo, der sich in Nellas Nähe hielt, brach plötzlich in leises Weinen aus.
„Was fehlt dir?“ fragte Nella, sich zu ihm niederbeugend.
„Das Ungeheuer tut mir leid. Man hat ihm weh getan und dann mußte es sterben“, flüsterte der Knabe.
Nella schlang den Arm um den Kleinen und versuchte ihn zu beschwichtigen, doch dauerte es lange Zeit, bis er sich beruhigte.
Enno berichtete von den zahllosen einzigartigen Reichtümern dieses herrlichen Planeten, von den gewaltigen, viele Millionen Pferdekräfte besitzenden Wasserfällen, von den Edelmetallen, die sich auf den Gipfeln der Berge befinden, von den reichen Radiumlagern, die schon bei einer Tiefe von etlichen hundert Metern zutage gefördert werden könnten, von dem Vorrat an Energie für hunderttausend Jahre. Ich beherrschte die Sprache noch nicht genügend, um die ganze Schönheit des Vortrags zu empfinden, die Bilder aber fesselten meine Aufmerksamkeit im gleichen Maße, wie die der Kinder. Als Enno endete und der Saal erhellt ward, wurde mir schier ein wenig traurig zumute, wie mochten da wohl erst die Kinder das Ende des schönen Märchens bedauern.
Als der Vortrag zu Ende war, begannen die Zuhörer Fragen zu stellen, ihre Bemerkungen zu machen. Die Fragen waren verschiedenartig, wie es ja auch die Zuhörer waren; sie betrafen die Genauigkeit der Photographien, die Mittel, die im Kampf gegen die Natur angewendet wurden. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, wann sich auf der Venus von selbst Menschen entwickeln würden und wie deren Körper beschaffen sein werde?
Die Bemerkungen waren meist naiv, häufig jedoch scharfsinnig; sie wandten sich vor allem gegen Ennos Behauptung, daß zu unserer Zeit die Venus für die Menschen ein äußerst nutzloser Planet sei und daß es kaum möglich sein würde, ihre gewaltigen Reichtümer bald auszubeuten. Gegen diese Ansichten lieferten die jungen Optimisten einen erbitterten Kampf, dem sich die meisten anschlossen. Enno bewies ihnen, daß die Sonnenglut und die feuchte Luft eine Unmenge Bazillen hervorbringe, die für die Menschen äußerst gefährlich seien, sie mit vielen Krankheiten bedrohten; dies erfuhren alle Reisenden auf der Venus am eigenen Leibe, sowie auch, daß die Orkane und gewaltigen Gewitter jegliche Arbeit erschwerten, das Leben der Menschen gefährdeten, und dergleichen mehr. Die Kinder jedoch fanden, es sei merkwürdig, sich von derartigen Hindernissen abschrecken zu lassen, wenn es um die Eroberung eines so herrlichen Planeten gehe. Zur Bekämpfung der Bakterien und Krankheiten müßte man so rasch wie möglich Tausende von Aerzten auf die Venus senden, und auch den Orkanen und Gewittern könnte Trotz geboten werden, indem man hunderttausend Bauarbeiter hinschickt, die überall dort, wo es nötig ist, hohe Mauern errichten und Blitzableiter anbringen. „Mögen neun, zehn und mehr Menschen umkommen!“ rief ein entflammter zwölfjähriger Knabe. „Dort gibt es Dinge, um derentwillen es sich zu sterben lohnt, es kommt ja nur darauf an, den Sieg zu erringen.“ Und seine glühenden Augen verrieten, daß er sich nicht weigern würde, zu jenen zehn Menschen zu gehören.
Sanft und gelassen warf Enno diese Kartenhäuser über den Haufen; doch war ihm anzumerken, daß er in der Tiefe seiner Seele das gleiche empfinde wie die Kinder, und daß seine junge lodernde Phantasie entschlossene Pläne verberge, die zwar bedachter und ausgeklügelter waren, aber ebenso hartnäckig. Er selbst war noch nicht auf der Venus gewesen, und seine Begeisterung bewies klar, wie sehr ihn deren Schönheit und Gefahren anzogen.
Als der Gedankenaustausch beendet war, verließ Enno mit mir und Netti den Saal. Er beschloß, noch einige Tage in dieser Stadt zu verweilen und schlug mir vor, am folgenden Tag das Kunstmuseum zu besichtigen. Netti würde beschäftigt sein; er war in eine andere Stadt zu einem großen Aerztekonsilium gerufen worden.
„Ich hätte nie gedacht, daß auch bei Euch ein eigenes Museum für Kunstgegenstände existiere“, meinte ich, mit Enno dem Museum zustrebend. „Glaubte, daß Bildergalerien und Skulpturausstellungen eine Eigenheit des Kapitalismus mit seinem prunkhaften Luxus und grob zur Schau getragenen Reichtum seien. In der sozialistischen Gesellschaft erwartete ich die Kunst überall im Leben zu finden, als Schmuck dieses Lebens.“
„Darin irren Sie auch nicht“, antwortete Enno. „Der größte Teil der Kunstgegenstände ist bei uns für die Gemeinschaftsgebäude bestimmt, für jene, wo wir unsere allgemeinen Angelegenheiten regeln, wo wir studieren und Forschungen anstellen oder der Ruhe pflegen. Fabriken und Betriebe werden weit weniger geschmückt, die Aesthetik der gewaltigen Maschinen und deren Bewegung ist an und für sich ein schöner Anblick, und es gibt nur wenig Kunstgegenstände, die völlig mit den Maschinen harmonieren, in deren Gegenwart nicht einen abgeschwächten, verminderten Eindruck machten. Am wenigsten aber schmücken wir unsere Häuser, wo wir uns ja auch äußerst selten aufhalten. Unser Kunstmuseum jedoch ist eine ästhetisch-wissenschaftliche Anstalt, eine Schule, in der man die Entwicklung der Kunst zu verfolgen vermag, oder, richtiger gesagt, die Entwicklung der Menschheit in ihrer künstlerischen Tätigkeit.“
Das Museum befand sich auf einer kleinen Insel inmitten eines Sees, durch eine schmale Brücke mit dem Ufer verbunden. Das viereckige Gebäude war von einem Garten umgeben, in dem hohe Springbrunnen plätscherten und unzählige blaue, weiße, schwarze und gelbe Blumen prunkten; außen war es herrlich geschmückt, innen hell von Licht überflutet.
Hier gab es wahrlich nicht jene unsinnige Anhäufung von Gemälden und Statuen wie in den großen Museen der Erde. Vor mir erläuterten einige hundert Abbildungen die Entwicklung der plastischen Kunst, angefangen von den groben, ersten Gegenständen der prähistorischen Zeit bis zu den technisch-idealen Erzeugnissen des letzten Jahrhunderts. Und vom Anfang bis zum Ende war überall der Stempel jener innerlichen Vollkommenheit fühlbar, die wir „Genie“ nennen. Offensichtlich gehörte alles hier ausgestellte zu den besten Erzeugnissen jeder Epoche.
Um die Schönheit einer anderen Welt klar zu erfassen, gilt es, deren Leben genau zu kennen, aber um anderen das Verständnis für diese Schönheit zu übermitteln, dazu muß man selbst deren teilhaftig sein. Deshalb vermag ich auch nicht zu schildern, was ich dort sah; ich vermag nur Andeutungen zu geben, kann bloß ausdrücken, was mich am meisten in Staunen versetzte.
Das Hauptmotiv der Skulptur war bei den Marsbewohnern ebenso wie bei uns der schöne menschliche Körper. Die körperliche Beschaffenheit der Marsbewohner unterscheidet sich nur wenig von jener der Erdenmenschen, abgesehen von der Verschiedenheit der Augen, die zum Teil durch die Schädelformation bedingt ist, doch übersteigt auch diese Verschiedenheit nicht jene, die bei den einzelnen irdischen Rassen vorkommt. Ich kann diesen Unterschied nicht genau erklären, verstehe mich schlecht auf Anatomie; jedenfalls aber gewöhnte sich mein Auge bald an die Marsbewohner, sah in ihnen keineswegs Mißgeburten, sondern vielmehr etwas Originelles.
Ich bemerkte, daß der männliche und weibliche Körperbau weit ähnlicher war, als bei den Erdenrassen; die Breite der Frauenschultern entsprach häufig der der Männer, und das gleiche galt von der Muskulatur. Dies zeigte sich besonders in den Abbildungen aus der letzten Zeit, der Zeit der freien menschlichen Entwicklung; bei den Werken aus der kapitalistischen Periode trat der Unterschied zwischen dem männlichen und weiblichen Körper weit stärker zutage. Anscheinend hatte die häusliche Sklaverei der Frau und das Schuften des Mannes die Körper nach verschiedenen Richtungen hin beeinflußt.
Ich verlor auf keinen Augenblick die bald klare, bald verschwommene Erkenntnis, daß ich vor mir die Bilder einer fremden Welt sehe; sie trugen für mich den Stempel des Seltsamen, Gespenstischen. Sogar die herrlichen Frauenkörper dieser Statuen und Bilder erweckten in mir ein unverständliches Gefühl, das mit dem mir bekannten aesthetisch verliebten Entzücken nichts gemein hatte, sondern vielmehr den unklaren Ahnungen und Empfindungen glich, die mich vor langer Zeit, an der Grenze zwischen Kindheit und Jünglingsalter, heimgesucht hatten.
Die Statuen der frühesten Epochen waren, wie dies auch bei uns der Fall ist, einfarbig. Die späteren jedoch besaßen die Farben der Natur. Dies wunderte mich keineswegs; ich fand stets, daß das Verwerfen der Wirklichkeit nicht ein unentbehrliches Element der Kunst sein könne, ja, daß es sogar unkünstlerisch wirke, insbesondere, wenn es die Mannigfaltigkeit der Wahrnehmung vermindert, wie dies bei einfarbigen Skulpturen der Fall zu sein pflegt. In solchen Fällen wird die künstlerische Idealisierung des konzentrierten Lebens gestört.
Bei den Statuen und Bildern der alten Zeiten herrschte ebenso wie bei unseren antiken Kunstgegenständen große Ruhe und Gelassenheit vor; diese waren voller Harmonie, frei von jeglicher Anspannung. In den folgenden Uebergangsepochen zeigte sich ein anderer Charakter: Leidenschaft, Aufregung, bisweilen gemildert zu irren Träumen, Träumen erotischer oder religiöser Natur, mitunter den schmerzhaften Widerspruch zwischen seelischer und körperlicher Kraft scharf betonend. In der sozialistischen Epoche veränderte sich abermals der Grundcharakter: hier überwogen harmonische Bewegung, gelassen vertrauensvolle Entfaltung der Kräfte, fremd jeder schmerzlichen Vergewaltigung, ein freies Streben, eine lebendige Tätigkeit, das konzentrierte Bewußtsein der Einheitlichkeit des Körpers und der unbesieglichen Vernunft.
Wenn die ideale Frauenschönheit der antiken Zeiten die Möglichkeit grenzenloser Liebe, die der Renaissance den Durst nach mystischer und gefühlicher Liebe ausdrückte, so verkörperte jene, die sich nun meinen Augen zeigte, die Liebe selbst in ihrem ganzen ruhigen und stolzen Selbstbewußtsein – klar, leuchtend, alles besiegend ...
Den späteren sowie den frühesten künstlerischen Schöpfungen eignete ein äußerst einfacher Charakter; sie behandelten ein einziges Motiv. Ihre Aufgabe bestand darin, ein kompliziertes menschliches Wesen wiederzugeben, dessen Leben reich und ausgefüllt war; deshalb wählten sie jenen Augenblick des Lebens, in dem sich irgend ein Gefühl oder ein Streben konzentriert hatte ... Bei den neuesten Künstlern schienen beliebte Themen: die Extase des schöpferischen Gedankens, die Extase der Liebe, die Extase des Naturgenusses, der ruhige freiwillige Tod – lauter Themen, die charakteristisch waren für eine große Rasse, eine Rasse, die intensiv und vollkommen zu leben und bewußt und würdig zu sterben verstand.
Die Abteilung für Gemälde und Skulptur nahm die eine Hälfte des Museums ein; die andere war der Architektur gewidmet. Unter Architektur verstanden die Marsbewohner nicht nur die Aesthetik der Bauten und der großen technischen Konstruktionen, sondern auch die der Möbel, der Werkzeuge, der Maschinen, überhaupt die Aesthetik alles materiell Nützlichen. Welche gewaltige Rolle in ihrem Leben gerade diese Kunst spielte, ließ sich aus dem Reichtum und der Vollständigkeit dieser Sammlung ersehen. Von den ersten Höhlenwohnungen mit den primitiven Geräten bis zu den luxuriösen Gemeinschaftshäusern aus Glas und Aluminium, bis zu den gigantischen Fabriken mit den schauerlich schönen Maschinen, bis zu den gewaltigen Kanälen mit den mächtigen Ufern und Schwebebrücken – war hier alles in der typischen Form dargestellt, in Bildern, Plänen, Modellen, besonders aber in großen Stereoskopen, die eine Illusion der Wirklichkeit gaben. Eine besondere Stelle nahm die Aesthetik der Gärten, der Felder und Parke ein; und wie ungewohnt auch immer mir die Natur dieses Planeten war, so vermochte ich dennoch die Schönheit der Blumen- und Formenkombinationen zu erkennen, die das Kollektivgenie dieses großäugigen Volkes der Natur verliehen hatte.
In den Uebergangsepochen kam es, wie auch bei uns, häufig vor, daß die Pracht die Nützlichkeit beeinträchtigte, der äußere Schmuck hinderlich für die Dauerhaftigkeit wurde; die Kunst vergewaltigte die Gegenstände. Hier jedoch, in den Erzeugnissen der neuen Epoche, schauten meine Augen nichts derartiges, weder bei den Möbeln, noch bei den Geräten oder Konstruktionen. Ich fragte Enno, ob die zeitgenössische Architektur jemals die Neigung zeige, um der Schönheit willen die praktische Vollkommenheit zu vernachlässigen.
„Niemals“, entgegnete er. „Diese wäre eine falsche Schönheit, wäre etwas Gekünsteltes, aber keine Kunst.“
Bis zur sozialistischen Zeit ward das Andenken der großen Männer durch Denkmäler geehrt; jetzt jedoch wurden Denkmäler nur mehr zur Erinnerung an große Ereignisse errichtet: wie etwa der erste Versuch, die Erde zu erreichen, der mit dem Tode aller Mitglieder der Expedition endete, oder aber die völlige Ausrottung einer tödlichen Infektionskrankheit, oder die Entdeckung und Synthese der Spaltung aller chemischen Elemente. Im Stereogramm sah man zusammen mit den Denkmälern Grabmäler und Kirchen. (Früher hatte es bei den Marsbewohnern auch eine Religion gegeben.) Eines der letzten Denkmäler großer Männer war das jenes Ingenieurs, von dem mir Menni erzählt hatte. Es war dem Künstler trefflich gelungen, die ganze Seelenstärke dieses Mannes wiederzugeben, der die Armee der Arbeit siegreich in den Kampf wider die Natur geführt und stolz das feige Urteil der Sitten über seine Tat zurückgewiesen hatte. Als ich in unwillkürlicher Versonnenheit vor dem Panorama dieses Denkmals verweilte, sprach Enno leise einige Verse, in denen der seelischen Verfassung des Helden Ausdruck verliehen wurde.
„Von wem sind diese Verse?“ fragte ich.
„Von mir“, erwiderte Enno. „Ich schrieb sie für Menni.“
Ich vermochte nicht völlig die innere Schönheit dieser mir noch immer fremden Sprache zu beurteilen, aber die Gedanken waren zweifellos klar, der Reim war stark, der Rhythmus klingend und mächtig. Dies lenkte meine Gedanken in eine neue Richtung.
„Euere Dichtung hat also noch strenge Reime und Rhythmus?“
„Selbstverständlich“, entgegnete Enno erstaunt. „Finden Sie das etwa nicht schön?“
„Doch“, erklärte ich, „bei uns hingegen war die Ansicht verbreitet, daß diese Form dem Geschmack der herrschenden Klassen unserer Gesellschaft entspringe, der Ausdruck ihrer Laune und ihrer Leidenschaft für Begrenztes sei, eine Fessel für die freie künstlerische Rede bedeute. Wir glaubten, die Poesie der Zukunft, die Dichtung der sozialistischen Epoche werde diese engen Gesetze abschütteln und vergessen.“
„Das ist völlig falsch“, meinte Enno. „Die reinen Reime erscheinen uns schön, aber keineswegs aus Leidenschaft für das Begrenzte, sondern weil sie zutiefst mit dem rhythmischen Prozeß unseres Lebens und unseres Bewußtseins harmonieren. Und der Rhythmus, der das Vielförmige zu einem einzigen Schlußakkord vereint, hat nicht auch er seinen tiefgründigen Ursprung in der lebendigen Verbindung der Menschen, die das Mannigfache des Aeußern mit der Lust der einheitlichen Liebe krönt? Der Arbeit mit dem einheitlichen Ziel, der Einheitlichkeit der Stimmung in der Kunst? Ohne Reim und Rhythmus gibt es überhaupt keine künstlerische Form. Wo der Rhythmus der Töne fehlt, muß er durch den umso strengeren Rhythmus der Bilder oder Ideen ersetzt werden ... Und wenn Reim und Rhythmus tatsächlich feudalen Ursprungs sind, so läßt sich dies ja auch von vielen anderen guten und schönen Dingen sagen.“
„Aber der Reim an und für sich beschränkt und erschwert den poetischen Ausdruck der Idee.“
„Was hat das zu bedeuten? Diese Begrenzung entspringt dem vom Künstler frei gewählten Ziel. Sie erschwert nicht nur, sondern vervollkommnet auch den Ausdruck der dichterischen Idee, verfolgt ausschließlich diesen Zweck. Je komplizierter das Ziel, desto schwerer der dazu führende Weg und desto größer der Zwang, den sich der Künstler auferlegen muß. Wenn Sie einen schönen Bau errichten wollen, wie viel richtiger Technik und Harmonie bedürfen Sie dabei, das heißt: wie viel „Zwang“ müssen Sie sich auferlegen! Bei der Wahl des Zieles sind Sie frei. Dies ist die einzige menschliche Freiheit. Wenn Sie aber nach dem Ziel verlangen, so verlangen Sie gleichzeitig auch nach den Mitteln, durch die es zu erreichen ist.“
Wir schlenderten in den Garten hinaus, um uns von den zahlreichen Eindrücken zu erholen. Der Abend war bereits niedergesunken, ein klarer milder Frühlingsabend. Die Blumen zogen Kelche und Blätter ein, um sie für die Nacht zu schließen; dies war eine Eigenheit der Marspflanzen, verursacht von den kalten Nächten. Ich wandte mich abermals an meinen Gefährten:
„Sagen Sie mir, welche Art der Belletristik ist heutzutage bei Ihnen die vorherrschende?“
„Im Drama die Tragödie, in der Dichtung die Naturschilderung“, antwortete Enno.
„Was ist der Inhalt der Tragödien? Wo finden Sie bei Ihrem glücklichen friedlichen Dasein den Stoff für Tragödien?“
„Glücklich? Friedlich? Woher nehmen Sie das? Es ist ja wahr, daß bei uns zwischen den Menschen Frieden herrscht, aber keineswegs herrscht Frieden zwischen uns und den Kräften der Natur, das wäre ja auch unmöglich. Diese ist ein Feind, bei dem selbst jeder Sieg eine neue drohende Gefahr bedeutet. In der letzten Epoche der Geschichte haben wir die Ausbeutung unseres Planeten um das zehnfache erhöht, unsere Bevölkerung wächst an und noch weit mehr steigern sich unsere Bedürfnisse. Schon mehr als einmal bedrohte uns auf dem einen oder anderen Arbeitsfeld die Erschöpfung der Naturkräfte und Mittel. Bis heute gelang es uns noch immer, diese Gefahr zu besiegen, ohne zu der hassenswerten Verkürzung des Lebens greifen zu müssen, der Verkürzung des Lebens bei uns selbst und unseren Nachkommen. Aber gerade jetzt nimmt der Kampf abermals einen besonders ernsthaften Charakter an.“
„Ich hätte niemals gedacht, daß bei Ihrer technischen und wissenschaftlichen Vollkommenheit eine derartige Gefahr bestehen könnte. Sie sagten, dies habe sich auf dem Mars bereits ereignet?“
„Ja, vor siebzig Jahren; als unsere Steinkohlenvorräte versiegten und der Uebergang zur Wasser- und Elektrizitätskraft noch lange nicht bewerkstelligt war; damals mußten wir, um die gewaltigen Maschinen herstellen zu können, einen bedeutenden Teil unserer Wälder abholzen, was auf Jahre hinaus unseren Planeten verunstaltete und das Klima verschlechtert hat. Als dann diese Krise überwunden war, zeigte es sich, vor etwa zwanzig Jahren, daß die Eisenerzlager erschöpft waren. Nun galt es, in aller Eile die richtige dauerhafte Legierung des Aluminiums herzustellen, und ein großer Teil unserer technischen Kraft wurde auf die elektrische Gewinnung des Aluminiums aus der Erde verwandt. Heute, da sich, wie auch aus der Statistik ersichtlich ist, die Bevölkerung äußerst rasch vermehrt, wissen wir bereits, daß uns in dreißig Jahren ein furchtbarer Mangel an Lebensmitteln bedrohen wird, falls es uns bis dorthin nicht gelingen sollte, die Synthese des Eiweiß aus den Elementen zu entdecken.“
„Aber die anderen Planeten“, warf ich ein, „könnten Sie nicht auf denen das Fehlende finden?“
„Wo? Die Venus ist anscheinend noch unzugänglich. Und die Erde? Die besitzt ihre eigene Menschheit, und es ist bis heute noch nicht klar ersichtlich, inwieweit wir deren Kräfte ausnützen können. Jede Fahrt nach der Erde verschlingt große Vorräte an radiumausstrahlenden Stoffen; dies weiß ich von Menni, der mir unlängst über seine letzte Expedition berichtete, und unser Vorrat an diesen Stoffen ist ziemlich gering. Nein, die sich uns überall entgegenstellenden Schwierigkeiten sind keineswegs zu unterschätzen, und je enger sich unsere Menschheit im Kampfe gegen die Natur zusammenschließt, desto enger schließen sich auch die Elemente zusammen.“
„Aber es würde doch genügen, die Vermehrung zu beschränken?“
„Die Vermehrung beschränken! Das bedeutete den Sieg der Natur. Bedeutete den Verzicht auf das unbegrenzte Anwachsen des Lebens, bedeutete das Stehenbleiben auf der gleichen Stufe. Wir siegen, weil wir in gewaltigen Massen gegen die Natur vorgehen. Wenn wir aber auf das Anwachsen unseres Heeres verzichten, dann sind wir von allen Seiten durch die Elementargewalten belagert. Dann würde auch der Glaube an unsere Kollektivkraft geschwächt werden, an unser großes Gemeinschaftsleben. Und zusammen mit diesem Glauben ginge auch für jeden Einzelnen der Sinn des Lebens verloren, weil ja doch in jedem von uns die kleine Zelle des großen Organismus lebt, vollständig lebt, und jeder wieder in dieser Zelle sein Dasein hat. Nein, eine Beschränkung der Vermehrung, – das wäre das allerletzte, wozu wir uns entschließen könnten, und wenn dies gegen unseren Willen geschähe, so würde es den Anfang vom Ende bedeuten.“
„Nun begreife ich, daß auch bei Ihnen stets Tragödienstoffe vorhanden sind, zumindest als drohende Möglichkeit. Solange jedoch der Sieg noch auf Seiten der Menschheit ist, sieht sich der Einzelne zur Genüge vor dieser Tragödie der Gemeinschaft bewahrt; ja selbst wenn die Gefahr in unmittelbare Nähe rückt, so verteilen sich die gigantische Anstrengung und die Leiden des Kampfes so gleichmäßig unter den zahllosen Einzelwesen, daß deren ruhiges Glück kaum gestört werden kann. Und zu diesem Glück fehlt anscheinend bei Ihnen nichts.“
„Ruhiges Glück! Ist es denn möglich, daß der Einzelne nicht zutiefst die Erschütterung eines ganzen Lebens, in dem sein Anfang und sein Ende liegt, empfinde? Und zeigen sich nicht auch die tiefen Widersprüche des Lebens in der Begrenztheit des Einzelwesens verglichen mit dessen Ziel, in seiner Ohnmacht, mit diesem Ziel zu verschmelzen, es völlig mit seinem Bewußtsein zu umfassen und sein Bewußtsein selbst aus dem Ziel zu schöpfen? Begreifen Sie diese Widersprüche nicht? Das kommt daher, weil sie in Euerer Welt von anderen, näherliegenden und gröberen Dingen verdunkelt werden. Der Kampf der Klassen, der Gruppen, der Einzelwesen raubt Euch die Idee des Zieles, und zugleich damit das Glück sowie das Leid, die darin enthalten sind. Ich sah Ihre Welt; und ich vermag auch nicht den zehnten Teil des Wahnsinns zu erfassen, in dem Ihre Brüder leben. Eben deshalb vermag ich nicht zu beurteilen, wer von uns dem ruhigen Glück näher ist: je stärker und harmonischer das Leben, desto quälender und unvermeidlicher wirken die Dissonanzen.“
„Sagen Sie, Enno, sind Sie zum Beispiel nicht glücklich? Sie besitzen Jugend, Wissen, Poesie und sicher auch Liebe ... Was können Sie Schweres erfahren haben, daß Sie so glühend von der Tragödie des Lebens sprechen?“
„Das ist prächtig“, lachte Enno, und sein Lachen klang seltsam. „Sie wissen nicht, daß der heitere Enno bereits einmal zu sterben beschlossen hatte. Und wenn Menni nur einen einzigen Tag später sechs Worte geschrieben hätte, in denen unsäglich viel lag: „Wollen Sie auf die Erde mitkommen?“ so würde Ihnen Ihr heiterer Reisegefährte gefehlt haben. Doch kann ich Ihnen augenblicklich nichts Näheres verraten. Sie werden ja selbst sehen, daß, wenn es bei uns ein Glück gibt, dieses keineswegs das friedliche und ruhige Glück ist, von dem Sie sprechen.“
Ich konnte mich nicht entschließen, weitere Fragen zu stellen. Aber ich konnte auch nicht länger systematisch die Kunstsammlung besichtigen. Meine Aufmerksamkeit war abgelenkt, meine Gedanken schweiften umher. In der Abteilung für Skulptur verharrte ich vor einer der neuesten Statuen, die einen schönen Jüngling darstellte. Seine Gesichtszüge erinnerten an Netti; mich erschütterte das Talent, mit dem der Künstler in dem leblosen Stoff, in unvollendeten Zügen, in den glühenden Augen des Knaben die Geburt des Genies wiedergegeben hatte. Lange verweilte ich reglos vor dieser Statue, und die ganze Umgebung entschwand meinem Bewußtsein; Ennos Stimme durchbrach meine Gedanken:
„Das seid Ihr“, sprach er, auf den Jüngling weisend. „Dies ist Ihre Welt. Sie wird eine wundervolle Welt sein; heute befindet sie sich noch in ihrer Kindheit, beachten Sie, was für dunkle Träume, was für bebende Bilder noch ihr Bewußtsein erregen ... Noch liegt sie im Halbschlaf, doch wird sie erwachen; ich fühle es, glaube zutiefst daran!“
In das freudige Gefühl, das diese Worte in mir erweckten, mischte sich ein seltsames Bedauern:
„Weshalb war es nicht Netti, der diese Worte sprach?“
Ich kehrte äußerst ermüdet heim; nach zwei schlaflosen Nächten und einem qualvollen Tag, da ich zu keiner Arbeit fähig war, beschloß ich, mich an Netti zu wenden. Ich wollte den mir unbekannten Arzt der chemischen Stadt nicht zu Rate ziehen. Netti arbeitete seit dem Morgen im Krankenhaus, dort fand ich ihn in der Vorhalle, mit der Aufnahme der eben eingetroffenen Kranken beschäftigt.
Als Netti mich im Vorraum erblickte, eilte er sofort auf mich zu, betrachtete aufmerksam mein Gesicht, nahm mich bei der Hand und führte mich in ein kleines Zimmer. Hier herrschte weiches blaues Licht, ein leichter angenehmer, mir unbekannter Duft erfüllte den Raum, dessen Stille durch nichts gestört wurde. Netti drückte mich in einen bequemen Lehnstuhl und sprach:
„Denken Sie an nichts, machen Sie sich über nichts Sorgen. Für heute nehme ich alles auf mich. Rasten Sie; später komme ich wieder.“
Er verließ das Zimmer, und ich dachte an nichts, machte mir über nichts Sorgen, als habe er tatsächlich alle meine Gedanken und Sorgen auf sich genommen. Dies war äußerst angenehm, und nach wenigen Minuten schlief ich ein. Als ich erwachte, stand Netti vor mir, blickte mich lächelnd an.
„Fühlen Sie sich besser?“ fragte er.
„Ich bin vollkommen gesund, Sie aber sind ein genialer Arzt“, erwiderte ich. „Gehen Sie zu Ihren Kranken und beunruhigen Sie sich meinetwegen nicht.“
„Meine Arbeit ist schon beendet. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen unser Krankenhaus zeigen“, schlug Netti vor.
Ich empfand dafür lebhaftes Interesse, und wir schickten uns an, das ganze schöne Gebäude zu besichtigen.
Chirurgische Fälle und Nervenkrankheiten schienen hier vorzuherrschen. Die meisten chirurgischen Fälle waren durch Maschinen verursachte Verletzungen.
„Es ist doch nicht möglich, daß es in Eueren Betrieben an Schutzvorrichtungen fehlt?“ fragte ich Netti.
„Vollkommene Schutzvorrichtungen, die jeden Unglücksfall ausschließen, gibt es überhaupt nicht. Aber Sie sehen hier die Verletzten aus einem Gebiet mit zwei Millionen Einwohnern – bei einem derartigen Gebiet sind etliche zehn Verwundete gar nicht so viel. Meist handelt es sich hier um Neulinge, die sich noch nicht recht auf die Maschinen verstehen, an denen sie arbeiten. Bei uns behagt es den Leuten, von dem einen Arbeitszweig zum anderen überzugehen. Die Erziehungs- und Kunstspezialisten sind am häufigsten die Opfer ihrer Zerstreutheit; ihre Aufmerksamkeit schweift oft ab, sie versinken in Gedanken und Betrachtungen.“
„Die Nervenkrankheiten werden wohl meistens durch Erschöpfung verursacht?“
„Ja, dieser Fälle gibt es viele. Doch werden derartige Krankheiten auch ebenso oft durch eine Krise im Geschlechtsleben oder aber eine andere seelische Erschütterung hervorgerufen, wie etwa der Tod geliebter Menschen.“
„Werden hier auch Geisteskranke mit verdunkeltem oder verwirrtem Bewußtsein aufgenommen?“
„Nein. Für diese gibt es ein eigenes Krankenhaus. Bei ihnen bedarf es besonderer Vorrichtungen, damit sie in gewissen Fällen weder sich, noch anderen Schaden zufügen können.“
„Und wird bei Euch in solchen Fällen gegen die Kranken Gewalt angewandt?“
„Bisweilen; selbstverständlich aber nur dann, wenn es sich als unumgänglich nötig erweist.“
„Nun begegne ich in Ihrer Welt bereits zum zweiten Mal der Gewalt! Das erste Mal geschah dies im „Haus der Kinder“. Sagen Sie mir, es gelingt also auch auf dem Mars nicht, dieses Element völlig aus dem Leben zu verbannen? Sie sind gezwungen, es mit Bewußtsein anzunehmen.“
„Ja; ebenso wie wir gezwungen sind, Krankheit und Tod hinzunehmen, oder etwa eine bittere Medizin zu schlucken. Welches vernünftige Wesen würde zum Beispiel im Fall der Selbstverteidigung auf die Gewalt verzichten?“
„Wissen Sie, daß diese Tatsache mir die Kluft zwischen Ihrer und unserer Welt weit weniger groß erscheinen läßt?“
„Der Unterschied besteht nicht darin, daß bei Ihnen notgedrungenerweise viel, bei uns aber wenig Gewalt angewandt wird, sondern vielmehr darin, daß sich bei Ihnen die Gewalt als Gesetz verkleidet, sei es nun als äußeres oder inneres, daß sie als sittliche und rechtliche Norm auftritt, die die Menschen beherrscht und belastet. Bei uns hingegen tritt die Gewalt entweder als Krankheitserscheinung auf, oder aber als vernünftige Handlung eines vernunftbegabten Wesens. In keinem dieser Fälle bedeutet sie irgendein gesellschaftliches Gesetz, oder eine gesellschaftliche Norm, ist weder persönliches noch unpersönliches Gebot.“
„Gibt es denn keine Regel, nach der Sie die Freiheit der Geisteskranken oder der Kinder einschränken?“
„Ja, eine Art wissenschaftliche, der Medizin oder Pädagogik entstammende Regel. Freilich sind in dieser technischen Regel nicht alle jene Fälle vorausgesehen, in denen die Gewalt angewandt werden muß, noch aber die Mittel bei ihrer Anwendung, die Stufen – alldies hängt selbstverständlich von der Gesamtheit der Vorbedingungen ab.“
„Wird dadurch der Willkür der Erzieher oder Krankenpfleger nicht völlig freier Lauf gelassen?“
„Was bedeutet das Wort „Willkür“? Wenn es unnötige, überflüssige Anwendung der Gewalt bedeutet, so kann es nur in bezug auf einen Kranken angewandt werden, der sich im Krankenhaus befindet. Ein vernünftiger, bewußt handelnder Mensch ist der Willkür nicht fähig.“
Wir durchschritten die Krankensäle, die Operationsräume, die Zimmer, in denen die Medizinen aufbewahrt wurden, die Stuben der Pfleger. Im obersten Stockwerk betraten wir einen geräumigen, schönen Saal, dessen durchsichtige Wände den Ausblick auf den See, den Wald und die fernen Berge gestatteten. Der Raum war mit Statuen und Gemälden von hohem künstlerischem Wert geschmückt, die Möbel waren prächtig und luxuriös.
„Dies ist das Zimmer der Sterbenden“, sprach Netti.
„Bringen Sie alle Sterbenden hierher?“ fragte ich.
„Ja, oder sie begeben sich selbst in diesen Saal“, lautete die Antwort.
„Können denn bei Ihnen die Sterbenden noch selbst gehen?“ staunte ich.
„Jene, die körperlich gesund sind, vermögen es selbstverständlich.“
Ich begriff, daß es sich hier um Selbstmörder handle.
„Sie überlassen diesen Saal den Selbstmördern zur Ausführung ihres Vorhabens?“
„Ja, sowie alle Mittel, die einen ruhigen schmerzlosen Tod bringen.“
„Und Sie legen ihnen kein einziges Hindernis in den Weg?“
„Wenn der Patient bei klarem Verstand ist und sein Entschluß feststeht, kann es doch gar kein Hindernis geben. Natürlich wird dem Kranken Gelegenheit gewährt, sich vorher mit dem Arzt zu beraten. Einige tun dies, – andere nicht.“
„Kommen bei Ihnen viele Selbstmorde vor?“
„Ja, besonders unter den alten Leuten. Wenn sich das Gefühl des Lebens abstumpft und schwächer wird, ziehen es viele vor, nicht das natürliche Ende abzuwarten.“
„Begehen auch junge, völlig gesunde und starke Menschen Selbstmord?“
„Auch dies kommt vor, aber äußerst selten. Seitdem ich im Krankenhaus arbeite, kann ich mich bloß an zwei Fälle erinnern, der dritte ließ von seinem Vorhaben ab.“
„Wer waren die beiden Unglücklichen und was trieb sie in den Tod?“
„Der erste war mein Lehrer, ein hervorragender Arzt, der der Wissenschaft viel Neues gegeben hat. Bei ihm war die Fähigkeit, die Leiden anderer mitzufühlen, in einem unglaublich hohen Maße entwickelt. Dies führte seinen Verstand und seine Energie zum Studium der Medizin, war aber auch sein Verderben. Er ertrug es nicht. Verbarg aber seine geistige Einstellung so gut vor allen Menschen, daß seine Tat völlig überraschend wirkte. Er beging diese nach einer schweren Epidemie, die als Folge der Trockenlegung einer Meeresbucht auftrat, als die toten Fische tonnenweise verwesend am Strand lagen. Die Krankheit war ebenso schmerzhaft wie bei Ihnen die Cholera, aber noch weit gefährlicher. Von zehn Erkrankungen nahmen neun einen tödlichen Verlauf. Da aber dennoch eine geringe Möglichkeit der Genesung bestand, konnten die Aerzte den Bitten der Kranken um einen raschen und schmerzlosen Tod nicht nachkommen; es war ja auch nicht möglich, von einem Menschen, den starkes Fieber und große Schmerzen peinigten, anzunehmen, daß er sich bei völlig klarem Bewußtsein befinde. Mein Lehrer arbeitete wie ein Wahnsinniger, und seine Forschungen trugen viel dazu bei, die Epidemie abzukürzen. Als diese völlig verschwunden war, beging er Selbstmord.“
„Wie alt war er damals?“
„Ihrer Berechnung nach ungefähr Fünfzig. Bei uns ist dies noch ein jugendliches Alter.“
„Und der zweite Fall?“
„Eine Frau, der am gleichen Tag Mann und Kind gestorben waren.“
„Und der dritte Fall?“
„Den kann Ihnen nur jener Genosse erzählen, der ihn selbst erlebte.“
„Das ist wahr“, meinte ich. „Erklären Sie mir aber nun etwas anderes: wie kommt es, daß sich die Marsbewohner so lange jung erhalten? Ist dies eine Eigenheit Ihrer Rasse oder hängt es von den günstigen Lebensbedingungen, oder aber noch von etwas anderem ab?“
„Mit der Rasse hat es nichts zu tun; noch vor zweihundert Jahren waren wir weit weniger langlebig. Die günstigeren Lebensbedingungen? Ja, selbstverständlich spielen auch diese eine bedeutsame Rolle, die Hauptursache jedoch ist eine ganz andere: nämlich die Erneuerung des Lebens.“
„Was ist das?“
„Eine dem Wesen nach äußerst einfache Sache, Ihnen jedoch wird sie wahrscheinlich seltsam erscheinen, obgleich Ihre Wissenschaft bereits alle Daten für diese Methode kennt. Sie wissen, daß die Natur, um die Lebensfähigkeit der Zelle oder des Organismus zu steigern, das Einzelwesen durch ein anderes ergänzt. Um dieses Ziel zu erreichen, verschmilzt sich das Einzelwesen aus zweien zu einem, und auf diese Art erhält es die Lebens- und Vermehrungsfähigkeit, die „Unsterblichkeit“ des Protoplasma. Derselbe Gedanke beherrscht die Kreuzungen der höheren Pflanzen- und Tierarten; hier vereinigen sich lebendige Elemente zweier verschiedener Wesen, auf daß ein drittes geboren werde. Schließlich wissen Sie wohl auch um die Einimpfung des Blutes, von dem einen zum anderen Geschöpf, um diesem anderen eine stärkere Lebensfähigkeit zu verleihen, wie dies beim Serum gegen verschiedene Krankheiten der Fall ist. Wir gehen hierin noch weiter: verwenden die Transfusion des Blutes zwischen zwei menschlichen Wesen, von denen jedes dem anderen eine gesteigerte Lebensfähigkeit zu geben vermag. Diese einmalige Transfusion des Blutes zwischen zwei Menschen wird durch einen die Blutgefäße der beiden verbindenden Apparat bewerkstelligt. Bei Beobachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln ist der Prozeß völlig ungefährlich. Das Blut des einen Menschen lebt weiter im Organismus des anderen, vermischt sich mit dem eigenen Blut und erneuert die Gewebe.“
„Auf diese Art vermögen Sie durch die Transfusion jungen Blutes den Alten die Jugend wiederzugeben?“
„Zum Teil; freilich nicht ganz. Denn das Blut ist im Organismus nicht alles, der Organismus verarbeitet es. Deshalb altert auch der junge Mensch nach der Transfusion alten Blutes nicht; alles, was in ihm Schwäche, Alter ist, verteilt sich rasch im jungen Organismus, und zur gleichen Zeit scheidet er aus dem Organismus all das aus, dessen er nicht bedarf; dadurch werden die Energie und Anpassungsfähigkeit seines ganzen Wesens gesteigert.“
„Wenn dies so einfach ist, weshalb hat bis heute unsere irdische Medizin das Mittel noch nicht angewandt? Die Transfusion des Blutes ist, wenn ich nicht irre, bereits seit etlichen hundert Jahren bekannt.“
„Ich weiß es nicht; vielleicht besteht irgendeine organische Eigenheit, die bei den Erdenmenschen diesem Mittel seine Wirksamkeit raubt. Vielleicht aber kommt dies auch von dem bei Ihnen herrschenden Individualismus, der so sehr den einen Menschen vom anderen trennt, daß der Gedanke an eine lebendige Verschmelzung Ihren Gelehrten schier als ein Ding der Unmöglichkeit erscheint. Außerdem gibt es bei Ihnen eine Unzahl das Blut vergiftender Krankheiten, Krankheiten, von denen die Befallenen oft gar nicht wissen, oder die sie verheimlichen. Die bei Ihnen äußerst selten vollzogene Transfusion des Blutes trägt irgendwie einen philanthropischen Charakter: jener, der viel Blut besitzt, gibt davon jenem, der dessen äußerst nötig bedarf, zum Beispiel in Fällen, wo durch Wunden ein großer Blutverlust entstanden ist. Freilich kommt dies auch bei uns vor; meist aber verhält es sich anders, entspricht unserer ganzen Ordnung: unser Leben ist nicht nur dem Geist nach ein kameradschaftliches, sondern sogar dem Körper nach.“
Die Eindrücke der ersten Tage, die wie ein stürmischer Wasserfall mein Bewußtsein überfluteten, ließen mich erkennen, was für eine ungeheuere Arbeit mir bevorstand. Vor allem galt es, diese Welt zu begreifen, diese unermeßlich reiche und in ihrer Ordnung so eigenartige Welt. Dann aber mußte ich mich ihr nähern, jedoch nicht wie einem interessanten Museumsgegenstand, sondern wie ein Mensch den Menschen, ein Arbeiter den Arbeitern. Nur so vermochte ich meine Mission zu erfüllen, als wahrhaftes Band zwischen zwei Welten zu dienen, zwischen denen ich, der an der Grenze stehende Sozialist, einen unendlich winzigen Augenblick der Gegenwart bedeutete, der Vergangenheit und Zukunft verband.
Als ich das Krankenhaus verließ, sprach Netti zu mir: „Beeilen Sie sich nicht allzu sehr.“ Mir schien es, als habe er unrecht. Im Gegenteil: ich mußte mich beeilen, mußte alle Kräfte, alle Energie anspannen – denn meine Verantwortung war eine ungeheuer große. Welcher gewaltige Nutzen konnte unserer alten zerquälten Menschheit erwachsen, welche gigantische Beschleunigung ihrer Entwicklung durch den Einfluß dieser lebendigen, energischen, hohen Kultur, die so mächtig und harmonisch war! Und jeder Augenblick der Verzögerung in meiner Arbeit konnte ein Hinausschieben dieses Einflusses bedeuten ... Nein, ich durfte nicht erwarten, durfte nicht rasten. Und ich arbeitete viel. Lernte die Wissenschaft und die Technik der neuen Welt kennen, beobachtete genau ihr gesellschaftliches Leben, studierte ihre Literatur. Und dabei boten sich mir viele Schwierigkeiten.
Die wissenschaftlichen Methoden verblüfften mich völlig: ich prägte sie mir mechanisch ein, vermeinte anfangs, sie seien leicht, einfach, ohne Fehler; bald aber bemerkte ich, daß ich sie nicht verstand, daß ich nicht begriff, wieso sie zum Ziele führten, ihre Verbindung nicht fand und ihr Wesen nicht erfaßte. Ich glich einem alten Mathematiker des 17. Jahrhunderts, dessen begrenzter unbeweglicher Geist die lebendige Dynamik der unendlich kleinen Größen nicht zu erfassen vermag.
Die allgemein zugänglichen Versammlungen der Marsbewohner versetzten mich durch ihren rein sachlichen Charakter in großes Erstaunen. Ob sie nun wissenschaftlichen Fragen, oder aber der Organisation der Arbeit oder Kunstfragen galten, – stets waren die Ausführungen und Reden seltsam nüchtern und kurz, die Argumente genau, sachlich, niemand wiederholte sich und keiner wiederholte, was ein anderer gesagt hatte. Der Beschluß der Versammlung, der häufig ein einstimmiger war, wurde mit märchenhafter Geschwindigkeit durchgeführt. Beschloß die Versammlung der Lehrer, daß eine neue Lehranstalt gegründet werden müsse, oder die Versammlung der Arbeitsstatistiker, daß ein neues Unternehmen gegründet werden solle, oder die Versammlung der Stadtbewohner, daß irgendein Gebäude zu schmücken sei, – sofort erschienen auch schon die neuen Zahlen der erforderlichen Arbeitskraft, das Zentralbureau schaffte auf dem Luftweg Hunderte und Tausende von neuen Arbeitern herbei; nach einigen Tagen oder einer Woche war bereits alles beendet, und die neuen Arbeiter verschwanden; niemand wußte, wohin. All dies erweckte in mir schier den Eindruck der Magie, einer seltsamen, gelassenen, kalten, Beschwörungen und Mystik verachtenden Magie, die vielleicht eben deshalb durch ihre übermenschliche Macht besonders rätselhaft wirkte.
Auch die Literatur der neuen Welt, sogar die rein künstlerische, bedeutete für mich weder Erholung noch Beruhigung. Ihre Form erschien zwar klar und unkompliziert, aber der Inhalt mutete mich fremd an. Es verlangte mich, tiefer in sie einzudringen, sie zu begreifen, ihr näher zu kommen, doch führten meine Bemühungen zu einem völlig unerwarteten Ergebnis: die Formen wurden gespenstisch, von Nebel umhüllt.
Besuchte ich das Theater, so überkam mich ebenfalls das Gefühl der Verständnislosigkeit. Die Reden der Helden waren so zurückhaltend und gedämpft, ihre Gefühle so schwach betont, daß es fast schien, als wollten sie bei dem Zuschauer keinerlei Stimmung erregen, als wären sie nur abgeklärte Philosophen, freilich äußerst idealisierte. Nur die historischen, in der fernen Vergangenheit spielenden Dramen weckten in mir einen vertrauten Eindruck; hier war auch das Spiel der Darsteller bedeutend lebhafter, der Ausdruck persönlicher Gefühle um vieles unverhüllter, glich weit mehr dem, woran ich in unseren Theatern gewöhnt war.
Ein Umstand zog mich trotz allem immer wieder ins Theater unserer kleinen Stadt: nämlich der, daß es hier keine Schauspieler gab. Die hier aufgeführten Stücke wurden uns durch optische und akustische Apparate vermittelt, die sich in anderen großen Städten befanden, oder aber, und dies kam noch häufiger vor, es wurden Stücke aufgeführt, die so alt waren, daß die meisten der darin auftretenden Schauspieler nicht mehr unter den Lebenden weilten. Die Marsbewohner kannten die Momentaufnahmen in natürlichen Farben, benützten sie, um Leben und Bewegung wiederzugeben, wie dies in unseren Kinos geschieht. Aber sie vereinigten nicht nur den Kinematograph mit dem Phonograph, wie das bereits, wenn auch ohne rechten Erfolg, auf der Erde getan wurde, sondern sie wandten auch das Stereogramm an und verliehen dadurch den Kinobildern Relief. Auf der Leinwand erschienen gleichzeitig zwei Abbildungen, – zwei halbe Stereogramme; vor jedem Sitz war ein entsprechendes stereoskopisches Glas befestigt, das die beiden flachen Abbildungen zu einer vereinigte. Es schien seltsam, klar und genau lebendige Menschen zu sehen, die sich bewegten, handelten, ihren Gefühlen in Worten Ausdruck verliehen, und gleichzeitig zu wissen, daß von all dem nichts existierte, als die Mattscheibe, der Phonograph und das elektrische Licht mit dem Uhrwerk. Ja, dies war fast mystisch seltsam, und erweckte unklare Zweifel an aller Wirklichkeit.
Selbstverständlich wurde durch all diese Tatsachen meine Aufgabe, das Verstehen der fremden Welt, in hohem Maße erschwert. Ich hätte entschieden fremder Hilfe bedurft. Doch wandte ich mich nur sehr selten an Menni mit der Bitte um Erklärungen. Ich wollte ihn nicht in Anspruch nehmen, denn er war eben mit seinen Forschungen über die Gewinnung der „Minus-Materie“ beschäftigt. Er arbeitete unermüdlich, schlief oft nächtelang nicht, und ich wollte ihn nicht stören und ablenken. Seine Arbeitsfreudigkeit war für mich ein lebendiges Beispiel, das mich unwillkürlich dazu verleitete, meine Anstrengungen fortzusetzen.
Die übrigen Freunde waren von meinem Horizont verschwunden. Netti verreiste auf etliche hundert Kilometer, um den Bau und die Organisation eines riesenhaften neuen Krankenhauses auf der anderen Halbkugel des Planeten zu leiten. Enno, Sternis Gehilfe, war ebenfalls viel beschäftigt; in seinem Observatorium wurden Messungen und Berechnungen für neue Expeditionen nach der Venus und der Erde angestellt, sowie für Expeditionen nach dem Mond und dem Merkur; letztere sollten photographiert und von den Mineralien sollten Proben zurückgebracht werden. Mit den anderen Marsbewohnern war ich nicht näher bekannt, beschränkte meine Gespräche mit ihnen auf praktische Fragen; es fiel mir schwer, mich diesen so fremden und hoch über mir stehenden Wesen zu nähern.
Allmählich begann ich zu finden, daß, allgemein gesprochen, meine Arbeit gute Fortschritte machte. Ich bedurfte immer weniger der Rast, ja sogar des Schlafes. Alles, was ich fast mechanisch leicht und frei erlernte, brachte ich bequem in meinem Kopf unter, und dies rief irgendwie das Gefühl hervor, als sei mein Kopf völlig leer und könne noch viel, sehr viel beherbergen. Freilich, wenn ich nach alter Gewohnheit versuchte, für mich selbst genau zu formulieren, was ich wußte, so mißlang das fast immer; doch deuchte mich, es sei nicht wichtig, Einzelheiten und Teile klar definieren zu können. Vor allem gelte es einen Allgemeinbegriff zu haben, und den besaß ich.
Eine besonders lebhafte Befriedigung fand ich in meiner Arbeit nicht; es gab nichts, das in mir das frühere Gefühl unmittelbaren Interesses wachgerufen hätte, doch erschien mir dies selbstverständlich: nach all dem, was ich gesehen und erfahren hatte, fiel es mir schwer, noch über irgendetwas zu staunen. Es kam ja auch gar nicht darauf an, ob mir etwas angenehm sei, sondern vielmehr darauf, daß ich alles begreife und mir zu eigen mache.
Eines nur war peinlich: es wurde mir täglich schwerer, meine Aufmerksamkeit völlig auf einen Gegenstand zu konzentrieren. Die Gedanken schweiften von einer Sache, von einer Seite zur anderen; klare, gänzlich unerwartete Erinnerungen fluteten bisweilen über mein Bewußtsein hinweg, ließen mich meine Umgebung vergessen, raubten mir die kostbaren Minuten. Ich bemerkte dies, zwang mich mit neuer Energie zur Arbeit, aber nach kurzer Zeit suchten abermals flüchtige Bilder und Phantasien der Vergangenheit mein Gehirn heim, und es galt von neuem, ihrer Gewalt zu widerstehen.
Immer häufiger überkam mich ein bebendes, seltsam beunruhigendes Gefühl; bekannte Gesichter tauchten vor mir auf, alte Geschehnisse. Eine übermächtige Flut riß mich zurück, in ferne Zeiten, in die Jugend und früheste Kindheit, dort verlor sich mein Bewußtsein in Unklarheit und Wirrnis. Nach solchen Stunden vermochte ich die andauernde Zerstreutheit nicht zu bewältigen.
In meinem Inneren entstand ein heftiger Widerstand, der mich hinderte, einer Sache lange Zeit zu widmen; ich hastete von Gegenstand zu Gegenstand, schleppte in meine Stube einen Haufen Bücher, die früher am rechten Ort aufbewahrt waren, Tabellen, Karten, Stereogramme, Phonographen usw. Auf diese Art hoffte ich, den Zeitverlust wieder einzubringen, aber die furchtbare Zerstreutheit übermannte mich stets von neuem, und häufig ertappte ich mich dabei, daß ich lange reglos auf einen Punkt starrte, nichts begriff, nichts tat.
Lag ich auf meinem Bett und blickte durch das Glasdach zum düsteren Nachthimmel empor, so begannen meine Gedanken eigenwillig mit erstaunlicher Lebhaftigkeit und Energie zu arbeiten. Vor meinem Geiste erschienen ganze Zahlenreihen und Formeln, sie waren von einer derartigen Klarheit, daß ich sie, Zeile um Zeile, abzulesen vermochte. Doch verblaßten diese Erscheinungen gar bald, machten anderen Platz, mein Bewußtsein kehrte zum Panorama eines unglaublich lebendigen und klar umrissenen Bildes zurück, das nichts mit meiner Beschäftigung und meinen Sorgen zu tun hatte. Ich schaute irdische Landschaften, theatralische Szenen, Bilder aus Kindermärchen, sah sie wie in einem Spiegel. Sie durchdrangen meine Seele, verschwammen, vermischten sich, erweckten keinerlei Aufregung, sondern bloß ein leichtes Interesse, eine gewisse Neugierde, der eine schwache Befriedigung eignete. Dieser Vorgang vollzog sich in meinem Bewußtsein, vermengte sich nicht mit der äußeren Umgebung; später jedoch griff er auch auf sie über. Ich versank in Schlummer, in Träume, die voll lebendiger und komplizierter Erscheinungen waren; der Schlummer war ein leichter und gab mir nicht, wonach mich so sehr verlangte – das Gefühl der Rast und Erholung.
Schon längere Zeit störte mich Ohrensausen, jetzt wurde dieses immer unaufhörlicher und stärker, hinderte mich bisweilen sogar daran, die Töne des Phonographen zu vernehmen. Des Nachts raubte es mir den Schlaf. Immer wieder vermeinte ich dazwischen Menschenstimmen zu hören, bekannte und unbekannte, bisweilen glaubte ich, mein Name würde gerufen, oder aber ich vernähme Gespräche, deren Worte ich wegen des Sausens nicht zu verstehen vermochte. Ich sah ein, daß ich nicht völlig gesund sei, daß mich Verwirrung und Zerstreutheit überwältigten, vermochte ich doch nicht einmal einige Zeilen im Zusammenhang zu lesen.
„Das ist selbstverständlich nur Uebermüdung“, sprach ich zu mir. „Ich muß mehr rasten, habe tatsächlich zu viel gearbeitet. Doch brauche ich Menni davon nichts zu sagen, denn was jetzt mit mir vorgeht, erweckt gar sehr den Eindruck, als machte ich bereits zu Anfang meiner Arbeit Bankrott.“
Wenn mich Menni in meiner Stube aufsuchte, dies kam freilich zu jener Zeit selten vor, gab ich mir den Anschein, äußerst beschäftigt zu sein. Er warnte mich: ich arbeite zu viel, setze mich der Gefahr der Erschöpfung aus.
„Heute sehen Sie besonders schlecht aus“, sagte er. „Schauen Sie in den Spiegel, wie Ihre Augen glänzen, wie blaß Sie sind. Sie müssen sich ausruhen, das wird später Früchte tragen.“
Mich verlangte ja selbst nach Ruhe, doch vermochte ich keine zu finden. Zwar tat ich fast nichts, aber alles ermüdete mich, sogar die geringste Anstrengung. Die stürmische Flut lebendiger Bilder, Erinnerungen und Phantasien ebbte weder bei Tag noch bei Nacht ab. In ihr verblaßte meine Umgebung, verlor sich, nahm etwas Gespenstisches an.
Schließlich mußte ich mich ergeben; ich sah, daß Schlaffheit und Apathie immer stärker meinen Willen schwächten, daß ich immer weniger gegen sie anzukämpfen vermochte. Eines Abends, als ich zu Bette lag, wurde es mir plötzlich schwarz vor den Augen. Doch verging dies rasch, und ich trat ans Fenster, um auf die Bäume des Parkes zu blicken. Jählings fühlte ich, daß mich jemand anstarre. Ich wandte mich um – vor mir stand Anna Nikolajewna Ihr Antlitz war blaß und traurig, aus ihren Blicken sprach Vorwurf. Ich wurde erregt, dachte gar nicht an das Seltsame ihrer Erscheinung, tat einen Schritt vor, um ihr entgegenzugehen und etwas zu sagen. Sie aber verschwand, als habe sie sich in Luft aufgelöst.
Und in diesem Augenblick begann der Gespensterreigen. An vieles erinnere ich mich nicht; mein Bewußtsein war verdunkelt, ich befand mich in einer Art Traum. Es kamen und gingen, erschienen vor mir allerlei Menschen, denen ich in meinem früheren Leben begegnet war, aber auch Unbekannte. Merkwürdigerweise befanden sich unter ihnen keine Marsbewohner, es waren lauter Erdenmenschen. Die Bekannten gehörten meist zu jenen, die ich seit langem nicht gesehen hatte, alte Schulkameraden, mein junger Bruder, der noch als Kind gestorben war. Durchs Fenster erblickte ich einen berüchtigten Spion, der mich mit bösem Lachen aus seinen listigen, unsteten Augen anblickte. Die Gespenster redeten nicht mit mir; in der Nacht jedoch, da alles still war, vernahm ich halluzinierende Töne, hörte unzusammenhängende, sinnlose Gespräche, geführt von den Unbekannten: ein Fahrgast, der mit einem Droschkenkutscher stritt, ein Kommis überredete einen Kunden, die Ware zu kaufen, der Lärm eines Universitätsauditoriums tobte, der Pedell versuchte Ruhe zu schaffen, verkündete, daß der Herr Professor gleich kommen würde. Die Gesichtshalluzinationen waren weit interessanter und störten mich viel weniger und seltener.
Nach der Erscheinung Anna Nikolajewnas sprach ich selbstverständlich mit Menni über meinen Zustand. Er schickte mich sofort ins Bett, berief den Arzt und telephonierte den sechstausend Kilometer entfernten Netti an. Der Arzt erklärte, er könne sich nicht entschließen, etwas zu tun, da er den Organismus der Erdenmenschen zu wenig kenne; jedenfalls bedürfe ich vor allem der Ruhe und Erholung. Befolgte ich diesen Rat, so sei es nicht gefährlich, einige Tage zu warten, bis Netti zurückkäme.
Netti stellte sich am dritten Tag ein. Als er sah, in was für einem Zustand ich mich befand, blickte er Menni mit traurigem Vorwurf an.
Trotz der Behandlung durch einen so ausgezeichneten Arzt wie Netti währte meine Krankheit einige Wochen. Ich lag zu Bett, ruhig und apathisch, betrachtete mit der gleichen Seelenruhe die Wirklichkeit und die Gespenster. Nettis stete Gegenwart erweckte in mir ein kaum merkliches, leichtes Gefühl der Zufriedenheit.
Heute erscheint mir in der Erinnerung mein damaliges Verhältnis zu den Halluzinationen sehr merkwürdig; obgleich ich mich an die hundert Mal von ihrer Unwirklichkeit überzeugte, so vergaß ich dies, sobald sie erschienen; selbst wenn sich mein Bewußtsein nicht verdunkelte und verwirrte, hielt ich die Erscheinungen für wirkliche Gesichter und Dinge. Bloß wenn sie bereits verschwunden waren, oder im Augenblick vor ihrem Verschwinden, erkannte ich ihre Gespensterhaftigkeit.
Nettis Hauptbestreben ging dahin, mir Schlaf und Ruhe zu verschaffen. Er konnte sich nicht dazu entschließen, mir irgendeine Medizin zu verabreichen, fürchtete, diese könnte auf den irdischen Organismus als Gift wirken. Etliche Tage vermochte er mich mit den gewöhnlichen Mitteln nicht zum Schlafen zu bringen; die Halluzinationen verhinderten dies. Endlich aber gelang es ihm dennoch, und als ich nach zwei- bis dreistündigem Schlaf erwachte, sprach er:
„Nun zweifle ich nicht mehr an Ihrer Genesung, wenngleich die Krankheit noch lange währen dürfte.“
Und die Krankheit nahm ihren Verlauf. Die Halluzinationen wurden seltener, doch waren sie um nichts weniger lebhaft und klar, wurden sogar etwas komplizierter; bisweilen ließen sich die gespenstischen Gäste mit mir in ein Gespräch ein.
Von diesen Gesprächen hatte nur ein einziges für mich Sinn und Bedeutung; es war schon gegen Ende meiner Krankheit, als es geführt wurde.
Eines Morgens erwachend, sah ich Netti wie gewöhnlich in meiner Nähe; vor seinem Lehnstuhl aber stand mein alter Revolutionskamerad, der lebhafte, boshaft spöttische Agitator Ibrahim. Er schien etwas zu erwarten. Als sich Netti ins anstoßende Zimmer begab, um das Bad vorzubereiten, sprach Ibrahim grob und entschlossen zu mir:
„Du Dummkopf! Was hältst du Maulaffen feil? Siehst du denn etwa nicht, wer dein Arzt ist?“
Ich wunderte mich weder über die in seinen Worten enthaltene Andeutung, noch über den zynischen Ton, ich kannte ja seine Art. Doch entsann ich mich des eisernen Griffs, mit dem Nettis kleine Hände zupackten und glaubte Ibrahim nicht.
„Umso ärger für dich!“ meinte er mit verächtlichem Lachen und verschwand.
Netti betrat das Zimmer. Bei seinem Anblick empfand ich ein seltsames Unbehagen. Er schaute mich scharf an.
„Nun“, sprach er, „Ihre Genesung macht rasche Fortschritte.“
Den ganzen Tag über war Netti schweigsam und versonnen. Am folgenden Tag, überzeugt davon, daß ich mich wohl fühle und die Halluzinationen sich nicht wiederholen würden, ging er seiner Arbeit nach und kehrte erst gegen Abend heim, ließ sich durch einen anderen Arzt vertreten. Etliche Tage kam er nur des Abends zu mir, um mich einzuschläfern. Erst nun wurde es mir klar, wie wichtig und angenehm mir seine Anwesenheit sei. Zusammen mit der Erregung der Genesung, die irgendwie aus der ganzen Natur in meinen Organismus einzudringen schien, verfolgte mich immer häufiger Ibrahims Andeutung. Ich schwankte, versicherte mir selbst, das ganze sei Unsinn, der Gedanke entspringe meiner Krankheit; weshalb hätten Netti und die übrigen Freunde mich in dieser Beziehung irreführen sollen? Nichtsdestoweniger blieb ein unklarer Zweifel zurück, der etwas Angenehmes besaß.
Einmal fragte ich Netti, mit was für einer Arbeit er eben beschäftigt sei. Er erwiderte, es gebe jetzt viele Beratungen, auf denen über eine neue Expedition nach den anderen Planeten verhandelt werde, er sei als Experte zugezogen. Menni leite die Beratungen, doch dächte weder er noch Netti daran, die Expedition in nächster Zeit zu unternehmen, was mich mit großer Freude erfüllte.
„Aber Sie selbst, beabsichtigten Sie nicht heimzukehren?“ fragte Netti, und aus seinem Ton klang leise Unruhe.
„Es gelang mir doch noch nicht, irgendetwas zu tun“, entgegnete ich. Nettis Gesicht strahlte.
„Sie irren, Sie haben bereits viel getan, ... schon diese Antwort allein ...“, erwiderte er.
Ich ahnte in dieser Andeutung etwas, das ich nicht wußte, das mich aber betraf.
„Kann ich Sie nicht zu einer dieser Beratungen begleiten?“ erkundigte ich mich.
„Auf keinen Fall. Abgesehen davon, daß Sie noch der Erholung bedürfen, müssen Sie noch einige Monate alles vermeiden, was mit dem Beginn Ihrer Krankheit im Zusammenhang steht.“
Ich wollte nicht streiten. Es war so angenehm, sich zu erholen; die Pflicht der Menschheit gegenüber schien in weite Ferne gerückt. Jetzt beunruhigten mich nur mehr, und zwar in immer stärkerem Maße, die Gedanken über Netti.
Eines Abends stand ich am Fenster und blickte durch die Dämmerung in die geheimnisvolle Schönheit des Parkes; dieser dünkte mich herrlich, und nichts an ihm war meinem Herzen fremd. Ein leises Klopfen an der Tür wurde vernehmbar, und ich fühlte mit einem Mal – dies sei Netti. Er näherte sich mit seinen leichten raschen Schritten, streckte mir lächelnd die Hand hin: der alte Erdengruß, der ihm gefiel. Freudig griff ich nach seiner Hand, drückte sie so heftig, daß es sogar seine festen Finger schmerzte.
„Ich sehe, daß meine Rolle als Arzt zu Ende ist“, lächelte er. „Doch muß ich noch einige Fragen an Sie richten, um meiner Sache ganz gewiß zu sein.“
Er richtete Fragen an mich, ich gab Antwort, erfaßt von unverständlicher Verwirrung, und las in der Tiefe seiner großen, großen Augen heimliches Lachen. Schließlich vermochte ich mich nicht länger zu beherrschen.
„Erklären Sie mir, weshalb ich mich so stark zu Ihnen hingezogen fühle? Weshalb freut es mich so ungemein, Sie zu sehen?“
„Hauptsächlich wohl aus dem Grunde, weil ich Sie behandelt habe und Sie unbewußt die Freude der Genesung auf mich übertragen. Vielleicht aber auch ... deshalb, weil ich ... eine Frau bin ...“
Dunkle Punkte kreisten vor meinen Augen, alles ringsum versank in Nacht, das Herz hörte schier zu schlagen auf ... Einen Augenblick lang hielt ich wie ein Wahnsinniger Netti in meiner Umarmung fest, küßte ihre Hände, ihr Gesicht, ihre großen tiefen Augen, die grünlich blau leuchteten, wie der Himmel ihres Planeten ...
Schlicht und großherzig überließ sich Netti meiner Umarmung ... Als ich meine sinnlose Freude beherrschte und von neuem ihre Hände und ihr Gesicht küßte, die Augen voller Freudentränen, die selbstverständlich von der durch die Krankheit verursachten Schwäche herrührten, sprach Netti mit ihrem lieben Lächeln:
„Es schien mir, als fühlte ich in Ihrer Umarmung Ihre ganze junge Welt, deren Despotismus, deren verzweifeltes Glücksverlangen – all dies lag in Ihrer Liebkosung. Ihre Liebe gleicht dem Mord ... Aber ... ich liebe Sie, Lenni ...“
Dies war Glück.
Diese Monate! ... Gedenke ich ihrer, so erfaßt gewaltiges Zittern meinen Leib, Nebel verdunkeln mein Auge, alles ringsum erscheint mir nichtig. Und es gibt keine Worte, um das vergangene Glück zu schildern.
Die neue Welt kam mir nahe, schien mir mit einem Mal völlig verständlich. Die erlittene Niederlage bekümmerte mich nicht. Jugend und Glaube kehrten zu mir zurück, um, wie ich glaubte, mich nie mehr zu verlassen. Ich besaß Hoffnung und einen starken Verbündeten; für die Schwäche war kein Raum. Die ganze Zukunft gehörte mir.
In die Vergangenheit schweiften meine Gedanken nur selten zurück, sie beschäftigten sich mit dem, was Netti und unsere Liebe anbelangte.
„Weshalb verbargen Sie mir Ihr Geschlecht?“ fragte ich bald nach jenem Abend.
„Anfangs ergab sich dies von selbst, zufällig. Dann aber unterstützte ich absichtlich Ihre Täuschung, entfernte sogar von meiner Kleidung alles, was Ihnen die Wahrheit hätte verraten können. Mich erschreckte die Schwere und Kompliziertheit Ihrer Aufgabe, ich fürchtete, diese noch verwickelter zu gestalten, besonders als ich später Ihre unbewußte Zuneigung zu mir wahrnahm. Auch verstand ich mich selbst nicht recht ... bis zu Ihrer Krankheit.“
„Diese also hat die Lösung herbeigeführt ... Wie segne ich meine lieben Halluzinationen!“
„Ja, als ich von Ihrer Erkrankung erfuhr, traf es mich wie ein Hammerschlag. Hätte ich nicht vermocht, Sie vollständig zu heilen, ich wäre vielleicht gestorben.“
Nach einigen Augenblicken des Schweigens fügte sie hinzu:
„Wissen Sie auch, daß sich unter Ihren Freunden noch eine Frau befindet, von der Sie dies gleichfalls nicht ahnten? Sie ist Ihnen sehr zugetan, freilich nicht so wie ich ...“
„Enno!“ erriet ich sofort.
„Selbstverständlich. Und auch Enno führte Sie absichtlich irre, befolgte dabei meinen Rat.“
„Ach, wie viel Trug und Feigheit gibt es doch in Eurer Welt!“ rief ich mit scherzhaftem Pathos. „Laßt nur, bitte, Menni einen Mann bleiben, denn verliebte ich mich in ihn, so wäre dies furchtbar.“
„Ja, dies ist furchtbar“, entgegnete Netti gedankenvoll, und ich verstand ihren seltsamen Ernst nicht.
Tage reihten sich an Tage, und beglückt nahm ich von der schönen neuen Welt Besitz.
Und dennoch kam ein Tag, kam der Tag, an den ich nicht ohne Verwünschungen zu denken vermag – der Tag, da sich zwischen Netti und mir der schwarze Schatten einer verhaßten und unvermeidlichen Trennung erhob.
Mit dem gleichen gelassenen, abgeklärten Gesichtsausdruck, der ihr eigen war, erklärte mir Netti unvermittelt, sie müsse sich im Verlauf eines Tages der Riesenexpedition nach der Venus anschließen, die von Menni geleitet wurde. Als sie sah, wie sehr mich diese Nachricht verstörte, sprach sie:
„Es ist ja nicht auf lange Zeit. Hat die Expedition Erfolg, und ich zweifle nicht daran, so wird ein Teil der Mitglieder baldigst zurückkehren, und auch ich werde diesem Teil angehören.“
Dann berichtete sie mir, worum es sich handle. Auf dem Mars waren die Vorräte der radiumausstrahlenden Materie, die für die Motoren der interplanetarischen Luftschiffe und für die Zerlegung und Synthese aller Elemente unentbehrlich waren, erschöpft und konnten nicht erneuert werden. Auf der Venus hingegen, einem jungen Planeten, der fast viermal kürzere Zeit bestand als der Mars, gab es auf Grund untrüglicher Anzeichen ungeheure Lager dieser Materie, die sich fast an der Erdoberfläche befand und sich nicht selbständig zerlegen konnte. Auf einer Insel, die in dem gigantischen Ozean der Venus lag und von den Marsbewohnern die „Insel des glühenden Sturms“ genannt ward, gab es ein reiches Lager der radiumausstrahlenden Materie, und es war beschlossen worden, dieses Lager so rasch wie möglich auszubeuten. Doch war vorher nötig, äußerst hohe und dicke Mauern zu errichten, die die Arbeiter gegen den verderblichen glühenden Wind schützen sollten, der in seiner Wildheit und Grausamkeit die Sandstürme unserer Wüsten bei weitem übertraf. Diese Arbeit erforderte eine Expedition von zehn Aetheroneffs und von zweitausend Menschen, unter denen sich zwanzig Chemiker befanden; die übrigen sollten den Bau der Mauer übernehmen. Die besten wissenschaftlichen Kräfte sowie die erfahrensten Aerzte würden sich anschließen; die Gesundheit aller Expeditionsmitglieder war vom Klima gefährdet und auch von der mörderischen Glut, sowie von den Emanationen der radiumausstrahlenden Stoffe. Netti vermochte sich, den eigenen Worten zufolge, nicht von der Expedition zu drücken, doch hatte sie sich ausbedungen, daß, wenn die Arbeit gut von statten gehe, bereits nach drei Monaten ein Aetheroneff zurückkehre, um Nachrichten und die zutage geförderte Materie mitzubringen. Mit diesem Aetheroneff wollte dann auch Netti heimkommen, also etwa zehn bis elf Monate nach Ausfahrt der Expedition.
Ich vermochte nicht zu begreifen, weshalb Netti unbedingt an der Expedition teilnehmen müsse. Sie meinte, das Unternehmen sei ein derart ernstes, daß sie sich ihm nicht entziehen könne, außerdem sei es auch für meine Aufgabe von großer Bedeutung, denn der Erfolg würde die Möglichkeit einer engeren Verbindung mit der Erde schaffen. Uebrigens würde ein jeder Irrtum auf dem Gebiet der medizinischen Hilfe das Unternehmen von allem Anfang an zum Mißerfolg verurteilen. All dies klang überzeugend, ich wußte ja auch, daß Netti als der beste Arzt galt, besonders in Fällen, die nicht in den Rahmen der alten erfahrungsgemäßen Medizin paßten; dennoch schien mir irgendwie, daß dies nicht alles sei, als gäbe es noch etwas Unausgesprochenes.
An einem zweifelte ich nicht; an Netti selbst und ihrer Liebe. Wenn sie sagte, es sei unbedingt nötig, die Expedition mitzumachen, so war dies wirklich unvermeidlich, erklärte sie mir aber nicht, weshalb dies so sein mußte, so bedeutete es, daß ich sie nicht weiter befragen dürfe. Wenn sie sich von mir unbeobachtet glaubte, sah ich in ihren schönen Augen Angst und Schmerz.
„Enno wird dir ein guter und liebevoller Freund sein“, sprach sie mit wehmütigem Lächeln. „Und auch Nella wird dich nicht vergessen, sie liebt dich um meinetwillen, besitzt viel Verstand und Erfahrung; in den schweren Augenblicken des Lebens ist ihre Hilfe von hohem Wert. Wenn du an mich denkst, so denke immer nur das eine: daß ich zurückkehre, sobald dies irgendwie möglich ist.“
„Ich vertraue dir, Netti“, sprach ich, „und deshalb glaube ich auch an mich, an den Menschen, den du liebst.“
„Du hast recht, Lenni, und ich bin überzeugt, daß dich keinerlei Schicksalsschläge, keinerlei Prüfungen von deiner Aufgabe ablenken werden, daß du dir selbst ebenso treu und daß du ebenso stark und rein bleiben wirst wie bisher.“
Die Zukunft warf ihre Schatten auf unsere Abschiedsliebkosungen und erschütterte Netti bis zu Tränen.
In diesen kurzen Monaten war es mir dank Nettis Hilfe in hohem Maße gelungen, mich auf die Verwirklichung meines Hauptplanes vorzubereiten: ein nützlicher Arbeiter der Marsgesellschaft zu werden. Ich schlug wohlüberlegt alle Aufforderungen ab, über die Erde und deren Menschen Vorträge zu halten; es wäre sinnlos gewesen, dies zu meiner Spezialität zu machen, da es ja auf künstliche Art mein Bewußtsein an die Dinge der Vergangenheit gefesselt hätte und mir dadurch die Zukunft, für die es zu kämpfen galt, verloren gegangen wäre. Ich beschloß ganz einfach, in einen Betrieb zu gehen und wählte, nach verschiedenen Vergleichen und reiflicher Ueberlegung, als erste Arbeitsstelle die Kleiderfabrik.
Selbstverständlich wählte ich eine leichtere Arbeit. Dennoch forderte diese von mir eine nicht geringe und ernsthafte Vorbereitung. Vor allem galt es, mich mit der Ausarbeitung des wissenschaftlichen Prinzips der Fabrikorganisationen im allgemeinen bekannt zu machen, dann aber mit jener besonderen Organisation der von mir gewählten Fabrik, mit deren Architektur, deren Arbeitseinteilung, mit den Maschinen, an denen ich arbeiten würde, kurzum mit allen Einzelheiten. Zu diesem Vorbereitungsstudium mußte ich gewisse Gebiete der Mechanik, der Technik, ja sogar der mathematischen Analyse studieren. Die Hauptschwierigkeit bestand für mich nicht in den Gegenständen selbst, sondern in den Formeln. Die Lehrbücher und Anleitungen rechneten nicht mit der weit niedrigeren Erdenkultur. Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind gequält wurde, indem man mir ein französisches Lehrbuch der Mathematik gab. Ich empfand für diesen Gegenstand eine ernsthafte Vorliebe, und anscheinend auch eine ungewöhnliche Begabung. Die Schwierigkeiten, die dem Anfänger meist so viel Kopfzerbrechen bereiten, die Idee des „Grenzwertes“ und der „Ableitung“ machten mir so wenig Mühe, als wären sie mir immer bekannt gewesen. Doch fehlten mir jene logische Disziplin und das praktische Wissen, die von dem französischen Professor vorausgesetzt wurden; das ganze Lehrbuch war dem Ausdruck nach äußerst klar und genau, doch geizte es mit Erklärungen. Es gab hier keine jener logischen Brücken, die sich ein Mensch von höherer wissenschaftlicher Kultur selbst hinzudenken kann, die aber für den jungen Asiaten vonnöten sind. Bisweilen dachte ich ganze Stunden lang über irgendeine magische Reduktion nach, die auf die Worte folgte: „Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den vorangegangenen Vergleich richten, so kommen wir zu dem Ergebnis ...“ – Derart war es mir damals ergangen, und das gleiche empfand ich in noch verstärktem Maße beim Studium der wissenschaftlichen Bücher des Mars. Die Illusion, die mich zu Beginn meiner Krankheit irregeführt hatte, daß alles leicht und verständlich sei, verschwand spurlos. Aber Netti hatte mir mit ihrer geduldigen Hilfe stets zur Seite gestanden und mir den schweren Weg geebnet.
Bald nach Nettis Abfahrt faßte ich meinen Entschluß und trat in den Betrieb ein. Die Fabrik war ein riesenhaftes und äußerst kompliziertes Unternehmen; sie glich nicht im geringsten unserer üblichen Vorstellung von einer Kleiderfabrik. Hier waren Spinnerei, Weberei, das Zuschneiden, Nähen und Färben der Kleider vereinigt, das Material jedoch, das zur Verarbeitung gelangte, war weder Flachs, noch Baumwolle, noch Pflanzenfasern überhaupt, noch Wolle, noch Seide, sondern etwas ganz anderes.
In der ersten Zeit verfertigten die Marsbewohner ihre Gewänder aus den gleichen Stoffen wie wir; sie bauten jene Pflanzen an, deren Gewebe diesem Zweck diente, schoren die wolletragenden Tiere, zogen ihnen die Haut ab, züchteten eine besondere Art Spinnen, deren Gewebe die Eigenschaften der Seide besaß usw. Die wirtschaftlichen Veränderungen und die Vervollkommnung der Technik erforderten jedoch eine immer größere Getreideproduktion. Die Pflanzenfasern wurden durch mineralische Fasern ersetzt. Später wandten die Gelehrten alle Aufmerksamkeit der Erforschung der Spinnengewebe zu, suchten nach einer Synthese neuer Stoffe mit analogen Eigenschaften. Als ihnen dies gelungen war, erfolgte auf diesem ganzen Gebiet eine gewaltige Umwälzung, und heute konnte man die Gewebe des alten Typus nur noch in historischen Museen sehen.
Unsere Fabrik war die wahrhafte Verkörperung dieser Umwälzung. Etliche Mal im Monat wurde aus der zunächstgelegenen chemischen Fabrik auf dem Schienenweg für die Spinnerei „Material“ geliefert, das heißt: eine durchsichtige Flüssigkeit in gewaltigen Zisternen. Aus diesen Zisternen wurde vermittels besonderer luftdichter Apparate das Material in ungeheure, hohe Metallreservoire geleitet, deren dichter Boden hunderttausend mikroskopisch kleine Oeffnungen besaß. Durch diese Oeffnungen gelangte die klebrige Flüssigkeit unter einen starken Luftdruck und verhärtete sich zu zähen Fasern. Zehntausend mechanische Spindeln erfaßten diese Fasern, spannen sie zu Fäden verschiedener Dicke, schafften das Gespinst in die Webeabteilung. Hier wurden die verschiedenen Stoffe gewebt, von den allerfeinsten, wie Musselin und Batist, bis zu den dicksten, wie Tuch und Filz. Die endlosen breiten Streifen gelangten nun weiter in die Zuschneidewerkstätte. Hier wurden sie von neuen Maschinen gepackt, sorgfältig gefaltet, geschichtet, zu genau ausgemessenen Stücken zerschnitten, zu Stücken, die die einzelnen Teile des Gewandes bildeten.
In der Schneiderwerkstatt wurden aus den zugeschnittenen Stücken fertige Kleider hergestellt, jedoch ohne daß dabei Nadel, Faden oder Nähmaschine angewandt worden wären. Durch einen chemischen Prozeß wurden die Ränder der Kleidungsstücke erweicht und abermals in ihren ersten flüssigen Zustand versetzt. Sobald die chemische Substanz verdunstete, waren die Kleider gleichsam zusammengelötet, fester, als es bei der besten Schneiderarbeit der Fall gewesen wäre. Diese Lötung wurde gleichzeitig überall vollzogen, wo es nottat, so daß auf diese Art fertige Kleider hergestellt wurden, und zwar in einigen tausend Mustern, der Form und dem Maß nach verschieden.
Es gab für jede Größe einige hundert Muster, aus denen ein jeder fast immer das geeignete zu wählen vermochte, und dies umso mehr, als sich die Marsbewohner äußerst ungezwungen kleideten. War dennoch das Geeignete nicht vorhanden, wie etwa im Fall einer körperlichen Unnormalität, so kam das Stück abermals unter die Zuschneidemaschine; es wurde ein besonderer Anzug „genäht“, was etwa eine Stunde in Anspruch nahm.
Was die Farbe der Gewänder anbelangte, so trugen die Marsbewohner meist dunkle weiche Farben, die dem Material entsprachen. Wurde jedoch eine andere Farbe verlangt, so kam der Anzug in die Färbeabteilung und erhielt vermittels eines chemisch-elektrischen Prozesses die gewünschte Farbe, die ideal gleichmäßig und ideal dauerhaft war.
Aus den gleichen, nur viel dickeren Geweben wurden das Schuhwerk und die warmen Winterkleider hergestellt. Unsere Fabrik verfertigte diese nicht, doch gab es andere, noch größere Betriebe, in denen alles verfertigt wurde, was ein Mensch vom Kopf bis zu den Füßen an Bekleidung braucht.
Ich arbeitete der Reihe nach in allen Abteilungen des Betriebes, ließ mich anfangs völlig von meiner Arbeit hinreißen. Besonders interessant erschien mir die Zuschneidewerkstatt; hier mußte ich bei meiner Arbeit mir bisher unbekannte Hilfsmittel in Anspruch nehmen: die mathematische Analyse. Die Aufgabe bestand darin, aus einem gegebenen Stück bei dem geringstmöglichen Materialverlust alle Teile eines Anzugs zu gewinnen. Dies war natürlich eine äußerst prosaische, aber auch ernste Sache, denn selbst der geringste Irrtum, der sich im Verlauf der Arbeit viele Millionen Mal wiederholte, bedeutete einen ungeheuren Verlust. Einen erfolgreichen Entschluß zu fassen, gelang mir meist „nicht schlechter“ als andern.
Nicht „schlechter“ zu arbeiten als die anderen, das strebte ich aus allen Kräften an, und fast immer mit einem gewissen Erfolg. Doch mußte ich bemerken, daß dies für mich eine weit größere Anstrengung bedeutete als für meine Kameraden. Nach den gewöhnlichen vier bis sechs Arbeitsstunden – die Erdenberechnung als Grundlage genommen – fühlte ich heftige Erschöpfung und mußte sofort rasten, während die andern noch in Museen, Bibliotheken, Laboratorien gingen oder aber in andere Fabriken, um dort die Arbeit zu beobachten, bisweilen auch noch selbst mitzuarbeiten ...
Ich hoffte, mich allmählich an die neue Arbeit zu gewöhnen und meinen Genossen gleich zu werden. Doch geschah dies nicht. Ich überzeugte mich immer mehr davon, daß mir die Kultur der Aufmerksamkeit fehle. Körperliche Bewegungen wurden äußerst wenig erfordert, und was deren Schnelligkeit und Gewandtheit anbelangte, so stand ich nicht hinter den anderen zurück, ja, ich übertraf sie sogar. Aber die ununterbrochene aufmerksame Beobachtung der Maschine und des Materials fiel meinem Gehirn ungeheuer schwer: diese Fähigkeit vermag sich offensichtlich erst im Verlauf einiger Generationen zu jener Stufe zu entwickeln, die hier als Durchschnitt und völlig alltäglich erscheint.
Wenn mich, und dies war meist am Ende des Arbeitstages der Fall, Erschöpfung ankam und meine Aufmerksamkeit nachließ, ich Fehler beging oder auf eine Sekunde die Ausführung einer Arbeit unterließ, brachte die unermüdliche, unbeirrte Hand meines Nachbarn die Sache immer in Ordnung.
Die merkwürdige Fähigkeit dieser Menschen, alles ringsum zu beobachten, ohne dabei auch nur im geringsten die eigene Arbeit zu vernachlässigen, versetzte mich in Erstaunen und reizte mich sogar. Ihre Fürsorge störte mich nicht nur, nein, sie rief in mir auch Aerger und Ungeduld wach; erregte in mir das Gefühl, als ob alle ununterbrochen meine Tätigkeit verfolgten ... Diese Unruhe verstärkte noch meine Zerstreutheit und ließ mich schlechter arbeiten.
Heute, nach langer Zeit, da ich genau und leidenschaftslos an all dies zurückdenke, sehe ich ein, daß ich es damals falsch aufgefaßt habe. Mit der gleichen Fürsorge und auf dieselbe Art halfen meine Genossen in der Fabrik einander. Ich war keineswegs der Gegenstand irgendeiner ausschließlichen Aufsicht oder Kontrolle, wie es mich damals dünkte. Ich selbst, der Mensch aus einer individualistischen Welt, sonderte mich von den übrigen ab und verkannte auf krankhafte Art ihre Güte und ihre kameradschaftlichen Dienste, für die sie, die Menschen einer kameradschaftlichen Welt, von mir nicht gewürdigt werden konnten.
Der lange Herbst war vorüber, nun beherrschte bereits der schneearme, aber kalte Winter unsere Gegend, die nördliche Mitte der Halbkugel. Die kleine Sonne wärmte gar nicht mehr und leuchtete noch weniger als zuvor. Die Natur warf die hellen Farben ab, erschien fahl und streng. Die Kälte schlich sich ins Herz, der Zweifel in die Seele ein, und die Einsamkeit des Sprößlings aus einer anderen Welt wurde immer qualvoller.
Ich suchte Enno auf, die ich seit langer Zeit nicht gesehen hatte. Sie empfing mich wie einen ihr nahestehenden lieben Menschen; mir war, als durchbreche das strahlende Licht der nahegelegenen Vergangenheit die Winterkälte und die Nacht der Sorgen. Dann aber bemerkte ich, daß auch sie blaß und von Kummer erschöpft zu sein schien. In ihrem Verhalten und ihren Worten lag verborgener Gram. Wir hatten einander viel zu sagen, und einige Stunden vergingen für mich angenehm und gut, wie dies seit Nettis Abfahrt nicht mehr gewesen war.
Als ich mich erhob, um heimzukehren, wurde uns beiden schwer ums Herz.
„Wenn Ihre Arbeit Sie nicht hier festhält, so kommen Sie mit mir“, sagte ich.
Enno ging sofort auf meinen Vorschlag ein. Sie nahm ihre Arbeit mit. Zu jener Zeit hatte sie nichts im Observatorium zu tun, trug einen ungeheuren Vorrat von Berechnungen zusammen, und wir begaben uns in die chemische Stadt, wo ich Mennis Wohnung allein bewohnte. Allmorgendlich fuhr ich in meine Fabrik, die sich hundert Kilometer, also eine halbe Wegstunde, entfernt befand. Die langen Winterabende verbrachte ich von nun an mit Enno; wir beschäftigten uns mit wissenschaftlichen Arbeiten, plauderten oder unternahmen Spaziergänge in die Umgebung.
Enno erzählte mir ihre Geschichte. Sie liebte Menni und war dessen Frau gewesen. Es verlangte sie sehnlichst danach, von ihm ein Kind zu haben, aber Jahr um Jahr verstrich, ohne daß ihr Wunsch in Erfüllung ging. Sie wandte sich an Netti um Rat. Diese erforschte alle Umstände und gelangte zu dem kategorischen Ausspruch, daß Enno von Menni niemals ein Kind haben werde. Menni hatte sich allzu spät vom Knaben zum Mann entwickelt und allzu früh das anstrengende Leben eines Gelehrten und Denkers zu führen begonnen. Die übertriebene Tätigkeit seines Gehirnes und dessen außerordentliche Entwicklung hatten von allem Anfang an die lebendigen Elemente der Vermehrung zerstört und erdrückt; dies war nicht mehr gut zu machen.
Nettis Urteil bedeutete einen furchtbaren Schlag für Enno, bei der die Liebe zu dem genialen Menschen und der starke Mutterinstinkt zu einem Streben verschmolzen waren, das sich nun als hoffnungslos erwies.
Doch war dies noch nicht alles: Nettis Untersuchungen führten auch zu einem zweiten Ergebnis. Es zeigte sich, daß für Mennis gigantische geistige Arbeit, für die Entwicklung seiner genialen Fähigkeiten die größte Enthaltsamkeit vonnöten sei, daß er sich so wenig wie möglich den Liebkosungen der Liebe hingeben dürfe. Enno fühlte sich verpflichtet, Nettis Rat zu befolgen und konnte sich bald von dessen Richtigkeit überzeugen. Menni war wie neubelebt, er arbeitete mit größerer Energie als je zuvor, neue Pläne entstanden mit außergewöhnlicher Schnelligkeit in seinem Kopfe, er führte sie mit Erfolg durch und schien offensichtlich nichts zu entbehren. Enno, der ihre Liebe teuerer war als das Leben, die aber das Genie des geliebten Menschen noch höher wertete als ihre Liebe, zog die Folgen dieser Erkenntnis.
Sie trennte sich von Menni. Dieser war im Anfang äußerst erzürnt, fand sich jedoch bald mit der Tatsache ab. Der wahre Grund des Bruches war ihm vielleicht unbekannt. Enno und Netti hielten ihn geheim, doch konnte man freilich nicht sicher wissen, ob nicht Mennis durchdringender Verstand die Ursache erraten habe. Für Enno aber war nun das Leben so unsäglich leer, das Unterdrücken ihrer Gefühle quälte sie derart, daß die junge Frau schon nach kurzer Zeit beschloß, Selbstmord zu begehen.
Netti, an die sich Enno gewandt hatte, schob die Tat, die sie verhindern wollte, unter verschiedenen Vorwänden immer wieder hinaus und benachrichtigte schließlich Menni. Dieser organisierte damals gerade die Expedition nach der Erde und sandte sofort eine Aufforderung an Enno, sie möge sich diesem bedeutsamen und gefährlichen Unternehmen anschließen. Es war schwer, dieser Aufforderung nicht Folge zu leisten; Enno nahm sie an. Eine Unmenge neuer Eindrücke halfen ihr, den Seelenschmerz zu überwinden, und zur Zeit der Rückkehr auf den Mars vermochte sie sich bereits so weit zu beherrschen, um als der heitere, junge Dichter zu erscheinen, den ich auf dem Aetheroneff kennen gelernt hatte.
An der neuen Expedition hatte Enno nicht teilgenommen, weil sie fürchtete, sich allzu sehr an Mennis Gegenwart zu gewöhnen. Aber die Angst um dessen Schicksal folterte sie in ihrer Einsamkeit, denn sie kannte genau die große Gefahr des Unternehmens. An den langen Winterabenden kreisten unsere Gedanken und Worte beständig um den einen Punkt des Weltalls: um jenen, wo unter der Glut der gigantischen Sonne, unter dem sengenden Hauch des Windes, die beiden uns liebsten Wesen mit fieberhafter Energie ihre titanisch kühne Arbeit verrichteten. Dieser gemeinsame Gedanke und die gleichartige Stimmung brachte uns einander sehr nahe. Enno war mir mehr als eine Schwester.
Schier selbstverständlich, ohne Kampf und ohne Erschütterungen führte unsere Freundschaft zu einem Liebesverhältnis. Die unbeirrbar ehrliche und gütige Enno wich dieser Entwicklung nicht aus, wenngleich sie sie nicht angestrebt hatte. Sie beschloß nur, von mir kein Kind zu haben ... Der Schatten einer leisen Trauer verdunkelte ihre Liebkosungen, – die Liebkosungen einer zärtlichen Freundschaft, die alles gestattet ...
Der Winter breitete seine kalten weißen Flügel über uns, – der lange Marswinter, ohne Tau, ohne Winde und Schneestürme, ruhig, starr wie der Tod. Wir beide fühlten kein Verlangen, nach dem Süden zu fliegen, wo um diese Zeit die Sonne glühte und die Natur ihr leuchtendes Gewand angelegt hatte. Enno sehnte sich nicht nach einer derartigen Natur, die so schlecht mit ihrer Stimmung harmoniert hätte, und ich floh fast vor neuen Menschen und neuen Umgebungen, denn die Gewöhnung an diese würde neue nutzlose Arbeit gefordert, neue Erschöpfung verursacht haben; ich näherte mich ohnehin nur gar langsam meinem Ziel. Unserer Freundschaft eignete etwas seltsam Gespenstisches – Liebe, die Herrschaft des Winters, Sorgen und angstvolle Erwartung ...
Enno war seit ihrer frühesten Jugend mit Netti befreundet gewesen und wußte mir über sie viel zu erzählen. Während eines unserer Gespräche wurden Nettis und Sternis Namen in einer gewissen Verbindung genannt, die mir merkwürdig erschien. Als ich darauf eine direkte Frage stellte, überlegte Enno eine Weile, wurde schier verwirrt und erwiderte schließlich:
„Netti war früher Sternis Frau. Wenn sie Ihnen dies nicht gesagt hat, so steht mir kein Recht zu, darüber zu reden. Ich beging offensichtlich einen Irrtum und Sie dürfen mich nicht weiter befragen.“
Das Vernommene erschütterte mich seltsam ... Eigentlich war es ja nichts Neues, Unerwartetes ... Ich hatte niemals angenommen, daß ich Nettis erster Mann sei. Es wäre Torheit gewesen, zu glauben, daß eine lebensvolle, gesunde Frau mit schönem Leib und schöner Seele, das Kind einer freien, hochkultivierten Rasse, bis zu unserer Begegnung ohne Liebe gelebt habe. Weshalb also meine unbegreifliche Verblüffung? Ich vermochte keine Erklärung dafür zu finden, kannte bloß ein Gefühl: ich müsse alles erfahren, alles genau und klar wissen. Enno zu befragen, ging offensichtlich nicht an. Ich erinnerte mich an Nella.
Netti hatte vor ihrer Abfahrt zu mir gesprochen: „Vergiß Nella nicht; suche sie auf in deinen schweren Augenblicken.“ Ich hatte schon mehr als einmal daran gedacht, zu Nella zu gehen, war aber zum Teil durch meine Arbeit, zum Teil durch die unklare Angst vor den Hunderten von neugierigen Kinderaugen zurückgehalten worden. Jetzt jedoch schwand jegliche Unentschlossenheit; noch am gleichen Tag begab ich mich nach dem Haus der Kinder, in die große Maschinenstadt.
Nella ließ sogleich ihre Arbeit liegen, bat eine der Erzieherinnen, sie zu vertreten und führte mich in ihre Stube, wo uns die Kinder nicht stören würden.
Ich beschloß, ihr nicht sofort den Zweck meines Besuches zu bekennen, umsomehr, als mir dieser Zweck auch selbst nicht recht vernünftig und ganz richtig erschien. Es war ja vollkommen natürlich, daß ich das Gespräch auf jenes Wesen lenkte, das uns beiden das teuerste war, und dann den günstigsten Augenblick für meine Frage abwartete. Nella erzählte voller Eifer von Netti, deren Kindheit und Jugend.
Ihre ersten Lebensjahre hatte Netti bei der Mutter verbracht, wie dies auf dem Mars allgemein üblich war. Als dann die Zeit kam, da Netti ins Haus der Kinder gebracht werden mußte, damit sie nicht den erzieherischen Einfluß des Umgangs mit anderen Kindern entbehre, brachte es Nella nicht übers Herz, sich schon von ihr zu trennen und lebte mit ihr zusammen in dieser Anstalt, wo sie dann schließlich als Erzieherin blieb. Das ergab sich zum Teil aus ihrem Spezialstudium: sie hatte sich vornehmlich mit Psychologie befaßt.
Netti war ein lebhaftes, energisches, wildes Kind mit großem Wissens- und Tatendurst. Am meisten interessierte und zog sie die geheimnisvolle astronomische Welt jenseits des Planeten an. Die Erde, die zu erreichen damals noch nicht gelungen war, und deren unbekannte Menschheit waren Nettis Lieblingstraum, das Hauptthema ihrer Gespräche mit den anderen Kindern und den Erwachsenen.
Als der Bericht über Mennis erste erfolgreiche Expedition nach der Erde veröffentlicht wurde, verlor das kleine Mädchen vor Freude und Entzücken fast den Verstand. Die kleine Netti kannte Mennis Bericht Wort für Wort auswendig und quälte die Mutter sowie die Erzieherinnen ewig mit Fragen über die ihr unverständlichen technischen Ausdrücke, die in dem Bericht vorkamen. Netti verliebte sich in Menni, ohne ihn zu kennen, schrieb ihm einen begeisterten Brief, flehte ihn unter anderem an, er möge sie zu den Erdenkindern bringen, denen keine Erziehung zu Teil werde, sie übernehme es, diese auf vortreffliche Art zu erziehen. Sie schmückte ihr Zimmer mit Erdenbildern und den Porträts der Erdenmenschen und stürzte sich auf das Studium der Erdensprachen, sobald die dazu nötigen Bücher erschienen waren. Sie entrüstete sich über die Gewalt, mit der Menni und dessen Gefährten dem ersten Erdenmenschen begegnet waren: sie hatten ihn gefangen genommen, damit er ihnen beim Erlernen der Erdensprachen behilflich sei; zur gleichen Zeit jedoch bedauerte sie heftig, daß Menni und die seinen bei der Rückkehr in die Heimat den Erdenmenschen freigelassen und nicht nach dem Mars mitgenommen hatten. Sie faßte den festen Entschluß, eines Tages nach der Erde zu fliegen, und auf die Scherze der Mutter, sie würde sich dort sicher mit einem Erdenmenschen verheiraten, entgegnete sie sinnend: „Das ist sehr möglich.“
All diese Dinge hatte mir Netti niemals erzählt; in ihren Gesprächen schien sie vielmehr der Vergangenheit auszuweichen. Selbstverständlich konnte niemand, nicht einmal sie selbst, jene Dinge besser berichten, als Nella. Bisweilen vergaß ich völlig meine Person, sah vor mir das reizende kleine Mädchen mit den großen funkelnden Augen und der rätselhaften Sehnsucht nach der fernen, fernen Welt ... Doch verging diese Stimmung rasch, das Bewußtsein meiner Umgebung kehrte zurück und damit auch die Erinnerung an den Zweck unseres Gesprächs; von neuem drang eisige Kälte in meine Seele.
Als sich das Gespräch den letzten Jahren aus Nettis Leben zuwandte, beschloß ich, meine Frage zu stellen, mich so ruhig und ungezwungen wie nur möglich nach Nettis und Sternis Verhältnis zu erkundigen. Nella dachte einen Augenblick lang nach.
„Also deshalb suchten Sie mich auf! ... Weshalb sagten Sie es nicht gerade heraus?“
Unerbittliche Strenge klang aus ihrer Stimme. Ich schwieg.
„Selbstverständlich kann ich es Ihnen erzählen“, fuhr sie fort. „Es ist eine ganz einfache Geschichte. Sterni war einer von Nettis Lehrern. Er hielt den Jüngeren Vorträge über Mathematik und Astronomie. Als er von seiner ersten Expedition nach der Erde zurückkehrte, – ich glaube, dies war Mennis zweite Expedition, – hielt er eine Reihe Vorträge über diesen Planeten und dessen Bewohner. Netti zählte zu seinen ständigen Hörern. Die Geduld und Aufmerksamkeit, mit der er ihren ewigen Fragen begegnete, brachte die beiden einander näher. Schließlich führte all dies zu ihrer Verbindung. Beide waren grundverschiedene Charaktere. Das Ergebnis der Verschiedenheit zeigte sich bald auch in ihrem Privatleben, führte zur Entfremdung und schließlich zum Bruch. Das ist alles.“
„Sagen Sie mir, wann kam es zum Bruch?“
„Zum endgültigen Bruch kam es nach Lettas Tode. Die innige Freundschaft zwischen Netti und Letta gab dazu den ersten Anstoß. Netti litt unter Sternis analytisch kaltem Verstand; er zerstörte allzu systematisch und hartnäckig alle Luftschlösser, alle Phantasien des Geistes und des Gefühls, die für sie einen Teil des Lebens bedeuten. Unwillkürlich suchte sie nach einem Menschen, der sich diesen Dingen gegenüber anders verhielt. Und dem alten Letta eigneten ein selten teilnahmsvolles Herz sowie ein schier kindlicher Enthusiasmus. Netti suchte in ihm jenen Gefährten, dessen sie bedurfte: Letta hatte mit ihren Phantasien nicht nur Geduld, sondern ließ sich auch häufig selbst von ihnen fortreißen. Bei ihm konnte sie von der strengen selbstzerfleischenden Kritik Sternis Erholung finden. Letta liebte gleich ihr die Erdenträume und Phantasien, glaubte an die künftige Verbindung der beiden Welten, die eine herrliche Blüte und eine gewaltige Lebenspoesie zur Folge haben würde. Als dann Netti erfuhr, daß ein Mensch, in dessen Seele derartige Gefühle verborgen lagen, niemals Frauenliebe und Zärtlichkeit kennen gelernt habe, konnte sie sich damit nicht abfinden. Auf diese Art kam Nettis zweiter Bund zustande.“
„Einen Augenblick“, unterbrach ich sie. „Verstehe ich Sie recht, Sie sagten, Netti sei Lettas Frau gewesen?“
„Sie sagten aber doch, daß der endgültige Bruch mit Sterni erst nach Lettas Tode erfolgte.“
„Ja; erscheint Ihnen dies unbegreiflich?“
„Nein, ich verstehe Sie, wußte bloß nicht darum.“
In diesem Augenblick wurde unser Gespräch unterbrochen. Eines der Kinder hatte einen nervösen Anfall erlitten und einer der Schüler rief Nella. Ich blieb eine Zeitlang allein. Die Gedanken wirbelten durch meinen Kopf; mir war so seltsam zumute, daß ich dies in Worten nicht auszudrücken vermag. Weshalb eigentlich? Es war doch nichts Besonderes vorgefallen. Netti war ein freier Mensch, hatte als freier Mensch gehandelt. Letta ist ihr Mann gewesen? Ich hatte ihn stets verehrt, für ihn warme Zuneigung empfunden, hätte ihn selbst dann geliebt, wenn er sich nicht für mich geopfert haben würde. Netti war also gleichzeitig mit zwei Genossen verheiratet gewesen? Ich hatte immer gefunden, daß die Monogamie in unserer Welt ausschließlich den wirtschaftlichen Bedingungen entspringe, die den Menschen bei jedem Schritt begrenzen und hemmen. Hier existierten diese Bedingungen nicht, auf dem Mars herrschten andere Verhältnisse, die dem persönlichen Gefühl und den persönlichen Verbindungen keine Fesseln anlegten. Woher kam aber meine Erregung und der unbegreifliche Schmerz, über den ich aufschreien, dann aber wieder lachen hätte mögen? Konnte ich das, was ich dachte, nicht auch fühlen? Anscheinend nicht. Und mein eigenes Verhältnis zu Enno? Wo blieb da meine Logik? Und was bin ich eigentlich? Welch törichte Stimmung!
Ach ja, und auch dies berührte mich peinlich: weshalb hatte Netti nicht mit mir darüber gesprochen? Wie viele Geheimnisse, wie viel Betrug umgeben mich noch? Wie viele harren meiner in der Zukunft? Aber nein, auch dies stimmt nicht! Geheimnisse, ja, aber kein Betrug. Ist aber nicht auch schon das Geheimnis ein Betrug?
Derartige Gedanken wirbelten durch meinen Kopf, als sich die Tür öffnete und Nella zurückkam. Sie las augenscheinlich von meinen Zügen ab, wie schwer mir ums Herz war, denn der Ton, mit dem sie sich an mich wandte, war frei von Strenge und Kälte.
„Es ist natürlich schwer“, meinte sie, „sich an die völlig fremden Lebensbedingungen und an die Sitten einer anderen Welt zu gewöhnen, mit der Sie keine Blutsverwandtschaft verbindet. Sie haben bereits in dieser Beziehung manchen Sieg errungen, finden Sie sich nun auch in diese Dinge. Netti glaubt an Sie, und mir scheint, daß sie recht hat. Ist etwa Ihr Vertrauen zu Netti, Ihr Glaube an sie schwankend geworden?“
„Weshalb verbarg sie diese Tatsache vor mir? Wo blieb da ihr Glaube? Ich begreife sie nicht.“
„Ich weiß nicht, weshalb sie so handelte. Doch bin ich davon überzeugt, daß sie hierfür gewichtige und edle Gründe hatte, es keineswegs aus kleinlichen Motiven tat. Vielleicht vermag Sie dieser Brief aufzuklären. Sie ließ ihn mir für den Fall zurück, daß wir ein derartiges Gespräch führen sollten, wie wir es heute taten.“
Der Brief war in meiner Muttersprache geschrieben, die Netti so gut beherrschte. Ich las folgendes:
„Mein Lenni! Ich sprach niemals mit Dir über meine früheren persönlichen Verhältnisse, doch geschah es keineswegs deshalb, weil ich Dir irgendetwas aus meinem Leben verheimlichen wollte. Ich vertraue fest auf Deinen klaren Kopf und Dein edles Herz; zweifle gar nicht daran, daß Du, wie auch immer fremd und ungewohnt unsere Sitten für Dich sein mögen, sie zu verstehen und richtig zu werten vermagst.
Eines jedoch fürchtete ich ... Nach der Krankheit kehrte Deine Arbeitskraft rasch zurück, jenes seelische Gleichgewicht hingegen, von dem in jeder Minute die Selbstbeherrschung in Wort und Tat abhängt, hast Du noch nicht völlig wiedererlangt. Würdest Du Dich, beeinflußt vom Augenblick und von der elementaren Gewalt, die in der Tiefe jeder Menschenseele verborgen liegt, mir gegenüber wie gegen eine schlechte Frau verhalten, die sich aus der Vergewaltigung und Sklaverei der alten Welt befreit hat – Du würdest es Dir selbst niemals verzeihen. Ja, Teuerster, ich weiß es, Du bist gegen Dich selbst streng, bisweilen sogar grausam – diesen Zug brachtest Du aus Eurer harten Schule mit, aus den jahrhundertealten Kämpfen der Erdenwelt – eine einzige Sekunde böser, schmerzlicher Entzweiung würde genügen, um in Deinem Herzen auf unsere Liebe für immer einen dunklen Schatten zu werfen.
Mein Lenni, ich will und kann Dich beruhigen. Möge in Deiner Seele ewig schlummern und niemals erwachen jenes böse Gefühl, das in die Liebe zu einem Menschen die Unruhe und Sorge um ein lebendiges Eigentum mischt. Ich werde keine persönlichen Verhältnisse mehr haben. Das vermag ich Dir leicht und mit Bestimmtheit zu versprechen, weil im Vergleich zu meiner Liebe für Dich, zu dem leidenschaftlichen Wunsch, Dir bei Deiner großen lebendigen Aufgabe zu helfen, alles andere gering und nichtig erscheint. Ich liebe Dich nicht nur wie eine Gattin, sondern auch wie eine Mutter, die ihr Kind in ein neues und ihm fremdes Leben einführt, das voller Gefahren und Mühen ist. Diese Liebe aber ist stärker und tiefer, als irgendeine andere Liebe zwischen Mensch und Mensch. Deshalb bedeutet auch mein Versprechen kein Opfer.
Auf Wiedersehen, mein teueres, geliebtes Kind,
Deine Netti.“
Als ich den Brief zu Ende gelesen hatte, blickte mich Nella fragend an.
„Sie hatten Recht“, sprach ich und küßte ihr die Hand.
Der oben geschilderte Vorfall ließ in meiner Seele das Gefühl tiefster Demütigung zurück. Noch weit schmerzlicher als früher empfand ich die Ueberlegenheit meiner Umgebung, in der Fabrik und überall. Zweifellos übertrieb ich diese Ueberlegenheit sowie das Gefühl der eigenen Schwäche. Ich begann in der mich umgebenden Dienstbereitschaft und Fürsorge eine leichte Färbung halb verächtlicher Herablassung zu sehen, in der vorsichtigen Zurückhaltung meiner Arbeitsgefährten eine heimliche Abneigung gegen das niedrigere Wesen. In einer derartigen Stimmung verlor ich die Fähigkeit genauer Beobachtung und richtiger Wertung.
In allen anderen Beziehungen blieben meine Gedanken klar, arbeiteten nun vor allem an dem Problem, das sich auf Nettis Abreise bezog. Ich fühlte immer stärker die Ueberzeugung, daß es für Nettis Teilnahme an der Expedition ein mir noch unbekanntes Motiv gab, eines, das stärker und gewichtiger war, als jene, die sie mir gegenüber vorgebracht hatte. Der neue Beweis von Nettis Liebe und von der ungeheueren Bedeutung, die sie meiner Mission, die zwei Welten einander nahe zu bringen, beilegte, bestärkte mich in der Annahme, daß sie sich ohne zwingende Gründe nicht entschlossen haben würde, mich für lange Zeit auf dem tiefen, durch Sandbänke und Klippen gefahrvollen Meer des fremden Lebens allein zu lassen, mußte doch ihr heller und scharfer Verstand besser als jeder andere begreifen, welche Gefahren mich hier bedrohten. Es gab etwas, um das ich nicht wußte, doch war ich fest überzeugt, dieses Etwas stehe in enger Verbindung mit mir, und es sei nötig, um jeden Preis zu erfahren, worum es sich handle.
Ich beschloß, systematisch Nachforschungen anzustellen. Es fielen mir Beobachtungen ein, zu denen mich einige zufällige und unwillkürliche Andeutungen Nettis veranlaßt hatten: der beunruhigte Ausdruck, der auf ihrem Gesicht lag und mich in Erstaunen versetzte, sobald die Rede auf die Kolonialexpeditionen kam; ich begann zu ahnen, daß Netti sich zu unserer Trennung nicht erst damals entschlossen hatte, als sie mir davon sprach, sondern bereits weit früher, schon in den ersten Tagen unserer Vereinigung. Demnach mußte der Grund aus jener Zeit stammen. Wo aber war er zu suchen?
Er konnte eine rein persönliche Angelegenheit Nettis sein, konnte aber auch mit der besonderen Bedeutung der Expedition zusammenhängen. Die erste Annahme erschien mir, nachdem ich Nettis Brief gelesen hatte, unwahrscheinlich. Vor allem galt es also, die Einzelheiten zu erforschen, mit jenen zu beginnen, die die Geschichte dieser Expeditionen zu erklären vermochten.
Es verstand sich von selbst, daß die Expedition auf den Beschluß der „Kolonialgruppe“ zurückzuführen war. – Diesen Namen trug die Vereinigung jener Arbeiter, die aktive Teilnehmer der interplanetarischen Reisen waren, zusammen mit dem Vorsitzenden des Zentralen statistischen Bureaus und jener Fabriken, die die Aetheroneffs herstellten, sowie alle für die Expedition unentbehrlichen Mittel. Ich wußte, daß die letzte Sitzung der „Kolonialgruppe“ während meiner Krankheit stattgefunden hatte. Menni und Netti hatten an ihr teilgenommen. Damals befand ich mich bereits auf dem Wege der Genesung, langweilte mich ohne Netti und verlangte, ebenfalls der Sitzung beizuwohnen. Netti jedoch erwiderte, dies wäre gefährlich für meine Gesundheit. Hing diese „Gefahr“ vielleicht von etwas ab, das ich nicht wissen durfte? Ich mußte demnach das Protokoll der Sitzung lesen, dort alles suchen, was mit dieser Frage in Zusammenhang stehen konnte.
Doch stieß ich bereits hier auf Schwierigkeiten. In der Kolonialbibliothek wurde mir nur die auf der Sitzung gefaßte Resolution vorgelegt. In dieser Resolution wurde bis in alle Einzelheiten die ganze Organisation des grandiosen Unternehmens geschildert, doch fand ich nirgends das, was mich im Augenblick interessierte. Ich erhielt auf meine Fragen keine Antwort. Die Resolution wurde ohne jedes Motiv wiedergegeben, ohne irgendeinen Hinweis auf die Ausführungen, die ihr vorangegangen waren. Als ich dem Bibliothekar erklärte, ich wolle das Protokoll, erwiderte er, das Protokoll werde nicht veröffentlicht, außerdem würden detaillierte Protokolle überhaupt nicht geführt, wie dies auch bei den technischen Sitzungen der Fall sei.
Auf den ersten Blick erschien mir dies richtig. Die Marsbewohner veröffentlichten meist nur die „Beschlüsse“ dieser Sitzungen, sie nahmen an, daß jede dort geäußerte verständige und nützliche Ansicht, sowie gegenteilige Meinungen und Auffassungen besser in Artikeln, Broschüren, Büchern usw. verfochten werden konnten, als in einer kurzen Rede. Ueberhaupt behagte es den Marsbewohnern nicht, die „Literatur“ übermäßig zu vermehren und man suchte bei ihnen vergeblich etwas, das unserer „Arbeitskommission“ gleichkam; sie bemühten sich, alles so wenig umfangreich wie möglich zu gestalten. Im gegebenen Fall jedoch schenkte ich den Worten des Bibliothekars keinen Glauben. Auf dieser Sitzung hatte es sich um große und gewichtige Dinge gehandelt, als daß man sie der öffentlichen Beurteilung hätte entziehen können, wie das bei den gewöhnlichen technischen Fragen der Fall war.
Ich versuchte selbstverständlich mein Mißtrauen zu verbergen, um keinerlei Verdacht zu erregen, vertiefte mich ergeben in das mir gewährte Material und entwickelte unterdessen den Plan meines weiteren Vorgehens.
Es war offensichtlich, daß ich von den Büchern der Bibliothek nicht jene erhalten würde, deren ich bedurfte; entweder gab es über diese Angelegenheit gar kein Protokoll, oder aber der Bibliothekar war auf meine Fragen vorbereitet gewesen und versteckte es vor mir. Doch blieb noch die Phonographen-Abteilung der Bibliothek übrig.
Dort konnten auch jene Protokolle, die nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurden, gefunden werden. Der Phonograph ersetzte bei den Marsbewohnern häufig die Stenographie, und in den Archiven wurden viele phonographische Platten der verschiedenen wichtigen Versammlungen aufbewahrt.
Ich benützte den Augenblick, da der Bibliothekar in seine Arbeit vertieft war und verfügte mich unbemerkt in die Phonographen-Abteilung. Dort erbat ich von dem diensthabenden Genossen den Katalog der Platten. Er gab ihn mir.
Aus dem Katalog ersah ich gar bald die Nummer der Platte der mich interessierenden Sitzung und ich begab mich unter dem Vorwand, daß ich den Genossen nicht belästigen wolle, selbst auf die Suche. Auch hier errang ich einen Erfolg.
Es gab von dieser Sitzung fünfzehn Phonogramme. An jeder der Platten war entsprechend dem hier üblichen Brauch ein Inhaltsverzeichnis befestigt. Ich studierte rasch diese Verzeichnisse.
Die fünf ersten waren den Berichten über die Expedition gewidmet, stammten noch aus einer früheren Sitzung und beschäftigten sich mit technischen, den Aetheroneff betreffenden Fragen.
Die Ueberschrift der vierten Platte lautete:
„Vorschlag des Zentralen statistischen Bureaus für den Uebergang zur Massenkolonisation. Wahl der Planeten – Erde oder Venus. Reden und Vorschläge Sternis, Nettis, Mennis und anderer. Beschluß zu Gunsten der Venus.“
Ich fühlte, dies sei, was ich suche und steckte die Platte in den Apparat. Was ich nun vernahm, schnitt mir für ewige Zeiten in die Seele. Es war Folgendes.
Menni eröffnete die Sitzung als Vorsitzender des Kongresses. Als erster ergriff der Vorsitzende des Zentralen statistischen Bureaus das Wort.
Er bewies auf Grund genauer Zahlen, daß bei der gegebenen Vermehrung der Bevölkerung und der Steigerung ihrer Bedürfnisse selbst für den Fall, daß die Marsbewohner die Ausbeutung ihres Planeten einschränkten, in etwa dreißig Jahren ein Mangel an Lebensmitteln eintreten müsse. Dieser Gefahr vermöchte freilich die Entdeckung der Synthese des Eiweiß aus unorganischen Stoffen zu begegnen, doch könne niemand dafür bürgen, daß diese Entdeckung in den nächsten dreißig Jahren gemacht würde. Deshalb sei es unbedingt nötig, daß die Kolonialgruppe von den rein wissenschaftlichen Expeditionen nach anderen Planeten zur Organisation einer Massenauswanderung der Marsbewohner übergehe. In Frage kämen zwei vom Mars aus erreichbare Planeten, beide reich an Naturschätzen. Es müsse schleunigst beschlossen werden, welcher der beiden als Zentrum der Kolonisation zu wählen sei, damit dann sofort an die Ausarbeitung des Planes gegangen werden könne.
Menni stellte die Frage, ob jemand gegen den Antrag des Redners oder gegen dessen Motivierung etwas einzuwenden habe. Doch verlangte niemand das Wort.
Dann warf Menni die Frage auf, welcher Planet als erster für die Massenkolonisation gewählt werden solle.
Sterni ergriff das Wort.
„Die erste, von dem Vorsitzenden des Zentralen statistischen Bureaus gestellte Frage“, hub Sterni in seinem üblichen, mathematisch nüchternen Ton an, „bezieht sich auf die Wahl des zu kolonisierenden Planeten. Meiner Ansicht nach bedarf es hier gar keiner Entscheidung, denn die Wahl wurde schon längst von der Wirklichkeit getroffen. Es hat gar keinen Sinn, zwischen den zwei Planeten wählen zu wollen, denn von den beiden uns erreichbaren ist für die Massenkolonisation bloß der eine geeignet: und zwar die Erde. Wir besitzen über die Venus eine ausführliche Literatur, mit der Sie alle selbstverständlich gut bekannt sind. Das Ergebnis aller unserer Versammlungen und Beratungen war stets das gleiche: es ist uns unmöglich, in diesem Augenblick von der Venus Besitz zu ergreifen. Ihre versengende Sonne erschöpft und schwächt unsere Kolonisten, ihre furchtbaren Stürme und Gewitter zerstören unsere Bauten, schleudern unsere Aeroplane in den Raum, zerschmettern sie an den riesenhaften Bergen. Mit ihren Ungeheuern vermöchten wir, freilich um den Preis nicht geringer Opfer, fertig zu werden; aber ihre unglaublich reiche Bakterienwelt, mit der wir noch ungenügend bekannt sind – wie viele neue Krankheiten vermag diese in sich zu bergen? Ihre Vulkane befinden sich noch in Tätigkeit; wie viele unerwartete Erdbeben, Lavaströme, Sturzfluten würden uns dort bedrohen? Der Versuch, die Venus zu kolonisieren, würde unzählige und völlig nutzlose Opfer fordern, Opfer, nicht der Wissenschaft und dem Glück der Allgemeinheit gebracht, sondern der Unvernunft und Phantasterei. Diese Frage erscheint mir völlig klar, und der Bericht über die letzte Expedition nach der Venus zerstört endgültig alle Zweifel.
Wenn es sich also um eine Massenauswanderung handelt, so kommt dafür nur die Erde in Betracht. Dort sind die durch die Natur bedingten Hindernisse gering, der Reichtum der Natur ist grenzenlos, übertrifft den unseres Planeten um das achtfache. Die Kolonisation selbst ist bereits durch die auf der Erde lebenden Wesen gut vorbereitet, wenngleich diesen Erdengeschöpfen eine höhere Kultur mangelt. All dies ist dem Zentralen statistischen Bureau wohlbekannt. Wenn es uns daher vorschlägt, die Wahl des Planeten zu treffen und wir es auch selbst für nötig halten, so besteht dafür ein einziger Grund, nämlich, daß sich uns auf der Erde ein äußerst ernstes Hindernis entgegenstellt: ihre Menschheit.
Die Erdenmenschen bewohnen die ganze Erde, werden auf keinen Fall bereit sein, sie gutwillig, und sei es auch nur einen Teil, an uns abzutreten. Das hängt mit dem ganzen Charakter ihrer Kultur zusammen, deren Basis der Besitz und die organisierte Gewalt sind. Wenngleich selbst die zivilisiertesten Völker der Erde bloß einen geringen Teil der ihnen erreichbaren Schätze der Natur ausbeuten, so verlangt es sie dennoch immer nach der Eroberung weiterer Territorien, und diese Gier schwächt sich niemals ab. Der systematisch betriebene Raub der Länder und des Besitzes der weniger zivilisierten Völker trägt bei ihnen die Bezeichnung Kolonialpolitik und wird als eine der Hauptaufgaben des staatlichen Lebens betrachtet. Man kann sich demnach vorstellen, wie sich die Erdenmenschen unserem ganz natürlichen und vernünftigen Vorschlag gegenüber verhalten würden: uns einen Teil ihres Gebietes abzutreten, wofür wir sie lehren und ihnen behilflich sein würden, den ihnen gebliebenen Teil in unvergleichlich höherem Maße auszunützen ... Für sie ist die Kolonisation eine Frage der rohen Kraft und der Vergewaltigung und wir wären, ob wir nun wollen oder nicht, gezwungen, ihnen gegenüber ebenfalls diesen Standpunkt einzunehmen.
Handelte es sich hier ausschließlich darum, ihnen ein einziges Mal unsere größere Kraft zu beweisen, so wäre dies sehr einfach und würde nicht mehr Opfer kosten, als die bei ihnen so beliebten unsinnigen, nutzlosen Kriege. Es existiert bei ihnen eine gewaltige Herde für den Mord dressierter Leute, die mit dem Wort Armee bezeichnet wird. Freilich vermöchten wir vom Aetheroneff aus vermittels der verderblichen, durch die beschleunigte Spaltung des Radiums erzeugten Lichtfluten in wenigen Augenblicken ein oder zwei dieser Herden zu vernichten, und dies wäre für die Zivilisation der Erde weit mehr nützlich als schädlich. Leider jedoch ist das, was nachher käme, lange nicht so einfach, die wahren Schwierigkeiten würden erst mit diesem Augenblick beginnen.
In dem jahrhundertealten Kampf der Erdenvölker gegen einander entwickelte sich bei ihnen eine psychologische Eigenheit, die Patriotismus heißt. Dieses unbestimmbare, aber starke und tiefe Gefühl enthält ebensowohl boshaftes Mißtrauen gegen alle Völker und Rassen, als auch eine schier elementare Anhänglichkeit für die Sitten und Gebräuche der eigenen Umgebung. Besonders ist dies in jenen Ländern der Fall, wo die Erdenvölker gleich Schildkröten mit ihrer Umgebung verwachsen sind; oft aber ist dieser Patriotismus nichts anderes, als die Gier nach Zerstörung, Vergewaltigung und Raub. Die patriotische Einstellung wird besonders stark nach kriegerischen Niederlagen; nehmen die Sieger den Besiegten einen Teil ihres Landes fort, dann nimmt der Patriotismus dieser Besiegten den Charakter eines hartnäckigen und grausamen Hasses gegen die Sieger an, und die Rache wird zum Lebensideal des ganzen Volkes, nicht nur der schlechteren Elemente, der „oberen“, der reaktionären Klassen, sondern auch der besten, der Arbeitermassen.
Wenn wir uns nun eines Teiles der Erdoberfläche durch Gewalt bemächtigten, so würde dies zweifellos zu einer Vereinigung aller Erdenmenschen in einem einzigen Gefühl des Erdenpatriotismus führen, zu einem unbarmherzigen Rassenhaß, zu wilder Wut gegen unsere Kolonisten; die Ausrottung der Eindringlinge, gleichviel mit welchen Mitteln, bis zum gemeinsten Verrat, würde als heilige und edle Sache gelten, die unsterblichen Ruhm verleiht. Unseren Kolonisten würde das Leben unerträglich gemacht werden. Sie wissen, daß die Vernichtung des Lebens selbst bei einer niederen Kulturstufe etwas äußerst einfaches ist. Im offenen Kampf sind wir unvergleichlich stärker als die Erdenmenschen, dennoch vermöchten sie durch unerwartete Ueberfälle uns ebenso zu töten, wie sie dies untereinander zu tun pflegen. Außerdem darf nicht außer acht gelassen werden, daß bei ihnen die Kunst der Zerstörung weit stärker entwickelt ist, als irgendetwas anderes in ihrer Kultur.
Unter diesen Umständen wäre das Leben auf der Erde geradezu unmöglich; es würde auf ihrer Seite Verschwörungen und Terror, auf der unserer Genossen beständige Gefahr und unzählige Opfer bedeuten. Diese müßten sich zu zehn oder vielleicht sogar hundert Millionen ansiedeln. Bei dem auf der Erde herrschenden gesellschaftlichen System, das keine gegenseitige Hilfe kennt, bei den dort herrschenden sozialen Verhältnissen, Dienste und Hilfe mit Geld zu entlohnen, bei der unzulänglichen und verschwenderischen Art der Produktion, die sich nicht rasch genug auf die gewaltige Vermehrung der Bewohner einzustellen vermöchte, würden Millionen der von uns Vertriebenen größtenteils zu einem schmerzlichen Hungertod verdammt sein. Die Minderheit des kolonisierten Teiles würde gegen uns bei der übrigen Erdenmenschheit eine grausam fanatische Agitation betreiben.
Wir müßten also den Kampf fortsetzen. Unser ganzer Erdenteil müßte sich in ein uneinnehmbares, festes Kriegslager verwandeln. Die Angst vor künftigen Eroberungen unsererseits, sowie der starke Rassenhaß würden alle Erdenvölker dazu vereinigen, sich auf einen Krieg gegen uns vorzubereiten. Sind schon heute ihre Waffen weit vollkommener als ihre Arbeitswerkzeuge, so würde in diesem Fall die technische Vervollkommnung der Mordinstrumente mit rasender Schnelligkeit vor sich gehen. Zu gleicher Zeit würden sie absichtlich eine Ursache für den Beginn des gewaltigen Krieges herbeiführen und erzwingen, eines Krieges, der für uns, selbst im Falle eines Sieges, ungeheure Verluste bedeutete. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ihnen auch die Aneignung und Verwertung unserer besten Mittel gelingen könnte. Sie kennen bereits die radiumausstrahlenden Stoffe; die Methode der beschleunigten Spaltung vermöchten sie vielleicht irgendwie durch uns erfahren, oder aber ihre Gelehrten könnten diese selbst entdecken. Es ist Ihnen allen bekannt, daß bei Anwendung dieser Waffen jener, der auch nur um wenige Minuten früher angreift als der Feind, diesen unweigerlich vernichtet; in diesem Fall erfolgt das Zerstören des höchsten Lebens ebenso leicht, wie durch ein Elementarereignis.
Welch ein Leben müßten unsere Genossen führen, umgeben von diesen Gefahren, gefoltert von der ewigen Erwartung ähnlicher Ueberfälle? Nicht nur alle Lebensfreude würde ihnen vergällt, nein, sogar ihr Typus würde sich verändern, verschlechtern. Allmählich schlichen sich in sie Argwohn, Mißtrauen ein, der egoistische Trieb der Selbsterhaltung und die von ihm unzertrennliche Grausamkeit. Die Kolonie würde aufhören, unsere Kolonie zu sein, würde sich in eine kriegerische Republik inmitten der geschlagenen, von Feindseligkeit erfüllten Völker verwandeln. Die sich wiederholenden blutige Opfer fordernden Ueberfälle würden immer mehr das Gefühl der Rache und der Feindschaft vergrößern, das uns teure Bild des Menschen entstellen und unsere Leute wären, objektiv gesprochen, aus Notwehr gezwungen, die grausamsten Mittel anzuwenden. Schließlich, nach langem Schwanken und einer qualvollen Kräftevergeudung, müßten wir unvermeidlich zu jener Lösung der Frage gelangen, die wir bereits von allem Anfang an hätten anerkennen müssen: die Kolonisierung der Erde fordert die völlige Ausrottung der Erdenmenschen.“
(Unter den hundert Zuhörern entstand ein Gemurmel des Entsetzens, aus dem sich Nettis mißbilligender Protest laut abhob. Als die Ruhe wieder hergestellt war, fuhr Sterni gelassen fort:)
„Das Unvermeidliche muß begriffen, und, wie hart auch immer es erscheint, es muß ihm ins Auge gesehen werden. Es gibt für uns zwei Möglichkeiten: entweder eine Stagnation in der Entwicklung unseres Lebens oder die Vernichtung des uns fremden Lebens auf der Erde. Ein drittes gibt es nicht. (Nettis Stimme durchklang den Raum: „Das ist nicht wahr!“) Ich weiß, woran Netti denkt, wenn sie gegen meine Worte protestiert und gehe auch schon zu der dritten Möglichkeit über, die sie im Auge hat.
Diese aber ist – der sofortige Versuch einer sozialistischen Erziehung der Erdenmenschheit, ein Plan, den wir alle noch unlängst befürwortet haben, der aber, meiner Ansicht nach, unbedingt aufgegeben werden muß. Wir kennen die Erdenmenschheit nun schon zur Genüge, um einzusehen, daß diese Idee völlig sinnlos sei.
Die Kulturstufe der führenden Erdenvölker ist etwa die gleiche, wie die unserer Vorfahren zur Zeit der großen Kanalbauten gewesen ist. Auf der Erde herrscht das Kapital, und es gibt ein Proletariat, das für den Sozialismus kämpft. Deshalb könnte man glauben, daß der Augenblick jener Umwälzung nicht mehr ferne sei, die die organisierte Gewalt vernichtet und die Möglichkeit einer freien und raschen Entwicklung des Lebens gibt. Doch besitzt der Erdenkapitalismus eine wichtige Eigenheit, die die Sache völlig verändert.
Einerseits ist die ganze Erdenwelt in politische und nationale Teile gespalten, so daß der Kampf um den Sozialismus nicht als einheitlicher vollkommener Prozeß einer Riesengesellschaft vor sich geht, sondern eine ganze Reihe selbständiger, eigenartiger Prozesse darstellt, geführt in den verschiedenen Staaten der Gesellschaft, die durch ihre staatliche Organisation, durch die Sprache und die Rasse getrennt sind. Andrerseits ist auf der Erde die Form des Klassenkampfes weit gröber und mechanischer, als dies bei uns der Fall gewesen ist, und die gleichsam materielle Kraft, verkörpert durch das stehende Heer und die bewaffneten Aufstände, spielt dabei eine große Rolle.
Aus allen diesen Umständen ergibt sich, daß die Frage der sozialen Revolution eine unbestimmbare ist: voraussichtlich wird es nicht eine, sondern verschiedene soziale Revolutionen geben, in den verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten. Ja, diese Revolutionen werden sogar einen verschiedenen Charakter haben, sowie einen unsicheren, nicht festzustellenden Ausgang. Die herrschenden Klassen verfügen über die Armee und eine hochentwickelte Kriegstechnik und vermögen daher in gewissen Fällen dem aufständischen Proletariat eine vernichtende Niederlage beizubringen, die in den großen Reichen den Kampf für den Sozialismus auf zehn Jahre zurückwirft. Derartige Fälle finden wir bereits in den Schriften der Erde erwähnt. Außerdem wird die Lage jener Länder, in denen der Sozialismus triumphiert hat, die einer Insel sein, umgeben von ihr feindlichen kapitalistischen Staaten, zum Teil sogar von Staaten, die noch nicht die Phase des Kapitalismus erreicht haben. Um ihre Herrschaft bangend, werden die besitzenden Klassen der nicht sozialistischen Länder alle Anstrengungen machen, um diese Insel zu zerstören, sie werden unaufhörlich kriegerische Ueberfälle gegen sie organisieren und sogar bei den sozialistischen Nationen genügend Verbündete finden, die, den früheren besitzenden Klassen angehörend, zu jedem Verrat bereit sind. Das Ergebnis dieser Kämpfe ist schwer vorauszusagen. Aber selbst dort, wo sich der Sozialismus kräftigt und wo er siegreich vordringt, wird sein Charakter auf viele Jahre hinaus getrübt werden, durch Terror, Kampf, sowie durch einen unvermeidlichen barbarischen Patriotismus. Dieser Sozialismus steht dem unseren äußerst fern.
Unsere Pflicht wäre demnach, falls wir an dem ersten Plan festhalten, ausschließlich für den beschleunigten Sieg des Sozialismus zu wirken. Welche Mittel stehen uns hierfür zur Verfügung? Wir vermögen den Erdenmenschen unsere Technik zu geben, unsere Wissenschaft, unser Wissen um die Beherrschung der Natur, sowie unsere Kultur, die mit den wirtschaftlichen und politischen Formen der Erde im schroffsten Widerspruch steht. Wir können auch das sozialistische Proletariat bei seinem revolutionären Umsturz unterstützen und ihm helfen, den Widerstand der übrigen Klassen zu brechen. Ueber andere Mittel verfügen wir nicht. Werden aber diese beiden zum Ziel führen? Wir wissen heute bereits genug von der Erde, um diese Frage mit einem endgültigen Nein beantworten zu können.
Was würden die Erdenmenschen mit unserem technischen Wissen und unseren Methoden anfangen?
Vor allem würden sich deren die besitzenden Klassen aller Länder bemächtigen. Dies wäre unvermeidlich, weil sich ja in ihren Händen alle Produktionsmittel befinden und weil ihnen neunzig- bis hunderttausend Gelehrte und Ingenieure zu Diensten stehen; das aber bedeutete, daß ihnen alle Möglichkeiten der neuen Industrie gehörten. Sie jedoch würden diese nur insofern ausnützen, als es für sie vorteilhaft wäre und ihre Macht über die Massen stärkt. Noch eines: jene gewaltigen neuen Zerstörungsmittel, die ihnen auf diese Art in die Hände fielen, würden sie zur Erdrosselung des sozialistischen Proletariats verwenden. Sie würden es verfolgen, würden eine Provokation in grandiosem Maßstab organisieren, um das Proletariat so rasch wie möglich zum offenen Kampf zu zwingen und in diesem Ringen dessen beste und klügste Kräfte zu morden, falls es diesem nicht gelänge, seinerseits bessere Kampfmethoden zu finden. Derart würde unsere Einmischung in die Angelegenheiten der Erde bloß der Reaktion von oben einen Antrieb geben und ihr zu gleicher Zeit Waffen von ungeheurer Gewalt in die Hände spielen. Das aber würde zumindest auf zehn Jahre den Fortschritt des Sozialismus hemmen.
Und was würden wir erreichen, wenn wir das sozialistische Proletariat gegen seine Feinde unterstützten?
Angenommen, und dies ist keineswegs gewiß, daß es sich mit uns verbündet. Die ersten Siege würden leicht errungen werden. Aber dann? Die unvermeidliche Entwicklung des Patriotismus bei den anderen Klassen würde sich gegen uns und gegen die Sozialisten der Erde wenden ... Das Proletariat aber stellt noch in den meisten Ländern der Erde die Minderheit dar, die Mehrheit hingegen besteht aus den in ihrer Entwicklung zurückgebliebenen Kleinbürgern, aus dunklen, unwissenden Menschen. Diese gegen das Proletariat zu verhetzen, wird den Großkapitalisten und deren Söldlingen, den Beamten und Lehrern, nur allzu leicht fallen. Umsomehr, als diese Massen, die dem Wesen nach konservativ, häufig sogar reaktionär sind, eine krankhafte Angst vor dem raschen Fortschritt empfinden. Das Proletariat sieht sich also auf allen Seiten von erbosten, erbarmungslosen Feinden umgeben, die größere Entwicklung des Proletariats verstärkt nur noch diese Feindseligkeit, es befindet sich in der gleichen furchtbaren Lage, in der sich unsere Kolonisten zwischen den Völkern der Erde befinden würden. Es wird zu zahllosen verräterischen Ueberfällen kommen, die Stellung des Proletariats in der Gesellschaft wird um so schwieriger sein, als es die Erneuerung der Gesellschaft durchführen muß. Und auch in diesem Falle wird unsere Einmischung die soziale Umwälzung verzögern, statt sie zu beschleunigen.
Die Zeit der Umwälzung ist demnach nicht zu bestimmen, und es hängt nicht von uns ab, sie früher herbeizuführen. Jedenfalls können wir nicht so lange warten. Im Verlauf von dreißig Jahren zeigt sich bei uns eine Vermehrung der Einwohner um fünfzehn bis zwanzig Millionen, die sich in jedem folgenden Jahr auf zwanzig bis fünfundzwanzig Millionen steigern wird. Es gilt daher, schon früher die Kolonisation zu organisieren, denn sonst werden uns die Kräfte und Mittel hierzu mangeln und wir werden unser Unternehmen nicht im richtigen Maßstab durchführen können.
Uebrigens ist es auch äußerst ungewiß, ob wir uns mit den sozialistischen Staaten der Erde, falls sich solche unerwartet bilden sollten, zu verständigen vermögen. Wie bereits gesagt: ihr Sozialismus ist noch lange nicht unser Sozialismus.
Die Jahrhunderte nationaler Unterdrückung, verstärkt durch die für uns unbegreiflich rohen und blutigen Kriege, können nicht spurlos vorübergehen, – sie werden ihre psychologischen Spuren bei den Erdbewohnern auf lange Zeit hinterlassen. Und wir wissen gar nicht, wie viel Barbarei und Wildheit die Erdensozialisten mit sich in die neue Gesellschaft hinübernehmen werden.
Wir haben vor Augen ein Beispiel, das uns klar ersichtlich beweist, wie fern selbst die Psychologie des besten Vertreters der Erdenmenschheit der unseren steht. Von unserer letzten Expedition brachten wir einen Erdensozialisten mit, einen Mann, der sich in seiner Umgebung durch Geisteskraft und körperliche Gesundheit auszeichnete. Und was ereignete sich? Unser ganzes Leben erschien ihm dermaßen fremd, stand so sehr im Widerspruch zu seinem Organismus, daß er in kürzester Zeit von einer schweren psychischen Krankheit befallen wurde.
Dies ereignete sich bei einem der Besten, den Menni selbst ausgewählt hatte; was können wir da von den übrigen erwarten?
Derart geraten wir in ein Dilemma: entweder wir müssen auf unserem Planeten die Vermehrung beschränken, was mit einer Schwächung unserer ganzen Lebensentwicklung gleichbedeutend wäre, oder aber wir müssen die Erde kolonisieren, was die Ausrottung der ganzen Erdenmenschheit bedingt.
Ich rede von der Ausrottung der ganzen Erdenmenschheit, weil wir auch bei deren sozialistischen Avantgarde keine Ausnahmen gelten lassen dürfen. Wir verfügen ja auch nicht über die technische Möglichkeit, diese Avantgarde aus der übrigen Masse auszuscheiden, deren unbedeutenden Teil sie darstellt. Aber selbst wenn es uns gelänge, die Sozialisten zu schonen, so würden diese gegen uns einen unerbittlich grausamen Krieg beginnen, sich selbst zur völligen Vernichtung aufopfern, weil sie sich niemals mit dem Töten von hundert Millionen Menschen abfinden könnten, die ihnen gleichen, und die mit ihnen durch viele, häufig äußerst enge lebendige Bande verknüpft waren. Beim Zusammenprall der beiden Welten gibt es kein Kompromiß.
Wir müssen die Wahl treffen. Und ich sage: wir haben bloß eine Wahl.
Das höhere Leben darf nicht dem niedern geopfert werden. Unter den Erdenmenschen gibt es kaum etliche Millionen, die bewußte Stufen zu dem wahrhaft menschlichen Leben sind. Um dieser Zellenwesen willen dürfen wir nicht auf die Geburt von zehn, ja vielleicht von hundert Millionen Wesen unserer Welt verzichten, Wesen, die in unvergleichlich höherem Sinn des Wortes Menschen sind. Unser Vorgehen wird keineswegs grausam sein, denn wir vermögen die Ausrottung der Erdenmenschen auf eine weit weniger schmerzliche Art zu bewerkstelligen, als sie dies untereinander zu tun gewohnt sind.
Das Weltenleben ist einheitlich. Es bedeutet daher keinen Verlust, wenn sich auf der Erde anstelle des noch fernen, halb barbarischen Sozialismus schon heute unser Sozialismus verwirklicht, das unvergleichlich harmonischere Leben mit seiner ununterbrochenen, unbesieglichen Entwicklung.“
(Sternis Rede folgte tiefe Stille. Schließlich wurde sie von Menni durchbrochen, der Anhänger einer anderen Ansicht aufforderte, sich zu äußern. Netti ergriff das Wort.)
„Das Weltenleben ist einheitlich, sprach Sterni. Und was schlug er uns vor?
Einen einzigartigen Typus dieses Lebens auf ewig zu vernichten, auszurotten, einen Typus, den wir niemals wiederbeleben, noch ersetzen können.
Hundert Millionen Jahre lebte der schöne Planet, lebte sein besonderes eigenes Leben, war anders als die übrigen ... Aus den mächtigen Elementen ging das Bewußtsein hervor, erhob sich im grausamen und harten Kampf von den niedersten Stufen zu den höchsten, bis zu der uns nahen, verwandten menschlichen Form. Diese Form ist nicht die gleiche wie die unsere, wurde beeinflußt von der Geschichte einer anderen Natur, eines anderen Kampfes; sie birgt in sich andere Gewalten, andere Widersprüche, andere Entwicklungsmöglichkeiten. Nun brach die Epoche an, da sich die Möglichkeit einer Vereinigung der beiden großen Lebenslinien ergibt. Welche Mannigfaltigkeit, welche erhabene Harmonie könnte sich aus dieser Vereinigung entfalten! Und nun wird uns gesagt: das Weltenleben ist einheitlich, deshalb sollen wir es nicht vereinigen – sondern zerstören.
Als Sterni bewies, wie sehr sich die Erdenmenschen, deren Geschichte und Sitten, sowie deren Psychologie von der unseren unterscheiden, widerlegte er selbst seine Ideen weit mehr, als ich dies zu tun vermag. Glichen die Erdenmenschen uns in allem, ausgenommen in ihrer Entwicklungsstufe, wären sie das, was unsere Vorfahren zur Zeit unseres Kapitalismus gewesen sind, dann könnte ich Sterni zustimmen: die niederen Stufen müssen den höheren, die Schwachen den Starken geopfert werden. Aber die Erdenmenschen sind etwas anderes; sie sind nicht nur von niedrigerer Kultur und schwächer als wir, sie sind auch anders als wir. Wollten wir sie beseitigen, so würden wir sie nicht in der Entwicklung der Welt ersetzen, sondern bloß auf mechanische Art jene Leere ausfüllen, die wir in der herrschenden Form des Lebens verursacht hätten.
Der grundlegende Unterschied zwischen den Erdenmenschen und uns liegt nicht in der grausamen und barbarischen Kultur der Erde. Barbarei und Grausamkeit sind nur vorübergehende Erscheinungen jener allgemeinen Verschwendung im Entwicklungsprozeß, durch die sich das ganze Erdenleben kennzeichnet. Dort erscheint der Kampf ums Dasein energischer und mühevoller, das Ringen mit der Natur nimmt vielartigere Formen an und die Entwicklung fordert weit mehr Opfer. Und dies kann auch gar nicht anders sein; denn die Erde erhält vom Quell alles Lebens, der Sonne, achtmal mehr Lichtenergien als unser Planet. Deshalb entwickeln und verbreiten sich dort so viele Leben, eine so große Verschiedenheit der Formen, aus denen sich gewaltige Widersprüche ergeben, so viele schmerzliche Hemmungen, deren Schlichtung gar oft scheitert. Im Pflanzen- und Tierreich herrschte erbitterter Kampf, das Leben und der Tod dieser Arten aber ergaben neue, vollendetere und harmonischere, synthetischere Typen. Dies ist auch im Reich der Menschen der Fall.
Wenn wir unsere Geschichte mit jener der Erdenmenschen vergleichen, so erscheint erstere erstaunlich einfach, frei von Irrtümern, und fast schematisch richtig. Der ruhige, friedliche Uebergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, das Verschwinden der Kleinbürger, das stufenweise sich entwickelnde Proletariat, all dies geschah ohne Schwanken und Zusammenstöße auf dem ganzen Planeten, der zu einer politischen Einheit verbunden war. Freilich wurde gekämpft, doch verstand ein Mensch den anderen, das Proletariat blickte nicht allzuweit voraus, die Bourgeoisie war in ihrer Reaktion nicht utopisch, die verschiedenen Epochen und gesellschaftlichen Formen vermischten sich nicht derart stark wie auf der Erde, wo in einem hoch kapitalistischen Land bisweilen das Einsetzen einer feudalen Reaktion möglich ist, und wo eine zahlreiche Bauernschaft, die sich kulturell in einer ganz anderen historischen Periode befindet, häufig den oberen Klassen als Werkzeug zur Abwürgung des Proletariats dient. Wir gingen einen ebenen, glatten Weg, erreichten vor einigen Generationen jenen Aufbau, der alle Kräfte der sozialistischen Entwicklung entbindet und vereinigt.
Unsere Erdenbrüder hingegen mußten einen anderen Weg gehen, einen dornenvollen Weg voller Krümmungen und Klüfte. Wenigen von uns ist bekannt, und keiner von uns vermag sich klar vorzustellen, bis zu welcher Stufe die Kunst des Menschenschindens selbst bei den kultiviertesten Völkern der Erde gediehen war, keiner von uns kennt genau die politisch organisierte Herrschaft der oberen Klassen, ausgedrückt in Kirche und Staat. Und was ist das Ergebnis? Eine Verlangsamung der Entwicklung? Nein, wir haben keinen Grund, dies zu behaupten, denn von den ersten Stadien des Kapitalismus entwickelte sich im Wirrsal und in den grausamen Kämpfen der verschiedensten Arten das proletarische Bewußtsein nicht langsamer, sondern schneller als bei uns, – wo die Wandlung stufenweise und ruhiger vor sich ging. Die Härte und Erbarmungslosigkeit des Kampfes aber erzeugte in den Kämpfern eine derartige Fülle an Energie und Leidenschaft, einen solchen Heldenmut und eine so gewaltige Leidenskraft, wie sie der aussichtsreichere und weit weniger tragische Kampf unserer Vorfahren gar nicht kennt. Bei diesem Typus des Erdenlebens sind die Menschen nicht niedriger, sondern höher als wir, wenngleich wir, deren Kultur älter ist, auf einer viel höheren Stufe stehen.
Die Erdenmenschen sind gespalten, die verschiedenen Rassen und Nationen eng verwachsen mit ihren Ländern und historischen Traditionen, sie reden verschiedene Sprachen, und ein gegenseitiges tiefgreifendes Nichtverstehen kennzeichnet alle ihre Verhältnisse ... All das trifft zu und es ist auch wahr, daß die allgemeinmenschliche Vereinigung, die sich mit großer Anstrengung einen Weg über alle Grenzen bahnt, bei unseren Erdenbrüdern weit später verwirklicht werden wird, als dies bei uns der Fall war. Betrachten Sie aber die Ursache und werten Sie deren Folgen. Die Spaltung wurde verursacht durch die Größe der Erdenwelt, den Reichtum und die Mannigfaltigkeit ihrer Natur. Das führte zu den verschiedensten Auffassungen über das Weltall. Ist aber all dies etwa der Beweis, daß die Erdenmenschheit niederer und nicht höher steht als unsere Welt in den analogen Epochen der Geschichte?
Schon die rein mechanische Verschiedenheit der Sprachen, in denen die Menschen reden, unterstützte die Entwicklung des Denkens, befreite den Begriff von der plumpen Herrschaft des Wortes. Vergleichen Sie die Philosophie der Erdenmenschen mit jener unserer kapitalistischen Ahnen. Die Philosophie der Erde ist nicht nur weit vielseitiger, sondern auch weit feiner, sie geht nicht nur von einem bei weitem komplizierteren Material aus, sondern ihre Analyse ist, in den besten Schulen, eine viel tiefgründigere, die weit richtiger die Verbindung der Tatsachen und Begriffe darstellt. Selbstverständlich ist jede Philosophie der Ausdruck der Schwäche und der fehlerhaften Erkenntnis, hervorgerufen durch mangelhafte wissenschaftliche Entwicklung; der Versuch, ein einheitliches Bild des Seins zu geben, ist ein unbeschriebenes Blatt der wissenschaftlichen Erfahrung, deshalb wird auch von der Erde die Philosophie verschwinden, wie dies bei uns mit dem wissenschaftlichen Monismus geschah. Betrachten Sie aber, wie viele philosophische Voraussetzungen, gegeben von den ersten Denkern und Kämpfern bereits in groben Umrissen die Entdeckungen unserer Wissenschaft voraussehen – so zum Beispiel fast alle sozialwissenschaftlichen Philosophien. Es ist klar, daß eine Rasse, die unsere Ahnen in der Schaffung einer Philosophie übertraf, auch imstande sein wird, diese in der Schaffung einer Wissenschaft zu übertreffen.
Und Sterni will diese Menschen aus der Liste der Gerechten streichen mitsamt den bewußten Sozialisten, die sich unter ihnen befinden; er will sie nach ihren niedersten Widersprüchen beurteilen, nicht aber nach jenen Kräften, die zur gegebenen Zeit diese Widersprüche ausgleichen werden. Er will auf ewig diesen stürmischen, aber schönen Ozean des Lebens austrocknen.
Fest und entschlossen müssen wir ihm die Antwort geben: niemals!
Wir müssen unseren künftigen Bund mit der Erdenmenschheit vorbereiten. Freilich können wir den Uebergang zu einer freien Welt nur wenig beschleunigen, aber auch das Wenige, was wir zu leisten vermögen, sind wir zu tun verpflichtet. Und wenn es uns nicht gelang, den ersten Abgesandten der Erde vor unnötigen Leiden und Krankheiten zu bewahren, – so gereicht dies keineswegs zu unserer Ehre. Zum Glück wird er bald hergestellt sein, und selbst wenn ihn der allzu rasche Uebergang in ein ihm fremdes Leben tötete, so hat er immerhin viel für den künftigen Bund der beiden Welten geleistet.
Unsere eigenen Schwierigkeiten und Gefahren müssen wir auf eine andere Art besiegen. Neue wissenschaftliche Kräfte müssen sich mit der chemischen Herstellung der Eiweißstoffe befassen und wir müssen, soweit dies möglich ist, die Kolonisation der Venus vorbereiten. Gelingt es uns nicht, diese Aufgabe in kürzester Zeit zu erfüllen, so müssen wir vorübergehend die Vermehrung einschränken. Welcher vernünftige Geburtshelfer opferte nicht das Leben des ungeborenen Kindes, um die Frau zu retten? Auch wir müssen, wenn dies unvermeidlich wird, einen Teil jenes Lebens opfern, das noch nicht ist, um das, wenn auch fremde Leben zu retten, das schon besteht und sich entwickelt. Die Verbindung der Welten wird dieses Opfer reichlich lohnen.
Die Einheitlichkeit des Lebens ist das höchste Ziel, und Liebe ist die höchste Weisheit!“
(Tiefes Schweigen. Dann ergriff Menni das Wort.)
„Ich beobachtete aufmerksam die Stimmung der Genossen und sehe nun, daß die Mehrheit auf seiten Nettis ist. Das freut mich sehr, denn auch meine Ansicht deckt sich ungefähr mit der ihren. Ich möchte nur noch eine praktische Erläuterung hinzufügen, die mir äußerst wichtig erscheint. Es besteht für den Fall, daß wir uns zu einer Massenkolonisation auf einem anderen Planeten entschließen, die ernste Gefahr, daß unsere technischen Mittel in kürzester Zeit nicht mehr ausreichen werden.
Wir vermögen zehntausend große Aetheroneffs herzustellen, und es kann geschehen, daß es uns an den zur Fortbewegung nötigen Stoffen mangelt. Jene radiumausstrahlende Materie, vermittels derer sich die Aetheroneffs für gewöhnlich bewegen, müßte um das Hundertfache vermehrt werden. Inzwischen aber versiegen die alten Lager, und neue werden immer seltener entdeckt.
Sie müssen auch wissen, daß wir der radiumausstrahlenden Materie nicht nur dazu bedürfen, um dem Aetheroneff seine ungeheure Geschwindigkeit zu verleihen. Sie wissen ja, daß unsere ganze technische Chemie auf diesen Stoffen beruht. Wir bedürfen ihrer auch zur Erzeugung der Minus-Materie, ohne die sich unsere Aetheroneffs und unsere zahllosen Luftschiffe in nutzlose schwerfällige Kisten verwandeln würden. Diesem unentbehrlichen Gebrauch dürfen wir die Materie nicht entziehen.
Noch ärger ist, daß die einzige Möglichkeit, die Kolonisation zu ersetzen, die Synthese des Eiweiß, aus dem gleichen Mangel an radiumausstrahlenden Stoffen zur Unmöglichkeit wird. Eine technisch leichte und entsprechende fabrikmäßige Herstellung der ungeheuer komplizierten Synthese des Eiweiß ist undenkbar bei der alten Methode der Synthese, einer äußerst komplizierten Methode. Sie wissen, daß es uns bereits vor etlichen Jahren gelang, auf diesem Wege ein vorzügliches Eiweiß herzustellen, aber nur in geringer Quantität und bei einem großen Verlust an Energie und Zeit, so daß die ganze Arbeit ausschließlich eine theoretische Bedeutung besaß. Die Massenproduktion des Eiweiß aus unorganischen Stoffen ist nur möglich vermittels der raschen und scharfen Umwandlung des chemischen Bestandes, der bei uns von einem nicht stabilen Element zu einer stabilen Materie wird. Die erfolgreiche Durchführung dieses Prozesses erfordert von zehntausend Arbeitern eine Spezialforschung über die Gewinnung des Eiweiß, sowie Millionen von neuen Experimenten. Demnach würde selbst im Fall eines Erfolges eine ungeheure Vergeudung der Kollektivaktivität unvermeidlich sein, eine Vergeudung, der wir nicht gewachsen sind.
Von diesem Gesichtspunkt aus gilt es, schleunigst die einzige für uns wichtige Frage zu beantworten: vermögen wir neue Quellen der radiumausstrahlenden Stoffe zu entdecken? Und wo sollen wir diese suchen? Offensichtlich auf einem anderen Planeten, das heißt: entweder auf der Erde oder auf der Venus. Meiner Ansicht nach muß der erste Versuch unbedingt auf der Venus gemacht werden.
Was die Erde anbelangt, so können wir annehmen, daß sich auf ihr reichliche Vorräte an radioaktiven Elementen befinden. Bei der Venus hingegen ist diese Tatsache bereits festgestellt. Wo sich auf der Erde diese Quellen befinden, ist uns unbekannt, denn jene, die von den Erdengelehrten gefunden wurden, taugen nichts. Auf der Venus aber entdeckte unsere Expedition sofort die bewußten Quellen. Außerdem befinden sich diese ganz nahe der Erdoberfläche, sind leicht erreichbar, so daß wir ihr Bestehen vermittels der Photographie feststellen konnten, während sich jene der Erde, gleich den unseren, tief unter dem Erdboden befinden. Wollten wir auf der Erde das Radium suchen, so müßten wir bis in die Tiefen dringen, wie das auch auf unserem Planeten der Fall ist. Dies aber bedeutete einen Verlust von vielleicht zehn Jahren, und es bestünde auch noch die Gefahr, daß wir uns in der Wahl des Ortes geirrt haben. Auf der Venus hingegen gilt es bloß, die bereits gefundenen Lager auszubeuten, und dies kann ohne jegliche Verzögerung geschehen.
Deshalb halte ich es für unbedingt notwendig, unabhängig davon, wie wir die Frage der Massenkolonisation lösen, sofort an eine teilweise, vielleicht auch nur vorübergehende Kolonisation der Venus zu schreiten, zu dem ausschließlichen Zweck, die dort befindliche radioaktive Materie zu gewinnen.
Die uns von der Natur entgegengestellten Hindernisse sind freilich ungeheuer groß, doch brauchen wir sie ja augenblicklich nicht völlig zu überwinden. Es gilt nur, von einem kleinen Teil des Planeten Besitz zu ergreifen. Wir müssen demnach eine große Expedition ausrüsten, die nicht, wie die erste, Monate auf der Venus verbringt, sondern Jahre, und deren Zweck es ist, das Radium zu gewinnen. Selbstverständlich muß zur gleichen Zeit ein energischer Kampf wider die Natur geführt werden, das Klima, wider die uns noch unbekannten Krankheiten, sowie gegen andere Gefahren. Es wird viele Opfer geben, vielleicht wird auch nur ein geringer Teil der Expedition heimkehren. Der Versuch jedoch muß gemacht werden.
Als erstes Feld unserer Tätigkeit kommt die „Insel des glühenden Sturmes“ in Betracht. Ich habe deren Natur genau studiert und einen detaillierten Plan unserer Tätigkeit ausgearbeitet. Wenn Sie, Genossen, jetzt bereit sind, diesen zu beurteilen, so werde ich ihn sofort vorlegen.“
(Niemand erhob Einwände, und Menni ging an die Erläuterung seines Planes, der sich mit allen technischen Einzelheiten befaßte. Nach Beendigung seiner Rede traten noch andere Redner auf, doch nahmen sie alle Mennis Vorschlag an, besprachen nur die Details. Etliche zweifelten an dem Erfolg der Expedition, alle aber waren damit einverstanden, daß sie unternommen werde. Schließlich wurde die von Menni vorgeschlagene Resolution angenommen.)
Die gewaltige Bestürzung, die mich übermannt hatte, verhinderte selbst den Versuch, meine Gedanken zu sammeln. Ich fühlte bloß, daß ein kalter Schmerz wie mit eisernen Fingern mein Herz zusammenpresse. Vor meinem Bewußtsein erhoben sich mit halluzinierender Lebendigkeit Sternis riesenhafte Gestalt, sein unerbittlich gelassenes Gesicht. Alles übrige versank in schwerem, nächtlichem Chaos.
Wie ein Automat verließ ich die Bibliothek und bestieg mein Luftschiff. Der durch den raschen Flug erzeugte kalte Wind hüllte mich wie ein Mantel ein und erweckte in mir auf irgendeine Art einen neuen Gedanken, einen Gedanken, der gleichsam in meinem Bewußtsein erstarrte und in mir die Gewißheit hervorrief: eines müsse geschehen. Heimgekehrt, ging ich daran, den Gedanken zu verwirklichen; all dies geschah schier mechanisch, als handelte nicht ich, sondern ein anderer.
Ich schrieb dem Leiter des Fabrikrates, daß ich auf einige Zeit meine Arbeit aufgebe. Enno sagte ich, wir müßten uns vorläufig trennen. Sie blickte mich beunruhigt, forschend an, erblaßte, sprach jedoch kein Wort. Bloß im Augenblick des Abschieds fragte sie, ob ich nicht Nella sehen möchte. Ich verneinte und küßte Enno zum letzten Mal.
Dann versank ich in ein dumpfes, tödliches Grübeln. Kalter Gram ließ mich erschaudern, zerriß meine Gedanken. Von Nettis und Mennis Reden war mir bloß eine blasse, gleichgültige Erinnerung geblieben, als wären sie etwas Unwichtiges, Uninteressantes. Nur ein einziges Mal durchzuckte mein Gehirn die Erkenntnis: also deshalb verließ mich Netti, von dieser Expedition hängt alles ab. Hingegen hatte ich Sternis Worte und sogar ganze Sätze seiner Rede getreu im Gedächtnis behalten: „Das Unvermeidliche muß begriffen werden ... einige Millionen Zellenwesen ... die völlige Ausrottung der Erdenmenschheit ... er wurde von einer schweren psychischen Krankheit befallen ...“ Doch vermochte ich weder Zusammenhänge, noch einen Ausweg zu finden. Bisweilen erschien mir die Ausrottung der Erdenmenschheit als eine bereits vollzogene Tatsache, aber auf unklare, abstrakte Art. Mein Schmerz wurde größer, und in mir erwachte der Gedanke, daß an dieser Ausrottung ich die Schuld trage. Dann wieder sah ich ein, daß ja noch nichts geschehen war, vielleicht niemals etwas derartiges geschehen würde. Aber selbst das vermochte nicht meinen Kummer zu lindern. Ich konstatierte bei mir: „Alle werden sterben ... auch Anna Nikolajewna ... und der Arbeiter Vania ... und Netti, nein, Netti bleibt am Leben, sie ist ein Marsmensch ... sonst aber werden alle sterben ... doch ist dies nicht grausam, denn sie werden nicht leiden ... so sagte Sterni ... alle werden sterben, weil ich erkrankte ... das bedeutet, daß ich daran die Schuld trage ...“ Zerrissene schwere Gedanken erstarrten in meinem Bewußtsein, kalt, reglos. Und zugleich mit ihnen schien die Zeit stehen zu bleiben.
Auf mir wuchtete eine schwere, qualvolle, nicht abzuschüttelnde Last. Die Gespenster befanden sich nicht außerhalb meiner selbst; in meiner Seele hockte ein einziges, schwarzes Gespenst, und dieses Gespenst bedeutete für mich alles. Ich sah kein Ende der Qual, war doch die Zeit stehen geblieben.
Der Gedanke an Selbstmord suchte mich heim, drang aber nicht völlig in mein Bewußtsein. Der Selbstmord erschien mir nutzlos und öde, – konnte er denn meinen schwarzen Gram heilen? Ich vermochte nicht an den Selbstmord zu glauben, weil ich den Glauben an mein Sein verloren hatte. Qual, Kälte und Haß existierten, aber mein „Ich“ verlor sich in ihnen, wie etwas Richtiges, unsäglich Kleines. Es gab kein „Ich“.
Es kamen Augenblicke, da meine Stimmung so unerträglich war, daß in mir der wilde Wunsch erwachte, mich auf meine ganze Umgebung zu stürzen, auf Lebendiges und Totes, alles zu zerschlagen, zu zerreißen, zu vernichten, damit davon auch nicht die geringste Spur zurückbleibe. Doch besaß ich noch genügend Verstand, um zu wissen, daß dies sinnlos und kindisch wäre; ich biß die Zähne zusammen und beherrschte mich.
Ohne Unterlaß umkreisten meine Gedanken Sterni; sein Bild haftete starr in meinem Bewußtsein, war der Mittelpunkt aller Qualen und Leiden. Allmählich, äußerst langsam, kristallisierte sich um diesen Mittelpunkt ein Entschluß heraus, der immer klarer und fester ward: „Ich muß Sterni sehen“. Weshalb, aus welchem Grund ich ihn sehen wollte, vermochte ich nicht zu sagen. Ich wußte bloß, daß ich es tun müsse. Zugleich aber fiel es mir qualvoll schwer, die auf mir lastende Starre und Unbeweglichkeit zu durchbrechen, um meinen Entschluß auszuführen.
Ich begab mich in den großen Observatoriumssaal und sprach dort zu einem der Arbeiter: „Ich muß Sterni sehen.“ Der Genosse ging, um Sterni zu rufen, kehrte nach wenigen Augenblicken zurück und erklärte, Sterni sei eben mit der Prüfung eines Instrumentes beschäftigt, er werde in einer Viertelstunde frei sein, und ich möge so lange in seinem Arbeitszimmer warten.
Der Genosse führte mich ins Arbeitszimmer. Ich setzte mich in einen Lehnstuhl vor den Schreibtisch und wartete. Der Raum war voll der verschiedensten Apparate und Maschinen, von denen ich einige kannte, während mir die anderen fremd waren. Meinem Lehnstuhl gegenüber ragte ein Instrument mit einem schweren Metallstativ auf, an dessen Ende sich drei Messer befanden. Auf dem Tisch lag ein offenes Buch über die Erde und deren Bewohner. Ich begann mechanisch darin zu lesen, hielt aber schon nach den ersten Zeilen inne und versank in ein dem früheren ähnliches Grübeln. In meinem Inneren fühlte ich, zusammen mit der alten Qual, eine unbezwingliche, fast krampfartige Erregung. So verging die Zeit.
Auf dem Korridor wurden schwere Schritte vernehmbar, die Tür öffnete sich, und Sterni betrat das Zimmer; auf seinen Zügen lag der gewöhnliche, gelassen beschäftigte Ausdruck. Er setzte sich in den Lehnstuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches und blickte mich fragend an. Ich schwieg. Er wartete noch einen Augenblick, wandte sich dann an mich mit der Frage: „Womit kann ich Ihnen dienen?“
Ich verharrte noch immer stumm, starrte ihn an, als wäre er ein lebloser Gegenstand. Er zuckte kaum merklich die Achseln und lehnte sich abwartend im Lehnstuhl zurück.
„Nettis Mann ...“ sprach ich schließlich halbbewußt, mit Anstrengung, mehr zu mir selbst, als zu ihm.
„Ich war Nettis Mann“, verbesserte er mich gelassen. „Wir haben uns bereits vor langer Zeit getrennt.“
„Die Ausrottung ... wird nicht ... grausam ...“ stammelte ich, langsam fast unbewußt jenen Gedanken Ausdruck verleihend, die mein Gehirn durchwirbelten.
„Also darum handelt es sich“, meinte er ruhig. „Jetzt ist doch davon nicht mehr die Rede. Es wurde, wie Sie ja wissen, ein völlig anderer Beschluß gefaßt.“
„Ein anderer Beschluß ...“, wiederholte ich mechanisch.
„Was meinen damaligen Plan anbelangt“, fuhr Sterni fort, „so muß ich zugeben, daß ich ihn noch nicht gänzlich aufgegeben habe. Doch bin ich von seiner Richtigkeit nicht mehr so fest überzeugt.“
„Nicht mehr so fest ...“ wiederholte ich abermals.
„Ihre Genesung und Ihre Teilnahme an unserer Gemeinschaftsarbeit haben zum Teil meine Argumente widerlegt ...“
„Ausrottung ... zum Teil ...“ murmelte ich, und das ganze von mir empfundene Leid und Weh mochten wohl aus meiner unbewußten Ironie klingen. Sterni erblaßte, schaute mich bekümmert an. Dann trat Schweigen ein.
Jählings preßte die kalte Hand des Schmerzes mit übermächtiger, ungeahnter Kraft mein Herz zusammen. Ich warf mich in den Lehnstuhl zurück, um den in mir aufsteigenden wahnsinnigen Schrei zu unterdrücken. Meine Finger umklammerten krampfhaft etwas Hartes, Kaltes. Ich fühlte in der Hand eine schwere Waffe. Mein Kummer verwandelte sich in sinnlose Verzweiflung. Ich schnellte vom Lehnstuhl empor und führte gegen Sterni einen gewaltigen Schlag.
Eines der drei Messer fiel auf ihn nieder; ohne einen Laut stürzte er zur Seite wie ein lebloser Körper.
Ich rannte auf den Korridor hinaus und sprach zum ersten mir begegnenden Genossen: „Ich habe Sterni getötet.“ Der Genosse erbleichte und eilte ins Arbeitszimmer, doch mußte er sich wohl auf den ersten Blick überzeugt haben, daß es hier keine Rettung mehr gebe, denn er kehrte sofort zu mir zurück. Er führte mich in seine Stube, beauftragte einen anderen Genossen, telephonisch einen Arzt zu berufen und sich dann zu Sterni zu begeben. Wir blieben allein zurück. Anscheinend konnte er sich nicht entschließen, mit mir zu sprechen. Ich selbst brach das Schweigen, indem ich ihn fragte:
„Ist Enno hier?“
„Nein“, entgegnete er, „sie fuhr für einige Tage zu Nella.“
Wir schwiegen abermals, bis sich der Arzt einfand. Er versuchte mich über das Vorgefallene zu befragen, doch erwiderte ich, ich wolle nichts sagen. Dann brachte er mich in die nahegelegene Heilanstalt für Geisteskranke.
Hier stellte man mir ein großes behagliches Zimmer zur Verfügung, und ich wurde lange Zeit nicht belästigt. Etwas Besseres konnte ich mir gar nicht wünschen.
Für mich erschien jetzt die Lage völlig geklärt. Ich hatte Sterni getötet und dadurch alles vereitelt. Die Marsbewohner sahen nun an einem lebendigen Beispiel, was sie von einer Annäherung an die Erdenmenschen erwarten durften. Sie sahen, daß sogar jener, den sie für befähigt gehalten hatten, ihr Leben zu teilen, ihnen nichts anderes zu bringen vermocht hatte, als Gewalt und Tod. Sterni war tot, aber seine Idee feierte ihre Auferstehung. Die letzte Hoffnung entschwand, die Erdenwelt war verdammt. Und an all dem trug ich die Schuld.
Nach dem Mord kreisten diese Gedanken in meinem Gehirn, beherrschten es zusammen mit der Erinnerung an meine Tat. Anfangs eignete der kalten Gewißheit eine Art Beruhigung. Dann aber steigerten sich Qual und Schmerz ins Grenzenlose.
Ich empfand gegen mich selbst die heftigste Abneigung. Fühlte mich als Verräter an der ganzen Menschheit. Einen Augenblick lang empfand ich die unklare leise Hoffnung, die Marsbewohner würden mich töten, doch erkannte ich dann, ich müsse sie allzu sehr ekeln, und daß ihre Verachtung für mich sie daran hindern würde. Freilich verbargen sie ihre Abneigung gegen mich, dennoch bemerkte ich sie trotz all ihrer Bemühungen genau.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit auf diese Art verstrich. Endlich betrat der Arzt das Zimmer und teilte mir mit, ich solle mich auf die Rückkehr nach der Erde vorbereiten. Ich glaubte, dies bedeute ein verschleiertes Todesurteil, doch empfand ich keinen Wunsch, mich dagegen zu wehren. Bat nur, mein Leichnam möge von allen Planeten so weit wie möglich geworfen werden, damit ich diese nicht verunreinige.
Die Eindrücke der Rückreise sind äußerst unklar und verschwommen. In meiner Umgebung sah ich keine bekannten Gesichter, sprach auch mit niemandem. Mein Bewußtsein war zwar nicht getrübt, doch bemerkte ich nichts von meiner Umgebung. Mir war alles einerlei.
Ich weiß nicht, wie es kam, daß ich mich plötzlich im Krankenhaus des Doktor Werner, meines alten Genossen, befand. Es war das Kreiskrankenhaus eines der nördlichen Gouvernements, das mir schon lange aus Werners Briefen bekannt war. Das Gebäude befand sich einige Werst von der Gouvernementsstadt entfernt, war äußerst schlecht geleitet, stets überfüllt, hatte zum wirtschaftlichen Verwalter einen großen Betrüger und verfügte über ein zahlenmäßig geringes, stark überarbeitetes Personal. Doktor Werner sah sich gezwungen, zusammen mit der äußerst liberalen Kreisverwaltung einen erbitterten Kampf gegen den wirtschaftlichen Verwalter zu führen, gegen die von diesem äußerst schlecht geleiteten Baracken, gegen den Bau der Kirche, den der Verwalter um jeden Preis beendigen wollte, sowie um die angemessene Entlohnung der Angestellten usw. Die Kranken starben aus Schwäche statt zu gesunden, wurden infolge der schlechten Luft und ungenügenden Nahrung von der Tuberkulose befallen. Werner selbst hätte natürlich schon längst das Krankenhaus verlassen, würden ihn nicht ganz besondere, mit seiner revolutionären Vergangenheit zusammenhängende Umstände dort festgehalten haben.
Mich ließen alle diese Reize des Krankenhauses kalt. Werner war ein ausgezeichneter Genosse und zögerte nicht, mir seine Bequemlichkeit zu opfern. Er überließ mir in der großen Wohnung, auf die er als erster Arzt ein Anrecht besaß, zwei Stuben; in der anstoßenden dritten wohnte ein junger Feldscher, in der vierten, die dem Schein nach der Krankenpflege diente, verbarg sich ein verfolgter Genosse. Freilich umgab mich keine besondere Behaglichkeit, und die Aufsicht, der ich unterworfen war, dünkte mich trotz dem großen Taktgefühl des jungen Genossen weit stärker ausgeprägt und fühlbarer, als auf dem Mars. Doch war mir all dies völlig gleichgültig. Doktor Werner verabreichte mir ebenso wie die Aerzte auf dem Mars fast keine Medizin, gab mir nur bisweilen ein Schlafmittel ein und sorgte vor allem dafür, daß ich Ruhe habe und mich wohl fühle. Allmorgendlich und allabendlich suchte er mich nach dem Bad auf, das mir der fürsorgliche Genosse zu bereiten pflegte. Doch dauerte sein Besuch stets nur wenige Minuten, und er beschränkte sich auf die Frage, ob ich nichts brauche. In den langen Monaten meiner Krankheit hatte ich mir das Sprechen fast abgewöhnt und begnügte mich damit, nein zu sagen, oder aber überhaupt keine Antwort zu geben. Seine Fürsorge jedoch störte mich, denn ich fühlte, daß ich eine derartige Behandlung gar nicht verdiene und daß ich ihm dies eigentlich mitteilen müßte. Schließlich gelang es mir auch mit Anstrengung aller Kräfte, ihm zu bekennen, daß ich ein Mörder und Verräter sei und daß durch meine Schuld die ganze Menschheit zugrunde gehen müsse. Er widersprach nicht, lächelte bloß und kam von da an häufiger.
Allmählich übte die Umgebung auf mich eine heilsame Wirkung aus. Der Schmerz krampfte mir weit weniger stark das Herz zusammen, die Qual verblaßte, die Gedanken wurden beweglicher, ihre Färbung wurde heller. Ich begann das Zimmer zu verlassen, im Garten und im Hain zu spazieren. Irgendeiner der Genossen hielt sich immer in meiner Nähe auf; das war peinlich, doch begriff ich sehr wohl, daß man einen Mörder nicht frei umhergehen lassen könne. Bisweilen sprach ich auch mit den Genossen, freilich nur über gleichgültige Dinge.
Es war zu Beginn des Frühlings, und die Wiedergeburt des Lebens ringsum schwächte ein wenig das Qualvolle meiner Erinnerungen ab; das Zwitschern der Vögel rief in mir eine gewisse traurige Beruhigung wach, erweckte den Gedanken, daß wenigstens sie nicht vergehen würden, sondern weiter leben, und daß nur die Menschen verloren seien. Einmal begegnete mir im Hain ein Schwachsinniger, der sich unter Aufsicht aufs Feld zur Arbeit begab. Er empfahl sich von mir mit außerordentlich stolzer Gebärde – er litt an Größenwahn, erklärte, er sei ein Gendarm, anscheinend die höchste Macht, die er während seines Lebens in der Freiheit gekannt hatte. Zum ersten Mal in meiner ganzen Krankheit mußte ich unwillkürlich lachen. Ich fühlte, daß mich das Vaterland umgebe, und gleich dem Riesen Antheus schöpfte ich, wenngleich äußerst langsam, neue Kraft aus der Heimaterde.
Als sich die Gedanken mehr meiner Umgebung zuwandten, verlangte es mich zu wissen, ob Werner und den beiden anderen Genossen bekannt sei, was sich mit mir ereignet und was ich getan hatte. Ich fragte Werner, wer mich ins Krankenhaus gebracht habe? Er erwiderte, ich sei mit zwei ihm unbekannten jungen Leuten gekommen, die nichts Genaues über meine Krankheit zu berichten wußten. Sie erklärten, mir in der Hauptstadt begegnet zu sein. Sie bemerkten, daß ich krank sei, hatten mich bereits vor der Revolution gekannt und damals durch mich von Doktor Werner gehört. Deshalb wandten sie sich nun an ihn. Sie reisten noch am gleichen Tag ab. Bei Werner hatten sie den Eindruck anständiger junger Menschen erweckt, an deren Worten nicht zu zweifeln war. Er selbst hatte mich bereits seit etlichen Jahren aus dem Auge verloren und es war ihm nicht gelungen, über mich Nachricht zu erhalten.
Ich wollte Werner über den von mir begangenen Mord berichten, doch fiel mir dies furchtbar schwer. War doch die ganze Geschichte unsäglich kompliziert, mit unzähligen Umständen verknüpft, die sie einem leidenschaftslos beurteilenden Menschen äußerst seltsam erscheinen lassen mußte. Ich erklärte Werner die Schwierigkeit und erhielt von ihm die unerwartete Antwort:
„Das beste wäre es, Sie würden mir jetzt überhaupt nichts erzählen. Derartiges ist Ihrer Genesung nicht förderlich. Ich will natürlich nicht mit Ihnen streiten, doch vermag ich an Ihre ganze Geschichte nicht zu glauben. Sie sind an Melancholie erkrankt, und diese Krankheit veranlaßt die ehrbarsten anständigsten Menschen, sich allerlei nie begangener Verbrechen zu zeihen. Das Gedächtnis unterstützt die Phantasie und erzeugt trügerische, unwahre Erinnerungen. Sie werden mir dies erst dann glauben, wenn Sie wieder hergestellt sind, deshalb ist es auch besser, die Erzählung bis zu jenem Zeitpunkt hinauszuschieben.“
Hätte dieses Gespräch einige Monate früher stattgefunden, so hätte ich zweifellos aus Werners Worten ein großes Mißtrauen und die Verachtung meiner Person herausgelesen. Jetzt jedoch, da meine Seele bereits nach Rast und Erholung suchte, faßte ich die ganze Sache anders auf. Es war mir angenehm, daß mein Verbrechen den Genossen nicht bekannt sei und daß die Tatsache angezweifelt werden könne. Ich begann von nun an immer seltener an meine Tat zu denken.
Meine Genesung machte rasche Fortschritte, nur bisweilen übermannte mich wieder die frühere Qual, doch dauerten diese Anfälle niemals lange. Werner war offensichtlich mit mir zufrieden, ich wurde auch nicht mehr so scharf beobachtet. Seiner Ansicht über meine „Phantasien“ gedenkend, bat ich ihn, mir einen typischen Fall meiner Krankheit zum Lesen zu geben, den er im Krankenhaus beobachtet und niedergeschrieben hatte. Zögernd und ungern erfüllte er meine Bitte. Er wählte aus den verschiedensten Krankheitsgeschichten eine und gab sie mir.
In dieser Krankheitsgeschichte wurde der Fall eines Bauern erzählt, den die Not aus einem entlegenen Dörfchen in eine der größten Fabriken der Hauptstadt trieb. Das Leben der großen Stadt erschütterte offensichtlich sein seelisches Gleichgewicht; den Worten seiner Frau zufolge war er lange Zeit „völlig außer sich“. Dann verging dies, er lebte und arbeitete wie alle übrigen. Als in der Fabrik ein Streik ausbrach, stand er auf Seiten der Genossen. Der Streik war lange und hartnäckig, der Bauer mußte mit Frau und Kindern Hunger leiden. Plötzlich begann er sich zu grämen, machte sich Vorwürfe, weil er geheiratet und ein Kind gezeugt habe und überhaupt „gottlos“ lebe.
Dann begann er irre zu reden, wurde zuerst ins städtische Spital und von dort in das Krankenhaus seines Heimatkreises gebracht. Er behauptete steif und fest, daß er den Streik gebrochen und die Genossen verkauft habe, sowie jenen „guten Ingenieur“, der im Geheimen den Streik unterstützte, und der von der Regierung aufgehängt wurde. Zufällig kannte ich genau die ganze Geschichte des Streiks – ich arbeitete damals in der Hauptstadt – wußte genau, daß bei diesem Streik kein Verrat vorgekommen, der „gute Ingenieur“ nicht bloß nicht gehängt, sondern nicht einmal verhaftet worden war. Die Krankheit des Arbeiters endete mit seiner Genesung.
Diese Geschichte verlieh meinen Gedanken eine neue Färbung. In mir wurde der Zweifel wach, ob ich tatsächlich den Mord begangen, oder aber ob, wie Werner sagte, „die Phantasie der Melancholie“ mein Gedächtnis beeinflußt habe. Zu jener Zeit waren meine Erinnerungen an das Leben auf dem Mars seltsam verworren und verblaßt, zusammenhanglos und unvollständig, und wenngleich das Bild des Verbrechens klar in meinem Gedächtnis haftete, so verlor es sich doch in den einfachen und scharfen Eindrücken der Gegenwart. Bisweilen schüttelte ich den kleinlichen, beruhigenden Zweifel ab, erkannte klar, daß alles tatsächlich so gewesen und daß es unmöglich sei, dies abzuleugnen. Dann aber kehrten Zweifel und Sophismen zurück, halfen mir, meine Gedanken von der Vergangenheit abzuwenden. Die Menschen glauben so gerne das, was ihnen angenehm ist ... Und wenngleich in der Tiefe meiner Seele die Erkenntnis lebte, daß diese Auffassung eine Lüge sei, so überließ ich mich ihr dennoch freudig, wie man sich einem Glückstraum überläßt.
Heute glaube ich, daß meine Genesung ohne diese betrügerische Autosuggestion nicht so rasch und so völlig erfolgt wäre.
Werner hielt von mir sorgsam jeden Eindruck fern, der für meine Gesundheit irgendwie „schädlich“ hätte sein können. Er gestattete mir nicht, mit ihm ins Krankenhaus zu gehen, und von den dort beherbergten Geisteskranken durfte ich nur die unheilbar Schwachsinnigen und Degenerierten beobachten, die frei umhergingen und sich mit verschiedenen Arbeiten auf dem Feld, in Hain und Garten beschäftigten. Ich muß gestehen, daß mich diese Fälle nicht sonderlich interessierten, habe ich doch mein Lebtag alles Hoffnungslose, Nutzlose, für Immer-Verurteilte gehaßt. Es verlangte mich weit mehr danach, akute Fälle zu studieren, vor allem jene, bei denen die Hoffnung auf Genesung bestand, die Melancholiker und die heiteren Maniaken. Werner versprach mir, mich mit ihnen bekannt zu machen, sobald meine eigene Genesung genügend Fortschritte gemacht habe; doch schob er es immer wieder von neuem hinaus.
Noch mehr aber bemühte sich Werner, mich von dem politischen Leben der Heimat zu isolieren. Anscheinend nahm er an, meine ganze Erkrankung rühre von den furchtbaren Eindrücken der Revolution her. Er wollte nicht glauben, daß ich mich die ganze Zeit über fern der Heimat befunden habe und nicht einmal wußte, was sich hier ereignet hat. Er hielt meine Unkenntnis der Lage für bloße Vergeßlichkeit und fand diese Tatsache sei für mich und meine Gesundheit äußerst günstig. Er weigerte sich nicht nur, mir etwas über die Vorfälle zu berichten, sondern verbot dies auch meinen Wärtern; in der ganzen Wohnung war keine einzige Zeitung, keine einzige Zeitschrift aus den letzten Jahren zu finden, er verbarg alle derartigen Dinge in seinem Arbeitszimmer oder im Krankenhaus. Ich war gezwungen, auf einer unbewohnten politischen Insel zu leben.
Anfangs, da es mich einzig und allein nach Ruhe und Stille verlangte, erschien mir diese Lage sehr angenehm. Später jedoch, als meine Kräfte zunahmen, wurde es mir in der Austernschale zu eng; ich stellte an meine Gefährten allerlei Fragen, die sie, dem Gebot des Arztes gehorchend, nicht beantworteten. Ich ärgerte und langweilte mich. Versuchte, meine politische Quarantäne zu durchbrechen, Werner davon zu überzeugen, daß ich gesund genug sei, um Zeitungen lesen zu dürfen. Vergeblich; Werner erklärte, es wäre verfrüht, und er selbst werde beurteilen, wann es an der Zeit sei, meine geistige Diät abzuändern.
Nun nahm ich zur List meine Zuflucht. Es galt, in meiner Umgebung einen Spießgesellen zu finden, der seiner Freiheit nicht beraubt war. Den Feldscher für mich zu gewinnen, wäre äußerst schwierig gewesen: er hatte eine übertrieben hohe Auffassung von seiner Berufspflicht. Deshalb wandte ich mich an den anderen Krankenpfleger, den Genossen Wladimir. Bei ihm stieß ich auf keinen großen Widerstand.
Wladimir war früher Arbeiter gewesen. Fast noch ein unwissender Knabe, hatte er sich den Revolutionären angeschlossen, war aber jetzt bereits ein erfahrener Soldat. Zur Zeit eines gewaltigen Pogroms, als eine Unzahl Genossen unter den Kugeln gefallen und in den Flammen der Feuersbrunst zugrundegegangen waren, hatte er sich einen Weg durch die Menge der Pogromisten gebahnt, etliche derselben erschossen und war durch einen glücklichen Zufall mit heiler Haut davongekommen. Dann lebte er lange Zeit illegal in verschiedenen Städten und Dörfern, widmete sich der bescheidenen aber gefährlichen Aufgabe, Literatur und Waffen zu transportieren. Schließlich, als ihm schon der Boden unter den Füßen brannte, sah er sich gezwungen, bei Werner ein Versteck zu suchen. Diese Einzelheiten erfuhr ich selbstverständlich erst später. Doch bemerkte ich gleich zu Anfang, daß der junge Mann unter seiner geringen Bildung litt und daß es ihn, dem die frühere wissenschaftliche Disziplin fehlte, viel Mühe kostete, sich selbst weiterzubilden. Ich begann mich mit ihm zu beschäftigen, wir kamen gut vorwärts, und ich gewann auf ewig sein Herz. Später fiel es mir leichter, mich meinem Ziel zu nähern: Wladimir hielt nur wenig von medizinischen Anordnungen und wir zettelten eine kleine Verschwörung an, um Doktor Werners Strenge zu paralysieren. Wladimirs Erzählungen, die Zeitungen, Zeitschriften und politischen Broschüren, die er mir zusteckte, gaben mir gar bald ein Bild vom Leben der Heimat während meiner Abwesenheit.
Die Revolution war nicht glatt vor sich gegangen, hatte sich qualvoll lange hingezogen. Das aus seiner Stumpfheit erwachende Proletariat hatte anfangs, dank unerwarteter Angriffe, große Siege errungen, doch wurde es im entscheidenden Augenblick von den Bauernmassen im Stich gelassen, und die vereinigten Kräfte der Reaktion brachten ihm furchtbare Niederlagen bei. Während es für einen neuen Kampf Kräfte sammelte und die Nachhut der bäuerlichen Revolutionäre erwartete, wurden zwischen den Großgrundbesitzern und der Bourgeoisie Verhandlungen angebahnt, die ein gemeinsames Vorgehen und die Erdrosselung der Revolution bezweckten. Diese Absichten nahmen die Form einer parlamentarischen Komödie an; sie endeten infolge der unversöhnlichen Haltung der Agrarier-Reaktionäre mit einem Mißerfolg. Das Spielzeug-Parlament berief seine Mitglieder ein, jagte sie dann, eines nach dem anderen, auf die gröbste Weise wieder fort. Die Bourgeoisie, erschöpft von den Stürmen der Revolution, erschreckt durch die ersten selbstbewußten energischen Angriffe des Proletariats, ging immer weiter nach rechts. Die Bauernschaft, in ihren Massen revolutionär gesinnt, machte sich rasch die politische Erfahrung zu eigen; die Flammen zahlloser Feuersbrünste erhellten den von ihr eingeschlagenen Weg des Kampfes. Die alte Macht versuchte auf blutigste Art die bäuerliche Erhebung abzuwürgen, wollte zu gleicher Zeit die Bauernschaft durch Verteilung von Grund und Boden versöhnen, doch geschah letzteres auf eine so geizige, schmutzige Art, das es völlig ergebnislos blieb. Tagtäglich ereigneten sich auf allen Seiten, von allen Parteien und Gruppen unternommene Ueberfälle. Im Lande wütete ein noch nie dagewesener, in keinem Reiche der Erde je geahnter Terror, oben und unten.
Das Land ging einem neuen entscheidenden Kampf entgegen. Doch war dieser Weg so lang und so voller Schwanken und Zweifeln, daß viele von Erschöpfung und sogar von Verzweiflung übermannt wurden. Die radikale Intelligenz, die am Kampf teilnahm, vor allem die Sympathisierenden, gingen fast vollständig ins Lager der Feinde über. Freilich bedauerte das niemand. Aber sogar unter meinen einstigen Genossen entstanden Verzagtheit und Hoffnungslosigkeit. Diese Tatsache bewies mir klar, wie schwer und kraftraubend das revolutionäre Leben dieser Zeit gewesen war. Ich selbst, ein ausgeruhter Mensch, der sich der Vorrevolutionszeit und des Anfangs des Kampfes erinnerte, ohne jedoch die Härte der späteren Niederlagen erlitten zu haben, sah klar das sinnlose Untergraben der Revolution, sah, wie sehr sich alles in diesen Jahren verändert habe, wie viele neue Elemente des Kampfes hinzugekommen waren, wie unmöglich es war, das Gleichgewicht herzustellen. Die neue Woge der Revolution mußte kommen und war schon nahe.
Es gab bloß eine Möglichkeit: warten. Ich ahnte, wie qualvoll schwer unter diesen Umständen die Arbeit der Genossen sein mußte. Mich selbst verlangte es nicht, allzu rasch wieder an die Arbeit zu gehen. Und dies unabhängig von Werners Ansichten; ich fand, es sei klüger, Kräfte zu sammeln, um sie erst dann anzuwenden, wenn sie wieder ihre ganze Stärke erreicht hatten.
Auf unseren langen Spaziergängen im Hain erwogen wir, Wladimir und ich, die Aussichten und Bedingungen des bevorstehenden Kampfes. Die heroisch naiven Träume und Pläne meines Gefährten erschütterten mich zutiefst, er schien mir ein edles, liebes Kind, dem ein schlichter, anspruchslos schöner Kämpfertod bevorstand, erhaben und einfach, wie sein ganzes junges Leben gewesen. Der Weg der Revolution wird mit edlen Opfern bezeichnet, und schönes Blut färbt die proletarische Fahne.
Aber nicht nur Wladimir kam mir wie ein Kind vor. Selbst Werner, dieser alte Revolutionär, erschien mir weit naiver und kindlicher, als ich früher geglaubt hatte – und das gleiche Gefühl empfand ich auch anderen Genossen, ja sogar etlichen unserer Führer gegenüber ... Alle jene Menschen, die ich auf der Erde gekannt hatte, machten auf mich den Eindruck halbkindlicher, noch nicht völlig erwachsener Wesen, die das Leben in sich und ringsum nur unklar zu erfassen vermögen, die äußeren und inneren Gewalten gehorchen. In dieser Empfindung war kein Tropfen von Selbstüberhebung, oder Verachtung, sondern tiefe Zuneigung und brüderliches Interesse für diese embryonalen Geschöpfe, die Kinder einer jungen Menschheit.
Die glühende Sommersonne schien das Eis, in dem das Leben des Landes erstarrt war, zu schmelzen. Es erwachte, und die Morgenröte neuer Stürme zeigte sich am Horizont. Aus der Tiefe drang von neuem dumpfes Murren. Diese Sonne, dieses Erwachen erwärmten meine Seele, steigerten meine Kräfte; ich fühlte, bald würde ich gesünder sein, als ich es je zuvor gewesen.
In dieser Stimmung unklarer Lebensfreude wollte ich nicht mehr an die Vergangenheit denken. Das Bewußtsein, ich sei von der ganzen Welt, von allen vergessen, tat mir wohl ... Für die Genossen wollte ich erst zu einer Zeit auferstehen, da es keinem mehr einfallen würde, mich über die Jahre meiner Abwesenheit zu befragen, es für derartiges kein Interesse geben und meine Vergangenheit in den stürmischen Wogen einer neuen Flut versunken sein werde. Bemerkte ich jedoch Tatsachen, die diese meine Hoffnung als zweifelhaft erscheinen ließen, so erfaßten mich Erregung und Unruhe, sowie eine sinnlose Feindseligkeit gegen jene, die sich noch an mich erinnern konnten.
An einem Sommerabend fand sich Werner bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus nicht, wie gewöhnlich, im Garten ein, um sich zu erholen – er bedurfte dieser Erholung, denn der Rundgang durchs Krankenhaus ermüdete ihn sehr, – sondern suchte mich auf und begann mich ausführlich über mein Befinden zu befragen. Mir schien, als strenge er sich an, meine Antworten im Gedächtnis zu behalten. Das war etwas ungewöhnliches, und ich glaubte, er habe vielleicht durch einen Zufall meine kleine Verschwörung entdeckt. Doch merkte ich bald, daß er keinerlei Verdacht hege. Dann verließ er die Stube und begab sich in sein Arbeitszimmer. Erst eine halbe Stunde später sah ich durchs Fenster, daß er in seiner dunklen Lieblingsallee spazieren ging. Ich konnte nicht umhin, diese Kleinigkeiten zu beobachten, gab es ja in meiner Umgebung keinerlei große Vorfälle und Ereignisse. Nachdem ich verschiedene Vermutungen verworfen hatte, kam ich zu der allerwahrscheinlichsten Lösung, Werner wolle vielleicht auf eine besondere Aufforderung hin jemandem über meine Gesundheit einen Bericht schreiben. Die Post wurde ihm allmorgendlich in sein Arbeitszimmer gebracht, – vielleicht hatte er heute einen Brief erhalten, der sich nach mir erkundigte.
Von wem war dieser Brief, was bezweckte er? Ich mußte dies unbedingt erfahren, um meine Seelenruhe wiederzufinden. Werner selbst zu befragen, wäre vergeblich gewesen – er schien einen besonderen Grund zu haben, mir den Brief zu verheimlichen, hätte sonst von selbst darüber gesprochen. Ob vielleicht Wladimir etwas wußte? Aber es erwies sich, daß auch ihm nichts bekannt war. Ich überlegte, auf welche Art und Weise ich die Wahrheit erfahren könnte.
Wladimir war zu jedem Dienst bereit. Meine Neugierde erschien ihm völlig berechtigt, Werners geheimnisvolles Wesen hingegen fand er unbegründet. Er scheute sich nicht, Werners Zimmer einer wahren Durchsuchung zu unterziehen, desgleichen das medizinische Kabinett, doch fand er nichts Interessantes.
„Entweder hat er den Brief eingesteckt“, meinte Wladimir, „oder aber zerrissen und fortgeworfen.“
„Wohin wirft er gewöhnlich die zerrissenen Briefe und Papiere?“ fragte ich.
„In den Korb, der unter dem Tisch seines Arbeitszimmers steht.“
„Gut, bringen Sie mir alle Papiere, die Sie im Korb finden.“ Wladimir ging und kehrte eiligst zurück.
„Es sind gar keine Papiere im Korb“, erklärte er. „Doch fand ich diesen Briefumschlag, den er, dem Stempel nach, heute erhalten haben muß.“
Ich griff nach dem Umschlag und betrachtete die Aufschrift. Plötzlich schien unter meinen Füßen die Erde zu versinken, und die Wände drohten über mir einzustürzen ...
Es war Nettis Schrift!
Aus dem Chaos der Erinnerungen und Gedanken, in dem meine Seele versank, als ich sah, daß sich Netti auf der Erde befinde und nicht mit mir zusammentreffen wolle, erhob sich nur das Endergebnis klar und deutlich. Dies kristallisierte sich gleichsam von selbst heraus, ohne irgendeinen logischen Prozeß, und stand über jedem Zweifel. Doch vermochte ich mich damit nicht abzufinden. Ich wollte meine Tat mir und anderen gegenüber begründen. Vor allem aber konnte ich mich nicht in den Gedanken finden, daß Netti meine Tat nicht begreifen, sie für einen bloßen Ausbruch des Gefühls halten könnte, obschon sie doch eine logische Notwendigkeit gewesen war, die sich unvermeidlich aus meiner ganzen Geschichte entwickelt hatte.
Es galt also, vor allen folgerichtig meine Geschichte zu erzählen, um der Genossen, um meiner, um Nettis willen ... Deshalb wurde dieses Manuskript geschrieben. Werner, der es als erster lesen wird – am Tage nach Wladimirs und meiner Flucht – möge für dessen Veröffentlichung sorgen, – selbstverständlich muß er die nötigen, durch unsere konspirative Tätigkeit bedingten Abänderungen vornehmen. Das ist meine einzige Bitte. Ich bedaure sehr, daß ich ihm nicht zum Abschied die Hand drücken kann ...
Während ich an diesen Erinnerungen schrieb, erhob sich die Vergangenheit immer heller und klarer vor mir, das Chaos verwandelte sich in Gewißheit, die von mir gespielte Rolle, sowie meine Lage zeichneten sich scharf in meinem Bewußtsein ab. Mit gesundem Verstand und klarer Erinnerung vermag ich alles zum Abschluß zu führen ...
Zweifellos überstieg die mir gestellte Aufgabe meine Kräfte. Worin aber ist die Ursache meines Mißerfolges zu suchen? Und wie ist der Irrtum zu erklären, den sich Mennis durchdringender, hoher Verstand bei meiner Wahl zu schulden kommen ließ?
Ich entsann mich eines Gespräches, das ich mit Menni über meine Wahl geführt hatte. Es war zu jener glücklichen Zeit gewesen, als Nettis Liebe in mir den unbegrenzten Glauben an meine Kraft erweckt hatte.
„Wie kam es, Menni“, fragte ich, „daß Sie aus der großen Menge verschiedenartigster Menschen unseres Landes, deren Bekanntschaft Sie während Ihres Aufenthaltes auf der Erde gemacht hatten, gerade mich für den geeignetsten Vertreter der Erde gehalten haben?“
„Die Auswahl war nicht besonders groß“, entgegnete er. „Sie mußte im Rahmen der Vertreter des wissenschaftlich-revolutionären Sozialismus getroffen werden, denn alle anderen Weltanschauungen standen der unseren noch weit ferner.“
„Mag sein. Wäre es aber nicht viel leichter gewesen, unter den Proletariern, die die Basis und die Kraft unserer Bewegung bedeuten, das richtige zu finden?“
„Ja, es wäre richtiger gewesen, dort zu suchen. Aber ... ich hätte bei ihnen nicht das gefunden, was mir unentbehrlich schien: die umfassende, vielseitige Bildung, die höchste Stufe Ihrer Kultur. Diese Tatsache lenkte mein Suchen nach der anderen Seite.“
So sprach Menni. Seine Annahme bewahrheitete sich nicht. Bedeutet dies, daß er überhaupt keinen Erdenmenschen hätte mitnehmen dürfen, daß der Unterschied zwischen den beiden Kulturen ein unüberbrückbarer Abgrund ist, über den der Einzelne nicht hinüberzugelangen, und den bloß die Gesellschaft zu besiegen vermag? Das zu glauben, wäre für mich persönlich ein großer Trost, doch zweifle ich ernstlich daran. Ich glaube vielmehr, daß sich Menni in jener Ansicht, die unsere Arbeitergenossen betrifft, geirrt habe.
Wodurch erlitt ich Schiffbruch?
Die erste Ursache war vielleicht der Umstand, daß sich eine Unmenge Eindrücke des fremden Lebens auf meinen Geist stürzte, daß deren Reichhaltigkeit mein Bewußtsein überflutete und die Ufer verwischte. Mit Nettis Hilfe überlebte ich die Krise und fand mich wieder zurecht. Aber war nicht diese Krise selbst die Folge jener erhöhten Empfindsamkeit, jener verfeinerten Wahrnehmung, die rein geistig arbeitenden Menschen eigen ist? Würde vielleicht einer primitiveren, etwas weniger komplizierten, widerstandsfähigeren und einfacheren Natur alles leichter gefallen, und für sie der rasche Uebergang weniger schmerzlich gewesen sein? Vielleicht wäre es für den mindergebildeten Proletarier weniger schwer gewesen, sich in ein neues, höheres Dasein zu finden, freilich hätte er weit mehr Neues lernen müssen, doch wäre in seinem Fall nicht nötig gewesen, so viel Altes zu verlernen, und gerade dies ist das schwerste ... Mir scheint, daß ich in dieser Hinsicht recht habe und daß sich in Mennis Berechnung ein Fehler eingeschlichen hatte, indem er dem Kulturniveau mehr Bedeutung beimaß, als der kulturellen Entwicklungskraft.
Ferner wurden meine Seelenkräfte von dem Charakter jener Kultur zermalmt, an die ich mich mit meinem ganzen Wesen anzupassen versuchte. Ihre Erhabenheit erdrückte mich, die Tiefgründigkeit ihrer sozialen Bande, die Reinheit und Durchsichtigkeit der Verhältnisse zwischen Mensch und Mensch. Sternis Rede, die auf etwas plumpe Art die Unermeßlichkeit der zwei Lebenstypen beleuchtete, war bloß die Veranlassung, der letzte Anstoß, der mich in die Untiefe stürzte, an deren Rand mich mit elementarer, unbezwinglicher Kraft der Widerspruch zwischen meinem Innenleben und dem ganzen sozialen Milieu, in der Fabrik, der Familie, der Gesellschaft, unter Freunden getrieben hatte. Und abermals muß ich fragen, ob diese Widersprüche nicht gerade bei mir doppelt so stark und scharf fühlbar wurden, bei mir, dem revolutionären Intellektuellen, der neun Zehntel seiner Arbeit entweder in der Einsamkeit verrichtet hatte, oder zumindest unter Bedingungen, die ihn von seinen auf einer anderen Bildungsstufe stehenden Mitarbeitern absonderten? Bei mir, dessen Persönlichkeit sich von den anderen abgesondert hatte? Würden sich diese Widersprüche nicht weit schwächer bei einem Menschen ausgewirkt haben, der neun Zehntel seines Arbeitslebens auf primitive, undifferenzierte Art verbracht, sich aber stets in einem Kameradenkreis aufgehalten hatte, mit diesem durch eine grobe, aber tatsächliche Gleichheit verbunden? Mir schien, daß dem so sei, und daß Menni seinen Versuch in anderer Richtung wiederholen müßte ...
Zwischen den beiden von mir erlittenen Schiffbrüchen hatte es eine Zeit der Entschlossenheit und der männlichen Tatkraft im Kampfe gegeben. Das, was damals meine Kraft aufrecht erhielt, half mir auch heute ohne ein Gefühl allzu großer Demütigung den Abschluß zu machen: Nettis Liebe.
Freilich war Nettis Liebe ein edler und liebevoller Irrtum gewesen, dennoch war eine solche Liebe möglich; diese Tatsache konnte durch nichts und niemanden weggeleugnet und verändert werden. Für uns bedeutete sie eine Bürgschaft für die tatsächliche Annäherung der beiden Welten, und für ihre künftige Verschmelzung zu einer einzigen, ungeahnt schönen und starken Welt.
Und ich selbst ... Für mich gibt es keinen Abschluß. Für das neue Leben war ich nicht geeignet, nach dem alten verlangt es mich nicht mehr. Ich gehöre ihm nicht mehr an, weder den Gedanken, noch den Gefühlen nach. Es gibt nur einen Ausweg.
Die Zeit ist vorüber. Mein Spießgeselle erwartet mich im Garten; eben hörte ich sein Signal. Morgen werden wir bereits fern von hier sein, auf dem Wege dorthin, wo das Leben brodelt und die Ufer überflutet, wo es leicht sein wird, die mir so verhaßte Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft zu verwischen. Leb wohl, Werner, guter, alter Genosse.
Gegrüßt seiest du, neues strahlendes Leben, und auch du, dessen leuchtende Erscheinung: meine Netti!
(Der Brief trägt kein Datum; diese Unterlassung ist
offenbar durch Werners Zerstreutheit verschuldet.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Kanonade war bereits seit langem verstummt, und noch immer wurden neue und neue Verwundete gebracht. Die meisten davon waren Milizleute und nicht Soldaten, oder friedliche Einwohner, darunter auch viele Frauen und sogar Kinder: vor den Schrapnellen sind alle gleich. In mein nahe dem Schlachtfeld gelegenes Krankenhaus wurden vor allem Milizleute und Soldaten eingebracht. Die von den Granaten und Schrapnellen verursachten furchtbaren Verwundungen machten sogar auf mich, den alten Arzt, der seit Jahren nicht mehr chirurgisch gearbeitet hat, einen tiefen Eindruck. Doch erhob sich aus dem Grauen triumphierend der leuchtende Gedanke: Sieg!
Es war unser erster großer Sieg im gegenwärtigen Ringen, war ein entscheidender Sieg. Die Wagschale senkte sich nach der anderen Seite. Ein furchtbares Gericht hub an. Hier wird es keine Gnade, sondern Gerechtigkeit geben. Schon längst war die Zeit reif ...
Auf den Straßen Blut und Trümmer. Feuersbrünste und der Rauch der Kanonade hatten die Sonne blutrot gefärbt. Doch erschien sie unserem Auge nicht böse und zornig, sondern freudenvoll. In der Seele klang ein Kampflied, eine Siegeshymne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leonid wurde gegen Mittag ins Krankenhaus gebracht. Er hatte eine gefährliche Wunde in der Brust und einige leichte Verletzungen, fast nur Schrammen. Er hatte sich zur Nachtzeit mit dem fünften Grenadierregiment in jenen Teil der Stadt begeben, der sich in den Händen der Regierung befand. Der Kampf endete damit, daß einige verzweifelte Ueberfälle Schrecken und Demoralisation hervorriefen. Leonid selbst hatte diesen Plan entworfen und dessen Ausführung geleitet. Er hatte in früheren Jahren viel in dieser Stadt gearbeitet und kannte alle Winkel und Verstecke, konnte deshalb dieses tollkühne Unternehmen besser durchführen als jeder andere. Der Führer der Miliz, der zuerst gegen den Plan gewesen war, stimmte schließlich zu. Es gelang Leonid, mit seinen Granaten bis zu einer der feindlichen Batterien vorzudringen und etliche Kisten mit Munition zu zerschmettern. Während der durch die Explosion entstandenen Panik gelang es den Unseren, die feindlichen Waffen zu zerstören, sowie die Batterien. Dabei erhielt Leonid einige leichte Verwundungen. Beim Rückzug gelangten die Unseren in die Reihen der feindlichen Dragoner. Leonid übergab das Kommando Wladimir, der sein Adjutant war, schlich sich selbst mit den beiden letzten Granaten zum nächsten Tor, hielt sich im Hinterhalt, bis es den anderen gelungen war, sich zurückzuziehen. Er ließ die feindlichen Reihen zum Teil an sich vorüberschreiten, warf dann die erste Granate gegen einen Offizier, die zweite in die nächste Gruppe der Dragoner. Die ganzen Reihen flüchteten eiligst; die Unseren kehrten zurück und fanden Leonid schwer verletzt neben seinen Granaten. Sie brachten ihn noch vor dem Morgengrauen in unsere Linien und übergaben ihn mir.

Es gelang mir, den Granatsplitter zu entfernen, doch waren die Lungen verletzt und Leonid befand sich in einem kritischen Zustand. Ich brachte den Kranken so gut wie möglich unter, freilich konnte ich ihm nicht das geben, dessen er am meisten bedurfte: die völlige Ruhe, die ihm so sehr not tat. Am Morgen begann die Schlacht von neuem, ihr Dröhnen drang bis zu uns. Die unruhige Erwartung des Ausgangs der Schlacht verstärkte Leonids Fieber. Als noch weitere Verwundete eingebracht wurden, steigerte sich seine Erregung, und ich war gezwungen, vor sein Bett einen Wandschirm zu stellen, damit er die fremden Wunden nicht sehe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nach etwa vier Stunden ging der Kampf bereits seinem Ende zu, und der Ausgang war klar ersichtlich. Ich war mit der Unterbringung der Verwundeten beschäftigt. Da wurde mir die Karte jener Frau gebracht, die sich vor einigen Wochen schriftlich nach Leonids Befinden erkundigt und mich nach Leonids Flucht aufgesucht hatte. Ich sandte sie damals mit einem Empfehlungsschreiben zu Ihnen, damit sie in Leonids Manuskript Einsicht nehme. Sie war zweifellos eine Genossin und anscheinend Aerztin. Deshalb führte ich sie in mein Zimmer. Sie trug auch heute wie damals einen dichten schwarzen Schleier, der ihre Züge völlig verdeckte.
„Ist Leonid bei Ihnen?“ fragte sie, ohne mich zu begrüßen.
„Ja“, erwiderte ich, „doch darf er sich keiner Aufregung aussetzen; wenngleich seine Verwundung eine ernste ist, so hoffe ich dennoch, ihn heilen zu können.“
Sie stellte hastig eine Reihe von Fragen an mich, die den Zustand des Verwundeten betrafen. Dann erklärte sie, ihn sehen zu wollen.
„Wird das Wiedersehen ihn nicht aufregen?“ fragte ich.
„Zweifellos“, lautete die Antwort. „Doch wird ihm diese Aufregung weit mehr nützlich als schädlich sein. Dafür kann ich Ihnen bürgen.“
Ihre Stimme klang entschlossen und sicher. Ich fühlte, daß sie genau wisse, was sie sage und konnte ihre Bitte nicht abschlagen. Wir begaben uns in jenen Raum, wo Leonid lag und ich zeigte mit einer Gebärde, sie möge sich hinter den Wandschirm begeben. Ich selbst verharrte in der Nähe, am Bett eines anderen Schwerverwundeten, um den ich mich bemühte. Es verlangte mich danach, das Gespräch der Frau mit Leonid zu erlauschen, um eingreifen zu können, sobald dies notwendig wurde.
Während sie sich hinter den Schirm begab, hob sie ein wenig den Schleier. Ich erblickte ihre Silhouette durch das undichte Gewebe des Schirms und sah, wie sie sich zu dem Verwundeten niederbeugte.
„Die Maske ...“ ertönte Leonids schwache Stimme.
„Deine Netti“, entgegnete sie. Und in diesen leise, melodisch gesprochenen Worten lag so viel Liebe und Zärtlichkeit, daß mein altes Herz erbebte, erfaßt von schmerzlich freudigen Gefühlen.
Die Frau machte eine scharfe hastige Gebärde, fast, als wollte sie ihren Kragen lösen, nahm dann Hut und Schleier ab und beugte sich noch näher zu Leonid nieder. Einen Augenblick herrschte tiefes Schweigen.
„Das bedeutet wohl, daß ich sterbe?“ fragte Leonid leise.
„Nein, Lenni, das ganze Leben liegt vor uns. Deine Wunde ist nicht tödlich, ist nicht einmal gefährlich.“
„Und der Mord?“ rief er schmerzlich erregt.
„Das war eine Krankheit, mein Lenni. Sei ruhig, diese tödliche Wunde wird niemals zwischen uns stehen, auch nicht auf dem Wege zu unserem erhabenen gemeinsamen Ziel. Wir werden das Ziel erreichen, mein Lenni ...“
Ein leises Stöhnen löste sich aus seiner Brust, doch war es kein Schmerzenston. Ich verließ das Zimmer; mein Patient hatte mir bereits alles verraten, was ich zu wissen verlangte. Es hätte keinen Sinn gehabt, weiter zu lauschen. Einige Minuten später erschien die Unbekannte abermals in Hut und Schleier bei mir.
„Ich nehme Leonid mit“, sprach sie. „Er wünscht dies selbst, und die Bedingungen für seine Genesung sind bei mir günstiger als hier; Sie können ganz unbesorgt sein. Zwei Genossen warten unten, werden Leonid zu mir schaffen. Lassen Sie uns, bitte, eine Tragbahre zur Verfügung stellen.“
Ich hatte keine Ursache, mich zu weigern: in unserem Spital waren die Bedingungen tatsächlich keineswegs glänzend. Ich fragte die Unbekannte nach ihrer Adresse, – sie wohnte ganz nahe von hier. Ich beschloß, am folgenden Tag hinzugehen und Leonid zu besuchen. Zwei Arbeiter erschienen und trugen Leonid vorsichtig auf einer Bahre fort.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS. geschrieben am folgenden Tag.
Leonid und Netti sind spurlos verschwunden. Ich war eben in ihrer Wohnung: die Türen waren geöffnet, die Zimmer leer. Im großen Saal stand ein ungeheures Fenster sperrangelweit offen, auf dem Tisch lag ein an mich gerichteter Brief. Mit zitternder Hand waren bloß einige wenige Worte geschrieben:
„Grüße an die Genossen. Auf Wiedersehen.
Ihr Leonid.“
Seltsam, ich fühle keinerlei Unruhe und Sorge. Diese Tage haben mich zu Tode erschöpft; ich sah viel Blut, sah viele Leiden, die ich nicht zu lindern vermochte, erblickte Bilder der Zerstörung und des Untergangs; dennoch herrschen in meiner Seele Freude und Licht.
Das Aergste liegt hinter uns. Noch harrt unser ein langer und schwerer Kampf, aber vor uns leuchtet der Sieg ... Und der neue Kampf wird leichter sein.
Ende.
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Weitere Änderungen sind hier aufgeführt (vorher/nachher):