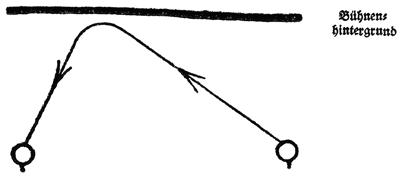
Schema der Bewegung einer Chansonette
Title: Über die Schönheit häßlicher Bilder. Ein Vademecum für Romantiker unserer Zeit
Author: Max Brod
Release date: August 11, 2011 [eBook #37033]
Most recently updated: January 8, 2021
Language: German
Credits: Produced by Jana Srna, Norbert H. Langkau and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text so gekennzeichnet. Der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
Max Brod
Falstaff: »– denn die armseligen Mißbräuche der Zeit haben Aufmunterung nötig«
1913
Kurt Wolff Verlag, Leipzig
Copyright by Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1913
Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig
| Seite | |
|---|---|
| Über die Schönheit häßlicher Bilder | 5 |
| Gegen moderne Möbel | 13 |
| Der Frauen-Nichtkenner | 24 |
| Der allerletzte Brief | 29 |
| Zufällige Konzerte | 36 |
| Mein Tod | 41 |
| Unter Kindern | 49 |
| Der Ordnungsliebende | 55 |
| Panorama | 59 |
| Kinematographentheater | 68 |
| Notwendigkeit des Theaters | 72 |
| Torquato Tasso | 76 |
| Bewegungen auf der Bühne | 83 |
| Die Liebe wacht | 87 |
| Louskáček | 90 |
| König Wenzel IV. | 92 |
| Weiße Wände | 99 |
| Untergang des Dramas | 101 |
| Ideen für Ausstattungsstücke | 104 |
| Illusion | 112 |
| Die Vorstadtbühne | 117 |
| Das Wunderkind | 129 |
| Im Chantant | 135 |
| Liane de Vriès | 139 |
| Höhere Welten | 144 |
| Kommentar zu Robert Walser | 158 |
| Verworrene Nebengedanken | 167 |
| Meyerbeer | 173 |
| Gustav Mahlers III. Symphonie | 178 |
| VI. Symphonie von Mahler | 181 |
| Kleine Konzerte | 189 |
| Smetana | 195 |
| Das Berlioz-Theater | 205 |
»Ach, warum ist nicht alles operettenhaft.«
Laforgue.
Noch heute, wenn aus der bronzierten Netzfläche einer Dampfheizung lauer Hauch von ungefähr mich befällt (o Erinnerung, erfolgreiche Schmutzkonkurrentin des Gegenwärtigen!) ... dann fällt mir jene Kunstausstellung im Künstlerhaus zu Wien ein, die mich erzogen hat. Das war reizend, damals. Schon unterwegs im rauhen Märzwind der Straßen, der allen Damen längs empörter Frisuren die Hüte in die Höh' trieb (Balzac würde sagen: In diesem Wind, der für Wien ebenso charakteristisch ist wie usf.) ... schon unterwegs freute ich mich auf dieses Künstlerhaus, das ich mir warm und nach seinem Namen als einen Versammlungsort hochgemuter Künstlerrecken vorstellte, ja lauter solcher Tiziane, die dort auf und ab gehn, patrizisch, und in Prunkwämsern ohne Farbflecke mit Königen Gespräche führen. Doch ich war kaum enttäuscht, als ich nur Bilder vorfand, Bilder ohne Zahl, und an manchen Stellen der Wand zwischen zwei Bildern diese braven Siebe der Zentralheizung, die unversehens mit Garben tropischer Witterung überschütten. Ich blieb immer zwischen den Bildern. Aber meine Gefährtin war von künstlerischen Entzückungen schon umzingelt, attackiert, überwältigt. Die Luft deutlich gemalter Sonnenuntergänge atmete sie, wiewohl in dieser Luft fettglänzende Wolken aus Himbeerlimonade hingen, mit Vergnügen ein, sie fuhr in sauber-wuchtige Fjordkulissen, wurde durch Charlie Stuarts Hinrichtung erschüttert zugleich und belehrt ... »Aber das ist doch lauter Kitsch! Wie kann Ihnen so etwas gefallen?« rief ich lächerlich-ernsthaft, indem ich meiner durch Wärmebedürfnis erklärbaren Stellung ein satirisches Cachet zu geben bemüht war. Sie sah mir gekränkt zu und ging in den nächsten Saal. Ich folgte ... Auch hier Korbsessel, Teppiche, Palmen, Oberlicht, und an den Wänden führten Schutzengel mit aufgereckten Gänseflügeln kleine Mädchen über Stege unpraktischer Bauart, ein Lohengrin, dessen Bewegungen trotz seines Silberpanzers wie unter geselligstem Frack sich zierten, küßte sein kokettes Elschen, nebenan sagten gesund und doch melancholisch aussehende Handwerksburschen in vormärzlichen Kostümen ihrer aber schon sehr poetischen Heimatstadt Ade, blondeste Backfische, rosarot, frisch vom Konditor, hatten Noten und eine Lyra und einen auch im Schlafe blassen Dichter, den sie amüsant bekränzten, auf Schneelandschaften (weiß, fraise, perlgrau) erschienen krächzende Raben durch das ein für allemal feststehende Zeichen zweier aneinander gefügter Beistriche angedeutet, und das Exotische war vertreten durch Beduinen, Schwerttänzerinnen, slowakische Bauern, Szenen aus Buchara, Zentauren im Galopp, Fellahfrauen neben den bekannt schrägen Raen der Nilbarken. Ja, dieser Orient, das ist doch noch was ... Indes mit mehr als meinem Tone der Entrüstung »Und das gefällt dir nicht?« führt mich meine Gefährtin vor die reizendste Zofe der Welt, die ihr Händchen so geschickt hinter eine Kerze zu halten weiß, daß die heraufsteigenden Lichtstrahlen rotgelb ihr Gesicht schminken ... Und nun bin ich besiegt, nun gefällt mir schon alles. Ich vergesse die Franzosen, den Fortschritt, Meier-Graefe, die Verpflichtungen eines modernen Menschen. Schon zurückgetaucht in Jahre unverantwortlicher Jugend, freue ich mich über die Zahnlosigkeit eines gutmütigen Mönches, der rechts-links umflochtene Weinflaschen an sich preßt, wie einfach-menschlich; und bin verblüfft von glattlasierten Schlachten, den sorgfältig-blutigen Kopftüchern der Verwundeten, den sauberen Reitersäbeln. Und »Rast im Manöver« heißt es, wenn auf Tornister gepackte Blechgefäße grau dem grauen Straßenstaub entgegenblitzen. Und deutlich strichliertes Schilf wächst »vor dem Gewitter« aus zinnweißen Reflexen eines Sumpfspiegels. Am Klavier wird Abschied genommen, für ewig vielleicht. Rosen lösen sich welkend aus Wassergläsern. Kühe ruhen im Grünen. Miß nur, kleines Mäderl, wer höher ist, du oder euer Barry ...
Seit damals liebe ich die Behaglichkeit, die bewußtlose Grazie schlechter Bilder, diese Ironie, die von sich selbst nichts weiß, diese Eleganz der unbeabsichtigten Effekte. Wie ärmlich stellen sich seriöse Bilder daneben dar, die den Geist des Beschauers in eine einzige, vom Künstler eben gewollte Richtung drängen. Sie sind so eindeutig, so vollkommen, so häßlich ... die schönen Bilder. Aber Wonnen eines triebhaften Balletts, die unwillkürliche, unausschöpfliche Natur selbst, das Chaos und urzeitliche Zeremonien lese ich aus Annoncenklischees, Reklamebildern, Briefmarken, Klebebogen, aus Kulissen für Kindertheater, Abziehbildern, Vignetten; mich entzückt die Romantik des Geschmacklosen.
Seit damals sind die Plakate an den Straßenecken meine Gemäldesammlungen. Da steht und zeugt für »Laurin & Clement« ein rotes Prachtautomobil, bewohnt von Herr und Dame in totschicker Dreß, steht vor einer gelben Gebirgslandschaft aus aufgetürmten Rühreiern. Der Herr scheint mit eleganter Handbewegung dieses seltene Naturschauspiel der Dame zu präsentieren, die indes, ungerührt von den Blicken aus seiner imposanten Schutzbrille eines Tauchers, ihren Schleier mit spitzer Nase zu zerstechen sucht ... Ein Chamberlain mit Monokel und imperialistisch-frechen Mundwinkeln macht auf die Eröffnung eines Herrenkonfektionsgeschäftes geziemend aufmerksam ... Nicht ganz so glücklich führt sich »Altvater Jägerndorf« durch einen triefäugigen Greis, mit Federbarett und Grubenlampe jedoch, ein ... Werden wir dieser arglos hochgeschürzten Galathea, dem witzreich verzeichneten Knaben einer Varieté-Affiche widerstehen?... Und nieder auf die Knie, die Knie vor dem Porträt Zolas, vor seinem Stirnknittern, das dem Autor ernster Bücher wohl ansteht, und das ein einsichtsvoller Plakatkleber durch besonders runzliges Ankleben gerade dieses Plakates noch verstärkt hat ... Falls du immer noch die Wirkung dieser wahrhaft primitiven Kunst anzweifelst, schwebt schon, nicht um zu strafen, nein, um sanft zu überreden, ein Genius herbei, massiv, doch jungfräulich, in ein aus Bolero und Chiffon kombiniertes Kleid gehüllt und mit unbeteiligt-symmetrischen Flügeln, während wilde Falten den unteren Gewandsaum wegblasen. Er verkündigt »Maifestspiele«, schleudert in der Linken einen Kranz nach vorn und, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, hat er den rechten Arm eingeknickt, wobei ihm freilich das Versehen geschieht, die Posaune statt an den Mund ans Ohr zu setzen, so daß sie einem pompösen Hörrohr ähnelt. Doch scheint dies kein unpassendes Symbol, da er so vortrefflichen Opern, die er anzeigt, auch wohl selbst zu lauschen Lust bekommt. Und unbekümmert um all dies jedenfalls dringt er in die Photographie des Theatergebäudes ein, trotz sichtlichen Gegenwindes, und obwohl das Licht verwirrend genug ihn von links, das Theater von rechts bestrahlt.
Glückselig darüber, daß nicht immer die Physik das letzte Wort behält, wende ich mich weiteren Kunstgenüssen zu. Sie warten in allen Auslagen, diese zauberhaften Offenbachiaden des Lebens, auf mich. Die Parfümerien stehen im Farbenschmuck so schematischer Blumen, daß man »Kinder Floras« mit Lächeln sie zu nennen versucht ist ... Van Houtens Kakao ist schon undenkbar ohne diese etwas nördliche Dame, die im Eisenbahnkupee vornehmer Klasse einer trostlosen Winteröde den Rücken kehrt, um desto neckischer ihr Lieblingstäßchen zu schlürfen, de smakelijkste, in't Gebruk de vordeeligste. Klingt es nicht wie das phantastische Deutsch eines ganz souveränen erstklassigen Schriftstellers? Lustig, lustig ... In einem Seidengeschäft ist die »Wiener Mode« aufgeschlagen. Was für seltsame, von mystischen Rhythmen beherrschte Gestalten, und die Gesichter offen, klug, unschuldig, wie eben aus der »Wiener Mode« ... Papierfirmen stellen Ansichtskarten aus, lustig, lustig, diese verschneiten Kapellen im Walde, die photographierten Liebespaare im Fortschritt der Situationen, harmlose Ostergrüße, als Hasen verkleidete Kaninchen, operettenhafte Alpengletscher, Leid und Freud, Schusterbuben, Villa Miramare, handkolorierte Unwahrscheinlichkeiten ... Und der Delikatessenhändler nebenan. Wie drollig zieht das Baby seinen Karren voll von Schokolade Suchard, wie abenteuerlich und unkontrollierbar wird auf diesen Päckchen der Tee gepflückt. Von einer Weinflasche schwingt ein Herrenreiter höflich uns den Zylinder entgegen, Spanierinnen verführen von Konservenbüchsen herab, an Bonbonnieren treten wie in einer Zauberposse Feen und Ritter auf, der Karlsbader Sprudel plätschert auf jener Kolonne von Oblatenschachteln sechsfach dazu, manche Schnapsfabrikanten ziehen Berglandschaften, andere den biederen Jäger vor, der die Pfeife auf den Holztisch stemmt, Herolde verkünden den Ruhm deutschen Schaumweins, während Biscuits Pernod mit ihren rothosigen piou-pious Deutschland okkupieren.
Ich gehe heim, verlasse das populäre Ausstattungsstück des Täglichen. Doch auch noch zu Hause habe ich Unterhaltung genug, die Phantastik der Zigarettenschachteln, die Etiketten auf Parfumflaschen, märchenhafte Vaudevilleszenen auf Briefkassetten und Wandkalendern, Diplome, Reiseandenken ...
Und gar die geliebte Mappe japanischer Holzschnitte .. Halt! Zurück!... Japanische Holzschnitte sind doch anerkannt schön! Mir scheint, da habe ich etwas sehr Blamables gesagt (»gesagt« ist Ziererei ... nein, geschrieben) ... Doch die Grenze zu ziehen, das ist die Schwierigkeit dieser an sich so einfachen Sache.
Und ich sehe schon, daß die gesamte Menschheit nichts dringender bedarf als mein neues System der Ästhetik, das ich gewissenhaft und mit fast barbarischem Fleiß schon lange schreibe, jedoch an meinem fünfzigsten Geburtstage erst, das ist am siebenundzwanzigsten Mai 1934, herauszugeben felsenfest entschlossen bin. Indes bin ich schon vorher für Abordnungen der durch diesen Aufsatz besonders in Verwirrung versetzten Erdstriche zu sprechen, täglich zwischen drei und vier. Um diese Stunde sitze ich sehr behaglich zu Hause und spiele Karten mit zwei gleichgesinnten Freunden. Ach die Feerie dieser Bildchen auf den Karten übertrifft doch alles. Lockige Burschen mit müden, träumerisch-verschauten Augen turnen, kreuzen ein Schwert und ein stumpfes Rapier, trommeln, flöten, tragen stolz ihre weißen Halskrausen, die gestickten Westen. Auf Rot-Zehn schaut ein Amor ins Publikum und trifft dennoch seitlich das zinnoberrote Herz. Welches Lied spielst du, Knabe, in merkwürdiger Tracht, deinem treuen Hunde vor? Gravitätische Könige, würdevoll trotz der zu kurzen Beine, wo sind eure Untertanen, eure chimärischen Länder?... Dann legen wir den Skat weg. Und in den Taroks mit ihren Sarazenen, Albanesen auf Vorposten, mit Csardastänzerinnen, Liebespaaren in Fez und Jägerhut, jugendlichen Eheleuten, die an der Schalmei sich ergötzen, mit Wahrsagerinnen und edlen Rossen umgibt uns der Zauber der Levante, Lord Byrons, die abenteuerliche Luft der Türkenkriege, vielleicht der Kreuzzüge. Uns belustigt der heraldische Aar, der wütend seine altertümliche Devise in den Klauen hält: »Industrie und Glück.« Wir zittern für das Schicksal der edlen Dame, die zögernd den Gondoliere nicht anblickt und doch so gern entführt werden möchte ...
Ich habe mich mit modernen Möbeln im Grunde ebensowenig ernstlich befaßt wie mit den andern Dingen, über die ich so schreibe. Ich gehe meines Weges und denke eigentlich über ganz andre Sachen nach, zuweilen aber fällt mir hier und dort etwas wie zwischen zwinkernden Augenlidern auf, und dann notiere ich es, mögen andre zusehen, wie sie damit fertig werden. – Dies alles soll nicht etwa ironisch aufgefaßt werden. Ich glaube nämlich, daß in mancher Beziehung die oberflächliche Meinung wirklich besser ist als die fachmännische. Wir improvisieren nicht ohne Grund.
Gegen moderne Möbel nun trage ich seit langem eine merkwürdige Art von Haß in mir, nicht gerade gierig, eher übersättigt ... nun, man wird sehen. Ich will der Einteilung wegen bemerken, daß ich moderne Möbel a) aus Zeitschriften, b) aus Möbelausstellungen und c) aus bewohnten Räumen kenne – und habe somit den Schein der pedantischen Wissenschaft nicht minder als den des Leichtsinns schon auf mich geladen. Sehe ich nun diese Zeitschriften, deren Titel man sich durch beliebiges Zusammensetzen der Worte »Kunst«, »Kunsthandwerk«, »Innendekoration« und so weiter selbst bilden kann, so habe ich sofort die Zwangsvorstellung: »Das muß man überblättern.« Als solche erkannt, veranlaßt mich nun diese Zwangsvorstellung just zum bedächtigen Lesen und Bilderanschauen, da haben wir das Malheur. Und obwohl ich dieses abwechslungslose Zeug längst schon kenne: stets wieder stehe ich vor Villen, denen übermächtige Schindeldächer wie Hauben über das Gesicht gerutscht sind, wie Zylinderhüte über den kleinen Gernegroß. Und wieder trete ich, vor Langeweile meine Zunge mit den Zähnen zerpflückend, in diese Vorhallen oder Dielen, wo dieselbe schamlos freistehende Treppe auf denselben Kamin herabsieht ... Kurz, um es gleich hier zu sagen, wir sind einer Konvention imitierter Renaissance entflohn, aber sofort in eine andre Konvention geraten, die bedeutend unangenehmer ist, weil sie »guter Geschmack« sein und bleiben will ... Hier einige Grundeinfälle unsrer Raumkünstler, die sich zum Überdruß wiederholen: Die Wände sind mit spiegelnden Holzplatten belegt. Dazwischen hängen ein paar Bildchen, wie gemaßregelt, in Rahmen von jener impertinenten Einfachheit, die das Aufdringlichste ist, was es gibt. Hier und dort in Vasen verteilte Bäume sollen leben, aber sie erfrieren sichtlich. Um den Kamin schart sich etwas aus farbigem Marmor, Blöcke und leere Flächen, dann ein Dächlein aus Metall. Niemals fehlen Sitze, in Nischen eingebaut, von der ungemütlichsten Gemütlichkeit, zu dünn oder zu dick bepolstert; ich weiß nicht, was mich stört. Gibt es denn in diesen Familien immer etwas zu erzählen, wozu das lodernde Herdfeuer traulich paßt? Oder stehen diese Sitze leer, noch ärger!... Schaudernd treten wir in das Herrenzimmer. Ich will die Klubfauteuils nicht bemerken, sie machen es mir zu leicht. Aber diese Beleuchtungskörper, offenbar vom Juwelier, nicht vom Klempner, mit Ringen, rasselnden Ketten, strengen, geschlossenen Fransenröckchen. O Gott, speit niemand aus vor dieser erlesenen Kultur! Oder diese immerdar in die Wand versenkten Bücherkästen, hat noch niemand das traurige Einerlei dieser Novität bemerkt! Da findet sich immer Glas, dahinter schräge, müde Buchrücken wie Kornfelder nach Hagelschlägen, und immer das Glas durch schmale Holzstäbe in Rechtecke und Rhomben zerlegt. Rhomben, das ist die Hauptkunst unsrer Wohnungskünstler. Rhomben und auf die Spitze gestellte Quadrate, die in ein Netz von Meridianen und Parallelkreisen, mehr oder minder dicht, Abwechslung bringen sollen: wer befreit uns von dieser Tyrannei! Und wer zerbricht endlich diese Rähmchen- und Fensterl-Kultur, deren Vertreter nur darin originell sind, daß sie die unerläßlichen Stäbchen bald kantig, bald gerippt, bald glattgerundet anzufühlen machen ... Gehn wir weiter, über die Treppe etwa, deren Geländer als Gitter derselben ewigen Vertikallineale wie eine schräge Borte durch die Halle ziehen muß. Oben empfängt uns die moderne Schablonenveranda, unbarmherzig ein seichtes Kreissegment, die Fenster nahe beisammen, polygonal gestellt, die schmalen, vom Licht überfluteten Streifen zwischen ihnen durch die eingezogenen Vorhänge befahnt. Und wieder eingebaute Holzbänke, über ihnen breite Fensterbretter, Gesimse, und daß überall so viel bequemer Platz ist, Sachen hinzustellen und zu vergessen, das macht die Fadheit vollständig. Die Uhr versäumt nicht, an einen aufgestellten Sarg zu erinnern. Die Kredenz ist ein Grabmonument. Und daß alles so materialecht ist, daß man den Birkenwald so vor den Augen hat – es ist zuviel, es macht auf mich wenigstens den Eindruck eines ungeheuren Wasserkopfs. Ja, etwas Unheimliches liegt in der Behaglichkeit, etwas zu Fettes und zu Süßes, etwas wie verdorbener Magen. Und genau so kann ich mir nicht vorstellen, daß in diesem übertrieben hellen oder übertrieben dunklen Musikzimmer wirklich gute Musik gemacht wird.
Ich gelange zum Kern der Sache: Sollen Möbel schön sein? Kann man es wünschen, in einer Fuge von Bach zu schlafen und ein Gedicht von Goethe als noch so ästhetischen Speisetisch zu verwenden? – Nein, ich bin dafür, daß das Kunsthandwerk in seine ehemalige Verächtlichkeit zurückfalle, es verdient nicht mehr. Die Möbel seien bequem – und es lohnt sich nicht einmal, besonders lange über neue Bequemlichkeit nachzudenken. Aber wozu Brüsseler Weltausstellungen, Kulturtaten, wozu diese Pracht und dumme »angewandte Kunst« bei Sektkellereien! Ich bin dafür, geschmacklose Möbel in Massen zu fabrizieren – nicht aber der Menschheit einzureden, es lasse sich auch nur ein Funken der reinen, tugendhaften, göttlichen Schönheit, wie er etwa eine inspirierte Prosazeile Gottfried Kellers erleuchtet, so nebenher auch noch in Sesseln, Kredenzen und Türklinken einfangen. Ich will begeistert sein, edel, getragen, heroisch – nicht aber in einem lauen Mittelmaß abgetragener Ornamente und zimperlicher Vitrinen mit zufriedener fortschrittlicher Miene ausruhn.
Ich finde moderne geschmackvolle Möbel einfach unmoralisch. (Und nicht anders geschmackvolle Buchausstattungen, künstlerische Photographien, kurz: alle Mittelglieder und Vermittlungen zwischen Kunst und Alltag.)
Doch nein, etwas Schönes sind Möbelausstellungen, etwas phantastisch Schönes, von niemandem noch bemerkt. Da stehen in einem großen, prunkvollen Ausstellungspalais, in ganz kalten Riesensälen, in Nischen verteilt: nicht einzelne Möbel, nein, ganze Zimmereinrichtungen, den Blicken aller preisgegeben. Man ermesse die tiefe Komik und die Wehmut zugleich dieser Situation. Die Zimmer sind keine Zimmer, nur Nischen eines alten Riesensaales sind als Zimmer ausgebaut, und das soll man für ein gemütliches Zimmer halten. Für ein Kinderzimmer dieses hier, die Spielsachen sind auf dem Boden hingestreut wie von Kinderhänden, nicht von Arrangeurhänden – für ein Schreibzimmer dieses, der fleißige Herr ist nur für einen Moment hinausgegangen, seine junge, schöne Frau liebkosen etwa, und hat seine Feder im Tintenfaß gelassen, das offene Heft hier, die dicken, funkelnagelneuen Nachschlagewerke auf dem Regal – oder dieses für ein liebenswürdiges Speisezimmer, knapp vor dem Eintritt der Familie, alles ist schon zur Mahlzeit vorbereitet, schon die Themen der künftigen Unterhaltung lauern sprungbereit in den Schatten der Serviette, die man gleich, sofort entfalten wird. – Dieser Schein ist beabsichtigt. Und doch, wie anders, merkt es niemand, stimmt die Wirklichkeit. Traurige Zimmer, eure vierte Wand hat man eingerissen, und nun steht ihr, nur durch eine luftige, gewellte, rote Seidenschnur, durch schwache Stangen vom Gehweg getrennt, jeglichem Einbruch der Barbaren offen. Niemals werden die idealen Besitzer, deren Geister jetzt harmonisch euren unwesenhaften Raum bevölkern, niemals wird dieses märchenhafte, heroische, bescheidene Gedränge biedermännischer und ehrbarer Gestalten zwischen euren Sesseln schreiten auf zarten Teppichen, den Napf vom Ofen nehmen, in die Kanapeehöhlung sich hinflegeln. Sondern ein von euren Jugendträumen gewiß sehr verschiedenes Einzelindividuum wird euch roh kaufen, einpacken, in den Speditionswagen aufladen – und ade, reizvolles Nachdenken in ungewissem Licht. Denn auch diese Atelierbeleuchtung, die durch einen in ausgespannte Leinwand verdünnten Plafond fällt, werdet ihr aufgeben müssen, diese Aquariumsbeleuchtung, diese hellgelbe Teegebäck-Sonne. Man wird wahrhaftige Fenster in eure bisher noch geschlossenen Wände bohren, alles wird sich verändern. Traurige Zimmer, und man geht an ihnen vorbei, als wären sie schon jetzt gewöhnliche Zimmer. Indessen stehen sie auf Podien, jedes auf seiner mäßigen Holzerhöhung wie ein kleiner, wenig begabter Violinspieler, kein Virtuose etwa im Glanz der Konzerte, sondern ein armer Knabe, den reiche Verwandte für ihr Geld ins Konservatorium geschickt haben und der jetzt nach dem Diner vorspielen soll, etwas Eingelerntes mit mißklingenden Doppelgriffen. So warten sie und schauen die Betrachter an, beschämt im voraus vor lauter Angst. Und ist es da zu verwundern, daß sie ein wenig in Unordnung geraten sind, in künstlerische Verwirrung, ganz, ganz klein wenig in Lampenfieber? Nein, man kann nicht die normalen Verhältnisse von ihnen verlangen, wird sich nicht darüber bei dem diensthabenden Aufseher beschweren, daß hier eine Vase umgefallen ist – hier eine Decke sich mit dem Futter nach oben schlägt – in diesen auf Podien gestellten Zimmern. Überhaupt, alles ist ein wenig, nur unmerklich anders als im Leben. Eine gespenstische Mißwirtschaft hat sich in das sorgfältige Arrangement eingeschlichen, man kann kaum davon sprechen, z. B. daß dieses Zimmer einen Eindruck wie etwas Breitgequetschtes macht, jenes mit seinen Rosentapeten und Seidenfauteuils trotz vorgespiegelter Eleganz entfernt an eine Rumpelkammer erinnert, an ein staubiges Zusammengedrängtsein und Zugrundegehen ... Ich erschrecke. Ich glaube vor hundert Bühnen zu stehen, wo schlechte Schauspieler, als Zimmer verkleidet, unwahre Grimassen schneiden. Zitternd laufe ich an der in meiner Hand gleichfalls zitternden Seidenschnur hinaus, ich freue mich des neuen, schrecklichen Gefühls – endlich haben moderne Möbel einen Eindruck auf mich gemacht!
Wenn ich sie aber im Leben sehe, im brauchbaren Tageslicht, dann muß ich doch nur wieder lachen.
Ich besuchte auf einer Reise mehrere Schriftsteller. Und überall fand ich diese geometrischen Regelmäßigkeiten, diese Glasscheiben, die nicht flach in den Rahmen sitzen, sondern vorher noch funkelnd sich abschrägen, ehe sie münden – es sind gleichsam keine Glasscheiben, sondern riesige, simpel allerdings geschliffene Brillanten. Und überall die flache Veranda, die Metallbeschläge, die Rhomben, die weißlackierten Kästen, die das Innere der Wand wie einen Berg Sesam öffnen ... Ein Freund gar führte mich in sein von oben bis unten ganz schwarz gebohntes Bibliothekszimmer, wie eine Totenburg ragte der Bücherkasten auf, Fabrikat der »Wiener Werkstätten«. Die monumentale Einfachheit dieser Riesenkiste stimmte mich weinerlich, das muß ich schon sagen, diese Einfachheit hat zu sehr das Gigantische einer großen Geldbörse, nicht eines großen Menschen. Dieses Kolossale ist nicht wie das Meer, nicht wie eine unermeßliche Aussicht auf eine Landschaft hinab: es gleicht eher einer Fabriksmauer oder einem unliebenswürdigen Vorgesetzten im Bureau. Kurz, es macht keinen lustigen Eindruck. Aber dann, als man mir im Speisesaal nebenan zu einem Braten kleine, weiße, säuerliche Perlzwieberl anbot, brachte mich die Erinnerung an den mächtigen Schrank plötzlich zum Lachen. Erklären kann ich das nicht, konnte das zu meiner großen Verlegenheit auch damals nicht. Nur das gleichzeitige Vorhandensein eines so königlichen Brokatmantel-Kastens und dieses winzigen Gemüses mit seinem schlechten, zähen, übelriechenden, delikaten Geschmack – man muß das empfinden, oder man versteht es nicht – man muß an Mephisto neben dem langbärtigen, dummen Faust denken oder an den merkwürdigen Zufall, der manchmal passiert, wenn man ein reizendes, rotbäckiges Baby auf den Schoß nimmt.
Wie ich mir also ein Zimmer vorstelle, damit man darin nicht immer weinen oder lachen muß, sondern arbeiten kann nach Herzenslust?... Möglichst kitschig und geschmacklos, natürlich ... Ich habe mir z. B. ein Sofa machen lassen, aus rotem Plüsch, in der abscheulichsten Vorstadt-Sezession, mit einem Ornament aus gelben Dreiecken, die wie Zungen auflecken und die Bestimmung haben, wenn ich mittags zu lange schlafe, mich in den Leib zu zwicken. Mein Schreibtisch kann ohne gedrehte Säulchen, ohne imitierte Schlösser, die gar nicht für Schlüssel eingerichtet sind, ohne Balustraden und verkleinerte Palastarchitektur gar nicht existieren. So stört er mich nämlich am wenigsten, nur manchmal danke ich ihm, wenn ich ermüdet bin, durch leises Streicheln für seine diskrete Häßlichkeit. Man möge entschuldigen, daß rote Tücher flächenhaft über meine Büchergestelle niederwallen. Das soll kein Kunstwerk sein, nur das Billigste in seiner Art. Und die lange Leiter gehört dazu, die an den alten Biedermeierkasten gelehnt jede etwa reizvolle und stilechte Linie glücklich verhindert ... So ist es, ich kann nicht heftig genug betonen (denn ich nehme von diesem Thema Abschied), wie gleichgültig mir Möbel sind, und daß ich die leuchtenden Erfrischungen meiner Sinne nicht bei ihnen und nicht stündlich suche, sondern in konzentrierter Form, in auserwählten Momenten. Und das Beste für diese Lebensweise wären natürlich Möbel aus Wasserstaub, aus Luft, aus Ätherwellen. Der Leser wird schon bemerkt haben: das geschmacklose Zimmer ist mein irdisches Surrogat für das unsichtbare, das ich einmal im Himmel bewohnen werde. Da ist alles in wohltuende Ruhe übergegangen, an keine Kante stößt man an, niemals ist ein Buch oder ein Manuskript verlegt, denn in dem Augenblick, in dem ich es hinter die lautlose, gewichtlose Kastenwand stelle, ist es verschwunden, hat sich ganz einfach in Nichts aufgelöst. Und im Nichts berühren sich ja alle Bücher, alle Dinge, die man sucht, alles ist vorhanden, ohne irgendeine leiseste Spur von Nervosität ... Es klingelt. Der Briefträger ist es, und ich sehe an der Schrift auf dem Kuvert, daß eine unangenehme Nachricht von einem unangenehmen Menschen da auf mich eindringt. Keine Angst, ich ergreife den Brief, und er hat sich schon in so kristallhelle Luft verflüchtigt, daß ich statt seines Gegendruckes an meinen Fingerspitzen nur plötzliche Kälte spüre, wie wenn Salmiak verdampft ... Also wirklich, ich soll jetzt glücklich sein, ich soll nichts mehr empfinden, als was aus meinem reinen Herzen wie ein Baum emporwächst, wie ein Baum, dessen Äste von innen her schon erschütternd mein Gehirn berühren. Keine Pulte mehr, keine Federstiele, keine Schubfächer, die stecken bleiben, wenn man sie öffnen will. Mit einem Wort, kein Hindernis mehr. Vor Jubel greife ich mir an den Kopf. Aber auch der ist, überflüssiges Möbelstück, weggezaubert, und in die geöffneten Nerven klingen die Diskantchöre der Sphären.
Dank den Bemühungen einiger Schriftsteller, aus deren Liste mir augenblicklich die Namen: Marcel Prévost, Auernheimer, Maupassant (welch ein Zufall! gerade diese) einfallen, haben wir jetzt einen Typus der modernen Frau, einen Grundriß des Weiblichen. Gott sei Lob und Dank, ein Schema ...
Also: die Frau ist naschhaft, immer lüstern nach Sensationen und zu Sinnlichkeit aufgelegt, der Grausamkeit nicht abgeneigt, hysterisch, begeisterte Lügnerin, eifersüchtig auch noch auf den Mann, den sie nicht mehr liebt, mäßig begabt im Geiste und für theoretische und zarte Probleme gänzlich ohne Interesse (nur Neulinge langweilen sie damit, Erfahrenere gehen direkt aufs Ziel los), dafür in der Praxis der Liebesangelegenheiten dem Manne weit überlegen usw. Diesem Typus »Frau« entspricht ein Typus »Frauenkenner«. Frauenkenner ist, wer in jeder Frau den Typus »Frau« mit scharfem Auge wiederfindet. Frauenkenner sind vornehmlich die genannten Dichter ...
Ich ziehe es vor, ein Frauen-Nichtkenner zu sein.
Warum?... Ganz einfach, weil es mir mehr Vergnügen macht.
Wie geradlinig und schlicht wäre die Welt, wenn alle Frauen mehr oder minder dem Schema sich näherten. Vielleicht waren es beste Glücksfälle, daß gerade ich immer (nein, nicht immer, denn auch das wäre zu geradlinig; aber sehr oft geschah es) mit Frauen ganz anderer Artung zusammengetroffen bin. Ach, in Gesprächen, die so seltsam und ohne Bezug auf Dinge dieses Lebens waren, daß sie nur aus Schabernack noch in irdische Worte gekleidet schienen, gingen wir stundenlang um runde Wasserbassins aus indigoblauem Marmor, kauften Bretzel und fütterten die ruckweise auftauchenden Fischmäulchen. Es waren Spiele, sanfte Spiele, wir dachten keinesfalls an Regeln, Bedürfnis und Ordnungsliebe.
Ein einziges Mal war es mir vielleicht bestimmt, den Typus Weib zu sehen. Aber der trübe, regnerische Abend, an dem das geschah, verbietet mir, mich allzusehr auf meine Erinnerung zu verlassen ... Es geschah dies in einer Hafenstadt wertlosen Namens ...
Ein kleines Torpedoboot war eingelaufen, und nun lag es, müde und schmutzig, an der Holzverschalung des Ufers. Der gedrungene, dunkle Schornstein, der schief zurückgelehnt stand wie der Kopf eines, der sich ekelt, blies seinen letzten Rauch aus. Eine Weile verging ruhig. Ich dachte an einen gestrandeten schwarzen Vogel. Dann wurde das Brett angelegt und einige von der Bemannung verließen lustig das Schiff, große, braunrote Leute mit kühnen Augen, in breiten, wallenden Hosen, Blaublusen, tief dekolletiert, eine rote, dicke Bindkrawatte unter dem Matrosenkragen gewulstet ... Nun konnte man an Bord gehen, und viele aus dem Hafen taten es aus Neugierde. Auch ich bestieg das enge, gewölbte Verdeck, machte schmale Schritte, da ich immerfort an Schrauben, eiserne Scheiben, Hebel mit dem Fuße anstieß. Die Damen hoben ihre Röcke, denn alles war vom Regen naß. Während die Mannschaft, die in weißen Arbeitskitteln auf dem Schiff geblieben war und eifrig an der Wäsche seifte oder sie an Stricke zum Trocknen hängte (es regnete aber immer noch ganz fein), um die Gäste wenig sich bekümmerte, zeigte uns ein junger, freundlicher Offizier die Hängematten, den kleinen Schlafraum in der Vertiefung des Vorderdecks, das imponierend-drehbare Maschinengewehr, die Falltüren zur Kapitänskajüte und zur Munitionskammer, die unverständlich große Dampfmaschine unten, die Ventilationsluken, die verderblichen Lancierrohre ... Er erzählte lächelnd, daß solch ein Torpedoboot so und so nahe, sehr nahe, an den Feind heranfahren muß, um sein Geschoß abzufeuern. Und das ist gefährlich, die Scheinwerfer spielen und sehen, man riskiert sein Leben ...
Neben mir steht eine hohe Blondine, sehr fahl im Gesicht, mit fast weißen Augenbrauen über den dunkeln Augen. Hart und gierig sieht sie den freundlichen Offizier an, und während der Wind rauschend über unsere Köpfe fährt, kommen aus der edlen, rosigen Kurve ihres Mundes diese Worte: »Sind Sie schon einmal in Lebensgefahr gewesen?«
Der Offizier enttäuscht sie sichtlich, da er mit »Nein!« lächelnd und wie ein sympathisches Kind antwortet.
Er geht weiter uns voran und zeigt uns das Rettungsboot. Mißmutig streicht die Blonde über die nassen Planken von weißer Lackfarbe. Der liebe Offizier erläutert den Kran, die Kommandos, er führt die Schwimmwesten aus Kork vor, die numeriert sind und schon dadurch ein wohliges Gefühl von Geborgenheit einflößen, er sucht uns wirklich auf alle Weise über das Schicksal der tollkühnen Angreifer zu beruhigen.
»Aber nein,« schreit die Blonde, grell, enttäuscht, »da können Sie ja überhaupt gar nie in Lebensgefahr kommen!«
Alle sehen sie verdutzt an. Ich halte mich zitternd am Kompaßständer fest.
Der Offizier verbeugt sich gefällig gegen sie, und so gut (ich liebe ihn schon wirklich) sagt er: »Nun, es ist ja allerdings doch nicht für uns alle Platz in dem Boot, Gnädigste.«
Sie wendet sich ab, ich bemerke noch, wie sie erleichtert und mit krankhaftem Zucken der Nasenflügel zu weinen beginnt. Der braune Wind rauscht, die benachbarten Schiffe schaukeln ein wenig, es ist fast Nacht ...
Also, das war der Typus »Frau«, sensationslüstern, grausam, hysterisch ...
Lieber Gott! wie mich diese Hysterie schon langweilt! Vielleicht brauchte ich nur die Augen aufzumachen, um mehr von diesem Typus zu sehen. Aber ich will gar nicht. Es ist ja so angenehm, liebenswürdige Haltungen des Kopfes vor den Augen einer Frau einzuüben, mit ihr über die Farbe einer Wolke zu streiten, gelinde, gelinde natürlich, das Dessert für übermorgen und die Mode unserer Urenkel zu beraten, nichts als zwecklose Dinge. Wie gesagt, ich ziehe es vor, ein Frauen-Nichtkenner zu bleiben ...
Mein lieber Feind,
bisher bist mein Freund Du gewesen, aber mein gehaßter Freund. Und von diesem Haß, den Du vielleicht nie geahnt hast, wird heute noch viel die Rede sein ... Vorläufig das eine: sei statt dessen, was Du mir bisher warst, lieber mein Feind; mein lieber Feind, wenn Du willst.
Seit vier Jahren, seit wir einander kennen, ... verkennen wir einander. Unausgesetzt hast Du mich mißverstanden, unermüdlich. Du hast mich mißverstehn wollen, das ist das Schlimme, und daß es dir auch gelungen ist, nur eine nebensächliche Verschärfung ... Erinnre Dich nur, was für merkwürdige Eigenschaften, die ich ganz und gar nicht besitze, Du in mir entdeckt hast. Vor allem ist Dir immer meine Feinheit bewundernswert gewesen, meine zarten und eigentümlichen Fingerbewegungen, »diese Aquarelle von Liebesstunden, die Mousseline des Benehmens, die Zierstücke seltsamer Einflüsterungen« ... Nun wisse (Du weißt es schon längst, immer), ich bin gar nicht so vornehm geartet, bin gar nicht so eigentümlich. Ich würde es für beleidigend halten, wenn jemand eine kultivierte Frau mich benennte. Ich bin eine schöne Frau, weiter nichts. Mein Äußeres ist mein Tiefstes, wirkt als einziger Schatz um so glänzender vor dem im übrigen schattigen Hintergrund meiner gewöhnlichen Persönlichkeit ... Und ich verzichte gern darauf, den klügsten Männern ebenbürtig und Arbeitsgenosse zu sein. Da ich sie beherrschen kann.
Du hast mir ferner eingeredet, ich sei gut. Nicht im Sinne der herkömmlichen Sittlichkeit, die ich um Deinetwillen oft gering schätzte. (Und das tut mir auch heute nicht leid, das nicht.) Aber ich sei brav, sagtest Du, von Mildheit zukünftiger Generationen erfüllt, dem kategorischen Imperativ einer bessern Welt gehorsam. Und so unschuldig sei ich, sagtest Du ... Was für Unsinn. Ich lehne es entschieden ab, unschuldig zu sein. Unschuldige Frauen sehen dumm aus. Und nur die Schuldigen wissen Mienen von Unschuldigen zu tragen.
Du dichtetest mir an, ich sei treuer als die andern; Du ließest mich unkokett sein (unschädlich mithin für Dich und weniger zeitraubend. Wie fein war das eingefädelt.)
Meine Redeweise, ehe ich in den Verkehr mit Dir geriet, war höchst läppisch. Ich gefiel mir in Witzen, in Wortspielen, in Stacheln und Qualen ... Du hast als mir eigentümlich mir eine Lyrik der Sätze beigebracht. Glockentöne in der Stellung der Vokale und durch merkwürdige Drehungen der syntaktischen Fügung erzeugte Melodien. Weil es Dir gefiel, im Sommer abends am Flußnebel unklare Gespräche, geschmückt mit sehr langen Pausen, zu haben, deutetest Du meine Ratlosigkeit damals als ein Schweigen infolge verständnisvoller Stimmung. Ohne Unterlaß hast Du mich umgedeutet. Immer hast Du nur das an mir gesehn und gehört, was Du hören und sehn wolltest ... So oft war ich trivial, meiner Natur nachgebend, habe alltägliche Dinge gesagt, ganz einfach Sprichworte, moralische Lehren aus dem Abreißkalender. Und Du bliebst auch dann stets noch heuchlerisch genug, diese dummen Redensarten in Entzückung einzufangen, die durch meine Lippen in Schwingung versetzte Luft mit kostbaren Ausrufen der Freude zu umrahmen. Du wolltest mich glauben machen, ich sei Dir ebenbürtig, ganz von selbst fließe mir eine Welle bedeutsamer Ansichten unversieglich zu und alles, was ich rede, klinge reizend, sanft und entrückt ... Und Deine bestimmten Entgegnungen, wenn ich mich weigerte, wenn ich sagte, Du überschätzest mich! Deine manchmal beinahe überzeugenden Zwischenrufe, wenn ich im Zuge war, meine Werktäglichkeit zu beichten!...
Ohne darüber nachzudenken, daß ich vielleicht mir eigentümliche Vorzüge haben könnte, hast Du mir kurzwegs einige Vorzüge nach Deinem Geschmack obenauf angeschminkt. Du hast retouchiert. Schließlich war ich eine Vollkommenheit von Deinen Gnaden, ich danke schön.
Wenn Dir nur jemals irgend eine lebenskräftige Dummheit entschlüpft wäre! Aber nein, selbst Deine Dummheiten waren hübsch anzusehen, verzeihliche Streiche eines liebenswürdigen Kindes. Wenn Du mich nur jemals gelangweilt hättest! Aber nein, Du hast mich immer entzückt. Das verträgt keine Frau.
Wie ich Dich immer gehaßt habe! Mein Gott, wie ich Dich gehaßt habe!
Wenn ich so zu Dir kam, ein fehlerhafter Mensch, aber doch ein Mensch; frischauf atmende Lungen, ungleichmäßige Herzschläge, Finger voll Gift, boshaft-lebendige Wangen ... wenn ich die Treppen zu Deiner Wohnung hinaufstürmte, mit dem festen Entschluß, heute Dir alles ins Gesicht zu schreien, Dir ins Gesicht zu schreien: Liebe mich, aber liebe mich endlich einmal so gemein, wie ich bin!... und wenn ich dann die Türe öffnete, die schauspielernde Luft Deiner Zimmer, den Dunstkreis des Unendlichen eintrank ... dann war alles wieder vorbei ... Wir sahn als zwei seltsame Menschen einander in die Augen, ich war bezaubert, ich war nach Deinem Wunsch. Wohin versanken da die Entschlüsse, die Selbständigkeiten ...
Ein umgekehrter Fall der Nora: wie gern wäre ich die Puppe geblieben! Aber Du wolltest mich jedenfalls zu Gott weiß was Besonderem machen.
Ja, ich war glücklich ... Welch eine sichere Zeit atmete ich bei Dir, nichts konnte mir etwas anhaben. Wir besprachen dies und jenes. Wir stellten zwecklose Dinge an. Wir küßten einander in aller Liebe, aber immer ein wenig pierrotmäßig. Alles war ein Spaß, ein Luftzug, eine Frage. Und die brutale Realität schien entfernt, das Leben ein klein-harmloses, unzerreißbares Bilderbuch nur ... Und o! wie hast Du es immer abgewehrt, wenn ich Dir sagte: Du betrachtest das Leben als einen Spaß. Das durfte nicht ausgesprochen werden, durch so grobe Konstatierungen wären wir schon wieder ins Reich des Tätlichen gerückt. Daß Du das Leben wahrhaftig als einen Spaß betrachten konntest, wurde nur dadurch ermöglicht, daß Du immer behauptetest: O nein, ich nehme das Leben sehr ernst ... Wie wunderbar warst Du oft durch das, was Du verschwiegst. Und nicht einmal das ließest Du zu, daß man Dein Verschweigen bewundere. Einen Firnis von Schlichtheit, Ungeschicklichkeit sogar legtest Du über Deine feinsten Dinge. Und durch graziöse Schnörkel des Schweigens und Sagens hieltest Du uns beide beständig in der Höhe, über den Wahrheiten. Nie machten wir einander Geständnisse. Nie waren wir intim und vertraut. Aber wenn ich zu Dir kam, verschwanden alle meine Sorgen, machten alle Befürchtungen ein unwichtiges, fast drolliges Gesicht. Gerade dadurch, daß Du mich nicht tröstetest, tröstetest Du mich ... Und wie schön, wenn wir uns Mühe gaben, einander näher zu kommen! Diese Selbstbekenntnisse geschahn so unwegsam, in einer so verzwickten und schwierigen Manier, daß wir einander immer nur noch verhüllter, interessanter wurden. O diese fluoreszierenden Auseinandersetzungen, diese Erleuchtungen ohne Halt, diese unrichtigen Klarheiten und diese Unklarheiten!
Wie glücklich war all dies!
Wie ich dich immer geliebt habe! Mein Gott, wie ich Dich geliebt habe!
Ach, vielleicht ist es ein Unrecht, daß ich diesen Brief Dir schreibe. Gewiß tue ich Dir Unrecht, denn Du warst immer gut zu mir ... Und jetzt verwirrt sich mir alles. Als ich diese Zeilen begann, war mir unser Verhältnis so klar, so schlimm, so verächtlich. Ein Magazin von Kontrasten und Angriffen stand mir zur Verfügung ... Wie kommt es, daß in diesem Augenblicke verschwimmende Gebirge über mich stürzen, rosige Bergketten vom bewegten Horizont her, Zweifel, Subtilitäten ohne Zahl ...
Vielleicht ist alles, was ich Dir heute schreibe, auch nichts anderes als solch eine fluoreszierende, verzwickte Auseinandersetzung, durch die wir einander nur noch interessanter werden?...
Ich will nicht darüber nachdenken. Aber eines: Habe Mitleid mit mir! Mitleid! Und wenn auch gerührte Leidenschaft, Verständnis für Tragik Deine Sache nicht ist .... aus Mitleid begreife dieses eine Mal die nackte Wahrheit, den großen Ernst der Tatsachen, die Schrecken meiner inneren Krisis. Gib mich frei. Gib mich endlich frei. Ich will Dir nie mehr schreiben. Ich will Dich nie mehr sehn. Es ist mein fester Entschluß, mich nicht länger von Dir beeinflussen zu lassen. Ich bitte Dich, vergiß mich oder sei mein Feind. Gib mich frei!
Anfissa.
Du vergißt doch nicht, Liebste? Morgen um 6 Uhr bei der Apollinariskirche.
Dein Carus.
Ach wie auf Erden nichts, wie nichts auf Erden gleicht den Schauplätzen angenehmer Begebenheiten! Das Postamt war rot. Gleichfalls die Kirche machte kein Geheimnis aus ihren deutlichen Ziegelsteinfugen. Von da in den Kurpark reichten wenige Schritte. Und man erging sich in diesem ohne jegliche Verantwortung, dem Bewußtsein ungerechten Vorzugs fremd, wiewohl die vielfach krummen Wege so zeitverschwenderisch waren und die reichlichen Seelüfte darin eine ganz unverdiente Belohnung für uns Müßiggänger. Daran dachte man nicht; o die Schauplätze angenehmer Begebenheiten. Weil's mir damals gut, so richtig gut ging, fiel mir nie es ein, die Anlage dieses Parkes auf Steuern und Taxen, seine freundliche Abwechslung der Gebüsche, Wiesen und Bauminseln auf ermüdende Studien ausländischer Werke über Hortikultur, die Kinderfeste auf geschäftstüchtige Tricks der Badeverwaltung und Toiletten der Damen auf Berufspein ihrer Ehemänner zurückzuführen; kurz alles auf das ökonomische Prinzip. Sonst erscheint mir doch die Welt so gnadenlos betrieblich und zielbewußt, im Dunst des Arbeiten-Müssens, von Fabrikswaren besetzt. Damals jedoch bewegte sie sich liebenswürdig. Und als ich einmal, von irgendwelcher Bank aus ganz ferne Kurmusik zu hören bekam, verübelte ich dies niemandem, sondern ich hörte gut zu und staunte nur ... Das Stück, auf seinem Wege durch die Bäume her zu mir, hatte Blättergrün und Zweige, Tau, Sonnentupfen in seine Töne mitgenommen, sie wehten gefärbt und aufgefrischt. Das Herablassen einer Persienne im Hotelfenster links blinzte aus ihnen, mit den Spatzen des Sandwegs und mit dieser Vormittagsstunde in Südostbrise. Mein Herz klopfte. Wie ein hinter erglühender Luft bebendes Gebäude, wie ein Shawl in Bewegung, aus dem die eingewebten Metallstücke glänzen, standen die Akkorde vor mir, wie das Laforguische je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue, de même que la voix du sang ... Indessen erkannte ich das Stück nicht, wiewohl es mir geläufig war. Ich ging zwischen seinen kontrapunktischen Stimmen wie zwischen Häuserfronten, und es war wie in der Heimatstadt manchmal, wenn man aus einem neuen Durchhaus tritt oder von ungewohntem Standpunkt her beobachtet. Alles ist fremd und dennoch alles vertraut. Ich weiß, daß ich zu Hause bin und dennoch kenne ich mich nicht aus. So vergißt man auch bisweilen, aus Träumen nachts erwachend, die Lage der Fenster, die Wand am Bettrand, rechts und links im Dunkel. Jeden Augenblick kann die richtige Orientierung einfallen, mit einem Schlag alles ins gewöhnliche Licht ordnen, aber das zieht man in süßer Qual hinaus, absichtlich verwirrt man sich und ist in fremder Stadt, in fremdem Bett. Endlich längs eines Geigenlaufs schwinge ich mich in die Erkenntnis, daß ich die Meistersinger-Ouvertüre vor mir habe ... So wohlgetan hat sie mir schon lange nicht, seit ich vor Jahren mit ihr bekannt wurde, seit den ersten Entzückungen nicht mehr. Ich sitze da und, gerührt von jeder Modulation, danke ich dem lieben Gott für sie. Manchmal überrascht mich so die Musik, wie aus einem freundlichen Hinterhalt, und das wollte ich sagen: dann findet sie die Seele ganz anders offen als im Theater oder in den zweckdienlichen Konzertsälen. Zufällig kommt sie, Wind trägt sie her und löscht sie aus, Sonne wie über die Alpen gießt sich über Melodien. Niemand bietet mir Programme an oder das mit einer harfenschlagenden Dame gezierte Titelblatt eines thematischen Leitfadens. Keine Vor- und Nebensitzenden, keine Presse, keine Bonbons, nicht Gucker, nicht Begeisterung, nicht gemachte Begeisterung und keine aus Furcht, die Begeisterung könnte gemacht erscheinen, gemachte Nicht-Begeisterung. So natürlich geht alles und nicht einmal stolz sein auf seine Natürlichkeit kann man. Man hat weder Zeit, sich in Frack, noch aus Protest gegen Zeitvergeudung bei der Toilette nicht in Frack zu werfen. Einfach wird man vom Genuß attackiert, auf kurzem Wege vergewaltigt ...
Himmlisch! auf der Straße entzückt es mich, wenn ein Vorübergehender nicht ganz richtig die inniggeliebte Barcarole ans »Hoffmanns Erzählungen« pfeift ... Der Cafetier läßt seinen Phonographen losknirschen, ich verliere die Zeitung aus der Hand, denn so süß wie nichts mischt sich in das Klappern der Tassen und in Geflüster von andern Tischen her die Arie der Tosca ... In einer fremden Stadt hörte ich einmal ein Bach-Präludium, sehr gut auf einem jedoch schlechten Klavier (die Töne knatterten so) vorgetragen. Nie werde ich vergessen, mit welcher Freude ich damals in das gegenüberliegende Haus trat und zu dem offenen Fenster hinaufhorchte. Ich hörte auch noch die Fuge an und ging dann in Glück meiner Wege ... Begeistert bin ich für Nationalhymnen der Soldaten, die zufällig unten meinem Fenster vorbei in die Schlacht marschieren ... für die angstvoll asthmatischen Klänge eines Leierkastens auf verlorener Landstraße, die an den Geruch doppelt gewärmten Dorfkaffees erinnern; der Mann beginnt zu kurbeln, wenn er uns von weitem herannahen sieht, und zwar genau dort, mitten in einem Doppelschlag meinetwegen, wo er aufgehört hat, als er den Wanderer vor uns genügend weit mit seinen Tönen geleitet erachtete ... Ich liebe auch die städtischen Flaschinetts, hohlflötend und scharf; die Musik alter Ringelspiele; Orchestrions mit Janitscharenmusik; wispernde Aristons mit ihren Stahlbürsten, die plötzlich vom Wäschekasten herab oder beim Öffnen eines Stammbuchs einem Glockenspiel ähnlich erklingeln; die Berlioz-Instrumentation der Straße zur Singstimme eines fensterputzenden Dienstmädchens ... Oder ich ziehe mit den Gabelzinken in gestehendes Fett der Schöpfenbratensauce Kratzrinnen, die ich dann zu wohnlichen Gassen mit Häusern, groß und klein, mit Verkehrshindernissen und Volk zu vergrößern weiß. Das bringe ich fertig. Ich vergrößere auch oft das Eßzeug in Gedanken, mache aus dem Tisch eine weite Ebene, beschneit infolge des weißen Tischtuchs, die Teller sind wie Gebirge, die Messer, Gabeln, Löffel wie silberblinkende Seen, sicher wie ein Glaspalast steht mitten in weiter Einsamkeit das Salzfaß. Dazu summe ich gewisse Schlußsätze von Brahms, zum Beispiel den aus der Cellosonate F-Dur op. 99 oder aus dem Streichquartett (oder ist es ein Quintett?) G-Dur. Er geht so ... Könnte ich ihn doch allen vorsummen, die mir nicht glauben wollen, daß er in diese traute, friedlich im Familienkreis dämmernde Kinderstuben-Vergrößerungsstimmung (ich nenne sie auch Knecht-Ruprecht-Stimmung, aber ich weiß nicht, warum, und ich denke dabei auch an Marktbuden am Abend und Spielzeug aus farbigem Holz) einzig schön hineinpaßt ...
Das sind meine Vergnügungen.
Nun will ich, bitte schön, nur kein Programm daraus machen, keinen Antrag auf Umstürzung unsres gesamten Konzertlebens, keine Aktion mit dem Motto: »Aufgepaßt! Sie können sich noch retten. Es ist höchste Zeit, daß etwas für unsere Kultur geschieht!« ... Das liegt nicht in meinem Sinn.
Ich habe nur meine Notizen gesammelt, von deren Belanglosigkeit leider für das praktische Leben ich aufrichtig überzeugt bin, und gebe sie hier zum besten.
Von allen Tatsachen des Seins, die man zu szenischer und dichterischer Behandlung in Anspruch genommen hat, scheint sich der Tod als die unfruchtbarste erwiesen zu haben. Die Idee des Todes dient dazu, um die Romane oder Trauerspiele abzuschließen, abzuschneiden nur in manchen Fällen, sie soll schrecken und erhabene oder auch wohl groteske Ausblicke gewähren (»Der Tod ist in der Welt« – Byrons »Kain«) oder bestenfalls wie im »Hamlet« dazu dienen, die philosophischen Spielereien eines Grüblers zu veranschaulichen. Wo der Tod auftritt, zeigt er sich in einer dieser drei Gestalten. Einfach und banal. Das richtige Nichts, über das auch nichts zu sagen ist. Was jedoch nicht ausschließt, daß er bei Publikum und Kritik in beinahe ebenso hohem Ansehen steht wie andre banale und leere »große Ideen«, zum Beispiel: der Pantheismus. Braucht es doch heutzutage nur des leisesten Verdachtes, daß ein Dichter »Pantheist« ist und den großen Zusammenhang der Natur fühlt, die Natur in sich, sich in der Natur, und wie alle die bereitstehenden Floskeln heißen, um ihm sofort den Ruf eines großen Tiefsinns und göttlichen Ernstes zu verschaffen, wie denn auch ganz Deutschland auf Verhaeren prompt hineingefallen ist.
Stellen wir also fest: man hat den Tod trotz aller Pflege bisher vernachlässigt. Man ist von ihm zu sehr geblendet, läßt sich zu sehr imponieren. Immer nur Tod als etwas Großes, Abschließendes, Langweiliges, ... das kann doch nicht alles sein. – Doch nun fällt mir der Übergang schwer. Soll ich sagen, daß ich, um dem dringenden Bedürfnis einer detaillierteren, ruhigeren Dichterbehandlung des Todes abzuhelfen, auf die nachfolgenden Dinge verfallen bin? Wie unrichtig wäre das! Fasse man vielmehr das Bisherige als ungeschickte Einleitung auf, zu der mich die innere Erregung über das Nachfolgende, das mich natürlich zunächst beschäftigt, verlockt hat. Ich habe da wirklich Merkwürdiges zu berichten; man kann mit der Idee des Todes ganz familiär werden, das ist's, oder noch besser: sie ist ebenso aller Abschattierungen vom Traurigsten zum Süßesten und Gleichgültigsten fähig wie alle menschlichen Dinge.
Da lese ich, an einer Straßenecke wartend, ganz zerstreut, nur durch das farbige Bild angezogen, folgenden Witz (das tschechische Witzblatt, das ihn enthält, hängt aufgeschlagen hinter der Glasscheibe eines Buchhändlers):
Ballerine: Du, und was sagt denn dein Vater eigentlich zu unserem Verhältnis?
Junger Herr: Er weiß doch nichts davon.
Ballerine: So, wird denn bei Euch keine Bilanz gemacht?...
Das habe ich gelesen und starre nun in die Luft, den Passanten entgegen. Es ist schwer zu beschreiben, was da in mir vorgeht ... Ich suche diesen Witz zu begreifen, denn ich verstehe ihn nicht. Ich suche, indem ich mein Hirn umwühle, irgendeinen Standpunkt zu finden, von dem aus mir das eben Gelesene irgendwie auffallend, bemerkenswert, stark, wertvoll oder amüsant erschiene. Es muß doch etwas daran sein, sage ich mir, sonst würde man es nicht drucken, illustrieren, in der Hauptstraße ausstellen. Aber trotz aller Anstrengungen verschwimmt es mir, erscheint matt und von einer krankhaften Farblosigkeit. Wäre es ein Mädchen, ich müßte es als »krankhaft-interessant« oder so ungefähr bezeichnen. So zart und blaß steht es (ich meine: den Sinn und die Gesamtheit dieser Worte) im Hintergrund meiner Gedanken, opernhaft bescheidene und doch jedenfalls temperamentvolle Mignon! Ich empfinde eine krankhafte Wollust, so an der äußersten Peripherie meiner Denkfläche gekitzelt zu sein, dort wo mein Verständnis aufhört und nur noch unscharfe Bilder liefert. Mit wissenschaftlichem Interesse förmlich verfolge ich das Erlahmen meines Denkmechanismus, wie etwa der Experimentalpsychologe die geheimnisvollen Vorgänge am Rande des Sehfeldes prüft. Ich beobachte, wie mein Verstand dieses ihm Dargebotene, das zu weit abliegt von den Dingen, mit denen er sich sonst befaßt, nicht mehr fassen kann, es mit andern Dingen verwechselt, daran herumarbeitet, schließlich kraftlos es in den allgemeinen Trubel der Welt, aus dem er es für einen Augenblick hervorgezogen hat, zurückfallen läßt. Und ganz deutlich mischt sich in das Gefühl der Schwäche und Ermüdung nun eine Art von humoristischer und doch wehmütiger Todesahnung, die ich eben beschreiben will ... Doch auf diesem Wege komme ich ihr nicht näher. Vielleicht anders.
Manchmal, wenn ich so recht müde bin, in der Nacht – in einem Kaffeehaus ist man schon ohne Erfolg und ohne Lust gesessen, jetzt freut man sich auf das kühle Bett zu Hause, aber wieder fällt es zum Unglück einem Kameraden ein, ein anderes Lokal vorzuschlagen und aus Mattigkeit kann man nicht »nein« sagen, läßt sich wieder aus der reinen Nachtluft in lärmenden Rauch verschleppen – in solcher, tieftrauriger und wohl auch erbitterter Abgeschlagenheit, wenn die Augen beißen, die Lippen weh tun, erscheint jenes Todesgefühl wieder. Und wieder in der Form, daß ich mein Vermögen, Dinge aufzufassen, schwinden fühle. Ich kann zum Beispiel nicht mehr feststellen, ob der schwarze Fleck auf der Sessellehne jenseits des Tisches ein Ornament dieser Lehne ist oder etwa ein Teil des dunklen Anzugs meines Freundes oder vielleicht etwa ganz weit hinten im Saal, ein Stückchen Klavier, das perspektivisch über die Sessellehne ragt. Ich kann das nicht feststellen, weil ich keine Lust, keine Berufung dazu fühle. Lasse lieber einen unanalysierten, unreinlichen Komplex in meinem Gehirn. Man reicht eine komplizierte, glänzende Schüssel auf den Tisch, allerlei Farbenflecken sind auf ihr, vielleicht Backwerk, und ein dumpfer Lärm brandet um sie her, aus ihr heraus, sollte sie ein Musikinstrument sein? Ich kann sie nicht mehr auflösen, ich bitte einen neben mir, das Zweckdienlichste in bezug auf diese Schüssel oder was es sonst ist, zu unternehmen, nur mich in Ruhe zu lassen. Es ist der tiefste Punkt der Erschlaffung. Der ganze Körper ist eine einzige, müde, wunde Fußsohle ... Und da denke ich mir nun: »Max, jetzt bist du tot. Vielmehr, du warst tot und bist jetzt soeben wieder zum Leben aufgeweckt worden. Da bist du jetzt natürlich ganz ungeübt, unbeholfen, elementar. Nur die einfachsten Dinge des Lebens sind dir im Gedächtnis geblieben, nur solche, die dir im Leben das Wichtigste waren. Fragte man dich beispielsweise jetzt nach Flaubert, da würdest du noch etwas wissen, wenn auch nicht so viel wie in deiner Blüte. Auch Worte wie: Geliebte, Vaterland, Mutter – wären dir zur Not verständlich, gäben dir etwas zu fühlen. Aber diese Weinstube? Waren dir jemals in deinem früheren Leben Weinstuben wesentlich, zentral? Nun ist aber nur der Mittelpunkt deines Ich erst erwacht, auf das andere sollst du dich erst allmählich besinnen, und da kommen solche barocke, willkürliche Einrichtungen wie eine Bar mit hohen Sesseln noch lange nicht an die Reihe. Dies, Max, die Erklärung deines gegenwärtigen Zustandes. Du hast dich zu nebensächlichen Eindrücken zu entwickeln noch nicht Zeit gehabt. Also schlafe, schlafe nur ruhig ...«
Ich habe auf diese Art im höchsten Grade die Eigenschaft, mich geistig tot zu stellen und so zu vereinfachen ... Plötzlich mitten in meinem Treiben findet sich mir die Frage ein: Was würde ich zu dieser Sache sagen, wenn ich soeben aus dem Grabe entstiege? Oder noch verschärft: Was würde jemand zu dieser Sache sagen, der nur für einige Augenblicke aus der tiefen Ruhe des Jenseits hierher versetzt würde und gleich wieder weg müßte? Hierher, zum Beispiel vor die Oper in Paris? Welchen verworrenen Eindruck, welchen falschen, müßte er sich von diesen Dingen machen?... Oder noch anders: ich liege halbschlafend nachmittags auf dem Kanapee, da weckt mich leise, falsch gespielte Salonmusik, die mir nie das Geringste bedeuten kann. Und doch, wie dankbar wäre ich für diesen leeren Fetzen Realität – ein Jahr nach meinem Tode, wenn ich plötzlich erwachend nichts als eben dieses Stück hören könnte, diese Erinnerung an meine ehemalige Existenz. Und wie würde sich diese Musik in einem solchen Moment meiner Seele ausmalen? Ich könnte mir vielleicht im Augenblick nicht herauskonstruieren, was das »leise« »falsch gespielte« »Salonmusik«, was das überhaupt bedeuten soll »Schallwellen« ... Es ist köstlich, für einen Moment mit Hilfe dieses Tricks (ich bin tot, soeben wieder erwacht) alle die komplizierten Erfahrungen, die man hat, preiszugeben, sich selbst gleichsam in einen Urzustand zu versetzen und nun zwischen den fein ausgebildeten Lebensdingen ratlos umherzutappen wie in einem ungeheuerlichen Chaos, in einer ganz sinnlosen Rumpelkammer ... Wir üben jetzt ein Quintett. »Noch einmal drei Takte vor M«, schreit einer wütend, weil es nicht klappt. Ich weiß sofort, was er meint. So eingefahren bin ich in diese, von mir doch so wenig notwendig erlebte Konstellation. Was würde von all dem Herumsitzen, Stimmen, Plaudern, Sich-Anstrengen übrig bleiben in meinem posthumen Gedächtnis? So zieht man ein Schema seines Daseins, um dann mit doppelter Lust vorläufig noch das Unschematische weiter zu genießen.
Das Thema dieses »posthumen Gedächtnisses« hat noch einen Ausläufer. Ich habe nämlich schon zu Lebzeiten ein teilweise posthumes Gedächtnis ... Zur Erklärung: Die Symphonien Beethovens, die Königsdramen Shakespeares, die Violinsonaten von Bach, Brahms und Reger gehören doch zu meinem essentiellen geistigen Besitzstande, glaub' ich. Näher geprüft, ergibt sich, daß ich sie nur deshalb zu besitzen meine, weil ich sie periodisch immer wieder durchnehme. Aber jedesmal bin ich doch wieder von ihnen überrascht, entdecke neue, schon halbvergessene Schönheiten. An den Percy Hotspur hatte ich schon beinahe ganz vergessen, da ist er wieder, willkommen, mein Held, denkst du noch an unsere letzte Begegnung vor drei Jahren, in drei Jahren also auf Wiedersehen!... Aber mein Glauben, daß ich alle diese Dinge und noch einige andere, mir unentbehrliche, zu jeder Zeit im Kopf habe, ist doch nur Fiktion. Dadurch entstanden, daß ich sie jeden Augenblick wieder auffrischen kann ... Wenn ich aber nun sterbe, dann ist doch diese Hoffnung auf weitere Periodizität zu Ende. Dann kann ich nichts mehr auffrischen. In diesem Moment weiß ich nur das, was mir gerade aktuell (nicht nur potentiell) im Kopf ist. Und ein großer Teil, ja der größte der Dinge, die ich liebe, wird also schon lange vor mir gestorben sein; – zu jener Zeit, da ich eben nichts ahnend zum letztenmal die Percyszenen gelesen habe und ihre Details vergesse, sterben sie. Diesmal ist es ein Vergessen für die Ewigkeit ... Mit einem Satze: ich kann nicht in einem Moment meiner vollsten Ausbreitung sterben. Ich sterbe allein, ohne meine liebsten Lebensbegleiter. Sie haben sich schon längst, zu verschiedenen Zeiten von mir verabschiedet, allmählich, einer nach dem andern, ohne daß ich es bemerkt habe. Vielleicht ist heute, während ich dieses schreibe, schon ein Teil meines Ich, meines Wissens und meiner Gefühle tot, tot für immer und ich weiß gar nichts davon ... Diesen Zustand immer vor Augen, ist es da ein Wunder, daß ich den Erlebnissen meines Daseins mit einer überzärtlichen Hingabe entgegenkommen möchte, daß ich sie immer, wenn sie wieder auftauchen – zum Beispiel den Einsatz der Geigen in der Zweiten Brahmssymphonie, den Napoleon von Lautrec usf., – wie Freunde begrüße, die noch einmal zu sehen ich kaum erhofft habe ... Ja, es hat neben den komischen auch seine rührenden Seiten, wenn man mit dem Tode sich auf guten Fuß stellt, wenn man dem allgemeinen und nichtssagenden Sterben es vorzieht, schon bei Lebzeiten seinen eigenen, ganz privaten Tod zu haben.
Viele Nachmittage in diesem Sommer verbrachte ich unter Kindern. – Eine schöne, gütige Dame, die mich kannte und mein Vergnügen an neuen Dingen, lud mich öfters auf ihre Villa ein, nahe bei Prag. Die Ortschaft heißt Koschirsch. Dort sind Obstpflanzungen, Gärten, Restaurants für Ausflügler, auch ein paar Fabriken, die aber der Luft nicht weh tun, und vor allem ein Zug der herrlichsten Anhöhen, voll von Gestrüpp, Bäumen, versteckten Pfaden, Drahtzäunen und feisten Grasbüscheln, über die man ausrutschen muß.
Die Dame wußte wohl, daß zehn Jahre viel Zeit sind und daß ich inzwischen viel Kindliches vergessen habe, wenn auch nicht alles. Und diese Dame hat zwei Kinder, ein lustiges Mäderl und einen kühnen, schlanken Buben, und die haben Freunde und Freundinnen, da gibt es oft Gesellschaften. Da war ich also auch mit eingeladen.
Lärm, der zum Himmel dringt, ungeheurer Lärm, Kreischen noch darüber hinaus wie eine Feuersäule aus einem Dorf, die Hände geschüttelt und gerissen, Gruppen, die einen Schritt zwischen Laufen und Tanzen einschlagen, Gespräche in drei Worten und beendet durch einen Schlag auf die Schultern, Mädchen, die sich durch Ketten anderer drängen, sich paarweise fassen, übereinander kollern, immerwährendes Lachen durch dieselben Lippen hindurch, die ebenso immerwährend auch reden ... Anfangs ging es mir steif durch den Kopf, es war mir unbegreiflich. Diese vielen winzigen Gesichter, und sind sie nicht alle einander ähnlich, ja gleich?... Und diese Bewegung, wird dir nicht der Arm müde, wenn du zusiehst, wie zwecklos und außer sich dieser Knabe wie eine Radspeiche den seinen dreht und dazu redet und lacht noch obendrein, alles zugleich? Die Luft muß dir ausgehn ... Aber ich gewöhnte mich daran. Bald verstand ich alles, ich unterschied diese ähnlichen Augen und Näschen, nannte jedes mit dem Namen. Plötzlich war ich eingeschrumpft, nach dem Maßstabe kindlicher Angelegenheiten fand ich die kurzen Gartenwege lang wie Landstraßen, und die Beete waren nur noch da zum Dreintrampeln. Ich schrie mit. Ich bot meine Kenntnisse an, und es bildeten sich Spiele, wie ich wollte oder wie ein anderer wollte manchmal. Sprach ich einen Vorschlag aus, so war ich ängstlich aus Ehrgeiz und kränkte mich, wenn er nicht angenommen, gar interesselos überschrien wurde.
Bald verstand ich alles. Alle Kinder wollten neben dem Haustöchterchen sitzen, denn sie war Geburtstagskind und gab das Fest. Sie stritten, sie schlossen Verträge: »Also du bist jetzt bei ihr, aber auf dem Heimweg komm' ich dran,« das war die wichtigste Angelegenheit. Aber eine wurde vorgezogen, Bascha, die hübsche Polin, die am lautesten schrie (manchmal, denn manchmal auch schrien alle am lautesten) und die von der Schaukel stundenlang nicht fortzubringen war ... Es begann zu regnen, die Bäume im Garten bekamen schwarzgrüne Blätter im Schatten tiefer Wolken, dunkel war es, feuchte Luft stieg aus dem nassen Gras wie aus Höhlen. Man sah, wie in helleren Regionen des Himmels graue Wolkenzipfel sich drehten, im Drehen auflösten, wie sie als Regen im Fall verschwanden. »O weh,« sagten die Erwachsenen und bedauerten die Kinder, »jetzt ist der Ausflug verregnet.« Aber die Kinder machten sich nichts aus dem bißchen Wasser, sie lachten weiter, und eine sah ich mit erhobenem Zeigefinger im strömenden Guß durch die Allee hüpfen, mit dem Triumphruf: »Es regnet nicht mehr, es regnet nicht mehr.«
In der Veranda wurde gegessen, große Butterbrote, Kaffee, manche erklärten sich für Milch. Und man sprach von der Schule, hauptsächlich vom »Dividieren«, das war der Erbfeind, die Schattenseite des Daseins. Auch der Herr Lehrer war eingeladen, und nun bildete sich in der Ecke, mir zunächst, eine eifrige Verschwörung. Plötzlich brach eine helle Stimme aus: »Bitte, Herr Lehrer, werden wir morgen nicht dividieren?«
Dann habe ich mit den Buben Raupen gesammelt, eine große Heuschrecke auf die sanfteste Art getötet, nachdem ihr vorher einer ein Bein ausgerissen hatte ... Es wurde wieder schön, und wir erstürmten die Hügel, die Düppler Schanzen mit Hurrageschrei. Man fing eine Blindschleiche, die wie ein Stock in der Hand erstarrte, und sekierte sie, was ich auch sagen mochte. Bis ich drohte. Dann kamen die herrlichen Spiele meiner Jugend: »Nationale«, »Räuber und Polizei«. Die Polizisten müssen zuerst auf dem Bauch liegen, das Gesicht in den Händen, und dürfen nicht sehen, wie die Räuber sich verstecken. Dabei sollen sie bis dreihundert zählen ... O wie fielen mir in dem Lärm alle Erfahrungen und Schliche aus den Kinderjahren ein, von der Schützeninsel, als wir noch unter den Brückenbogen spielten. Diese Streitigkeiten: »Sie haben geschaut«, »Nein«, »Die Räuberhöhle darf nicht bewacht werden.« Dann wie man in rasender Eile zählt und immer das Zählen dem überläßt, der größter Virtuos im Schnellzählen ist und in neuen Schwindeln. Man zählt immer nur bis zehn und merkt sich die Zehner, denn da gibt es weniger Silben auszusprechen bei »eins, zwei, drei« als bei »einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig«. Für halb und halb erlaubt gilt es auch, statt der letzten fünfzig »langsam« bis zehn zu zählen, und wie hastig ist dieses »langsam«. Doch die Räuber sind schon versteckt. Aus einem sichern Gebüsch lächeln sie über die vergeblichen Operationen der Polizei, laufen dann weit, um sie irrezuführen. Und wie war es da Freude und Stolz, kriechend sich die Hände zu zerkratzen, die Hosen aufzuschlitzen im Winkel. Und gar zu rennen über die Stoppelfelder hin, die hart sind wie das beste Pflaster und noch überdies durch Knacken bei jedem Tritt ein lustiges Gefühl ihrer Härte dem Laufenden mitteilen. Wie der Wind blies! Wie sich das Gelb einförmig bis an den Himmel hob und nichts mehr vor mir lag, auch in meinem Geiste nichts anderes, als diese Fläche, die zu überlaufen war, geradeaus! Wie wir dann überraschend auf der anderen Seite erschienen, wo niemand uns erwartet hatte, und tollkühn, die letzten Mohikaner, den steilen Abhang hinunter mehr sprangen, stürzten als rannten, durch die angedonnerte Meute hindurch!... Ja es war Gesundheit und voll Frohsinn, nie mehr werde ich mich so frei fühlen, wie in diesem Augenblick des Herunterrennens, so glanzvoll und so mit Recht bewundert!
Nein, zehn oder fünfzehn Jahre sind nicht viel, ich habe sie gestrichen.
Überdies nannten die Erwachsenen mich ein Kind, und ich mußte mit ihnen die Villa besichtigen, das Speisezimmer, das Bad, das Klavier, und so fort. Aber ich hörte – es drang durch die geschlossenen Fenster – das Jauchzen der Kleinen, aus dem Garten, von den Bergen her. In diesem Moment wurde ich wirklich ein Kind. Tiefer Schmerz befiel mich, daß ich nicht unter den andern mit unten sein durfte, daß ich mich langweilen mußte, wie früher auf Spaziergängen mit der Gouvernante längs des Quais. Draußen rauschten die Bäume, so hell warf die Sonne Funken durch die naßglänzenden Blätter. Da faßte ich die Hand der guten, schönen Dame und bat schon, man möge mich zu den Kindern fortlassen ...
Der Sommer ist vorbei, und nun bin ich wieder allein, ein erwachsener Schriftsteller für Österreich und das Deutsche Reich.
Nun wünsche ich mir seit heute früh eine Insel.
Eine Insel zum Ordnen.
Ordnungsliebe ist meine geheimste und eigentlichste Eigenschaft, daran zweifle man nicht, bitte. Aber jahrelang habe ich leider keinen Ausweg für sie gefunden, keinen andern Ausweg als schäbige Pedanterien ohne Erfolg, peinvolle Anstrengungen. Deshalb eben freue ich mich heute so, seit dem Frühlicht, da ich über die Steinbrücke ging. Denn nun weiß ich, wohin ich strebe, was ich mir wünschen soll ...
Seit längsten Jahren ist es meine Sehnsucht, irgendein Ding genau zu ordnen, durch Ordnung zu beherrschen, über seine kleinlichsten Veränderungen zu wachen und förmlich Buch zu führen, es gründlich in der Hand zu haben, ohne daß ihm eine dunkle Ecke übrig bliebe, wahrhaft zu einer Kolonie des eigenen Ich es auszugestalten ... Aber ahnt man, wie schwer das ist? Gewiß gehört es zu den kompliziertesten Unternehmungen unseres Erdballs, ohne daß sich bisher ein Ruhm oder auch nur eine Aufmerksamkeit für das Überwinden dieser Schwierigkeit gezeigt hätte. Es ist ein bisher noch nicht gewürdigter Sport, den ich entdeckt habe. Und eigentlich mehr als kompliziert. Ich will gleich die Wahrheit sagen: es ist unmöglich. Ehemals habe ich versucht, meinen Schreibtisch zu ordnen. Das war eine meiner Jugendtorheiten, ein idealistischer Zug der zarten, unerfahrenen Seele ... Wie schön habe ich davon geträumt, ihn übersichtlich geschlichtet zu haben, jede Ecke und Schadhaftigkeit der kastanienbraunen Schreibmappe zu kennen, ihre Lage genau nach eigenem Willen zu bestimmen und die Zentimeter zu wissen, die ihr Rand von dem Rand des Schreibtisches, von dem grün eingepflanzten Tuch Abstand hat. Dann die Bücher! Jedes einzelne durchforscht, alle Worte, alle Beistriche darin auf den ersten Handgriff zugänglich wie Sklavinnen im Serail, und jedes unintriguant an seinem Platz, ohne Widerrede. Hier die Briefe, hier die Papiere, das Tintenfaß ohne die mindeste Verzierung eines Kleckses an seine gewisse Stelle gezwungen, von der es sich nicht rühren darf. Lauter Kettenhunde. Willige Löschblätter, ein Messer wie zum Rasieren, Lineale voll Pflichtgefühl, Federn von biederem Charakter und ganz nahe auf geringstem Raum aneinander gepreßt, Tinte mit deutlicher Abneigung gegen Staubkörner. All dies wie etwas Ewiges, dem Wechsel der Zeit entrückt, aus dem allgemeinen Raum in einen Privatraum meines Fabrikats gehoben, frei von der üblichen Kausalität ... Wie herrlich: ich würde aufhören zu arbeiten, aus Angst, dieses Heiligtum zu beflecken, und nur an manchen Abenden behaglich möchte ich die Lampe entzünden, um verzückt und voll Andacht dieses Wunder von Ordnung, Präzision, Dienstfertigkeit zu betrachten, so gemütlich und mit einem sichern Haushalt zufrieden; an unruhigen Abenden, während draußen wüst die Bohémiens zu den trostlosen Sprüngen ihres ungeordneten Lebens ansetzen ...
Ach, daß es ein Traum geblieben ist!
Unmöglich, einen Schreibtisch bis zur letzten Feinheit zu ordnen. Ganz einfach, weil es unmöglich ist, die Grenze dieses Schreibtisches zu bestimmen. Seine Holzfüße verlaufen unmerklich in das Holzparkett des Fußbodens, tröpfeln wie Regenlinien ins Meer, die Zimmerwand berührt ihn mit ungeschickter Zärtlichkeit, andere Möbel stoßen an, es ist ein kameradschaftliches Kitzeln und Winken von allen erdenklichen Dingen her, schließlich bemerkt man (man bemerkt es ärgerlich), daß kein Ding in der Stube einer gewissen Beziehung auf diesen Schreibtisch entbehrt. Die Stube wieder steht mit allen andern Räumen des Hauses in Verbindung, das Haus ist auf der Straße, die Straße gehört der Stadt, die Stadt rechnet sich zur zivilisierten Welt ... So kommt es, daß man als gewissenhafter Mensch, um einen kleinen Schreibtisch zu tyrannisieren, schließlich die ganze Welt in Ordnung bringen müßte; eine Aufgabe, die man vielleicht aus Bescheidenheit, vielleicht mit Rücksicht auf mangelhafte Sprachkenntnisse ablehnt ...
Das Unendliche und die Zusammenhänge. Nun habe ich die siegreichen Feinde meiner Ordnungsliebe genannt. Doch scheint es mir, als würden sie von heute an nicht siegreich bleiben. Ich habe die Steinbrücke beschritten, ich habe zufällig einen Blick der Inselfläche unter ihr gegeben ... Ich will nicht prahlen, möglicherweise ist all das ein Irrtum ... Aber nein, ich glaube wirklich, daß diese Insel etwas Abgeschlossenes ist, wie nichts anderes in der Welt. Das Wasser ringsum und die Mauer des polierten Quaderquais sind so brav, mit nichts außerhalb zu kokettieren. Wohlan, die Insel liegt da, nichts als Insel, punktum, keine Gemeinschaften mit unvorhergesehenen Kameraden. O diese Insel. Und zumal im Herbst, wenn keine Belaubung stört. Zweifellos könnte ich sie säubern, unterwerfen, regieren. Jeden Morgen würde ich an einem Ende beginnen und, kriechend auf allen Vieren, die Blätter vom Boden klauben, das Gras abmähen, die Bänke putzen, die Spatzen erschießen. Sie könnte mein kleines Königreich sein, wo nichts ohne meine Einwilligung vor sich geht, später würde ich die Bäume fällen, die Beete umhacken, um mir die Arbeit zu erleichtern. Natürlich dürfte kein Mensch Zutritt haben ... Allmählich müßte alles Leben und jede Zuckung in meinem Gebiete aussterben, nichts bliebe als eine Sandfläche von geometrisch genau berechenbarer Gestalt und einer bestimmten gleichförmigen Farbe, hart in den Quaigürtel gepreßt und durch den Fluß nach allen Seiten begrenzt, ein höchstes Musterbild der Übersichtlichkeit und der eindeutigen Regel, und so durch kahle Erstarrung wie ein Fremdkörper aus diesem zappeligen Dasein ausgeschieden ...
Ich werde mich an einen Staat wenden und ihn bitten, mir eine seiner Inseln zu schenken, eine ganz kleine Insel zum Ordnen ...
Hat niemand mehr Lust, mit mir in ein Panorama zu gehn? Diese Vergnügung, obwohl sie ja dem Namen nach alles, rundweg alles, was man nur sehn kann, darzubieten verheißt, gehört keineswegs zu den heutigen und irgendwie begünstigten, sie ist eine ruhige, altmodische Vergnügung und kann als solche dem Tempo unseres Zeitalters natürlich nicht mehr nachkommen. Das Panorama wird bald die symbolische Zufluchtsstätte aller Unzufriedenen mit unserer Zeit sein, wird ein dunkles, melancholisches Vergnügen mit viel Bitterkeit auf dem Grund, bekommt – wie alles, wo solche Schwächlingsopposition sich einnistet – einen Beiglanz von Poesie, von verlorner Kindheit, von süßer und höchst angenehmer Faulenzerei, von all den lieben Dingen, welche der starke und, wie man zu sagen pflegt, gesunde Hauch der Neuzeit etwas angegriffen hat; wir werden ja sehn, was ihnen nachkommt. Weniger träumerisch ausgedrückt: die Panoramen gehn halt ein. Billigerweise muß eine harmlose Einrichtung, die auf einem so ganz einfachen physikalischen Kunststückerl, wie das Körperlichsehn ist, beruht, dem neuen und kompliziert-technischen Hervorzauberer beweglicher Landschaften und gar lebendiger Wesen das Feld räumen. Armes Panorama, Vergnügung unserer Großeltern, Überbleibsel der Biedermeierzeit: jetzt erregt unsere Nerven der Kinematograph. Wir wollen beflimmert sein, förmlich von wechselnden Augen aus kreidiger Leinwand heraus angeschaut, nicht selbst ruhig und sanft durch zwei Gucklöcher in eine schwarze Kiste blicken.
Wie dem auch sei, wir treten ein. Das Gefühl, daß es heute vielleicht zum letztenmal ist, lassen wir vorläufig gar nicht erst aufkommen. Aber während wir uns an dem höflichen, unsagbar freundlichen und dabei gar nicht hübschen Billettfräulein vorbeibewegen, durch geraffte, staubigrote Portieren in den Raum treten, der die große Holztrommel mit den Weltbildern faßt – und schon hören wir das akzentlose, wie seit Ewigkeit vorhandene, nagende Ticken des Uhrwerks –: während wir also alle Vorbereitungen treffen und den Hut an einen Rechen hängen, müssen wir doch dem allerdings gefährlichen Gedanken nachgehn, daß niemand auf der ganzen Erde sich so feinfühlig und gütig benimmt wie Kaufleute, denen es geschäftlich nicht gut geht, am besten: die vor dem Konkurs stehn. Scheint es nicht, als ob alle Menschlichkeit und gute Erziehung, Selbstbeherrschung und Demut in solchen liebenswürdigst zusammenträfen. Als ob ihre gar nicht mehr erzwungen klingende Aufmerksamkeit gegen die Kunden, ihr Witzigsein und ihr ernstliches Besorgtsein um mein so bescheidenes Einkaufspaket, ja noch um die Schnurmasche an diesem Paket, ihre vorbildliche Heiterkeit im Geschäftsgespräch sie selbst für ihre peinliche Lage reichlich entschädigen müßten. Ich kannte einen solchen, einen Photographen, den die Konkurrenz verbesserter Apparate ruinierte; in der kritischen Zeit glich er einem zarten shakespearischen Edelmann, so gewählt waren seine stets vernünftigen Worte, so fein sein Anstand. Ein Muster des guten Tons war er, eine Blume seines Standes. Nun, ein solcher Schimmer von Selbstlosigkeit und Moral breitet sich auch über niedergehende ganze Unternehmungszweige aus, niedergehende Unternehmungen haben etwas Aristokratisches und selbst ihre Angestellten, wiewohl gegen monatliches Fixum verpflichtet (jawohl, mein höfliches Fräulein), gewinnen Anteil an diesem ein wenig verweichlichten, süßlich duftenden Altjungfernhimmel der Gerechten; weiche, schwarze Seide, billige, und etwas welker Blütenflor stünde ihnen gut zu Gesicht, doch genug davon, sonst werde ich noch ganz und gar traurig. – Dieses Zimmer ist von einer heillosen, sprachlosen Wehmut, in seiner Dunkelheit, die nur von der Decke her ein wenig rückstrahlendes Licht beregnet, es wird einem wirklich ganz feucht um den Hals, und dazu funkeln paarweise die Fensterchen wie winzige Kabinenluken eines fernen Dampfers. Doch jetzt erhebt sich ein Laut, ein allgemeiner, durch den ganzen Raum fortschütternder, wie ein im Schlafe gelalltes Wort, ein halbgelähmtes Aufatmen, die einzige Lebensäußerung dieses Kosmos, rüttelnd an seinem ganzen Bau – es ist nichts, nur die Bilder sind weitergerückt und ein Glöckchen hat das Zeichen dazu gegeben. Ruhe ist wieder eingetreten, zum Weinen tiefe Ruhe ... Vergraben wir uns also schnell bis an die Ohren in die Schaumuscheln und flüchten wir – dazu ist ja das Panorama da – aus der Nässe heimatlicher Lebensbedingungen in fremde, schon durch ihre Entlegenheit oder gar durch bessere Sonnen gewärmte Gegenden, frischen wir vergangene Geographieschulstunden auf, sei es durch eine Reise über das Weltmeer, sei es in Florenz. Ich sah neulich Bitlis, die Hauptstadt von Kurdistan, ich fand es gemütlich dort zu wohnen am Fuße einer uralten Festung, die Hauptstraße herunterzubummeln, welche auf der einen Seite den aus harter Steppenerde gegrabenen Wall hat, auf der andern einen schmalen, schnellen Fluß mit einem Halbmondbrückchen aus Stein darüber. Ich war auch einmal in Ceylon, sah fremdartige wie aus Hanf gewebte Schiffchen an der Küste eines Landsees, ihre Ankerseile gespannt zum Greifen. Ein Mädchen, vielleicht eine junge Frau, lächelte mich an in der Nähe von Kapstadt, angesichts des Tafelberges lächelte sie aus guten, starken, weißen Zähnen. – Doch damit die Illusion nicht zu ergreifend werde, sind die Bilder handkoloriert wie schlechtere Ansichtskarten. Da gibt es spaßige Bäume aus Grünspan, der Boden ist zitronengelb und mit drei immerwiederkehrenden Nüancen müssen sich alle die bunten Trachten eines sizilischen Volksfestes zufriedenstellen. Dann dieser Himmel, er ist glasig grünblau, sehr transparent und milde, auch die heftigsten Wolken bewahren das Durchsichtige, etwa wie schmutzige Wände eines Tintenfasses, und werden niemals regnen. In diesem Glasgrund der Diapositive finde ich die schöne, heitere Stilisierung, die Erdferne der Panoramawelt. Zu Glas vereist das hurtige Bächlein mit seinen Schatten unter den dichten Waldbäumen, Glas zeigt sich unterbrechend in dem allzu naturwahren Gesicht eines Bettlers, und nicht nur Kirchenfenster sind glitzrig, auch ihre Reflexe auf dem Estrich haben etwas seltsam Materielles, man glaubt sie unter den Schritten der Pilger knistern zu hören. Anläßlich dieser Kirchenfenster kann ich überdies nach so viel Lob des Panoramas einen Tadel aus Gerechtigkeit nicht unterdrücken: Interieurs von Kirchen, auch von Palais und Gemäldegalerien geben keine schönen Panoramabilder. Sie wirken flächig, tot, versperrt. Wenn ich daher auf dem kalligraphierten Programm in der Auslage meines Stamm-Panoramas allzu oft die Worte »Inneres von –« lese, vermeide ich es, trotz des geringfügigen Eintrittsgeldes von zwanzig Hellern, einzutreten. Ich halte derartige Aufnahmen für stilwidrig, für eine Verkennung des Panoramastils. Autoren von Panoramakollektionen sollten (falls sie überhaupt vor dem endgültigen Untergang ihres Metiers noch zu theoretischen Überlegungen kommen) ihre Bemühung dankbaren Gegenständen zuwenden, denen sie im Kreis ihrer Methoden neue Wirkungen entlocken mögen. Denn keine Kunst überschreitet ungestraft die Grenzen ihrer legitimen Macht. Gute Bilder sind, zum Beispiel, Straßenszenen, weite Ausblicke, kurz alles, worin plastisches Hervorheben und Abstände zur Geltung kommen. –
Nun wieder etwas Trauriges: ich habe einmal, durch unziemliche Neugierde verleitet, den Vorhang zu meinen Füßen, der rings um das Polygon gespannt war, gehoben, um in das Innere dieser oft so lebensvollen, weiten Gegenden zu gelangen, und ich dachte nichts anderes, als nun ganz bestimmt in ein wärmeres Klima, nach Italien oder zwischen fahnen- und segelartige Firmen einer japanischen Gasse zu kriechen. Aber als ich mich bückte, sah ich nichts als einen leeren Raum, diesen grell beleuchtet von einem in der Mitte an einer Eisenstange hoch emporgereckten, nackten Glühstrumpf, dumpfige Luft, den schmutzigen Boden mit drei oder vier ausgebrannten Zündhölzchen, und gar nichts von Farbe, denn ich hatte den Kopf schon hinter dem Gürtel der überraschend winzigen Bildchen, der von einem Zahnrad getrieben ruckweise vorging. So starrte ich erschrocken in ein hellstrahlendes, ganz kahles Geheimnis, und ich besaß den Leichtsinn, einen Augenblick zu denken, auch unsere Welt, die uns so raffiniert betrieben dünkt, könnte in ihrer Mitte so eine leere, schweigsame, einfache, gleichgültige Hauptsache haben. Doch lehnen wir das ab, es ist unwissenschaftlich, laben wir uns dagegen an den historischen Toiletten, die mit der ganzen Unbefangenheit des damaligen Modernseins auf diesen Bildern getragen werden, vor Europäern wie vor Eingeborenen, an den Hütchen, culs de Paris, den Ballonärmeln, die man schön fand, als in Wien die Rotunde neu war. Ja, diese Bilderserien reisen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wie sie auch von Stadt zu Stadt reisen, ihre Figurinen haben daher das Unbewußt-Hilflose, das Komische von allem, was nicht mehr ist und nicht bei uns ist. Mit verhaltenem Mitleid kommen wir ihnen am besten entgegen und doch waren sie, die Stutzer, auf allen Bildern wiederkehrend, waren die damals höchst gegenwärtige Reisegesellschaft des Stereographen oder seine mächtige, einflußreiche Gemahlin, die bald auf zertrümmerten Säulen einer schottischen Abtei sitzt, bald vor einem Zulukraal mit zugekniffenen Augen der Sonne trotzt. Wir kennen sie schon, die gnädige Frau. Und wir sind überhaupt von Langeweile nicht allzuweit entfernt, wir beobachten schon nicht mehr die Bilder, sondern vielmehr den Moment, in dem sie doppelt hereinschweben, schattenhaft anprallen mit Gerumpel (dem einzigen Lebenslaut in dieser Karthause), nicht stehn bleiben können und endlich wackelnd sich beruhigen. Die Bilder bleiben uns zu lang. Dann wieder gibt es andere, die offenbar nur kürzere Zeit, zu kurz vor dem Auge stehn, deren Einzelheiten man hastig durchsucht, umklaubt, förmlich in Unordnung bringt aus lauter nervöser Angst, daß das Ganze im nächsten Augenblick davonfedern muß. Das Totenglöckchen von der Wand her klagt man, wiewohl man weiß, daß es mechanisch die Zeit abmißt, der Ungenauigkeit und Willkür an. Ja, der Mensch ist eben eine ganz besondere Uhr. – Man könnte nach all dem glauben, daß ich ein Freund der Panoramen bin, ein Sentimentaler. Aber weit entfernt davon sehe ich kaum den Vorzug, den die Unterhaltung im Panorama vor dem Durchblättern irgendeiner illustrierten Reisebeschreibung haben sollte. Höchstens den, daß man gezwungen wird, alle Bilder eine gewisse gleiche Zeit lang (obwohl sie bald länger, bald kürzer ist) zu betrachten, und wenn man dazu noch geldgierig ist, daß man die ganze Runde zwei- oder mehrmals ansieht. Denn das ist ohne weitere Umstände erlaubt. Freilich könnte man einwenden, daß sich auch der Kino die Verlockung ununterbrochener Vorstellungen zunutze gemacht hat. Aber – nun kommt mein letzter Trumpf – in welchem andern Etablissement kann man, verliebt in ein besonderes Bild, diesem von Guckloch zu Guckloch, von Sessel zu Sessel folgen und einen ganzen Nachmittag lang nichts als dieses Eine vor der Seele haben. Wo, ich bitte? Im Panorama nur, im altmodischen, dessen sämtliche Sessel mit oder ohne Lederpolster beinahe immer leer sind; so sieht man am Schluß meiner Betrachtung die Vortrefflichkeit dieser Einrichtung wieder mit ihrer Verlassenheit zusammenfallen, was ich überdies nach so vielen vorbereitenden Akkorden in grobe Worte zu fassen wohl gar nicht mehr nötig gehabt hätte. Nur unruhige Kinder gehn noch hin, verarmte ehemalige Hochzeitsreisende schwelgen in Erinnerungen, untätige Offiziere suchen passende Schlachtfelder für ihre phantastischen Kolonialkriege. Man kann auch mit einer Dame ins Panorama gehn und, wenn man sich so setzt, daß man die Vorhand hat, ihr mit Kennerschaft die Bilder, die sie zu sehn bekommen wird, angenehm vorerzählen: »Du, aber jetzt kommt was Schönes ...« Nur muß man wissen, daß ein Bild im Holzrahmen immer verdeckt bleibt, daß also das meine erst als übernächstes (nicht als nächstes) zu ihr kommt, und wenn ich (wie natürlich) noch so dicht neben der Schönen sitze.
Mitarbeiter der Firma Pathé frères, Paris, stelle ich mir so etwa vor: nach neuen kinematographischen Ideen ausstreifend durch die bekannt-schöne Umgebung von Paris kommen sie, beispielsweise, zu einer Sandgrube. Sofort ruft einer: Voilà! usf., auf französisch natürlich, zu deutsch ungefähr heißt es, daß seiner Ansicht nach hier die beste Gelegenheit für eine neue Aufnahme wäre, die man dann »Drama in den Goldminen Kaliforniens« nennen könnte. Und schnell werden die notwendigen Utensilien herbeigeschafft, wie breitkrämpige Hüte, Revolver, Seile für Goldlasten, Kurbeln, Patronengürtel, quer um die Brust zu schnallen, und los, man spielt schon unter Aufsicht des gigerlhaften Regisseurs Wildwestmanieren auf den Film ... Oder ein flaches Magazindach gibt diesen Romantischen Anregung zu maurischen Zitadellen, ein Sumpf zu Ritten durch die Wüste Gobi, ein vorbeifahrender Kulissenwagen zu allen Szenerien der Erde ... Und nicht als Tadel sage ich das, nein, es entzückt mich ja, daß gerade durch diese Edisonerfindung, die anfangs nur nüchtern kopiertes Leben sein wollte, so viel phantastisches Theater in die Welt gekommen ist ... Nun sitze ich manchen Abend vor der weißen Leinwand und, nachdem es mich schon beim Eintritt jedesmal belustigt hat, daß es hier eine Kassa, eine Garderobe, Musik, Programme, Saaldiener, Sitzreihen gibt, all dies pedantisch genau so wie in einem wirklichen Theater mit lebendigen Spielern, nach dieser, wie mir scheint, witzreichen Beobachtung macht mich das leise Sausen des Apparats siedend vor Erwarten. Ich habe die Liste studiert, ich weiß, welche Nummer »belehrend«, welche »urkomisch«, »sensationell« oder »rührende Szene aus dem wirklichen Leben« sein wird. Und bald verfinstert sich der Saal zu einer »Reise nach Australien«. Ich sehe Straßen, Menschen, die vorbeigehn, sehr schnell trotz aller Behaglichkeit, manche bleiben stehn und unbeteiligt schaun sie unter ihren australischen Mützen her zu mir. Grüß dich Gott, Mensch, du siehst mich nicht, vielleicht bist du schon tot, einerlei, sei mir gegrüßt! Sodann erlebe ich eine Feuersbrunst, Alarm, die pflichtübertreue Löschmannschaft im Ansturm. Es kommt mir vor, als hätte ich denselben Brand auch auf einer Reise durch Chikago schon erlebt, aber vielleicht täuscht mich da mein kinematographisches Gedächtnis. Überdies bin ich nicht nach Australien gekommen, um nur Brände zu sehn; gleich werde ich durch zwei Schienen überrascht, die auf mich zugleiten, ich sitze nämlich in der Lokomotive eines Blitzzuges, ich erfreue mich an Bergen, Flüssen, Eingeborenen, an dem absoluten Nichts im Tunnel. Typen aus dem Innern des Landes; wie immer bei exotischen Aufnahmen fehlt der Raseur nicht, nicht der eingeseifte Schwarze, der Grimassen mitteleuropäischen Varietéstils schneidet. Schluß, überraschend, ach warum schon? Aber das folgende ist nicht schlechter. Die Wissenschaft hat ihr Recht bekommen, jetzt zappelt das Fröhliche an die Reihe und mit Adagiobegleitung eines Wiener Liedes die Tragik. Da sind die Zaubereien, geduldig kolorierte tausend Photographien, Verwandlungen der Blumen in Ballettmädchen, Brahminen mit langen Bärten, Übeltäter, denen der Kopf abfällt wie nichts, Schwebende, Reisende zum Mond, Gottheiten, der Teufel. Geschehnisse des Alltags wollen nicht fehlen. Falschmünzer werden entdeckt, Verbrecher nach langer Verfolgung gefangen genommen, arme Kinder gefoltert, Familienväter unschuldig verurteilt, gerettet im letzten Augenblick. Ich kenne das auftretende Personal schon ganz genau, genau den Knaben, der sich vor Lachen kaum halten kann, immer wenn er weinen soll. Dieser betrogene Gatte war gestern ein nicht zu rührender Bruder. So erfüllt sich die Gerechtigkeit, über die einzelne Tat hinweg. Dies bewundere ich; noch mehr aber, wie durch Gesten die kompliziertesten Voraussetzungen deutlich gemacht werden. Man sieht: »dich hasse ich« oder »warum hast du gestern meinem Onkel gesagt, daß ich um halb sechs Uhr noch zu Hause war?« oder »auch der Sohn dieses Mannes hat mich vor zwanzig Jahren bestohlen«. Und nur das eine erscheint mir rätselhaft, da gewöhnliches Sprechen schon durch so starke Gesten dargestellt wird: wie man kinematographisch jemanden andeuten würde, der in einem fremden Lande gestikulierend sich verständlich macht oder der von Natur aus zu heftigen Gebärden neigt. Indes zu Nachdenken ist nicht die Zeit. Denn die zweite Abteilung überschüttet mich schon mit Bildern »zum Kranklachen«, wie das Programm sie nennt, mit betrunkenen Briefträgern, Naturmenschen, Galanen, die in einen Kasten sich verstecken und dann die o! so lange, so zum Kranklachen lange Reise im Speditionswagen, auf der Eisenbahn wippend mitmachen müssen. Matratzen werden lebendig, ein Klebestoff ist unübertrefflich, der Stiefel zu eng, Teller zerkrachen lautlos in Staub, Megären heulen, Witzbolde lachen. Und ganze Versammlungen von Menschen, die einander prügeln, ganze Kolonien von Leuten, die unter jeder Bedingung einen davonlaufenden Pintscher einfangen wollen ... Die Lebendigkeit, mit der so viel geschieht, hat mich schließlich aus meiner halbschlafenden Daseinsart aufgeschüttelt. Nun auf dem Heimwege werde ich zum Erfinder, denke mir selbst neue Bilder für den Biographen aus: eine Verfolgung, in der einmal statt Automobil, Lokomotive oder Dräsine zwei Schiffe miteinander Wettlauf machen, ein Kreuzer und ein Piratenschiff, über die weite Meeresfläche hin verringert sich immer mehr im wütendsten Schießen ihr Abstand ... Das wäre allerdings ein teurer Film. Um so billiger der zweite, darstellend einen Dichter in einsamer Kammer, der über die Schwierigkeiten eindringlicher, doch rückhaltender Darstellung in verzweifelte Wut gerät.
Ich gehe allein durch die Stadt, in einer vollkommen zerworfenen Stimmung. Ich bin so krank in mir, daß ich dreißig Gesunde anstecken könnte. Mein Kopf ist von literarischen Plänen erfüllt, ich habe die Sehnsucht, irgend etwas genau so darzustellen, wie ich es fühle, und wär's auch nur was Geringes, so strahlend und klar als nur möglich es zu sagen, nahe dem Ideal ... Ich komme über eine Brücke, steige die breite Seitentreppe hinab und auf der parkartigen Insel bin ich nun allein. Tausend Gedanken bewegen mich, aber nichts ist da faßbar, es scheint mir, ich werde untergehn, heute abend ... Es ist Abend. Ich setze mich auf eine Bank nieder, ganz im Schatten. Vom Quai drüben breitet sich ein Lichtschein in den Himmel aus, die dichten Äste lassen nur ein paar Sterne herein. Auf dem Boden der Allee ist aus diesen Sternen, Ästen und städtischen Lichtern etwas geworden, eine Verwirrung, eine Ruhe zugleich ... in diesem Augenblick, während ich zu Boden sehe, ergreift mich tief die Schwierigkeit aller Darstellung. Was kann ähnliches sein zwischen meinen Worten und dem, was ich da sehe. Niemals, niemals. Ich empfinde es im Herzen meines Herzens: gäbe es nicht Beweise, Beispiele, daß die Menschen seit jeher Schriftstellerei betrieben haben, man würde den Gedanken daran als den unglaublichsten Wahnsinn verjagen ... Meine Stimmung jetzt genau: man sollte glauben, daß sie aufgeregt ist irgendwie, daß ich an Literatur denke. O nein, trotz allem bin ich jetzt so glücklich und voll von einer zufriedenen Müdigkeit, wie nur selten, ich fühle mich ganz bei mir, ich habe mich lieb, und die Gedanken an Schreiben zersplittern mich nicht, sie sind nur kleine Liebkosungen und das Hauptgefühl bleibt: es ist Herbst, und da ist Wasser, eine Brücke ... Ein Licht geht schnell über das bläuliche Wasser unter den andern Lichtern, die stehn oder langsam gehn. Ich sehe den Quai nicht, nur die Spiegelung. Da glaube ich, dieses rasche Licht war die Spiegelung einer Tramway. Falsch, ein Kahn mit einer Laterne voran ist vorbeigeglitten, ohne Geräusch, es war also keine bloße Spiegelung. Und wie die Lichter lange Glanzlinien alle ins Wasser legen, das in kleinen Wellen dazwischenströmt! Diese Linien oder Flächen kürzen sich abwechselnd zusammen, dehnen sich aus, wie Gummibänder, an die man etwas gehängt hat und die jetzt eine Weile elastisch auf und ab sich ziehen, ehe sie zur Ruhe kommen ... Ich betrachte den Brückenbogen, die Balustrade mit ihren kleinen Pfeilern hoch oben. Von Zeit zu Zeit eine Steinkuppel zur Verzierung, nun leuchtet hinter einer solchen Kuppel ein Nimbus hervor, ein wunderbarer Strahlenkreis; so sind auf Reklamebildern manchmal Moscheekuppeln im Glanz, der dann die Worte trägt: »Der beste Kaffee ist usf.« Ich weiß, diese Strahlen kommen nicht aus dem Stein, gehören zu einer mir unsichtbaren elektrischen Bogenlampe, die dahinter unten auf dem andern Teil der Insel steht. Sie beleuchtet auch Bäume, die ich unter dem Brückenbogen hindurch sehe, ein hellgrünes Licht wirft sie auf den nächsten, dann braun scheint eine andere Gruppe, mancher Strich gelblich. (Auch Maler müßten verzweifeln, fällt mir ein.) Und nun, hoch oben zwischen den kleinen Pfeilern ziehn ununterbrochen Menschen vorbei, Wagen, ein Lärm. Diese Brücke ist wie ein hohes Haus, von dem aber nur das oberste Stockwerk benutzt wird. Und hier unten sitze ich allein im Dunkel, ganz glücklich, bei mir. Wer das fassen könnte! Von Zeit zu Zeit knackt etwas auf die Erde und zerschmettert, wahrscheinlich fallen die reifen Kastanien, sage ich mir, und aus Vorsicht setze ich den Hut auf, den ich bisher in der Hand gehalten habe. Zugleich, obwohl ich nichts sehe, sehe ich die grünen, stachligen Früchte, innen so schön weiß, ganz zersprungen und zerschmettert auf dem harten Boden, und der braune Kern muß davongerollt sein, vielleicht unter meine Bank. Noch zugleich bemerke ich eine lange Reihe von Oleanderbäumen, zwecklos. Oder zu welchem Zweck? Vielleicht hat man sie aus der Restauration zum Lüften hergestellt. Ich höre Lärm. Auf dem ganz finstern Spielplatz kommandiert ein Knabe, vier winzige Mäderl stehn in einer Reihe, heben die Hände, marschieren, drehn sich um. Werden sie nicht zu spät zum Abendessen kommen? Indessen sitzen zwei oder drei Gouvernanten und reden leise miteinander, auf einer entfernten Bank. Ich stelle mir durch das Dunkel hindurch vor, doch sehe ich nichts, daß sie im Reden ähnlich ruhig die Hände ausbreiten wie auf ägyptischen Malereien konversierende Könige. Nur einen Moment, das geht vorbei. Auch an meine Kindertage muß ich denken, hier auf demselben Fleck haben wir bis in die Nacht hinein den verbotenen Fußball gespielt. Und indessen huschen über die beleuchteten gelben, grünen und rötlichen Bäume, die ich durch den riesigen Brückenbogen hindurch fern im Hintergrund sehe, ganz flüchtige Schatten. Die Leute von der Brücke herab werfen also diese dünnen Schatten, das sehe ich heute zum erstenmal, und diese Bäume, die doch unregelmäßig auch hintereinander stehn, wirken wie eine glatte, ebene Fläche. Merkwürdig! Aber sag' es einmal, sag' es doch so, daß man es sieht ... Ekelhaft. Aber die gute Luft! Die gute Luft auf dieser Insel! Es ist ein milder Herbstabend.
Plötzlich erschien mir diese Baumfläche mit ihrem Schattenspiel wie eine Kulisse. Warum sitze ich nicht lieber im Theater, da hat man was Sicheres, Abgegrenztes, statt allein ohnmächtig in dieser problematischen, unendlichen Natur! Die Herbstsaison hat begonnen. Ich werde fleißig ins Theater gehen, alles andere ist gefährliche Ausschweifung.
Also ich habe beschlossen, jetzt häufig ins Theater zu gehen. Ich mache den Anfang mit »Torquato Tasso«. Das Stück ist berühmt, aber ich habe es noch nie gesehen, nicht einmal gelesen. Ja, so bin ich, ziemlich ungebildet. Es ist richtig eine Premiere für mich.
Ein italienischer Garten. Nun, ich hätte mir Gärten, in denen Dichter mit Fürsten spazieren gehen, anders vorgestellt, überschwänglicher. Und geschlossener, nicht so für uns Zuseher offen. Aber das liegt vielleicht im Wesen der Bühne ... Und nun erklingen Verse, da beruhige ich mich sofort, das ist schön ...
Jemand stört, die Bankreihe herein. Ich schaue zürnend auf. Aber nicht lange zürnend. Es ist Hede, das schöne Mädchen, sie sitzt zufällig neben mir.
»Guten Abend, Fräulein Hede.«
Sie erkennt mich und streckt mir die Linke hin, da sie mit der Rechten allerlei zu tun hat, die Nadeln aus ihrem Hut ziehen, die Bonbonniere hinlegen neben den kleinen Handspiegel ... Hede, die lustige Gefährtin unsrer Nächte, jeden andern hätte ich eher hier erwartet als sie.
Und ich sage es ihr auch.
»Wissen Sie denn nicht, daß ich jetzt auf Theater studiere.«
»Nein, seit wann denn?«
»Ich hab' schon drei Stunden gehabt.«
Voll Stolz zieht sie aus ihrer Pompadour einen kleinen Flaschenstöpsel und zeigt ihn mir: »Das muß ich jetzt immer im Mund haben und üben. Es ist wegen der Aussprache ...« Wir reden weiter von andern Dingen, aber sie hat keine Ruhe, sie wühlt weiter in ihrem Tascherl und endlich findet sie, was sie sucht, einen zweiten, ebensolchen Korkstöpsel. »Sehen Sie, da hab' ich noch einen,« weist sie mir ihn vor.
Das Parterre ist ziemlich leer, in unsrer Nähe sitzt niemand, so müssen wir nicht fürchten, daß unsre Gespräche stören. Nur daß da auf der Bühne etwas geschieht, stört uns.
»Ich bitte Sie, was geht denn da vor? Wovon handelt das Stück?«
Ich sage ein paar Dinge darüber, Nachklänge des Gymnasiums.
»So, und was geschieht zum Schluß?«
»Er versöhnt sich mit dem Antonio.«
»Das ist alles ..?« Sie macht ein enttäuschtes Gesicht, eine Weile schaut sie noch auf die Bühne, mit Anspannung, wie man einem Entfliehenden etwa nachschauen würde. Dann gibt sie sich mit einem Ruck mir, sieht mich so lange von der Seite an, bis ich es bemerke ... Da war gerade ein Klang, irgendein leiser Angstschrei des Genies, wie Baudelaires Albatros zieht er traurig taumelnd vorbei. Ich fahre auf.
»Wollen Sie das Opernglas, Fräulein?«
»Ah nein, ich seh besser ohne Glas.«
Wie gesund sie ist: von den dicken Wangen angefangen, bis hinunter. Diesen Busen könnte man für eine Merkwürdigkeit halten, so groß ist er, so eine fremdartige Masse. Und unbegreiflich, wie sie ihn ohne Mühe erträgt, und wie er überdies in ihre Gestalt hineinpaßt. Ganz nahe bei mir hält sie ihre Schulter, dick, dick, dick. Und vollkommen schön und immer aufs neue verlockend, unter diesem runden Arm seine Hand zu wärmen. Nein, die haben wir noch nicht ruiniert. Eher gehen wir alle zugrunde, als daß dieser unerschütterliche Felsen von Lebenskraft wankt. Wie sie atmet, wie ruhig! Nein, unsre Nächte haben sie nicht im mindesten nervös gemacht, da ist ein Stück Natur und ergibt sich nicht. Nicht einmal ein Opernglas braucht sie ... Es fällt mir ein, wie sie einmal in einer Weinstube die Röcke hob und mit Stolz ihre weißen, widerstandsfähigen Schenkel zeigte, den schmalen Streifen wie ein weißes Strumpfband zwischen Hose und schwarzem Strumpf. Nein, da können noch zehn Großstädte kommen, ihr geschieht nichts, der Hede. Sie ist ja noch so jung. Damals war ich sehr müde, in dieser Weinstube, voll von Wein, ehrlich gern wäre ich schlafen gegangen, denn ich halte nicht viel aus. Aber sie setzte sich auf den Tisch, und ein Schrei kam aus ihr heraus, ein Jubel, wie ein Pferdeschrei ... Ja, ja, schöne Beine hat sie, das muß man sagen.
»Warum sind Sie eigentlich nicht mehr beim Ballett?«
Sie murrt etwas. Etwas, was sie offenbar selbst nicht begreift. Irgendein Beschützer hat entdeckt, daß sie eine angenehme Stimme hat. (Warum nicht, denke ich, sicher ist alles an ihr gesund und natürlich.) Also jetzt wird sie Heroine.
Ich lenke sie wieder zur Bühne, denn ich möchte ja ganz gern dem Drama zuhören: »Wie gefällt Ihnen unsre Heroine?«
»Ja, sie hat eine angenehme Stimme.« Eine Weile hat sie mit strengem Gesicht aufgepaßt, während Eleonore sprach, dann kommt dieses Urteil ... Der zweite Akt beginnt, ein kompliziertes Gespräch der Herzogin mit Tasso. »Liebt er sie eigentlich?« fragt mich das Mädchen neben mir ganz einfach. Ich, ebenso einfach: »Ja.«
Sie legt den Arm oben auf die Rückenlehne des nächsten Sitzes, um sich bequemer hinstrecken zu können. Dabei entstehen neue Arten von Rundungen aus ihrem Körper, neue Höhlen und Einsprünge. Sonst kenne ich nur von Bildern her so ausgedacht reizvolle Stellungen. Aber hier ist es ohne Absicht und ist Wirklichkeit. Es ist schrecklich aufregend, so etwas zu sehen; noch aufregender, es nicht zu sehen ... Ich wende mich also wieder zu ihr: »Na, was?« Nur um etwas zu sagen, eine primitive Anknüpfung.
»Was denn?« erwidert sie erschrocken. Sie hat schon halb geschlafen.
Eine Weile sehen wir einander an, keiner hat einen Einfall. Dann erlöst sie etwas, aus vollem, aufrichtigem Herzen hat sie es erkannt und sagt es, denn sie ist ein ehrliches, gutes Mädchen: »Wissen Sie, das Stück ist eigentlich ziemlich fad ...«
Plötzlich bin ich entflammt. Ich weiß nicht, was das ist, manchmal bricht tief aus mir heraus irgendeine Person, die gar nicht mein Ich ist. Dann fange ich an, mit Begeisterung Dinge zu reden, an die ich gar nicht glaube. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, zu lügen. Sondern ich denke immer noch in der Unterströmung: »Ja, rede nur, Max, rede nur brav weiter. Das ist zwar nicht deine Meinung. Aber nur zufällig. Ebensogut könnte es auch deine wahre Meinung sein, das Schicksal hätte sein Steuer nur ein wenig nach links oder rechts biegen müssen, und bums, schon wär' aus dir wirklich das geworden, was du jetzt redest. Also lasse dich nur aus, lasse dein ungeborenes, durch irgendwelchen Zufall nur verhindertes Ich auch ein bissel zum Leben ...« Also nehme ich ihre Hand und werde ganz gerührt vor innerer Roheit, die ich in mir aufwachsen fühle wie ein Gebäude: »Sie haben recht, Hede. Wozu ich eigentlich hergekommen bin! So ein langweiliges Stück, es geschieht ja nichts, immerfort wird nur hin und her geredet. Da stelle ich mir ein Drama ganz anders vor. Lauter Handlung, lauter Krawall. So wie Sherlock Holmes. Und glühende Liebesszenen dazwischen, zum Zerspringen. Hier weiß man ja eigentlich nie, was sie voneinander wollen und ob sie überhaupt etwas wollen ...«
Im Zusammenhang damit bespreche ich ein Rendezvous mit ihr. Warum sie mich schon so lange nicht besucht hat? Ob sie wieder kommen will?
»Wenn's sein muß,« sagt sie. Das ist eine ihrer Lieblingsredensarten.
»Sehr gut,« entzücke ich mich weiter, »und ich werde ein Stück für Sie schreiben. Ich plane nämlich schon lange ein Drama, bisher habe ich's noch nicht versucht. Ausgezeichnet passen wir jetzt zusammen, Sie als Schauspielerin! Es wird eine Bombenrolle für Sie sein, und jetzt werde ich das Stück auch sofort anfangen. Für Sie, ja? Es soll ›Lady Hamilton und Nelson‹ heißen, oder so ähnlich. Wissen Sie halt, ein Seeheld, und sie liebt ihn sehr und verführt ihn auch zu ein paar Dingen, die nicht so das Rechte waren. Auch einen Tanz muß sie drin tanzen, den Shawltanz, den sie selbst erfunden hat. Gefällt Ihnen das?... Es ist eine historische Sache; Goethe selbst, verstehen Sie, von dem dieser Tasso ist, hat sie in Neapel gesehen.« Ich höre mir selbst zu und weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob das wahr oder falsch ist, was ich da rede. Ich will ja im Ernst dieses Drama schreiben. Aber ich würde mich schämen, wenn mich wirklich diese Argumente dazu bestimmt hätten, diese Schönheiten und Vorzüge meines Planes, die ich ihr anpreise. »Und vor allem viele Schlachten werden vorkommen. Lauter Seeschlachten. Ein Akt spielt auf dem Verdeck des Admiralschiffes während der Schlacht bei Trafalgar. Das Schießen darf gar nicht aufhören. Sogar in den Zwischenakten muß geschossen werden ... Nun, was sagen Sie jetzt? Werden Sie da keine Angst haben?«
»Ich? Angst?« Sie wird ganz wild und setzt sich aufrecht. »Ich habe nie Angst. Hören Sie, voriges Jahr waren wir in Brandeis auf Sommerwohnung. Abends sitzen wir da im Restaurant. Plötzlich macht sich der Wachtmeister, was mit uns gesessen ist, einen Jux und schießt sein Revolver los, blind geladen natürlich, auf die Erde. Alle sind sitzen geblieben, vor Schreck, wie angemalt. Nur ich stehe auf und gehe lustig im Zimmer herum, wie wann nix g'schehn wär« ...
Auf der Bühne rast eben Tasso, verwundet, wegen irgendeiner Kleinigkeit gellen seine Schreie durch den Palast. Er zittert, seine Lippen sind weiß und gekräuselt, wie schäumendes Wasser in immer neuer Bewegung.
»So was Überspanntes!« sagt das gesunde Mädchen neben mir.
Ich lobe sie. Ein Kerl ist das, ein Stück Felsen ...
Entschieden sind wir beide heute nicht die richtigen Zuhörer für Tasso.
Noch schnell, ehe das verbesserte moderne Theater die alten Gebräuche gänzlich übermalt hat, stelle ich fest: sie waren lasterhaft, doch darum nicht minder interessant ... Namentlich muß gesagt werden: die tiefe Kniebeuge hatte damals eine viel ausgedehntere Verwendung, und so ist es ja glücklich noch jetzt an den meisten Theatern außerhalb berlinischer Neuerungen. Die tiefe Kniebeuge wird ausgeführt, wenn zwei oder drei auf der Bühne beisammenstehen und »Das Geheimnis« an zitternden Handflächen vorbei einander zuflüstern. Noch tiefere Kniebeuge bedeutet dann »Verschwörung«. Und mit gänzlich eingeknickten Beinen, beinahe kriechend nur, bewegt sich der Schauspieler älterer Konvention auf dem Erdboden weiter, die Hände weit von sich gereckt, wenn er Bericht gibt, wie es bei der »Verfolgung« zugegangen ist. Wohlgemerkt, wenn er wirklich auf der Bühne verfolgt, bedarf er keiner solchen Aufwendungen von Beweglichkeit. Nur Berichte müssen so ausdrucksvoll-anstrengend gespielt werden ... Eben an solchen Gesetzen jenseits der Realität war, ist die mittelmäßige Schauspielkunst überreich. Man könnte riskieren: nur der mittelmäßige Schauspieler ist Schauspieler, denn nur er folgt Gesetzen, die nicht aus dem ganz fremden Rayon der Naturbeobachtung stammen, sondern immanent aus dem Wesentlichen des Theaters. Der gute Schauspieler stellt etwas dar, der mittelmäßige ist etwas. Durch den guten Schauspieler hindurch, wie durch einen Kristall, bleibt der Blick ins Dasein, in die Historie offen. Die Vortrefflichkeit eines Schauspielers ist Durchsichtigkeit. Und den ganz vortrefflichen sehe ich überhaupt nicht mehr. Symbol und Symbolisiertes sind in eins gefallen ... Der Mime in Schablonenmanier hingegen hat etwas Materielles bewahrt. Er lenkt ab von dem Helden, den er geben will. Je schlechter er wird, desto mehr sieht man ihn, desto deutlicher tritt er aus dem Bilde ... wie Gespenstererscheinungen im Kinematographen. Schließlich werden seine Gesten ein selbständiges Objekt, würdiger der Beobachtung als sogar Shakespeares unerreichbarer Jago, den sie verdunkeln und in Vergessenheit bringen ... Mit Recht! Denn würde Jago, wenn er jetzt lebendig aufträte, auch es verstehen, in so interessant-allgemeingebräuchlicher Weise sein Trinklied zu brüllen, seinen Becher zu heben. Theater-Becher eines Theater-Trinklieds werden nämlich immer so gehoben: zuerst beschreiben sie einen großen, wagerechten Kreis durch die Luft, dann fliegen sie empor, dann an den Mund in halbe Höhe, und während sie sich senken, muß die linke Hand aufsteigen mit gestrecktem Zeigefinger, der erst, wenn der Becher geleert ist, zu den andern Fingern einknickt. Nicht wahr?... So sitze ich oft im Theater und nichts freut mich als diese eingehenden Studien, die ich mit ziemlichem Erfolge betreibe. Denn ich weiß jetzt schon, wie einfach »ländliche Liebeswerbungen« darin sich ausdrücken, daß man dem begehrten Mädchen mit dem Oberarm in den Rücken reibt und schließlich schmunzelnd sie zur Seite wegstößt. Ich weiß, daß »träumerisch verliebte Dirndl« ihre Wangen an zwei Finger stützen, das Gesicht etwa wie einen dicken Federstiel in die Hand nehmen. Diese Kenntnisse verdanke ich den vielen Volksstücken, die ich gesehen habe ... Dagegen aus dem klassischen Kurs stammt meine Erfahrung, daß Wallensteins Offiziere im Kriegsrat stets nur die Kante der Sessel zu beschweren pflegten, das eine Bein geknickt, das andere nachgezogen, wie im Lauf ... Noch hübscher sind Opern, hier bleibt das Spiel noch ergiebiger in seinen Grenzen autonomer Natur-Unwahrheit. Nebenbuhlerinnen zerren einander erst in die rechte, dann die linke Bühnenecke; denn die Nebenbuhlerinnen-Arie hat zwei Strophen und so viel Haß will symmetrisch verteilt sein. Jeder Feind wird mit »Verräter« angefaucht. Vom Geliebten aber heißt es: »Ihn lieben ist süßer Gewinn.« Je koketter eine Zofe, desto mehr neigt sie sich lächelnd ins Publikum, Finger an der Lippe. Selbst der verabscheute Bewerber, der im nächsten Moment für immer abgewiesen werden wird, darf noch im Singen Liebchens Arm umschmeicheln. Was man im Leben für ein Zeichen nicht unbeträchtlicher Gunst halten würde, hier ist es nichts. Und beim Stelldichein ein Kuß ohne nähere Anpressungen, im Leben nichts, hier bleibt es alles ... Wie billige ich diese Unterschiede! Wie liebe ich es, wenn ein Akteur, an der Rampe nicht benötigt, jetzt zurücktritt, im Hintergrunde einen andern fest bei den Händen packt, ihn nicht mehr losläßt und tut, als habe er Wichtigstes mit ihm zu besprechen, indessen er angespannt nach vorn horcht und prompt auf sein Stichwort wieder vorstürmt. Wie liebe ich Statisten, gestikulierende, einschlafende, jubelnde, Chormädchen, die jemanden in einer Loge suchen. Und auch dich, o illustrissimer gastierender Tenor und Millionär, der trotz ihrer geringen Gage die Edelleute seines Festes mit »Freunde« anspricht, bekannt mit ihnen tut, liebevoll einem die Schulter beklopft, dann einen andern bevorzugt, an die Rampe führt und seinen Arm, den er erfaßt hat, im Rhythmus der berühmten Kanzone hin und her reißt ...
Es ist doch nicht gut, ... dachte ich im Theater während der Vorstellung ..., wenn die Pracht von »Haben Sie nichts zu verzollen?« mit »Weißes-Rößl«-Komik für den Mittelstand sich amalgamieren will ... Ein Nachthemd ist immerhin ein Nachthemd, und lustig. Was aber lernen wir aus diesem (jetzt sage ich's schon) miserablen Stück? Zum Beispiel, es tritt ein junges Mädchen auf und legt Karten. Die Gouvernante kommt dazu, zankt sie aus, dann dreht sie sich selbst um, fängt ihre Patience an. Ein Abbé tritt auf ... mein Freund und ich im Publikum, wir lachen schon, wollen ihn durch Gebärden abhalten ... es nützt nichts, es bleibt dem Abbé nicht erspart, sich lächerlich zu machen, indem er die Gouvernante auszankt und dann (beiseite) seine Patience anfängt ... Ist darin eine Moral, so ist sie mindestens sehr langweilig! Und plattgedrückt von dieser ausdrücklichen, wie mit Humor akzentuierten Langeweile kriecht das Stück über die dreiaktige Bühne, nein vieraktige sogar! Schließlich wirkt diese Öde verwirrend, wie eine große Stille, diese Selbstverständlichkeit wird unverständlich; man gähnt, um sich mit etwas zu amüsieren ...
Doch merkwürdig, jetzt zu Hause hat auf einmal dieses unaufmerksam gehörte Spiel eine Einheit für mich bekommen ... Ein Gelehrter kommt darin vor, schreibt über etwas Uninteressantes, Kleines aus dem Mittelalter, liebt eine Frau, ist schüchtern, ungeschickt, mit Mißlingen von oben bis unten bekleidet. Und dann, in dem Moment, wo er glaubt, diese Frau liebe ihn doch, schmeißt er seine Bücher weg, verschmäht eine Freundschaft, tanzt und bestellt Champagner (genau Champagner!). Da erstaune ich. Und weiß: dieser Gelehrte ist nichts Reales, er ist ein Gelehrter, wie sich die Autoren vorstellen, daß eine Frau sich ihn vorstellt ... Daher seine vernachlässigte Tracht! Daher sein Vorname, den er betrauert: Auguste! Daher die schlimmen Ibsen-Symbole das ganze Stück entlang! Daher das ganze Stück!... Das ganze Stück stellt ein Gehirn einer mittelmäßigen Frau im Sinne mittelmäßiger Autoren dar. Es ist gleichsam ein inwendiges Stück, ein Kapitel Physiologie, ein Blick in die arbeitenden Gedankenzellen des Fräulein Jacqueline. Deshalb muß ihr begünstigter Liebhaber ein Lebemann und ziemlich untreu, schlagfertig, eifersüchtig, im Grunde edelmütig sein; der Gelehrte aber nebst allem Unglück auch unehrlich, zappelnd, zum Auslachen, ohne eine Spur von Tesmans Tragikomik einfach zum Auslachen. – Auch bei andern Dichtern gibt es diesen Geistigen, der den Kürzern zieht. Aber konnte ein einziger bisher sich zurückhalten, innerlich diesem Geistigen wenigstens ein bißchen recht zu geben, ein bißchen ironisch auf die siegende Eleganz zu seitenblicken? Ibsen, Hamsuns Nagel, Shakespeares Hamlet ... In diese Galerie unterliegender Gelehrter führen nun die Herren G. A. de Caillavet und Robert de Flers (Ritter aus den Kreuzzügen, Autoren von »Die Liebe wacht«) ihren Auguste, als den einzigen, der gänzlich unterliegt, gänzlich unrecht hat und dem wir´s gönnen (im Sinne des erwähnten Zentralgehirns der kleinen Jacqueline) ...
Und in diesem Sinne auch wünschen wir ungebrochene Erfolge weiterhin über alle Bühnen Deutschlands diesem physiologisch-inwendigen, originellen Stück. –
Man kann jetzt eines der größten Vergnügen der Welt haben, ohne Widerrede, wenn man in Prag ist und im tschechischen Theater dieses Ballett besucht, Louskáček, den »Nußknacker« von Tschaikovskij. Es handelt von gar nichts. Keine Konflikte gibt es darin, nichts Geistreiches, nicht Tragik, nicht Verwicklung. Sondern einfach wie ein glatter Film rollt alles vorbei, alles in sich selbst nur begründet, in sich selbst gehalten und aufgehoben, und alles so süß den Augen und Ohren ... So stelle ich mir ein vollkommenes Drama vor, eine vollkommene Belustigung: ohne Verlegenheit wird an grundlose Szenen ein Tanz, an Tänze eine grundlose Szene geknüpft. Und wer ist so stumpf, daß es ihn nicht vergnügte, ganz große Mäuse wie Känguruhs über die Bühne hüpfen zu sehen, in glänzenden, graugrünen Fellen aus Samt, und gegen sie im Kampfe aufgestellt eine Gruppe buntester Schildknappen? Es wird sogar geschossen, ja, eine Kanone wird abgefeuert. Dann tanzt man weiter. Alle Kämpfe der Erdoberfläche, das wünscht mancher und namentlich in diesen Tagen, sollten auf so humorvolle Weise ausgetragen werden. Würde das vielleicht irgend jemandem schaden?... Und ebenso vorbildlich ist die Art, wie Tschaikovskij auf einem Harfen-Glissando über die gesamte Melancholie der Erdoberfläche hinweggleitet, hinauf zum Sternenhimmel voll von Flöten-Tonleitern in Terzen. Da kann man erfahren, wie das ist, wenn elegante Leute ausgelassen sich benehmen, wenn am Hofe lustig es zugeht. Kein andrer Komponist hat das so: Kerzenbeleuchtung, Übermut, Wohlstand. O, und die Schwermut dieser Melodien, es ist eine Schwermut, über die vornehmsten Kanapees hingelagert und ein ringgeschmücktes Händchen gestützt an eine parfümierte Stirnfrisur, während die Parklandschaft von Somoff ins Boudoir hereinglitzert, im Mondschein nicht so sehr als im Zerrieseln des modischesten Feuerwerks ...
So wurde es hier auch aufgeführt. Luxuriös, russisch, mit einem Wort: vortrefflich. In einer weißen Lichtung, schneeverweht im Eiszapfen-Walde, hinter weißen Gazeschleiern sah man aus lockern Schneeflockenhaufen Mädchen hervorgezaubert, Feen in weißen Locken, weißen, lichten Tüllkleidchen, weißen Atlasschuhen, und nur ihre rosigen Busen taten einem leid, die in dieser blendenden Kälte abfrieren mußten, trotz aller Walzerschritte, abfrieren und vor Frost immer rosiger, röter, härter, brennender erscheinen. Ach Gott, mitten in der freien, unwirtlichen Natur Ballerinen; es war ein aus Mitleid, Grausamkeit und Sinnlichkeit gemischter Effekt. Die ganze Bühne nur Weiß und Rosa, das vergesse ich nicht so bald ... Gewißlich aber noch später die schöne Primaballerina Anna Korecká, wenn ich sie überhaupt jemals vergesse.
Im Prager Tschechischen Theater findet jetzt die Tragödie eines neuen Dichters vielen Beifall. Das Haus ist ausverkauft. Ein Teil der Presse spricht von einer nationalen Tat, ein andrer lacht tadelnd. »König Wenzel der Vierte« von Ernst Dvorak.
Der Theaterzettel, beinahe länger als beim Medardus, gibt schon manchen Grund zu träumerischem Nachdenken. Neben dem König, der Königin, der hohen Geistlichkeit tritt der hohe Adel auf, jene »böhmischen Herren« von Bilin, Douba und Hohenstein, Rosenberg, die jetzt verschollen sind – und die jetzt so blühenden Adelsgeschlechter der Lobkowitze, zum Beispiel, figurieren als niedere neue Namen. Sofort denkt man an die Umwälzungen, die unser Heimatland betroffen haben. Und liest man nun gar unter den Personen nach: Johann Hus, Zizka von Trocnov, den päpstlichen Nuntius, Jost von Mähren, schlichte Bürgersleute, Bauern, einen Bettelmönch, einen Hofnarren ... so ist man von der richtigen historischen Atmosphäre schon durchdampft. Freilich möchte man gern noch den Dichter, obwohl er ja sichtlich vor schönen Taten steht, gern noch an die Schwierigkeiten erinnern, möchte ihn warnen, am Ärmel zurückhalten: Was ist denn das? Jeder Akt spielt in einer andern Stadt, und immer nach zehn Jahren – in Beraun, Wien, Prag, Kuttenberg, Kunratitz? Wirst du das bewältigen?... Doch das Stück ist ja schon geschrieben, und mit einem Seufzer beendet man das nichtige Studium des Theaterzettels.
Meine Sorgen steigerten sich, als ich vor dem Abend meine Kenntnisse der vaterländischen Geschichte aus einigen Büchern auffrischte – ach, aus Büchern, die meiner Kindheit Spielzeug waren, in denen ich jedes Wort und jede Vignette als unendliches Kunstwerk einst bewundert habe. Da fiel mir auf, daß ich die Wirren unter Wenzel dem Vierten eigentlich immer überschlagen hatte, weil ich in ihrem planlosen Hin und Her ohne Frucht und ohne Höhe nichts Interessantes finden konnte ... Ein schwacher König, um das Deutsche Reich wenig besorgt und also »der Faule« benannt, das tschechische Volk liebend, von ihm geliebt, in ewigem Streit mit dem Prager Erzbischof, mit dem frondierenden Adel, bald für Hus, bald gegen Hus, schwankend Verratner und Verräter, Säufer, allgemeine Unordnung, das Jahr 1411 mit drei Kaisern und drei Päpsten, zum Schluß von einem Schlaganfall getötet, während das Volk seinen Palast stürmt. Was ist aus all dem andres zu ersehen als die Grausamkeit und Zwecklosigkeit alles Menschlichen, sofern es nicht geistig-logische Richtungen nimmt?
Nun wurden aber meine Bedenken durch das aufgeführte Drama auf die schönste Weise zerstreut. Und deshalb schreibe ich. Ein Trauerspiel ist geschaffen, voll von Patriotismus, den ich, wo nicht als Patriotismus, doch mindestens als Begeisterung zitternd mitfühle – die Tragödie eines Königs, der sein Volk liebt und mißversteht. Wenn irgendwo, so ist hier das, was die Älteren »tragische Schuld« nannten, in herzlichster Vollendung gegeben.
In der Hauptfigur des Wenzel hat Dvorak eine so scharf individualisierte königliche Gestalt geschaffen, daß ich sie dicht neben Shakespeares Könige stelle. Ein gutes Herz, heiter und gesund, so tritt er, unter dem atemlosen, innigen Jubel des Volkes auf, im grünen Wams, mit Jägerhut und Armbrust, wie ihn das Bild im Römer zu Frankfurt zeigt. Alle sind so froh, ihm die Hand küssen zu dürfen. Ein Bauer bringt die Butter, die für den Markt vorbereitet war, einen schmackhaft aussehenden gelben Klumpen, für den geliebten König aufs Schloß. (An solchen volkstümlich-lustigen Zügen ist das im Innern trübe Stück äußerlich reich.) Alle lachen und trinken gern mit ihm. Doch schon hier zeigt sich der Konflikt. »Wir lieben dich sehr,« sagt ein Greis, »aber wir möchten auch, daß du unser Vorbild bist, ein Muster. Dein Vater Karl war so erhaben ...« Es hat etwas unter Komik Grausiges, wie das Volk immer von neuem diese Forderung gegen den Herrscher erhebt, von ihm das Höchste verlangt. Wenzel, der sie auf weltliche Art glücklich machen will, Steuern erläßt und freigebig Waldungen an die Gemeinden verschenkt, dieser Wenzel genügt ihnen nicht. Sie wollen ihn heilig, er ist ein Mensch. Man muß den Dichter bewundern, der diesen vielleicht historisch unrichtigen, aber so sympathischen, neuartigen, unglücklichen Regenten erfunden hat. Nicht wahr? Den Dramatiker ferner, der aus dem nun vorliegenden Material einen Aufbau und eine Einheit gestaltet hat. Wie er den Jähzorn des Königs, sein schnelles Dolchziehen benützt! Ja, er ist gut, aber an den Tod des Johann von Nepomuk darf man ihn nicht erinnern. Wie er ihn allen Frauen nachstellen, seine Geliebten unter den Dienstmädchen im Volke suchen (auch darin populär, beliebt, aber den höchsten moralischen Anforderungen des Volkes nicht gewachsen), ihn trotzdem zärtlich, mit großem Herzen an seiner Frau hängen, sie als »Moje kuratko« (»Mein armes Huhn«) sanft an sich reißen läßt, vor versammeltem Hofstaate familiär mit ihr ... Man fühlt: in jeder andern Zeit wäre er ein guter König gewesen. Aber »die Zeit ist aus den Fugen, Schmach und Gram ....«. Hus ist aufgetreten, und der König, den eben die Hussiten aus seinem Kerker gerissen haben, versteht die neuen »Ketzer« nicht. Er versteht noch das Nationale ihrer Bewegung, hilft ihr gegen die Deutschen, aber das Metaphysische, Religiöse interessiert ihn einfach nicht ... Nun wirkt es erschütternd, wie er, der sich bewußt ist, stets das Beste seines Volkes gewollt zu haben, der auf die Zustimmung des Volkes stolz ist, plötzlich bemerkt, daß alle den Kelch über ihn stellen. »Gib uns den Kelch wieder,« heulen unten die Rebellen. Und im letzten Akt stellt sich die Rührung ein, mittelst einer vielfachen Perspektive, mittelst eines wahrhaft geschichtsphilosophischen Überblicks, der aber vom Dichter nirgends durch Theorien, nur durch Gestalten ausgedrückt wird. Natürlich so: Wenzel hat recht, wenn er das Volk irdisch beglücken will – unrecht, wenn er die Tiefe der religiösen Sehnsucht verkennt – und doch wieder recht, wenn er all das Elend, das infolge dieser Religionskämpfe über Böhmen hereinbrechen will, prophetisch ahnt – und doch vielleicht von einem höchsten Standpunkt, kraft dessen die geistige Freiheit dem Menschen wichtiger als alles leibliche Wohl und Wehe ist, wieder unrecht – und doch vielleicht zum Schluß recht, weil er ein Mensch ist, ein mystischer Rationalist, eine Art Goethe, der den Himmel auf der Erde sucht. Diese komplizierten Antithesen, von Akt zu Akt gesteigert, trotz der Uneinheit von Raum und Zeit zu einer innern Einheit erhoben durch Heroismus, Schönheit, blutige Aufwallungen, persönlich gemacht durch brennende Details – das ist eben das neue Drama dieses neuen Dichters!
Es wird vorzüglich aufgeführt, wie dies unter dem Dramaturgen des Nationaltheaters Kvapil nicht anders zu erwarten steht. In der Titelrolle leistet Schlaghammer Packendes, Sicheres, Springendes ... wie seine Augen glänzen, seine Rede melodisch dröhnt, wie er unstet-trotzig die Würden des Reiches dem einen nimmt, dem andern nach einem verwirrten Blicke in die Runde hinwirft, wie er voll schöner, jugendlicher Ideale in Blüten des Frühlings steht, sonnig, und schließlich im Feuerschein geplünderter Dörfer zusammenröchelt! Ich habe geweint ... Und neben ihm der Narr, vom Dichter zwar mit wenig Humor begabt, aber mit melancholischen treuen Bocksprüngen ausgestattet von Haschler. Zum Schluß nimmt er Gift aus einem Ring, sinkt lautlos am Fenster nieder, niemand kümmert sich um ihn, nicht einmal der König bemerkt, daß der einzige als Freund mit ihm zugleich stirbt. Ein rührender Zug ... Noch vieles andre hat mir gefallen. Hus allerdings nicht – Vojan spielt ihn mit feuchten Haaren, allzu schulmeisterlich. Aber daß ihn der König, als scheute er sich vor seinem für das Volk so suggestiven Namen, immer nur als »Hussinetzer« nach seiner Herkunft anspricht: wie gefällt euch das? Oder daß unter tausend Höflichkeitsformeln und Treuversicherungen, galant beinahe, ein König gefangen gesetzt wird, mit aller Etikette. Daß ein halbtauber Diener auftritt, dessen dunkelbraunes, altes Gesicht den Anschein erweckt, als verrammle ihm zu viel braunes, dickes Blut das Gehör. Daß er überdies kurzgeschorene, dichte, graue Haare hat, die man gern streichelt wie einen Hund, und die mit einem unsäglich einfältigen Eindruck in die Stirn hereinhängen. Daß jemand in einem Zimmer sitzt, und man weiß gar nicht, daß er hier gefangen ist, bis plötzlich die Türe sich öffnet, nur zufällig, eines Besuches wegen, und da sieht man draußen vor einem hellen, in den weißlichen Himmel verästelten gotischen Fenster unheimliche schwarze Wachtsoldaten stehen, die ein enges Vorzimmer ganz anfüllen, dunkel abgehoben vor dem weißen Licht. Sofort schließt sich die Türe wieder. Und so oft sie sich öffnet, derselbe unbewegliche Anblick.
Zum Schluß nach so viel Lob eine Einschränkung, mich selbst betreffend. Ich gehöre zu den Leuten, die Glockenklang hinter der Szene, Hochrufe des Volkes, jeder Lärm und alle Waffen auf der Bühne aufregen. Inwiefern es ferner zu meiner Rührung über dieses Stück beigetragen hat, daß Orte und Gassen der geliebten Heimat in einem bedeutenden Ton genannt werden, daß man vom uralten »Gasthaus zum grünen Frosch«, das ich kenne, und vom Teinhof mit Zuneigung spricht – das kann ich nicht feststellen und wünsche es auch gar nicht zu wissen.
Schade, daß ich kein Regisseur bin. Es muß hübsch sein, in ein scheinbar schon fertiges Kunstwerk seine Gedanken einzufügen und ihm dadurch eine Vollkommenheit zu geben, die man vorher nicht vermißt hat, weil man sie nicht geahnt hat ... So hat Herr Jaroslav Kvapil Schillers »Wallenstein« durch schöne Bilder und Bewegungen vervollständigt, man spielt jetzt die Trilogie am tschechischen Theater in Prag mit vielem Glück. Jetzt erst sehe ich, wie das eigentlich war, dieser Krieg, wie schön Spitzenkragen und zackiges Linnen zu Lederkollern paßt, wie gepanzerte Männer im Marschieren klirren, wie eine rote Schärpe irgendwie einen hohen Rang bedeutet. Sehr schön wirken auch lange, glänzende Goldquasten an dunklen Kniehosen, diese Quasten führen ein ganz selbständiges Leben und, ob nun ihr Träger steht oder sich erzürnt, immer wissen sie auffallend zu schlenkern. Doch das Beste war es, daß sämtliche Szenerien (ohne das Lager natürlich) weiße Wände waren. Reine, weiße, kahle Wände, in die nur hölzerne Türaufsätze oder Fensterrahmen braune Lücken schnitten. Solche Wände rufen sofort in mir das Gefühl wach, daß es lange her seitdem ist, lange, lange vorbei. Ich weiß wirklich nicht, ob das der Wissenschaft entspricht, ob wirklich zur Zeit jenes Krieges im Rathaus zu Pilsen und in Eger so weiße Gespensterwände sich spannten. Einerlei. Diese Wände bedeuten für mich »Dreißigjähriger Krieg«, überdies auch jede andre vergangene Zeit. Vielleicht kommt das daher, weil die alten renovierten Burgen, die ich besichtigt habe, alle so frischgekalkte, saubere, billige Wände hatten, ohne viel Bemalung ... Und so war es auch gestern auf der Bühne. Große, ja gigantische weiße Flächen, wenig Möbel, hier und dort ein Fresko in dünnen harten Farben. Ich dachte an die Burg Karlstein, wie sie jetzt ist, an hypothetische Vergangenheiten, schließlich an die leibhafte Historie. Was für Menschen, denen so in die Augen stechende Einfachheit genügt! Sie scheinen nicht auf lange sich einzurichten, nirgends, morgen wird alles zusammengeschossen. Wieviel Waffen und Quasten hat so ein Kerl auf sich, aber die Prunksäle sind weiß wie Wäsche auf der Bleiche, sind leer, als sei man eben im Umzug begriffen ... Und sehr gut paßte es da herein, wie Herr Vojan den Wallenstein spielte. Müde, fast resigniert, bleich, in sich gekehrt, langsam. Häufig sprach er nicht oder schloß im Reden für lange Zeit die Augen. Das rührte mich sehr, denn das sah dann genau so aus wie die weißen Wände ringsum. Es war förmlich ein Echo dieser Wände. Und man fühlte im Herzen, was Schiller geschrieben hat: die Tragödie niedersteigender Sterne.
Das Erlebnis, das mich in diese abschüssige Bahn gestipst hat, war nur sehr einfach:
Ich wollte einmal Italienisch lernen und kaufte mir deshalb eine rühmenswerte Grammatik »Parla ella italiano?« samt angefügten Konversationsübungen.
Bei diesen Gesprächen stockte ich, las immer langsamer und wie hingegeben: »Ich habe recht gut geschlafen« – »Das freut mich sehr« – »Es freut mich, Sie wohl zu sehen« – »Befindet sich Ihre ganze Familie wohl?« – und immer gieriger wurde ich da, immer weniger interessierte mich die Übersetzung ins Italienische, bis ich schließlich einsah, daß der Inhalt mir Vergnügen machte, die spannende Handlung, und nicht mehr das nützliche Sprach-Erlernen. In meiner Vorstellung kamen ganz deutlich Zimmer, Gartenwege, Bäche, über die hinweg die Gutsnachbarn miteinander Unterhaltung führen. Mehr und mehr erregt erkannte ich Situationen, die Haltung und die Vorgeschichte. Schließlich im Weiterlesen wußte ich, daß diese Dialoge eine dramatische Wirkung auf mich hatten und demnach bestimmt waren, in meinem leeren Herzen Ersatz zu sein für alle Theaterstücke, an denen ich damals gerade die Lust verloren hatte ...
Wie eindeutig und, hat man diese eine Deutung ein für allemal in sich, wie klanglos spielen sich die Szenen der üblichen Dichter ab. Einige Leidenschaften, schon seit langem veraltet, einige Lächerlichkeiten mit weinerlichem Glanz erfüllen die Bühnen Europas ... Schön natürlich sind die Kulissen, die Ballette, die Ausstattungsstücke, schön für immer und unerschöpflich, weil diese Unerschöpflichkeit in uns liegt. Was soll man aber dazu sagen, wenn immer noch Heerführer überredet, Frauen verführt, Söhne verflucht werden. Solche Gespräche, akkurat eingeklemmt zwischen die handelnden Personen wie ein Hals in die Aussparung der Guillotine, wollen mich nicht glücklich machen.
Dagegen Luft in bester Menge geben die Dialoge meines Konversationsbuches. Da finden sich tragische: »Was gibt es für Neuigkeiten?« – »Ich weiß nichts.« – »Was wünschen Sie, daß ich tun soll?« – »Ich beschwöre Sie, es zu tun« ... Anmutig pastorale wie der ganze Abschnitt über das Wetter und über Ausflüge ... Derbkomische: »Haben Sie Mäuse in Ihrem Hotelzimmer?« – »Nein, aber meines Oheims Freund wird eine Falle kaufen« ... Auch das Tempo wechselt; überstürzte, gleichgültige, gezogene Partien lassen sich unterscheiden ... Die Charaktere treten vor, wechseln aber in jeder Zeile beinahe, wie dies bei komplizierten Naturen nicht überraschen kann. Fast nie wird eine Angelegenheit ganz erledigt. Man respektiert die Chiffre, das Halbverschwiegene. So haben diese Sätze, ungewiß woher gesprochen und wohin, und dennoch ganz sicher gesprochen, den fast mystischen Reiz und die wirksame Undeutlichkeit diophantischer Gleichungen, in denen zwei Variable eine konstante Beziehung bewahren ... Ich sehe es voraus, daß man in Zukunft nur solchen Schattenspielen gestatten wird, die Phantasie in Wallung zu bringen.
Ich habe beständig Einfälle, von denen ich wohl annehmen darf, daß sie einem Regisseur ganz hübsch zugute kämen. Immerhin sehe ich ein, daß unsre Zeit für diese Einfälle noch nicht reif ist, und deshalb vermeide ich es, besondere Sorgfalt auf ihre Ausarbeitung zu verwenden. Kunterbunt, so wie sie mir durch den Kopf marschieren, seien sie hier aufgezeichnet, und manche werden wohl eher nur der Anfang eines Einfalles als Einfälle genannt werden. Tut nichts; sollen sich die mit ihnen Mühe geben, die später von ihnen profitieren wollen! Ordnung in diese unreifen, halb ausgereiften Pläne bringen: das ist meine Sache nicht. Möge man nur deshalb nicht das Ganze für einen Scherz halten ...
Also ich ertappe mich oft dabei, im Theater, bei langweiligen Szenen (und das sind so viele!), daß ich schon gar nicht mehr auf das klangreiche und doch wieder so klanglose Gerede aufpasse – sondern plötzlich habe ich, beispielsweise, die Lehne eines glattpolierten Alt-Wiener Sessels auf der Bühne ins Auge gefaßt und amüsiere mich damit, ein Pünktchen des grünlich durchs Fenster einfallenden Mondes auf dieser Lehne zu verfolgen. Wie es behaglich da festsitzt und aus sich heraus strahlt, als eine Filiale des Mondes, dieses Pünkterl, ja als ein Mond für sich. Und mit jener Leichtigkeit, die ätherischen Dingen eigen ist, rutscht es das harte, glatte Holz entlang, ohne eine Spur von Sentimentalität, von Heimweh nach der frühern Ansiedlung, falls eine der Bühnenfiguren eben diesen Sessel in die Hand nimmt. Ist das nicht interessanter als das ganze Drama? Der grüne Punkt, die Blüte des Mondes, entfaltet sich auf einmal und bedeckt den Seidensitz des Sessels eiligst und doch so zart, daß keine Dame der Welt mit einer auch nur annähernden Grazie so in diesem Sessel Platz nehmen könnte ... Und hieraus entspringt mein Vorschlag. Man führe keine Handlungen auf, sondern einfach Szenen aus dem Leben der Dinge. Der Vorhang geht auf. Man sieht ein kahles Zimmer, einen kahlen Tisch, auf dem Tisch brennt in einfachem Leuchter eine Kerze. Das Fenster ist geöffnet, ein Nachtwind kommt herein. Die Kerze flackert, erhebt sich, sie kämpft, sie wirft Lichter die Wand hinauf und hinab, sie wird schwächer, es war aber nur eine List von ihr, gleich darauf brennt sie in voller Leuchtkraft, glänzend, aber auch dies war nur Schein, sie hat sich erschöpft, sie glimmt nur, atemlos zittert das Publikum, der Wind verstärkt sich, wie zum Hohn entfacht er sie, galvanisiert gleichsam die Leiche, sie erlischt – und das vollkommene Dunkel des Zimmers nun, in dem nicht einmal die schwarze Fensteröffnung sich abhebt, unterscheidet sich vom schwächsten Glimmen viel mehr als dieses Glimmen von der hellsten Helligkeit. Diese Einsicht erschüttert jedermanns Herz ... Ja, ich würde mit dem Luxus der Ausstattungsstücke gründlich aufräumen. Nichts habe ich im Kopf als lauter Reformen. Keine Ballette, keine exotischen, hängenden Gärten, keine venezianischen Serenaden! Ich würde das Publikum zum Genuß des Details erziehen, der verachteten groben Umgebung. So hat man ja auch früher gemeint, man könne Stilleben nicht anders malen als mit üppig getriebenen Pokalen, über Prunkteppiche hingebreiteten Hasen, Rehen und Auerhähnen, den Strecken ganzer fürstlichen Jagden, den Weinernten Italiens, mit schwellenden Pfirsichen und Guirlanden süßester Rosen. Bis Cézanne auf einen Bauerntisch neben einen Krug ein Laib Brot legte und das schöner oder ebenso schön war wie die verschwenderischen Holländer. So habe ich auch bei Bernheim ein Wunderbild des van Gogh gesehen, es stellte vor: einen rohen Sessel, der die ganze Fläche der Leinwand einnimmt, und auf dem Sitz steht eine brennende Kerze. Zu gestehen, daß ich diesem Bilde die Inspiration zu der obigen Kerzen-Tragödie verdanke, hieße, die Schlußkraft, das literarische Feingefühl und das Ahnungsvermögen meiner Leser beleidigen.
Schön wäre auch ein Zyklus: Schreibtische. Der des Ministers, des Direktors, des Professors, des Dichters, des staatlich angestellten Diurnisten, der Schreibtisch eines »höhern Wesens«, eines eleganten Fräuleins, eines Gelangweilten ... Der Vorhang geht auf. Man sieht, was man sieht. Schluß. Keine Erklärungen, kein überflüssiger Lärm. Eine Katze schleicht zwischen stürmisch beschriebenen Papieren, und man weiß, es handelt sich um den Dichter. Ich selbst übrigens fürchte mich vor Katzen. Aber natürlich wäre auf individuelle Abweichungen hier keine Rücksicht zu nehmen.
Das Butterbrotpapier, nach dem gleichnamigen Gedicht von Christian Morgenstern, dramatisiert, gäbe eine weitere prächtige Bereicherung des Repertoires.
Leben und Treiben in einem Korridor. Die Bühne ganz schmal, unendlich tief. Fenster an Fenster, jedes wirft seinen Lichtstreifen über den Boden. Viele Türen, numeriert. Wir sind in einem öffentlichen Gebäude. Hauptfinanzamt oder so etwas. Die Katze aus dem benachbarten Dachzimmer des Dichters schleicht vorbei. Spucknapf. Darüber warnende Inschrift, nicht daneben zu spucken. Eine Maus. Auch Menschen werden geduldet, sofern sie sich mit ihrem Seelenleben nicht vordrängen. Beamte, fröhlich und trüb. Bureaudiener bringt Bier, Gabelfrühstück. Agent mit Barttinkturen, Zahnpasta, Junggesellen-Knöpfen, die man nicht annähen muß. Privatparteien, sich verirrend. Wieder alles leer; Katze, Maus, Spucknapf, Sonnenstreifen. Schöne Dame erscheint, läßt ihren Freund für ein Gespräch und einen kurzen Kuß aus seinem Bureau rufen. Sie gehen auf und ab. Ab. Es hagelt, ein Fenster zerbricht. Ensemble der herbeistürzenden Diener. Wir hoffen, daß die Dame vor dem Unwetter nach Hause gekommen ist.
Der Kahn. Die Bühne stellt den Rand eines Flußbades dar, ein Brettersteg, Geländer. Im Wasser der Kahn, zur Seite. Er schaukelt, ein Dampfer ist vorbeigefahren. Köpfe schwimmender Mädchen, in roten und gelben Badehauben, von ferne ähnlich Turbanen. Brennende Sonne, Wassergeruch und Holzgeruch, hier scheint es gesünder zu sein als im obigen Korridor. Der Kahn füllt sich mit Wasser. Unberechenbar bewegt er sich, stößt an seine Nachbarkähne, er führt ein eigentümliches Leben. Knaben schöpfen das Wasser aus. Ein fescher Herr vom Ruderklub dankt ihnen durch ein paar Püffe, steigt ein und, futsch, ist er davongefahren, über das glitzernde Wasser.
Jetzt ein Traum meiner Jugend: Das Seebeben. Hat man schon einmal bemerkt, wie das Wasser in einem Lavoir schwankt, das man mit mangelhafter Geschicklichkeit trägt? Es legt sich gleichsam mit seinem ganzen dicken Leib, eine einzige Welle, zunächst auf die eine Seite des Lavoirs und, nachdem es hier gehörig übergespritzt ist, liegt es schon wieder ebenso heftig und schwer auf der andern Seite. Wie eine Bleimasse scheint einem das Wasser, so gewichtig, und was seine Flüssigkeit dabei anlangt, flüssiger als ein Wasserfall, direkt haltlos, sinnberaubt ... Dies alles auf ein ungeheures Meer übertragen, und man hat das, was ich mir unter Seebeben vorstelle, wovon ich bisher leider weder ein Bild gesehen noch eine Beschreibung gelesen habe. Ich wäre jedoch schmerzlich enttäuscht, falls dieses gewaltige Elementarereignis einfach so vor sich ginge, daß das Meer Wellen, nur etwas größere als sonst, würfe. Das würde ja ein Sturm sein, nicht viel mehr. Nein, die Natur übertrifft gewiß unsre kühnsten Träume. Das Meer bildet eine einzige Fläche, ich bitte darum, von Asien bis Amerika, und diese große Fläche steigt auf, stellt sich schief, erhebt sich bis an die zerreißenden Wolken, sie senkt sich wieder, und dumpf wie das Schicksal richtet sie sich auf der andern Seite empor, diese ungeheure Schaukel. So wie das Verdeck eines Schiffes schlingert ... Sache des Regisseurs ist es nun, dies auf die Szene zu bringen. Ich würde es so machen: Eine Hafenstadt, die nachts in ihrem unglücklichen Schlaf von einem Ausläufer des Seebebens überrascht wird. Das Wasser ist bis zur Höhe der halben Bühne gestiegen. Jetzt bemerkt man, daß es leise schwankt, in seiner ganzen Oberfläche, die an der Seite der Bühne emporklettert und wieder fällt. Kein Rauschen, kein Getöse. Es sieht beinahe sanft aus: wie eine Mutter, die ihr Kind in den Schlaf wiegt, wie eine große Wiege. Damit aber kontrastiert aufs gräßlichste die Hast in den dunklen Gebäuden, die aufleuchtenden Fenster, die sofort wieder im Wasserschwall erlöschen, das Rufen treppauf und treppab. Die Häuser stehen noch, es sieht fast aus, als seien sie zu dem Zweck gebaut, unter Wasser zu stehen, wie die Paläste der Stadt Vineta. Aber der Zuschauer ahnt, daß sie schon unterwaschen sind, daß sie nicht lange mehr standhalten können. Und während die unheimliche Flut lautlos, ohne Grausamkeit, wie gesagt, ihre Wiegebewegung fortsetzt, brechen plötzlich in dem Moment, wo man es nicht mehr erwartet (warum gerade jetzt? warum nicht früher?), alle Häuser samt der Domkirche in die Knie. Sie werden in Trümmern davongeschwemmt, die Stadt existiert nicht mehr, die Flut wiegt sich noch immer.
Ein freundlicheres Bild: Die Liebenden in der Landschaft. Ein heiß verliebtes Paar hat einen Ausflug unternommen, und während sie dahinschreiten, verwandelt sich die Gegend, natürlich nur für ihre Augen. Der geschickte Redakteur leiht uns ihre Augen. Nebst der Sonne glänzen alle Sterne am Himmel, der Mond, zwei Kometen, deren Schweife je einem des Paares Luft zuwedeln. Es ist sehr heiß. Der Bach, an dem sie gehen, ist aus Silber, die Waldbäume aus patiniertem Kupfer, die kleinen Küchlein bei der Hütte aus Gold. Sämtliche Singvögel sind Virtuosen in ihrem Fach. Eine Wiese wird zu dem Gefieder eines sagenhaften Riesenpapageis, der sie über alle Lande hinwegträgt, an träumerischen Aussichten vorbei, wobei er immer den Namen eben dieser beiden Menschen in die Luft hinausschmettert, als hätte er mehr nicht gelernt. Dies alles ist aber nur die erste Stufe der Zauberei. Mit einem Schlage ist die ganze Umgebung zurückverwandelt, ist gewöhnlich und ordnungsgemäß Wiese, Bach, Wald, aber trotzdem ist sie für die beiden gänzlich neu, sehenswert bis aufs äußerste, noch nie dagewesen. Sie sagen es einander. (Der geschickte Bühnenkünstler sehe, wo er bleibe.) Hierauf fragen sie einander, wann der letzte Zug nach Prag zurückfährt. Ihre Gespräche sind nicht sehr belangreich, wie man sieht. Der erquickte Zuschauer jedoch überhört geduldig einige Dummheiten und Kindereien, da er durch den Anblick dieses reizenden Ausstattungsstückes genugsam entschädigt ist.
Von hier aus, von der Kleinstadt, stelle ich mir manchmal eine Redaktion wie einen ungeheuren Palast vor, der seinen Lärm in die dunkeln Nebenstraßen wie eine Ausstrahlung verbreitet. Noch ehe man ums Eck biegt, fühlt und sieht man an allem: Ah, jetzt kommen wir zur Redaktion ... Geflügelte Stiere bewachen das Portal, und wer vorbeigeht, nimmt den Hut ab. Der Unterbau des Palastes besteht ganz aus riesigen Rotationsdruckmaschinen, die so kompliziert wie Rechenmaschinen (als der Erfinder sie zu Ende erdacht hatte, kam er ins Irrenhaus), aber zweihundertmal so groß aussehen. Im ersten Stockwerk geschehen Musterbeispiele der Dinge, die von den Redakteuren in der nächsten Nummer beschrieben werden müssen: ein Pferd stürzt, der erste Schnee schwebt nieder, Armeen ziehen vorbei, Parlamente debattieren, ein Aviatiker nimmt von seiner Mutter Abschied, Schauspieler in ihren Kostümen sprechen erhebende Verse. In der nächsten Etage, die durch ein kompliziertes Treppensystem mit der untern verbunden ist, gibt es nichts als Telephone, ungeheure Fernrohre, Bahnhöfe für Expreßzüge, Warenmagazine, Kinematographen – kurz ein solches Durcheinander aller Kultureinrichtungen, daß dem Beherztesten der Mut sinkt. Der Chefredakteur rollt auf Flügelrädern durch lange Galerien, in denen seine Angestellten laut schreiend schreiben, die Füllfeder an seinem Gürtel ist wie ein diamantbesetzter Degen. Durch das offene Fenster sieht man auf den Hof, wo Nachrichten und Herzensergüsse aufgestapelt werden, aus andern Höfen führen Fäden zu allen Städten des Kontinents und Amerikas ... So stelle ich mir das Redigieren vor, und das ist eigentlich meine regelmäßige, natürliche Ansicht, die ich nur dann unterdrücken kann, wenn ich das Wort »Redaktion« mit absichtlicher Schnelligkeit und Unachtsamkeit ausspreche.
Komme ich aber nach Berlin oder Paris, so sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Ich muß lange das Haus der Redaktion unter fünfzig gleichartigen derselben Gasse herausstöbern, niemand spricht noch in der nächsten Nähe dieses Hauses von Dingen, die man als Ehrfurcht gegen ein so ungeheures Etablissement deuten könnte. Noch der Krämer nebenan scheint nicht zu ahnen, daß gleich benachbart eine Redaktion ist, und hält sich selbst offenbar für wichtiger. Ein Kind spielt Reisen, es ahnt nichts. Ein Lastwagen poltert durch die merkwürdig unbelebte Gasse. Und nur ein kleines Emailschildchen heißt »Simplizissimus« oder sonst etwas, ganz ebenso große Schildchen hat ein Rechtsanwalt und ein Schreibbureau im Toreingang ausgehängt. Oft muß ich sogar an Pflaster und Blumen vorbei ins Hinterhaus gehen, an ruhigen, mit sich selbst beschäftigten Dienstmädchen oder Mietern vorbei. Und dann empfängt mich an einem gewöhnlichen Schreibtisch ein gar nicht mystischer Herr, spricht die üblichen Dinge, während ich das einfache Mobiliar betrachte: ein paar Bücher, einen Telephon-Tischapparat wie in jedem größern Geschäft, Briefe, ein Sofa, einen Briefordner, einen Kunstdruck an der Wand ... Und da überfällt mich immer wieder derselbe Gedanke, den ich jetzt ausdrücken möchte. Ich fühlte mich überlistet. Es erscheint mir plötzlich wie eine bloße Übereinkunft, eine Legende, daß von diesem ganz unmerkwürdigen Zimmer so viel Erschütterung und Macht ausgeht. Warum gerade von hier aus? Wo sind die Fäden? Ist die Druckerei hinter der Wand? Wo laufen die Verbindungen zu dem Kapital, zu den Autoren, zu den Setzern an ihren Kästen, zu den Verkäufern in ihren Kiosken auf den Boulevards? Ist es nicht ein bloßer Aberglaube, daß sich diese Verkäufer immer wieder an dieses in nichts ausgezeichnete Zimmer wenden und an andre nicht? Man müßte sie aufklären über ihre Verblendung. Man müßte vor allem einmal folgenden Versuch machen: ein Zimmer mit sklavischer Genauigkeit nach einem wohlrenommierten Redaktionszimmer einrichten. Ich würde es dann übernehmen, mich ruhig wartend an den Schreibtisch zu setzen, das getreu nachgebildete Elfenbeinmesser in der Hand. Ich bin überzeugt, es müßte auf diesem Wege plötzlich eine mächtige Zeitschrift entstehen. Entsteht sie nicht, dann ist das nur ein Beweis dafür, daß die Kulissen des nachgemachten Redaktionszimmers nicht genau dem wirklichen gleichen. Ich fühle es: die richtig ausgestattete Bühne muß die szenischen Vorgänge in sich hineinziehen wie ein luftleerer Raum Luft in sich saugt. Nur ruhig warten und in die Wand schauen: plötzlich fühlst du das Kapital hinter dir, die Interessengruppen, alle Verhandlungen, die der Gründung vorangehen mußten, plötzlich ist alles da, wie etwas Vergessenes im Gedächtnis auftaucht und doch von jeher da war. Und du fühlst, daß du in diesem Moment Menschenhände in einer fernen Setzerei bewegst; der Telephonapparat, der ein bloßes Bühnenversatzstück ist und gar nicht an die Leitung angeschlossen, funktioniert in diesem Augenblick, du weißt es und du zweifelst nicht. Ohne Elektrizität klingelt die Signalglocke. Du erteilst Weisungen, Ratschläge, Entscheidungen. Du bist ein lebendiger Machtfaktor. Ein Unterbeamter, von dessen Existenz du bisher nichts geahnt hast, tritt herein, legt Ausarbeitungen vor, die du ihm gestern aufgegeben hast, wie es scheint. Andre danken für empfangene Vorschüsse. Und ohne daß du dich von deinem Platz gerührt hast, hörst du mit einem Mal, wie draußen vor dem Fenster die Zeitungsjungen den Titel deiner Zeitschrift in die Luft brüllen, wie sie die noch klebrigen Blätter, die nassen, schwarzen, zischenden Lettern entfalten und schwingen, wie sie rennen und so schnell den Vorbeigehenden das Papier in die Hand stecken, daß man meint, sie reißen es ihnen aus der Hand ... Überdies bist du gar kein Schwärmer für Zeitschriften natürlich, im Grunde hältst du alle für überflüssig. Nur einmal hast du es aus wissenschaftlichem Interesse probieren wollen, ob man eine Zeitschrift nicht intuitiv von innen heraus gründen kann, mit Hilfe der Bühnenausstattung eines Redaktionszimmers, statt rationalistisch mit den langweiligen Maschinerien der Welt.
Um mein Problem zu formulieren: ich möchte den genauen Anteil suchen, den das Bühnenmäßige an den Vorgängen des Lebens hat.
Dasselbe gewöhnliche Zimmer, als Gerichtssaal eingerichtet: und ganz gewiß werden bald Richter, Zeugen und Angeklagte da sein. Die Ähnlichkeit der äußern Situation, sofern sie nur täuschend und exakt ist, muß die gewohnten Vorgänge des Lebens heranlocken ... Ebenso glaube ich, daß ein Sterbender sofort dem Tode entrinnen müßte, wenn man ihn aus der gewohnten Sterbeumgebung, aus diesem Bett und Nachthemd und Kästchen nebenan mit den farbigen Arzneien in Fläschchen, aus dieser Luft und den das Ende heranzagenden Freunden, plötzlich auf die Straße versetzte, an eine Straßenkreuzung, wo die Reihen der Automobile vor dem weißen Stab des Polizisten stocken, wo alles schreit und läuft und jeder Passant eher dem nächsten absichtlich auf den Fuß treten würde als an Sterben denken. Wenn man aufpassen muß, daß einem im Nachtwind nicht der Hut in die nächste Pfütze fliegt, hat man keine Zeit zu sterben. Die Szenerie ist es, die mordet und das Leben rettet.
Sie machte ein ernstes Gesicht. Und nicht nur deshalb, weil ihr dies gut stand. Sondern sie war wirklich traurig.
Der junge Mann, namens Carus, der, ihr gegenübersitzend, das eine Bein durch das andre gehoben hielt, tröstete sie: »Schau, ich hab' dich wirklich nicht kränken wollen, Kindchen. Aber wie sollen wir es anders anstellen, um aneinander Freude zu haben. Heiraten kann ich dich nicht, du weißt, daß ich zu wenig Glück im Beruf habe. Also mußte ich dich doch einmal bitten, meine Geliebte zu werden, nicht wahr.«
Jetzt weinte sie schon.
Das dunkle Hofzimmer nur mit einem Fenster und schmal wie ein Fernrohr blieb eine Weile still, während die Dämmerung anbrach. Plötzlich setzte unten laut das überraschende und häßliche Geflöte eines Leierkastens ein ...
Da stand der junge Mann auf und, während er die Fransen der Tischdecke zu regelmäßigen Bündeln ordnete, bat er das weinende Mädchen in leisen Sätzen, verständig zu sein, ihm nicht zu zürnen.
Martha erhob den Kopf, noch fielen zwei Tränen, sie sagte mit Energie: »Nein, Carus. Überwinde dich, sei ein Mann. Ich werde immer stolz darauf sein, wenn du mich als deine Freundin betrachtest. Aber niemals kann ich dir das werden, was deine Träume dir vorspiegeln. Verlange es nicht von mir, du selbst würdest mich verachten, wenn ich mich und meine Ehre vergäße. Ich muß doch einmal Klarheit zwischen uns schaffen: Du bist mein Freund, mehr nicht, also bleibe so, wie du warst.«
»Klarheit schaffen ... Ich bitte dich, laß das. Ich verzichte auf jegliche Klarheit.«
»Aber das Leben ist einmal so, klar und unerbittlich.«
»So kennst du es, arme Kleine. Natürlich, wenn man seit seinem sechzehnten Jahr ganz selbständig in einer großen Stadt sein Brot verdienen muß. Und gar durch Klavierstunden ... O, wie schlimm ist es dir ergangen! Man hat dich immer betteln und kämpfen lassen, und schließlich hast du dich gewöhnt, dies als den gerechtfertigten Lauf der Welt anzusehen. Nie ist dir eingefallen, daß alles ganz anders sein könnte, ein wenig ›operettenhaft‹, wie Jules Laforgue es wünscht. Ah! que tout n'est-il opéra-comique! Que tout n'évolue-t-il en mesure sur cette valse anglaise Myosotis!...«
»Was willst du eigentlich damit?«
Carus öffnete den Deckel des Pianinos und drückte im Dunkeln so langsam einige Tasten nieder, daß kein Ton erklang: »Meine Liebe, du nimmst die Sache viel zu wichtig.«
»Welche Sache eigentlich?«
»Ach Gott, alles. Und deine so ernsthafte Erklärung mit schweren Worterbstücken wie: Ehre, verachten, Klarheit schaffen, Freundin, Träume vorspiegeln ... Wie schön wäre es, wenn du ein einziges Mal diese Logik vergäßest, die doch zu gar nichts taugt! Das Leben ist nicht so hart und endgültig, wie es dir vorkommt. Es gehen immerhin witzige Dinge darin vor. Warst du, beispielsweise, schon einmal im Vorstadttheater draußen?«
»Nie.«
»Bitte, komm morgen mit mir hin! Man spielt zwar tschechisch dort, aber so viel verstehen wir ja. Und wenn nicht, um so operettenhafter ist es. Du willst? Also gut, ich hole dich morgen um diese Zeit ab. Du wirst etwas Unterrichtendes erleben ... Aber jetzt, sei nicht mehr böse, gib mir einen Kuß ...«
Es ist hübsch, wenn Rendezvous pünktlich von beiden eingehalten werden.
Und so geschah es auch in diesem Fall.
Arm in Arm denn betraten die Beiden das Foyer des Vorstadttheaters. Aus einem Privathaus hergerichtet, das nur durch transparente Buchstaben und den wagerechten großen Glasfächer über der Tür auffiel, empfing es in einem bunt mit Solenhofer Platten gepflasterten Raum, der rechts Garderobe, links Konditorei hieß. Von hier kam man in einen schmalen Gang, Schauplatz der Zwischenakts-Promenaden, von roten Plüschkanapees an den Seiten in die Länge gezogen, mit Glühbirnen, Photographien des Direktors unter seinen besten Kräften, und mit einem goldgerahmten Spiegel versehen, den als Gegenstücke der Apoll vom Belvedere und die Königin Luise nach Rauch bewachten. Ein gutmütiger Eisenofen machte bieder auf die fehlenden Siebe der Luftheizungen aufmerksam. Eine Palme, von Staub weißlich gepudert, erinnerte an den Orient.
Über ausgebeulte Holztreppen stolperten Carus und Martha lachend in ihre Loge. Die aber war keineswegs ein Zimmerchen, wie sie es von den langweiligen großen Theatern her gewohnt waren, sondern nur ein durch rote, sammtbortierte Pappwände in Ordnung gebrachter und abgeteilter Luftraum. Über ihnen direkt schwebte die Decke und an ihr eine Posaune aus Stuck, lebhaft geblasen vom Zentralengel des Plafonds. Er hielt sie dezent und edelmütig, kaum geängstigt durch die sezessionistischen Blumen, die mit gesteiften, parabolischen Stengeln auf der Tünche um ihn wucherten ... Neben der Loge gleich hockten dichtbesetzt die finstern Bänke der Galerie; es drückten sich Dienstmädchen, Soldaten, Modistinnen, ein ganz kindlicher Pikkolo in seiner Amtstracht, alte Frauen in Sonntagsjacken mit sehr großen Perlmutterknöpfen und mit Tüchern um den Kopf, ein witziger Hausmeister, Arbeiter, Bankdiener, markensammelnde Gymnasiasten, Ladenfräuleins, Lakaien, schöne Kommis. Und alle bewegten sich, redeten mit lauter Gedämpftheit, borgten einander die Operngucker, die Programme, riefen nach Bier, stritten um ihre Plätze, lachten. Es schien das Ganze nicht unähnlich einem religiösen oder zwecklosen Tanze, ins unsichere Licht weniger Lampen gestopft, stückweise wiederholt von schiefen Spiegeln, die hier und dort unter Thronhimmeln aus dem braunen Dunkel funkelten, umrahmt von dem weiten Wandbogen, dessen Papiertapete wie lustige Flaggen ihre Fetzen herabwehen ließ ...
»Das Parterre ist wenig besetzt,« meinte Martha.
»Da brauchst du auch nicht hinzusehen. Hier wird für die Galerie gespielt. Und für uns, wenn wir heute ein bißchen kindisch sein wollen. Wollen wir?«
»Ja natürlich. Mir gefällt's schon großartig.«
Der eiserne Vorhang ging in die Höhe. Aber da hatte des andern kostbare Teppichflut, rubinrot und von goldenem Tau mit großer Quaste gerafft, noch nicht vollständig die Erde erreicht. Die eiligen Füße der Mitspielenden sah man, ein überraschtes Getrippel im Rückzug; niemand nahm das übel. »Die Regie wird hier nicht so ernst genommen,« erklärte Carus, »und gerade deshalb bin ich gern da. Wie dumm ist dagegen dieser würdevolle Zusammenhang, die Logik der großen Bühnen. Dort wird man auch bei den hitzigsten Possenspielen, die allen Ernst verbannen wollen, doch das Gefühl nicht los, daß all das etwas Ernstes ist, daß es im Grunde streng und akkurat zugeht, daß alles mit Berechnung eingeübt und von dem zweckmäßigen Herrn Regisseur hinter der Szene peinlich belauert wird. Hier läßt man sich, gottlob, gehen, hier darf man sich in Träume, Possen, Auflösung verlieren ...«
Nach einer sehr lauten und auf scherzend verstimmten Instrumenten vorgebrachten Ouvertüre, die vage Erinnerungen ans Spezialitätentheater auftauchen ließ, stellte die Bühne ein elegantes Zimmer vor. O Eleganz für naive Seelen! Luxusidee der Vorstädter! Komfort, angedeutet durch einen großen – sagen wir Perserteppich! Außer diesem und zwei Sesseln befand sich nichts zwischen den drei mit blauen Blumenkörbchen gemusterten Wänden. Nur im Hintergrund führten zwei Stufen zu einer Estrade mit einem Tisch, dessen Weinflaschen eine dunkle, etwas geneigte Leinwand stützend in aufrechte Lage erhielten. Da diese Leinwand mit Blättern und Ästen bemalt war, mußte man sie für die Aussicht in einen Garten und gute Luft in weitem Umkreis um eine offene Veranda halten.
Ein Vater in luxuriös-abgeschabtem Frack betritt mit seiner ungarisch kostümierten Tochter seiner Besitzung Prunkgemach. Er zankt mit ihr. Was will sie den Baron nicht heiraten, diesen entzückenden und ehrfurchtgebietenden Altadeligen! Er spricht wie ein Salamifabrikant und Parvenu, der er ist. Jetzt sind Gäste zur Verlobungsfeier geladen; der komische Diener kann es in seiner rettungslosen Betrunkenheit nicht mehr erwarten, sie zu melden, und Ilka denkt immer noch an ihren Cousin, diesen feschen Husarenleutnant. Sie weint, der Vater ist verzweifelt. Dann tanzen sie miteinander einen zornigen Csardas ... Beifall. Sie geraten noch einmal in Zorn und Csardas ... Ilka bleibt und singt. Wo bleibt nur der Cousin, dieses süße Ekel?... Aha, da ist er schon, es entsteht keine Lücke in der Handlung! Prachtvoll: sechs Husaren marschieren hintereinander herein, weibliche natürlich, mit runden Armen und herausgedrehten Becken, und dann er, der männlichste aller Husaren. Er beeilt sich, ein triumphierendes Couplet ins Publikum zu salutieren; dann erst hat er Zeit, die harrende Cousine zu bemerken. Er salutiert wieder. Er salutiert überhaupt unaufhörlich, und wenn irgend jemand in dem Stück seine Überlegenheit bezweifeln sollte, so wird er auch dann nur salutieren und alles wird klar sein. Eljen!
»Siehst du, so nett und gar nicht traurig ist das Leben,« wandte sich Carus an Martha, die lächelte.
Und dann das Finale. Man sieht es herannahen, man fühlt es förmlich, daß der Akt reif ist. Zum Crescendo des Orchesters eilen aus allen Kulissen Leute; Gastgeber, Gäste, den Baron und seine hochmütige Mama, die Husarendamen mit ihrem Helden; sogar alle Dienstmädchen und Köche des Hauses sind gern dabei, wo es gilt, den Chor zu verstärken. Die Bühne wird zu eng. Die Wände zittern, die Gartenaussicht wirft Falten. Die Türen pendeln aus und ein, noch lange, nachdem man sie geschlossen hat. Einige Gäste setzen sich zusammen auf einen Sessel. Das ist ein Witz, obwohl es tatsächlich an Sesseln fehlt. Mit Begeisterung wirft man sich auf die bemalten Holzstücke des Gänsebratens, sucht die wirklichen Äpfel aus dem Gummi-Dessert, schwenkt leere Gläser mit Unbedacht, zwickt die Choristinnen in passende Körperstellen, schlägt einem wenig beliebten Statistenkollegen den Hut ein und regt ihn hierdurch zu unerwartet ausdrucksvollem Spiel an. Eine Orgie entsteht, blitzschnell, schon sind alle betrunken! Nun gerät alles, aber auch alles, in ausdrückliche Unordnung; vor Übermut mißlingen die Einsätze, werden die Positionen und Gruppen verfehlt. Schnell erscheint noch eine Fee, auf dem Tremolo der Geigen anschwebend. Dann fassen alle einander an den Händen und tanzen in zwei Reihen vor, auch zurück, soweit Platz ist, werfen die Beine in die Höhe, machen gemeinsame Gebärden, natürlich nicht allzu pedantisch gemeinsam, unternehmen einen Cancan, lassen den Vorhang schnell wie eine Guillotine über ihrem tüchtigen Geheul herunterstürzen ...
»Ach, wie schön das ist, wie vollkommen schön!« ruft Carus.
Martha: »Hast du die Fee bemerkt? So eine junge Brust, ein schönes Mädchen. Es wäre schade um sie, hoffentlich wird sie entdeckt.«
»Du hast doch immer Sorgen, du Gute. Vielleicht wird sie entdeckt, vielleicht nicht. Scheint dir das so wichtig?«
»Das ist wahr. Hier ist alles so leichtsinnig, so frisch, daß man sich gar nicht vorstellen kann, es gebe außerdem wichtige Dinge.«
»Nun, so freue dich. Wir schweben, was liegt daran! Das Theater wackelt. Hoffentlich sind auch seine Kritiker reizende Menschen und seine Finanzen nicht übertrieben seriös. Glaubst du nicht, daß es ein durchaus liebenswürdiges Unternehmen darstellt?«
»Ich weiß nicht ... Aber eines ist sicher, ich fühle mich hier so frei, so glücklich ...«
»Alles ist wie Luft. Sei unbesorgt. Und ob du mein sein wirst oder nicht: ich bleibe munter ohne Schwere. Du auch, nicht wahr?«
... »Ich möchte dich küssen.« ...
Der zweite Akt brachte einen Urwald, nein, einen Schilfsee, nein, ein Gebirge, nein, eine Eisenbahnstrecke mit Stationsgebäude. Es war alles zugleich auf verschiedenen Kulissen zu sehen. Und man stand nun in einer mit Grazie unkonsequenten Welt, in einer launigen Kausalität. Da erlebte man, daß alles wie mit Erdbeersaft begossen war, ah! einen sympathischen Sonnenuntergang. Dann brach eine Dämmerung ein, die ruckweise fortschritt, so, als vergäße der liebe Gott immer eine Weile, es dunkeln zu lassen, besänne sich jedesmal und hole es dann plötzlich mit Energie ein. Nun in der Nacht, wer erwartet nicht Liebespaare an diesem Urwald-Eisenbahn-Gebirgs-Schilfsee zu treffen? Und da kommen sie schon, der Cousin mit Ilka; um nicht gestört zu werden, singen sie (selbstverständlich müssen sie ja singen) leise. Ab. Von der andern Seite schleichen mit der zweiten Strophe genau nach derselben, gleichsam verabredeten Melodie die Fee und der Baron. Ilka und Cousin kommen zurück. Man entdeckt einander, man ist überrascht, wenn auch nicht mit Heftigkeit, man tanzt eine Überraschungs- und Entführungsquadrille.
»Eine Entführung! Ah, jetzt verstehe ich, was das Stationsgebäude soll,« flüstert Carus mit dem erregt-dummen Gesicht eines kleinen Schülers.
»Gewiß wird ein Zug auf die Bühne kommen, ein Schnellzug. Das wird schön sein! Ich freue mich schon so sehr!« Wie ein Baby klatscht Martha in die Hände. Carus, sorgenvoll: »Wer weiß, vielleicht wird er nur hinter der Szene pfeifen.«
... Aber mir nichts dir nichts tauchen jetzt struppige Gesellen auf, langsam, aber die Hände vorgestreckt wie Leute, die aus dem Wirtshaus herausgeworfen werden, mit beschwörend eingeknickten Knien schleichend. Ah, Räuber! Nein, es ist nur eine wandernde Schauspielergesellschaft! Und nichts in der Welt ist selbstverständlicher, als daß sie genau hier im Walde ihre Probe abhält, wo zwei zerrüttete Liebespaare auf den Schnellzug warten. Natürlich strömen Bauern und Bäuerinnen aus dem benachbarten Dorfe herbei; slawische, ungarische, sizilische, spanische Kostüme, selbst Zigeuner, alles, was farbig und phantastisch ist. Und wie sorglos und anheimelnd wirkt auch die Art, in der windesschnell eine Bühne aufgezimmert, eine Zuschauerbank herbeigeschafft wird! Kurz und gut, alles ist bei der Hand, die Vorstellung kann beginnen ... Und nun ereignet sich in kaum möglicher Steigerung, daß diese auf der Vorstadtbühne dargestellte Landschaft noch einen Grad primitiver sein soll. Mit ihr verglichen, muß alles übrige auf der Szene als elegante Welt erscheinen. Was für Dekorationsruinen erfordert diese Schmiere auf der Schmiere, wie puppenhaft geschminkte Komödianten, welch ein exotisch unsinniges Theaterstück. Auf der höchstens quadratmetergroßen Szenenfläche pressen sich die Darsteller, mit übertrieben linkischen Gesten, von roten Flammen bengalischer Streichhölzer geblendet. Und jetzt spielen sie absichtlich, weil sie eben Dorfmimen spielen, nicht etwa von Natur aus, schlecht. Ihre Ungeschicklichkeit wird zur Kunst; wenn einer gierig eine Knackwurst ißt, so soll man seinem Hunger die Ironie glauben; einen Zerlumpten für einen Dandy sonst halten, eine komisch-alte Naive für nur heute häßlich. Und das Bauernpublikum auf der Bühne lacht und applaudiert ... Da verkennt das reale Publikum auf der Galerie die Sachlage, stimmt fröhlich in den Applaus ein und lacht mit, bitte, nur keine Umstände, lacht mit und zeigt sich in den Strahlen seiner wahrhaft volkstümlichen, unbeschränkten Toleranz. Nun ist alles verwirrt und versöhnt, man kennt sich nicht mehr aus, man muß einfach ein braver Mensch sein und mitlachen, lachen ohne Grund und Gnade und die Hände in einen ziellosen Himmel ausstrecken ... Und da wird noch schnell, unten auf der Bühne, entdeckt, daß der Cousin eigentlich ein lange vermißtes Kind der stolzen Baronin ist. Somit adelig, darf er Ilka heiraten, der Baron nimmt indes die Fee zur Frau. Martha schluchzt am Hals Carus', der vor Lachen gleichfalls außer sich ist, und nur durch Tränen sehen sie noch, daß als imposanter Schlußeffekt der Eisenbahnzug einfährt. Die übermenschlich große Lokomotive mit feuriger Laterne am Rauchfang bäumt sich an einigen Bäuerinnen empor, die keinen Platz haben, aus dem Wege zu gehen, stockt, macht noch einen Schritt und bleibt dann endgültig stehen. Die Liebenden bereiten sich zum Einsteigen, Carus und Martha wollen ihnen nachwinken, da fällt der Vorhang ...
In dieser Nacht gehörten sie einander zum erstenmal.
Es gibt eine Stufe im Jahr, nur wenige Tage, da scheint alles in Klarheit zu erstarren. Du mußt sie bemerkt haben, fühlender Freund, wenn du durch die erfrorenen Parkanlagen mit langsamem Nicken schreitest, wenn dein Herz urplötzlich der Seltsamkeit dieser einzigen Stunden so hingegeben ist, daß es in entfernte Gegenden entrückt scheint, auf kostspieligen Eisenbahnfahrten ... Der Herbst ist vorbei. Der Winter hat alles zerstört, entlaubt, verwühlt. Und auch dein Ach, mit dem du notwendig diesen Untergang akkompagniert hast, verhallte schon, du Lieber. Aber zum Vorfrühling ist noch weit, zu diesen nach allgemeiner Übereinkunft schicksalsvollen Erweckungen. Denn du siehst noch den Schnee in soliden, beinahe ewigen Flächen über die Wiesenbeete gehüllt, schollig aufgeschaufelt zu beiden Seiten des Parkweges und ein wenig angeschmutzt, ganz weiß aber in den Ästen. Er scheint flockig vor lauter Frische, du greifst ihn an, da pocht er dir steinhart in die Hand. Zwischen Winter und Vorfrühling trifft dich dieser Schlag wie mit Klang einer Glocke. Und nun verstehst du es: alles ruht ringsum, eine Pause von unendlicher Bedeutung ist eingetreten. Wenn du auch im wissenschaftlichen Bewußtsein hast, daß die Säfte in diesen Stämmen weiterkreisen: du siehst es nicht, nichts geschieht, weder verfällt etwas, noch lebt es wieder auf, der Tod ist vorüber und die Auferstehung noch nicht einmal angekündigt. Was will die Sonne? Sie strahlt gelblich zwischen Schatten der Zweige hindurch, etwas geht von ihr aus, was man eisige Wärme nennen möchte. Aber nicht vermag sie, und nicht vermag die milde, schnobernde Luft diesen harten, stillen Baumstämmen irgendwie Leben zu entlocken. Fremdartig wie ein körperlicher Gegenstand an einen andern Gegenstand fällt, so fällt das Sonnenlicht, mit Luft gemischt, an den hölzernen Baum, ohne Reizung. Baum und Sonne haben einander nichts zu sagen ... O einzige Stunde im Jahr, reinste, keuscheste, unausgesprochenste! Und auch du, Freund, halte die Tränen nicht länger zurück, geh' in Rührung den schräg geneigten Weg herab, der heute, da nichts wirkt, da auch die Schwerkraft aufgehoben scheint, deine Schritte nicht um ein Gran beschleunigen wird. Wie an einem kleinen schwachen Luftballon befestigt schreitest du herab, im Gleichgewicht. Vergiß es niemals, wie deutlich heute alle Dinge waren, innerlich ohne Zweck, ohne Beziehung aufeinander, wie ähnlich Kristallen. Daß eine Amsel vorbeihüpft, ist ein bloßes Naturschauspiel. Denn sieh, sie frißt nichts, sie sucht nichts, sie will nichts, sieht nicht ihr braunes Weibchen nebenan. Mit einem saubern Schnitt hat sich jedes Wesen heute aus dem Gemenge der Welt losgelöst, einzeln nun und friedlich blickt es in den lautern wolkenlosen Himmelsäther, entschlossen, für eine Zeit unverändert so zu bleiben.
Der zwölfjährige Klaviervirtuose Széll springt aus der Kulisse, förmlich befreit von etwas, was ihn dort festgehalten hat. Er ähnelt einem kleinen, aber festen Fußballspieler. Seine Schenkel in den kurzen Hosen sind dick. Eine Hand wirft er im Gehen vor und zurück wie ein Pendel, die andre wie ein Quirl beschreibt enge Kreise am Körper. Kaum kann er es erwarten, am Klavier zu sitzen, den Sessel in die richtige Höhe aufzukurbeln. Wie sehr kennt man diesen Eifer an wohlgeratenen Kindern bei ihren Spielen und Hetzen, wie natürlich dies alles ... Und nun, während das Orchester schon dem feurigen Schmerze des F-Moll-Konzerts von Chopin sich preisgibt, hält er sich mit den Fingern heftig an dem gekrümmten Holzprofil unterhalb der Klaviatur fest, förmlich um nicht gegen seinen Willen ins Spielen zu kommen. Den Kopf bewegt er im Takt, und sein Gesicht ist so zart und weiß, daß man es in der Luft verschwimmen sieht, nur von den blonden Haaren zurückgehalten ... Nun setzt er ein, fröhlich wie ein Kind, dem endlich in Gesellschaft Erwachsener zu reden erlaubt wird. Seine Läufe rutschen gesund und klar aus dem Gelenk ... Jemand flüstert neben mir: »So soll Chopin gespielt werden.« Nein, das ist natürlich falsche Begeisterung. Aber ich denke mir: »So soll von Kindern Chopin gespielt werden.« Oder noch deutlicher und wahrhaftiger wird es zum Gefühle »So mag Chopin, als er noch ein Knabe war, wie dieser hier, in kurzen, weißen Hosen, so mag er die Keime seiner zukünftigen Musik, seines zukünftigen Leidens mit ahnungsvollen Regungen in sich gespürt haben.« ... Der zerlegte Dreiklang, mit dem das Adagio beginnt und schließt, wie breitet er so sehnsüchtig die Arme aus nach einer Geliebten, die ihm immer ferner ins Höhere entschwindet. Noch einen Ton, noch einen gibt er zu, klettert zögernd empor, vergebens ... So pflege ich diese Stelle zu spielen, manchmal an Abenden, wenn die ganze mühevolle Erfahrung meiner Jahre sich in mir angesammelt hat. Ich übertreibe es vielleicht und bleibe minutenlang bei diesen süßen Noten ... Keine Spur davon heute. Und recht so, und bravo, lieber Széll, wackerer Knabe, du bringst das vorgeschriebene Diminuendo und das vorgeschriebene Ritardando, aber ist es deine Sache, vergiftete Tropfen von Liebe den zerlegten Dreiklängen zu injizieren, die musikalische Figur am Ende durch Überschwang zu zerstören? Und du springst im letzten Satz tapfer und richtig auf die weit entfernte F-Taste, aber ohne wahnsinnigen Zorn, denn wer sollte dich in deinem talentierten Leben gekränkt haben? Kurz, du spielst das ganze Stück so vorzüglich sauber, so freundlich und durchaus nicht ohne die angemessenen Betonungen, daß es mir heute in großen Formen entgegentritt und über allem Dampf menschlicher Leidenschaften. Ja, man sollte sich alle Musikwerke einmal von Wunderkindern vorspielen lassen. Das ist etwas ganz andres als das Spiel erwachsener Virtuosen, gereifter Männer, die ihre eigenen Erlebnisse kommentierend in die Akkorde einflechten, deren zerrissenes Herz schreit, getröstet wird und wieder schreit ... Heute erinnert mich das Konzert an die hellen kühlen Tage, die weder dem Winter noch dem Vorfrühling gehören. Wie im Park draußen die Sonne wirkungslos um die Baumstämme steht, so kann die Hitze dieser Komposition nicht in die Hand des kleinen Spielers dringen. Die Hitze ist hier, und die Hand ist hier, aber zwischen den beiden gibt es keinen Zusammenhang, sie grenzen aneinander, aber sie berühren einander nicht. Und gerade dadurch entstehen so genaue reine Konturen, eine Freude für jeden Menschen, der das Seltene liebt ... Er ist zu Ende. Er verbeugt sich vor dem applaudierenden Publikum und, wie man ihn belehrt hat, leitet er einen Teil des Beifalls, indem er die drei-, viermal kurz zusammenschlagenden Hände erhebt, dem Orchester zu. Auch diese Form des nervösen Maestro, den man gejagt durch alle Länder, alle Orchester der Großstädte sich vorstellt, heute hier, morgen dort, erfüllt er mit schöner fremder Sicherheit, ohne Selbstüberwindung oder etwas derartiges Nervöses durch sie äußern zu wollen. Er setzt sich wieder und, da man weiter applaudiert, steht er wieder auf, um mit einem Ruck sich zu bücken. Während aber andre, die Gereiften, während des Beifalls im Sitzen so tun, als beschäftige sie schon wieder das Klavier und ihr nächstes Stück und als schrecke sie nur der gesteigerte Lärm zu noch einer Verbeugung auf: sitzt der Knabe ruhig da, die Arme über der Brust gekreuzt, schaut dem klatschenden Publikum ins Gesicht, wartet in dieser Stellung eine passende Weile, ehe er wieder vortritt. Man hat ihn eben belehrt, er solle zwischen den Verbeugungen warten. Vielleicht zählt er inzwischen bis dreißig.
Ich habe eine Entdeckung gemacht: Sämtliche Soubretten der Welt haben genau eine Art, auf dem Podium zu gehen. Wie oft habe ich darüber gesonnen, in dieses scheinbar so zackige Hin- und Hermarschieren eine Regel zu bringen. Da ist sie nun (und ich bitte Sie, lieber Herr Verleger, keine Kosten zu scheuen, um ihren Lesern durch eine kleine Reproduktion zu zeigen, was ich meine):
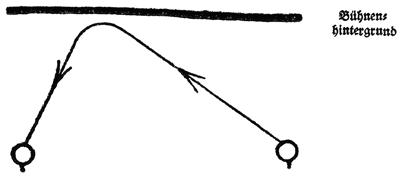
Schema der Bewegung einer Chansonette
Nämlich: die normale Chansonette singt zuerst einige kleine Zeilen rechts auf der Bühne, rechts vorn, das Gesicht gegen die Zuschauer gekehrt; dann geht sie gegen den Hintergrund, geht jedoch mit dem Rücken voran, immer noch uns zulächelnd; nicht ganz erreicht sie die Wand und doch, als würde sie elastisch von dort (nach den Gesetzen unseres Physiklehrbuches) zurückgeschleudert, kommt sie jetzt mit schnellerem Schritt energisch auf uns zu, immer singend, nach links vorn, mit wachsendem Lächeln. Von hier aus wiederholt sich vielleicht dieselbe Kurve in der entgegengesetzten Richtung, das ist unabwendbar. Ich bin wirklich froh, daß mir nach vielen Beobachtungen dieses wissenschaftliche Gesetz klar geworden ist. Vielleicht gebe ich jetzt, mit einem befreundeten Mathematiker, bald eine »Geometrie des Chantants« heraus. Ich weiß ja auch schon, daß von den beiden Ästen der heute entdeckten Kurve der erste immer weniger steil als der andere sein muß; natürlich, weil die Dame vorsichtiger mit dem Rücken gegen die Wand losgeht als mit dem Gesicht gegen das Publikum nach vorn.
Und solche Dinge weiß ich noch viele. Ich sitze so gern im Chantant, es ist mein liebstes Theater. Das Zimmer ist eng, heiß, und noch am nächsten Vormittag wird dieser Zigarrenrauch meine Augen zwicken. Der Klavierspieler brilliert. Das heißt nicht etwa: brillant spielen. Er hat seine eigene Technik: »brillieren«, er läßt stets die Schwierigkeit seiner Ouvertüren durchschimmern und namentlich auch seine Ohnmacht auf diesem (ach! zufälligerweise) so miserablen Pianino. Fast ebenso laut, wie die Leute reden, spielt er. Wieso ermüdet er nicht? Vielleicht hofft er, von einem dieser Gäste eines Abends entdeckt, zu einem bessern Klavier hingeführt zu werden. – Die Mädchen kommen, die lieben Mädchen, und man vergißt ihn. Sie haben ihre Metallschuppen an, ihre Trikotstrümpfe, wie zu unserer Väter Zeit, sie zeigen auf ihre Frisur, auf ihren Schuh, den sie vorstrecken, während sie sich vorbeugen; all dies, um anzudeuten, daß sie »von Kopf bis Fuß« einfach die »Brettlkönigin« sind. Es sind geheiligte Bewegungen, die sie ausführen, Stiltraditionen: dieses Vorhalten eines Spazierstocks soll »gigerlhaft« sein; Seidenhosen, noch so kurze über noch so dicken Schenkeln, deuten den »Gassenbub« an; das Wort »ich bin noch jung« wird viele Strophen hindurch immer wieder mit demselben Geheul neuer Erkenntnisse ausgestoßen; der Kakewalkschritt, als wate man knietief durch Sand, so mit Aufgebot aller Kraft, ist »Amerika«; wird der steif abstehende Rock ans Knie vorn mit beiden Händen gepreßt, so daß er hinten sich hebt, bei seitlich geneigtem Köpfchen, so ist »Unschuld« gemeint; aber »Paris« selbst, Metropole des Lasters, rauscht über die Szene, wenn dann die Kleine die Röcke aufhebt, den gebückten Kopf an sie legt, als wolle sie in diesem Polster ausruhen, und nun von hier aus lächelnde Blicke schickt – als Halbmond füllen die Dessous schön den Raum aus zwischen Bein und Hals, wie ein geöffneter Fächer; oder in geänderter Figur mischt sie jetzt alles durcheinander, beugt sich noch tiefer zu ihren Spitzen, wie eine Wäscherin über die Wäsche, hebt schnell abwechselnd ein Bein, das andere, und mit eiligen Händen rührt sie die schäumenden Falten, wirft sie hin und her, während ihr Blick beschäftigt auf diesem Schaukeln ruht. Weisheit des Chantants! Sie singt: »Was die Französin kann. Das kann auch ich. Es ist nicht so viel dran. Ganz sicherlich. Nur weil's Franzosen sind. Drum hamm's mehr Glück. Doch hat die Wienerin denselben Chic.«
Der Reklamograph: interessanter, als man glaubt. Dann schnellte eine »akrobatische Neuheit« über die Varietébühne, dann hielten Clowns Violinen und Glocken an Drehbänke, und es klang wie eine Art von Musik, so sollte es auch sein. Die Kulisse oft benutzten Herbstlaubes erzitterte vom Urwaldgekreisch dressierter Kakadus und von ihren springenden Farben. Gut, gut, all das sind Versprechungen – kommt sie noch nicht? Ich sah sie verdeckt hinter den turnenden Arabern, hinter dieser temperamentvollen Wüste, hinter synkopischen Engländerinnen, hinter der Pause, die den Riesensaal hell machte und all die blauen schönen Zigarrenrauchwolken zu den Wolken des Plafonds trieb, zu den Fächerspiegeln, den Verzierungen. Aber sie zeigte sich nicht. Noch diese Germania mit kantigen Hüften mußte auftretend sie verdecken und Zigeunerweisen geigen, mit ihrem Bogen alle Ziehbrunnen der Pußta heben, pizzicato und im Flageolet, wobei passenderweise ihre Postichen kräuselnd in Unordnung gerieten, während zur nächsten Cantilene doch wieder schon der gehörige Augenaufschlag in Bereitschaft war. Geh schon weg! Und auch du, ade, Amerikanerin, die den Kunststücken der Brüder hilft, auf sie zeigt, im tiefsten Mundwinkel ihren Goldzahn aufblitzen läßt. Ade, geh schon weg ...
Dann trat Liane de Vriès auf. (»Während dieser Nummer wird nicht serviert.« Das Plakat ist von Damaré in Paris gedruckt und schlecht. Ein Freund hat mir erzählt, er habe in der Nacht, nachdem er sie gesehen, nicht schlafen können ... So sammle ich schnell noch, vor dem erregten Moment, alles, was ich bisher von ihr weiß.) Musik. Ich schließe die Augen. Und dann sehe ich sie, sie steht da auf der Bühne, und ich höre sie, und es ist die Sprache, die Sprache Flauberts. Da steht sie, so wie ich mir immer die Pariserin meiner Legenden vorgestellt habe, ich habe Paris noch nie gesehen: da ist nun das Vorbild der mondänen Wochenschriften, der Bilder von Fabiano, Gosé, Galanis, de Mouvel, das Vergnügen meiner einsamen Abende im Kaffeehaus, nächstens werde ich davon schreiben. Da ist sie, und es ist keine Enttäuschung, nein, eher war das Erwarten eine Enttäuschung, denn ich hätte sie sehnsüchtiger erwarten sollen ... Ihr Hut, das Kleid mit Flittergold, und dazu geben die vielen echten Perlen eine Harmonie, eine Harmonie im höheren Sinne, o jenseits, dort wo auch die Wurzeln von Minus-Eins schweben! Die Perlen, die solitären Brillanten und an Ketten die Schmuckstücke, neben ihrer Schönheit sagen sie tautologisch noch einmal dasselbe: »Man muß mich lieben, alle lieben mich.« Das sagen die Schmuckstücke, das sagt die Schönheit auch allein. Denn sie ist schön. Hab' ich's noch nicht gesagt?... Sie ist schön und so weiß, andere werden vom elektrischen Reflektor beleuchtet, sie wirft ihr Licht in den Reflektor, beleuchtet ihn. Toilettekünste, wendet eine ein. Aber mach' es ihr doch nach, kleine Hausfrau, eben wirst du von der Bühne her aufgefordert, nicht eifersüchtig auf deinen Mann zu sein; denn dieser Kuß gilt gerade ihm. Sie ist schön – können diese Hände auch Wärme geben? Unmöglich, daran zu glauben!... Ganz ruhig nun betrachtet, denn es ist höchste Zeit, einige wertvolle Beobachtungen zu machen: ihre Brust liegt im oberen Fünftel etwa des Leibes, das macht ihn stark und schlank zugleich, schafft Raum für männerartige Freiheit des Unterkörpers, für die in Müllers System beliebten Korsettmuskeln. Wie gesund sieht sie aus, wie schön und gesund. Lieber noch als mit ihr sein ... möchte man sie sein! Sie ist so rein, gewaschen, überwacht, Sündfluten von Reinigungsbädern förmlich müssen durch ihre Haare gegangen sein, daß sie so naß glänzen und so trocken sind. Das ist unbegreiflich, obwohl nichts unbegreiflich ist. Alles andere war Schweinerei bisher, Brunst. Hier beginnt meine Liebe. Und diese freie Stirn, das intelligente Achselzucken, dieses Sich-wenden einer großen Dame, wobei der nackte Rücken mit Grübchen, Schatten, Sehnen, Anhöhen erscheint. Gewiß ist sie witzig, das sehe ich an ihrem nackten Rücken, und gut, brav. Alle schönen Frauen sind brav, nur bei Maupassant und andern schlechten Autoren (Wiener Schule!) sind sie's nicht. Und siehst du, sehen Sie ... ich habe recht gehabt, sie hat Deutsch und Tschechisch gelernt, um uns etwas zu sagen. Was ist das für eine Szene? Ein Kellner kommt auf die Bühne, bringt ihr einen Brief. Jetzt fetzt sie den Brief auf, ihr Zeigefinger als Messer, wie der sich ins Seidenfutter wühlt und einen Schlitz macht, um den sich Locken des Papiers aufbäumen! Sie erklärt uns alles: jemand möchte sie zum Souper einladen: »Sind Sie es? Oder Sie in der Loge, auf der Galerie?« Strophenweise antwortet niemand, natürlich, weil alle wie im magischen Banne liegen und vielleicht auch nicht so perfekt die Sprache Flauberts beherrschen, und das gibt ihr Gelegenheit zu ihren aufreizenden Mienen, zu dieser ewig lügnerischen, ironischen Geste: »Niemand will mich, ach, warum will mich niemand?« Den Finger an der Lippe steht sie da, weinerliche Vorwürfe heuchelnd.
Ihre andern Couplets. O schönster Abend meiner Saison heuer, neben Variationen von Reger ... Die andern Couplets: Sie ist Masseuse und streichelt ihre Umrisse, modelliert sich, zu unserer größeren Aufmerksamkeit. Oder sie hat was Schönes, sie gefällt und weiß nicht warum. »Fragt nur eure Söhne, die wissen's.« Oder sie muß lachen, von unsichtbarer Hand gekitzelt. Oder das kleine Erschrecken, die Halbkreise (statt Halbellipsen) der Augenbrauen, der Mund, der ein o sagt, weil er einmal rund sein möchte, nach seiner sonst so sanft geschwungenen Form. Die Klappen des Kleides an ihrem Busen und zwischen diesen Klappen, das feste Licht im Ausschnitt locker, doch nicht schwankend. Nun verteilt sie Blumen und ist einfach das, was sie ist, ohne Gesang und Pointen: eine schöne, gutartige, gescheite Frau, ein Aktivum des Weltalls ... Zum Schluß verbeugt sie sich tief. Achtung, die Klappen!... ein Kollektivkuß, den sie in ihre hohle Hand gibt und ausstreut; dennoch bin ich in Dankbarkeit beschämt ...
Mein lieber Freund, auch ich habe die Nacht darauf nicht geschlafen. Aber aus einem andern Grunde. Ich mußte das da schreiben. (In erster Linie nämlich bin ich Schriftsteller, nicht Liebhaber.)
Ich bin weder Spiritist noch Antispiritist, weder Antitheosoph noch Theosoph. »Welcher Weltanschauung gehören Sie also an?« Ich bin Literat.
Man wird sich doch endlich angewöhnen müssen, die Literatur als eine vollgültige alles umfassende Weltanschauung anzusehen, nicht als einen Beruf. Der Schriftsteller hat seine ihm eigentümliche Art, die Dinge zu sehen, er sieht eben das Literarische an ihnen, also das künstlerisch Beschreibenswerte, das den an diesen Dingen anderweitig Beteiligten freilich sehr oft nur einen Nebenumstand darstellen mag ... Hierdurch gerät er allerdings in den üblen Verdacht, zu ironisieren, d. h. von den Dingen nicht ergriffen zu sein ... Ganz falsch: er ist in seiner Art ergriffen, literarisch ergriffen von ihnen. – Einem Dichter vorwerfen, daß er sich von der Welt nur literarisch beeinflussen läßt, ist genau dasselbe, wie einem Politiker vorwerfen, daß er sich nicht um den Knochenbau seiner Wähler kümmert, oder einem Anatomen, daß ihm einerlei ist, ob die Skelette seines Kabinetts zu Lebzeiten der konservativen oder freisinnigen Partei angehört haben.
Ich gestehe von vornherein und mit Stolz, ich bin Literat, ich interessiere mich auch für »Höhere Welten« nur literarisch. – Kommt einer und predigt mir, daß die ganze sinnliche Welt nur Schein ist, daß es ganz andere Dinge gibt, die zu sehen für mich von der allerhöchsten Wichtigkeit ist, ja die nicht sehen mich in ewige Verdammnis stürzen wird, – so werde ich nicht umhin können, die seltsame Haarformierung und Frisur etwa dieses Drohenden in erster Linie, als Hauptsache zu beobachten und im Geiste unwillkürlich die treffendsten Worte und Vergleiche dafür zu suchen. Ganz einfach: er stellt mich in seine übersinnliche Weltanschauung, ich ihn in meine literarische. Niemals werde ich zugeben, daß die literarische Weltanschauung irgendeiner anderen, noch so erhabenen, nicht ebenbürtig ist. – Dieses Gejammer über die »Lebensschwäche des Künstlers«, über die »Minderwertigkeit der Literatur gegenüber dem Leben«, möge endlich aufhören! Warum sich der Literatur schämen? Sie ist ein Mittelpunkt, nicht schwächer als Erotik oder Demagogie oder Wissenschaft.
Ich schäme mich nicht, – dies als Vorbemerkung – ich freue mich der Literatur.
Viele Nachmittage verbrachte ich einst mit Gustav Meyrink, nun habe ich ihn lange nicht gesehen und hätte ihn vergessen, wenn mich nicht neulich wieder seine vortreffliche Dickens-Ausgabe (bei Langen) gut an ihn erinnert hätte ... Oft hatte ich damals das Gefühl, daß es rings um ihn spuke. Als ich ihn kennen lernte, sprach zufällig gerade jemand mit leiser Stimme auf ihn ein, erzählte von einem Spukhaus in Budapest, das die Behörden aber versperrt hielten. Niemand dürfe hinein. Er lächelte: »Ja, so wird es immer gemacht« ... Er selbst berichtete über erstaunliche Erlebnisse, einmal in Tirol habe sich ein Tisch, an dem er mit Freunden experimentierte, bis an die Decke gehoben, habe ihre Köpfe an den Plafond gedrückt. Er hatte eine ruhige Stimme und einen glänzend-treuen warmen Blick seiner großen blauen Augen. Ich betrachtete jede Stunde, die er mit mir verbrachte, als Geschenk, ich stand vollständig unter seinem Einflusse; oft erwartete ich, wenn spät nachts das Kaffeehaus fast leer war und der herrenlose Tabaksqualm, der von Abwesenden aufgerührte Staub wie auf matte Nachzügler eines Heeres auf die letzten Gäste sich stürzte: jetzt müßten Geisterhände hervorgreifen, die Tischbeine umklammern und dann auf uns los ... Ich bewunderte sein Wissen, seine geheimen Wege. Er galt als unheilbar krank, schleppte ein Bein nach, – er kurierte sich selbst und wurde gesund. Er machte alchymistische Experimente, zu denen seine ausgeschriebene Geschäftsschrift mit banal-violetter Tinte so entzückend wenig paßte. – Ich begleitete ihn nachts zu seiner Wohnung, in einem Vorort neben der Gasanstalt. Und auch das schien mir okkult, daß er neben der Gasanstalt wohnte, und entsetzte mich, unklar schwebte mir vor: wenn nun ein Funke überirdischer Aureole in so einen gefüllten Gasometer einschlägt, dieser Brand ... Später durfte ich ihn besuchen, in seiner Bibliothek blättern. Eine Standuhr aus Porzellan fiel mir im Zimmer auf, das Zifferblatt war eine Trommel, eine teuflische Gestalt hielt sie zwischen die gespreizten Beine eingeklemmt und hob mit ungeheurer Kraft, mit wütender Grimasse den Arm hoch empor, um auf sie loszuschlagen. Man konnte nicht hinsehen, ohne jeden Augenblick den Knall zerkrachenden Porzellans im Ohr zu haben. Daneben hing ein Bild, blasses Gesicht, Schlangen, Phosphor. »Was stellt das vor?« »Den Hüter der Schwelle«, sagte er leichthin, welchen mystischen Ausdruck ich erst Jahre darauf verstand.... Überdies schwieg er gern, wurde plötzlich lebhaft, witzig, lebte in Rätseln und Prozessen, niemand verstand ihn, ein Schleier von Widersprüchen hüllte ihn leuchtend ein, fast blendend. Er verkehrte unter anderem mit einem Mann, der Fliegen sammelte, tote Fliegen, deren er schon Tausende besaß. Er pflegte immer an der äußersten Kante des Trottoirs zu gehen, wie um alles übersehen zu können, was zwischen ihm und der Wand vorging; doch sah er oft gar nicht auf. Ich erinnere mich nicht, irgendeinen Menschen nach ihm mit der gleichen Demut geliebt zu haben ... Gegenwärtig wandelt sich mir seine Gestalt langsam in eine Legende um, geschrieben in violetter Geschäftsschrift.
Viele Jahre später, nachdem ich meine geheimwissenschaftlichen Kenntnisse in den Büchern der Blawatzky, in Kiesewetters Archiv, im Lotus, Luzifer-Gnosis, Flammarion usf. erweitert hatte und mir immer noch ein Gedicht von Goethe oder eine Fuge von Reger erstaunlicher, geheimnisvoller, verehrungswürdiger als alle okkulten Manifestationen erschien, selbst rätselhafter als jene beiden ineinandergeschlossenen intakten Ringe aus hartem Holz, die Zöllner aufbewahrt, – traf mich ein neuer Ruf aus der Geisterwelt. Einige jüngere Freunde (daß ich auch einmal mit Leuten, jünger als ich, verkehren werde, hätte ich noch unlängst nicht gedacht. So altert man!) luden mich ein, sie hätten ein Medium unter sich, sie bewegten Tische. Ich geriet in ein schlecht erleuchtetes Zimmer, in dem einige schon aufgeregt warteten, einige von früheren Erlebnissen lachend erzählten oder begeistert. Das Medium, ein sechzehnjähriger starker Bursche, an dem man diese Eigenschaft zufällig entdeckt hatte, rauchte Zigaretten, schien teilnahmslos. Wie ich erfuhr, interessierten ihn die Versuche wenig, und er mußte jedesmal erst sehr gebeten werden, seine Kraft wirken zu lassen. Das alles spielte unter Kameraden, guten Freunden, alle aus reichen Familien, ein Betrug war ausgeschlossen ... Ich fand bereits ein ausgebildetes Zeremoniell vor. Man trat um das Tischchen (ein leichtes war ausgewählt), bildete die Kette, indem man die Hände nur leicht auflegte, die eigenen Daumen, mit dem Nachbar die kleinen Finger verband und nun leicht plaudernd auf die Phänomene harrte, nicht etwa mit Willensanspannung oder Religiosität, denn ausdrücklich wurde ein heiterer Gleichmut als besonders günstig für den Eintritt der okkulten Ereignisse bezeichnet. Man erzählte Witze oder Alltägliches. Dann beugte sich einer, der zum Sprecher für alle ausersehen war, zur Tischplatte hinunter und murmelte: »Ist ein Geist im Tisch?« Nach mehreren vergeblichen Versuchen zuckte es im Tisch, endlich neigte er sich langsam feierlich zu einer Seite herab. Der Sprecher: »Willst du uns antworten. Ja – einmal, Nein – zweimal, ich weiß nicht – dreimal.« Der Tisch neigt sich einmal, zweimal, dreimal, und so geht es weiter bis zwölf. Wir schließen daraus, daß der Geist erst um zwölf Uhr erscheinen will. Zwei Stunden lang stehen wir herum und essen Brötchen. Um zwölf wird die Kette geschlossen und sofort meldet sich der Geist. Man sagt ihm das Alphabet vor, und bei dem ihm passenden Buchstaben bewegt sich der Tisch, so erfährt man seinen Namen, seine Wünsche. Es ist eine Frau in Semlin, ihr Kind ist krank, sie bittet uns, für das Kind zu beten. Wir geraten in Aufregung, denn keinem von uns ist es eingefallen, jetzt gerade an Semlin zu denken. Die folgenden Nachrichten sind noch überraschender, machen uns halb toll. »Einen Arzt, schnell einen Arzt« zittert der Tisch. Und unfehlbar geht er seinem eigenen Willen nach, selbst dann wenn alle einen ganz anderen Buchstaben zur Ergänzung des eben diktierten Wortes erwarten, kommt es oft entgegengesetzt. Oft will man nicht das ganze Alphabet aufsagen, nennt den nächsten Buchstaben ratend. Der Tisch rührt sich nicht. Er reagiert auf seine Art und nicht anders. »Können wir dir helfen?« fragen wir die unbekannte Semlinerin, die auf so seltene Art uns sich genähert hat. »Beten, beten.« Wir sind so erregt, daß wir alle laut zu beten beginnen. »Sollen wir dich weiter fragen?« Der Tisch gibt ein so heftiges »Ja«, daß er unsern Händen sich entreißend zu Boden stürzt. Das Schwierige ist, in solcher Hitze über die richtige Fragestellung nachzudenken. Endlich nach unsäglicher Mühe, alle Schweißtropfen auf der Stirn, erfahren wir, daß wir an die Polizei telegraphieren sollen. Wohin aber den Arzt schicken? Besonders neugierig sehn wir dieser Antwort entgegen, denn nun mußte die Semlinerin, die uns ihren Namen, ihre Adresse vorhin nicht näher nennen wollte, ihr Inkognito lüften. Die Antwort: »Postamt Belgrad« ... Nun sind unsere letzten Zweifel verstummt, denn keiner hat an Belgrad gedacht, alle schwören, gar nicht so bewandert in der Geographie zu sein; die Landkarte, schnell geholt, zeigt uns erst, daß Belgrad und Semlin einander gegenüberliegen. Eiligst läuft einer von uns zur Hauptpost, es ist drei Uhr nachts, und gibt unser französisch aufgesetztes Telegramm an die Polizeiverwaltung Belgrad auf, die über diesen nächtlichen, so dringenden Wunsch aus Prag, sofort einen Arzt zum dortigen Postamt zu senden, damals sehr erstaunt sein muß. Wir fühlen uns schaudernd dem Wahnsinn nahe, wir verstummen. Nach einer Stunde antwortet der Tisch: »Das Kind ist tot«, ein leises Zittern, das lange anhält, folgt dem letzten Schlag ...
Um es gleich zu sagen: unsere spiritistischen Experimente, von da an mit Eifer fortgesetzt, erreichten nie mehr die Erregungshöhe dieser ersten Nacht. Zwar gaben sich noch viele Geister kund: ein Kammersänger, der beklagte, am Suff gestorben zu sein – ein Einsiedler in Tibet, dessen Klopfen ganz zart (wie infolge der ungeheuren Entfernung) kam und dessen Buchstaben Worte einer uns unverständlichen Sprache ergaben – dann ein junges Mädchen unserer Gesellschaft, das jüngst durch Selbstmord gestorben war – dann der Geist Lortzings (seltsam, gerade dieses Komponisten, der keinen von uns besonders interessierte). Aber die Resultate waren oft unklar, oft sinnlos oder banal. Es beteiligten sich exakte Psychologen an den Sitzungen und untersuchten, ob sich ein von uns unterschiedenes Psychisches nachweisen ließe. Wir stellten Fragen, die keiner von uns hätte beantworten können, die man erst in Nachschlagewerken hätte aufsuchen müssen. Die Geister ließen sich auf solche Fragen nicht ein oder beantworteten sie unrichtig. Ein einziges Mal gab Lortzing das Entstehungsjahr des »Wildschütz« richtig an ... Allmählich wurden die Sitzungen immer langweiliger. Zum Schluß erschien immer nur ein und derselbe Geist, der gar nichts wußte, gar nichts sagte, aber immer alle andern, die sich meldeten, eifersüchtig verdrängte. Indessen waren die spiritistischen Sitzungen zu einer geselligen Unterhaltung herabgesunken, man fügte sie auf Hausbällen in den Kotillon ein, Mädchen nahmen teil, wobei sich einige als hochgradig nervös, wo nicht medial veranlagt enthüllten; schließlich benützte man dieses Spiel, um die kleinen verliebten Affären Lebender und Toter zu erforschen, um irgend jemanden wenigstens in Verlegenheit zu bringen, wenn schon nichts bewiesen werden konnte. Die Ernsthafteren gaben die Sache ganz auf.
Was mir von dieser Periode geblieben ist, sind angenehme Erinnerungen an das rein-körperlich so süße Gefühl, wenn unter den Fingern der belebte Tisch sich zu bewegen beginnt, dieser unirdische Druck, dem man nicht widerstehen kann, dann die individuelle Mannigfaltigkeit der Geister, von denen die einen hastig antworteten, andere faul und undeutlich, einige lustig aus der Nähe, andere, wie unter Wasser vergraben, schwerfällig. Dann denke ich immer noch gern an die hohen Grade von Angst, die ich damals durchmachte, wenn ein Geist versprach, etwas niederzuschreiben oder gar selbst zu erscheinen (es ging aber nie in Erfüllung oder in so koboldhaft mißdeuteter Weise, daß ich an die Schlauheit des Teufels in Volksmärchen denken mußte z. B. der Geist schrieb etwas nieder, sagte auf wiederholte Fragen: ja, er habe etwas geschrieben – es sei aber unsichtbar). Und endlich: ich kann den Eindruck nicht los werden, daß an diesen mysteriösen Nachrichten aus Semlin doch etwas Wahres war. Vielleicht kann ein Mensch, durch die innerste Not zur Ekstase getrieben, eine unglückliche Mutter wie diese, ihre herzsprengenden Gefühle in den Weltraum hinausströmen und mitfühlenden Wesen, deren Geist gerade um dieselbe Stunde allen kosmischen Wellen offen steht, in zarten Schwingungen übertragen. Ist das so undenkbar?
Während der Spiritismus die Bewohner einer geahnten höheren Welt uns physikalisch vordemonstrieren will, durch Töne, Gewichtsverlust u. ä., behauptet die Theosophie, daß jeder durch gewisse Seelenübungen zu einem direkten Schauen der höheren Welt gelangen kann. Diese Lehre, die von den Geheimlehren der Inder, mittelalterlicher Mystik, Kabbala abstammt, gründet sich also nicht auf objektive Beweisgründe, sondern auf subjektives Erleben jedes Beteiligten, kann aber jedem, der ihr infolgedessen objektive Gültigkeit abspricht, entgegenhalten, daß ja auch unsere irdische Welt kein objektives Kriterium der Wahrheit bietet. Man lese nur in einer modernen Logik, beispielsweise bei Husserl, nach, wie hier, nur um dem »radikalen Skeptizismus zu entgehen«, eine Evidenz angenommen wird. Unsere ganze Erkenntnistheorie steht eben vor einem ungelösten Rätsel, und man kann einem, der Dinge sieht, die wir nicht sehen, nichts als statistische Wahrscheinlichkeitsgründe gegen seine Behauptung, keine Widerlegung vorhalten ... Auf dieser Lücke irdischer Philosophie ist das System neuer Theosophie, wie es Dr. Rudolf Steiner in seinen sehr zahlreichen Büchern und Vorlesungsheften bietet, nachdenklich und reizvoll aufgebaut. Seine Sprache ist bei weitem klarer und ruhiger als die der Blawatzky, etwas weitschweifig, aber logisch gegliedert, im Grunde unwiderleglich. Wie fein betont er, daß der »Geheimschüler« vor allem nüchtern sein soll, daß Phantasterei mit dieser »höheren Welt« nichts zu tun hat. Sehr einnehmend lehnt er auch jeden Fanatismus ab, betont den Wert der Einwände: kurz, er arbeitet in der Manier der Wissenschaft, nicht des Glaubens, er verschanzt sich nach allen Seiten, er fordert vor allem von den Trainierenden Geduld und Hingabe. Gelingen Experimente nicht, so ist dies nur ein Beweis dafür, daß man nicht geduldig und devotionell genug war.
Das Merkwürdige ist ferner, daß diesem Manne Scharen von Anhängern aus der ganzen Welt mit vollem Vertrauen folgen, daß er Verehrung wie kaum ein anderer Lebender genießt, daß sich Legenden um ihn bilden, wie die, er esse nur eine Weintraube täglich, er erscheine seinen Schülern als Geist usf. Dabei soll er von allen, ehe er sie in seinen Unterricht aufnimmt, vollständige Schulung in der Mathematik verlangen, ja gerade in der Mathematik.
Ich höre einen Vortrag Steiners über Theosophie. Der Saal ist dicht gefüllt. Viele Ausländer sind eigens, um ihn zu hören, nach Prag gekommen. Wie in einem internationalen Seebad, nur moralisch disziplinierter, wimmelt es von Französinnen, Engländern, noch Entfernteren. Es zeigen sich ... Männer mit weißen Bärten, andere, unter deren schöngewölbter glänzender Stirnkapsel die Brille wie eine Bewaffnung sitzt, viele Frauen in Reformkleidern, mit gemalten Achselbändern, weiße Haare, in ganz kleinen schmalen Zöpfchen zu einem Häuflein geringelt, unter ihnen ein schönes Prager Mädchen, die ich von der Gasse kenne und hier nicht erwartet habe, ihr Hut mit roten Fittichen paßt dem schwarzen Haar, und es beruhigt mich eine Weile, daß sie also bei aller Sorge um Karmagesetz und Wiedergeburt ihrer zeitlichen anmutigen Existenz doch die Pflege nicht entzieht ... Freilich verlangt ja auch Dr. Steiner (und dies gehört zu den verlockendsten Partien seiner Lehre), daß der Geheimschüler seinen Beruf nicht vernachlässige, daß er seinen Körper und den Geist kräftig und gesund erhalte. Hat sie es daher? Oder aus sich selbst? – Mir fällt da überdies ein, daß aus denselben indischen Lehren Schopenhauer seine Askese, dem Pessimismus ableitete, während Steiner (dem allgemeinen amerikanischen Zug unserer Zeit folgend) Tüchtigkeit und Optimismus diesen Quellen entnahm ... Nun steht er am Pult, ein langer schwarzer Strich, sogar der Ausschnitt des Rockes ist von der schwarzen Krawatte ganz ausgefüllt, nur die beiden niedrigen Dreiecke des Umlegekragens ragen weiß vor. Das Gesicht mager, gelb, faltig, soweit die eingefallenen Wangen mit ihrer Spannung noch Falten zeigen, schöne Augen und Hände, wie sie Frauen gefallen. Er schreit, er läßt nicht ab, er breitet die Arme weit aus, die Handflächen uns zugekehrt und im Gegengewicht den schlanken Rumpf zurückgebogen, oder er fährt mit gestrecktem Daumen und zwei Fingern, die andern Finger schlaff, durch die Luft, er ist unermüdlich. Selbst Einwände trägt er mit demselben Pathos vor, wie das, was ihm gefällt, und die Unverdrossenheit, mit der er für das Publikum bei den Elementen der Lehre anfängt, deren letzte Komplikationen ihm doch so geläufig sind, hat wirklich etwas Rührendes und Großes. Oft schließt er die Augen, und ein Zittern von den Füßen aus durchsteigt den ganzen Körper. Er macht auf mich den Eindruck eines Mannes, der in seinem Ideal aufgeht ... Nach dem Vortrag: Fragebeantwortung, geschickt und schlagfertig. Ich wundere mich, daß er sich auf so etwas Menschliches einläßt, auf dieses Virtuosenstück. Da habe ich aber zu laut gesprochen, und eine seiner Verehrerinnen weist mich zurecht: »Ich denke, das überlassen wir ruhig ihm, er wird schon wissen, was er tut. Er befolgt seine besonderen Zwecke, davon bin ich überzeugt.« Wir kommen ins Gespräch, die Dame, obwohl der Vortrag den Anhängern Toleranz so warm empfohlen hat, wird recht bissig. Ich stelle mich vor. »Aber das ist ja unter Theosophen ganz egal.« »Ich bin aber kein Theosoph,« muß ich nun noch meine Höflichkeit vor ihr entschuldigen. Zum Schluß meint sie, sie habe so ihre Gedanken darüber, daß Steiner die Fragezettel immer nach den Vorträgen zu sich nehme. Ich will die Drohung nicht bemerken, die darin liegt, und meine: »Wahrscheinlich studiert er zu Hause die Fragen genauer.« Sie aber, von der Allwissenheit und Allmacht ihres Meisters, dem die Dämonen gehorchen, ganz durchdrungen, fährt fort: »Er erkennt wohl auch, wer den Zettel geschrieben hat« ... Ich fühle mich schuldig ...
Also bleibt diese dunkle Drohung in mir zurück? O nein. Denn Steiner hat die Unvorsichtigkeit begangen, einen Vers von Goethe zu zitieren (kein minderer Stil sollte wagen, so Hervorleuchtendes in seine Zeilen einzulassen) – und die schön geordneten Vokale, die unendlichmal als alle Astralleiber mysteriösere Musik dieser Worte hat wie Mondschein mein Gemüt schon ganz erfüllt. Und sie bleibt zurück, in meinem nur literarisch organisierten Gehirn, auf dem Heimwege, hat mich längst schon wieder aus den Polemiken und systemhaft verwirrten Abstraktionen in ein Reich aufgelösten unwiderstehlichen Wohlgefallens gezogen ... Ich bleibe bei meiner Partei. Wir werden ja sehen, was man von diesem bornierten Parteistandpunkt aus (denn borniert ist er, begrenzt, glücklicherweise!) noch erleben kann. Auch aus den »höheren Welten« komme mir noch manches Schöne!
Die einzig richtige Form, in der Buchkritiken verfaßt sein sollten, ist: der Kommentar. Solange es aber nicht Mode geworden ist, mit solcher Ehre unsere zeitgenössischen Dichter auszuzeichnen, die man nur wohl den lieben römischen und griechischen Klassikern zuteil werden läßt, – diese Ehre, daß auf jeder Seite, die nur je ein Weniges des unschätzbaren Textes enthält, unter dem Strich jedes wichtigere Wort des Dichters erwogen und belobt, jede Wendung mit Parallelstellen belegt oder als originell befunden, jeder angedeutete Gedanken und jede auch nur etwaige Anspielung in voller Schönheit zu Ende ausgearbeitet wird, – solange dies alles nicht eingeführt ist, bleibt nichts übrig, als eine kurze, unvollkommene und deshalb auch schwierigere Kritikerleistung zu versuchen.
Ich werde also nur einen Pseudokommentar geben können, eine Auswahl kommentierender Anmerkungen vielmehr, zusammengehalten durch übersichtliche, dafür aber auch nur halbrichtige Leitsätze, die ich zwischen fünfmal oder zwanzigmal so viel Anmerkungen wahrscheinlich anmutiger, geahnter und doch auch exakter versteckt hätte.
Gleich im Beginn veranlaßt und begeistert mich der Genuß von etwas so Außergewöhnlichem, wie es Walsers Dichtungen sind, zu folgender unwahrscheinlicher Behauptung: – Es gibt Zwei-Schichten-Dichter, z. B. Dickens, der es vortrefflich versteht, wenn er etwas Lustiges darstellt, den darunter liegenden Ernst, und im Ernsten das Lustige darunter und dahinter ahnen zu lassen. Oder Hamsun bringt es zustande, daß jemand eine Situation berichtet, die er selbst mißversteht, der Erzählende; aber wir, die Leser, verstehen sie durch seine verirrte Erzählung hindurch. Das Buch Dostojewskis »Ein Werdender« erglänzt unsterblich in solchen Details ... Neben solchen Zwei-Schichtern gibt es die einflächigen Dichter, natürlich. Drei-Schichter hat es aber bisher noch nicht gegeben. Walser ist so ein Drei-Schichter, da haben wir ihn.
Obenauf, in der ersten Schicht, ist Walser naiv, fast ungeschickt, schlicht, geradeaus. Wenige lassen sich davon täuschen, man spürt schnell die zweite Schicht unter der ersten, die Ironie, das Raffinement, den Feinfühligen. Also ist Walser, wie man so zu sagen pflegt, »gemacht« und »unecht«. O nein, weit was Überraschenderes ist er. Er hat nämlich noch unter der tiefen zweiten Schicht eine tiefere dritte, einen Grund, und der ist wirklich naiv, kräftig und schweizerisch-deutsch. Und den muß man gut durchgefühlt haben, ehe man ihn versteht, in dem wurzelt manch seltsamer Reiz seiner Sprache, Gesinnung, ja des Aufbaus seiner Werke.
Zunächst die Sprache. Man hat wohl schon lange nicht in unserer Zeit, die sich von allen einfachen Prosamelodie abzukehren scheint, Sätze gehört wie den: »Joseph sah ihn den Hügel durch den abstürzenden Garten hinuntergehn.« Welche blendende, vielmehr stille Reinheit, welche Abgewogenheit in den Vokalen, der Stellung und Länge der Worte, welche ungezwungene Musik. Ich gestehe hiermit, daß es nur wenige Bücher gibt, die mich durch ihren unsaubern Stil nicht anwiderten. Bei Walser aber atme ich furchtlos auf, noch mehr: hier erquickt mich jeder Ton, hier schallt es so angenehm ... Nun ist es aber eine Eigentümlichkeit der Walserschen Diktion, daß er die Ruhe seiner Sätze oft mit einem scheinbar der Zeitungssprache oder dem Vulgären entnommenen Wort scheinbar unterbricht. Hier setzt nun die Drei-Schichten-Theorie ein. Solche Zerrissenheit klingt naiv, unbefangen, kunstlos. Der tiefer Zusehende erkennt wohl romantische Ironie in ihr, denkt etwa an Heine. Der Verstehende aber sieht unter dieser wirklichen Naivität und wirklichen Ironie (beide sind real vorhanden, nur beide nicht selbständig, beide auf die dritte Schicht beziehungsvoll) eine ganz inwendige Seelen-Unbekümmertheit, eine über allen Mitteln stehende und deshalb in den Mitteln mit Fug wahllose Dichterurkraft. Ein Beispiel (man findet leicht treffendere): »Das Feuer, das wie alle wilden Elemente keine Besinnung hat, tut ganz verrückt. Warum sind noch die zügelnden Menschenhände nicht in der Nähe? Müssen denn gerade in solcher Schreckensnacht usf.« Ich habe mir erlaubt, natürlich gegen den Text, die deutlichsten Papierworte hervorzuheben. Wie flüchtig sieht man sie der Feder des Dichters entgleiten, als Anklänge fast an populäre Schillerzitate, sieht den Dichter ihr Unangebrachtes erkennen, ironisch belächeln, sieht ihn sie dann trotzdem stehen lassen, einer inneren Flüchtigkeit, weil Heiterkeit folgend, die sich zu jener oberflächlichen Flüchtigkeit wie ein lebendiger Mensch zu seiner Momentphotographie verhält ... Walser liebt es, wie in dem zitierten Buch (»Fritz Kochers Aufsätze«), sich als Knaben, als halberkennenden Reifenden zu verkleiden, um diesen Stil gleichsam zu rechtfertigen. Doch führt er ihn glücklicherweise auch ohne besondere Rechtfertigung durch alle Bücher hindurch und ebenso durch seine schönen eilfertigen kleinen Stücke in unsern Zeitschriften.
Was für Sätze, was für Satzneubildungen und unbewußtes Glück! »Ich wohne sehr nett in einem, es kommt mir vor, hochgelegenen Turmzimmer.« Oder: »Er wolle, fand es Tobler für passend zu sagen, nicht hoffen, daß es soweit komme.« Ohne Arg und doch mit großer Schlauheit und doch im Herzen ohne Arg wird mit der deutschen Syntax hübsch gewirtschaftet. Gehäufte Verba geben einen halb-komischen, ganz-entzückenden Effekt: »... daß ich jederzeit dasjenige zu leisten imstande sein werde, was Sie glauben werden, von mir verlangen zu dürfen.« Oder alte Phrasen werden mit einem neuen oder recht abgebrauchten Adjektiv kuriert: »Die Berge am Ufer waren in dem Dunst, den der vollendet schöne Tag über den See verbreitete usf.« »Zeitungen solchen Schwunges und Charakters schossen ... an die erstaunte und erfreute Öffentlichkeit.« Analog zu »Ins Reine Schreiben« wird neu geschaffen: »Ins Mehrfache Schreiben.« – Ist es möglich, einer tausendjährigen Sprache so neue gezwungen-ungezwungene Töne abzulisten, die von nun an nicht mehr verstummen werden?! Wer in solchen neuen Stilerfindungen nicht das größte literarische Tun unserer Zeit sieht, von dem kann man getrost sagen, daß er von dem Wesen der Literatur noch nie eine Ahnung in der Seele verspürt hat.
Über die Schweizer Provinzialismen bei Walser und ihre Schönheit denke man sich einen selbstverständlichen Absatz hier eingeschoben.
Ebenso über seinen scheinbar sorglosen, dennoch sehr bedachten und doch im Tiefsten blumenhafte frische Sorglosigkeit aushauchenden Szenenaufbau.
Seine Gesinnung erkläre ich mir gleichfalls dreischichtig. Eine leicht erkennbare Aristokratie im Wesen (»Warum ist Armut eine solche Schande? Ich weiß es nicht. Meine Eltern sind wohlhabend. Papa hat Wagen und Pferde.«); man würde aber irren, wollte man die durch solche leichtfertige, absichtlich leichtfertige Reden als deren Widerlegung deutlich durchschimmernde soziale Mitleidsgesinnung als die wahre auffassen. Noch tiefer vielmehr stößt man wieder auf etwas sehr Nobles, Feinorganisiertes, Sich-Abschließendes – und wundervoll ist es, wenn Walser manchmal durch einen einzigen Satz den Leser zwingt, alle drei Standpunkte mit ihm zu durchlaufen. »Es wurde nach und nach bei den Frauen Mode, und zwar bei den sogenannten bessern, nämlich bei solchen, die nicht gar so streng zu arbeiten brauchten, den Tag über, und das gerade sind ja die Besseren ...« Man suche sich das Richtige aus!
Es ist in dem labend komplizierten Wesen dieses Dichters gelegen, daß er vielartige Figuren von solcher Vollständigkeit ihres Gehabens und Wirkens gestalten kann und nicht im Relief, nein rund, komplett. Er braucht nur seines eigenen Wesens Züge zu isolieren, aus sich herauszustellen ... Da erscheint in mehrfachen Varianten die schöne, stattliche Frau aus patrizischem Bürgerhaus, der der Hochmut so gut steht, der man gern dient. Immer trägt sie Federn auf dem Hut ... Da erscheint der junge Mann, bald Schüler, bald Kommis, bald Gehilfe, der es in keinem Beruf lange aushält. Das Heroische und die Kunst leben in ihm, hübsch verwickelt mit kleineren Begierden wie z. B. einer kräftigen Eßlust. Die Liebe zum Bruder, der als Ideal vorschwebt, wird oft gezeigt. »Geschwister Tanner« gar ist die Geschichte einer in sich zusammenhaltenden, ganz bunten und doch durch einen edlen Familienzug angeglichenen Kette von Geschwistern. In ihrem Familienstolz zeigt sich wieder der Aristokrat. Nur das Feine, Ebenbürtige gefällt ihnen. Am liebsten würden sie in einer märchenhaften Welt von Schönheit leben, wie sie Karl Walser zierlich aufzuzeichnen weiß; und ebenso wird im Buche »Der Gehilfe« gern geträumt, in der guten Art Gottfried Kellers etwa, ausführlich im Schlaf, oder wachend vom »Ritterfräulein in Samtrock und ledernen Handschuhen.« Doch – und das ist das Dreischichtige, Vielschichtige, Ungezähltschichtige meinetwegen – in demselben Buche spielt auch die kleine »verschuggte« Silvi ihre wichtige Rolle, und allnächtlich »pißt sie ins Bett«. Was ich damit sagen will: Die Feinheit Walsers hat durchaus nichts Ästhetelndes, mir so verhaßt Wienerisches! Fritz Kocher, dessen Aufsatzheft mit den Worten »Der Mensch ist ein feinfühliges Wesen« beginnt, sagt so schön, wie er den »Lehrer in der Schulstube« beschreibt: »Hin und wieder kratzt er sich wollüstig in den Haaren. Ich weiß, welche Wollust es ist, sich in den Haaren zu kratzen. Dadurch reizt man das Denken unendlich. Es sieht allerdings nicht besonders schön aus, aber item, es kann nicht alles schön aussehen.«
Das ist nun Walsers lieblichster Frohsinn; er steht, obwohl poetischeren Zeiten entsprossen, fest in unserer unpoetischen Gegenwart. Er liebt sie, er macht sie poetisch. Er hält einfach ihre Ekelhaftigkeiten aus – der gesunde schöne Körper »fähig, Anstrengungen und Entbehrungen zu ertragen«, das ist die gute Basis, die er allen seinen Helden gibt. Ihr Lachen ist ein ins Akustische umgewandelter solcher Gesundkörper. Allen Mädchen müssen sie wohlgefallen, und das freut diese jungen Herren selbstverständlich ... In ihrer guten Laune gefällt ihnen selbst alles. Sie finden sich zum Erstaunen mühelos in der Welt zurecht. Der liebe verschwenderische, scheinbar so gar nicht ins 20. Jahrhundert passende Herr Tobler, Erfinder der genial unpraktischen Reklameuhr und des Schützenautomaten, wird sich schließlich – so eröffnet uns die abschließende Voraussicht des Romans –, wenn er den Gläubigern seine »brillante« Villa am Seeufer räumen muß, auch in der engen Stadt »in einem billigen Quartier« recht wohl fühlen. »Man gewöhnt sich an alles ...« Von einer versinkenden Weltanschauung, von überlebten Stimmungen ist in der obersten Schicht dieser Bücher viel die Rede (»Man bedauerte das Zeitalter, das sich gezwungen sah, mit Menschen von des Melkers Veranlagung derart kleinlich und mißverständlich verfahren«, so heißt es von dem derben Naturburschen im Polizeigefängnis, der noch das Blut der »stolzen und unbändigen Ahnen des Landes« hat und dafür, d. h. für Raufhändel, bestraft wird), aber im Innersten der Bücher lebt schon eine tüchtige Anpassung an die Neuzeit, an Industrie und alles, was man will. Der Gesunde wendet sich eben von nichts ab. »Ich liebe und verehre Tatsachen.« Oberste Schicht mag bei Walser Romantik oder Ironie der Romantik sein, zuunterst liegt tapferster freundlich-ausgesponnenster Positivismus: »Nichts kann mich so tief aufregen wie der Anblick und der Geruch des Guten und Rechtschaffenen. Etwas Gemeines und Böses ist bald ausempfunden, aber aus etwas Bravem und Edlem klug zu werden, das ist so schwer und doch zugleich so reizvoll. Nein, die Laster interessieren mich viel, viel weniger wie die Tugenden.« – Hier, wenn irgendwo, finde ich den neuen Ton, die Romantik unserer letzten, arkadisch-gegenwärtigen Strömung, endlich, endlich die Reaktion auf Nietzsche, die Freiheit, die Entspannung der Seele. Deshalb die Fülle der Eingebungen bei Walser, als hätte er das Dichten überhaupt erfunden.
... Was für Einfälle: diese Musterschule »Benjamenta« mit ihrem so intelligenten, so unermüdlich vom Dichter belobten und doch unterirdisch von ihm mißachteten Vorzugsschüler, dieser Brief, der mit »Geachtete Frau« beginnt, oder der betrunkene Wirsich, dieses Mitleidige, Mitleidslose, Mitleidsindifferente usf. usf. ... Es ist wirklich unmöglich, diesen Dichter nach Gebühr zu loben. Ich kann meine verliebte Freude über seine Existenz in Kurzem nicht mehr anders ausdrücken als indem ich die Namen seinen bisheutigen Bücher mit meiner schönsten Schrift ins Manuskript kalligraphiere: »Gedichte« – »Fritz Kochers Aufsätze« – »Geschwister Tanner« – »Der Gehilfe« – »Jakob von Gunten« – Aufsätze.
Will man in Paris seinen Winterrock weghängen, so nähert sich ein Vollmond aus Holz oder ein ungeschlachter Messingbügel, so daß man über die Geringfügigkeit der heimatlichen Aufhängeösen in Verzweiflung ausbricht. Man steht da und wartet, bis man ein Französchen herantanzen sieht, das sein Kleidungsstück an dem Bügel nicht aufhängt, sondern wie über den Rücken einer geliebten Dame umhüllend anlegt. Also so geht es, man hat hier keine Ösen, und dadurch behält das Kleid vielleicht wirklich besser seine angeborene Gestalt als in unsrer Strangulierung ... O Fremdartigkeit! Diese Gassen, Wildbächen ähnlich, die zu den Boulevards dunkel herabstürzen, die Häuser, die entwurzelten umgestürzten Baumstämmen gleichen, mit ihren emporgestreckten Rauchfängen, die zweistöckigen Omnibusse, Löwen auf Elefanten reitend, und diese zart gewellten Wasserläufe in der Gosse, so benachbart den verschwenderisch im Freien ausgebreiteten Stoffen und Hüten und Backwaren zum Verkauf, alles beseelt vom Takte desselben Wirrwarrs ... Mit allem ging es mir so. Und auch wenn ich im Vaudevilletheater abends die Polaire tanzen sah – ihr Mund ist groß, ihre Nase groß und zudem rot geschminkt, die Augen eines Gassenmädchens und der Tanz einer göttlich zu verehrenden Spanierin – o, ihre Hände zittern, die Finger wie die dünnsten Äste im Frühlingswind, ihr Haar verlernt den Weg den Nacken hinab und fällt begehrlich, als hebe es Röckchen, über Stirn und Mund, die magern Schultern scheinen Befruchtung zu verlangen und die Schenkel sind dick – auch da noch blieb mir das Gefühl: Anders als bei uns ... Immer dieses ›bei uns‹, wieviel Stolz liegt darin, wieviel Ekel schon deshalb, weil es sich immer wiederholt, wieviel Mißtrauen, weil man nicht sagen kann ›bei mir‹, wieviel Heuchelei, weil man ein einheitliches Gefühl statt dieser Zusammensetzung empfinden möchte. Und gar im Odéon, wenn bei erleuchtetem Zuschauerraum die Schlösser in den Logentüren knacken, wenn Gallipaux auf der matten Bühne sein Äffchen hin und her zieht, dann es weinend begräbt, dann aus schrägem Sessel und Tisch eine kaum stabile Ruhestätte für sich herstellt, hingeworfen die Beine hebt, mit den Händen flattert, durch ungestüme Bewegungen uns in Angst versetzt, wie bei Akrobatentricks und so, ja in dieser Siestalage gerade, den Traum jedes Parisers anhebt: ein Schloß besitzen, die Freunde zu sich einladen – auf fünfzehn Tage nur ... O, wie nah war ich der französischen Literatur in Prag, wie fern bin ich ihr in Paris! Und dabei ist dieses Theaterstück in acht Bildern wirklich von Edmond de Goncourt, den ich in so vielen Artikeln besungen habe, ist die ›Manette Salomon‹ – und ich glaubte von Prag aus immer, diesen Dichter gegen ein Pariser Publikum in Schutz nehmen zu müssen ... indessen wird hier bei Stellen gelacht, deren Worte mir wie Rauch um die Ohren gehen. Gänzlich als Ausländer also wandre ich zum Théâtre du Châtelet, während aus jedem der unsichtbaren Briefkästen, von jedem zinkenen Schenktisch mit seinen farbigen Fläschchen und Siphons Hohn mir entgegenschlägt und im Nebel die zwerghaften Tischplattenkreise vor den Kaffeehäusern, in ihren Ringen aus Metall, die winzigen Strohsesselchen, die Zuckerstückchen wie weiße Särge, die fremden Semmeln, die Brotwürste über mich hinstürzen. Noch im Gedränge der Stiege bin ich bedrängt, aber da bemerke ich schon befreundete Klavierauszüge. Schau, ein junger Mann zeigt neben mir, während ich mich setze, seiner Freundin eine schöne Stelle, hinter mir an der Säule diskutiert man die Instrumentation. Oben auf der Galerie pfeift Italien, schlägt die Stöcke gleichmäßig auf den Boden, schickt Papierpfeile zu uns herab und klatscht Beifall. Das kenne ich schon ... Aber nun still. Der Dirigent Pierné ist aufgetreten, den ich nur aus einem schlechten Violinschlager kenne. Ist da Hoffnung?... Aber still. Man wird mir ja ›Fausts Verdammnis‹ von Berlioz vorspielen. Sein Grab hab' ich auf dem Montmartre oben gesehen, mit Blumen bekränzt, wie leuchten die Namen der Werke aus dem Stein, und oben ist in einzelnen Buchstaben aus Eisen sein Name zwischen Feuerpfeilen aufgestellt, das erinnert schon wieder an die Reklameaufschriften des Skating-Ring und Moulin Rouge, nur die elektrischen Glühlämpchen fehlen ... Aber still! Und nun setzt die Viola mit ihren stillen Tönen ein. Und auf einmal bin ich in irgendeiner meiner lieben Landschaften Böhmens ... nein, nicht in Böhmen, in Ungarn doch, denn bald wird der Rakoczimarsch donnern ... nein, bei Frankfurt irgendwo, denn das deutsche Schäferlied erklingt ... o nein, o nein, meine Lieben, jetzt hat das alles ein Ende. Zu Boden nieder mit all den kleinen Gedanken. Wir sind im Lande der Begeisterung, ohne Geographie, wir taumeln in einem aus Schmerz und Schmerzlosigkeit innig vermischten, in dem süßesten Gefühl der vereinigten Menschlichkeit. Kleine Pariserin neben mir, bist du still geworden? Kein Parfüm mehr, keine Seide, nichts? Nur diese Chöre, die Glocken, die Harfen, die reinen Stimmen, die entschwebenden Dreiklänge des heiligen Osterfeiertags. O Gott, möge doch meine Seele sich ergießen, möge ich würdig dieser Töne werden ... Komponisten, die in ihren Werken manchmal Bläser hinter der Bühne spielen lassen, sollten bedenken, daß es immer einen merkwürdigen Eindruck macht, wenn diese Bläser dann nachher wieder sich hereinschleichen durch die Sitzreihen der andern, wie Leute, die zu spät ins Theater kommen. Das ist ein Übelstand. Es müßten da vielleicht Spieler verwendet werden, die im Orchester gar nichts zu tun haben. Sie bleiben draußen, rätselhafte Stimmen der Wände ... Aber die Wände mußten ja auch diesmal mittönen, mitsprechen, mithören – denn wäre es möglich, daß so viel Begeisterung aus nur natürlichen Instrumenten quillt an nur natürliche Ohren? Nein, gewiß, dieses Fest war über alle Gesetze hinaus beseligend. Ich verzeihe es Pierné, nein, ich bitte ihm ab, als hätte ich seine Romanze geschrieben: so herrlich hat er dirigiert. Und alle die guten Leute im Orchester, Félia Litvinne als Gretchen, Laffitte als Faust, und so fort. Und die lieben Zuhörer, die alles noch einmal hören wollten. Es war ein Erfolg, ein Erfolg. Und nun wüßte ich diesen Aufsatz nicht besser als mit dem Kopf des Programms zu schließen: Hundertundsiebenundsechzigste und unwiderruflich letzte Aufführung in dieser Saison. Hundertundsiebenundsechzigste Aufführung des ›Faust‹ in dieser Saison! Was ich schon oft gesagt habe: ich finde, daß man in Deutschland Berlioz vernachlässigt. Reinhardt sollte diese Oper inszenieren. Nedbal sollte seinen Stolz darin sehen, sie ganz zu dirigieren, nicht herausgehackte Stücklein. Doch nein, auch wenn sie niemand hört, niemand spielt, diese Musik bleibt mein, bleibt mir aus meinem unfranzösischen Herzen hervorgewachsen wie das Korallenriff aus dem schwankenden Meer herauf. O, mehr als nur ganz Paris würde ich vergessen, wenn diese gerissene gebrüllte Teufelsserenade mich antanzt – aber ich freue mich, daß man applaudiert, das nebenbei – man ist nicht allein auf der Welt, glücklicherweise – ich freue mich, daß Goethe, Shakespeare, Berlioz in dieser langen Melodie vereinigt sind, drei Nationen reichen einander die Hand und schöner als auf dem Titelblatt der Unterrichtsbriefe zum Selbststudium, System Toussaint-Langenscheidt. Ich freue mich, ich erlebe eine meiner Ekstasen. Ist die Musik international etwa? Daß ich hier mitten unter Fremdartigem mich plötzlich an die weiche Kante meines heimatlichen Klaviers gedrückt fühle; weich, weil das Taschentuch auf ihr liegt, in das ich weine? Niemand wird hoffentlich eine Antwort auf diese unsinnige Frage erwarten. Und doch, als Zeichen meiner Begeisterung, als Wiehern gleichsam sei sie notiert. Noch etwas: daß der Tanz der Irrlichter so langsam, mit würdigem Leichtsinn, mit schneidender Lustigkeit gedehnter, fast fauler Menuette vor sich geht, erst zum Schluß ein Reigen mit geworfenen Händen und Haaren – das ist es eben, das Genie, langsam war das zu komponieren, nicht wie hergebracht: in schnellem Funkeln ... Doch nun ist es genug. Wir treten auf die Gasse. Uns umgibt die frische Pariser Gebirgsluft, doch eine lange Weile noch träumen wir von Heimat, Liebe und süßer Musik, bis eine Reihe dunkler Bogenlampen uns den Elektrizitätsstreik hier in Erinnerung ruft. Und darüber die ziehenden glänzenden Wolken mit polierten Fingernagelrändern, »wie bei uns«, oder ein wenig anders.
Neulich kam mein Bruder mißmutig aus dem Theater. »Nun, was hat's denn gegeben?« frage ich aus dem Bett schon, vor dem ein Sessel, eine Kerze, brennend, die Tasse Milch und das aufgeschlagene Buch ein gemütliches Winkerl zusammenstellen ... Er wütet: »Eine kleine Operette hat man aufgeführt: Der umgekippte Mastbaum! Weißt du, was aber auf dem Theaterzettel stand: ›Die Afrikanerin‹ von Meyerbeer.«
Wirklich gibt es nichts Weinerlicheres als diese Abspielungen Meyerbeerscher Opern, wie sie an Provinztheatern jetzt zur Mode geworden sind. O Mode, Windhauch der Zeiten! einmal war die Mode um Meyerbeer anders bestellt. Könige ließen ihre wappengestickten Samtdecken von den Logenbrüstungen flattern, indes unsre Großväter jugendfrisch die Galerie stürmten, um die Premiere des ›Kreuzfahrers in Ägypten‹ zu erleben, den Enkeln zu überliefern. Es gab Leute, die siebenundachtzigmal die ›Hugenotten‹ gehört hatten. Was ist aus euch geworden, ihr Prachtträume der Einzugsmärsche, vergiftete Blüten, grausige Geisterbeschwörungen in Felsschluchten, Tanz der Wahnsinnigen mit ihrer Ziege an schroffen Klippen, kriegerische Zeltlager, Feenballette!... Jetzt wird dieselbe Leinwand, rissig geworden, an abgefärbte Baumstämme gelehnt, die Äste greifen zerbogen durch Löcher der Gaze, die eine sanfte tropische Luft im Glanz vorstellen soll, und die Strahlen des Reflektors, dieser ersehnten Gegenden Sonne, spießen sich an einem Versatzstück, das einem zerbrochenen Kasten ähnlicher sieht als einem großmächtigen Opferaltar. Und über all diese Ruinen hinweg kreischt die zweite Garnitur der Sänger, dirigiert der vierte Kapellmeister, der Chor mit undeutlichen Einsätzen bröckelt die süße Landschaft, die Melodie auseinander, und das Orchester schwemmt mit ein paar rohen Trompetenstößen, was übrig ist, hinweg. Zum Aufschluchzen freilich nimmt sich neben dieser lieblosen Vernichtung aus, was noch aus der schönen Ausstattung früherer Moden gerettet wurde. Dieses mit großem Aufwand im Durchschnitt gezeigte Schiff, der fallende Mast ... rings um sie hat man alles zusammengestrichen; aber diese Utensilien, einmal dem Theaterinventar einverleibt, trotzen der Verachtung: wie exilierte Fürsten machen sie von Zeit zu Zeit ihren traurigen regelmäßigen Spaziergang durch fremde Alleen. Und mit einem Schlag wird beides deutlicher: das frohe Einst, das schlimme Jetzt.
Das anerkennend-neidische Wort des Berlioz hat sich längst ins Gegenteil gekehrt: »Meyerbeer hat nicht nur Genie, er hat auch Glück.« Jetzt könnte man sagen: »Er hat auch Unglück.« Und sein Genie? In dieser Welt, wo Kunsturteile wie Mücken durcheinander schwirren, sich kreuzen und zerstieben, von keinem mehr ernst genommen, scheint über eines nur volle Übereinstimmung zu herrschen: daß Meyerbeer, ehedem überschätzt, ein seiner Unwahrheit, seiner Effekthascherei wegen zu maßregelnder Taugenichts sei. Und wie hat man ihn gemaßregelt! Am Abend durch eine heuchlerische, gichtbrüchige Aufführung, am Morgen darauf in der Zeitung durch Ernst und Strenge unsers Jahrhunderts. Ein in Wagners Schule stramm erzogener Kritiker, mithin besser: ein Merker, schrieb einmal über ›Die Afrikanerin‹, dieses heiße, verliebte, verzauberte Eiland, etwa in diesem Sinn (die Worte habe ich vergessen): »Wagt man wirklich noch, vernünftigen Menschen unseres Jahrhunderts ein solches Machwerk vorzusetzen, in dem die Seefahrer sofort nach Umschiffung des Kaps der guten Hoffnung in – (dieser Gedankenstrich ersetzt eine Lachsalve) Indien landen!«
Wünscht man geographisches Wissen, Effektlosigkeit von einer Oper, dann halte man sich allerdings von Meyerbeer fern ... Mich aber hat das Wort ›Kap‹ nie mehr so mit der Wucht ferner Umblicke getroffen, mit dieser Wahrheit einer Reisebeschreibung, die man zum dreizehnten Geburtstag geschenkt bekommt und immer wieder liest. »Zum Himmel reicht sein Haupt, sein Fuß zur Hölle«: ja, in diesen Noten eines seltsamen Kontrapunkts, leer und einfach, ragte das ›furchtbare‹ Kap in die Höhe, wurde so groß wie die Erdkugel – und wir sahen das Meer, die zerschellten Schiffe, sahen auch Indien, wenn du willst, sahen jedenfalls ein herzbewegendes Leben, Abenteuer und Begeisterung. Wir pflegten ›Die Afrikanerin‹ täglich aufzuführen, mein Bruder und ich als Kinder. Die ersten zwanzig Seiten fehlten dem Auszug, dann waren noch zwei schmutzig und zerrissen, so daß man sie schwer auf dem Pult halten konnte – sie krümmten sich wie kleine Wimpel ... Wir aber begannen am liebsten mit dem dritten Akt. Da war es heißumstritten und begehrt, die Rolle des Nelusco zu bekommen. Abgesehen davon, daß diese Töne den eben mutierten Stimmen am besten lagen: uns gefiel dieser edle Wildfang, wir liebten seine Erbitterung, seine Heimtücke, die in scharfen Zwischenrufen unisono mit dem Klavier sich ausschreien konnte. Und die Ballade von ›Adanastor‹, wobei einer bauchrednerisch sämtliche Stimmen der bebenden Matrosen geben mußte. Wie gut sang sich auch die Unterredung: »Ja, ihr seid's, Don Alvar«, in die man Rache und Klugheit, adeligen Mut und Verblendung zu legen hatte. Und wenn beim Schein der einfallenden Sonne das Morgenlied des Chores erklang, das Gebet, die Glockenschläge, der Hymnus an irgendeinen wohlvertrauten und unbekannten ›Sankt Dominik‹, dann waren wir lustig auf dieses romantische Schiff versetzt, hatten jeder für sich seine Kommandobrücke, seine gute Luft, die den Sinn erfrischt, sein sanftgewelltes Meer ringsum ... Wir gaben auch das Parlament von Lissabon, alle Sänger der Opposition und der Majorität mit großer Übung, den tüchtigen kühnen Vasco auch, der es ihnen ins Gesicht zusagt: »Euch gehören die Küsten und die Meere.« Wie wirbeln an dieser Stelle unablässig zwei Noten umeinander herum, alle Wollust des Entdeckers, der auf dem hohen Kap steht, die neuen Länder sieht und außer sich, atemlos mit dem Arm winkt, um zu zeigen und zugleich auch, um seine wahnsinnige Freude auszudrücken. Der Windhauch weiter Umblicke ist in diesen Noten, wie etwa in dem tschechischen Wort ›mávati‹, das ›winken‹ bedeutet ... Und wir traten nach kleinen Vorspielen, die mit ihrer Lieblichkeit jeden Schmerz auflösen, in den melodiösen Kerker, wo man vom ›Sohn der Sonne‹ singt, vom ›Bengalis‹, von Ergebenheit, Tod, barbarischen Gottheiten. Wir zitterten bei neuartigen Akkorden, bei diesen aus sich herausschwingenden Kantilenen, die in jeder Zeile und einheitlich ihr Feuer ausstrahlen, jede die nächste befruchtend ...
Man gewöhne es sich nur endlich ab, diesen Meyerbeer ›historisch‹ zu nehmen. Sein Pomp kommt aus einer heroischen Seele, seine Effekte aus hellsten, reinsten Leidenschaften. Fühlt man es noch nicht, daß sein Stolz und seine Wehmut mit der Sprache der jungen pathetischen Dichter zusammenklingt, die neuerdings auftreten! Die Zeitungen melden von Neuaufführungen in Berlin und in Breslau. Mögen sie so heftig, so ekstatisch verlaufen wie unsre Kinderaufführungen auf der schmalen Bühne zwischen der Klavierbank und dem Notenpult.
Ein junger Musiker aus dem Konservatorium steht auf der letzten Galerie. Außer sich vor Entzückung, hört er das körnige Prasseln langatmiger Posaunentöne, den großen Schritt des Trauermarsches, leeren Moll-Hall im Orchester.
Und von ferne, ganz von ferne naht des Vergnügens Lichtermeer wie eine aus der Nacht schimmernde Großstadt. Die Luft, von so üppigen Geigen gestrichen, schmeckt süß. Mit dem ganzen Körper fühlt der Musiker den Wohlklang einer überirdischen Operette und ist versucht, die Hand aus der Hosentasche zu nehmen, um auch ihr einen Anteil an dieser Himmelsmusik zu verschaffen.
Wie kommt es, daß dieser Mahler alles aussingt, was ich so tief fühle, denkt der arme kleine Musiker. Er nimmt mir meine Einfälle weg. Und wie er dirigiert! Jede Nuance könnte ich nur genau so ausfeilen. Wenn ich ihn nur von hier aus sehen könnte. Nun steigt wieder ein Motiv auf, das ich geahnt habe ... Aber wo ich einen Faden klebrig-mühsam spann, schwingt sich ein weites, schattiges Seidennetz ... Und rote Rosen, duftendes Lebensblut ... Ach, wenn ich ihn nur einmal sehen könnte, den Gott! Man sagt mir, daß ich ihm ähnlich sehe ...
Da bietet sich eine Lücke in der stehenden Menschenmauer. Einen Augenblick lang kann der Konservatorist den schwarzen Kapellmeister unten sehen ... Ah, Mahler, das bin ich selbst! schreit er leise.
Wie eine starke, schwarze Hand überfällt ihn das Fieber. Er wankt und fällt hintenüber hinter die Zuschauer, wo die halberlöschten Lampen zischen, fällt mit einem dumpfen Knall. Die rote Blutrose wächst eilig aus seinem Munde hervor und überdeckt mit warmen Blättern sein Antlitz ... In der Ekstase der Crescendo-Symphonie hat niemand sein Niederfallen bemerkt. Nur der beste Freund, der neben ihm gestanden hatte, ringt verzweifelt die Hände und steigt hastig zu ihm hinab.
»Ich sterbe jetzt,« sagt der Musiker.
»Wehe,« der Freund.
Sie sprechen schnell, während das Orchester schwelgerisch Tonpokale leert und zerschellen läßt, absteigt, sich beruhigt in kleinen chromatischen Küssen mit halboffenen Lippen, sich beruhigt ...
Aber da hat das erregte Flüstern der beiden Freunde zu einem Geräusch sich gehoben. Und der Kapellmeister, entrüstet ... hört zu dirigieren auf. Es wird blasse Stille im Theater. Alle Köpfe richten sich zur letzten Galerie.
Der Musiker seufzt: »Was will er? Ist es nicht genug, daß ich ihn so verrückt liebe, daß ich mein Leben um seines Werkes willen wegwerfe? Haßt er mich auch noch, nach all dem, nur weil das letzte, größte Ereignis meines Daseins einen Schatten auf einen nebensächlichen Moment des seinen wirft?«
Inzwischen hat sich der Grimm Gustav Mahlers beruhigt. Er klopft. Man beginnt von neuem, fortfahrend in genußsüchtigsten Trillern. Eine Melodie ohne Ende zackt sich hin, zerspritzt, wirft ihre rosigsten Gipfel. Infanterieregimenter von Faunen und Bacchanten marschieren auf, man gibt Signale, man trommelt einen hypnotischen Takt ...
Da fühlt der sterbende Musiker, wie die Hand des Freundes auf seiner roten Brust zittert ... im Takt zittert ... wie der Rhythmus dann weiterfährt in den Arm, über die Schultern, in den Kopf des Freundes. Und nun steht der auf, läßt den Halbtoten liegen, wie ein Schlafwandler strebt er wieder den Stufen zu, lauscht den reichen Klängen, angespannt ...
»Ich hasse Mahler,« röchelt der Musiker auf dem Fußboden. »Ich hasse ihn. Er nimmt mir meine Einfälle, meine Kunst, mein Ich, mein Aussehen, meinen besten Freund.«
Der Trauermarsch setzt ein, körnige Posaunenstöße, Rührung.
Der Musiker im Sterben: »Nein, ich bete ihn an. Seit jeher haben die Götter Menschenopfer geliebt ...«
Wie wahrscheinlich mancher andre, kämpfe ich im kleinen Kreise, von Zeit zu Zeit auch ins Fernere wirkend, für die Meister, die ich als glückbringend erkannt habe.
Es freut mich, beispielsweise, einer der ersten gewesen zu sein, die das Genie Heinrich Manns geliebt haben. Zu der Zeit schon, als nur das ›Schlaraffenland‹ erschienen war, bin ich für ihn eingetreten. Ich las schöne Stellen vor. Man hat mich ausgelacht. Mittlerweile ist meine Meinung fast allgemeingültig geworden.
Mit keinem meiner Lieblinge habe ich größeres Unglück gehabt als mit Gustav Mahler. Schon vor acht Jahren habe ich in der ›Schaubühne‹ einen Dithyrambus auf seine dritte Symphonie angestimmt. Mit Grausen denke ich an die zahllosen Debatten, die ich seither für ihn ausgefochten habe – an die Abende, die mir dumme Kritiken gegen ihn vergällt haben – an die sinnlosen Gewaltmaßregeln, durch die ich nahe Freunde zur Verehrung herbeizwingen wollte – an meine erschöpften Hände, die auf den Klaviertasten liegen, noch berauscht von den Tönen, die sie hervorgebracht haben und schon belächelt von teilnahmslosen Gesichtern einer Zuhörerschar – an das Schlimmste von allem: an schiefe Urteile von Männern, die mir unbegreiflich klingen, weil ich von eben diesen Männern die richtigsten Gedanken, die gefühlvollsten Eindrücke zu hören gewohnt hin.
Nun bin ich etwas älter geworden und habe es aufgegeben, mit dem Kopf gegen Wände zu rennen. Ich habe die Nekrologe auf Mahlers Tod gelesen, auch sie ergingen sich zumeist in bedingtem Lob, der große Wille wurde anerkannt, aber viel Abstoßendes, Übertriebenes festgestellt. Man zweifelte an der Unsterblichkeit der Riesenwerke, ganz wohlwollend zweifelte man daran.
Meine Überzeugung ist dieselbe geblieben. Aber ich beginne nach den Gründen zu fragen, die diese so verbreitete Unbeliebtheit Mahlers erklären könnten.
Ganz allgemein wird man auch in Kreisen, in denen intensives Verständnis für Musikalisches herrscht, absprechende Urteile über Mahler hören. Reger und andre werden viel widerspruchsloser geschätzt. Dagegen reden gerade ernste, bedächtige, innige Kunstfreunde von Mahler mit einer gewissen Gehässigkeit. Man wirft ihm die ewigen Marschrhythmen und Trompetensignale höhnisch vor, man hält sich die Ohren zu, man lacht gar.
Ich habe mir dafür folgende Theorie zurechtgelegt: Mahler ist nicht der Schwerverständlichste unter den modernen Komponisten, aber er ist derjenige, der sich die Gunst des unvoreingenommenen Hörers am leichtesten durch gewisse grelle und übermütige Eigenheiten verscherzt. Zu seinem Verständnis gelangt man in zwei Stufen. Auf der ersten sieht man ein, daß dieses Grelle nur Nebenwerk ist und lernt die eigentlichen melodischen und harmonischen Schönheiten kennen. Auf der zweiten Stufe erst gelangt man wieder dazu, dieses vermeintlich undisziplinierte Nebenwerk doch eigentlich wieder als organisch mit allem Musikalischen des Werks verbunden und als Gesamtausbruch eines Temperaments zu empfinden, dessen Maß nur in ihm selbst zu suchen ist.
Man kann im Fall Mahler ein lehrreiches Beispiel dafür sehen, daß selbst die ernste Kritik vor gewissen komplizierten und mit viel Hohem und Niedrigem verschränkten Erscheinungen versagt. Die gewissenhafte Kritik kann starke Überraschungen verdauen, sofern sie ein einheitliches Gebilde hinter ihnen ahnt oder mindestens konstruieren kann. Sie nimmt die heftigsten Genialitäten Regers mit in den Kauf, da sie doch immerhin überzeugt ist, daß der Mann viel studiert, seinen Bach im kleinen Finger hat und nur etwas Rechtes, Gerades in der Welt beabsichtigt. Wo aber das Pathos in Narrheit umschlägt, Buntheit in Strenge, indiskrete Wollust mit Kindlichkeit abwechselt: da wittert die Kritik einen Bluff, da geht sie nicht mehr mit, da hat sie es ganz einfach nicht nötig.
Ergriffen habe ich einmal gelesen, daß Mahler Kritiken sehr ernst nahm, daß er nach jeder seiner Premieren von neuem seine zahllosen Tadler genau las. Er muß unendlich gelitten haben.
Doch ich schulde den Beweis für meine Behauptung. Zwei Stufen sollen es sein, die zu Mahler führen. Die erste ist beispielsweise durch die Meinung charakterisiert, daß die Orchestrierung Mahlers Symphonien nur schade, daß man viel mehr Freude an den vierhändigen Klavierauszügen habe. Diese Meinung habe ich selbst jahrelang als liebes Paradoxon gehegt. Und noch jetzt bin ich der Ansicht, daß der Orchestersatz, zum Beispiel, der Rinaldo-Kantate von Brahms in seiner Einfachheit (von Unverständigen wird dieses Raffinement, vielmehr diese Gesundheit: Askese genannt) viel wirkungsvoller ist als das hundertköpfige Mahlerorchester ... Doch hier handelt es sich ja nicht um das Wirkungsvolle, sondern um das Schöne. Und da erfährt man bald, daß Mahlers Orchestrierung in ihrer Schärfe und Rücksichtslosigkeit ebensogut einen Gipfel der Schönheit darstellt wie die Gesetzmäßigkeit des Brahms.
Richtig an der oben aufgestellten Meinung ist nur, daß eine Symphonie von Mahler so viel Neues in jeder Richtung bringt, daß man praktischerweise zuerst die schönen Melodien mit all ihren überraschenden Ausläufern und Verwandlungen kennen lernt, die Verwandtschaft dieses natürlichen Gesanges mit Schubert empfindet, den steten Fluß des einmal aufgegriffenen Einfalls von Bachs erhabenem Vorbild ableitet – ehe man sich den Herdenglocken und Xylophonen der Partitur preisgibt. Es ist einfach zu viel auf einmal. Und ich kann mir ganz gut das verärgerte und gereizte Gemüt eines unvorbereiteten Zuhörers während einer Mahlerschen Symphonie vorstellen.
Dann gibt es aber eine Sorte von Kennern, die über das Xylophon einfach nicht hinwegkommen. Sie verachten es; sie geben nicht zu, daß es in eine ernsthafte Symphonie gehört. Unter keinen Umständen gehört es hinein. Solchen Leuten kann man hundertmal die Schönheit der Melodien zeigen; sie verstehen die Melodien ganz richtig, sie wissen jedes Nebenmotiv aus dem Thema abzuleiten. Sie finden die Erfindung »geistreich«. Das ist ihr höchstes Lob. Aber innig, seelenvoll? Kann ein Komponist Seele haben, ernste, ringende Seelenregungen, dem so ein Einfall kommt wie ein Xylophon, ein Hammer? Das beweist unsern Kennern aufs deutlichste, daß seine Begabung »nur äußerlich« ist, »nur auf Effekt gerichtet«, »nur seicht«. Was mich an solchen Urteilen am meisten ärgert, ist das Wörtchen »nur«; weil es so ganz unlogisch ist. Zugegeben (wenn auch nur für diesen Moment), daß das Xylophon ein äußerer Effekteinfall ist. Dann mögen diese schwermütigen Kenner das Xylophon subtrahieren! Daß aber dieser eine Effekteinfall auch alle andern Einfälle vernichtet, einfach ausradiert, was gar nicht zu ihm gehört, was um ihn, neben ihm steht – kann man das anders erklären als durch die übermäßige Gereiztheit dieser Zensoren? Mahler hat es sich mit ihnen verdorben, ein für allemal. Wäre er vorsichtiger gewesen, so hätte er das Xylophon eben nicht gebracht.
So denkt man auf der ersten Stufe.
Dann aber schlägt man die Partitur auf, zum Beispiel Seite 25 der Sechsten Symphonie, und versteht: er mußte das Xylophon bringen. Schöner konnte die Durchführung vom ersten Teil dieses Satzes gar nicht abgehoben werden. Wann wird man endlich Mahlers barockes, romantisches Genie mit Sittenstrichen und Fleißpunkten verschonen? Das Überschwänglichste wollte er sagen, nirgends ein Ziel haben, bis an die Sterne sich ausbreiten. Dazu brauchte er unter anderem auch Xylophon, Celesta, Triangeln und Tamtam.
Rücksichtslos wie Mahlers Orchester ist auch seine Melodik. Er kennt keine Scham. Er durchbricht die Zäune des sogenannten »geläuterten Geschmacks«. Man hat ihm Banalität vorgeworfen. Richtig ist, daß er dort, wo er lustig wird, sich nicht geniert, in die süßesten Operettenmelodien auszuschwelgen. Aber gibt es denn nicht auch schöne Operettenmelodien? Die meisten sind Schund und Aas, gewiß. Aber die Gattung als solche ist der höchsten Aufschwünge fähig. Mahler beweist es. So ist eine lange Stelle im letzten Satz der Sechsten Symphonie (Partitur Seite 205–210) für mein Gefühl der großartigste Niggertanz. Im besten Cakewalkrhythmus schlingen sich die Motive, zugleich den besten Kontrapunkt bildend. Ja, muß denn Kontrapunkt immer nur vom Katheder aus doziert werden! Gibt es nicht herrliche Lebensaugenblicke, in denen kühle Pedanterie zu rasen beginnt, pedantisch bleibt und doch rast und doch dabei gar nicht selbstmörderisch und verzweifelt, sondern ganz fröhlich, selig und sogar kinderinnig bleibt! Es gibt Mischungen von Gefühlen, Gott sei Dank, die noch gar nicht von Worten abgestempelt sind, die es offiziell noch gar nicht gibt. Aber wage es nur ein Musiker oder Literat, so etwas, was er doch mit der wünschenswertesten Klarheit und Wichtigkeit in sich fühlt, hinauszuschreien! Die ernsten Zensoren glauben sofort, man mache sich über sie lustig, man nehme die Sache nicht ernst genug. Gerade dann, wenn man die Sache endlich ganz ernst nimmt und, ganz unbeeinflußt von Weltwertungen, das Eigenste sagt, gerade dann – belächelt die Welt das Xylophon.
Vor einiger Zeit wurde Mahlers Sechste Symphonie in Prag aufgeführt. Die tschechische Philharmonie unter Zemaneks Leitung spielte herrlich, mußte auch die Kältesten entflammen. Ich weiß nicht, ob sie sie wirklich entflammt hat. Ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt, ich erlebte alle Ekstasen, deren meine Seele fähig ist. Jahrelang habe ich mich gesehnt, während ich dieses tragischste Opus unsrer Zeit studierte, seine Aufführung zu erleben. Nun fühlte ich mich für alle Sehnsucht belohnt, sammelte Kraft gegen Enttäuschungen und Fehlschläge ... Nachher gab es viel Applaus. Die Kritik tadelte.
Noch eines sei festgestellt: als es zu der Stelle kam, die ich für mich ›Niggertanz‹ getauft habe, erlebte ich doch noch eine Überraschung. Ich hatte nicht bemerkt, daß in der Partitur gerade zum Einsatz dieser Wendung ›Rutenschläge‹ verzeichnet sind. Nun bei dem frechen Klang der Hölzer, der die an sich freche Melodie zerhackt, faßte mich ein andachtsvoller Schauer vor Mahler: weil er so würdelos, so unbändig war, so naiv und ohne Rücksicht das unterstrich, was andre für seine Fehler hielten – was zukünftigen Geschlechtern seine Größe sein wird.
Ich liebe es, statt in großen Konzertsälen das Räuspern einer Volksmenge zu überhören und in Pausen Leuten, denen ich lieber ausgewichen wäre, auf gleichgültige Fragen noch gleichgültiger zu antworten, ich liebe es, meine Musik mir allein zu machen, einen Freund etwa zu besuchen, der schön, wie ein eifriger Dilettant eben, die Violine spielt, dann nach kurzem Gruß an seinem Klavier niederzusitzen und die Sonne unsterblicher Melodien erstrahlen zu lassen, wir beiden Zauberer. Die gewohnten Möbel sind gute und angenehme Zuhörer. Die Aussicht auf die Gasse nebenan friedet uns ein.
Allen denen nun, die es gern ebenso machen wie ich, habe ich einen guten Rat zu geben. Gewiß haben sie, ebenso wie ich, schon schmerzlich empfunden, wie gering eigentlich die Literatur für diese kleinen Konzerte ist. Die Violinsonaten von Beethoven kennt man auswendig, bei Mozart sucht man Überraschungen, ohne sie immer zu finden, man kehrt zu Tartini, Spohr, Stamitz zurück, ohne viel Glück, man atmet auf bei Bach, aber schließlich wird auch in diesen erquickenden Gebilden jede Note wohlbekannt. Ein Glück, als Reger kam. Und die drei fabelhaften Sonaten von Brahms, die beiden nachgelassenen noch, mit ihrem rührenden Ade, Ade, Lebewohl ... Zu Ende. Da muß jeder dankbar sein, dem ein neues Licht begegnet, ein wirklich schönes Werk für diese beiden Instrumente, die so schrill und sanft zusammenklingen zwischen den bekannten Möbeln. Ich kenne eine solche Violinsonate, die von Carl Nielsen, ich will sie loben. (Opus 9, Verlag Wilhelm Hansen in Kopenhagen.)
Lange Zeit schien es mir seltsam und bedenklich, daß die nordischen Völker, die in Knut Hamsun einen so natürlichen und zugleich bewundernswürdigen Poeten haben, als Musiker nichts Ähnliches hervorgebracht haben sollten. Ihr Kjerulf schien mir zu simpel, Gade zu maßvoll, Grieg zu sehr im Glanz von Salonparketten jodelnd. Alle drei hatte ich gern, aber entrangen sie mir wie Hamsun süße Tränen?... Seit ich Nielsens Kompositionen kenne, ist diese (übrigens so kindische, so jugendliche) Nachfrage beschwichtigt. Ich erkenne in Nielsen viele Elemente von Hamsuns Kunst wieder: seine unter tüchtiger Männlichkeit verhüllte Zartheit, seine gute Laune bei allen Übeln, niemals weich, niemals Chopinsche Zerflossenheit und vor allem: seine Moral. Lebt in Hamsuns zentralen Figuren immer ein heißer, fast übertriebener Trieb zu Rechtlichkeit, Anständigkeit, zu erlaubten Mitteln, Vermeidung aller Effekte, Bescheidenheit, ja zu einer Verschleierung eigener Vorzüge: so finde ich dasselbe beinahe in Nielsens legitimem Kontrapunkt, in seiner ehrlichen und reinen Stimmführung, die keiner noch so scharfen Kante ausweicht, in seiner Vorliebe für das Fortissimo, in seiner zarten einfachen und doch so neuen Melodik, kurz in dieser ganzen Musik, die unzergliedert bleiben möge, so wie sie einer liebevollen Landschaft gleich mit Freudengewalt bis zum Zerspringen mein Herz erfüllt hat, so wie ich mich diesem Genie, diesem Genie gern zu Füßen werfen möchte und seine Hände mit Küssen bedecken.
Fürwahr, ist der Lauf unserer Zeit den Ausbrüchen solcher Zärtlichkeit nicht günstig, soll es lächerlich scheinen, einem Künstler laut schreiend und außer sich für seine Gaben zu huldigen, dann lohnt es sich nicht mehr, zu leben ... Ich bin von Nielsen einfach besessen, ich stelle ihn neben Brahms, Reger, Smetana, Bach ... neben alle die Namen, die mir zu Altären geworden sind. Ich habe mir sogar ein Bild Nielsens verschafft, aus dem er mich anschaut wie ein begabter, unergründlicher Schuljunge, mit nackten breiten Lippen, starrer Stirn, abstehenden Ohren, aufgebürsteten weichen dünnen Haaren, die aber einen tüchtigen Polster bilden, und mit solchen regellos glänzenden Augen! Dieses Gesicht, ähnlich wie das Regers, wirkt auf den ersten Blick kahl und matt, das Gesicht eines erwachsenen Kindes. Aber schnell ahnt man bei beiden den Reichtum hinter dieser Nüchternheit, hinter diesem Uninteressanten den Blitz! – Ich weiß auch einiges aus Nielsens Biographie. Er ist Hofkapellmeister in Kopenhagen, schon fünfundvierzig Jahre alt. Und ich frage entrüstet, indem ich mich nach allen Seiten drehe: Wer kennt ihn? Warum hat, außer einigen Fachblättern und dem »Kunstwart« einmal, niemand über ihn geschrieben? Wo sind seine Triumphe? seine Münchener Festspielwochen? Ist es möglich, daß auf der Welt das Schöne keine Beachtung findet?
Gern wende ich mich von diesen fruchtlosen Ausrufungen ab, die wahrscheinlich nicht viel ändern werden, und ergebe mich wieder dem sanft in-sich-ruhenden Frieden der neuen Hamsun-Musik. Die Waldtiere schaun langsam auf, und, während sie sich auf ihren duftenden Futterplätzen im Schatten der Bäume lagern, den Abglanz entfernter Gletscher wie ein dünnes Schneegestöber zwischen sich, gleichen sie schon den ernsten, gesetzmäßigen, kraftvollen Tönen der lieben Sonate, scheinen sie im Chor zu singen und zu brüllen, Rehe, Vögel, Eidechsen, Käfer, Bären ... Wir sind im Norden. Seltsam mischt sich zur strengen Kunst Nielsens das Nationale, diese abwechselnd großen und kleinen Terzenschritte, die immer wieder auf denselben Grundton zurückfallen, eine hartnäckige Schalmei, aus der hie und da eine Quart jubelnd heraufschlägt, eine Sekunde traurig herab, das Ganze trotzig und klagend, hart und doch in unklaren Nebeln, präzise Verschwommenheit. Wie bei Bach zeigt sich hier die Kraft in mannigfaltigen, durchsichtigen und beweglichen Sechzehntelfiguren, die gleichsam stets bis ins Innere erleuchtete, veränderliche Organismen bleiben, niemals zur Begleitung trübe erstarrt ... So in dieser Prachtsonate. Königlich setzt das Hauptmotiv ein, nie gehört, es spaltet sich, ein Teil dient als Nebenstimme der Kantilene, er breitet sich fächerförmig aus, zuckt wie nach elektrischen Schlägen empfindlich zusammen, ein anderer Teil wird in der Durchführung überraschend selbständig, durch eben diese abwechselnd geschärften und abgestumpften Terzen zu einem zauberhaften Gewebe ausgespannt, die Verlängerung des Einfalls mit dem Original verbunden zu einem eigensinnigen Witz. Und die Stimmung über all dem durch Gesetze hervorgebracht, für deren Benennung noch keine Worte existieren. Lauter Geheimnisse, Urkräfte am Werk ... Ich notiere noch: Nielsen hat Opern geschrieben, Symphonien, Quartette, Lieder, die Texte von Holstein und Jacobsen sind durch diese Melodien übertroffen. In der Übersetzung heißt es einmal »Sonnes Liebchen«, als Genetiv von »Sonne« gebildet. Wen stört das? Es klingt ja gar nicht dumm, nur rauh und nordisch. Einfache Tonleitern in Gegenbewegung bringen unerhörte Rührung hervor »Gruß«, »Fahr wohl, du kleiner Dampfer«. Ist es möglich, daß dieses Lied noch nicht zum Lieblingslied der gesamten zivilisierten Menschheit geworden ist? Ich gestehe, das Erstaunen hierüber stört mich sehr in meinem Kunstgenuß. Würde nur Nielsen bekannt und von allen geliebt sein, wie er es verdient, so könnte ich mich ruhiger seinen Werken hingeben. Es liegt gar nicht in meiner Art, Propaganda zu machen. Ich empfinde das nur als Pflicht, als lästige ... Ich notiere noch: seine Vorliebe für Sextengänge. Seine herrlichen Schlüsse. Man erkennt den großen Meister immer an den originellen Schlüssen, da setzt sich die Melodie pulsierend bis ins äußerste Glied des letzten Akkordes fort, ein klopfendes Herz, während die Nichtskönner ein schallendes Bumbum imposant an ihr Machwerk picken, alle nach derselben Schablone. Und dann, ich bitte alle Leser, sich doch zumindest die »Symphonische Suite« für Klavier allein zu kaufen, die Goethes Worte »Ach, die zärtlichen Herzen! Ein Pfuscher vermag sie zu rühren« ironisch über ihren unsterblichen vier Sätzen trägt. Ich bitte alle Kapellmeister, die Orchesterwerke von Nielsen aufzuführen, damit ich endlich Ruhe habe. Dann würde ich auch trotz meiner Abneigung gegen die großen Konzerte diese wieder einmal ausnahmsweise besuchen.
Meine Augen füllen sich mit Tränen, alle meine Nerven sammeln sich, um so überirdischer Musik gewachsen zu sein, zu einem einzigen musikalischen Gesamtnerven, wenn Töne von Smetana mein Ohr treffen. Armer Freund – so erlaube ich mir, mich anzusprechen – Armer, der seine Tage in oft allzu wohl ertragener Niedrigkeit verbringt: woher diese Aufwallungen, vielmehr diese ganz naturgemäßen wohltuenden Entspannungen, die dich plötzlich wie in einen Zustand vor dem Sündenfall, in eine Luft ohne Staub und ohne Ruß versetzen? Woher dieses gierige Ja-Sagen deiner Seele, dessen Begier auch im Ja noch anhält – so wie ein Kind schreit, noch lange, nachdem man ihm jenes Glänzende, Verlangte gereicht hat? Armer, armer Yorick, deine Sehnsucht muß sehr stark gewesen sein, du kannst nicht glauben, daß sie endlich erfüllt ist?... Doch wozu diese Begründungen! Verweilen wir lieber noch ein Weilchen, lassen wir diese köstlichen Augenblicke noch einmal und wiederum in unsere Seele treten. Da nähern sich Marschenka und ihr Jenik (man spielt ›Die verkaufte Braut‹), der Chor unterbricht seine schneidig-lustige Melodie, die sofort als Moll-Nachhall von der Klarinette aufgenommen wird und bald in ihrer neuen Färbung, wie irgendwo ganz anders, in einem andern Lande, ihr Dur wiederfindet, da stehen die Liebenden allein, wie auf einer erhöhten Ebene, über den allgemeinen Freuden und Sorgen der Dorfgenossen mit ihrem privaten Leid und Glück. Ihre Nachfrage und Antwort überbaut, bald noch gefestigter, die Orchesternachklänge. Nun haben sie einander die vier oder fünf wichtigen Sätze gesagt, die sie sich mitzuteilen haben. Sofort löst der Chor ab und rundet die Szene mit einer Reprise seines Liedes. Nachspiel verhallt, Ende der ersten Szene. Wie einfach ist das, wie selbstverständlich! Man sagt sich: Würde der liebe Gott Musik schreiben, er hätte für diese Situation keine andre erschaffen können. Und in dieser Vollkommenheit geht es weiter, gleich wird unser Pärchen allein sein, und die ganze Mythologie einfacher Leute, die Stiefmutter, Segnen und Fluchen, Schwüre, Vergangenheit, Treue, Eifersucht, alles wird ohne Zwang wie im Glanze der ersten Jugend erscheinen. Oder hört nur, etwas andres! Wir sitzen im Theater und erwarten, wie immer, irgendeine Steigerung unsres Selbst, eine Verkomplizierung, Beängstigung, nur um Himmels willen nicht dieses Stadtleben weiter! Da rauschen die ersten D-Dur-Akkorde des ›Kuß‹, steigen auf und ab, immer noch derselbe Akkord ist es, der allereinfachste Dreiklang in seinen selbstverständlichen angeborenen Lagen: wie ein Wald mit der Gleichmäßigkeit von zwanzigtausend gesunden Baumwipfeln beruhigt es unsere gärenden Sinne. Wir sind gesteigert, aber nicht durch Komplikation, sondern durch äußerste, intensivste Vereinfachung. Darin liegt meiner Ansicht nach die tiefste Wirkung der Kunst Smetanas.
Der ›Kuß‹, dieses Meisterwerk, dessen Vernachlässigung außerhalb Böhmens unbegreiflich ist (nachdem die ›Verkaufte Braut‹ längst internationales Kunstgut geworden ist), zeigt wohl am deutlichsten, was ich meine. Wie leicht und simpel ist schon der Text! Man hat in ihm oft einen Fehler gesehen. Ich finde in seiner Wahl das Zeichen von Smetanas genialer Selbsterkenntnis. Wenn freilich die deutsche Übersetzung so ruinös vor sich geht, daß sie aus der frischen trotzigen ›Vendulka‹ eine gouvernantenhafte ›Pauline‹ macht, daß sie das urwüchsige, blumengleiche Schlummerlied mit Zeilen wie: »Fromme Taube, fleug' und glaube!« ausposamentiert – dann kann man das Kopfschütteln in fernen Zuschauerräumen verstehen. Eine ungekünstelte Übersetzung wäre Grundbedingung des Verständnisses. Dann aber würde man sehen, worum es sich in diesem Werk handelt: in bäurischen Gemütern steigen große, ja unendliche Leidenschaften auf, die im Kreise heimatlicher Ehrbarkeit, ohne Nebengeräusch und ohne Verbiegungen, ausgetragen werden. Jeden Charakter bis zu Ende gedacht, bis ins Herz hinein ehrlich. Nirgends eine Anlehnung an die Schablone. Selbst der frömmelnde Vater, dem man irgendwie bei Anzengruber auf die Spur zu kommen meint, ist eine ganz selbständige Figur, er frömmelt eben nicht, sondern ist wirklich fromm, und dabei hat er, in spaßigem Egoismus, seine einzige Freude daran, daß zu Hause durch Heirat der Tochter endlich »heilige Ruh« wird. Und nun kommen die Gäste, nun erfolgt mit ererbtem Pathos ohne Augenzwinkern die Werbung. Alle tun, als hörten sie das Neueste; obwohl alle es wissen. Mit gemessener Heiterkeit steigert die Musik ihr Schritt-Thema, das aus dem Jubel vorhin allein im Baß übrig geblieben ist. Und wenn nun nach einer kleinen Zwischenepisode die Liebenden, so lange Getrennten, einander in die Arme stürzen und ihre Stimmen im Duett vereinen, dann drängt sich mir der Vergleich mit einem andern Einander-in-die-Arme-stürzen auf, mit der großen Szene in ›Tristan und Isolde‹, zweiter Akt. Hier wie dort in der Musik ein atemlos seliges Endlich; aber was sich bei Smetana vor allen Freunden und Verwandten, konfliktlos und erlaubt vollzieht, gleichsam feierlich vor der Öffentlichkeit und doch in einsamstem Vergessen aller kleinen Dinge – dasselbe ist bei Wagner überreizt, verboten, schwül, umlauert. Hier scheiden sich zwei Welten der Kunst. Und es scheint mir ganz leichtfertig gedacht, was die Zeitgenossen über Smetanas Wagner-Nachfolge schmierten.
Smetana ist kein Dramatiker, wenn man darunter das Erzeugen von Spannungen, Überraschungen, Handlungen versteht. Versucht er derartiges, zum Beispiel in der ›Teufelswand‹, so wird er oft ungeschickt, freilich so hübsch kindlich ungeschickt, daß man ihn deshalb nur doppelt liebt. Smetana ist aber der größte, der einzige Musikdramatiker, wenn man seine Eigenart der idyllischen Ruhe und der dank ihrer Größe bescheidenen Verschiebungen erkannt hat. Es ist wahr, die Oper ›Der Kuß‹ handelt von gar nichts, von einem Kuß. Aber eben dieses Nichts ist in einer Art gestaltet, spielt sich unter herrlichen Personen, in schönster freiester Natur so gütig ab, daß man alle Sherlock Holmes der Welt vergißt. Da wird dem ersten Akt mit seinem Tag, seiner gastlichen Bauernstube der zweite Akt entgegengestellt: offener kalter Wald, Schmuggler in den Nacht, Einöde. Ins Symbolische steigert sich die Flucht des Mädchens, ihr Klagen, die gleichmütigen Konstatierungen der alten Martinka (die Übersetzung muß sie natürlich zur ›Brigitta‹ entfärben), ihre ironische Weisheit und die Flinte des Gendarmen. Dieser Akt handelt von gar nichts, nur vom Urgesetz aller menschlichen Sozietät, vom Urgebot der Verträglichkeit und Milde, dem man plötzlich in ungeahnter Ergebenheit die Brust zu öffnen sich willig fühlt. Nein, sonst handelt der Akt von gar nichts.
Die Idylle grenzte an heroische Welten. Smetanas Kreis wird von derselben Atmosphäre erfüllt wie die Gedichte Homers. Eine aufrechte ungebrochene Menschlichkeit spricht und singt sich aus, und gerade weil die Charaktere so großartig sind, und weil alle ihre Eigenschaften so offen daliegen, kann die Handlung keine schnellen Sprünge machen. Es ist gleichsam zu schade um diese Riesenleute, als daß sie im Räderwerk eiligen Geschehens hastig abgetan werden könnten. Stücke, in denen viel vorgeht, drücken ihre Figuren leicht zu Chargen herab. Dagegen wollen Helden sich in einer langsamen Aktion förmlich auswachsen. So ist es bei Homer, wie bei Smetana. Und bei beiden fühle ich dieselbe ethische Parteinahme für das Ganze und Rechte, für das Gute und Volkstümlich-Gesunde. Beide verweilen gern dabei, wenn es ihren Helden gut geht, sie suchen Tugend und Billigkeit, sie verabscheuen Böses, das wie ein Einbruch dargestellt wird.
Es ist vielleicht kein Zufall, daß ich diese Zeilen über Smetana gerade in einer Zeit schreibe, da in der deutschen Literatur aus verschiedenen Quellen, einander unbewußt, eine neue Bewegung entstehen will, die ich am besten vielleicht negativ, als Abkehr von der Dekadenz bezeichnen möchte. Ihr Positives ist schwerer zu fassen: einige Dichter, die einander vielleicht nicht einmal kennen, haben entdeckt, daß das phosphoreszierend Lasterhafte und Faulende nicht das einzige interessante Thema der Kunst ist, wie man in den letzten zehn Jahren etwa geglaubt hat. Den Optimismus nämlich hat man in diesen letzten Jahren fast ausschließlich schlechten Stilisten und ›Heimatkünstlern‹ wie Bartsch, Stilgebauer, Frenssen überlassen oder denen, die extreme Nietzsche- und Amerika-Weltreise-Stimmung wie J. V. Jensen zu verkünden hatten. Nun aber hat Robert Walser den Roman ›Der Gehilfe‹ veröffentlicht, in dem die ganze scharfsichtige Beobachtungsart der Moderne wie ihre verfeinerte Sprachkunst wieder einfachen, naiven, heroischen Menschen in Freude sich zuwendet. Max Mell hat in seinen Novellen ›Hans Hochgedacht‹ und ›Barbara Naderers Viehzucht‹ die Bauernnovelle auf ein bisher nie erreichtes Niveau der Kunst gehoben, Otto Stoessl entdeckt im Roman ›Morgenrot‹ die wuchtigen heroischen Stimmungen, die jeder Mensch in seiner Kindheit als seiner einzigen Heldenzeit erlebt. Franz Werfels Gedichte ›Der Weltfreund‹, Otto Picks ›Freundliches Erleben‹ bringen den frohen und erhabenen Ton in die Lyrik. Auch meinen eigenen letzten Büchern möchte ich gern diese Stimmung entnommen wissen. Fast in allen genannten Werken zeigt sich eine Freude am idyllischen, langsamen Erzählen, an werten und hochachtbaren Menschen, an freundlichen Kräften der Natur, am Lebenspendenden, am Arkadischen. Man hofft wieder, man vertraut. Dabei verzichtet man auf kein Mittel einer ausgebildeten psychologischen und sprachlichen Technik, man wendet sie aber endlich einmal auch auf Almwiesen an, statt immer nur auf Lasterhöhlen. Und dabei klingt mir die Musik Smetanas als liebste Begleitung in den Ohren ...
Ich würde mich getrauen, aus der eben geschilderten moralischen Stimmung die charakteristischen Eigenschaften dieser Musik abzuleiten. Die heroischen und idyllischen Töne Smetanas sind ja offenbar. Seinem gütigen Ernst entspringt auch ein Spezifikum, der lange Atem seiner Inspirationen. Bei keinem andern Komponisten findet man wohl eine Figur so ausgiebig wiederholt und gesteigert wie bei ihm. Der Einzugsmarsch in ›Dalibor‹ ist das auffallendste Beispiel, in seiner eisernen Konsequenz. Dadurch erhalten Smetanas Arbeiten diese Architektur im Kolossalstil, die den Teilnehmenden beinahe erschreckt. Sie dehnt sich über das Menschliche hinaus. Der Wiederholung gesellt sich oft eine unermüdliche Modulation derselben Akkordreihe, man wird gehoben, ins Unendliche mit fortgezogen, man fühlt sich verirrt, auf Wolken ohne Halt, plötzlich öffnet eine Lücke wieder den Blick auf den heimatlichen Boden, auf die ursprüngliche Tonart. In der Symphonie ›Blanik‹ wiederholt sich dieses unnachahmliche Zauberspiel an zwei Stellen, vom fünfzehnten Takt an und bei Meno mosso. In der ganzen Musikliteratur wüßte ich diesen Stellen nichts ebenso Gewaltiges an die Seite zu stellen. Man merkt: Smetanas Gewalt entspringt keinen Massenmitteln, sondern seiner echt musikalischen Logik und strengen Form. So sehen wir den heroischen Zug bei Smetana gleichsam zwei Tendenzen zustreben: wie jeder Heroismus wendet er sich an das Volk, wird also national – zugleich nimmt er sein Mittel aus den strengsten exklusivsten Kunstgesetzen, wendet sich also vom Volkstümlichen ab. Jede geringere Begabung als Smetanas hätte diese Doppeltendenz als Konflikt empfunden. Meine Verehrung Smetanas beginnt aber gerade da, wo er diesen Zwiespalt ausglich. Man könnte das Paradox wagen: Smetana ist volkstümlich ohne das Volk, ja, gegen das Volk. Niemals hat er bei seinen ›Volksopern‹ dem Banalen irgendeine Konzession gemacht. Die Ouvertüre zu seiner nationalsten Oper beginnt mit einen langen Fuge. Während andre volkstümliche Komponisten wie Lortzing, Nicolai immer ein wenig zur Operette neigen, zum Possengeschmack, zum entartenden ›Volksstück‹, bleibt Smetana bei aller Heiterkeit anstandsvoll, edel, harmonisch, seine komischen Opern haben etwas von der Weihe eines Festspiels. Er wendet sich nicht an irgendein gegebenes Theaterpublikum mit seinen schlechten Instinkten, sondern er hat sich in seiner höherfliegenden Menschlichkeit ein ideales Volk von Helden und Bauern, von unwandelbaren Gesinnungen und starken Armen gebildet, dem er in seinem Patriotismus die Züge des geliebten Heimatlandes aufprägte. Nicht ihn hat das Nationale beeinflußt, er hat es so lange umgemodelt, bis es so war, wie er es brauchte. Anfängliche Mißerfolge haben ja nicht gefehlt. Heute aber, da die Nation das Segensreiche dieser Arbeit eines einzigen Mannes in sich aufgesogen hat und als Gemeingut fühlt, steht die Sache so, daß ich mir eher Smetana ohne Prag als Prag ohne Smetana vorstellen kann. So stark schwebt das göttliche Licht und diese Moral über der Stadt. Niemand kann daran zweifeln, daß die Moldau, weil er es so gewollt, fortan in G-dur fließt, daß die Mauern des Wyschehrad die Röte der Es-dur-Tonart haben und eigentlich als versteinerte Harfenakkorde in der Luft stehen, zart und fest.
Zu meinen größten, quälendsten Rätseln gehört es, von Jugend an: Warum wird der Opernkomponist Berlioz nicht häufiger aufgeführt? Ich halte mich jetzt zurück, ich erwähne nur still: Berlioz ist edel, neu, auch für uns noch neu, ein nie mehr erreichter Siedepunkt des Genies, erhaben zugleich und zart, die »kolossale Nachtigall« Heines. Das sind keine Gründe, ich weiß es ... Aber Berlioz ist hinreißend, wirksam! Nun? Ihr schweigt, Freunde? Wie ich, wißt ihr das Rätsel nicht zu lösen?
Und nun dämmern wir ein wenig. Wir träumen davon, ein Reinhardt der Oper (und warum nicht Reinhardt selbst?) nehme die Sache in die Hand. Es entsteht ein zweites Bayreuth. Ich stelle mir ein wundervolles Theater vor, überwältigend schon durch die Kühle in seinen weiten Vorhallen, zwischen den hohen Säulen. Mitten in Gärten, die schwarzgrauen Mauern wie ungeheure Meereswellen an das Grün stürmend ... Nein, hören wir lieber, wie Berlioz selbst es sich vorstellt, in seinen Memoiren: »Ich fühle wohl, was ich für die dramatische Musik schaffen könnte, aber es ist ebenso zwecklos wie gefährlich, den Versuch zu wagen. Zunächst sind die meisten unserer Operntheater recht übelberüchtigte Gegenden, musikalisch gesprochen, und besonders usf. Ferner könnte ich auf diesem musikalischen Gebiet meinen Gedanken nur dann freien Lauf lassen, wenn ich mich als den absoluten Herrscher über ein großes Theater betrachten könnte, wie ich der Herrscher über mein Orchester bin, wenn ich eine meiner Symphonien dirigiere. Ich müßte über den guten Willen aller Beteiligten verfügen können, über den Gehorsam aller, von der ersten Sängerin und dem ersten Tenor, den Choristen, den Orchestermusikern, den Tänzerinnen und den Statisten an bis zum Dekorateur, zu den Maschinisten und zum Regisseur. Ein Opernhaus, wie ich es mir vorstelle, ist vor allem ein großes Musikinstrument; ich weiß darauf zu spielen usf.«
Sein Leben lang hat man ihn an dieses Instrument nicht herangelassen. Eine Zeitlang hieß es, er werde Direktor der Großen Pariser Oper werden. Nichts. Man verbannte ihn in die kalten, sinnlosen Gegenden des Feuilletons, man bezahlte ihm Kritiken, die er mit Ekel schrieb, nicht Opern. So unterdrückt er einmal, in der Stille eines feierlichen Morgens, eine neue Symphonie, deren Hauptgedanke in A-Moll schon vor ihm in alle Nebenwege sich ausbreiten will. Er unterdrückt diesen Gedanken – und man liest diese Stelle seiner Biographie mit mehr Grauen als die neueste Zeitungsnotiz von sechzig Ertrunkenen –, unterdrückt ihn, weil er fürchtet, er werde sich nicht zurückhalten können, ihn auszuführen, das Ausgeführte darzustellen, wieder mit Tausenden von Musikern dröhnend, verstummend in einer Ausstellungsrotunde, und mit ungeheuerstem Defizit ... So sehr kannte er sich als Sklaven seiner Sehnsucht, die nach guten Aufführungen seiner Werke lechzte.
Statt menschlicher Worte stehe hier seine göttliche Beschreibung eines Dirigenten während der Arbeit: »Mit welcher rasenden Freude gibt er sich der Wonne hin, auf dem Orchester zu spielen! Wie versteht er es, dieses großartige feurige Instrument zu drängen, zu fassen, zu umklammern! Er entfaltet eine allseitige Aufmerksamkeit; er sieht überall hin: mit einem Blick gibt er den Sängern und Musikern ihre Einsätze an, oben, unten, links, rechts, mit einer Bewegung des rechten Armes wirft er Akkorde hin, welche wie harmonische Geschosse in der Ferne zu platzen scheinen; dann läßt er in den Fermaten die ganze durch ihn entstandene Bewegung anhalten; er fesselt die Aufmerksamkeit aller; er hält jeden Arm, jeden Atemzug in seinem Bann, er lauscht einen Augenblick der Stille und gibt den bezähmten Wirbelsturm zu noch tollerem Laufe wieder frei.«
Die Sänger: sie gehören hier ausdrücklich zum Orchester. Auch seine Opern wollte Berlioz aufgeführt sehen, an Theatern. Wie dankte er's dem Liszt, daß er »Beatrice und Benedikt« in Weimar gab, mit guten Erfolgen.
Und jetzt ... Wir hören Berlioz in Konzerten. Faust tritt im Frack auf. Die Gäste, die vom glänzenden Feste gehen, leise die Melodie noch nachsingen, indes Romeo schmachtend im zauberhaften Garten steht, bald zu summen anfängt ... diese Gäste sind nie auf der Bühne gewesen, haben nie getanzt. Oder Lelio ... Neulich gab man »Ernani« im Theater, diese schöne italienisch-eingeborene Oper. Trotzdem hatte ich da meine Gedanken. Der Vorhang ging auf. Auf den Steinen umher lagen, saßen, erhoben sich die Räuber, schüttelten ihre breiten Hüte, ihre mit Lederriemen benähten Seidengürtel. Und am Waldrand tritt langsam er hervor, elegant trotz seiner Schritte, die vor Würde steif sind. Von Zeit zu Zeit bleibt er stehen, der Räuberhauptmann, sperrt mit beiden Händen die Mündung des Gewehres zu, das er aufstellt, und darauf legt er sein Gesicht, stützt das Kinn so fest an, daß es grausam blutgierig vorstößt, zu allem entschlossen bei diesen eng verbissenen Lippen ... Damals dachte ich: nun ist alles so schön beisammen, der Wald, die Horde, der Hauptmann – warum beginnen sie nicht plötzlich statt »Ernani« den Räuberchor aus »Lelio« zu singen, zu brüllen, daß alles begeistert sein muß. Nichts bedürfte es als einer kleinen Verschwörung dazu. Der Kapellmeister lächelt schon im Einverständnis. Ein Ruck ... man singt »Ernani«.
Nein, ich sehe schon, so geht es nicht. Ich muß diesen Artikel schreiben ... Also ich wünsche, o Theaterdirektoren, vor allem den »Faust« den man ja hie und da versucht, immerfort im Repertoire. »Fausts Verdammung«, diesen pessimistisch gedrehten Goethe, ich will ihn rufen hören, zugrunde gehn in seiner Hölle will ich. Die liebliche Musik, die ihn am Anfang zwischen Vogelstimmen in freie Luft bringt, soll zwischen schön gemalten Bäumen tönen, eine Lichtung im Hintergrund bleibe frei für die tanzenden Hirten, das vorüberziehende ungarische Heer. Dann die gotischen Fenster des Studierzimmers, Auerbachs Keller, die wundervollen Sylphiden, die von fernen Gestirnen und Hügeln flüstern, von Margarethe, bis ihre Melodie in den berühmten Tanz sich sanft variiert. O all dieses, das Mädchen auch am Spinnrad, den Studentenchor in die Krieger gemischt, mit Waffenklirren und dem Hintaumeln weingeröteter Gesichter, kurz alles sei wirklich und ziehe vorüber. Vielleicht lächelt man dann in den Zwischenakten und denkt verwundert, warum ehemals nur Gounods zwar süße, aber glanzlos zähe Musik diese Bilder umklingen durfte ... Ein Zyklus werde gewagt und zeige uns den abenteuerlichen Goldschmied Cellini mitten im schnellsten Sechsachteltakt des Karnevals, zeige die heilige Familie, wie sie in der ägyptischen Wüste beinahe verdurstet. Dann Troja, und hier habe ein geschmackvoller Maler alle Freiheit, die Tänze am Grabe des Achilles, das edelmütige Herz der Kassandra, die betrogene Dido mit den Farben seiner Phantasie zu schmücken. Gern sähe ich Kostüme und Hintergründe von Kokoschka, während Koröbus mit der Prophetin im unsterblichen Duette »Dich verlassen noch heut« wetteifert. Und nicht, bitte, vergesse man den unglücklichen Lelio. Man spiele die phantastische Symphonie zunächst und dann lasse man ihm, der silberne Vorhang weicht zurück, sein einsames Zimmer, sein Klavier, seine Musikschüler. Alles ungekürzt natürlich, den vollständigen Text, dort wo er schwärmt und dort wo er als tüchtiger Dirigent belehrende Winke austeilt. Man höre nun die romantischen Stimmen, die aus den Wänden des Zimmers wie ein Uhrenticken zu entquillen scheinen: die magische Ballade vom Fischer mit ihrer kunstvoll dreimal gesteigerten Kantilene, die Geister auf Hamlets Burg, das Lied vom ewigen Liebesglück, das traumhaft in scheinbarer Unordnung hier und nochmals eine Harfensaite zupft, einen gebrochenen Akkord wie im Wind hinhaucht. O und die, wenn sie nicht geschrieben wäre, unmögliche Phantasie über Shakespeares »Sturm«, die Luftgeister in Trillern und Arpeggien, und sie singen italienische wohlklingende Worte (genial ist das, ebenso wie das Swedenborgische der Teufel an anderer Stelle): »Miranda, conoscerai l'amore.« Nur diese drei Worte, und doch ist alles da, was wir in jugendlicher Shakespearefreude auf diese Insel geträumt haben: blauer Himmel, Flügel, Zaubereien, etwas Gebäck und Korallenriffe. Dann fallen wieder nur ein paar Worte: »Caliban, Caliban, horrido monstro, oh Caliban!« Und er stampft, er ist außer sich, pfui, schnappt nach Luft, unser dumpfer Bruder mit den Erdklößen, die in der langen Behaarung seiner Beine zittern. Niemals, nein, nie ist so kurz und gut die wahre Essenz eines Stoffes erfaßt worden, das Musikalische eine Musik, der Mittelpunkt der Oper; nur hier. Und das ist der richtige Weg der Oper, nicht Wagner und Richard Strauß. Was kümmern mich rhetorische Auseinandersetzungen, Konflikte, Dialoge, Ermordungsszenen, Gefechte, kurz: dramatische Handlung. Nein, das ist die Oper, die mir unbegreiflich die Stimmung eines Dramas in Tönen nachbildet, irgendwo beiseite, durch ungeahnte Einfälle, durch Dinge, die in dem Drama gar nicht vorkommen, die eben spezifisch musikalische Mittel sind. Aber Gott im Himmel, wer wird denn so langweilig sein und setzt einen Text Wort für Wort und Zeile für Zeile pedantisch in Musik und läßt seine Helden bei symphonischen Zwischenspielen brüten, in die Luft starren, drei Schritte machen, weil das Orchester eine Triole spielt! Nein, alles gehe so vor sich, daß man gar nicht weiß, warum jetzt Bässe und jetzt Flöte klingen, warum ein Vorhang sich aufbläht und ein unsichtbarer Chor fremde Worte verschleiert; nur ein zauberhafter Klang, ein Echo, eine Erinnerung und »Ah, seit meinem zehnten Jahr hab' ich das nicht mehr gefühlt, dieses Märchen ohne Vernunft, diesen Schwung, der meine Haare erstarren läßt.«
Natürlich, jetzt ist es gesagt, es handelt sich nicht um Ruhm für Berlioz, nein, um mein Glück, vielleicht um aller Glück. Wir haben ja jetzt vielerlei, wir sind erfinderisch und feinfühlend. Aber etwas fehlt vielleicht im modernen Leben. Und deshalb brauchen wir Berlioz-Aufführungen, Berlioz im Theater, und wenn wir das von den Theaterherrschaften nicht kriegen: ein Berlioz-Theater. Etwas fehlt: die Ahnung heroischer Zeiten ... Man fühlt, was ich sagen will. So etwas Großartiges gibt es jetzt nicht mehr oder gibt es zufällig jetzt nicht, etwas Entflammendes, über alles Irdische hinaus. Etwas, was nach großen pathetischen Worten verlangt, nach einer Begeisterung, deren man sich nicht schämt. Etwas wie feurige Tränen oder wie diese Szene damals, als Paganini durch das Publikum sich drängte und auf offener Bühne dem unbekannten Berlioz zu Füßen stürzte, die Schuhe ihm küßte, oder als er am nächsten Morgen ihm viel, viel Geld schickte und im Brief: »Nur Berlioz konnte Beethoven ersetzen.« Diese edlen Herzen, erglühend für die Kunst und voll von erhabenen Gedanken, Herzen, größer als die Welt ... Ich könnte mich mäßigen und sagen: Berlioz hat die wahre lyrische Oper erfunden, indem er mit nichtigem Griff nur die musikalisch eindrucksvollen Stellen der Handlung komponiert, bei ihnen sich ausdehnt und unbekümmert dazwischen wegläßt, was des Dichters und nicht des Musikers ist ... Und ich könnte mein Postulat in die Worte fassen: man würdige seine neuartigen Opern nicht zu frostigen Oratorien herab ... Aber ich halte mich auf der Höhe, seht ihr, und verlange das Theater, das eigene Theater, das zweite Bayreuth. Ich gehe zu Bett und erbaue es schon; die schwarzgrauen Mauern werfen ihre Schatten über weite Baumpflanzungen, die verödet und trotz ihres Laubes winterlich kühl aussehen. Hier ist Ernsthaftigkeit, Heldenmut, großer Schmerz und Harmonie. Hier werde ich mich immer erholen, wenn es mir vor lauter Kleinigkeiten im Leben, vor lauter Schönheiten häßlicher Bilder zu bunt wird.
Anmerkungen zur Transkription:
Im folgenden werden alle geänderten Textstellen angeführt, wobei jeweils zuerst die Stelle wie im Original, danach die geänderte Stelle steht.